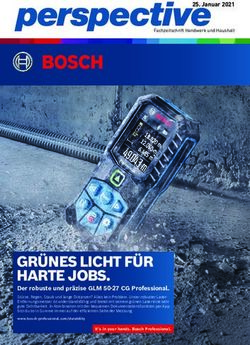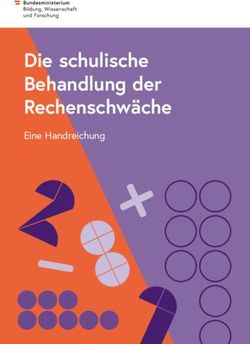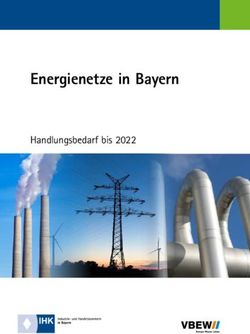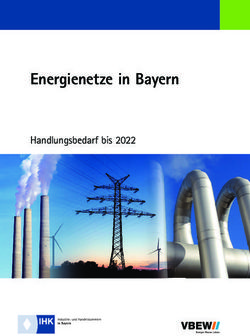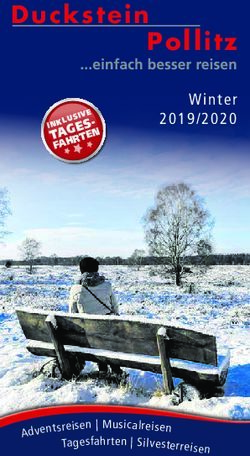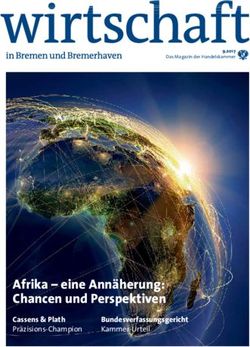"Potenziale gemeinschaftlicher Wohnformen - eine Bilanz" - Zuhause im Alter
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Grußwort
Liebe Leserinnen, Wohnumfeld, ein nachbarschaftliches
liebe Leser, Miteinander und die gesellschaftliche Teil-
habe zu stärken. Dabei werden die Bedürf-
wie wichtig das
nisse der Bewohnerinnen und Bewohner und
eigene Zuhause für
die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.
unser Wohlbefinden
ist, spüren wir Gemeinschaftliches Wohnen ist eine Chance
während der Corona für unsere alternde Gesellschaft. Wir alle
virus-Pandemie müssen uns früher oder später mit der
deutlich. Zuhause fühlen wir uns wohl und Frage befassen, wie und wo wir alt werden
sicher. Zuhause ist deshalb auch der Ort, möchten. Kommunen und die Wohnungs-
an dem wir alt werden möchten. Mehr als wirtschaft können sich schon heute darauf
90 Prozent der Menschen wünschen sich, einstellen, dass der Bedarf nach neuen
möglichst lange im gewohnten Umfeld Wohnformen weiter ansteigen wird.
leben zu können, auch wenn irgendwann
Danken möchte ich allen, die durch ihr
Krankheit, Hilfe- oder Pflegebedürftigkeit
großes Engagement und ihre Kreativität
eintreten.
zum Gelingen des Modellprogramms beige-
Damit das gelingen kann, brauchen wir tragen haben und dabei manches Hindernis
nicht nur barrierefreie und altersgerechte überwinden mussten. Sie zeigen mit ihren
Wohnungen. Auch eine Gemeinschaft gehört Projekten, wie neue, gemeinschaftliche
dazu, in der man aufeinander Acht gibt und Wohnformen das selbstbestimmte Wohnen
in der man sich einbringen kann. Daher in jedem Alter und in verschiedenen
wächst die Nachfrage nach Wohnangeboten, Lebenssituationen möglich machen. Men-
die bei Bedarf Unterstützung und Begleitung schen, die gemeinschaftlich wohnen, sind
im Alltag bieten – besonders, wenn Familie Kümmerer. Sie kümmern sich umeinander
und Freunde weiter weg wohnen. und um gemeinschaftliche Angelegenheiten.
Wenn das so ist, können wir gut leben – und
Diese Entwicklungen wurden im Modell-
gut alt werden.
programm „Gemeinschaftlich wohnen,
selbstbestimmt leben“ aufgegriffen. Die vom Mit freundlichen Grüßen
Bundesseniorenministerium in Zusammen-
arbeit mit dem FORUM Gemeinschaftliches
Wohnen e.V. geförderten Projekte zeigen,
wie gemeinschaftliches Wohnen für unter-
Dr. Franziska Giffey,
schiedliche Zielgruppen gelingen kann.
Jedes Projekt hat seinen eigenen Charakter, Bundesministerin für Familie, Senioren,
um Unterstützung und Versorgung im Frauen und Jugend
3Inhalt
1 Das Modellprogramm 6
1.1 Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen 6
1.2 Geschäftsstelle des Modellprogramms 11
1.3 Die Modellprojekte 13
1.3.1 Rechts-/Organisationsformen 17
1.3.2 Kooperationen 18
1.3.3 Finanzierung 20
1.3.4 Konzepte 21
1.4 Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer:
Fachveranstaltungen, Publikationen, Ländergespräche 24
2 Aus der Projektpraxis für die Projektpraxis 27
2.1 Was sind die größten Herausforderungen – und wie sind sie zu meistern? 27
2.1.1 Herausforderungen selbstorganisierter Projekte Gemeinschaftlichen Wohnens 29
2.1.2 Herausforderungen trägerinitiierter Projekte Gemeinschaftlichen Wohnens 33
2.1.3 Die Finanzierung – Dreh- und Angelpunkt für Projektinitiativen 35
2.2 Kooperation und Vernetzung 39
2.2.1 Die Rolle der Kommune 40
2.2.2 Vernetzung vor Ort – und darüber hinaus 41
3 Bilanz des Modellprogramms 42
3.1 rgebnisse und Erkenntnisse 42
3.2 Ansätze zur Förderung Gemeinschaftlicher Wohnformen 44
3.2.1 Handlungsempfehlungen auf Bundesebene 46
3.2.2 Handlungsempfehlungen auf Länderebene 51
3.2.3 Handlungsempfehlungen auf kommunaler Ebene 57
3.2.4 Handlungsempfehlungen an die Wohnungswirtschaft 59
3.2.5 Handlungsempfehlungen an Sozialverbände und die Pflegewirtschaft 62
3.3 Fazit 63
4 Projektbeschreibungen 66
Anhang – Übersicht der Projekte mit plus-Bausteinen84
Impressum/Bildnachweise86
4Vorwort
Dass Wohnen eine Dafür wurde der Begriff „Gemeinschaftliches
zentrale Bedeutung Wohnen plus“ geprägt. Herausgekommen
im und für das Leben ist ein Kaleidoskop an realisierten Projekten,
hat, muss man nicht das beispielhaft andeutet, wie Wohnen zu
besonders betonen. sozialem Zusammenhalt in der Gesellschaft
Ganz deutlich wird beitragen kann.
der Zusammenhang
Die vorliegende Broschüre vermittelt in sehr
in der englischen
differenzierter Weise, wie durch ein bun-
Sprache, in der
desweites Modellförderprogramm neue und
für wohnen und leben das gleiche Wort
„ungewohnte“ Wohninitiativen verschiedens-
genutzt wird: to live.
ter Art entstehen können: indem Akteure in
Diese Broschüre reflektiert Ergebnisse und ihrer Kreativität, Beharrlichkeit und in ihrem
Erkenntnisse aus dem im letzten Jahr zu Durchsetzungsvermögen bestärkt werden,
Ende gegangenen Modellprogramm des mehr soziale Teilhabe und Selbstbestimmt-
Bundesministeriums für Familie, Senioren, heit im Wohnen zu wagen. Sie wertet diese
Frauen und Jugend „Gemeinschaftlich Erfahrungen aus und formuliert detailliert,
wohnen, selbstbestimmt leben“. Gesucht wie durch konkrete Maßnahmen von Seiten
waren engagierte Akteure, die kreative der Gebietskörperschaften – also von Bun-
Projektideen zum Wohnen jenseits des des-, Landes- und kommunalen Instanzen –,
konventionellen Wohnungsbaus realisieren aber auch der Wohn- und Pflegewirtschaft
wollen: Erfinderinnen und Erfinder sowie derartige Wohninnovationen verbreitet
Umsetzerinnen und Umsetzer von gemein- werden können.
wohlorientierten Wohnformen.
Wenn man es genauer betrachtet, geht
Bei den vielen Initiativen, die sich beworben es im Kern bei den Projekten des Modell-
hatten und für die Förderung ausgewählt programms mehr um Leben als um Bauen
wurden, sollte es um mehr als um ein und Wohnen.
„wohnliches“ Dach über dem Kopf gehen.
Maximal erzielbare Rendite stand nicht im
Fokus der Projekte. Vielmehr waren Orte
fürs Leben mit vielen unterschiedlichen
Facetten gefragt, die auch besondere
Dr. Josef Bura,
soziale, wohnkulturelle, inklusive, emanzipa-
torische und kommunikative Impulse für ihre Erster Vorsitzender
Bewohnerinnen und Bewohner sowie für FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.,
die umliegenden Quartiere bieten sollten. Bundesvereinigung
51 Das Modellprogramm
1.1 Ausgangslage, Ziele und Rahmenbedingungen
Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Es bildet lichen Wohnens entwickelt. Sie zeigen, wie
die Basis der individuellen Lebensgestal- ein Wohnumfeld entstehen und gestaltet
tung und Entfaltung und ist eine Voraus- werden kann, in dem Menschen in unter-
setzung für die soziale Einbindung in die schiedlichen Lebensphasen und Lebens-
Gesellschaft. Die meisten Menschen wün- lagen einander unterstützen und somit
schen sich eine Wohnumgebung, die ihnen ein soziales Netz etablieren, das über den
Selbstständigkeit und Selbstbestimmung, familiären Rahmen hinausgeht. Eine Ent-
soziale Kontakte, Teilnahme und Teilhabe wicklung, für die sich nicht nur immer mehr
am gemeinschaftlichen Leben ermöglicht Bürgerinnen und Bürger interessieren und
und die notwendige Versorgung sichert engagieren, sondern die angesichts des
– auch im hohen Alter, bei Hilfe- und demografischen Wandels und der damit
Unterstützungsbedarf, Pflegebedürftigkeit verbundenen sozialen und wirtschaftlichen
oder Behinderung. Herausforderungen auch für Kommunen,
Wohnungswirtschaft und Wohlfahrtsver-
In den letzten Jahren haben sich innovative
bände an Bedeutung gewinnt.
Ansätze im Bereich des Gemeinschaft
61 Das Modellprogramm
Rahmenbedingungen ◆ Fördern der Verbreitung vielfältiger
Ideen für das gemeinschaftliche
Das Bundesministerium für Familie, Seni-
Zusammenleben von Jung und Alt.
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) unter-
stützt diese Entwicklung beim Wohnen ◆ Steigern der Bekanntheit von alternativen
unter anderem mit dem Modellprogramm Wohn- und Wohn-Pflege-Formen, die ein
„Gemeinschaftlich wohnen, selbstbestimmt selbstbestimmtes Wohnen im Alter und
leben“. Das Programm startete mit der bei Pflege- und Unterstützungsbedarf
Ausschreibung durch das BMFSFJ im März ermöglichen.
2015 und endete am 31. Dezember 2019.
◆ Erfassen und Darstellen der Bedeutung
Gefördert wurden insgesamt 34 innovative
gemeinschaftlicher Wohnprojekte für die
Vorhaben mit Vorbildwirkung im Bereich
Entwicklung von Quartieren oder Dörfern
des Gemeinschaftlichen Wohnens aus allen
und als Baustein einer generationenge-
16 Bundesländern. Diese waren auch am
rechten und inklusiven Kommune.
Auswahlprozess beteiligt. Das Gesamtbud-
get der Förderung durch das BMFSFJ für die ◆ Präsentieren von Planungsgrundlagen
Projekte lag bei rund 5,2 Mio. Euro. Ent- zur Entwicklung sozial gemischter und
sprechend ihrem Antragsziel konnten die partizipativer Wohnformen.
Initiativen bis zu 200.000 Euro Fördermittel
◆ Identifizieren und Aufbereiten der
für bauliche oder bis zu 50.000 Euro für
hemmenden und fördernden Faktoren
nicht-bauliche Zwecke erhalten. Insgesamt
während der verschiedenen Projekt-
hatten sich rund 230 Projekte fristgerecht
phasen in einer für andere Initiativen
(bis 31.05.2015) um eine Förderung
verwertbaren Form.
beworben. Dass die Zahl der Vorschläge
von überwiegend hoher Qualität die ◆ Identifizieren und Dokumentieren von
verfügbaren Mittel um ein Vielfaches Faktoren, die die Nachhaltigkeit von Pro-
überstieg, zeigt bereits, wie groß der Bedarf jekten des gemeinschaftlichen Bauens und
an Unterstützung von Projektinitiativen im Wohnens sichern, insbesondere im Hinblick
Bereich der Neuen Wohnformen ist. auf die soziale und kulturelle Dimension.
Ziele und Auswahlkriterien ◆ durch einen Dialog- und Werkstatt
charakter bei Veranstaltungen im Rahmen
Kernziel des Modellprogramms war die För
des Programms eine Plattform zum
derung innovativer und richtungsweisender
fachlichen Austausch und zur Vernetzung
neuer Wohnformen mit Vorbildcharakter
der Projekte untereinander bieten.
für die jeweilige Region. Darüber hinaus
wurden folgende inhaltliche Anforderungen ◆ Erfassen kommunaler Unterstützungs-
an die Prozessqualität formuliert: und Beteiligungsformen für mögliche
Nachahmerprojekte.
71 Das Modellprogramm
Drei Förderschwerpunkte bildeten den Förderschwerpunkt C:
programmatischen Rahmen, in dem sich Generationengerechte Wohn
die antragstellenden Initiativen verorten umgebung, Vielfalt und Inklusion
sollten:
Projekte in diesem Förderschwerpunkt
Förderschwerpunkt A: leisten einen besonderen Beitrag zur
Selbstständige Lebensführung Entwicklung inklusiver gemeinschaftlicher
älterer und hochaltriger Menschen Wohn- und Lebensformen, indem sie
im Quartier gemeinschaftlichen Wohnraum für Perso-
nen mit körperlichen und/oder psychischen
Zielgruppe waren Projekte des Gemein-
Beeinträchtigungen beziehungsweise
schaftlichen Wohnens, die innovative
Behinderungen geschaffen haben. Einbe-
Lösungen für eine selbstständige und
zogen werden zudem auch geflüchtete
unabhängige Lebensführung insbesondere
Menschen oder Menschen mit einer Migra-
älterer und hochbetagter Menschen im
tionsbiografie. Die Projekte haben sozial-
Projekt, Quartier oder Dorf aufzeigen.
räumliche Strukturen aufgebaut, die eine
Projektbestandteile sind beispielsweise
Teilhabe am Gemeinwesen ermöglichen
Pflege- und Betreuungsangebote im unmit-
und die betreffenden Personengruppen in
telbaren Wohnumfeld sowie niedrigschwel-
ein „gemischtes“ Quartier integrieren.
lige Hilfen und/oder Hilfe-Mix-Strukturen,
die einen längeren Verbleib im eigenen Die Projektauswahl erfolgte durch das
Zuhause ermöglichen. BMFSFJ. Relevant waren neben den Förder-
schwerpunkten auch strukturelle Kriterien.
Förderschwerpunkt B:
Der Fokus lag dabei unter anderem auf
Bezahlbares Wohnen, besonders
für Menschen mit niedrigem ◆ der Schaffung langfristig bezahlbaren und
Einkommen gesicherten Wohnraums,
Der Förderschwerpunkt vereint Ansätze, die ◆ der Stärkung des Engagements und
den Zugang von Menschen mit niedrigem der Partizipation von Bürgerinnen und
Einkommen zum Gemeinschaftlichen Bürgern in Nachbarschaft und Quartier,
Wohnen verbessern und neben langfristig
◆ innovativen Formen der
bezahlbarem Wohnen zugleich mehr
Projektfinanzierung,
Möglichkeiten zur Mitbestimmung und
Mitgestaltung bieten. Dabei überzeugten ◆ der Nachhaltigkeit von Projektorganisa-
insbesondere Projekte, die auch eine tion und Kooperationen,
altersmäßige/generationenübergreifende
◆ der Berücksichtigung geschlechterge-
Durchmischung anstrebten.
rechter Ziele und gleichgeschlechtlicher
Lebensformen,
8◆ der generationenübergreifenden und Zielgruppe
sozialen Mischung (z. B. ältere Menschen
Das Programm richtete sich an alle Initia-
und Familien),
tiven, Gruppen, Organisationen und Kom-
◆ dem Aufzeigen von Lösungen für munen, die ein den genannten Zielen und
Gemeinschaftliches Wohnen mit Anforderungen entsprechendes, innovatives
Versorgungssicherheit, und modellhaftes gemeinschaftliches
Wohnprojekt – ggf. auch in Kooperation –
◆ der Schaffung und nachhaltigen
planten und umsetzen wollten.
Sicherung von Pflege und Betreuung
im Quartier bzw. Dorf. Definition Gemeinschaftliches
Wohnen
Die teilnehmenden Projekte hatten sich
bereit erklärt, beispielsweise im Rahmen Im Gemeinschaftlichen Wohnen leben
von Workshops und Fachtagungen, aktiv Menschen miteinander in einem Haus
und offen an Prozessen der (Selbst-) oder in mehreren Häusern in direkter
Reflektion und Aufbereitung mitzuwirken. Nachbarschaft. Sie verfügen über private
Eine weitere wichtige Voraussetzung für Wohnbereiche sowie über gemeinschaftlich
eine Bewerbung war die Akzeptanz in genutzte Flächen wie z. B. Gemein-
der Kommune, bzw. deren ausdrückliche schaftsräume, Gärten, Werkstätten oder
Befürwortung oder gar fachliche, sachliche Gemeinschaftsküchen. Zusammen bilden
oder finanzielle Unterstützung des Projekts sie eine (Wohn-)Gruppe, die sich regelmä-
als einem Baustein der kommunalen ßig zur Besprechung individueller Anliegen
Daseinsvorsorge. sowie zur Planung und Koordination von
91 Das Modellprogramm
gemeinschaftlichen Aufgaben und Aktivi- Mögliche Rechtsformen im Gemeinschaft-
täten trifft. Nachbarschaftliche Kontakte lichen Wohnen sind genossenschaftlich
und wechselseitige Unterstützung sind organisierte Projekte, Wohnungseigentü-
verlässliche Elemente in ihrem Wohnalltag. mergemeinschaften (WEG), Projekte, die
Viele Projekte gemeinschaftlichen Wohnens das Genossenschaftsmodell in anderen
tragen auf unterschiedliche Weise positiv Rechtsformen adaptieren, wie das Miets-
zur Entwicklung der Orte (Quartier oder häuser-Syndikat (GmbH, Hausverein) und
Dorf) bei, in denen sie sich angesiedelt das GmbH & Co. KG-Modell. Andere Grup-
haben. Sie werden daher von Kommunen pen organisieren sich als Kooperations-/
zunehmend auch als Instrumente der Trägerprojekte (z. B. Wohnprojekt-GbR oder
Stadt-/Dorfentwicklung wahrgenommen. -Verein und (kommunales) Wohnungsunter-
nehmen) oder gemischte Miet-/Eigentums
Gemeinschaftliches Wohnen wird in
projekte (z. B. Genossenschaft und WEG).
unterschiedlichen Trägermodellen und
Diese Organisationsvielfalt führt dazu, dass
Rechtsformen umgesetzt. Mit jedem
nahezu alle Interessierten Zugangsmög-
Trägermodell sind spezifische Rechte und
lichkeiten zum Gemeinschaftlichen Wohnen
Pflichten der Mitglieder im Innen- und
finden können.
Außenverhältnis verbunden. Gemeinschaft-
liche Wohnformen mit hohem Selbstbe- Initiiert und realisiert werden gemein-
stimmungsgrad zeichnen sich dadurch aus, schaftliche Wohnformen von Akteuren
dass die Wohngruppe alleinverantwortlich aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich
für die Organisation der objektbezogenen sowie von Akteuren aus professionellen
Aufgaben wie z. B. der Vermietung, der Kontexten, wie der Wohnungswirtschaft,
Instandhaltung und dem Rechnungswesen den Sozialverbänden oder den Kommunen.
ist. Dies trifft z. B. auf Wohngruppen zu, die Ganz am Anfang eines jeden Vorhabens
eine eigene Genossenschaft als Trägerin steht die Einigung der Projektbeteiligten
gründen. Deutlich geringere Anforderungen auf ein gemeinsames Konzept. Auf
an Projektmitglieder bestehen demgegen- diese Weise entstehen Projekte mit
über bei Gemeinschaftlichem Wohnen in unterschiedlicher Akzentsetzung, wie z. B.
professioneller Trägerschaft. Dort liegt die Wohnprojekte älterer Menschen, Mehrgene-
Hauptlast der Objektverwaltung bei der rationenwohnprojekte oder auch inklusive
Kooperationspartnerin bzw. dem Koope- Projekte gemeinschaftlichen Wohnens, die
rationspartner (häufig dem (kommunalen) Zugänge für Personengruppen schaffen,
Wohnungsunternehmen oder der klassi- die am Wohnungsmarkt systematisch
schen Wohnungsgenossenschaft). benachteiligt sind.
101.2 Geschäftsstelle des Modellprogramms
Als Geschäftsstelle des Modellprogramms ◆ Fördertechnische Abwicklung, bspw.
eingesetzt und mit der Programmleitung Abstimmung als Erstempfänger mit dem
und -durchführung beauftragt wurde das Bundesverwaltungsamt, Beratung bei
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V., der Antragstellung, Abstimmung und
Bundesvereinigung, mit Sitz in Hannover. Abschluss von Weiterleitungsverträgen
Die Arbeit erfolgte in enger inhaltlicher mit den Projektträgern, Weiterleitung
Abstimmung mit dem BMFSFJ. von Fördermitteln sowie Prüfung der
Zwischen- und Verwendungsnachweise.
Aufgaben der Geschäftsstelle waren im
Wesentlichen: 2. Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
rund um das Modellprogramm:
1. Die fachliche Begleitung der Projekte
Dazu gehörten das Aufbereiten und
mit folgenden Aufgabenbereichen:
Zusammenstellen von Informationen
◆ Begleitung und Beratung der Projekt
über das Programm und die Modellpro-
träger und ihres Umfelds zu Planungs-
jekte im Rahmen einer Info-Broschüre,
und Umsetzungsfragen. Dazu gehörten
durch aktuelle Meldungen aus den
auch Besuche der Projekte bspw. anläss-
Projekten auf der Programm-Website
lich erreichter „Meilensteine“ wie dem
http://wohnprogramm.fgw-ev.de sowie
Richtfest oder der Einweihung.
in Newslettern des FORUM, auf internen
◆ Organisation und Moderation des und externen Veranstaltungen und in
Erfahrungsaustauschs der ausgewählten den Medien.
Projekte sowie deren Vernetzung mit
3. Die Dokumentation und der Wissens
Expertinnen und Experten im Rahmen
transfer von zentralen Erkenntnissen und
von Fachveranstaltungen, der Auftakt-
Ergebnissen aus dem Modellprogramm
und der Abschlussveranstaltung.
Formate waren Publikationen, Handlungs-
◆ Analyse und Auswertung von Schritten empfehlungen1 und Fachveranstaltungen:
zur erfolgreichen Umsetzung der
◆ Fachbroschüre „Inklusion und Vielfalt im
Modellprojekte.
Gemeinschaftlichen Wohnen“ (2019)
◆ Aufbereitung von Fachinformationen
◆ Fachbroschüre „Gemeinschaftliches
für die Projekte: auf der Website,
Wohnen plus“ (2018)
durch Publikationen, Meldungen,
Veranstaltungshinweise.
Zu finden auf der Website des Modellprogramms: http://wohnprogramm.fgw-ev.de
1
111 Das Modellprogramm
◆ Workshop-Dokumentation (online): Zieldimensionen der fachlichen
Gemeinschaftliches Wohnen mit Programmbegleitung
Versorgungssettings – organisieren
1. Vielfalt an Ideen und Lösungsansätzen
und finanzieren (2017)
der Modellprojekte im Bereich alternativer
◆ Artikel in Fachpublikationen und Wohn- und Wohn-Pflege-Formen für alters-
Teilnahme an Veranstaltungen Dritter, oder krankheitsbedingt assistenzbedürftige
beispielsweise dem 12. Deutschen Menschen, generationenübergreifende und
Seniorentag 2018 in Dortmund sozial gemischte, partizipative Wohnformen
präsentieren.
◆ Abschlussveranstaltung „Potenziale
gemeinschaftlicher Wohnformen – eine 2. Bedeutung gemeinschaftlicher Wohn
Bilanz“ 2019 in Berlin projekte für die Entwicklung von Quar
tieren und Dörfern darstellen und dabei
◆ Fachtagung „Inklusion und Vielfalt im
Wege zur gendergerechten, inklusiven
Wohnen“ 2018 in Weimar
und generationengerechten Kommune
◆ Expertinnen- und Expertenworkshop aufzeigen.
„Gemeinschaftliches Wohnen mit
3. Transferwissen sichern und weitergeben,
Versorgungssettings – organisieren und
indem Entwicklungsprozesse gemein-
finanzieren“ 2017 in Bremen
schaftlicher Wohnprojekte – von der Idee
◆ Auftaktveranstaltung des Bundesmodell- über die Realisierung bis zur Bewährung
programms „Gemeinschaftlich wohnen, im Alltag – analysiert und Best-Practice-
selbstbestimmt leben“ 2016 in Berlin Ansätze hinsichtlich Planung, Finanzierung,
Kooperationen, Kommunikation, Prozess-
Als Geschäftsstelle des Modellprogramms
steuerung und Prozessqualität vorgestellt
hatte das FORUM zudem die Gelegenheit,
werden.
Erfahrungen aus der fachlichen Begleitung
der Modellprojekte in die Beratungen 4. Nachhaltigkeit von Projekten fördern,
der Kommission Gleichwertige Lebens indem sozioökonomische und ökologische
verhältnisse einzubringen. Innovationen mit Effekten für das Projekt,
das Quartier/die Dorfgemeinschaft, die
Umwelt etc. herausgestellt werden, wie
bspw. Sharing-Ansätze (Auto, Fahrräder,
Werkzeuge), integrierte ökologische
Komponenten (ökologische Bauweisen,
erneuerbare Energien, landwirtschaftliche
Flächennutzung), aber auch Modelle zur
Konfliktlösung sowie zur erfolgreichen
Steuerung von Gruppenprozessen.
121.3 Die Modellprojekte
Je nach ihrer inhaltlichen Schwerpunkt- Dem Förderschwerpunkt A „Selbstständige
setzung waren die Modellprojekte einem Lebensführung älterer und hochaltriger
der drei Förderschwerpunkte zugeordnet, Menschen“ gehörten insgesamt 13 Projekte
wobei viele Projekte Schnittmengen mit an. Zwölf Projekte dieses Schwerpunktes
anderen Schwerpunkten aufwiesen. schafften den Übergang in die Umset-
zungsphase und erhielten eine bauliche
oder investive Förderung. Über die Hälfte
dieser Projekte ist inzwischen realisiert.
Ort Projekttitel Projektträger/-in
Aidhausen, Bayern Ambulante Hausgemeinschaft ACW Wohnprojekte GbR
Friesenhausen
Berlin-Lichterfelde Süd, Soziales Beratungszentrum und Kiez-Café Trägerwerk Soziale Dienste in
Berlin „ANDERS Celsius“ Berlin und Brandenburg gGmbH
Berlin Seniorinnen und Senioren leben in Würde MoRo Seniorenwohnanlagen e.V.
und mit viel Freude in Berlin
Bremen-Osterholz, Mehrgenerationenhaus Schweizer Viertel Bremer Heimstiftung
Bremen – Stiftungsdorf Graubündener Straße
Burgrieden, Allengerechtes Wohnen Burgrieden Bürgerstiftung Burgrieden
Baden-Württemberg
Celle, Niedersachsen Das Quartier Hattendorffstraße – Celler Bau- und Sparverein eG
Sanierung und Ausstattung
für mehr Lebensqualität
Frankfurt am Main, Pfad-Finder in Frankfurt: Wege zur Menschen voller Energie e.V.
Hessen Umsetzung von neuen Wohn- und
Pflegeformen
Frankfurt am Main, BeTrift Niederrad Wohngeno eG
Hessen
Hofgeismar, Hessen Petrihaus in Hofgeismar – Selbstbe- Wohnungsbaugenossenschaft
stimmt Wohnen im Altstadtquartier Hofgeismar eG
Speyer, Rheinland-Pfalz Quartiersoffensive Gemeinschaftliches GEWO Wohnen GmbH
Wohnen Speyer-West
Trier, Rheinland-Pfalz Wohnen im Quartier Wohnungsbaugenossenschaft
am Beutelweg eG
Ursensollen, Bayern Seniorenwohnen DAHOAM Gemeinde Ursensollen
Winnenden, Nahdran, Mittendrin – gemeinschaftlich Wohngemeinschaften in
Baden-Württemberg wohnen für Generationen Nahdran, Mittendrin e.V.
131 Das Modellprogramm
Im Förderschwerpunkt B „Bezahlbares initiativen wurden weiterverfolgt und konnten
Wohnen, besonders für Menschen mit ihr (Bau-)Vorhaben im Rahmen des Modell-
niedrigem Einkommen“ wurden insgesamt programms realisieren, die Hälfte davon ist
dreizehn Initiativen ausgewählt. Elf Projekt erfolgreich abgeschlossen.
Ort Projekttitel Projektträger/-in
Bad Dürkheim, Froh2Wo – ein generationenübergreifen- Wohnungsgenossenschaft
Rheinland-Pfalz des Wohnprojekt Froh2Wo eG
Berlin-Mitte, Berlin Umbau von Bestandsgebäuden zu einem STATTBAU Stadtentwicklungs-
barrierearmen generationenübergreifen- gesellschaft mbH
den Wohnprojekt
Berlin-Neukölln, Berlin Gemeinschaftlich Wohnen zur Miete Wohntraum e.V.
im Rollbergkiez – Nutzbarmachung
von Gemeinschaftsflächen im Neubau
Briesestraße
Bielefeld, So bunt wie möglich Die Hausgemeinschaft
Nordrhein-Westfalen im Pauluscarrée e.V.
Germering, Bayern Inklusives Wohnen – Barrierefrei für Alt GBW Portfolio 1 GmbH & Co. KG
und Jung
Greifswald, Gesellschaftshaus Greifswald (STRAZE): Stralsunder Straße 10 GmbH,
Mecklenburg-Vorpommern Wohnprojekt im Zentrum bürgerschaftli- Kultur- und Initiativenhaus
chen Engagements Greifswald e.V.
Hameln, Niedersachsen Zwei Flügel: Wohnen und Kultur unter Walkemühle GmbH
einem Dach
Husum, Neues Leben in alten Klassenzimmern – staTThus eG
Schleswig-Holstein Wohnprojekt staTThus
Ludwigsfelde, Nachbarschaftliches Mehrgenerationen- Grundstücksgesellschaft
Brandenburg wohnen mit Pflege-Wohngemeinschaft Wietstocker Dorfstr. 24
im Grünen GmbH & Co. KG
Lüneburg, Niedersachsen Gründung eines Wohnprojekts in Selbst- gemeinschaft.sinn
verwaltung – dauerhaft gemeinschaftlich wohnprojekt GmbH
und bezahlbar! (FLUSE)
Magdeburg, gemeinsam leben – gemeinsam Vitopia eG
Sachsen-Anhalt wachsen – gemeinsam altern
Michendorf, Brandenburg WohnMichel: Generationenübergreifendes WohnMichel
und ökologisches Gemeinschaftswohn- Gemeinschaft GmbH
projekt in Michendorf
Saarbrücken, Saarland Galia III – Solidarisch leben im Quartier Galia e.V. „Gemeinsam aktiv
leben ist attraktiv“
14Für den Förderschwerpunkt C „Generatio die Realisierungsphase und erhielten
nengerechte Wohnumgebung, Vielfalt und eine Modellförderung, davon sind sieben
Inklusion“ wurden 13 Projektinitiativen Projekte bereits abgeschlossen und vier
ausgewählt. Elf Initiativen starteten in Projekte noch in der Umsetzung.
Ort Projekttitel Projektträger/-in
Bad Kreuznach, Mehrgenerationenwohnen mit Franziskanerbrüder vom
Rheinland-Pfalz Versorgungssicherheit. Wohnprojekt Heiligen Kreuz e.V.
Inklusiv
Berlin – Bezirk Schöne- Lebensort Vielfalt am Südkreuz – zusam- Schwulenberatung
berg, Berlin men leben, zusammen älter werden Berlin gGmbH
Berlin-Mitte, Bezirk RuT – Frauen Kultur & Wohnen RuT – Rad und Tat
Tempelhof-Schöneberg, in Berlin-Mitte Berlin gGmbH
Berlin
Dillingen, Saarland Domus Johannes – Modernisierung eines Verein für Sozialpsychiatrie
veralteten Krankenhauses gem. e.V.
Fürth, Bayern Spiegelfabrik Fürth – Spiegelfabrik Fürth GbR
Wohnen für Generationen
Hamburg – HafenCity, FESTLAND – das Leuchtfeuer- Hamburg Leuchtfeuer
Hamburg Wohnprojekt für chronisch Festland gGmbH
kranke Menschen
Hildesheim, LebensRaum Hildesheim – Selbstbe- LebensRaum Hildesheim e.V.
Niedersachsen stimmte Lebens- und Arbeitsgemein-
schaft für Menschen mit Behinderung
Hofheim am Taunus, WIR am Klingenborn. Gemein- HWB – Hofheimer Wohnungs-
Hessen schaftliches Wohnen im Dr. bau GmbH
Max-Schulze-Kahleyss-Haus
Hückeswagen, Inklusives ambulant betreutes Wohnen Lebendige Inklusion e.V.
Nordrhein-Westfalen auf einem Bauernhof
Köln-Nippes, Von der Wohngemeinschaft zum Wunschnachbarn WEG
Nordrhein-Westfalen Little-Cohousing für Ältere in einem
altersgemischten Wohnprojekt
Leipzig, Sachsen Generationenwohnen Grünau-Nord Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.,
Regionalverband Leipzig/
Nordsachsen
Tübingen, Tante Huber: Vielfalt leben – beteiligt Wohnprojekt Tante Huber GmbH
Baden-Württemberg statt betroffen
Weimar, Thüringen Wohnprojekt Ro70 – Neues Wohnen und Wohnprojekt Ro70 eG
Arbeiten im alten Klinikum Weimar
151 Das Modellprogramm
Insgesamt stellten nur fünf Projektiniti- Mitgliedern. Der „Strauß an Möglichkeiten“,
ativen ihr Vorhaben ein. Ursachen waren den die Modellprojekte zur Nachahmung
der Rückzug von Schlüsselpersonen aus bieten, ist entsprechend bunt und zeichnet
gesundheitlichen Gründen, das Scheitern sich durch vielfältige Konzepte, Organi-
von Kooperationen sowie Schwierigkeiten sations- und Kooperationsformen sowie
beim Grundstückserwerb und/oder der Finanzierungmodelle aus. Abgesehen
Finanzierung des Vorhabens. Nachgerückt davon, diente eines der ausgewählten
sind aus der Liste der Bewerbungen für Projekte (Pfad-Finder in Frankfurt) der
das Modellprogramm die Projekte fol- Erstellung einer Expertise zum Thema
gender Trägerinnen und Träger: Galia e.V., Neuere Wohn- und Lebensformen im Alter,
Schwulenberatung Berlin gGmbH, auch bei Unterstützungs- und Pflegebedarf,
Wohnungsgenossenschaft Froh2Wo eG, für Interessierte, Initiativen, Netzwerkende
Spiegelfabrik Fürth GbR, Wohngeno eG, und Engagierte in Frankfurt a.M.
RuT – Rad und Tat Berlin gGmbH, Wohn
In Kapitel 4 dieser Broschüre werden
Michel Gemeinschaft GmbH, Celler
alle realisierten Modellprojekte mit Kurz
Bau- und Sparverein eG sowie STATTBAU
beschreibung vorgestellt.
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH.
Für die fachliche Auswertung des
Im Programm gefördert wurden Projekte
Modellprogramms und Aufbereitung des
im ländlichen Raum, Projekte in Klein-
Transferwissens der übrigen 32 baulichen
und Mittelstädten sowie Vorhaben in
Vorhaben erfolgte eine Projektanalyse nach
großstädtischen Ballungsgebieten. Dem-
den Dimensionen Rechts-/Organisations-
entsprechend waren sehr unterschiedliche
formen (1), Kooperationen (2), Finanzie-
Herausforderungen zu bewältigen, bspw.
rung (3) sowie Konzepte (4). Die folgenden
hinsichtlich der Projektfinanzierung, der
Abschnitte konkretisieren, welche innova-
Suche nach geeigneten Grundstücken
tiven Lösungen die Modellprojekte in den
sowie dem Gewinnen von Kooperierenden,
einzelnen Dimensionen aufweisen.
Investierenden, Multiplikatoren und/oder
161.3.1 Rechts-/Organisationsformen
Insgesamt 30 der geförderten Modellpro- Förderziel des Schwerpunkts B „Bezahl
jekte realisier(t)en Wohnungsbauvorhaben, bares Wohnen, besonders für Menschen
zwei Projekte realisierten Angebote, die das mit niedrigem Einkommen“. Vor allem hier,
Mietwohnen ergänzen bzw. bereichern sol- aber auch in anderen Schwerpunkten, sind
len (z. B. Beratungsentrum mit Kiez-Café). eine Reihe von Initiativen versammelt, die
Wie Abb. 1 verdeutlicht, handelt es sich bei auf die Sicherung langfristig bezahlbaren
den 30 Wohnungsbauprojekten mehrheit- Wohnraums abzielen. Zivilgesellschaftliche
lich um Mietwohnungsbau (22). Lediglich Initiativen wählten, um Wohnraum lang-
ein Förderprojekt bildete ausschließlich fristig zu sichern und der Spekulation zu
Wohneigentum. Sechs Initiativen kombi- entziehen, die Rechtsform der Genossen-
nieren Eigentum mit Wohnangeboten zur schaft oder das Modell des Mietshäuser-
Miete wie einer Gästewohnung und/oder syndikats (MHS), welches eine Kombination
einer Pflege-WG. von GmbH und Projektverein vorsieht (z. B.
Wohnprojekt Tante Huber, Gesellschafts-
Abb. 1 Wohnangebote Modellprojekte
haus Greifswald (STRAZE)). Zudem wurden
Projekte im Trägermodell realisiert, bei
dem ein Miet-Wohnprojekt als Verein oder
GbR unter dem Dach einer Genossenschaft,
eines Wohnungsunternehmens oder eines
privaten Investors entsteht. Im Programm-
portfolio befinden sich außerdem Projekte
traditioneller Genossenschaften und kom-
munaler Wohnungsunternehmen, die darauf
ausgerichtet sind, das soziale Miteinander
Die verhältnismäßig große Anzahl an in der Nachbarschaft und im Quartier zu
Projekten mit ausschließlich Mietwohnan- fördern und darüber hinaus Versorgungs-
geboten resultiert insbesondere aus dem bausteine integrieren.
171 Das Modellprogramm
1.3.2 Kooperationen
Viele der ausgewählten Modellvorhaben gin- lungsprozess beteiligt waren, finden sich
gen neue Partnerschaften ein, um Projekte Kooperationen mit lokalen Wohnungsunter-
realisieren zu können. Folgende Kooperati- nehmen und sozialen Vereinen (wie z. B. in
onsformen lassen sich differenzieren: den Projekten Seniorenwohnen DAHOAM in
Ursensollen und Petrihaus in Hofgeismar).
a) Kooperation zwischen Bürgerstiftung
Dieses Modell eignet sich für die Schaffung
und Kommune
von Mietwohnraum mit ambulanten Wohn-
Beim Projekt „Allengerechtes Wohnen und Versorgungsangeboten.
Burgrieden“, einem Mehrgenerationen-
c) Kooperation von Stiftungen
wohnprojekt im Eigentum, mit einer Pflege-
wohngruppe, einer Beratungsstelle sowie Im Projekt Mehrgenerationenhaus Schwei-
einem Café und Gemeinschaftsräumen, zer Viertel – Stiftungsdorf Graubündener
kooperierten die Bürgerstiftung Burgrieden Straße in Bremen kooperieren drei Stiftun-
und die Gemeinde Burgrieden. Gemeinsam gen, um ein umfassendes quartiersbezoge-
gründeten sie die Burgrieden baut GmbH, nes Konzept mit verschiedenen Nutzungen,
wobei die Bürgerstiftung 85 Prozent und Dienstleistungen und Quartiersangeboten
die Gemeinde 15 Prozent der Gesellschaf- zu realisieren. Das Modell ist z. B. für
teranteile übernahmen. Das Stimmrecht Wohnstifte interessant, die sich mit der
übten die Gesellschafter je zur Hälfte aus. Weiterentwicklung ihres Bestandes für
Die Geschäftsführung der GmbH übernah- zukünftige Herausforderungen des Woh-
men der Bürgermeister und der Vorsitzende nens, auch angesichts einer älter werden-
der Bürgerstiftung ehrenamtlich. Zudem den Mieterschaft, wappnen möchten.
wurde das Grundstück zum marktüblichen
d) Kooperation von Wohnungsunternehmen
Preis von der Gemeinde an die GmbH ver-
oder Wohnprojektgruppen mit Vereinen
äußert, der Erlös aber anschließend an die
und/oder Sozialverbänden
Bürgerstiftung gespendet. Das Projekt zeigt
ein attraktives Modell zur Entwicklung dörf- In vielen Projekten, insbesondere der
licher Kontexte, in denen klassischerweise Förderschwerpunkte A und C, kooperieren
keine kommunalen Wohnungsunternehmen Wohnungsunternehmen oder Wohnprojekt-
oder Genossenschaften als Kooperations- gruppen (organisiert als GmbH, Verein oder
partner zur Verfügung stehen. GbR) mit Vereinen und/oder Sozialverbän-
den, wie bspw. der Lebenshilfe, dem DRK
b) Kooperation von Kommune, Wohnungs
oder auch gemeinnützigen Nachbarschafts-
unternehmen und sozialen Vereinen
vereinen, um ambulant betreute Wohn- und
In Modellprojekten, in denen Kommunen Versorgungsformen, Pflege- und Beratungs-
maßgeblich am Gründungs- und Entwick- angebote sowie niedrigschwellige Hilfen
18für die Bewohnerschaft und das Quartier oder Genossenschaften, teilweise aber
zu schaffen (z. B. die Ro70 in Weimar, auch private Investoren (z. B. beim Projekt
BeTrift Niederrad in Frankfurt, Tante Huber „Galia III – Solidarisch leben im Quar-
in Tübingen). Diese Kooperationsform ist tier“). Wohnprojektgruppen erhalten oft
besonders für Projektinitiativen interessant, Mitspracherechte beim Zuschnitt der Woh-
die über das gemeinschaftliche Wohnen nungsgrundrisse sowie bei der Ausstattung
hinaus Angebote integrieren möchten, die der Wohnprojekt-Wohnungen. Darüber
einen Verbleib im Projekt, auch im Alter hinaus liegt die Zuständigkeit für die Aus-
und bei Pflege- und Betreuungsbedarf, wahl neuer Mieterinnen und Mieter meist
ermöglichen. bei den Wohnprojektgruppen. Die genauen
Rechte und Pflichten zwischen Eigentü-
e) Kooperation von Wohnungsunternehmen
merin oder Eigentümer und Wohnprojekt
und Wohnprojektgruppen
regelt die jeweilige Kooperationsvereinba-
Mit dem Ziel bezahlbaren Wohnraum zu rung. Diese Form der Zusammenarbeit von
schaffen, wählten einige Projektinitiativen Wohnprojektinitiativen und Wohnraum
auch das sogenannte Trägermodell. Dabei anbietern findet im Bundesgebiet vielfach
kooperieren Wohnprojektgruppen, die in Anwendung, insbesondere in Kommunen,
der Regel als Verein oder GbR organisiert die Grundstücke im Konzeptverfahren
sind, mit einem Wohnraumanbieter – häu- vergeben, mit besonderen Anforderungen
fig kommunale Wohnungsunternehmen an Wohnvielfalt und Quartiersbezug.
191 Das Modellprogramm
1.3.3 Finanzierung
Etliche Modellprojekte nutzten Mittel des
öffentlich geförderten Wohnungsbaus und/
oder kalkulierten in engen Preisgrenzen,
um bezahlbaren Wohnraum auch für untere
und mittlere Einkommensgruppen bereit-
zustellen. Einige Modellprojekte konnten
auch Gruppenwohnungen mit Mitteln des
öffentlich geförderten Wohnungsbaus
finanzieren. Eine solche Förderung erhiel- Modellprojekten, die genossenschaftliches
ten bspw. die Projekte der Träger Vitopia eG Eigentum mit Wohneigentum kombinierten,
in Magdeburg, HWB – Hofheimer wie die Projekte der staTThus eG, der
Wohnungsbau GmbH sowie LebensRaum Gemeinde Ursensollen und des Vereins
Hildesheim e.V. Wohngemeinschaften in Nahdran, Mittendrin
e.V., diente die Schaffung von Wohneigentum
Weiterhin nutzten viele der Modellprojekte
u. a. als Finanzierungsinstrument, um den
die Programme der Kreditanstalt für
erforderlichen Eigenkapitalanteil zur Auf-
Wiederaufbau (KfW) „Energieeffizient
nahme von Krediten aufzubringen. Weiterhin
bauen“ (153 und 431, Zuschuss Baubeglei-
nutzten Modellvorhaben Mittel aus der
tung), „Energieeffizient sanieren“ (151, 152)
Städtebauförderung (z. B. das Projekt der Bre-
und „Erneuerbare Energien Premium“
mer Heimstiftung Mittel aus dem Programm
(271/281, 272/282) mit zinsgünstigen
„Soziale Stadt“) und dem Denkmalschutz
Darlehen und Tilgungszuschüssen.
(z. B. Gesellschaftshaus Greifswald). Zur
Auch Mittel aus anderen Landesprogram- Finanzierung des Quartiersmanagements
men wurden abgerufen, wie z. B. von der wurden von mehreren Modellprojekten
Spiegelfabrik Fürth GbR aus dem Programm Stiftungsmittel (z. B. Hermann-Reemtsma-
„Zukunftsinitiative Sozialgenossenschaften“ Stiftung, Stiftung Deutsche Klassenlotterie
oder von der Wohnungsbaugenossenschaft Berlin, Skala-Stiftung, Stiftung Deutsches
Hofgeismar eG aus dem Programm „Aktive Hilfswerk) eingeworben. Finanzierungsinst-
Kernbereiche in Hessen“. Das Projekt der rumente waren außerdem Stiftungsdarlehen,
Wohnungsgenossenschaft Froh2Wo eG z. B. der Stiftung trias, sowie Direktkredite.
erhielt eine Anschubförderung vom Minis- Zu einem erheblichen Teil über Spenden
terium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und finanziert wurde das Projekt „FESTLAND –
Demografie Rheinland-Pfalz sowie eine das Leuchtfeuer-Wohnprojekt für chronisch
Moderationsförderung vom Ministerium der kranke Menschen“, dessen Initiatorin
Finanzen Rheinland-Pfalz. Hamburg Leuchtfeuer über langjährige
Erfahrungen im Fundraising verfügt.
201.3.4 Konzepte
Jedes Modellprojekt ist einzigartig und STRAZE“ in Greifswald zwei Projekte,
konzeptionell auf den lokalen Kontext bei denen der Aufbau eines Kultur- und
abgestimmt, in dem es entwickelt wurde. Begegnungszentrums im Fokus steht und
So waren Projekte in ländlichen Räumen das gemeinschaftliche Wohnen einen
häufig auf eine Stärkung der Ortskerne und ergänzenden Baustein bildet.
mithin der lokalen Infrastruktur, z. B. durch
Dimension 2:
die Kombination neuer Wohn-Pflege-For-
Wohnen in sorgenden Gemeinschaften
men mit Nachbarschaftstreffs/-cafés und
niedrigschwelligen Hilfsangeboten, ausge- Gemeinschaftliches Wohnen stiftet soziale
richtet. In Kommunen mit angespanntem Kontakte und damit einhergehend Fürsor-
Wohnungsmarkt zielten viele Initiativen gestrukturen jenseits der Familie. Damit
darauf ab Wohnangebote für Zielgruppen werden individuelle Unterstützungsbedarfe
zu integrieren, die systematisch am Woh- aufgefangen, für die keine oder nur bedingt
nungsmarkt benachteiligt werden und für professionelle Dienstleistungen zur Verfü-
die insgesamt zu wenig bedarfsgerechter gung stehen. Niedrigschwellige Hilfen im
Wohnraum zur Verfügung steht (z. B. junge Alltag wie z. B. Unterstützung bei Einkäufen
Familien oder Menschen mit Pflege- und/ oder Arztbesuchen sind, neben anderen
oder Unterstützungsbedarf). Faktoren, eine wichtige Voraussetzung
für eine selbstständige Lebensführung im
Die Projekte im Modellprogramm weisen
Alter und bei Unterstützungsbedarf. Die
die folgenden vier Qualitäts- und Nachhal-
selbstverständliche Unterstützung unter
tigkeitsdimensionen auf, wobei viele Initia-
Nachbarinnen und Nachbarn im Gemein-
tiven mehrdimensional aufgestellt sind.
schaftlichen Wohnen stärkt die selbst-
Dimension 1: ständige Lebensführung von Menschen im
Begegnungsräume für Quartiere Alter und mit Unterstützungsbedarf, erhöht
die Lebensqualität in häuslichen Pflege-
Modellprojekte schaffen öffentliche Räume
arrangements und trägt zur Entlastung
für politisches und soziales Engagement,
sorgender Angehöriger bei.
für Kultur und Kunst. Dabei erhalten sie
auch historische Gebäudesubstanz. Im Dimension 3:
Modellprogramm befanden sich insgesamt Gemeinschaftliches Wohnen plus
sechs Modellprojekte, die denkmalge-
Neue Wohnformen, die das Gemein-
schützte Gebäude sanierten, darunter
schaftliche Wohnen mit plus-Bausteinen
mit den Projekten „Zwei Flügel: Wohnen
der Versorgung, Pflege, Teilhabe und
und Kultur unter einem Dach“ in Hameln
Beratung verbinden, schaffen Angebote,
und dem „Kultur- und Gesellschaftshaus
die über das bloße Wohnen hinaus
211 Das Modellprogramm
Abb. 2 Gemeinschaftliches Wohnen plus
Gästewohnung
Gemeinschaftsküche
Pflegewohnung auf Zeit
Gemeinschaftsräume
Wohngruppen
Sharingeconomy
Beratungsstellen
Werkstatt
· mit und ohne Nachbarschaftstreff/café
Bibliothek Behinderung
· bei Hilfs-, Pflege- und Quartiersbüro
Betreuungsbedarf
· aktiv, selbstbestimmt, ambulant betreute WG
nachbarschaftlich
Tagespflege
Nachbarschaftshilfe
gehen und die Quartiere, in denen sie blaue Haus verkörpert dabei das klassische
entstehen, auch infrastrukturell aufwerten. Gemeinschaftliche Wohnen, in dem Gemein-
Indem (plus-)Angebote, wie bspw. eine schaftsbereiche und Gemeinschaftsgüter
Tagespflege, eine ambulant betreute eine Basis für gemeinschaftliche Aktivitäten
Wohn-Pflege-Gemeinschaft oder Ser- und die gemeinschaftliche Organisation
vice-Wohnen, in das Gemeinschaftliche bilden. Das rote Haus steht für ergänzende
Wohnen integriert werden, unterstützen plus-Bausteine, die je nach Projektträger
Projekte dieses Typus die kommunale und Planungsbudget variieren. Kommunale
Daseinsvorsorge. Auf diese Weise können Wohnungsunternehmen und große Genos-
Menschen auch in vulnerablen Phasen des senschaften planen mit stärkerem Quar-
Lebens im gemeinschaftlichen Wohnen bzw. tiersbezug. Ihre Konzepte verbinden häufig
im angestammten Wohnumfeld verbleiben. verschiedene ineinandergreifende Kompo-
Im Ergebnis entsteht ein gemeinwohlori- nenten. Kleine Wohnprojektgruppen planen
entierter Wohnungsbau, von dem die Quar- – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – eher
tiere als Ganzes profitieren.2 Abbildung 2 projektbezogen, wie z. B. die Wunschnach-
zeigt, welche Formen der Kombination von barn WEG in Köln, die mit einer Co-Housing-
Gemeinschaftlichem Wohnen mit erweiter- Etage ein Wohnangebot geschaffen haben,
ten Angebotsbausteinen im Rahmen des das speziell auf die Bedarfe älterer Projekt-
Modellprogramms umgesetzt wurden. Das mitglieder abgestimmt ist.
Vgl. weiterführend: FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V., Bundesvereinigung 2018:
2
Gemeinschaftliches Wohnen plus. Teilhabe, Fürsorge, Pflege, Beratung.
22Die folgende Tabelle gibt einen Überblick stärken und zusätzlich zum Wohnen Versor-
über die Häufigkeit der einzelnen Angebote gungsangebote schaffen. Darüber hinaus
in den Modellprojekten. Eine Übersicht ermöglicht die Schaffung barrierefreien und
der Modellprojekte mit plus-Bausteinen rollstuhlgerechten Wohnraums im Projekt,
befindet sich im Anhang auf Seite 84. dass Menschen mit Behinderung gemein-
schaftlich in einem sozialen Verbund mit
Tabelle 1: Häufigkeit der plus-Bausteine
Menschen ohne Behinderungen wohnen
Gemeinschaftliches Wohnen plus können.
(insg. in 18 von 34 Modellprojekten)
Beispiele aus dem Modellprogramm sind
Tagespflege 6 Projekte, die
Pflege-WG 9 ◆ barrierefreie, rollstuhlgerechte und/
Service-Wohnen 3 oder ambulant betreute Wohnangebote
integrieren (z. B. Wohnprojekt Ro 70 eG,
ehrenamtliche Hilfen 6 gemeinschaft.sinn wohnprojekt GmbH),
Beratungsstelle 8 ◆ gender- und kultursensible Wohn- und
Wohngruppe 3 Wohn-Pflege-Angebote schaffen
(RuT – Rad und Tat Berlin gGmbH,
Pflege-Wohnen auf Zeit 1
Schwulenberatung Berlin gGmbH),
Quartierscafé/ 10
Nachbarschaftstreff
◆ auch Wohnangebote für Menschen mit
Fluchterfahrung und/oder Migrations-
Dimension 4: hintergrund schaffen (z. B. Spiegelfabrik
Inklusion und Vielfalt beim Wohnen Fürth GbR).
Vielfalt beim Wohnen entsteht durch Dimension 5:
Wohnumfelder und Wohnangebote, die Ökologische Nachhaltigkeit
Vielfalt ermöglichen. Damit Menschen mit
Viele Modellprojekte bauen flächen- und
und ohne Behinderung bzw. Unterstüt-
ressourcenschonend und nutzen neue
zungsbedarf, Alte und Junge, Familien und
Formen der Energiegewinnung. Darüber
Singles sowie Menschen mit unterschied-
hinaus integrieren sie Sharing-Angebote,
licher sozialer und kultureller Herkunft in
z. B. für Werkzeuge, Autos und Fahrräder,
einem Quartier zusammenleben können,
oder bewirtschaften gemeinschaftlich
müssen eine Reihe von räumlichen, techni-
große Gartenflächen. Beispiele sind das
schen und sozialen Voraussetzungen erfüllt
generationenübergreifende Gemeinschafts-
sein. Projekte des Gemeinschaftlichen
wohnprojekt der WohnMichel Gemeinschaft
Wohnens können Vielfalt fördern, indem
GmbH in Michendorf, das die eigene
sie die lokalen Strukturen und Netzwerke
Energieerzeugung und -versorgung durch
231 Das Modellprogramm
ein Blockheizkraftwerk, Solarthermie, ökologisch saniert und in Wohnraum umge-
Photovoltaik, Wärmerückgewinnung und wandelt wird sowie, das im Passivhausstan-
Erdwärmespeicher sichert; das Magde- dard und mit Co-Housing-Etage errichtete
burger Projekt der Vitopia eG, bei dem ein Kölner Projekt der Wunschnachbarn WEG.
denkmalgeschütztes Gebäudeensemble
1.4 Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer:
Fachveranstaltungen, Publikationen, Ländergespräche
Den Modellprojekten wurden im Förderzeit- gramms zum Thema „Gemeinschaftliches
raum im Rahmen von jährlichen Fachveran- Wohnen mit Versorgungssettings“ statt.
staltungen Möglichkeiten zur Vernetzung, zur In verschiedenen Formaten tauschten
Information und zum fachlichen Austausch sich Vertreterinnen und Vertreter aus
mit Expertinnen und Experten geboten. den Modellprojekten mit Fachleuten
aus Politik, Wohnungswirtschaft, von
Ziel der Auftaktveranstaltung im Juni 2016
Wohlfahrtsverbänden, Stiftungen,
in Berlin war es, einen Überblick über die
Pflegedienstleistern und anderen
Bandbreite an Fördermöglichkeiten für
professionellen Akteurinnen und Akteu-
soziale und zukunftsfähige Wohnformen zu
ren aus dem Bereich der Altenpflege und
geben. Zudem diskutierten die Modellpro-
des Wohnens für ältere Menschen über
jekte als selbstorganisierte Träger, soziale
die finanziellen und organisatorischen
Träger, Wohnungsunternehmen und Kom-
Herausforderungen der Realisierung
munen über die Rolle und Erfahrungen mit
von Projekten des Gemeinschaftlichen
Kommunen als Kooperationspartner. Tenor
Wohnens plus aus.3 Im Ergebnis kamen
der Veranstaltung war, dass Kommunen
die Teilnehmenden überein, dass es an der
viel bewegen können, wenn sie sich für den
Zeit sei, die Förderung gemeinschaftlichen
Bereich der Neuen Wohnformen öffnen und
Wohnens breiter aufzustellen. Zudem
sinnbildlich die ausgestreckten Hände der
wurde eine gute Beratungs- und Begleit-
Projektinitiativen ergreifen.
struktur als zentrale Voraussetzung für die
Am 07.03.2017 fand in Bremen der erste Entstehung und die Nachhaltigkeit Neuer
Fachworkshop im Rahmen des Modellpro- Wohnformen gesehen.
Dokumentation und Präsentationen zum Fachworkshop stehen auf der Website des Modellprogramms
3
zum Download bereit unter URL: http://wohnprogramm.fgw-ev.de/fachinformationen/, (Stand 09.03.2020).
Weitere Informationen bietet das Serviceportal „Zuhause im Alter“ unter URL: https://www.serviceportal-zu
hause-im-alter.de/service/aktuellmeldungen/meldungen-aus-dem-jahr-2017/070317-wohnen-mit-
pflegerischen-hilfen-verbinden.html, (Zugriff 20.03.2020).
24Die zweite Fachveranstaltung im Rahmen Zur Abschlusstagung des Modellprogramms
des Modellprogramms fand am 13.11.2018 am 05.11.2019 in Berlin erhielten die
in Weimar zum Thema „Inklusion und Modellprojekte noch einmal die Gelegen-
Vielfalt im Wohnen“ statt. Förderprojekte heit, sich über Projekterfahrungen und
des Modellprogramms „Gemeinschaftlich -ergebnisse auszutauschen. Vertreterinnen
wohnen, selbstbestimmt leben“ stellten und Vertreter aus der Sozial-, Pflege- und
ihre Konzepte zur Sicherung der Inklusion Wohnungswirtschaft sowie aus Politik und
beim Wohnen vor und diskutierten mit Wissenschaft konnten sich von dem Inno-
Fachleuten über Herausforderungen der vationspotential Gemeinschaftlicher Wohn-
Entwicklung und Realisierung inklusiver formen überzeugen. Die konzeptionelle
Wohnformen. Insgesamt wünschten sich Vielfalt der Modellprojekte ließ erahnen,
die Teilnehmenden verbesserte rechtliche wie vielversprechend für die kommunale
und finanzielle Rahmenbedingungen für die Entwicklung – insbesondere in Zeiten des
Schaffung ambulant unterstützter Wohn demografischen Wandels – eine Förderung
angebote und neuer Wohn-Pflege-Formen.4 Gemeinschaftlicher Wohnformen in der
Dokumentation und Präsentationen zur Fachtagung stehen auf der Homepage des Modellprogramms zum
4
Download bereit unter URL: http://wohnprogramm.fgw-ev.de/fachinformationen/, (Stand 09.03.2020).
251 Das Modellprogramm
Fläche sein kann. Deutlich wurde aber Im Rahmen des Modellprogramms
auch: Projektinitiativen brauchen vielerorts erschienen neben diversen Beiträgen
bessere Rahmenbedingungen, um Projekte in Zeitungen und Fachzeitschriften
des Gemeinschaftlichen Wohnens (plus) (u. a. wohnbund-Informationen 1/2019,
zu realisieren.5 CAREkonkret 02.11.18, FREIHAUS 09/2018)
die folgenden Fachpublikationen:
Neben der Durchführung der Fachveran-
staltungen knüpfte die Geschäftsstelle des FORUM Gemeinschaftliches Wohnen e.V.,
Modellprogramms Kontakte zu externen Bundesvereinigung (Hrsg.) 2019: Inklusion
Multiplikatoren und Institutionen, um das und Vielfalt im Gemeinschaftlichen
Programm und die Projekte bekannter zu Wohnen.6
machen und den Diskussionskreis rund
FORUM Gemeinschaftliches Wohnen
um die Förderung und den Ausbau Neuer
e.V., Bundesvereinigung (Hrsg.) 2018:
Wohnformen zu erweitern. Dazu gehörte
Gemeinschaftliches Wohnen plus. Teilhabe,
unter anderem die Teilnahme an einer
Fürsorge, Pflege, Beratung.7
Anhörung der Kommission Gleichwertige
Lebensverhältnisse zum Thema „Mitgestal-
tung des Wohn- und Lebensumfeldes“, auf
Einladung der Facharbeitsgruppe 6 „Teil-
habe und Zusammenhalt der Gesellschaft“.
Zudem wurden umfangreiche Fach
gespräche mit den Ländern Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz und Bayern zur jeweiligen
regionalen Förderkulisse für Neue Wohn-
formen geführt. Die Ergebnisse dieser
Fachgespräche sind in die Handlungs-
empfehlungen dieses Abschlussberichtes
(Kapitel 3) eingeflossen.
Vgl. hierzu Kapitel 2 dieser Publikation sowie die Handlungsempfehlungen in Kapitel 3.
5
Download unter URL:
6
http://wohnprogramm.fgw-ev.de/wp-content/uploads/Inklusion-und-Vielfalt_barrierefrei.pdf,
(Zugriff 20.03.2020).
Download unter URL:
7
http://wohnprogramm.fgw-ev.de/wp-content/uploads/FORUM_GW-plus_A4_barrierfereies-Web-PDF_neu.pdf,
(Zugriff 20.03.2020).
262 Aus der Projektpraxis für die Projektpraxis
2.1 Was sind die größten Herausforderungen –
und wie sind sie zu meistern?
Ein Ziel der fachlichen Begleitung des ten Projektgruppen (1), gut strukturierte
Modellprogramms war es, anhand der Kommunikations- und Beteiligungspro-
Modellprojekte typische Herausforderun- zesse, insbesondere bei trägerinitiierten
gen im Projektverlauf und erfolgreiche Projekten im Quartier (2), eine belastbare
Lösungsstrategien aufzuzeigen. Die fol- Finanz- und Kostenplanung (3).
gende Darstellung fasst die Ergebnisse aus
1. Für selbstorganisierte Projektgruppen
Workshops, Erfahrungsaustauschen, Pro-
ist der soziale Zusammenhalt eine
jektbesuchen und -befragungen im Rahmen
prozessbegleitende Herausforderung,
der Programmdurchführung zusammen.
deren Bewältigung maßgeblich für den
Ungeachtet der individuellen Projektver- Erfolg oder das Scheitern des Projekts ist.
läufe lassen sich drei zentrale Themenkom- Ohne den Gruppenzusammenhalt und die
plexe hervorheben, die Vertreterinnen und gemeinsam getragene Vision des zukünf-
Vertreter aller Modellprojekte tigen Miteinander-Wohnens lassen sich
als relevant einstufen: der soziale Zusam- die viele Arbeit sowie die in jedem Projekt
menhalt, insbesondere bei selbstorganisier- auftauchenden Probleme, Rückschläge und
27Sie können auch lesen