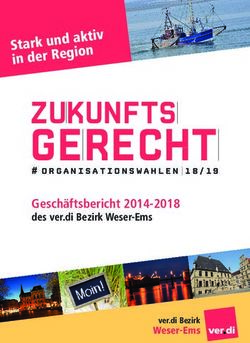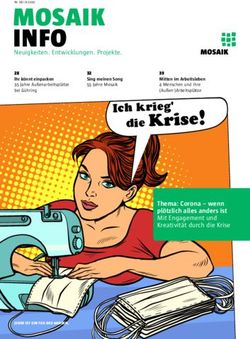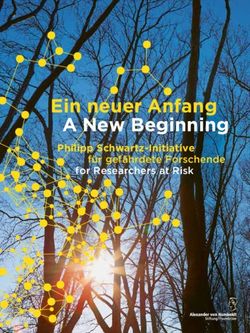Rückblicke - Einblicke - Ausblicke - Sozialraumorientierung aus verschiedenen Perspektiven - Sozialraumorientierung ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Impressum
Herausgeber: St. Elisabeth-Verein e.V.
Hermann-Jacobsohn-Weg 2
35039 Marburg
V.i.S.d.P.: Ulrich Kling-Böhm, Vorstand
Redaktion: Ulrich Kling-Böhm, Manfred Günther, Jürgen Jacob, Rainer Waldinger, Andrea Arnold, Alexandra
Böth, Judith Jungwirth, Kristin Mandler, Lisa Paul, Karina Wendlandt, Jonathan Bentzer, Andreas
Droste, Ulrich Gerhard, John Hörwick, Thomas Jost, Manuel Kissel, Oliver Pappert
Satz & Layout: Rainer Waldinger
Druck: msi - media serve international GmbH
Auflage: 1.000 Stück
Bildnachweise: Titel, Seite 5, 19, 21, 38, 39: Rainer Waldinger • Seite 6, 7, 8, 11, 14, 15, 36, 37: AdobeStock,
shutterstock, pexels-photo • Seite 16, 17: Projekthof Kernbach • Seite 18, 19, 25, 26:
St. Elisabeth-Verein e.V. • Seite 20, 21: Jürgen Jacob • Seite 29 - 35: Familienhaus Alsfeld • Seite 45,
46: Louisenstift gGmbH
2Inhaltsverzeichnis Impressum Seite 2 Vorwort Seite 5 Sozialräumliches Arbeiten im St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg: Seite 6 Einladung zu einer sozialraumorientierten Reise durch die Altenhilfe, Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie Sozialraumorientierung: Seite 10 Aspekte aktueller Herausforderungen für sozialraumorientierte Erziehungshilfen Über Empowerment in der Sozialraumorientierung Seite 14 Leben in Gemeinschaft – ein Modell für selbstbestimmtes Seite 16 Leben unter Anleitung und Hilfestellung Hauskonzept „Dachsbau“- Seite 18 Wachsen und Reinwachsen- Willkommen im Waldtal! Ein Sozialraum entsteht dort, wo Menschen Seite 20 aufeinander treffen und einen Raum kreieren - die Kinderwohngruppe auf dem Hof Schönstadt nach einem Jahr - Parteiliche Mädechenarbeit und Sozialraum- Seite 22 warum diese Begriffe eng beieinanderstehen dürfen oder sogar müssen (Heil-)Pädagogisches Reiten im St. Elisabeth-Verein e.V. Marburg Seite 25 Die Idee HueD-Hilfen unter einem Dach Seite 28 oder Sozialräumliche Jugendhilfe stationär - geht das? Möglichkeiten und Grenzen der Sozialraumorientierung Seite 36 in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften Das Betreute Wohnen für ältere Menschen als wesentlicher Teil einer Seite 38 sozialraumorientierten Altenhilfe im Quartier Wetter Neue „Soziale“ Räume braucht das Land Seite 40 „Darf ich Dich kennenlernen?“ Seite 44 Betreuung chronisch psychisch kranker Menschen in weiten ländlichen (Sozial) Raum 4
Sozialraumorientierung:
Rückblicke – Einblicke – Ausblicke
Menschen in ihren Lebenszügen wahrnehmen Das nun vorliegende kleine Heft schließt diesen
und stärken, das ist seit über 140 Jahren Ziel Prozess nicht ab, sondern will einen Doppel-
des St. Elisabeth-Vereins. Dabei bleiben wir punkt setzen: Bis hierhin gab es diese Impulse,
fachlich und methodisch nicht stehen, sondern nun gilt es, mit diesen Impulsen neue Reiserou-
begeben uns immer wieder auf eine Reise. Le- ten zu erkunden.
bensthemen entdecken, wahrnehmen und mit
den Menschen und für die Menschen, die auf Wir danken insbesondere Herrn Prof. Dr. Wolf-
einem Teil ihrer Lebensreise Assistenz, Beglei- gang Hinte, der uns für dieses Heft wichtige
tung und Unterstützung bei uns suchen, stär- Impulse zur Verfügung gestellt hat, und Frau
kend werden zu lassen, ist unabdingbar. Dayana Fritz vom Hessischen Sozialministe-
rium, die kenntnisreich die ersten Reiseschritte
Im Jahr 2019 wurde deshalb das Thema „So- beschreibt. Ein Dank auch allen Autorinnen und
zialraumorientierung“ zum Leitthema unserer Autoren aus dem Verein und seinen Töchtern,
Arbeit für die nächsten Jahre. Prinzipiell ein die uns an ihren ganz unterschiedlichen Erfah-
nicht abschließbares Thema, da sich die Lebens- rungen teilhaben lassen und so auch mit dafür
züge von Menschen und auch die Sozialräume, sorgen, dass dieses Thema bei uns lebendig
in denen sie agieren, immer wieder neu formie- bleibt.
ren und beschreiben lassen. Mitarbeiter*innen,
Menschen, für die und mit denen wir da sind, Ein weiterer Dank unserer Öffentlichkeitsar-
haben sich auf den Weg gemacht und aus einem beit, die die Arbeit an diesem Heft koordiniert
reinen Begriff Lebenswirklichkeit werden las- und für die Produktion gesorgt sowie immer
sen. Wir danken allen, insbesondere unseren wieder freundlich und geduldig an den Redak-
Mitarbeiter*innen, dafür, hier mobil und agil tionsschluss erinnert hat.
Sozialräume in den Blick genommen und in ihre
Arbeit und den Alltag einbezogen zu haben. Wir wünschen allen ein inspirierendes Lesen!
Ulrich Kling-Böhm Matthias Bohn
5Sozialräumliches Arbeiten im St. Elisabeth-Verein Marburg:
Einladung zu einer sozialraumorientierten Reise durch
die Altenhilfe, Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie
Von Dayana Fritz und Ulrich Kling-Böhm
Das Reisen fasziniert die Menschen. Unzählige Bücher, Lie- Zum Thema Sozialraumorientierung gibt es unterschiedliche
der und Filme handeln vom Reisen. Von der Pilgerreise eines Ideen und Interpretationen, die für die Reise durch die Ar-
Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg über Paulo Coelhos phi- beitsfelder im St. Elisabeth-Verein eine klare Sicht und Ori-
losophische Gedanken1 bis hin zu Liedern von Bob Marley, entierung für die Reisenden – also für die Organisation und
die uns direkt an sonnige Strände mitnehmen … die Liste der Fachkräfte – oft erschweren. Deshalb wollen wir an dieser
Anknüpfungspunkte zum Reisen lässt sich noch lange fort- Stelle den Versuch wagen, etwas Licht ins Dunkel zu bringen
setzen. Reisen ist für viele von uns mit positiven Gefühlen oder anders gesagt, gezielt eine Sozialraum-Brille aufsetzen
und Gedanken verbunden. Urlaub und Erholung, Entspan- und passendes Gepäck mitnehmen.
nung und Abenteuer, Vertrautes und Neues – die Bedeutun- Wie bei jeder Entdeckungsreise werden auch hier die Le-
gen sind vielfältig und spannen einen weiten Bogen. Gerade ser*innen feststellen, dass nicht alle Gepäckstücke richtig
deshalb scheint die Metapher des Reisens eine geeignete, gepackt waren und die Sozialraum-Brille immer mal wieder
um in dieses Themenheft einzusteigen. Wir sind uns sicher, „nachvermessen“ werden musste, um die Sehschärfe rich-
dass Sie das Reisen durch diese Ausführungen nicht bereu- tig einzustellen. Sozialraumorientierung ist mit nicht nur mit
en, denn das Themenheft bietet zugleich Inspiration und Ori- Unschärfen im Begriff und in der Abgrenzung zu anderen
entierung für eine Reise durch die vielfältigen Sozialräume, Orientierungen in der Sozialen Arbeit verbunden, sondern
die in den Arbeitsbereichen im St. Elisabeth-Verein ebenso auch mit Vorurteilen und Labels versehen.
wie in der sozialpädagogischen Arbeit mit den Adressat*in-
nen sowie in den Kooperationen des Vereins mit Kostenträ- Sozialräumliche Arbeit wird beispielsweise etikettiert als
ger*innen und anderen Leistungserbringer*innen bestehen. • neue Verpackung für Unverändertes,
• „nice to have“,
Eines ist uns auf dieser Reise wichtig. Reisen ist für uns nicht • Deckmantel für die Einführung von Budgets für Hilfen,
in erster Linie Mittel zum Zweck. Es geht nicht vordergrün- • Gefahr, weil sie zum Abbau von stationären Plätzen führt,
dig darum, von Ort A aufzubrechen, um an das gewünsch- • Vernetzung zwischen Anbietern
te Ziel B zu kommen. Auch eine Rückreise in eine vertraute • oder als Gemeinwesenarbeit im Sinne eines Arbeitsfeldes
Heimat ist nicht eingeplant. Reisen beschreibt für uns eine der Sozialen Arbeit
Grundhaltung. Wir sind bereit, immer wieder neu aufzubre-
chen. Wir sind neugierig auf das, was wir auf dieser Reise er- Tatsächlich ist eine einheitliche Definition schon des Begrif-
leben und entdecken werden. Und oft genug kommen wir an fes Sozialraum in der Fachliteratur nicht vorhanden. Frank
einem anderen Ort an, als wir zu Beginn der Reise dachten. Früchtel, Gudrun Cyprian und Wolfgang Budde beschreiben:
„Innerhalb der Theoriediskussion über Sozialraumorientie-
1 „Wenn du mutig genug bist „Lebewohl“ zu sagen, wird dich das Leben mit einem neuen „Hallo“ belohnen.“
6rung liegen inzwischen verschiedene Systematisierungen Die fachlichen Ausführungen von Herrn Hinte ermöglichen
vor, die im Vergleich ziemlich uneinheitlich daherkommen“ die Sozialraumorientierung zu nutzen, um über die Einzel-
(2007: 24). fallhilfe in den Arbeitsbereichen hinaus „Arrangements (zu)
schaffen, in denen Menschen in schwierigen Lebensverhält-
Auf dieser Reise soll es bewusst nicht darum gehen zu er- nissen unter gezielter und sorgfältig angesetzter professio-
klären, wie „die sozialräumliche Welt“ funktioniert und wie neller und freiwilliger/ehrenamtlicher Unterstützung mög-
diese richtigerweise zu verstehen ist. Vielmehr wollen wir lichst aus eigener Kraft ‚ihr Leben‘ leben können.“ (Hinte
mit Ihnen zusammen eine sozialräumliche Brille aufziehen 2007: 58)
und den Blick schärfen, um Wolfgang Hinte verdeutlicht in seinen Ausführungen als
Handlungsprinzipien der Sozialraumorientierung
• Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit
in unseren Arbeitsfeldern zu entdecken, • Orientierung an den Interessen
• unsere Haltungen und Perspektiven und am Willen der Menschen,
miteinander zu interpretieren, • Stärkung der Eigeninitiative und Selbsthilfe,
• neue Ideen des Arbeitens und Kooperierens zu entwickeln • Konzentration auf die personalen und
• und den Austausch im St. Elisabet-Verein, mit den Adre- sozialräumlichen Ressourcen,
ssat*innen unserer Arbeit und den Kostenträger*innen so- • Stärkung der zielgruppen- und
wie anderen Kooperationsparter*innen anregen. bereichsübergreifenden Aktivitäten,
• Kooperation, Koordination und Vernetzung
Wenn wir mit einer Sozialraum-Brille die Reise planen, stel- als Grundlage für funktionierende Einzelfallhilfen.
len wir direkt zu Beginn fest, dass (mindestens) zwei Koffer
mitgenommen werden sollten. Im ersten Koffer packen wir Sie können den Inhalt dieses Koffers nutzen, um die sozial-
alles ein, was hilft, Sozialraumorientierung erstens als Hand- raumorientierte Arbeit auszugestalten und die Ressourcen
lungskonzept zu verstehen und umzusetzen. Im zweiten Kof- der Adressat*innen, mit denen der (kommunalpolitischen)
fer haben wir die Gegenstände dabei, die man gebrauchen Akteure im Sozialraum sowie den Stärken verschiedener
kann, um die Sozialraumorientierung zweitens als Raumkon- Leistungserbringer im Sozialraum zusammenzuführen.
zept zu interpretieren und für die sozialpädagogische Arbeit Hier gilt es auch, immer wieder hinzuschauen, was der spe-
zu nutzen. zifische Beitrag einer sozialräumlich orientierten Sozialen
Arbeit auch in Kooperation mit den Trägern von Gemein-
Der Koffer, den wir für das sozialräumlich orientierte Han- wesenarbeit zum Beispiel in Stadtteilen mit hohem Armuts-
deln in unserer sozialpädagogischen Arbeit in der Altenhilfe, risiko und Benachteiligungspotential ist. Ähnliches gilt auch
Jugendhilfe und in der Sozialpsychiatrie brauchen, enthält für das Miteinander und Nebeneinander in Kommunen oder
die z. B. die Ausrüstung, die uns Wolfgang Hinte mit seinem Nachbarschaften mit einer ausgeprägten Kultur der Stadt-
Artikel „Sozialraumorientierung: Aspekte aktueller Heraus- teil-, Nachbarschafts- oder lokal verankerten und orientier-
forderungen für sozialraumorientierte Erziehungshilfen“ ten Vereinsarbeit.
zum Fachkonzept Sozialraumorientierung vorstellt.
Ebenso wichtig für unsere Reise
ist es, auf die Inhalte des zwei-
ten Koffers zuzugreifen. In die-
sem befinden sich jene Dinge,
die wir benötigen, um „den Sozi-
al-Raum“ in einem relationalen
Raumverständnis zu sehen. Der
Sozialraum ist nicht nur ein geo-
grafisch abgegrenzter Raum,
also nicht nur ein Quartier oder
eine Wohngruppe, sondern So-
zialräume sind immer auch so-
ziale Produkte, also Ausdruck
und Niederschlag von sozialen
Prozessen (vgl. Castells, Manuel
1977: 100-107) und ebenso ein
Raum der Beziehungen. Es hat
Auswirkungen auf die einzelnen
Menschen, wo sie geboren wer-
den, in welchen Sozialräumen
sie aufwachsen und leben und
mit wem sie in Beziehung sind
bzw. sein können. Entsprechend
erleben gerade auch Adres-
7sat*innen der Sozialen Arbeit entweder Chancen und Mög- ne Stärken und Eigenschaften entwickelt und verwirklicht,
lichkeiten oder eben Risiken und Ausschlüsse. Deshalb müs- alternative Lebens-Erfahrungen organisiert und im besten
sen wir in unserem zweiten Koffer unbedingt einen Kompass Fall auf die Perspektive einer Selbstverwirklichung in einer
mitnehmen. Dieser ist (statt auf Norden, Süden, Osten und selbstbestimmten Lebenswelt hin gearbeitet werden.
Westen) auf Inklusion, Partizipation, Teilhabe und Empower-
ment ausgerichtet. Sie sind in Ihrer Professionalität gefor- Neben den örtlichen und stationären Sozialräumen spielen
dert, diese Fachbegriffe mit Leben zu füllen. Dabei müssen auch die „temporären“ Sozialräume gerade in der Jugend-
sie sich mit den Konflikten auseinandersetzen, die entstehen und Familienhilfe sowie der sozialpsychiatrischen Arbeit eine
können, wenn sich parteiliche Professionelle dafür einsetzen, nicht zu unterschätzende Rolle. Schulen und Arbeitsorte
dass für die von ihnen begleiteten Menschen Räume ent- sind als reale Räume und als Orte prägender sozialer Inter-
stehen, in denen sie dazugehören und mitmachen können. aktion für das Leben unserer Adressat*innen bedeutsam.
Räume, in denen sich Diesen Zusammenhängen werden wir in Zukunft noch mehr
Wir stellen Ihnen nun die Reiseroute vor:
Aufmerksamkeit schenken müssen.
Die Reise führt uns nicht nur geographisch an ganz verschie-
dene Orte. Von Mittel- über Nord-, Ost- und Südhessen bis
nach Sachsen beleuchten wir in diesem Heft ganz verschie-
dene Standorte des St. Elisabeth-Vereins und seiner Toch-
tergesellschaften. Auch inhaltlich gibt es viel zu erleben.
Menschen be-
teiligen und Da geht es mal um Empowerment auf struktureller und per-
selbstbestimmt sonenzentrierter Ebene, um „virtuelle Familienzentren“, das
entscheiden, ent- Leben in einem kleinen Dorf auf dem Lande oder in einem
sprechend ihren Vor- durch Sozialwohnungen geprägten Stadtteil einer großen
aussetzungen teilhaben Mittelstadt. Dann geht es außerdem um die interdiszipli-
sowie ihre Interessen und näre Zusammenarbeit einzelner Bereiche, geschlechterspe-
Stärken herausfinden und zifische Arbeit oder tiergestützte Pädagogik, oder wie sich
einbringen können, um Inklusion, Partizipa- stationäre Jugendhilfe sozialräumlich aufstellen kann. Und
tion, Teilhabe und Empowerment mit Leben last but not least wird über die Integration von Wohnange-
zu füllen. boten der Altenhilfe in einer Kleinstadt und die Betreuung
psychisch kranker Menschen im weiten ländlichen Raum be-
Wenn wir als Fachkräfte der Sozialen Arbeit und richtet.
Diakonie diesen Kompass aus den Augen verlieren, ver-
schließen wir die Augen vor bestehenden Herrschaftsver- Als Verfasser*innen des Vorwortes haben wir einen Vor-
hältnissen und sozialer Ungleichheit, vergessen die Unter- sprung gegenüber Ihnen als Leser*innen. Wir kennen die
schiedlichkeit von soziokulturellen Milieus und schweigen zu Reiseorte, zu denen uns dieses Themenheft mitnimmt und
den individuellen wie auch gesellschaftlichen Abgrenzungs- haben beim Schreiben dieses Vorwortes außerdem bereits
bedürfnissen. Wir predigen dann mit dem Begriff Sozial- Einblicke in jene Erfahrungen der Kolleg*innen bekommen,
raumorientierung eine Illusion. die in den einzelnen Kapiteln beschrieben sind. Deshalb la-
den wir Sie mit Überzeugung zu dieser sozialräumlichen
In unserem zweiten Koffer finden wir den Kompass und Reise ein. Wir hoffen, dass Sie neue Ideen kennenlernen und
andere nützliche Utensilien für unsere Reise, um in den So- aus diesem Themenheft heraus bereichernde Impulse ent-
zialräumen mit unseren Adressat*innen in der Arbeit der stehen. Wir sind überzeugt davon, dass die beschriebenen
Altenhilfe, Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie soziale Räume Erfahrungen und die fachlichen Ausführungen zur Sozial-
zu gestalten, in denen oder aus denen heraus die unter- raumorientierung für die Professionalität und die Arbeit im
stützten Menschen mehr teilhaben. Unabhängig davon, ob St. Elisabeth-Verein ein Gewinn sind. Unabhängig davon, ob
Ihre Arbeitsbereiche ambulant oder (teil-)stationär sind, sie es um eine Sozialraumorientierung an sozialpädagogisch
bieten sozial und räumlich einen Kontext, der die Verwirk- gestalteten Orten, wie Wohneinrichtungen für ältere Men-
lichung von Subjektivität ermöglicht, Aneignungsprozesse schen, für Kinder und Jugendliche oder für psychisch be-
befördert und die Formulierung von übergreifenden Interes- lastete Menschen, geht beziehungsweise „der Sozialraum“
sen der Adressat*innen zulässt. Hier liegt ein Grund, warum als quartiersbezogenes Gemeinwesen aufgegriffen wird oder
es neben einer Orientierung an den örtlichen Lebensräumen, ob die sozialräumliche Ausrichtung unserer sozialpädagogi-
wie Quartieren, Städten und Gemeinden, auch stationäre schen Konzepte in den Arbeitsfeldern Altenhilfe, Jugend-
Sozialräume, bspw. Einrichtungen für Kinder und Jugend- hilfe und Sozialpsychiatrie im Fokus steht, als Leser*innen
liche, psychisch Erkrankte oder ältere Menschen, braucht. erweitern wir gemeinsam unsere Perspektiven. Der Raum
In diesen geschützten Sozialräumen können noch verborge- des fachlichen Denkens und Handelns im St. Elisabeth-Ver-
8ein wächst über die Einrichtungen und über die Bearbeitung welches Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen
der individuellen Themenstellungen der Adressat*innen hin- Möglichkeiten von Partizipation und Räume für ihre Teilhabe
aus. Der St. Elisabeth-Verein öffnet sich damit noch stärker bietet. Genau das ist die Vision des sozialpädagogisch-diako-
in vielfältige Lebenswelten und Sozialräume hinein und nutzt nischen Handelns im St. Elisabeth-Verein und gerade nicht
eine Chance, um die soziale Wirklichkeit in einem Lernpro- die Anpassung der uns anvertrauten Menschen an gesell-
zess von Fachkräften und Adressat*innen zu verändern. Die schaftliche Bedingungen durch Bearbeitung ihrer individuel-
Arbeit im St. Elisabeth-Verein kann daran mitwirken, dass len Problemlagen.
ein inklusives und sozialräumliches Gemeinwesen entsteht,
Dayana Fritz Ulrich Kling-Böhm
Referentin für Gemeinwesenarbeit im Hessischen Minis- Vorstand des St. Elisabeth-Verein Marburg e.V. seit Ja-
terium für Soziales und Integration mit langjähriger Er- nuar 2020. Zuvor sechs Jahre lang Diakoniepfarrer im
fahrung in der Kinder- und Jugendhilfe und fachlichem Landkreis Marburg-Biedenkopf.
Schwerpunkt in der Sozialraumarbeit. Davor als evangelischer Gemeindepfarrer im Fuldaer
Land und am Marburger Richtsberg tätig. In diesen Posi-
Frau Fritz war unter anderem mehr als zehn Jahre als tionen mit vielerlei Lebenswirklichkeiten von Menschen
Mitarbeiterin im St. Elisabeth-Verein Marburg e.V. tätig. jeden Alters konfrontiert.
Quellen- und Literaturangaben
Castells, Manuel (1977): Die kapitalistische Stadt. Ökonomie und Poli- Hinte, Wolfgang (2007): Das Fachkonzept „Sozialraumorientierung“.
tik der Stadtentwicklung. Hamburg: VSA Verlag für das Studium der In: Hinte, Wolfgang / Treeß, Helga: Sozialraumorientierung in der Ju-
Arbeiterbewegung. gendhilfe. Theoretische Grundlagen, Handlungsprinzipien und Praxis-
beispiele einer kooperativ-integrativen Pädagogik. Weinheim, Mün-
Früchtel, Frank / Cyprian, Gudrun / Budde, Wolfgang (2007): Sozialer chen: Juventa Verlag, S. 15–128.
Raum und Soziale Arbeit. Textbook: Theoretische Grundlagen. Wiesba-
den: VS Verlag.
9Sozialraumorientierung:
Aspekte aktueller Herausforderungen für
sozialraumorientierte Erziehungshilfen
Von Wolfgang Hinte
Wenn sich ein Träger sozialer oder pädagogischer Arbeit re- Abstechern in die alte Logik, so dass doch wieder der Erhalt
spektvoll und mit der Absicht, im Interesse der Betroffenen der Immobilie, die Zuteilung von (finanzierungssichernden)
in deren Sozialraum gestaltend zu wirken, als anschlussfä- Fällen oder der interne Teamfrieden im Vordergrund stehen.
hig an die ins Auge genommene Lebenswelt erweisen will, Jeder in einem Wohngebiet agierenden Einrichtung wird
muss er als sinnstiftende Folie eine Steuerungsdimension eine Öffnung auf mehreren Ebenen abverlangt: zum einen
wählen, die wesentlich durch die Lebenswelt der Menschen in das Wohnquartier hinein und zum anderen hin zu den
und weniger durch die Bürokratie bestimmt wird. Eine be- übrigen Institutionen, die sich vielleicht in einem ähnlichen
deutende Dimension im Alltag vieler (gerade benachteilig- Prozess befinden. Nicht zu unterschätzen sind dabei die al-
ter) Menschen ist das Wohnquartier, also der Ort, an dem lerorts wirkenden Beharrungskräfte: Die Unberechenbarkeit
die Menschen leben, einen Teil ihrer Freizeit verbringen, den des Wohnquartiers bringt zahlreiche der in vielen Jahren
sie auf ihre je eigenartige Weise gestalten, wo sie einkaufen, entwickelten Abläufe und Rituale durcheinander, und die
Kontakte pflegen oder ihr Auto abstellen. Wer sich als Motor Transparenz der eigenen Arbeit ist angesichts der kritischen
einer anregungsreichen Lebenswelt im Sinne der Interessen Blicke anderer Einrichtungen nicht gerade Anlass für institu-
von Kindern, Jugendlichen und Familien versteht, muss in tionellen Frieden. Bei Störungen von außen entwickelt jedes
Struktur und Management stärker den Erfordernissen der System auch solche Kräfte, die den Rückzug auf Gewohntes
Lebenswelt folgen als denen der Abteilung, der Immobilie, fordern und dazu führen, sich in bewährter Weise abzu-
der Hilfeform oder der Finanzierungslogik. Dazu bedarf es schließen, auch um sich vor allzu viel Innovation zu schützen.
einer Organisation, die zum einen im Kern straff ist und im Insofern kann es durchaus sinnvoll sein, in manchen Phasen
guten Sinne bürokratisch funktioniert, zum anderen aber an eines Umbau-Prozesses „das Tempo rauszunehmen“, um die
den Rändern so offen und flexibel ist, dass sie sich den wech- jeweiligen Akteur/innen nicht unnötig zu überfordern.
selnden Entwicklungen in den Quartieren und insbesondere
der leistungsberechtigten Menschen „anschmiegen“ kann. Beziehungsarbeit und Ökonomie:
Aktivierende Arbeit, Ressourcenmobilisierung mit den Men- Wer zahlt wann wie viel?
schen im Wohnquartier, Nutzung der Sozialraumressourcen
etwa bei der Entwicklung eines Hilfearrangements, fallun- Die Unterstützung von gelingendem Aufwachsen wird in
spezifische Arbeit in Kooperation mit anderen (Leistungs-) der Regel familiär oder zumindest in verwandtschaftlichen
Bereichen usw. sind zentrale Handlungsformen, die heute Kontexten erbracht, und ist damit für die öffentlichen Kas-
noch häufig zurückstehen hinter der Konzentration auf den sen zunächst unmittelbar kostenlos. Natürlich fließen in fa-
Einzelfall, die Auslastung des Hauses oder die sture Einhal- miliäre Unterstützungsleistungen die Tätigkeiten öffentlich
tung überzogener bürokratischer Verfahren. geförderter Institutionen wie öffentliche Kinderbetreuung,
Schulen, offene Kinder- und Jugendarbeit, Familienbildung
Das Wohngebiet ist als Steuerungsdimension zweifach be- usw. ein; den familiären Netzen werden Institutionen ange-
deutsam. Zum einen geht es immer darum, soziale Räume zu boten, die ihnen die Unterstützungsaufgabe erleichtern. Die-
gestalten und Menschen in ihrem Lebensraum zu unterstüt- se Situation ändert sich, wenn – aus welchen Gründen auch
zen, zum anderen dient es der Qualität der Einzelfallarbeit, immer – Kinder gefährdet sind, auffällig werden, der Gesell-
wenn Ressourcen des sozialen Raumes genutzt bzw. syste- schaft zur Last fallen, Entwicklungsrückstände aufweisen –
matisch solche Ressourcen aufgebaut werden, die bei der wenn also die Unterstützungsleistung des familialen Kontex-
Ausübung des gesetzlichen Auftrags den sozialen Diensten tes nicht ausreicht, um dem heranwachsenden Menschen
nutzen können. Das Wohngebiet kann zudem ein integrie- wirklich ein gelingendes Leben zu ermöglichen. Für diesen
rendes Bezugselement für verschiedene Abteilungen, Träger Fall gibt es Leistungsgesetze, die es ermöglichen, auf der
und Zielgruppen darstellen. Insofern müssen sich die Wohn- Grundlage eines behördlichen Beschlusses einem einzelnen
gebiete auch in der Struktur einer Organisation abbilden. Kind bzw. einer einzelnen Familie „auf den jeweiligen Fall“
bezogen Leistungen zukommen zu lassen: Sozialpädagogi-
Die Einrichtungen des Sozialwesens stärker gebietsbezo- sche Familienhilfe, Sonderbeschulung, Heimunterbringung,
gen auszurichten und zu verzahnen, scheint sich angesichts Schulassistenz, betreutes Wohnen usw. Zur Erbringung
der gewachsenen traditionellen Strukturen in der sozialen dieser Leistungen stehen zahlreiche Institutionen bereit, die
Arbeit schwierig zu gestalten. Selbst bei ausgewiesenen In- nur deshalb existieren, weil es diesen staatlich konstatierten
novationsträger/innen kommt es immer wieder zu mentalen oder von den Familien angefragten Unterstützungsbedarf
10gibt, und die – strukturell gesehen – geradezu darauf war- einzelnen Menschen im Blick haben und nicht seine lebens-
ten, dass Kinder und Jugendliche endlich unterstützungs- weltlichen sozialräumlichen Netze. Dies ist sozialarbeiterisch
bedürftig werden, weil nur bei genügender Auslastung die unvertretbar, ganz zu schweigen von den Folgen für die öf-
jeweilige Einrichtung überleben kann. Insofern hat – wie- fentlichen Haushalte.
derum nur strukturell gesehen – keine der zahlreichen Ein-
richtungen im Bereich der erzieherischen Hilfen ein Inter- Angesichts ständig wechselnder, heterogener und immer
esse daran, Kinder frühzeitig so zu unterstützen, dass die komplizierterer lebensweltlicher Problemlagen sowie einem
familialen Netze weiterhin tragen und die Menschen alleine wachsenden Druck auf die öffentlichen Haushalte sind Fi-
klarkommen, nein, sie müssten – wirtschaftlich betrachtet nanzierungskonzepte gefragt, die folgenden Kriterien ge-
– eher dazu beitragen, dass Kinder „auffällig“ geschrieben horchen sollten:
werden, damit sie dann mit ihrem Arsenal an Immobilien, - Sie müssen orientieren auf vom Einzelfall ausgehende, so-
Personal und gutem Willen auf den Plan treten können. Si- zialräumlich erbrachte Dienstleistungen: Nur bei konsequen-
cherlich wird dann von vielen Einrichtungen gute Arbeit in ter territorialer Orientierung entfaltet sich die ganze Palette
dem gewünschten Sinne ge- an fachlich wünschenswerten Aspekten (etwa der stärkere
leistet, dies jedoch Einbezug lebensweltlicher Netze zur Unterstützung der Fa-
auf einem milien, der systematische Aufbau fallunspezifischer – aber
durch ge- immer auf potenzielle „Fälle“ bezogener – Strukturen, eine
radezu integrierte Leistungserbringung in einem Mix aus profes-
kapi- sioneller Tätigkeit mit anderen Leistungsbereichen aus den
ta- verschiedenen Sozialgesetzen sowie ehrenamtlicher und
nachbarschaftlicher Tätigkeit und eine durch „kurze Wege“
gekennzeichnete familienaktivierende Arbeit im Rahmen von
stationären Settings).
- Sie müssen den durch Akquise-Verhalten und Konkurrenz
geprägten Markt schrittweise ablösen durch eine koope-
rative Träger-Kultur, die über ein Fachcontrolling zu einem
kontinuierlichen Qualitätswettbewerb angeregt wird. Dazu
benötigen die Leistungserbringer ein gewisses Maß an Pla-
nungssicherheit, und zwar durch flexibel bewirtschaftbare
Budgets oder andere Pool-Finanzierungen.
- Sie müssen konsequent Anreize bieten, passgenaue Maß-
nahmen jenseits der Kategorien ambulant, teilstationär und
stationär zu entwickeln und durchzuführen. Solange das
Vorhalten von Plätzen, die Auslastung von Einrichtungen so-
wie die Spezialisierung auf bestimmte Symptome finanziell
lis- gefördert werden, wird kein Träger strukturelles Interesse
t i - daran entwickeln, flexibler mit Immobilien umzugehen bzw.
s c h e flexibel arbeitendes Personal einzustellen, das sowohl in Fa-
Gesetze milien, „am Jugendlichen“ sowie in einem Gruppensetting –
geprägten im Ausnahmefall auch mal in einer Immobilie – arbeiten kann.
Markt: Das staatli- - Sie müssen Grundlagen bieten, die tarifverhandlungsähn-
cherseits diagnostizierte lichen Debatten um Leistungsentgelte abzuschaffen zuguns-
Kind „wandert“ an eine Einrichtung, und möglichst an eine ten einer bürokratisch und verhandlungstechnisch unauf-
solche, die einen Platz frei hat, die fachlich ausgewiesen ist wändigen Finanzierungskultur, die dadurch geprägt ist, dass
in dem jeweils diagnostizierten Symptom und die einen ver- bestimmte Summen mit an bestimmte Indizes gebundenen
einbarten, hart und aufwändig ausgehandelten Pflegesatz Steigerungsraten bezogen auf bestimmte Quartiere sowie
hat. Je länger ein Kind bei einem Leistungserbringer ver- der gesamten Gebietskörperschaft den Rahmen bilden für
bleibt, desto länger fließt das Geld, und somit gibt es auch die Leistungserbringung, der – selbstverständlich nur bei
keine strukturellen Anreize, die staatlicherseits gewährten nachvollziehbar sich mehrenden Leistungsansprüchen – er-
Unterstützungsleistungen möglichst bald zu beenden, denn weitert werden kann.
damit würde ja auch das „gesicherte“ Entgelt entfallen und - Sie müssen an einfach zu erhebenden Wirkungsfaktoren
man hätte entweder einen leeren Platz oder müsste sich auf orientiert sein, die sich nicht abbilden in seitenlangen Ent-
ein neues Kind einstellen. Bei aller (guter) moderner Pro- wicklungsberichten, sondern konsequent auf die Lebens-
grammatik von Inklusion, Autonomie, Lebensweltbezug und entwürfe (den Willen!) der Betroffenen und die Schritte zu
Empowerment: Solange nicht die Finanzierungsinstrumente deren Erreichung (Leitfrage: „Was nehme ich mir vor?“) be-
und Diagnoseverfahren stärker vom Einzelfall weg hin zum zogen sind. Einfach gesagt: Solche Träger sind gut, denen es
sozialen Raum orientieren, verbleibt das gesamte System gelingt, mit möglichst wenig Aufwand die passenden Unter-
in diesem volkswirtschaftlichen Irrsinn: Wir helfen den Be- stützungssettings für die Familien bereitzustellen, damit
nachteiligten, aber tun dies erst dann, wenn sie „richtig“ diese die von ihnen selbst formulierten Ziele erreichen und
benachteiligt sind, und dies mit Mitteln, die vorrangig den von Hilfe unabhängig werden.
11Die Aufgabe der Leistungsträger in einem solchen Kontext gesagt ist – jedwede Rückkehr-Option zu wahren). Es wird
verändert sich substanziell. Die Behörden sind nicht mehr nur dann vermutlich nur noch für wenige Zielgruppen „Spezial-
die „Fallverteiler“, die je nach Fall den am besten geeigneten einrichtungen“ geben, die sich mit bestimmten Segmenten
Träger aussuchen. Vielmehr konzentriert sich der Zuweiser beschäftigen (etwa 16-18-jährige Mädchen mit frühkind-
auf die systematische Erarbeitung von Willen und Zielen der lichem Trauma). Vielmehr wird die Zahl der Einrichtungen
Betroffenen (also die Hilfeplanung), auf den Akt der grund- zunehmen, die den Ehrgeiz haben, möglichst jedes Kind /
sätzlichen Bewilligung der Leistung und auf die Kontrolle des jeden Jugendlichen aufzunehmen, die nicht mehr danach
Systems der Leistungserbringer sowie auf die ständig neu schauen, ob der Jugendliche in die Einrichtung „passt“, son-
zu leistende Gestaltung der lokalen Trägerlandschaft. Ver- dern die Einrichtung immer wieder neu den Gegebenheiten
glichen mit der derzeitigen Praxis spart man dabei viel Zeit. anpassen, die durch heterogene Gruppenzusammensetzun-
Klassische Entgelt-Verhandlungen kann man sich schenken, gen entstehen. Das Hilfesystem muss sich den jeweils wech-
ebenso die zum Teil differenziert durchgeführten Kontrollen selnden Bedarfen anpassen. Derzeit werden die Menschen
über Entwicklungsberichte und „Hineinregieren“ in den Ein- an das jeweilige Hilfesystem angepasst bzw. sie arrangieren
zelfall sowie die zum Teil höchst schwierige Auswahl des „ge- sich notgedrungen mit einem Hilfesystem, das regelmäßig
eigneten“ Trägers. Stattdessen konzentriert man sich auf die sein „Angebotsspektrum“ verändert, und wenn diese Verän-
fachlich-methodischen Aspekte im Falleingang sowie auf das derung vorgenommen wurde, haben sich die Bedarfe längst
Fachcontrolling der Träger (das natürlich dann die Grundlage auch schon wieder verändert.
für ein ordentliches Abrechnungsverfahren darstellt, das im
Übrigen auch erheblich einfacher ist im Vergleich zur äußerst Nicht die marktförmig organisierte Konkurrenz der Leis-
zeitaufwendigen bürokratischen Einzelfallabrechnung). Was tungsanbieter und die entsprechende Kontrolle des Kosten-
gerade in diesem Bereich an öffentlichen Geldern verplem- trägers der jeweils gesponserten und dennoch unkontrolliert
pert wird (und gar nicht in den Transferkosten auftaucht) ist wachsenden Landschaft führt zu einer besseren Leistungs-
seit Jahren unvertretbar. Der Kontrollaufwand wird regel- gestaltung, sondern nur ein kooperatives Verhältnis zwi-
mäßig in einer Art und Weise erhöht, die weder dazu bei- schen Kostenträger, Leistungserbringer und Leistungs-
trägt, den kontrollierten Gegenstand besser zu erfassen empfänger, und dies unter Verzicht auf einzelfallorientierte
noch das System flexibler zu machen, um geeignete Hilfen Fachleistungsstunden und Pflegesätze zugunsten von Pau-
tatsächlich passgenau und wirkungsvoll zu erbringen. Statt schal- und Budgetfinanzierungen, bei denen im Konsens zwi-
vermehrter formaler Kontrolle braucht es Investitionen in schen Kostenträger und Leistungserbringer unter Mitwir-
fachlich-methodische Qualität und intellektuelle Investition kung des Hilfeempfängers über die Hilfe entschieden wird,
in die Entwicklung alternativer Finanzierungsformen. und zwar unter Letztentscheidung des Kostenträgers bei
gleichzeitigem Veto-Recht des Leistungserbringers.
Passgenaue Arrangements statt „Hilfen von der
Stange“ Beim sozialräumlichen Fachkonzept geht es vor jeder Dis-
kussion um Struktur und Finanzierung um einen Paradig-
Somit ist klar, dass es nicht darum geht, das Angebotsspekt- menwechsel in der Unterstützung benachteiligter Milieus
rum an Einrichtungen zu verbessern, sondern darum, jeweils durch den Einsatz öffentlicher Gelder. Im Zentrum jeder Hilfe
bezogen auf den einzelnen Fall hochgradig flexibel das pas- steht – ausgenommen im Fall der konstatierten akuten Kin-
sende Angebot immer wieder neu zu kreieren. Selbstver- deswohlgefährdung – immer der von den Betroffenen for-
ständlich spielen (wenn denn der Träger sozialräumlich gut mulierte Wille, der sich möglichst präzise und in der Sprache
verankert ist) sozialräumliche Ressourcen (personelle wie der betroffenen Menschen ausgedrückt in kleinschrittigen
materielle) eine große Rolle, und ihre Benennung im Hilfe- „Meilensteinen“ abbildet, die gleichsam den „roten Faden“
plan ist von großer Bedeutung (gerade die Träger sollten durch eine Hilfe darstellen. Diese Form der kleinschrittigen,
„belohnt“ werden, die derlei Ressourcen in hohem Ausmaß oft mühsamen Erarbeitung der Schritte, die sich die Betrof-
schaffen bzw. heranschaffen). Dies führt dazu, dass zu- fenen vornehmen, ist genau die Kunst, die die Beschäftigten
nächst die Grenzen zwischen ambulant und stationär fol- beim Kostenträger beherrschen müssen. Auf der Grundlage
genreich verschwimmen und in einem weiteren Schritt die vorgegebener Zielformulierungen (vermeintlich „fallverste-
„guten“ Träger sich nicht mehr dadurch auszeichnen, dass hend“) gleichsam gegen die Energie einer hilfesuchenden
sie ein bestimmtes (in der Regel immobiliengestütztes) An- Familie zu arbeiten bzw. vorschnell eine (oft schwammige)
gebot vorhalten, sondern hochgradig flexibel arbeitendes in bürokratischem Slang formulierte Zielformulierung zu
Personal, das sich entsprechend den im Hilfeplan formulier- wählen, die keinerlei energetische Ausstrahlung auf den
ten Perspektiven so sensibel auf die Familie einstellt, dass Hilfeverlauf hat, ist grundsätzlich zum Scheitern verurteilt
jeweils die passenden Unterstützungs-Arrangements an- (von Ausnahmen mal abgesehen, bei denen man schlichtweg
geboten werden (und das kann durchaus ein Mix aus eher Glück hatte). Die konsequente Formulierung von seitens der
stationären, eher ambulanten und auch lebensweltlichen Betroffenen durch eigene Aktivität („Selbstwirksamkeit“)
Elementen sein). Flexibel arbeitendes, gut ausgebildetes selbst erreichbaren Zielen (bei denen man dann durch einen
Personal wird damit mindestens ebenso wichtig wie das Leistungsanbieter unterstützt wird) sowie der darauf bezo-
Vorhalten geeigneter Räumlichkeiten, und mit Blick auf der- gene punktgenaue Einsatz von personalen und sozialräum-
lei Räumlichkeiten wird in diesem Kontext immer mehr von lichen Ressourcen (insbesondere auch der Regelsysteme)
Bedeutung, dass diese Räumlichkeiten flexibel nutzbar sind machen den Kern eines sozialräumlichen Ansatzes aus. Da-
und möglichst nahe am Sozialraum liegen (um – wenn es an- mit ist klar: Jeder Wille (es sei denn, seine Realisierung ist
12ungesetzlich oder schadet anderen Menschen) ist statthaft, stehen, dass sie über den Auf- und Ausbau von Infrastruk-
und geradezu verboten ist eine seitens des Kostenträgers tur-Angeboten dazu beitragen, in den kommenden Jahren
vorgenommene Intervention unter der Überschrift: „Es wäre die Entstehung von Leistungsansprüchen zu verhindern,
aber doch gut, wenn …“ oder – schlimmer noch-: „Geld gibt eine bunte Landschaft aus derlei Angeboten kreieren, weil
es nur, wenn… . „Mit Blick auf die von den Menschen for- sie ein wirtschaftliches Interesse daran haben, eine funk-
mulierten Ziele muss immer auch gelten: Das Hilfesystem tionierende sozialräumliche Struktur zu entwickeln, in der
muss die passende Unterstützung möglichst frühzeitig zur möglichst frühzeitig Menschen in Belastungssituationen
Verfügung stellen – und das kann auch mal die umgehende Unterstützung erfahren (man könnte auch sagen – auf die
stationäre Unterbringung sein. Aber eben: Die richtige Hilfe Gefahr hin, als neo-liberal etikettiert zu werden – : „Fälle“ zu
zum richtigen Zeitpunkt schafft die hilfreichste Unterstüt- verhindern). Nur wenn klar ist, dass
zung (und nebenbei: sie gehorcht außerdem dem Gebot der
sparsamen Bewirtschaftung öffentlicher Mittel). Wenn das - Leistungserbringer auf mehrere Jahre
System (also sowohl der Kostenträger als auch die gesam- hinaus Planungssicherheit haben,
te Palette der Leistungsanbieter) nicht systematisch darauf - sozialräumliche Angebote gezielt auf solche Bevölkerungs-
hin orientiert wird, mit diesem Blick an „Fälle“ oder „poten- gruppen gerichtet sind, die „übermorgen“ zu attestierten
zielle Fälle“ heranzugehen, droht die gesamte Veranstaltung Leistungsempfängern werden könnten,
zu einer inhaltsleeren Sparorgie auf Kosten derjenigen Mi- - die Trägerlandschaft dadurch zur Kooperation angeleitet
lieus zu werden, in denen eben nicht so häufig bürgerliche wird, dass die beteiligten Akteure das vorhandene Geld
Normalbiografien gelebt werden wie unter Sozialarbeiter/ flexibel einsetzen können und gleichzeitig wissen, dass es
innen oder Jurist/innen. (Im Übrigen: Unterm Strich kostet in begründeten Ausnahmefällen anhand von gut erhobe-
diese Kampfansage an die Entrechteten und Benachteiligten nen Belastungsindikatoren in einem Quartier „mehr“ Geld
erheblich mehr als ein vernünftig gemanagter sozialräumli- geben kann
cher Ansatz auf dem Hintergrund solider Fachlichkeit.) - ein fachliches Controlling existiert, das anhand von relativ
harten Indikatoren regelmäßig darüber informiert, ob der
Damit klar ist, worüber wir reden: Kinder und Jugendliche in erwünschte Standard realisiert wird,
extremen Verweigerungsphasen, mit autonomen und eigen- wird die sozialräumliche Programmatik tatsächlich reali-
willigen Lebensentwürfen bereits in frühem Jugendalter, siert und ihre Wirkung entfalten.
Kids mit hohem Aggressionspotential, Suchtstrukturen und
vielfach diagnostiziertem psychiatrischem Hilfebedarf, also Eine Einrichtung, der es in diesem Kontext gelingt,
diejenigen, die in der Regel in hochstandardisierten, teu- - den Eigenwillen der Kinder und Jugendlichen als Chance
ren und häufig erfolglosen Hilfeangeboten landen, scheren und Ressource (und nicht als Betriebsstörung) zu achten,
sich in der Regel einen Teufel um den regelmäßigen Schul- - ein Umfeld zu schaffen, in dem Unterstützung nicht in Be
besuch oder die angebotene Lehrstelle. Der Aufbau eines treuung ausartet,
sozialräumlichen, ambulanten und da und dort auch durch - die (manchmal vielleicht verwirrenden) Energien von Kin
eine Immobilie gestützten Netzes mit für jeden „Fall“ eige- dern als Chance und Herausforderung zu sehen,
nen Lösungen für die Bereiche Freizeit, Wohnen, Gesundheit - sich als integraler Bestandteil des Alltags im Quartier zu
und meinetwegen auch Schule und Ausbildung und zwar verstehen,
möglichst unter Einbezug der Eltern ist eine sozialarbeite- - über eine konsequent kooperative Haltung nach innen
risch spannende und jenseits von Seiten des Leistungsträ- und außen immer wieder neu passende Unterstützungs-
gers vorgegebenen „erwünschten“ Zielen und vorgehalte- arrangements für oftmals schwierige Lebensphasen
nen Strukturen äußerst erfolgversprechende Aufgabe, die von Kindern zu schaffen
zu finanzieren weniger kostet als der klassische Heimplatz. einer solchen Einrichtung darf man wohlgemut eine gute
Der Aufbau eines Netzes von Leistungserbringern, die so- Zukunft prophezeien und eine die Zeiten überdauernde Exis-
zialräumlich gerade auch in diesen Segmenten hochwertige tenz wünschen.
Arbeit leisten, funktioniert nur im Rahmen eines Fach- und
Prof. Dr. Wolfgang Hinte, geboren 1952, Hochschul-
Strukturkonzeptes, das sowohl für „leichte“, „niederschwel-
lehrer i. R., war über 30 Jahre lang Leiter im „Institut
lige“ als auch für „schwere“, „hochpreisige“ Fälle nach der
für Stadtteilentwicklung, Sozialraumorientierte Arbeit
gleichen Logik funktioniert.
und Beratung“ (ISSAB) der Universität Duisburg-Essen;
er begleitet kommunale und freie Träger insbesonde-
Das A und O einer „funktionierenden“ sozialräumlichen
re der Jugend- und Behindertenhilfe in Deutschland,
Landschaft ist eine integrierte Finanzierungsform, bei der
Österreich und der Schweiz bei Umbauprozessen nach
Kostenträger und Leistungserbringer gemeinsam für die
sozialräumlichen Konzepten.
Einhaltung von Budgets und die Erbringung der gesetzlich
vorgeschriebenen Leistungen verantwortlich sind. Für ein Literaturhinweise:
territorial klar umschriebenes Gebiet braucht es ein festes • Fürst, R./ Hinte, W. (Hrsg.) (2020):
Sozialraumorientierung 4.0 – Das Fachkonzept: Prinzipien,
Budget, dessen Höhe alle Beteiligten kennen (egal, ob es nun Prozesse und Perspektiven, Wien
beim Kostenträger bleibt oder direkt an die Leistungserbrin- • Noack, M. (2015): Kompendium Sozialraumorientierung,
ger gezahlt wird), und aus diesem Budget müssen sämtliche Weinheim/ Basel
• Herrmann, H. (2019): Soziale Arbeit im Sozialraum, Stuttgart
in diesem Sozialraum anfallenden Hilfen bestritten werden. • Hinte, W./ Treeß. H. (2014): Sozialraumorientierung in der
Überall zeigt sich, dass die Leistungserbringer, wenn sie ver- Jugendhilfe, Weinheim/ München, 3. Auflage
13Über Empowerment in der Sozialraumorientierung
„Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen
um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“
Antoine de Saint-Exupéry
Von Jonathan Bentzer
Dieses Zitat von Antoine de Saint-Exupery beschreibt die Grundhaltung des Empowerments: Menschen befähigen, ihren eige-
nen Antrieb zu finden und zu aktivieren, selbständig zu denken und lösungsorientiert zu handeln. Doch warum ist das so wichtig
in der sozialraumorientierten Arbeit? Zunächst glaube ich, dass es wichtig ist, dass eigene Verständnis der Definition für Sozial-
raumorientierung etwas genauer darzulegen.
Ich persönlich sehe darin zwei Ebenen, welche in Wechselwirkung zueinander stehen und nicht „losgelöst“ voneinander erschlos-
sen werden können.
Ebene 1: Sozialraum auf struktureller Ebene Auf personenzentrierter Ebene
Beschreibt Räumlichkeiten, Institutionen, kommunale Struk- - Ressourcen des Klienten erkennen und fördern
turen, Nachbarschaft etc., Foren, Plattformen und Begeg- - Stärkung des Selbstbewusstseins und der Eigenverant-
nungsräume (auch digital), welche sich im Einflussbereich des wortung
Klienten befinden. - Förderung der kommunikativen Fähigkeiten
- Ängste und Vorbehalte des Klienten überwinden
Ebene 2: Sozialraum auf personenzentrierter Ebene - Partizipation, maximale Transparenz und uneingeschränkter
Beschreibt die Fähigkeit des Klienten, den Sozialraum aus Ebe- Zugang zu Information
ne 1 selbstständig zu erschließen, auszubauen und zu nutzen. - Vertrauensvorschuss
Aus dieser Definition ergeben sich für uns als Sozialpsychiatrie - „Tu nichts, was dein Klient nicht auch selbst tun kann“
folgende Aufgabenfelder: - die Haltung des Mitarbeitenden
Auf struktureller Ebene Wichtig zu beachten ist dabei:
- Kooperationen ausbauen (z. B. in Kommunen, Nachbar- - Es geht nicht um den Sozialraum der Einrichtung, sondern
schaften, Institutionen) um den Sozialraum des Klienten.
- Auflösen von „Sonderwelten“ – Dezentralisierung
- Ausbau von Begegnungsstätten, Plattformen und Foren Ein Sozialraum kann letztlich nur von jedem selbst erschlossen
- Abbau von Stigmatisierung von Menschen mit einer werden.
psychischen Erkrankung (durch Öffentlichkeitsarbeit, Unsere Aufgabe als Sozialpsychiatrie ist es nun, genau dafür
Aufklärung, Begegnung) günstige Rahmenbedingungen zu schaffen (Ebene 1), und den
Menschen zu befähigen, diese auch zu nutzen (Ebene 2).
Bisher konnten wir in unserem „Bistro Netzwerk“ in Frielen-
dorf, welches von einigen Klienten und Mitarbeitenden der
14
14Sozialpsychiatrie geführt wird, einige Erfahrungen hierzu ma-
chen. Dieses Bistro kann nach unserer Erfahrung für einige ein
„Sprungbrett“ in den Sozialraum sein.
Durch den direkten Kontakt mit der Kundschaft, den eigenver-
antwortlichen Umgang mit der Kasse, die Dienstplanung und
die Platzreservierung sind bereits Erfolge in der persönlichen
Entwicklung der Klienten festzustellen.
Natürlich bietet auch dieses Projekt zahlreiche Herausforde-
rungen und bedient noch nicht alle Handlungsfelder der per-
sonenzentrierten und strukturellen Ebene.
Es ist jedoch ein guter Anfang.
Wie können wir nun ganz konkret die Menschen, welche wir
begleiten, „empowern“, damit sich diese ihren eigenen Sozial-
raum besser erschließen und auch nutzen können?
Aus unserer Erfahrung sind es weniger die konkreten Ange- Kleine Schritte wagen: Oft sind es die großen Ziele, die uns
bote, als vielmehr die Haltung des Mitarbeitenden, welche den (und unsere Klienten) zurückschrecken lassen, uns daran hin-
Menschen befähigt. dern, erste Erfahrungen zu machen, auf denen wir aufbauen
können. Perfektion ist an dieser Stelle ein wahrer „Killer“ von
Hier einige Gedanken zu einer förderlichen Haltung: Pioniergeist. Lasst uns die „großen Ziele“ in kleine Schritte he-
runterbrechen und uns darauf konzentrieren. Das kann Über-
Transparenz: Aus „Mitwissern“ werden letztlich auch „Mit- forderung vermeiden.
täter“ – Wir wollen den Menschen, welche wir begleiten, alle
Informationen zugänglich machen, welche Sie für selbstbe- Sicherheit geben: Einen Plan B zu haben oder ein „Ass im Är-
stimmtes und eigenverantwortliches Handeln brauchen. mel“ gibt Sicherheit und kann frei von Zwang und Druck ma-
chen. Scheitern muss erlaubt sein. Menschen im Hintergrund,
Herausfordern: Anstatt zu fragen: „Warum tun wir et- die im Notfall erreichbar sind oder einspringen können, wenn
was?“;,wollen wir lieber fragen: „Warum tun wir eigentlich et- es eng wird, können ein großer Motivator sein, Dinge doch ein-
was nicht?“, „Was hindert uns eigentlich daran?“ fach mal zu versuchen …
Auf Ressourcen bauen: Ressourcen unserer Klienten werden Erfolge feiern: Es tut gut, das Erreichte immer wieder zu re-
leider viel zu oft unterschätzt! Eine spannende Frage, um diese flektieren. Auch wenn wir noch nicht am Ziel angekommen
Ressourcen zu entdecken, kann sein: „Was kann mein Klient sind, so sind wir doch nicht mehr da, wo wir einmal losgegan-
eigentlich besser als ich?“ – und wenn wir wirklich ehrlich sind, gen sind. Das darf und muss auch gefeiert werden.
gibt es darauf wohl immer eine Antwort.
„Ob du denkst, du kannst es, oder du kannst
es nicht – du wirst auf jeden Fall Recht behalten.”
Henry Ford
15Leben in
Gemeinschaft –
ein Modell für selbstbestimmtes Leben
unter Anleitung und Hilfestellung
Von Juliane Leuschner
Im Teilhabezentrum Kernbach leben seit 2012 Menschen mit ting aufzeigen kann. Bei Suchtproblematik beispielsweise ist
unterschiedlichem Unterstützungsbedarf und unterschied- die Freiheit, so agieren zu wollen, wie es die Sucht teilweise
lichen Alters in einem ambulanten Wohnprojekt zusammen fordert, in solch einem Zusammenleben schwierig und zum
mit den Projektverantwortlichen und ihren Familien auf einem Schutz der Hofgemeinschaft inklusive der Kinder oft unmög-
großen Hofgelände. Menschen mit und ohne Hilfebedarf tei- lich. Daher stoßen wir gelegentlich auf die Frage, wie ein
len den Alltag, leben und arbeiten zusammen. Alle Menschen, Mensch eigentlich „sein muss“, um mit uns und bei uns leben
die dort leben und Unterstützung benötigen, haben eine frei- zu können? Oder welches Umfeld die Menschen brauchen, um
willige Entscheidung dafür getroffen. Der Wille des Menschen sicher und selbstbestimmt leben zu können?
steht hierbei im Mittelpunkt und ohne Einsicht der Notwen-
digkeit von Hilfe ist pädagogische Betreuung nicht möglich. Betroffene sollen aktiv mitwirken dürfen an der Verbesserung
Die Orientierung der nötigen Hilfen und Unterstützungen rich- ihrer Umstände. Dazu braucht es Orte, an denen Hilfe für den
tet sich nach dem Willen und den Interessen der Betroffenen. einzelnen Menschen stattfindet. Allerdings kann dies besser
Eigeninitiative und Selbsthilfe soll entstehen und die (Mit-)Ge- gelingen in Kombination mit der allgemeinen Verbesserung
staltung des eigenen Lebensumfeldes im Wohnprojekt Kern- der Lebensumstände und des Umfeldes.
bach soll dazu beitragen.
Ein großes Netzwerk von ehrenamtlichen Helfenden und die
Der Ansatz des selbstbestimmten Lebens ist elementar. Ge- VieCo- e.V.-Lebensgemeinschaft als verlässliche Konstante
rade in schwierigen Lebenslagen und bei Angewiesensein auf sind in allen Belangen eine wichtige Hilfe.
Unterstützung wird die eigene Entscheidung, wie und wo ein Anders als im Stationär Betreuten Wohnen sind die Grenzen
Mensch leben möchte, teilweise nicht berücksichtigt. doch deutlich weiter gesteckt. Die Abende und Wochenenden
Im Wohnprojekt Kernbach soll besonders durch Alltägliches- stehen zur freien Verfügung.
Leben-teilen und durch Beziehungsaufbau und Begegnung Mit aufkommenden Krisen umzugehen, ist im Zusammenle-
zwischen Betroffenen und Nicht-Betroffenen der Abbau von ben mit vielen unterschiedlichen Menschen immer wieder eine
Vorurteilen erfolgen. Akzeptanz und Verständnis kann wach- Herausforderung.
sen und das Umfeld kann dadurch einen Beitrag leisten zur Der Schutz aller hier Lebenden muss im Vordergrund stehen.
Stabilisierung Einzelner. Der Zusammenhalt innerhalb des Jedoch darf auch der eigene Wille und die Selbstbestimmtheit
Dorfes Kernbach ist in den vergangenen Jahren gewachsen. des Einzelnen nicht untergraben werden.
Es durfte erlebt werden, wie Vorurteile und Ängste abgebaut
wurden und die nachbarschaftlichen Kontakte tragen dazu Als eines der vielen positiven Beispiele kann von einem Mann
bei, dass das gemeinschaftliche Leben Sicherheit und Akzep- im Rollstuhl berichtet werden. Nach jahrelangem Aufenthalt
tanz bewirkt. Dabei müssen die Ressourcen aller berücksich- in einem Pflegeheim konnte unsererseits seinem starken
tigt werden. Wunsch nach selbstbestimmterem Leben entsprochen wer-
den und für den Zeitraum, in dem es ihm möglich war, selb-
Im Alltag stellen wir fest, dass Selbstbestimmtheit auch Gren- ständiger zu leben, war er Teil der Hofgemeinschaft.
zen für gemeinschaftliches Leben in diesem familiären Set-
1616Sie können auch lesen