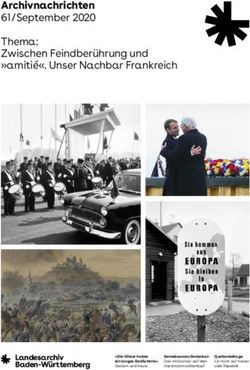SAG ES EINFACH. SAG ES LAUT! - Praxisbeispiel Salzburg Museum - Universität Salzburg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LEICHTE
SPRACHE
SAG ES EINFACH.
SAG ES LAUT!
Praxisbeispiel
Salzburg Museum
Herausgegeben von
Nadja Al Masri-Gutternig & Luise Reitstätter
für das Salzburg MuseumINHALT
Seite VORWORT
5 Martin Hochleitner
Seite EIN AUFRUF, EIN PROJEKT UND SEIN HANDBUCH
6–7
Nadja Al Masri-Gutternig, Luise Reitstätter
Seite LEICHTE SPRACHE
8 – 21
KEINE LEICHTE SACHE
Ein Praxisbericht aus dem Salzburg Museum
Nadja Al Masri-Gutternig
EINE DOPPELTE
Seite
22–35 DISKURSANALYSE
Was in Leichter Sprache und über leichte
Sprache im Museum (nicht) gesagt wird
Luise Reitstätter
„EYE-TRACKING“
IM MUSEUM Seite
36–43
Erfahrungen
Christian Flandera,
Mattia Rainoldi, Mario JoossDEUTSCH LERNEN
IM MUSEUM Seite
44 – 55
Theoretisch gedacht – praktisch umgesetzt
Theresa Bogensperger,
Margareta Strasser, Denis Weger
Seite ERZÄHL MIR SALZBURG!
56 – 69
Ein Ausstellungsrundgang mit
Stimmen aus dem Sprachkurs
Maria Gruber, Manuel Magenau
Seite LEICHTE SPRACHE IM KONTEXT
70 – 75
11 Fragen an Christiane Maaß, von Luise Reitstätter
Seite SPRACHLICHES UND
76 – 81
KULTURELLES LERNEN IM KONTEXT
11 Fragen an Hannes Schweiger, von Luise Reitstätter
Seite
82 – 83 BIOGRAFIEN
Seite
84
IMPRESSUMVORWORT
Ein Vorwort steht am Beginn von einem Buch. In Zukunft werden auch andere Museen
Das Vorwort erklärt den Inhalt. Leichte Sprache anwenden.
Dieses Vorwort ist in Leichter Sprache Unser Buch hilft dann den Museen.
geschrieben.
Viele Menschen sollen das Vorwort verstehen. Viele Menschen haben unser Projekt unterstützt.
Die Fachhochschule Salzburg hat uns geholfen.
Dieses Buch behandelt Leichte Sprache Der Staat Österreich hat sogar Geld gegeben.
im Museum. Das Salzburg Museum dankt für diese Hilfe.
2016 haben wir eine Ausstellung gemacht.
Bei dieser Ausstellung haben wir erstmals
Leichte Sprache verwendet. Das Salzburg Museum dankt:
Die Ausstellung hat im Salzburg Museum • Florian Bauer
stattgefunden. • Theresa Bogensperger
Wir haben die Texte in Leichter Sprache • Eva Maria Feldinger
geschrieben. • Christian Flandera
• Maria Gruber
In diesem Buch erzählen wir vom Projekt • Mario Joos
mit Leichter Sprache. • Peter Laub
Wir beschreiben unsere Gedanken und Ziele. • Christiane Maaß
Wir erklären die Umsetzung. • Manuel Magenau
Wir haben durch das Projekt viel gelernt. • Kerstin Matausch-Mahr
Diese Erfahrung geben wir nun weiter. • Sonja Olensky-Vorwalder
• Mattia Rainoldi
Leichte Sprache ist im Museum selten. • Hannes Schweiger
Dem Salzburg Museum ist Leichte Sprache • Margareta Strasser
aber wichtig. • Denis Weger
Der Universität Salzburg ist Leichte Sprache • Karin Zizala
auch wichtig.
Besonders dankt das Salzburg Museum:
Darum arbeiten das Museum und die • Nadja Al Masri-Gutternig
Universität zusammen. • Luise Reitstätter
Wir wünschen viel Freude mit dem Buch!
Martin Hochleitner,
Direktor vom Salzburg Museum
5EIN AUFRUF, EIN PROJEKT
UND SEIN HANDBUCH
Nadja Al Masri-Gutternig, Luise Reitstätter
D
ie Sektion Kunst und Kultur des Bundes- nahm dieses Textnovum zum Anlass, um
kanzleramts Österreich rief 2016 auf, neue einerseits empirisch zu untersuchen, wie Leichte
innovative und beispielgebende Projekte der Sprache im Salzburg Museum genützt wird und
inklusiven Museumsarbeit für eine Förderung andererseits wie Leichte Sprache als Ausgangs-
einzureichen. 2016 war auch das Jahr, in dem punkt für einen Sprachkurs im Museum genützt
das Salzburg Museum bei der Landesausstel- werden kann.
lung „Bischof. Kaiser. Jedermann. 200 Jahre
Salzburg bei Österreich“ Ausstellungstexte in An dieser Stelle bedanken wir uns bei der Sek-
Leichter Sprache einführte. tion Kunst und Kultur des Bundeskanzleramts
Österreich, die mit ihrem Aufruf zum inklusiven
Diese Gleichzeitigkeit brachte uns beide Museum den Anstoß fürs Projekt gegeben und
sowie das Salzburg Museum mit dem Schwer- durch die Förderung das Projekt ermöglicht hat.
punkt Wissenschaft & Kunst der Universität Herzlichen Dank auch an das Sprachenzentrum
Salzburg /Mozarteum zusammen. Vereint durch der Universität Salzburg, ohne deren Fachwissen
den Wunsch, das Museum in seiner zivilge- und Engagement der Sprachkurs nicht in einer
sellschaftlichen Verpflichtung gegenüber allen solchen Qualität hätte realisiert werden können.
BürgerInnen zu denken und sein Handeln in die-
ser Hinsicht zu analysieren, war schnell die Pro- Die Dauerausstellung „Erzähl mir Salzburg!“, ein
jektidee geboren. „Sag es einfach. Sag es laut. Teil der Landesausstellung, war Erhebungsort der
Leichte Sprache als Schlüssel zum Museum“ empirischen Studie wie auch Veranstaltungsort
6des Sprachkurses. Die Ausstellung war ein ide- Evaluation der Ausstellungstexte in Leichter
aler Ort insofern, als sie nicht nur Texte in Leich- Sprache folgt eine inhaltliche Erweiterung mit
ter Sprache und eine reiche Kulturgeschichte den Erfahrungen aus einer Eye-Tracking-Studie
anbot, sondern selbst die Mittel der Geschichts- von Christian Flandera, Mattia Rainoldi und
darstellung und der Museumserzählungen the- Mario Jooss. Zu „Deutsch im Museum“ brin-
matisierte. Der entsprechend entwickelte Kurs gen Theresa Bogensperger, Denis Weger und
„Erzähl mir Salzburg – Deutsch im Museum“ Margareta Strasser theoretische Überlegungen
verband sprachliches wie geschichtliches Ler- und zeigen praktische Umsetzungen auf. Maria
nen in einem kulturreflexiven Prozess. Studie- Gruber und Manuel Magenau geben in einer
rende des Schwerpunkts Wissenschaft & Kunst Bild-Text-Collage Stimmen aus dem Sprachkurs
begleiteten sowohl Studie als auch Sprachkurs wieder. Interviews mit Christiane Maaß und
und trugen so ebenso zu einer Reflexion des Hannes Schweiger kontextualisieren die Bemü-
Arbeitsprozesses bei. hungen von Leichte Sprache und Deutsch im
Museum in einem größeren Forschungskontext.
Das vorliegende Handbuch möchte in die- Die Arbeitsblätter von „Erzähl mir Salzburg –
sem Sinne weniger das Projekt dokumentie- Deutsch im Museum“ im Extra-Beiheft können
ren, als vielmehr detaillierte Einblicke geben unter einer Creative Commons Lizenz frei
und über gemachte Erkenntnisse zum Wei- genützt werden. Auf diese Weise kann und soll
terdenken und Weitermachen anregen. Auf das Pilotprojekt „Sag es einfach. Sag es laut.“
unsere Darstellungen zur Einführung und der weitere Kreise ziehen.
7EIN PRAXISBERICHT
AUS DEM
SALZBURG MUSEUM
Nadja Al Masri-Gutternig
ABSTRACT
B
arrierefreiheit bildet die Basis für die Gleich-
stellung von Menschen. Das Behinderten-
gleichstellungsgesetz, das seit 2006 in Kraft
ist, fordert sicherzustellen, dass jeder Mensch
gleichberechtigt am Leben der Gesellschaft
teilnehmen kann und jede Art von Diskriminie-
rung vermieden wird. Den Museen stehen also
ganz konkrete Forderungen gegenüber, die sie
zu erfüllen haben. In den Museen hat sich in
den letzten Jahren auch viel getan. Es wurden
Angebote für blinde und sehbehinderte Men-
schen und für Menschen mit einer Hörbeein-
trächtigung geschaffen und natürlich bauliche
Barrierefreiheit hergestellt. Weniger bekannt
und selten umgesetzt ist aber, das Prinzip der
Leichten Sprache als Mittel um Barrierefrei-
heit zu schaffen. Der folgenden Beitrag be-
schreibt die Geschichte und die Erfahrungen,
die das Salzburg Museum mit der Einführung
der Leichten Sprache gemacht hat. Welche
Haltung, welche Motivation steht hinter der Ver-
wendung der Leichten Sprache? Welche Hür-
de kann Sprache sein und wen kann sie „behin-
dern“? Was ist eigentlich Leichte Sprache und
welche Dinge muss man beachten, wenn man
Leichte Sprache anbieten möchte?
Abb. 1: Ausstellungsansicht „Erzähl mir Salzburg!”
9INKLUSIVE back der ExpertInnen und Betroffenen widerspie-
BESTREBUNGEN gelte. Als Gründe dafür wurden die Pionierarbeit
bei der Bereitstellung von Ausstellungstexten,
IM MUSEUM die gleichwertig und parallel zu den bisherigen
Texten in Leichter Sprache angeboten werden,
A
ls im Jahre 2009 durch die UN-Konvention sowie die Erstellung einer eigenen barrierefreien
das Recht auf kulturelle Teilhabe zum Homepage in Leichter Sprache hervorgehoben.
Menschenrecht erklärt wurde, kommen auch
in der Museumlandschaft immer häufiger Nicht unerwähnt sollte indes bleiben, dass es
Diskussionen über das Thema „Inklusion“ auf. im Vorfeld auch etliche Bedenken gab und allen
Während BefürworterInnen die Vorteile inklu- Beteiligten klar war, dass dieses Unterfangen
siver Museen preisen, befürchten KritikerIn- einen ersten Versuch darstellte – auch im Be-
nen eine Trivialisierung. Fakt ist: Es geht hier wusstsein, dass dieses erste Projekt noch nicht
nicht nur um eine neue Museums-Zielgruppe, die Perfektion darstellen würde. Das Museum
vielmehr geht es um einen gesetzlichen und wagte diesen Schritt und ging das Risiko be-
menschenrechtlichen Auftrag. Dieser Auftrag wusst ein, schließlich ist es besser beim Lernen
wird aktuell von unserem Haus, dem Salzburg Fehler zu machen als nichts zu tun.
Museum, aus Überzeugung ernst genommen
und in bestmöglicher Qualität umgesetzt. Aus
diesem Grund hat das Salzburg Museum als RÜCKBLICK
eines der ersten Museen in Österreich bei der
Landesaustellung 2016 „Bischof. Kaiser. Jeder-
B
mann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich“ die arrierefreiheit spielte im Salzburg Museum
Bereitstellung von Ausstellungstexten in Leichter in den letzten zehn Jahren eine sehr große
Sprache zusätzlich zu den üblichen Texten Rolle. Auch wenn schon davor ein gewisses
realisiert. Dieses Novum war die logische Bewusstsein für dieses Thema im Museum
Konsequenz des in den Jahren zuvor systema- vorhanden war, nahm man sich seit damals
tisch erfolgten Ausbaus der kommunikativen vor, verstärkt an dem Abbau von Barrieren zu
Barrierefreiheit im Salzburg Museum. Der Lern- arbeiten und so neue Zugänge zum Museum
prozess der Jahre 2014 und 2015 bezüglich zu schaffen. Einen kräftigen Anstoß gab das
barrierefreier Kommunikation sowie die vielen Behindertengleichstellungsgesetz, das mit
kleinen Schritte und Interventionen im Vorfeld 1. Jänner 2006 in Österreich in Kraft getreten
haben es letztendlich ermöglicht, die Texte war. Dieses verpflichtet dazu, den Zugang zu
gleichberechtigt und inklusiv zu den üblichen kulturellen Einrichtungen für Menschen mit Beein-
Ausstellungstexten im Museum anzubieten. trächtigung zu verbessern und ihre Teilnahme an
kulturellen Aktivitäten zu fördern. Nicht weniger
Mit diesem Schritt konnte die Zugänglichkeit ausschlaggebend war, das Bedürfnis des Salz-
des Museums für sehr viele Menschen erleich- burg Museum, all seinen BesucherInnen Ange-
tert werden. 2016 erhielt das Museum als bote zu bieten, die es ihnen ermöglichen, das
Honorierung rund um seine inklusiven Bemü- Museum in all seinen Facetten zu erleben. Hier-
hungen den „Österreichischen Inklusionspreis für müssen sichtbare und nicht sichtbare Barrie-
2016“ verliehen, welcher das positive Feed- ren abgebaut werden.
10KEIN zung oft am Unwissen der Verantwortlichen
über Bedürfnisse, Methoden und Hilfsmittel.
MINDERHEITSTHEMA!
Ihnen ist häufig nicht bewusst, für wen was
eine Barriere ist und wie oder wodurch diese
D
as Salzburg Museum hat schnell erkannt, zu beseitigen ist2. Zu kompliziert und facet-
dass Barrierefreiheit kein Minderheiten- tenreich präsentiert sich der Themenkom-
thema darstellt, sondern vielmehr auch Men- plex, zu unterschiedlich und widersprechend
schen ohne Behinderung von einer barrierefrei- sind die Bedürfnisse der Einzelnen. Die
en Umgebung profitieren. Hilfestellungen, die Heterogenität der Gruppe von Menschen
für Menschen mit Behinderung erforderlich sind, mit Behinderungen und die daraus resultie-
sind oftmals auch für Menschen ohne Behinde- renden behinderungsspezifischen Barrieren
rung von großem Nutzen. Schwer zu öffnende erschweren eine Adaptierung. Diese Erkennt-
Türen, klein gedruckte Texte, schlecht ausgeleuch- nis darf jedoch nicht zur Resignation verleiten,
tete Räume, fehlende Orientierungshilfen und sondern zwingt lediglich dazu, das barriere-
mangelnde Sitzgelegenheiten stellen für viele freie Museum neu zu definieren. Barrierefrei-
Menschen ein Hindernis dar. Zum Beispiel wird es Museum kann nichts anderes bedeuten als
auch die Gruppe der alten Menschen von den einen Ort zu schaffen, an dem allen Besucher-
oben beschriebenen Barrieren behindert. Wenn Innen das gleiche Interesse entgegengebracht
man dies vor dem Hintergrund der demografi- wird und keine Gruppe wesentlich benach-
schen Entwicklung unserer Gesellschaft sieht, so teiligt wird. Essentiell ist es, sich dem Thema
gewinnt diese Feststellung an Wert1. Ebenso zu öffnen und grundsätzlich alle potenziellen
verhält es sich bei Verwendung von Texten in BesucherInnen mit ihren jeweiligen spezifischen
Leichter Sprache für Menschen mit einer Lernbe- Bedürfnissen willkommen zu heißen und an der
hinderung. Sie bieten Kindern oder Menschen Umsetzung ihrer Forderung zu arbeiten3.
mit schlechten Sprachkenntnissen ebenso Hilfe-
stellung wie Menschen mit Lernschwierigkeiten Hierzu ist es nötig, sich intensiv mit den je-
oder gehörlosen Menschen. weiligen Gruppen auseinanderzusetzen, ihre
Ansprüche und Neigungen, ihre Begabun-
gen und ihre Bedingungen zu erkennen und
aus diesem Wissen heraus Angebote zu ent-
MANGELNDES
wickeln, welche für sie nutzbar sind. Sich zu
WISSEN öffnen heißt aber auch, sich Fragen zu stellen:
Was braucht die einzelne Person, um in das
W
ie zuvor beschrieben gibt es eine Museum zu kommen? Wie erschließt sie sich
gesetzliche Verpflichtung, Barriere- den Inhalt und welche Angebote braucht sie
freiheit herzustellen und sehr oft den Wunsch dazu? Welche Sinne sollte man ansprechen
von Museen, Barrieren abzubauen. Dennoch und welche Informationen müssen in welcher
existieren noch heute etliche Barrieren, die für Form bereitgestellt werden? Welche Dinge las-
Personen mit Handycap oftmals nur schwer zu sen sich schnell und leicht umsetzen? Welche
überwinden sind. Häufig ist die mangelnde Personen benötigen zusätzliche Qualifikatio-
Barrierefreiheit aber nicht Zeichen fehlender nen und Ressourcen? Welche Dinge sind die
Zustimmung, vielmehr scheitert die Umset- dringlichsten und erlauben keinen Aufschub?
11KOOPERATIONEN mobile Barrierefreiheit hergestellt werden. Auch
Angebote für blinde oder sehbeeinträchtigte
UND INTERAKTIONEN
Menschen und Angebote in Gebärdensprache
gab es zu jenem Zeitpunkt schon regelmäßig
U
m all diese Fragen beantworten zu können im Salzburg Museum. Angebote für Menschen
und um sich die verschiedenen Bedürfnisse mit Lernschwierigkeiten, wie zum Beispiel Leich-
bewusst zu machen, ist es am besten, sich mit te Sprache und ein umfassendes Konzept zur
den ExpertInnen – nämlich den Betroffenen Barrierefreiheit für das Museum steckten damals
selbst und deren Verbänden und Organisati- aber noch in den Kinderschuhen. Aus diesem
onen – darüber auszutauschen, welche Maß- Grund formulierte das Museum in den folgen-
nahmen am besten geeignet sind, um mögliche den Jahren Ziele, um auch in diesem Bereich
Barrieren abzubauen und den Bedürfnissen seine Barrierefreiheit bestmöglich auszubauen.
angepasste Angebote zu schaffen. So hat das
Salzburg Museum in den letzten Jahren seine
Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutio-
nen und Organisationen, wie zum Beispiel der
ZIELE
Lebenshilfe oder dem Verband für Blinde und
Sehbehinderte Menschen und natürlich vielen • Dem Thema Barrierefreiheit im Museum
mehr stetig ausgebaut. So konnte man innerhalb noch mehr Beachtung als bisher und somit
des Museumsteams wichtiges Wissen um Be- mehr Wertigkeit zukommen zu lassen und
dürfnisse und Möglichkeiten zur Barrierefreiheit diese Haltung des Salzburg Museum auch
gewinnen. Wichtig war dem Museum hierbei nach außen hin sichtbar zu machen.
auch immer, die verschiedenen Personen von
Beginn an in die Entwicklung miteinzubeziehen • Das Thema Barrierefreiheit bei allen Berei-
und frei nach dem Grundsatz der UN-Behinder- chen im Museum schon von Anfang an mit-
tenrechtskonventionen „Nichts ohne uns über zudenken. Bei jeder Ausstellung, bei jeder
uns“ gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Mit Projektplanung, bei der Erstellung von Inter-
all dem gesammelten Wissen konnten wir uns netauftritten, bei jeder Neugestaltung muss
auf den Weg machen, Schritt für Schritt Barriere von Beginn an der Aspekt der Barrierefrei-
für Barriere abbauen und die Angebote so aus- heit und Inklusion mitgedacht und bestmög-
bauen, dass das Museum von möglichst vielen lich miteinbezogen werden.
sinnvoll erlebt werden kann.
• Ressourcen und speziell geschultes Personal
für dieses Vorhaben bereitzustellen und lang-
fristig zu sichern.
BARRIEREN IM KOPF –
BARRIERE SPRACHE • Sich Wissen zum Thema Barrierefreiheit in
ausreichendem Umfang aneignen.
S
chon 2006 konnte im Zuge des Umzugs
des Salzburg Museum in die Neue Resi- • Neue Kooperationen aufzubauen und beste-
denz und die damit verbundene Adaptierung hende Kooperationen auszubauen, die zur
des Gebäudes eine größtmögliche bauliche/ Verbesserung der Barrierefreiheit beitragen.
12• Barrierenabbau durch Sensibilisierung und Grund spezifischer Anwendungskontexte nur
Überzeugungsarbeit voran zu treiben. bedingt sinnvoll. Die Barriere der Sprache wird
daher oft nicht erkannt oder als nicht wichtig
• Schulung und Sensibilisierung zum Thema gewertet. Bedenkt man jedoch, wie wichtig
für die eigenen MitarbeiterInnen. und essentiell Sprache für jeden einzelnen ist,
sei es, um sich auszudrücken oder um sich
• Als eines der dringlichsten Ziele hat das Informationen zu beschaffen, so lässt sich zu-
Salzburg Museum die Einführung und mindest erahnen, welche Barrieren kompli-
vielschichtige Umsetzung von kommunika- zierte Texte für Menschen darstellen können.
tiver Barrierefreiheit in Angriff genommen.
Der Fokus wurde auf den Abbau der Bar-
riere, die eine zu komplizierte und kom-
SPRACHE ALS SCHLÜSSEL
plexe Sprache mit sich bringt, gelegt. Um
ZU INFORMATION,
diese Arbeit effektiv voranzutreiben, war
viel Sensibilisierungs- und Überzeugungs-
GESELLSCHAFT & KULTUR
arbeit nötig.
D
ie Fachwelt ist sich einig, dass Lesen
ein Schlüssel zu unserem kulturellen und
!
wissenschaftlichen Erbe, und die Fähigkeit
NACHVOLL-
des Lesens für die persönliche Entwicklung
ZIEHBARKEIT des Einzelnen von großer Bedeutung ist. Die
Fähigkeit des Lesens erhöht die Lebensquali-
D
as Besondere bei der Barriere Sprache ist, tät und vermittelt Selbstvertrauen. Durch Lesen
dass sie für Nichtbetroffene sehr schwierig kann man seinen Horizont erweitern und seine
nachzuempfinden ist. Sehr schnell kann man Gedanken, Ideen und Erfahrungen austau-
zum Beispiel Menschen von der Notwendig- schen und sich weiterentwickeln. Des Weiteren
keit einer breiten Tür oder eines stufenlosen eröffnet Lesen den Zugang zu Kunst und Kultur
Aufgangs überzeugen, wenn man sie selbst und erlaubt so auch eine kulturelle Teilhabe.
die Erfahrung machen lässt, mit dem Rollstuhl Nicht zu vergessen ist der demokratische
ein Hindernis überwinden zu müssen. Ebenso Aspekt, der durch die Fähigkeit des Lesens
erkennen Menschen die Notwendigkeit von gestärkt wird, da Demokratie gut informierte Bür-
Leitsystemen, wenn sie mit einer Brille, die Blind- gerInnen braucht. So ist es für jeden Menschen
heit simuliert, durch ein Gebäude geschickt wichtig, einen Zugang zu Informationen, die
werden. Schwieriger nachzuempfinden ist, da er nützen kann, zu haben, um selbstständige
schlecht simulierbar, welche Barriere Sprache Entscheidungen für sich treffen zu können4.
sein kann. Es gibt keine Methode, die einen
nachempfinden lässt, was es heißt, durch die Konsequent gedacht heißt das im Gegenzug,
eigene Sprache ausgeschlossen zu sein. Me- dass kompliziert geschriebene Texte Menschen
thoden zur Sensibilisierung, die etwa darin bei der Beschaffung von Informationen, die für
bestehen, höchst komplizierte Gebrauchsan- sie äußerst relevant wären, „behindern“. Bestes
leitungen oder Texte in Fremdsprachen zu An- Beispiel hierzu sind kompliziert geschriebene
schauungszwecken heranzuziehen, sind auf Beipackzettel zu Medikamenten.
13Ein kompliziert geschriebener Ausstellungstext aus dem Jahr 2011 hervor, die das unterste
im Museum führt möglicherweise dazu, dass Kompetenzniveau des Lesens und Schreibens
Menschen Informationen fehlen, die ihnen die untersucht hat. Grundlage dieser Studie ist eine
Ausstellung erschließen würden. Wenn Men- Zufallsauswahl von in Deutschland lebenden
schen Informationen fehlen, fühlen sie sich sehr erwerbstätigen Personen im Alter von 18 bis
oft nicht angesprochen, überfordert und verlie- 64 Jahren. Aus der Studie geht hervor, dass
ren so das Interesse an der Ausstellung. Sie wer- nur ein halbes Prozent der erwachsenen er-
den so das Museum als einen Ort empfinden, werbstätigen Bevölkerung die Wortebene beim
der sie durch fehlende Information ausschließt Lesen und Schreiben nicht erreicht. Weitere 3,9
und sie nicht teilhaben lässt. Prozent erreichen nicht die Satzebene. 10 Pro-
zent kann mit kurzen Sätzen umgehen scheitert
aber an Texten. Darüber hinaus gibt es weite-
re 25 Prozent deren Schriftsprache auch bei
WER IST BETROFFEN?
gebräuchlichem Wortschatz fehlerhaft ist. Dies
ergibt in Summe 40,4 Prozent der erwachsenen
S
ehr oft begegnet man der Annahme, dass erwerbstätigen Bevölkerung, die große Probleme
jene Menschen, für die Sprache eine Barri- beim Lesen und Schreiben hat. Typisch Betroffe-
ere ist, eine Minderheit darstellen. Wenn man ne vermeiden das Lesen und Schreiben häufig.5
sich aber Studien zu diesem Thema ansieht,
erkennt man schnell, dass es sich bei einer Interessant ist es in diesem Zusammenhang natür-
Schreib- und Leseschwäche keineswegs um ein lich, dem gegenüberzustellen, wie viele Texte,
Minderheitenthema handelt, sondern dass ein denen man im Alltag begegnet, auf einem
großer Teil der Bevölkerung davon betroffen dieser unteren Sprachniveaus geschrieben
ist. Dies geht zum Beispiel aus der „leo. – level sind, man denke nur an Briefe von Ämtern, an
One Survey Studie” der Universität Hamburg Antragsformulare oder Gesetzestexte.
Alpha Level Anteil der erwachsenen Anteil
LITERALITÄT
α Bevölkerung (hochgerechnet)
Analphabetismus α1 0,6 % 0,3 Mio.
Funktionaler α2 3,9 % 2,0 Mio.
Analphabetismus α3 10,0 % 5,2 Mio.
Zwischensumme
14,5 % 7,5 Mio.
(funktionaler) Analphabetismus
Fehlerhaftes Schreiben α4 25,9 % 13,3 Mio
40,4 % 20,8 Mio
Tabelle Funktionaler Analphabetismus und fehlerhaftes Schreiben. Quelle: leo. Level One Studie
14ANGEBOTE
SCHAFFEN
I
n Museen sind häufig komplexe und kom-
plizierte Texte zu lesen, die ein großes Vor-
wissen voraussetzen und auf ein sehr museums-
affines Publikum zugeschnitten sind. Mit dem
Wissen um diese große Zahl an Menschen,
die beim Erfassen des Inhalts der üblichen
Ausstellungstexte überfordert ist, galt es in
Museen Mittel und Wege zu finden, neue
Angebote zu schaffen, die ein Erschließen
und Erleben der Ausstellung für Betroffene
möglich machte.
Abb. 2: Besucher in der Ausstellung
URSPRUNG
LEICHTE SPRACHE
D
ie Idee und der Anstoß zur Entwicklung stehen, worum es genau geht und was von
der Leichten Sprache kam selbst von ihnen gefordert wird. Dieser gleichberechtig-
Menschen mit Beeinträchtigung. Sie schlossen te Zugang zu Informationen ist wichtig, sonst
sich zusammen, um an einer Verbesserung bleibt die Selbstbestimmtheit auf der Strecke.
ihrer Lage zu arbeiten, also sich für mehr Ein wichtiger Teil dieser „People-First-Bewe-
Barrierefreiheit einzusetzen. Die Selbstver- gung“ war also das Konzept der Leichten
tretungs-Bewegung „People First“ formierte Sprache, mit dem Ziel, Regeln auszuarbei-
sich um 1974 in den USA und in Schwe- ten, um Standardsprache strukturiert in eine
den und erhob die Forderung, Menschen leicht verständliche Sprache zu übertragen,
mit Behinderung für sich selbst sprechen zu sodass auch Menschen mit Lernschwierigkei-
lassen. Zusätzlich forderte sie Informationen ten selbstständig am gesellschaftlichen Leben
für Menschen mit Behinderung so bereitzustel- teilhaben können. Schnell verbreitete sich die
len, dass diese von ihnen auch selbstständig Idee auch im deutschsprachigen Raum. Mitt-
erfasst werden können. Das bedeutet etwa, lerweile gibt es weltweit viele Organisationen
dass Briefe von Ämtern, wichtige Dokumen- und Institutionen, die sich für die Entwicklung
te und viele andere Texte, die Menschen mit und Verbreitung der Leichten Sprache einset-
Beeinträchtigung zur Informationsbeschaffung zen und verschiedene Angebote wie Überset-
brauchen, so formuliert sind, dass sie ver- zungen oder Textprüfungen anbieten.
15LEICHTE SPRACHE –
WAS IST DAS? GRAMMATIK,
RECHTSCHREIBUNG &
SATZAUFBAU
L
eichte Sprache ist eine speziell (jedoch
B
nicht einheitlich) geregelte sprachliche ei Texten in Leichter Sprache schreibt
Ausdrucksform, deren Hauptkriterium man – um hier nur die wichtigsten Regeln
leichte Verständlichkeit ist. Folglich ist es zu erwähnen – nur kurze Sätze und tätigt nur
eine sehr klare und einfache Sprache. eine Aussage pro Satz. Nebensätze sollten,
Diese Reduktion der Sprache erlaubt wenn möglich, weggelassen werden. Man
aber nicht ein Weglassen von wichtigen nutzt kurze, einfache, treffende und bekannte
Informationen. Anspruch der Leichten Wörter. Auch sollte man immer das gleiche
Sprache ist nicht, Inhalte in ihrem Sinn- Wort für ein und denselben Begriff verwenden
zusammenhang zu verkürzen, sondern (etwa nicht einmal Auto, dann Wagen und
den vollständigen Inhalt in einfacheren dann Fahrzeug schreiben). Es sollten Verben
Worten zu erläutern. Da hierfür in der verwendet und im Aktiv geschrieben werden.
Regel mehr Erklärungen notwendig sind, Zum Beispiel: Ich gehe morgen angeln. Statt:
verlängert sich der Text in Leichter Spra- Morgen werde ich beim Angeln sein. Man soll-
che in den meisten Fällen. Sofern man te Fremdwörter, Redewendungen, Metaphern
von der Zeichenanzahl her begrenzt ist, und den Konjunktiv vermeiden. Es wird so for-
wie dies bei Ausstellungstexten häufig muliert, dass relativ wenig Vorwissen nötig ist,
der Fall ist, kann dies zu Verknappun- um den Inhalt erfassen zu können6.
gen und Reduktion auf das Wesentliche
führen. Zu hoffen wäre, dass in den
nächsten Jahren durch die stetige Wei-
terentwicklung der Leichten Sprache und
TEXTGESTALTUNG
N
durch die Einführung neuer Techniken eben Grammatik und Rechtschreibung ist
hier Lösungen gefunden werden. Für die vor allen die grafische Textgestaltung bei
Erstellung von Texten gelten spezielle der Erstellung von Texten in Leichter Sprache
Regeln. Typisch für Leichte Sprache ist wichtig. Dazu gehören Schriftgröße und Schrift--
ein systematisch reduzierter Satzbau und art, Zeilenabstand und Schriftausrichtung. Tex-
die Beschränkung auf einfache Wörter. te in Leichter Sprache sind sehr klar strukturiert
Texte, die in diesem Stil geschrieben und durch viele Absätze und Überschriften
sind, werden oft als „unschön“ empfun- leichter lesbar. Die Texte sind außerdem links-
den und ÄsthetInnen warnen vor einem bündig geschrieben. Jeder neue Satz beginnt
Verlust der „schönen“ Sprache. Aber in einer neuen Zeile. Für eine gute Lesbarkeit
Leichte Sprache möchte nicht in erster Li- ist auch die Schriftart (ohne Serifen) und der
nie „schön“ sein. Sie möchte verstanden Kontrast des Gedruckten zum Hintergrund ent-
werden. Dies sollte keineswegs heißen, scheidend. Hier eignet sich besonders schwar-
dass nicht versucht wird, “schön“ zu ze Schrift auf hellem Hintergrund, der einfarbig
formulieren. Im Vordergrund steht aber und nicht gemustert sein sollte7.
immer die Verständlichkeit.
16Abb. 3: Deutschkurs im Museum/Gottfried-Salzmann-Saal
TEXTPRÜFUNG –
ZERTIFIZIERUNGEN
D
ies sind einige Richtlinien, die man gemeint, sondern auch effektiv und für das ange-
beachten sollte, wenn man Texte in Leichter sprochene Publikum nutzbar sind. Dies ist der
Sprache verfasst. Jedoch gibt es keine genauen Fall, wenn die geprüften Texte ohne fremde Hilfe
einheitlichen Bestimmungen, wie Leichte Spra- gelesen und verstanden werden können. Falls
che zu sein hat. Verschiedene Organisationen dabei noch Unklarheiten bestehen, wird dar-
haben zwar Kriterienkataloge und Richtlinien aufhin nachgebessert und erneut geprüft. Wenn
ausgearbeitet, aber es gibt noch keine europa- Texte diese Prüfung durch Kontrollgruppen
weit einheitlichen Regelungen. Wichtig und bestehen, können sie zertifiziert werden. Es gibt
äußerst sinnvoll für die Sicherstellung der Qualität verschiedene Zertifikate und Gütesiegel, die
der Texte ist auf jeden Fall die Prüfung der Texte durch verschiedene Symbole gekennzeichnet
durch betroffene Menschen. Es gibt eigens sind. Das Salzburg Museum hat sich hier für das
geschulte Menschen, die in Prüfgruppen, den Gütesiegel „Leicht Lesen“ von capito entschie-
sogenannten Kontrollgruppen, die Texte auf ihre den. Dieses garantiert, dass die Capito-Qualitäts-
Verständlichkeit und Lesbarkeit prüfen und so Standard eingehalten werden. Das Gütesiegel
dafür garantieren, dass die Texte nicht nur gut gibt es in drei Stufen: A1, A2 und B1.
17SPRACHNIVEAUS
C2 praktisch
alles
D
ie Texte werden je nach AdressatInnen breites Spektrum
auf verschiedenen Sprachniveaus von A1 C1 auch komplexer
Sachinhalte
bis B1 verfasst. Diese Sprachniveaus richten
sich nach den Sprachniveaustufen des Ge- B2 komplexe Texte, abstrakte
Inhalte, Fachtexte
meinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprache, der in der folgenden Tabelle veran- B1 kurze Texte,
klare Standardsprache
schaulicht wird.
A2 einzelne Sätze, häufig verwendete
Ausdrücke, vertraute Themen
Abb. 4: Stufenmodell Sprachniveaus
des GERS nach capito
A1 einfache, kurze Sätze, vertraute Wörter,
langsam und deutlich Sprechen
EINFÜHRUNG DER LEICHTEN SPRACHE
IM SALZBURG MUSEUM
...
W
ie oben beschrieben, hat sich das • Ressourcen und Fachpersonal zur Verwirklich-
Salzburg Museum vor vielen Jahren ung von Barrierefreiheit sind gesichert und wer-
dazu entschieden, Barrierefreiheit so gut wie den bei der Budgeterstellung berücksichtigt.
möglich umzusetzen und sich einem größeren
Publikum zu öffnen. Seither ist viel Zeit vergan- • Fachwissen zum Thema wurde gesammelt.
gen, und entscheidende Entwicklungen haben
stattgefunden, die nun anhand von sichtbaren • Neue und bestehende Kooperationen wur-
Ergebnissen zu erkennen sind: den ausgebaut.
• Die Auszeichnung mit dem Österreichischen • Durch Veranstaltungen im Salzburg Museum
Inklusionspreis lässt erkennen, dass das Ziel, (z.B. organisierte Vernetzungstreffen mit Mit-
dem Thema Barrierefreiheit und Inklusion arbeiterInnen anderer Museen) konnte viel zur
eine hohe Wertigkeit im Salzburg Museum Sensibilisierung und zur öffentlichen Verbrei-
zu geben und unserer Haltung zu diesen tung dieses Themas beigetragen werden.
Thema nach außen hin sichtbar zu machen,
erreicht wurde. • Durch interne Schulungen und Sensibilisie-
rung zum Thema konnten die MitarbeiterIn-
• Die Idee der Barrierefreiheit wird im nen des Hauses besser auf ihre Aufgaben
ganzen Haus nun von Beginn an mit- vorbereitet werden.
gedacht, was sich zum Beispiel im Heran-
ziehen von ExpertInnen in frühen Planungs- All diese erreichten Ziele haben die Idee der
phasen von Projekten und Ausstellungen Leichten Sprache im Salzburg Museum auf
äußert. einen sehr fruchtbaren Boden fallen lassen.
18einer noch so „museumsfremden Sprache“
ERSTE
leicht dem Hohn und Spott vor allem von
SCHRITTE jenen, die das Konzept der Leichten Spra-
che nicht kennen, aussetzen könnte. Manche
N
ach ersten Führungen in Leichter Sprache empfanden die Texte als „nicht schön formu-
war sehr schnell klar, dass man dieses liert“. Aber wie schon oben gesagt, Leichte
Angebot noch ausbauen möchte. Es entstand Sprache muss nicht „schön“ sein. Sie soll
ein erster gedruckter Folder in Leichter Spra- verstanden werden. Aus heutiger Sicht kann
che, der über die barrierefreien Angebote in jedem Fall gesagt werden, dass sich die
des Salzburg Museum informierte und so Anwendung der Leichten Sprache im Salz-
Menschen mit Beeinträchtigung die Möglich- burg Museum sehr bewährt hat.
keit gab, selbst ein Angebot zu wählen. Der
nächste Schritt war, ein Angebot zu schaffen, Bei der Umsetzung der Vision in die Tat, die
das es den Menschen ermöglicht, das Mu- Texte prominent und gleichwertig zu anderen
seum und seine Ausstellungen selbstständig, Texten in der Ausstellung zu präsentieren, war
also ohne Führung, zu erobern. Gelegenheit es sehr hilfreich, dass die Idee sowohl von
bot sich auch sehr schnell, da 2016 die Salz- der Leitung des Museums als auch von allen
burger Landesausstellung „Bischof. Kaiser. beteiligten MitarbeiterInnen stets mit Über-
Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Öster- zeugung getragen wurde. So wurde an der
reich“ im Salzburg Museum stattfand. Pädagogischen Hochschule Salzburg eine
Lehrveranstaltung zum Thema Leichte Spra-
Anfangs gab es den Plan, zu allen drei Aus- che konzipiert, in deren Rahmen die Texte
stellungsteilen der Landesausstellung einen für die Landesausstellung entstehen sollten.
Folder in Leichter Sprache zu gestalten. Diese Als zusätzliche professionelle Unterstützung
Folder sollten entweder bei der Kasse erhält- wurde capito Oberösterreich mit der Kon-
lich sein oder im Ausstellungsbereich bereitlie- zeption und Abhaltung der Lehrveranstaltung
gen. In Kooperation mit der Pädagogischen betraut. So wurde im Laufe des Semesters an
Hochschule Salzburg kam man aber zu dem der Übersetzung der Raumtexte zur Landes-
Schluss, dass dem inklusiven Gedanken bes- ausstellung gearbeitet.
ser Rechnung getragen wird, wenn man die
Texte in Leichter Sprache gleichwertig und pa- Im Zuge der Erarbeitung der Übersetzungen
rallel zu den sonst üblichen Ausstellungstexten der Texte stellte sich bald heraus, dass es sehr
direkt als Raumtexte bereitstellt. Natürlich gab schwierig ist, nur anhand von Texten und ohne
es hierzu auch viele kritische Stimmen, die umfangreiches Hintergrundwissen zur Thema-
befürchteten, dass es durch den Einsatz der tik der Ausstellung akzeptable und inhaltlich
Leichten Sprache zu einer Trivialisierung kom- korrekte Texte zu erstellen. Hier ist es sehr rat-
men würde. Man fürchtete, dass so komplexe sam, sich von Beginn an ein paar grundsätz-
Themen, wie sie bei der Landesausstellung liche Fragen zu stellen. So ist es z.B. wichtig,
vorkommen, nicht einfach zu erklären wären. im Vorfeld zu klären, ob man Texte überset-
Die Reduktion und Unvollständigkeit der zen lässt oder ob man Konzepte bereitstellt,
Texte wurde kritisiert. Außerdem gab man zu an Hand derer die Texte in Leichter Spra-
Bedenken, dass man sich durch den Einsatz che entstehen können. Auch geklärt werden
19sollte, ob man die Erstellung der Texte außer im ständigen Austausch mit den KuratorInnen
Haus in die Hand von Profis gibt oder ob die Richtigkeit der Inhalte zu kontrollieren.
man nur die Textprüfung extern vergibt. Das
Museum hat die Erfahrung gemacht, dass Also wurde bei der Erstellung der Texte zur
sich die Qualität der Texte in Leichter Spra- Landesausstellung immer wieder rückgekop-
che wesentlich erhöht, wenn Profis mit viel pelt und korrigiert, um so im regen Austausch
Erfahrung und Übung die Texte schreiben. Es der drei Institutionen (Museum/Pädagogische
verlangt nämlich, entgegen der weit verbrei- Hochschule/Capito) ein befriedigendes Er-
teten Meinung, sehr viel Können, Wissen, gebnis zu erzielen. Capito Oberösterreich hat
Erfahrung und Fingerspitzengefühl, Texte in alle Texte zusätzlich noch einmal sprachlich
Leichter Sprache schreiben zu können. Bei überarbeitet und im Anschluss mit Kontrollgrup-
dieser Vorgehensweise ist aber zu beachten, pen eine Textprüfung durchgeführt. So konnte
Abb. 5: Blick auf eine der Texttafeln in der Ausstellung
20das Salzburg Museum mit Unterstützung von so viel in Bewegung gekommen ist, wie die-
capito Öberösterreich und der Pädagogi- ses Projekt, der Sprachkurs und der rege Aus-
schen Hochschule Salzburg rechtzeitig zur tausch mit anderen Institutionen zeigen, freut
Eröffnung der Landesausstellung die geprüf- uns natürlich. Leichte Sprache ist im Salzburg
ten und zertifizierten Texte in Leichter Sprache Museum seit diesem Zeitpunkt Standard und
realisieren. wird in allen Ausstellungen angeboten.
Stolz präsentierte man das Novum bei der
Eröffnung und freute sich über das durchwegs
positive Echo von BesucherInnen, Medien,
Fachleuten und KollegInnen. Dass seit der
Einführung der Leichten Sprache im Museum
Anmerkungen
Folker Metzger: Barrierefreiheit und Besucherfreundlichkeit. Neue Anforderungen an die Koordination zwi-
1
schen Kurator, Gestalter und Pädagogen. In: Heike Kirchhoff und Martin Schmidt (Hrsg.): Das magische
Dreieck. Die Museumsausstellung als Zusammenspiel von Kuratoren, Museumspädagogen und Gestaltern.
Bielefeld 2007, S. 131–133.
Rüdiger Leidner: Die Begriffe „Barrierefreiheit“, „Zugänglichkeit“ und „Nutzbarkeit“ im Fokus. In: Patrick Föhl,
2
Stefanie Erdrich, Hartmut Jhon und Karin Maaß (Hrsg.): Das barrierefreie Museum. Theorie und Praxis einer
besseren Zugänglichkeit. Ein Handbuch. Bielefeld 2007, S. 29.
P. Föhl u.a. (Anm. 2), S. 10.
3
Bror Tronbacke: Richtlinien für easy-reader material. Den Haag 1999.
4
Wibke Riekmann und Anke Grotlüschen: leo.-Level-One Studie. Universität Hamburg, Hamburg. Online verfüg-
5
bar unter http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo (letzter Zugriff: 10.8.2017)
Christiane Maaß: Leichte Sprache. Das Regelbuch. Berlin 2015, S. 32–58.
6
C. Maaß (Anm. 6), S. 32–58.
7
Literatur
Patrick Föhl, Stefanie Erdrich, Hartmut Jhon und Karin Maaß (Hrsg.): Das barrierefreie Museum. Theorie und
Praxis einer besseren Zugänglichkeit. Ein Handbuch. Bielefeld 2007.
Wibke Riekmann und Anke Grotlüschen: leo.-Level-One Studie. Universität Hamburg, Hamburg. Online verfüg-
bar unter http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo (letzter Zugriff: 10.8.2017).
Rüdiger Leidner: Die Begriffe „Barrierefreiheit“, „Zugänglichkeit“ und „Nutzbarkeit“ im Fokus. In: Patrick Föhl,
Stefanie Erdrich, Hartmut Jhon und Karin Maaß (Hrsg.): Das barrierefreie Museum. Theorie und Praxis einer
besseren Zugänglichkeit. Ein Handbuch. Bielefeld 2007, S. 29.
Christiane Maaß: Leichte Sprache. Das Regelbuch. Berlin 2015.
Volker Metzger:,„Barrierefreiheit und Besucherfreundlichkeit. Neue Anforderungen an die Koordination zwischen
Kurator, Gestalter und Pädagogen. In: Heike Kirchhoff und Martin Schmidt (Hrsg.): Das magische Dreieck. Die
Museumsausstellung als Zusammenspiel von Kuratoren, Museumspädagogen und Gestaltern. Bielefeld 2007.
Bror Tronbacke: Richtlinien für Easy-Reader Material. Internationaler Verband der bibliothekarischen Vereine und
Institutionen. Den Haag 1999.
21EINE DOPPELTE DISKURSANALYSE
WAS IN LEICHTER
SPRACHE UND ÜBER
LEICHTE SPRACHE
IM MUSEUM (NICHT)
GESAGT WIRD
Luise Reitstätter
Ü
ber Sprache im Museum lässt sich streiten.
Texte ja, Texte nein, wie viel, wie verständ-
lich und wohin? Je nach Museumspartner und
hausinterner Tradition sind Texte im Museum
mehr oder weniger gebräuchlich. Je nach
Angebot und BesucherInnenpräferenz werden
diese mehr oder weniger genutzt. Ob Texte
vorhanden sind, wie diese gestaltet und auch
konsumiert werden können, markiert eine spe-
zifische museologische Haltung, wenn nicht
sogar eine Weltsicht. Doch was passiert, wenn
Texte im Museum nicht mehr durchgehend den
gewohnten bildungssprachlichen Standards
entspricht und auch in Leichter Sprache ange-
boten wird? Eine doppelte Diskursanalyse zur
Ausstellung „Erzähl mir Salzburg!“ gibt zum
einen Aufschluss darüber, welche Erzählfor-
men mit der Leichten Sprache im Vergleich zu
regulären Raumtexten gepflegt werden. Zum
anderen wird jenen Statements Raum gege-
ben, die die Einführung von Leichter Sprache
im Museum kommentieren und die Nutzung
in der Ausstellung kontextualisieren. Analog
einer diskursanalytischen Analyse fokussiert die
Untersuchung auch das „Nicht-Gesagte“, um
der Bedeutung von Betonungen sowie Leerstellen
in den Diskursen in Leichter Sprache und über
Leichte Sprache im Museum beizukommen.
Abb. 1: Ausstellungsansicht „Erzähl mir Salzburg!"
23DISKURSIVE EINE METHODEN-
ZUSAMMENHÄNGE KOMBINATION
F I
olgt man dem Theoretiker Michel Foucault, n der Evaluation der Leichten Sprache im Salz-
bedeutet Diskurs sowohl das Gesagte wie burg Museum kam eine Methodenkombination
auch das Nicht-Gesagte: All das, was zum von hermeneutischer Textanalyse, teilnehmen-
Sprechen bewegt, was verbalisiert wird, aber der Beobachtung und BesucherInnenbefragung
auch das, was zwischen den Zeilen steht oder zum Einsatz. Mit Triangulation, wie dieses
verschwiegen wird1. Damit sind bei dieser Un- vergleichende methodische Vorgehen auch ge-
tersuchung jene diskursiven Ebenen von Leich- nannt wird, ist jedoch nicht nur die Verknüpfung
ter Sprache im Blick, die sich deutlich zeigen, von Methoden, sondern ganz allgemein die
wie auch jene, die erst durch Deutung sichtbar vergleichende Betrachtung eines Gegenstandes
werden2. Diese verschiedenen Schichten von aus unterschiedlichen Perspektiven für die Beant-
Sprache zeigen sich auch hinsichtlich ihrer wortung von Forschungsfragen gemeint5. Im Fall
Verständlichkeit. Sprache kann als Tor zur Welt der Leichten Sprache im Salzburg Museum galt
ebenso empfunden werden wie als Wand, es, mehr zu Angebot, Nutzung und Reaktion
wenn verschiedenste Informationsbarrieren auf auf die Leichte Sprache herauszufinden. Denn:
der Wahrnehmungs-, Erfassungs-, Erfahrungs- Wem kommen Texte in Leichter Sprache im Mu-
und Wissensebene bestehen. Leichte Sprache, seum zugute? Wer liest sie? Wie informativ sind
entstanden aus einer Empowerment-Bewegung sie wirklich? Tragen sie zur Sinnstiftung außer-
von Menschen mit Lernschwierigkeiten, kann halb eines bildungsbürgerlichen Habitus bei?
hier eine Schlüsselfunktion im verstehenden Oder führen sie eben gerade zu Distinktionspro-
Kommunikationsprozess erfüllen, indem sie zessen zwischen BesucherInnengruppen?
Menschen den autonomen Zugang zu Infor-
mation ermöglicht3. Im Museum ist der Einsatz Die Methode der Textanalyse nahm vorerst die
von Leichter Sprache mit dem Ziel kommuni- regulären Raumtexte und jene in Leichter Spra-
kativer „Barrierefreiheit“ verbunden. Zu den che, denen die BesucherInnen in der Ausstel-
vielfach vorgeschriebenen und auch bereits lung begegnen, als analytische Ausgangsbasis
institutionalisierten baulichen Adaptierungen für in den Blick. Als Artefakte der Ausstellung sind
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen diese Raumtexte, etwa im Gegensatz zu Inter-
kommen kommunikative Angebote, die sich views, ohne Einflussnahme von Forschenden
speziell an Menschen mit Lern-, oder wie bei entstanden und dienten so als authentische Zeu-
Leichter Sprache, auch konkreten Leseschwie- gen institutioneller Entscheidungen. Über die
rigkeiten richten. Leichte Sprache und das teilnehmende Beobachtung ließ sich hingegen
Museum sind im Zusammenspiel bislang noch ein allgemeiner Eindruck vom Setting der Aus-
eher eine Seltenheit. Neben relativ wenigen stellung „Erzähl mir Salzburg!“ und der darin
Praxisbeispielen finden sich auch wenige Pub- stattfindenden Rezeptionsprozesse mit dem Fo-
likationen4. Doch was macht Leichte Sprache kus auf das Leseverhalten gewinnen. Während
mit dem Museum? die teilnehmende Beobachtung also Handlungs-
muster der BesucherInnen verortete, erhob die
Befragung anstelle von Handlungen ihre Erzäh-
24lungen zum Ausstellungsbesuch und bezog sich Texte in Leichter Sprache zur Landesausstel-
dabei auf ihre subjektiven Deutungen. Neben lung als jene Projektergebnisse zu betrachten,
Erzählungen zum individuellen Textnutzungsver- die aus einem ersten Umgang des Salzburg
halten, sammelte die BesucherInnenbefragung Museum (in Kooperation mit der Pädagogi-
so vor allem persönliche Meinungen zur Leichten schen Hochschule Salzburg und capito Oberös-
Sprache. Textanalyse, teilnehmende Beobach- terreich) mit dieser neuen Textsorte entstammen.
tung und BesucherInnenbefragung nahmen also
jeweils spezifische Phänomene der Einführung
der Leichten Sprache im Salzburg Museum von
Angebot über Nutzung und Reaktion durch ihre
methodischen Besonderheiten in den Blick.
Während ich nun im ersten Teil meiner empi-
rischen Analyse über die Methode der herme-
neutischen Textanalyse auf textinterne Diskurse
im Vergleich der Leichten Sprache mit den regu-
lären Ausstellungstexten eingehe, folge ich im
Abb. 2: Installationsansicht „Erzähl mir Salzburg!“
zweiten Teil den Diskursen über Leichte Sprache
im Museum, die ich mittels der BesucherInnen- Seither bestimmt ein kontinuierliches Anpassen
befragung erhoben habe. Mit dem Fokus auf und Verfeinern den Einsatz von Leichter Sprache
Diskurse tritt die teilnehmende Beobachtung als im Salzburg Museum, wie auch die Arbeit im
Methode in den Hintergrund, wenngleich sie Leichte Sprache-Universum per se. Nach dem
wertvolles Hintergrundwissen zum Wesen der Vorliegen eines konkreten Regelwerks und einer
Ausstellung und seiner Nutzung lieferte6. linguistischen Einordnung liegt etwa der Fokus
der Forschungsstelle Leichte Sprache der Univer-
sität Hildesheim zum einen auf der empirischen
Evaluation hinsichtlich Verständlichkeit und zum
EIN ÜBERSETZUNGS-
anderen auf einer Differenzierung der Regeln
PROZESS für spezifische Textsorten und ihre Kontexte8.
Betrachtet man die regulären Raumtexte von
L
eichte Sprache stellt eine Varietät der deut- „Erzähl mir Salzburg!“, fällt auf, dass diese
schen Sprache dar. Im Gegensatz zur einfa- analog zum Titel der Ausstellung verschiedene
chen Sprache bestimmt ein genaues Regelwerk, Erzählungen zur 200-jährigen Geschichte
wie Leichte Sprache hinsichtlich Wort- und Satz- Salzburgs bei Österreich mit darüber hinaus-
bau geformt, aber auch optisch beschaffen gehenden historischen und geografischen
sein muss. In der Ausstellung „Erzähl mir Salz- Bezugnahmen eröffnen. Von den römischen
burg!“ sind die Texte in Leichter Sprache links Ausgrabungen bis zur zeitgenössischen künst-
neben den regulären Raumtexten an der Wand lerischen Arbeit reichen die zwölf themati-
angebracht. Den BesucherInnen werden parallel schen Setzungen der Ausstellung. Neben den
zwei Textebenen geboten, die sich als Paneele inhaltlichen Fokussierungen präsentieren sich
überlappend ergänzen7. Wie im Text von Nadja die Mittel der Geschichtsdarstellung als zent-
Al Masri-Gutternig nachzulesen ist, sind diese rale kuratorische und auch textlich vermittelte
25Abb. 3: Blick in den Ausstellungsbereich mit Texttafeln
Ebene. In der Ausstellung werden etwa mit den folgenden Raumtexten jedoch nicht in der
Sagen auf Geschichte(n) zwischen „historischen gleichen Ausprägung wieder. Anstatt fokussiert
Fakten und ihrer fantasievollen Wiederspiege- das „Wie“ von Geschichtserzählungen mit zu
lung in einer ortsbezogene Sagenwelt“ verwie- thematisieren, wird stärker auf das faktische
sen, mit dem Medium der Fotografie „Geschichte „Was“ von Geschichte referenziert. Dies ent-
erstmals im Bild fassbar gemacht“ oder „die spricht der Logik und Notwendigkeit von Leich-
Brüche zwischen einer Salzburger Identität und ter Sprache, die als textliches Hilfsmittel keine
ihrer literarischen Beleuchtung“ thematisiert. Fragen aufwerfen darf, sondern Orientierung
Damit demonstriert die Ausstellung ihre „Über- geben soll11. Die Übersetzung des regulären
zeugung, dass jede Zeit Geschichte neu erzäh- Ausstellungstexts in Leichte Sprache hat dem-
len und bisherige Überlieferungen auch hinter- nach immer mit einer inhaltlichen Divergenz um-
fragen muss“9 mit ihren eigenen dramaturgi- zugehen, die in der Ausstellung „Erzähl mir Salz-
schen Mitteln. burg!“ mit recht freien Übersetzungen auch in
Distanz zum Ursprungstext gelöst wurde12. Die
Diese Tendenz der regulären Ausstellungstexte Übersetzungsleistung in Leichte Sprache bringt
auch im Sinne der geteilten Autorenschaft von eine veränderte Ausrichtung des Textes mit sich.
zwölf KuratorInnen, die Art der Erzählung mitzu-
thematisieren, findet sich in den Übersetzungen Im zweiten Raum der Ausstellung „Erzähl mir
in Leichter Sprache auch im Einleitungstext10, in Salzburg!“ etwa folgt auf die Ursprungserzäh-
26lung durch Sagen und Bergbau eine kulturhis-
torische Verortung über archäologische Funde.
Geht es beim regulären Raumtext noch darum,
die Auswahl der Fundstücke über die mit ihnen
verbundenen Geschichten von „ihrer Entde-
ckung, ihrem Weg in eine Museumssammlung“
oder „einer neuen Untersuchungsmethode“ zu
argumentieren, liest sich der Raumtext in Leich-
ter Sprache wie eine Einführung zur Geschichte
Abb. 5: Installationsansicht „Erzähl mir Salzburg!“
„Bilder von Helene von Taussig und Albert
Birkle“ und die „Nachbarschaft des Museums
zu den Orten der Ausstellung „Entartete Kunst“
im Festspielhaus und der Bücherverbrennung
auf dem Residenzplatz 1938“. Der Text in
Leichter Sprache erzählt vorerst eine allgemei-
ne Geschichte des Nationalsozialismus von
„wertvollen“ und „nicht wertvollen“ Menschen,
um dieses Klassifizierungsschema im zweiten
Abb. 4: Installationsansicht „Erzähl mir Salzburg!“
Schritt auf Kunst zu übertragen. Stehen im regu-
der römischen Siedlungen in Salzburg. Artefakt- lären Ausstellungstext noch Individualbiografien
geschichten werden zu einer konkreten Wis- von Helene von Taussig und Albert Birkle im
sensvermittlung, wenn die Fundstücke zeigen, Fokus, findet sich im Leichte Sprache Text eine
„wie es früher in Salzburg war“ und „wie die typologische Deutung.
Römer gelebt haben“. Im fünften Raum wird
die Geschichte Salzburgs über sein eigenes Leichte Sprache zeigt sich damit als eine neue
Museum, das heutige Salzburg Museum, er- Sprachform mit stilistischen Spezifika. Statt
zählt. Während sich die personelle Erzählung komplexe(re) Darstellungen mit Details stehen
mit dem Sammler Vinzenz Maria Süss und der Vereinfachung und Überblick im Vordergrund.
Kaiserin-Witwe Caroline Auguste als Schirm- Statt Darstellungen mit interpretativer Offen-
herrin deckt, bleibt das Zitat zur historischen heit überwiegen faktische Darstellungen und
Museums- und Sammlungspolitik, wo „fremd- geschlossene Deutungsschemata. Denn auch
artige Artikel ... gänzlich ausgeschlossen“ wenn die Leichte Sprache ebenso auf lingu-
waren, außen vor. Die Leichte Sprache bleibt istische und fachliche Korrektheit besteht, sind
hier stattdessen bei der reinen Aufzählung der Veränderungen durch andere inhaltliche Ge-
Objektgattungen „Bilder - Geld - Waffen - Pflan- wichtungen, notwendige Erläuterungen oder
zen - Bücher“. Im achten Raum zu Salzburg auch Weglassungen auf Grund ihrer Hilfsfunk-
und dem Nationalsozialismus referenziert der tion nicht nur zulässig, sondern auch notwen-
reguläre Ausstellungstext wiederum zwei „bio- dig13. Zudem gelten Limitierungen nicht allein
grafische und räumliche Konstellationen“ durch für das Leichte Sprache-System, sondern viel-
27mehr für eine jede linguistische Varietät, wenn vom klaren und strukturierten Textaufbau ließe
etwa im Gegenzug gerade die deutsche Wis- sich von Leichter Sprache lernen. So heißt es
senschaftssprache an unverständlicher Verklau- bei der Gegenüberstellung der Rezeptionsge-
sulierung, vielfachen Nominalkonstruktionen, schichte von Wolfgang Amadé Mozart und
kompliziertem Satzbau oder einfach an ihrer Johann Michael Haydn: „Ein Reisebericht ist
Geschlossenheit für ein ganz spezifisches von Franz Schubert. Er hat viel über Haydn
Publikum krankt14. Leichte Sprache hingegen geschrieben und wenig über Mozart./Der
versucht mit ihren Formulierungen für den 2. Reisebericht ist vom Ehepaar Novello. Sie
Großteil der Bevölkerung, unabhängig von haben Mozart verehrt. Im Reisebericht steht viel
unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzun- über ihn“. Reisebericht bleibt Reisebericht und
gen, verständlich zu sein. Somit ist es interes- viel versus wenig schafft Klarheit über inhaltli-
che Präferenzen. Weiters machen Beispiele in
Leichter Sprache Abstraktes anschaulich und
Vages begreifbar. Salzburger Utopien der Zwi-
schenkriegszeit werden so konkret zu „großen
Pläne[n], die nicht umgesetzt worden sind“.
Während in einem Absatz vom geplanten Fest-
spiel-Haus in Hellbrunn die Conclusio „Es ist nie
gebaut worden“ zu lesen ist, steht als weiteres
Beispiel „Der Wassermann“ mit dem zeitlichen
Resümee: „Die Künstlergruppe hat es nur kurz
gegeben“. Diese Gegenüberstellung, die im
regulären Raumtext und auch in der Präsentati-
Abb. 6: Installationsansicht „Erzähl mir Salzburg!“
on selbst nicht so eindeutig nachvollziehbar ist,
sant festzustellen, doch im Grunde auch nicht wird in Leichter Sprache zu einem hilfreichen
verwunderlich, dass jene Mittel, die Leichte Informationsgeleit.
Sprache zur Steigerung ihrer Verständlichkeit
benützt, sich auch in Regeln und Anleitun-
gen für gutes und anschauliches Schreiben
wiederfinden15.
Auch diese Qualitäten der Leichten Spra-
che finden sich in den Texten der Ausstellung
„Erzähl mir Salzburg!“, wenn diese beispielswei-
se Inhalte pointieren anstatt einfach zu paraphra-
sieren. Im sechsten Raum, der die Zeitschnitte
von 1866 bis 1961 fotografisch beleuchtet,
heißt es in Leichter Sprache: „Heute zeigen die
Abb. 7: Installationsansicht „Erzähl mir Salzburg!“
Fotos von damals, wie sich Salzburg verändert
hat“. Der Satz liest sich wie eine Essenz, die
dennoch die kuratorische Intention dieser rei-
chen Bildersammlung zu verstehen gibt. Auch
28Sie können auch lesen