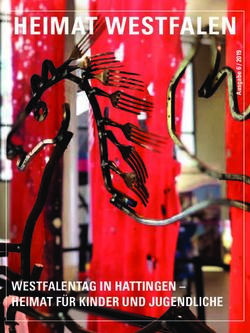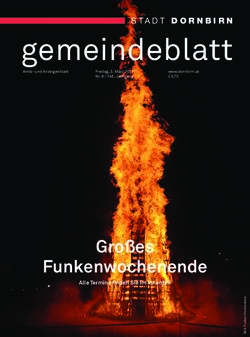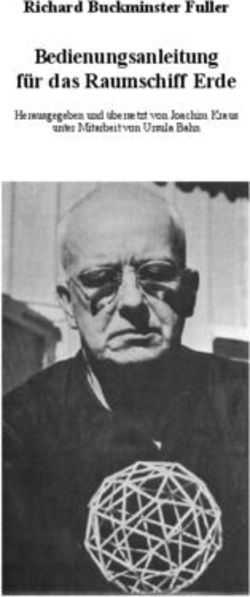Dokumentation Gesundheitskonferenz 2016 Verantwortung der Kommune im Präventionsgesetz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
G es un
n.
d
n d le be
a u f ac
w
su e n. G e
hs
Dokumentation
Gesundheitskonferenz 2016
Verantwortung der Kommune im PräventionsgesetzWorkshop Sucht im Alter -Beachtung geschlech- terspezifischer Unterschiede Moderation: Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah, Gleichstellungsbeauftragte für Mann und Frau Sucht im Alter: Bestandsanalyse und Ergebnisse im Workshop Anja Maatz, Koordination Suchthilfe / Suchtprävention, Gesundheitsamt Dresden 36
Landeshauptstadt Dresden Gesundheitsamt WHO-Projekt „Gesunde Städte“ Dokumentation Gesundheitskonferenz 2016 Verantwortung der Kommune im Präventionsgesetz
Inhalt Einleitung 4 Grußwort der Beigeordneten für Soziales Dr. Kristin Klaudia Kaufmann 6 Grußwort des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz Dr. Reinhild Benterbusch 8 Das Präventionsgesetz - Welche Chancen hat es für die Gesellschaft? ...aus der Perspektive des Deutschen Städtetages Anne Janz 10 ...aus der Perspektive der Gesetzlichen Krankenversicherung Heiko Kotte 13 Stand zur Umsetzung des Präventionsgesetzes in Hamburg Klaus-Peter Stender 15 Kommunales Lern- und Handlungsfeld Migration und Gesundheit Dr. Hans Wolter 17 Workshop Zwei Gruppen - ein Ziel: Förderung der Mundgesundheit im Kindesalter und bei älteren Menschen 19 Förderung der Mundgesundheit im Kindesalter Dr. Ursula Schütte 19 Die Bedeutung der Mundgesundheit im Alter insbesondere bei Pflegebedürftigen Martin Riegels 22 Ergebnisse des Workshops 24 Workshop Mobilitätsentwicklung und Gesundheit: Welche Ansätze sind möglich? 26 Aktive Mobilität in Städten: Trends, Motivationsfaktoren und Handlungsmöglichkeiten Prof. Dr.-Ing. Regine Gerike 26 Der Dresdner Verkehrsentwicklungsplan 2025plus im Spiegel der Gesundheitskonferenz 2016 in Dresden Dr. Matthias Mohaupt 28 Ergebnisse des Workshops 30 Workshop Migration und Gesundheit - strukturelle Ansätze für Dresden 31 Gesundheitsversorgung von Geflüchteten in Dresden – Angebotsüberblick und Notwendigkeit des Modellprojektes „Flüchtlingsambulanz“ Katja Lindner 31 Das Konzept zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund der Landeshauptstadt Dresden und das Handlungsfeld Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung Frank Bauer 33 Ergebnisse des Workshops 35 Workshop Sucht im Alter -Beachtung geschlechterspezifischer Unterschiede Sucht im Alter: Bestandsanalyse und Ergebnisse im Workshop Anja Maatz 36
Workshop Frühe Hilfen und Kinderschutz im Gesundheitswesen: Status Quo 39
Vorstellung des Netzwerkes „Kinderschutz und Frühe Hilfen“ in Dresden
Anja Krebs, Claudia Friedrich 39
Frühe Gesundheitshilfen - Familienhebammen und Familienkinderkrankenschwestern des Gesundheitsamtes
in Dresden
Ramona Blümel 41
Medizinischer Kinderschutz in Dresden als Teil eines sachsenweiten Verstetigungsprojektes
Frauke Schwier, Juliane Krüger, Dr. Anja Zschieschang 43
Ergebnisse des Workshops 46
Verabschiedung und Dank
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann 48
3Einleitung
Die vorliegende Broschüre dokumentiert die Gesundheitskon- Die soziale Lage der Dresdner Bevölkerung lässt sich wie
ferenz vom 2. Dezember 2016. Es werden die Plenumsbeiträ- folgt beschreiben:
ge sowie die Referate in den einzelnen Workshops beschrie- In Dresden lag 2013 die Zahl der sozialversicherungs-
ben und zentrale Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. pflichtigen Beschäftigten bei über 258 000 Personen.
Der Trend zur Verringerung der Arbeitslosenzahlen hält
Grundlage der Gesundheitskonferenz bildet das im Dezember in Dresden an.
2016 erschienene Stadtgesundheitsprofil. Zur Herausgabe des Vor allem ältere Menschen sind von Arbeitslosigkeit
Stadtgesundheitsprofils sowie zur Durchführung der Gesund- betroffen. Der Anteil junger Arbeitsloser unter 25 Jahren
heitskonferenz hat sich die Landeshauptstadt Dresden im ist in den letzten Jahren gesunken.
Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Europäischen Netzwerk „Ge- Der Anteil von Leistungsempfängern nach SGB II ist in
sunde Städte“ der Weltgesundheitsorganisation sowie im den Ortsämtern Altstadt, Pieschen, Prohlis und
Netzwerk „Gesunde Städte“ der Bundesrepublik Deutschland Cotta/westliche Ortschaften überdurchschnittlich hoch.
verpflichtet. Dies ist auch mit entsprechenden Stadtratsbe- Beinahe jedes sechste Dresdner Kind erhielt 2013 Leis-
schlüssen hinterlegt. Das Stadtgesundheitsprofil ist ein umfas- tungen nach SGB II.
sender Gesundheitsbericht, welcher einzelne Faktoren be- Haushalte mit Kind(ern) sowie Personen der Altersgruppe
schreibt, die einen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden zwischen 25 bis 60 Jahren schätzen ihre wirtschaftliche
in der Bevölkerung haben. Hierbei geht es nicht nur um das Lage zum gegenwärtigen Zeitpunkt überwiegend als gut
individuelle Gesundheitsverhalten, sondern auch um die bis sehr gut ein.
Bedingungen, die zur Gesunderhaltung beitragen. So werden Die Zufriedenheit mit der Wohnung, der Wohngegend
die soziale Lage, Wohn- und Lebensbedingungen ebenso und der Stadt wird sehr hoch beurteilt, wobei Differen-
beschrieben, wie die medizinische Versorgung, individuelles zen zwischen den Stadträumen bestehen. Als Beeinträch-
Verhalten oder auch die Verbreitung von Erkrankungen in der tigungen in der Wohnumgebung wurden von Haushalten
Bevölkerung. mit Kind(ern) sowie von Personen der Altersgruppe zwi-
schen 25 und 60 Jahren Lärm, Unfallrisiken im Verkehr
Zentrale Ergebnisse des Stadtgesundheitsprofils sind folgen- und mangelndes Parkraumangebot wahrgenommen.
de: Rund 60 Prozent fühlen sich von Hundekot in ihrer
Wohnumgebung beeinträchtigt.
Dresden ist eine wachsende Stadt aufgrund eines positi- Dresden wird überwiegend als kinderfreundlich wahrge-
ven Wanderungssaldos sowie anhaltend hoher Gebur- nommen. Bemängelt werden von Haushalten mit
tenraten. Kind(ern) teilweise die fehlenden Kinderspielplätze.
Der subjektive Gesundheitszustand sowie individuelles Die Abteilung Kinder- und Jugendgesundheit des
Wohlbefinden wird überwiegend als „gut“ bewertet. Mit Gesundheitsamtes untersucht regelmäßig den Gesund-
steigendem Alter nehmen das subjektive Wohlbefinden heitszustand der Kinder in Kindertagesstätten, zur Schul-
und der subjektive Gesundheitszustand ab. Zu beobach- aufnahme sowie in der 2. und 6. Klasse.
ten ist, dass in der Einschätzung der eigenen Gesundheit In den Untersuchungen werden mit dem
und des Wohlbefindens erhebliche Unterschiede zwi- Screeningverfahren Auffälligkeiten im Gesundheitszu-
schen den Stadträumen bestehen. stand ermittelt. Dabei ist für die Interpretation der Er-
Die häufigsten Gründe für eine stationäre Behandlung gebnisse wichtig zu wissen, dass „Auffälligkeiten“ nicht
sind in vielen Fällen im mittleren Lebensalter psychische gleichzusetzen sind mit einer fachärztlichen Diagnose
und Verhaltensstörungen aufgrund von Alkoholkonsums bzw. mit einem Krankeitswert. Ergebnisse belegen, dass
sowie Krebserkrankungen. Im fortgeschrittenen Alter reichlich 20 Prozent der Kinder Auffälligkeiten beim Seh-
nehmen vor allem Herz-Kreislauferkrankungen zu. test zeigen. Die Untersuchungsergebnisse beim Hörtest
Die medizinische Versorgung ist sichergestellt und wird liegen unter bzw. um 10 Prozent bei den einzelnen Al-
auch als zufriedenstellend eingeschätzt. Der Versor- tersklassen. Die 4-Jährigen sind nahezu unauffällig, was
gungsgrad bei Haus- und Fachärzten liegt in Dresden je- deren Fein- und Grobmotorik anbelangt. Bei drei von vier
weils bei über 100 Prozent. Eine besonders hohe Versor- Kindern konnten zur Schulaufnahmeuntersuchung keine
gungsquote liegt dabei im Fachbereich Kinderheilkunde auffälligen Befunde der Körperkoordination festgestellt
sowie für die Innere Medizin vor. 2013 führten die werden. Der Anteil an Sprachentwicklungsauffälligkeiten
Dresdner Krankenhäuser 3 651 Betten, welche zu 82,2 bei den Dresdner Einschüler/-innen blieb in den Schuljah-
Prozent ausgelastet wurden. Versorgt wurden die Kran- ren 2010/11 bis 2013/14 mit rund 30 Prozent nahezu
ken durch 7 511 Ärztinnen und Ärzte sowie durch 16 788 konstant.
Pflegefachkräfte. Bei stetig steigenden Fallzahlen ist eine In Dresden nimmt der Anteil von übergewichtigen sowie
personelle Zunahme besonders bei den Ärzten ersicht- adipösen Kindern mit dem Alter zu und unterliegt dabei
lich. Im Pflegebereich ist die Zunahme vergleichsweise schuljährlichen Schwankungen.
gering. Im Verlauf der letzten vier Untersuchungszeiträume
(Schuljahr 2011/12 bis 2014/15) wiesen gut 90 Prozent
der 3-jährigen untersuchten Kinder ein naturgesundes
Milchgebiss auf. Bei den 6-Jährigen hatten circa 66 Pro-
zent naturgesunde Zähne. Bei den 12-Jährigen waren im
Durchschnitt 75 Prozent ohne jegliche Karieserfahrung.
Menschen der Generation 55 Plus nutzen vorrangig
Spazierengehen, Nordic Walking oder Gartenarbeit als
körperliche Aktivität.
Zudem engagieren sich ältere Menschen ehrenamtlich im
Sportbereich. Für ältere Menschen sind Frei- und Hallen-
bäder sowie Sportanlagen ähnlich wichtig wie für jüngere
Altersgruppen, da bestehen nur geringfügige Unterschie-
de.
Viele Bürgerinnen und Bürger von Dresden engagieren
sich im Ehrenamt. Am stärksten engagiert sich die Grup-
pe der 65- bis 74-Jährigen. Ein Fünftel dieser Altersgrup-
pe übernimmt regelmäßig ehrenamtliche Aufgaben, wo-
bei dies vor allem Tätigkeiten im sozialen bzw. gesund-
heitlichen Bereich sind.
Das vollständige Stadtgesundheitsprofil kann im Internet
unter www.dresden.de/who heruntergeladen werden.
In Abstimmung mit dem Beirat „Gesunde Städte“ der Landes-
hauptstadt Dresden wurden die Schwerpunkte für die
Gesundheitskonferenz festgelegt. Neben dem Thema „Migra-
tion und Gesundheit“, wurden die Themen Mundgesundheit,
Mobilität und Sucht sowie Frühe Hilfen behandelt. In den
einzelnen Workshops wurde hierzu diskutiert und weitere
Schritte bzw. Handlungserfordernisse eruiert.
In den folgenden Kapiteln sind die Redebeiträge und Kurzfas-
sungen der Veranstaltung aufgeführt. Für die Inhalte der
Beiträge sind die Autor/-innen verantwortlich.
Die Broschüre ist auch elektronisch unter
www.dresden.de/who abrufbar.
5Grußwort
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann
Beigeordnete für Soziales Foto: Marlén Mieth
Sehr geehrte Damen und Herren, Fokus. Schließlich ist unsere Stadt in demografischer Hinsicht
liebe Dresdnerinnen und Dresdner, eine äußerst dynamische Stadt:
verehrte Gäste,
Dresden wächst.
wir tun es an Geburtstagen, wir tun es an kalten Tagen, wir
tun es in der Straßenbahn, in der Werkstatt und im Büro, wir Seit der letzten Gesundheitskonferenz vor drei Jahren sind
tun es bei jungen und bei alten Menschen: zwischen Oberwartha und Rossendorf, zwischen Weixdorf
Gesundheit wünschen! und Lockwitz bereits 15.000 neue Dresdnerinnen und Dresd-
ner dazu gekommen.
Gesundheit ist unser wichtigstes Gut. Wie so oft im Leben
handelt es sich bei der Gesundheit um eine Ressource, die nur Wir verzeichnen anhaltend hohe Geburtenzahlen.
begrenzt vorrätig ist. Deshalb muss sie auch besonders ge- Gleichzeitig steigt die Anzahl der älteren und alten Men-
schützt und gefördert werden. schen stetig an.
Deshalb macht sich die Landeshauptstadt Dresden stark für Mit der heutigen Gesundheitskonferenz betrachten wir die
Gesundheit. Wir wollen Krankheiten vermeiden, bevor sie aktuellen Befunde nun „durch die Brille“ verschiedener Diszip-
entstehen. Bessere Prävention und Gesundheitsförderung linen und stellen sie in den Kontext der Prävention. Los geht
können frühe Todesfälle vermeiden. Deshalb treten wir ein es mit den Impulsreferaten zum „Gesetz zur Stärkung der
für gesundes Aufwachsen, gesundes Leben und gesundes Gesundheitsförderung und der Prävention“ (PrävG). Herzlich
Älterwerden. Und deshalb haben wir Sie zur Gesundheitskon- willkommen, Frau Janz und Herr Kotte.
ferenz 2016 eingeladen.
Über die Umsetzung des Präventionsgesetzes in unserer
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herz- Partnerstadt Hamburg wird Klaus-Peter Stender berichten.
lich willkommen zu unserer Fachkonferenz „Verantwortung Herzlich willkommen, Herr Stender!
der Kommune im Präventionsgesetz“. Wir haben im Tagungs-
titel die „Verantwortung“ vorangestellt. Aus gutem Grund! Die aktuelle Herausforderung durch Flucht und Migration
Denn zu wirksamer Gesundheitsförderung und zu wirksamer greift Dr. Hans Wolter auf. Er wird uns die Erfahrungen in
Prävention gehört zu allererst einmal das Bekenntnis: Ja, wir Frankfurt am Main näher bringen. Herzlich willkommen, Herr
wollen das! Und Dresden will! Wolter!
Dresden, das sind wir alle – egal, ob wir medizinische Fach- Mit diesem Wissen im Gepäck werden wir uns in den Work-
kräfte, Pflegepersonal, Patientenvertreter, Angehörige, poli- shops in fünf Lebenswelten vertiefen. Mit seiner Mitglied-
tisch Aktive, Mitarbeiter von Krankenkassen und Ämtern und schaft im Gesunde-Städte-Netzwerk der Weltgesundheitsor-
dergleichen sind. Uns alle eint das Ziel, die Gesundheit in ganisation hat sich Dresden insbesondere zu diesen Themen-
Dresden zu stärken! schwerpunkten verpflichtet:
Mit dem seit Kurzem vorliegenden Dresdner Stadtgesund- „Kindergesundheit“
heitsprofil zeigen wir selbstkritisch Bedarfe der hiesigen „Gesunde Stadtplanung“
Gesundheitsförderung auf. Es ist nur eines der Produkte, das „Förderung der körperlichen Aktivität“
wir der Mitgliedschaft im Netzwerk der Weltgesundheitsor- „Gesundes und aktives Altern“
ganisation „Gesunde Städte“ zu verdanken haben.
Diese Themen finden Sie in den Workshops wieder. Aus aktu-
Wie steht es um die Gesundheit der Dresdnerinnen und ellem Anlass widmet sich Workshop 3 ausführlich dem Thema
Dresdner? Wie steht es um ihre individuelle soziale Lage, die Migration.
Lebensbedingungen, die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld
und die Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung? Das Diese lebensweltliche Betrachtung ist mir sehr wichtig. Denn
Stadtgesundheitsprofil ist dafür ein Gradmesser. Anhand der Prävention erreicht Kinder, Jugendliche und Erwachsene am
gewonnenen Daten gilt es nun, passgenaue Maßnahmen zu besten dort, wo sie leben. Wir bitten um Verständnis: Natür-
entwickeln. lich stellen die ausgewählten fünf Lebenswelten nur einen
gewissen Ausschnitt dar. Über die Themen der diesjährigen
Seit knapp 20 Jahren geben wir Stadtgesundheitsprofile her- Gesundheitskonferenz hatten wir uns im Beirat „Gesunde
aus. Dabei haben wir immer aktuelle Herausforderungen und Städte“ verständigt. Mit den Erkenntnissen dieser kleinen
Entwicklungen aufgegriffen. Mit dem aktuellen Gesundheits- Weltreise werden wir zum Ende dieser Gesundheitskonferenz
profil rücken wir erstmals Familien und Menschen im mittle- erste Maßnahmen skizzieren.
ren Lebensalter – als bevölkerungsreichste Gruppe – in den
6Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor uns liegt ein
arbeitsreicher Tag. Ich danke allen Referentinnen und Refe-
renten und allen Helferinnen und Helfern, die im Hintergrund
zu dieser Gesundheitskonferenz beitragen.
Ein besonderer Dank geht an die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege für die finanzielle
Unterstützung. Ich wünsche uns einen diskussions- und er-
kenntnisreichen Tag.
Ich bin sehr gespannt auf die Vorschläge, die am Nachmittag
präsentiert werden.
Dr. Kristin Klaudia Kaufmann
Beigeordnete für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Wohnen
7Grußwort
Dr. Reinhild Benterbusch
Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Sehr geehrte Frau Dr. Kaufmann, Für die betriebliche Gesundheitsförderung müssen die
Frau Janz, Kassen ebenfalls 2 Euro pro Versicherten und Jahr aus-
Frau Dr. Looks, geben.
Herr Kotte, Damit verbleiben (mindestens) 3 Euro, mit denen die
Herr Stender, verhaltensbezogene Prävention gestärkt werden soll. Al-
Herr Dr. Wolter, so zum Beispiel die Teilnahme und das Angebot an Rü-
Herr Koesling, ckenschulkursen.
Ganz neu ist, dass erstmals die Pflegekassen 30 Cent pro
herzlichen Dank für die freundliche Einladung und Begrüßung. Versicherten und Jahr für Gesundheitsförderung und
Zu allererst möchte ich Herrn Abteilungsleiter Bockting ent- Prävention in teil- und vollstationären Pflegeeinrichtun-
schuldigen, der kurzfristig erkrankt ist. In Vertretung für ihn gen auszugeben haben. – So viel zu den finanziellen Re-
möchte ich das Grußwort vortragen. gelungen des Präventionsgesetzes.
Das Präventionsgesetz setzt natürlich auch an bei dem,
Ich bringe die Grüße von Frau Staatsministerin Klepsch mit – was uns „krank“ macht: Das sind definitiv Viren und Bak-
sie befindet sich heute in Schleswig-Holstein, wo sie an der terien. Nicht alle sind gefährlich, nicht gegen alle gibt es
Konferenz der Arbeits- und Sozialminister der Länder teil- Impfstoffe. Aber den Impfschutz insgesamt zu erhöhen
nimmt. Sie hat mich gebeten, sie heute zu vertreten und dies durch beispielsweise eine verbesserte Handlungsfähig-
tue ich gern. Nicht nur, weil mir das Thema „Gesundheit“ am keit der Betriebsmediziner, ist ein wichtiges Anliegen des
Herzen liegt sondern auch, weil ich auf Ihre Gedanken und Präventionsgesetzes, das seitens unseres Hauses voll und
Ideen gespannt bin. ganz mitgetragen wird.
Das Präventionsgesetz entwickelt ferner den Bereich der
Nach langjähriger Diskussion verabschiedete im Sommer 2015 Vorsorgeuntersuchungen weiter. In das bestehende
der Deutsche Bundestag das Präventionsgesetz. Dies Gesetz Format werden unter anderem präventionsorientierte
ist ein Schritt, um Gesundheitsförderung und Prävention den Aspekte einbezogen, ärztliche Präventionsempfehlungen
Stellenwert einzuräumen, den das Thema in unserer Gesell- ermöglicht und Altersgrenzen aufgehoben.
schaft braucht. Denn wir sollten uns nicht nur damit ausei- Die bisherige „kann“-Regel zur Ausschüttung von Bonus-
nandersetzen, wie Krankheiten verhütet werden können. Leistungen seitens der Krankenkasse wurde in eine
Sondern uns auch die Frage stellen, was uns langfristig gesund „soll“-Regelung geändert. Das heißt, jede Kasse ist nun
hält. verpflichtet, in ihrer Satzung Bonusleistungen für z. B. die
Teilnahme an Gesundheitsuntersuchungen vorzusehen.
Diesen Ansatz – bekannt als Salutogenese – hat Antonovsky in
den 1980er Jahren entwickelt. Er hat damit aus meiner Sicht Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Präventionsge-
eine Vision formuliert, die wahrscheinlich viele von Ihnen hier setz verpflichtet die Sozialversicherungsträger, also Kranken-,
teilen. Dresden, als Mitglied im WHO-Gesunde-Städte- Renten- und Unfallversicherungsträger zur Zusammenarbeit.
Netzwerk ist dabei, diese Vision Wirklichkeit werden zu las- Und dies nicht nur untereinander, sondern auch mit den
sen. Und – davon bin ich überzeugt – das Präventionsgesetz unterschiedlichen föderalen Ebenen: das heißt vom Bund bis
ist eine dauerhafte Grundlage dafür, auch Schritt für Schritt zum Jugend- und Gesundheitsamt in den Kommunen.
die Strukturen und Ressourcen zu stärken, die uns gesund
halten. Diese gesetzlich festgeschriebene Kooperation braucht natür-
lich Strukturen und Inhalte. Daher gibt es laut Präventionsge-
Bevor ich zu der Kernaufgabe komme, die der Bund mit dem setz jetzt eine „Nationale Präventionskonferenz“, die bereits
Präventionsgesetz den Ländern aufgegeben hat, möchte ich im Februar dieses Jahres die sogenannte „Bundesrahmen-
kurz skizzieren, wo das Präventionsgesetz darüber hinaus empfehlungen“ verabschiedet hat. Diese Empfehlungen
ansetzt: bilden zusammen mit dem 2019 erstmals vorzulegenden
„Nationalen Präventionsbericht“ die „Nationale Präventions-
Zuallererst: Mit dem Präventionsgesetz werden die ge- strategie“.
setzlichen Krankenkassen verpflichtet, ihre Ausgaben für
Prävention und Gesundheitsförderung zu erhöhen. Der Den Ländern gab der Bundesgesetzgeber auf, diesen strategi-
Ausgabenrichtwert liegt für 2016 bei mindestens 7 Euro schen Ansatz auf Landesebene abzubilden. Der Gesetzestext
pro Versicherten und Jahr. lautet an dieser Stelle, ich zitiere:
Von diesem Betrag entfallen 2 Euro auf die Gesundheits-
förderung in Lebenswelten wie zum Beispiel Kita und „Zur Umsetzung der nationalen Präventionsstrategie schlie-
Schule. ßen die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatz-
kassen, auch für die Pflegekassen, mit den Trägern der gesetz-
lichen Rentenversicherung, den Trägern der gesetzlichen
8Unfallversicherung und mit den in den Ländern zuständigen Der erste Zielbereich umfasst das „Gesund aufwachsen“
Stellen gemeinsame Rahmenvereinbarungen auf Landesebe- und erstreckt sich von der Zielgruppe der werdenden,
ne.“ jungen Familien bis zu den Auszubildenden und Studie-
renden.
Nun meine Damen und Herren, am 1. Juni dieses Jahres war Der zweite Bereich ist überschrieben mit „Gesund leben
diese Aufgabe erfüllt. Als drittes Bundesland unterzeichneten und arbeiten“ sowie der „Gesundheitsförderung von Er-
die Landesvertreter der Sozialversicherungen und Staatsmi- werbslosen“. Bei letzterem haben sich die Krankenkassen
nisterin Klepsch die Landesrahmenvereinbarung für den und die Bundesagentur für Arbeit bereits darauf verstän-
Freistaat Sachsen. Kurz darauf traten die kommunalen Spit- digt, ein erfolgreiches Modellprojekt aus dem Vogtland
zenverbände in Sachsen und die Bundesagentur für Arbeit, auf andere Standorte in Sachsen zu übertragen. Die For-
Regionaldirektion Chemnitz der Landesrahmenvereinbarung mulierung „Gesund arbeiten“ steht für den großen Be-
bei. reich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Zielgrup-
pen bilden hier insbesondere kleinere und mittlere Un-
Dem formalen Akt am 1. Juni gingen einige Verhandlungsmo- ternehmen.
nate voraus. Denn allen Beteiligten war klar: Hier entsteht Der dritte Zielbereich ist überschrieben mit „Gesund im
etwas Neues, dass bis in die verschiedenen Lebenswelten – Alter“. Ohne nun möglichen Vorhaben vorzugreifen, stellt
Kita, Schule, Kommune, Stadtteil etc. – wirken kann, wenn es die Entwicklung von Maßnahmen für teil- und vollstatio-
erstens gut gemacht ist und zweitens wenn es vom gemein- näre Pflegeeinrichtungen, die auch in diesen Bereich fal-
samen Willen der Beteiligten getragen ist. Beides kann ich für len, auf jeden Fall eine Herausforderung dar. Denn prä-
das Sozialministerium bestätigen. Und ich denke, dass Herr ventive Maßnahmen dürfen sich nicht mit anderen ge-
Kotte, der selber an der Erstellung der Rahmenvereinbarung setzlichen Leistungen überschneiden.
beteiligt war, dies bestätigen würde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, dass
Zweck der Landesvereinbarung ist es, einen inhaltlichen Rah- die Erwartungen an das Präventionsgesetz hoch sind. Und ich
men für die nächsten Jahre mit Blick auf Gesundheitsförde- möchte Sie hier auch nicht weiter vertrösten. Im Gegenteil. Es
rung und Prävention abzustecken, nicht Einzelmaßnahmen gibt zur Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung eine
aufzuführen. Die inhaltlichen Grundlagen bilden: Geschäftsstelle, angesiedelt bei der Sächsischen Landesverei-
1. die bereits erwähnten Bundesrahmenempfehlungen, nigung für Gesundheitsförderung. Diese Geschäftsstelle steht
2. regionale Erfordernisse und für Fragen – auch finanzieller Art – gern zur Verfügung.
3. Inhalte aus dem sächsischen Gesundheitszieleprozess.
Ich möchte Sie ermutigen, sich weiter für Gesundheitsförde-
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich betonen, dass wir rung und Prävention zu engagieren. Denn erstens Gesundheit
bewusst Inhalte und strukturelle Elemente der Gesundheits- geht alle an und zweitens Gesundheitsförderung und Präven-
ziele in die Landesrahmenvereinbarung überführt haben. tion leben vom Mitmachen!
Denn wir wollten mit der Umsetzung des Präventionsgesetzes
keine Struktur, keine Gremien parallel zum Gesundheitsziele- Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
prozess aufbauen, da Akteure und Zielgruppen oft identisch
sind. Ende dieses Jahres läuft daher der Gesundheitszielepro-
zess aus. Allen Gesundheitsziel-Akteuren unter Ihnen, die sich Dr. Reinhild Benterbusch
an diesem Prozess auf Landesebene beteiligt haben, an dieser Referentin
Stelle für Ihr unermüdliches Engagement mein herzlichster Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucher-
Dank. schutz
Zurück zur Landesrahmenvereinbarung: Zentraler Akteur auf
Landesebene ist das Steuerungsgremium – bestehend aus:
den Krankenkassen,
der Renten- und Unfallversicherung,
den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände,
der Regionaldirektion Chemnitz der Bundesagentur für
Arbeit,
sowie Vertretern aus den Ministerien des Innern, Kultus,
Wirtschaft und Arbeit sowie dem Gesundheitsressort.
Gesetzlicher Auftrag dieses Gremiums ist es, in Sachen
Gesundheitsförderung und Prävention zusammenzuarbeiten,
zu kooperieren. Das heißt: das Steuerungsgremium entschei-
det über gemeinsame Vorhaben, ein gemeinsames Vorgehen.
Aus meiner Sicht ist das ein hoher, sehr hoher Anspruch
angesichts vieler Einzelprojekte sowie einem Feld, das im
Grunde vom Wettbewerb geprägt ist beziehungsweise war.
Denn wir – und ich denke alle Beteiligten des Steuerungsgre-
miums sehen es genau so – sind zur Zusammenarbeit bereit!
In der Landesrahmenvereinbarung haben sich die Beteiligten
auf Zielbereiche verständigt, die ich hier nur anreißen kann.
Von der Logik her orientieren sie sich an den Lebensphasen:
9Das Präventionsgesetz –
Welche Chancen hat es für
die Gesellschaft?
...aus der Perspektive des Deutschen Städtetages
Anne Janz
Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Städtetages und
Dezernentin für Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit der Stadt Kassel
-Es gilt das gesprochene Wort- förderung und Prävention praktisch werden zu lassen.
Die Zugänge sind vor Ort bereits da.
Sehr geehrte Frau Dr. Kaufmann, Darüber hinaus wissen Kommunen im Rahmen ihrer
Sehr geehrte Frau Dr. Benterbusch, Daseinsvorsorge und Sozialstrukturdaten, wie und wo
Sehr geehrte Damen und Herren, Gesundheitsförderung in den Lebenswelten vor Ort sinn-
voll eingesetzt werden kann
ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Und sie können vor allem auch eine unabhängige Platt-
Gesundheitskonferenz und freue mich, dass Fragen nach der form für die Vernetzung der an Gesundheitsförderung
Umsetzung des Präventionsgesetzes auf kommunaler Ebene beteiligten Akteure bieten oder aber bereits existierende
und die Gesundheitsförderung in den Lebenswelten auf die- Netzwerke für das Thema Gesundheitsförderung sensibi-
ser Fachkonferenz im Mittelpunkt stehen. lisieren und gewinnen.
Der Deutsche Städtetag als kommunaler Spitzenverband hat Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass
die Genese des Präventionsgesetzes sehr intensiv politisch „Gesundheitsförderung in Lebenswelten“ systematisch, ziel-
begleitet. Dies gilt auch für das „Gesunde Städte Netzwerk“, geleitet und bedarfsangepasst geschieht. Auf kommunaler
in dem die Stadt Dresden seit 1991 aktiv mitarbeitet – im Ebene beobachten wir schon lange, dass Leistungen nach § 20
Übrigen genauso lange wie die Stadt Kassel, wo ich ja SGB V vor Ort nicht immer am Bedarf orientiert und oft auch
Gesundheitsdezernentin bin. Ich bin auch – zugegeben– ein zu wenig nachhaltig angelegt sind. Im trägerübergreifenden,
bisschen neidisch darauf, dass die Stadt Dresden es schon lebensweltorientierten Ansatz des Präventionsgesetzes sehen
geschafft hat, eine Gesundheitskonferenz zu etablieren, dies wir jetzt eine gute Chance, Maßnahmen der Gesundheitsför-
ist in Kassel bisher – auch aus Ressourcengründen – noch derung und Prävention in der Kommune konsequenter an den
nicht gelungen. tatsächlichen Bedarfen ausrichten zu können.
Aber zum Präventionsgesetz: Ganz ohne Zweifel ist das Prä- Diese Potenziale sind aber nur gemeinsam mit den Kommu-
ventionsgesetz ein wichtiger Meilenstein für die Gesundheits- nen mit ihrer genauen Kenntnis der Verhältnisse vor Ort und
förderung in Deutschland. Nicht umsonst haben sich gerade ihrer expliziten Gemeinwohlverpflichtung zu realisieren. Die
auch die Kommunen über die kommunalen Spitzenverbände Hoffnungen der Kommunen richteten sich deshalb auch im
und das Gesunde Städte Netzwerk seit Jahren für ein Präven- Hinblick auf eine bessere kommunale Koordinierung stark auf
tionsgesetz stark gemacht und sich davon viel für die Gesund- das neue Präventionsgesetz. Die kommunalen Spitzenverbän-
heitsförderung vor Ort versprochen. de hatten sich hier auch klar und deutlich positioniert und
ihre Forderungen gestellt.
Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Kommunen haben ein Interesse an systematischer Kern der Forderungen war eine angemessene und möglichst
Gesundheitsförderung und dem Aufbau von Präventions- auskömmliche Finanzierung gesundheitsfördernder Angebote
ketten, weil die Probleme und Bedarfe ungleich verteilter und Maßnahmen in den Lebenswelten vor Ort – hier gibt es
Gesundheitschancen vor allem in den Kommunen spür- durch das neue Gesetz ja auch eine deutliche Verbesserung
bar werden und wir außerdem wissen, dass Präventions- der Finanzierung der Gesundheitsförderung in Lebenswelten.
strategien vor allem dann Wirksamkeit und Nachhaltig- Eine Stärkung der Rolle der Kommunen und des Präventions-
keit entfalten, wenn sie möglichst früh ansetzen und im auftrages des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist aber nicht
Lebensumfeld der Menschen verankert sind. Und dieses im gewünschten Umfang erfolgt.
Lebensumfeld befindet sich nun einmal vor Ort – in unse-
ren Städten und Gemeinden, in unseren Kitas, in Schulen, Wir haben uns über die kommunalen Spitzenverbände lange
Sportvereinen und Familienzentren und in den Quartie- und zuletzt auch noch einmal intensiv im Rahmen des Anhö-
ren. rungsverfahrens zum Präventionsgesetz eingesetzt, den
Auf der kommunalen Ebene haben wir deshalb viele Kommunen eine koordinierende Rolle und einen eigenständi-
Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte um Gesundheits- gen Auftrag einzuräumen – diese Hoffnung bzw. die diesbe-
10züglichen Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände meinsame, abgestimmte und an den konkreten lebenswelt-
haben sich leider nicht in den gesetzlichen Vorschriften nie- spezifischen Verhältnissen ansetzende Strategie zur Förde-
dergeschlagen. rung von Gesundheit zu eröffnen.
Diesen Grundsatz moderner Gesundheitsförderung würdigt Hier können die Kommunen auf vieles zurückgreifen, das
aber die „Nationale Präventionskonferenz“ in den von ihr am bereits vor der Verabschiedung des Präventionsgesetzes vor
19. Februar 2016 beschlossenen Bundesrahmenempfehlun- Ort aufgebaut wurde und jetzt anschlussfähig für eine Finan-
gen (gemäß § 20d SGB V, PrävG). Dort heißt es, dass die all- zierung nach dem Präventionsgesetz ist. Ich nenne hier als
täglichen Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen für die Beispiele zur Orientierung die kommunalen Präventionsket-
Gesundheit von erheblicher Bedeutung sind und „(…) maß- ten, die Frühen Hilfen oder die Arbeitskreise für Jugendzahn-
geblich in den Lebenswelten der Menschen gestaltet“ wer- pflege, die ja bereits auf bewährte und verbindliche zum Teil
den. trägerübergreifende Kooperationen zurückgreifen. Und Ori-
entierung bieten auch die vielen Beispiele guter kommunaler
Zu Recht verweist die Nationale Präventionskonferenz im Praxis zur Gesundheitsförderung in Lebenswelten. Ihr Erfolg
gleichen Kontext auch auf den besonderen Stellenwert der basiert im Wesentlichen darauf, dass sie an bereits bestehen-
Kommunen was ihre andere Lebenswelten integrierende den Strukturen auf kommunaler Ebene ansetzen und zielge-
Funktion, die Zugangschancen zu unterschiedlichen Zielgrup- nau an den konkreten Bedarfen vor Ort angepasst sind. Er-
pen sowie ihre Gestaltungskompetenz als Trägerinnen ver- wähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass die
schiedener Lebenswelten betrifft. vom Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit
und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sys-
Deshalb ist es auch folgerichtig, dass in allen der drei in den tematisierten Qualitätskriterien für Gesundheitsförderung in
Bundesrahmenempfehlungen genannten Gesundheitszielen Lebenswelten bereits in 2014 Eingang in den Präventionsleit-
„Gesund aufwachsen“, „Gesund leben und arbeiten“ und faden des GKV Spitzenverbandes gefunden haben und damit
„Gesund im Alter“ die Kommunen als wichtiger Partner in der den gesetzlichen Krankenkassen als Fördervoraussetzung für
Ausgestaltung von Strategien und Maßnahmen der Gesund- die Finanzierung von qualitativ guter Gesundheitsförderung in
heitsförderung und Prävention benannt sind und entspre- den Lebenswelten dienen.
chende ressortübergreifende kommunale Strategien aus-
drücklich unterstützt werden. Auch auf überörtlicher Ebene sind Kommunen als erfahrene
Akteure in Lebenswelten bei der strategischen Planung und
Diese guten fachlichen Ansätze der Bundesrahmenempfeh- Koordinierung der Umsetzung der bundeseinheitlichen Rah-
lungen finden in einigen zentralen Punkten aber bedauerli- menempfehlungen gefragt. Dieser Planungs- und Steuerungs-
cherweise keine sinnvolle Entsprechung in der konkreten prozess steht in den meisten Bundesländern aber erst noch
Ausformulierung der Aufgabenzuschnitte der unterschiedli- am Anfang. Während in Ländern mit einer seit Jahren aktiven
chen mit ihrer Umsetzung betrauten Akteure. Auch ist es dort und partizipativ angelegten Gesundheitsförderungslandschaft
nicht gelungen, das seit Jahrzehnten zementierte sektorale das Präventionsgesetz sich quasi lückenlos in bereits vorhan-
Handeln der Sozialversicherungsträger gegenüber einem eher dene Strukturen und gewachsene Kooperationen einfügen
integrierenden, lebensweltbezogenen Ansatz durchlässiger zu lässt, gilt es in anderen Ländern erst einmal wichtige Weichen
gestalten. hin zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zu stellen, die
mehr das gemeinsame Ziel denn die Partikularinteressen
Aus kommunaler Sicht bleiben die Bundesrahmenempfehlun- unterschiedlicher staatlicher und nichtstaatlicher Akteure im
gen damit in Teilen hinter ihren vom Gesetzgeber eingeräum- Blick hat.
ten Möglichkeiten zurück. Die kommunalen Spitzenverbände
haben in einer gemeinsamen Stellungnahme als beratende Ein wichtiger Schritt in diese Richtung sollten die gemäß § 20f
Mitglieder der Nationalen Präventionskonferenz kritisiert, SGB V zu treffenden Landesrahmenvereinbarungen (LRV)
dass die geplante und später beschlossene 1:1-Zuordnung geben. Das Gesetz verpflichtet die Partner der LRV zwar dazu,
einzelner Sozialversicherungsträger zu bestimmten Aufgaben neben der Berücksichtigung der Bundesrahmenempfehlungen
und Aktivitäten der in Lebenswelten ja üblichen Durchmi- auch die „regionalen Erfordernisse“ bei der Festlegung ge-
schung gesundheitsrelevanter Einfluss- und Bedingungsfakto- meinsamer Ziele und Handlungsfelder einzubeziehen. Wenn
ren nicht angemessen Rechnung trägt. man „regional“ als Sammelbegriff für „Kleinräumigkeit“ gene-
rell versteht, dann scheint in den bisher veröffentlichten
Vorsichtig optimistisch sollte man in Anbetracht der neuen Landesrahmenvereinbarungen die o. g. Aufgabenstellung
Gestaltungsmöglichkeiten aber dennoch sein, auch wenn es bislang vor allem in den sächsischen und nordrheinwestfäli-
die lebensweltbezogene Perspektive des Präventionsgesetzes schen Vereinbarungen substanzieller verfolgt worden zu sein.
angesichts beachtlicher Beharrungstendenzen im Gesund- So etwa im Falle der Einbeziehung der Kompetenzen und
heits- und Sozialsystem noch?! nicht gerade leicht hat. Aber Potentiale des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder der
vielleicht führen gerade auch die konkreten Umsetzungs- öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe auf dem Gebiet lebens-
schritte der Gesundheitsförderung in Lebenswelten und ihre weltbezogener Gesundheitsförderung.
Stolpersteine zu einer Art „learning by doing“ bei allen Betei-
ligten und fördern ein Umdenken. Die anderen Vereinbarungen halten sich eng an die öffentlich
gemachte Mustervorlage, was nicht gerade für eine ausge-
Wir betreten hier in den neuen Kooperationen alle Neuland – prägte Innovationsfreude spricht. Aber gerade auch deshalb
und auch das Präventionsgesetz ist nicht für alle Zeiten in sind die Kommunen –als langjährige Trägerinnen von innova-
Stein gemeißelt. Deshalb sollten die Kommunen den mit dem tiven Leistungen der kommunalen Gesundheitsförderung –
Präventionsgesetz angestoßenen Prozess nun konstruktiv und ihre Spitzenverbände weiterhin gefragt, sich partner-
unterstützen und begleiten, indem sie die eigenen Entschei- schaftlich und fachlich kompetent auf kommunaler und auf
dungs- und Gestaltungsspielräume konsequent dafür nutzen, Landes- und Bundesebene für eine bürgernahe, systemati-
den unterschiedlichen Trägern, im Geiste einer guten Part- sche und trägerübergreifende Umsetzung des Präventionsge-
nerschaft, Möglichkeiten für eine mit den Kommunen ge- setzes einzusetzen.
11Die Kommunen brauchen Verbindlichkeit auf örtlicher Ebene – in Bezug auf die Zusammenarbeit und in Bezug auf Finanzie- rung gesundheitsfördernder Angebote. Die muss jetzt quasi unterhalb der neuen gesetzlichen Regelungen hergestellt werden, insbesondere auch über gemeinsame, den örtlichen Bedarfslagen angepasste gemeinsame Strategien mit dem Land und den Kassen. Eine gute Hintergrundfolie für die Kooperation mit den Kassen sind dafür auch die „Empfehlungen des GKV-Spitzenverban- des und der kommunalen Spitzenverbände zur Zusammenar- beit im Bereich Primärprävention und Gesundheitsförderung“ (2013). Es wäre schade und eine große vertane Chance, wenn das Potenzial, das die kommunale Ebene hier beisteuern kann, für die Gesundheitsförderung verschenkt wäre. Das Kunststück und die Herausforderung für die Zukunft wird es deshalb sein, die Spielräume, die das Gesetz, die Rahmenver- einbarungen und die bereits verhandelten Ankerpunkte für die Zusammenarbeit mit den Krankenkassen bieten, so zu nutzen, das sie für die Menschen, die erreicht werden sollen, vor Ort bestmöglich wirksam werden können. Unbestritten bleibt nämlich: Eine gezielte, an den tatsächli- chen Bedarfen ausgerichtete Primärprävention und Gesund- heitsförderung kann nur auf örtlicher Ebene und in einem kommunal koordinierten Rahmen erfolgreich umgesetzt werden. Auch mit den Verbesserungen durch das Präventi- onsgesetz sprudeln die Mittel für die Gesundheitsförderung nicht im Überfluss. Deshalb sollte es ein gemeinsames Ziel sein, die Ressourcen dort einzusetzen, wo sie im gemeinsa- men Interesse und gemeinsam abgestimmt auf den größten Bedarf treffen und bestmögliche Wirkung in der Primärprä- vention und zum Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten erzielen können. Anne Janz Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Deutschen Städtetages und Dezernentin für Jugend, Schule, Frauen und Gesundheit der Stadt Kassel 12
Das Präventionsgesetz –
Welche Chancen hat es für
die Gesellschaft?
...aus der Perspektive der Gesetzlichen Krankenversicherung
Heiko Kotte
Bereichsleiter Gesundheitsförderung der AOK PLUS
Das im Sommer 2015 verabschiedete Gesetz zur Stärkung der Die GKV fördert bereits mit mehr als fünf Milliarden Euro
Gesundheitsförderung und Prävention enthält aus Sicht der jährlich Leistungen zur Früherkennung, Prävention und
AOK PLUS wichtige Schritte auf dem Weg, Prävention als Gesundheitsförderung. Im Rahmen des „Leitfadens Präventi-
wesentliche Säule zur gesundheitlichen Versorgung der Be- on“ haben die Krankenkassen bereits gemeinsame Ziele und
völkerung auszubauen. bundesweit einheitliche Vorgaben für die Qualität der Leis-
tungen in den Settings sowie der individuellen Prävention
Das Gesetz ist der vierte Anlauf einer Bundesregierung zur vereinbart.
Verbesserung der gesetzlichen Regelungen des Handlungsfel-
des „Gesundheitsförderung und Prävention“ und sieht in der Die AOK PLUS hat daraus ihre Setting-Maßnahmen in den
Hauptsache die folgenden Neuregelungen vor: Betrieben, Kindertagesstätten, Schulen und Senioreneinrich-
tungen abgeleitet und in der Praxis seit Jahren erfolgreich und
die Stärkung der Leistungen zur Gesundheitsförderung nachhaltig umgesetzt.
und Prävention in Lebenswelten,
die Intensivierung der Betrieblichen Gesundheitsförde- Eines der Kernanliegen der Gesetzgebung ist eine bessere
rung insbesondere für kleine und mittelständische Be- Zusammenarbeit der Sozialversicherungsträger sowie der
triebe, Länder und Kommunen. Dieses Ziel einer besseren Kooperati-
eine auf prioritäre Ziele und Handlungsbereiche ausge- on aller Beteiligten ist aus Sicht der AOK PLUS zu begrüßen
richtete Nationale Präventionsstrategie, deren Umset- und knüpft an bereits erfolgreiche Beispiele in der bisherigen
zungsvereinbarungen in den Ländern, Umsetzung von Maßnahmen der Prävention und Gesund-
Maßnahmen zur Steigerung der Qualität verhältnis- und heitsförderung im GKV-System an.
verhaltenspräventiver Leistungen sowie
eine Verdopplung der bisher für Gesundheitsförderung Die Gesetzesregelung beinhaltet allerdings trotz des Bekennt-
und Prävention zur Verfügung stehenden Finanzmittel. nisses zu Prävention und Gesundheitsförderung als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe das Risiko, dass allein die Gesetzliche
Die AOK PLUS begrüßt, dass mit dem Gesetz Prävention und Krankenversicherung (GKV) in die Verantwortung genommen
Gesundheitsförderung in der Gesellschaft des langen Lebens wird und den größten Anteil zu finanzieren hat. Dies ist aus
gestärkt und zum Ziel gesamtgesellschaftlicher Anstrengun- Sicht der AOK PLUS kritisch zu bewerten.
gen gemacht werden soll. Dazu gehört die Stärkung der
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten eben- Grundsätzlich falsch ist, verpflichtende Geldleistungen vorzu-
so wie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die geben ohne auf vorhandene Strukturen und Maßnahmen
betriebliche Gesundheitsförderung und deren engere Ver- aufzusetzen. Vor allem die Länder haben Leistungen zu ver-
knüpfung mit dem Arbeitsschutz. antworten, die einen wesentlichen Beitrag leisten, um die
sozialen Einflussfaktoren auf die Gesundheit zu gestalten.
Mit der Nationalen Präventionsstrategie wurden auf Bundes- Daher müssen sie sich aktiv in eine Nationale Präventionsstra-
ebene Rahmenempfehlungen konsentiert, die den Hand- tegie einbringen.
lungsrahmen für Rahmenvereinbarungen auf Landesebene
bilden: Weiterhin muss für die gesetzliche Renten- und Unfallversi-
cherung sowie die Private Krankenversicherung ein konkreter
Gesund aufwachsen Präventionsauftrag mit der dazugehörigen Finanzverantwor-
Gesund leben und arbeiten tung gesetzlich verankert werden.
Gesund im Alter
Länder müssen sich zu ihrer Verantwortung bekennen - vor
Den Schwerpunkt für die Gestaltung der Prävention und allem braucht es eine aktive Einbindung und klare Übernahme
Gesundheitsförderung in den Regionen zu verankern und so von Leistungsverantwortung der Länder in der Nationalen
den Partnern vor Ort den Gestaltungsspielraum zu geben, Präventionsstrategie. Nur dadurch kann sichergestellt wer-
wird von der AOK PLUS begrüßt. Das gilt auch für die Klarstel- den, dass mit der Ausgestaltung der bundeseinheitlichen
lung, dass die Verantwortlichen in den Lebenswelten eine Rahmenempfehlungen Signalwirkung auf die Gestaltung und
angemessene Eigenleistung zu erbringen haben.
13Umsetzung der Rahmenvereinbarungen auf Landesebene entfaltet werden kann. Die aktuellen Beauftragungen der BZgA zielen darauf ab, bei Bedarf im Rahmen der Landesrahmenvereinbarungen zur Unterstützung und Qualitätssicherung hinzugezogen zu wer- den, analog zu den Aktivitäten im Rahmen des Kooperations- verbundes gesundheitlicher Chancengleichheit. Qualität und Nutzen der Prävention und Gesundheitsförde- rung konsequent durch alle Regelungen stärken – es ist falsch, Prävention und Gesundheitsförderung an verpflichtende Geldleistungen zu binden. Vielmehr müssen Qualität und Nachhaltigkeit Maßstab guter Prävention sein. Es muss si- chergestellt sein, dass Geld sinnvoll investiert wird. Nach Verabschiedung der ersten Landesrahmenvereinbarun- gen (u. a. auch am 01.06.2016 in Sachsen) haben die Sozial- versicherungsträger ihre Kooperationsarbeit aufgenommen. Im Mittelpunkt der sächsischen Landesrahmenvereinbarung stehen die Zielbereiche „Gesund aufwachsen“, „Gesund leben und arbeiten“, „Gesundheitsförderung von Erwerbslosen“ und „Gesund im Alter“. Es wird darauf ankommen, die Men- schen in ihren Lebenswelten (zum Beispiel Kita, Schule oder Betrieb) noch besser als bisher zu erreichen, um allen mög- lichst gleiche Gesundheitschancen zu eröffnen. Dabei werden nicht nur neue Initiativen ins Leben gerufen, sondern ebenso bewährte Projekte und Kooperationen fortgeführt. Es gilt nun, die Landesrahmenvereinbarung konsequent und engagiert umzusetzen. Heiko Kotte Bereichsleiter Gesundheitsförderung der AOK PLUS 14
Stand zur Umsetzung des
Präventionsgesetzes in Hamburg
Klaus-Peter Stender
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg
1. Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der natio- Erreichung sozial benachteiligter Menschen durch Aktivi-
nalen Präventionsstrategie täten in sozial benachteiligten Stadtteilen
In Hamburg wurde die Landesrahmenvereinbarung (LRV) Verknüpfung von Aktivitäten – im Sinne integrierter
gemäß § 20f SGB V am 08.09.2016 im Hamburger Rathaus kommunaler Handlungsstrategien (Gesundheitsförde-
unterzeichnet. Unter Federführung des Verbandes der Ersatz- rungs- und Präventionsketten) – mit bestehenden und
krankenkassen (vdek) hatten die dafür gesetzlich vorgesehe- erfolgversprechenden Aktivitäten, Programmen und
nen Akteure (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherung Strukturen
sowie die BGV für die Stadt Hamburg) diese Vereinbarung LRV-Strukturen: Strategieforum Prävention, Koordinie-
ausgearbeitet. Von Anfang an dabei war auch die Hamburgi- rungsgremium, Pakt für Prävention:
sche Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAG). Das Strategieforum Prävention legt unter Leitung der für
Gesundheit zuständigen Senatorin die Rahmenvorgaben
Die Gesundheit der Bevölkerung wird wesentlich durch Le- (inhaltliche Schwerpunkte) für die Umsetzung der LRV
bensbedingungen und Gesundheitsverhalten beeinflusst. fest. Diesem Strategieforum gehören die Beteiligten der
Dabei sind Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken sozial LRV Hamburg gem. § 20 f SGB V an.
ungleich verteilt. Dieser Zusammenhang ist unstrittig und Dem Strategieforum Prävention zugeordnet ist ein Koor-
auch in der Hamburger Landesrahmenvereinbarung als Hand- dinierungsgremium zur Umsetzung der LRV Hamburg,
lungsfeld abgebildet. das die Sitzungen des Strategieforums Prävention vor-
und nachbereitet und die Umsetzung der Aktivitäten
Das Hinwirken auf gesundheitsförderliche Rahmenbedingun- steuert. Die Leitung liegt bei den Kassen, die Geschäfts-
gen und die Stärkung von Möglichkeiten für einen gesunden stelle des Koordinierungsgremiums ist bei der HAG ange-
Lebensstil fördern generell Gesundheit und dienen der Prä- siedelt.
vention von Krankheiten. Gesundheitsfördernde und präven- Fachlich unterstützt wird das Strategieforum Prävention
tive Aktivitäten sollen deshalb sowohl auf die Schaffung und das Koordinierungsgremium durch den „Pakt für
gesundheitsförderlicher Lebenswelten abzielen wie auch Prävention – gemeinsam für ein gesundes Hamburg“.
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten stär-
ken. Positives Gesundheitsverhalten und psychische Wider-
standsfähigkeit zu fördern sowie Gesundheitsrisiken abzu- 2. Blick zurück: Wo stehen wir in Hamburg?
bauen sind deshalbgesamtgesellschaftliche Aufgaben. Sie Gesundheitsförderung ist in der Stadt stabil verankert
gehören aber auch zu Handlungsschwerpunkten des Gesund- Gesundheitsförderungs-Strukturen sind auf den Ebenen
heitswesens. Stadt, Bezirk und Stadtteil etabliert
Verknüpfung von Erkenntnissen der Gesundheitsbericht-
Die Unterzeichnenden haben sich in der LRV darüber hinaus erstattung mit daraus abgeleiteten Gesundheitsförde-
auf weitere Punkte geeignet: rungsaktivitäten
Bewährtes fortsetzen und stärken Verständigung auf gemeinsame Handlungsschwerpunkte
Dazu gehören der Pakt für Prävention – Gemeinsam für in der Stadt und vor Ort (sozialraumorientierte Gesund-
ein gesundes Hamburg, insbesondere mit den gemein- heitsförderung)
schaftlich erarbeiteten und abgestimmten lebenspha- Gesundheitsfördernde Maßnahmen werden gemeinsam
senbezogenen Rahmenprogrammen und die HAG, insbe- umgesetzt und in Teilen auch gemeinsam finanziert
sondere mit ihrer Fachexpertise in den Lebenswelten (bspw. auch über einen Projektfördertopf der Kassen und
sowie der gemeinschaftlichen Mittelvergabe von Kran- der Stadt bei der HAG)
kenkassen untereinander und von Kassen zusammen mit Zusammenarbeit innerhalb von Behörden funktioniert
der BGV
Handlungsfelder gesund aufwachsen, gesund leben und
arbeiten, gesund alt werden 3. Blick nach vorn: Empfehlung eines Orientierungsrah-
Der Hamburger Pakt für Prävention hatte sich auf diese mens
drei Handlungsfelder verständigt und seit 2010 für diese Der Pakt für Prävention ist gemäß LRV aufgefordert, Hand-
drei Lebensphasen Handlungsprogramme abgestimmt. lungsschwerpunkte zu empfehlen.
Hamburger Gesundheitsförderungs- und Präventionsbe-
richt Der Pakt für Prävention wurde 2010 gegründet und umfasst
Die Hamburger Bürgerschaft hat den Senat aufgefordert, derzeit 122 Mitgliedsorganisationen. Seine Grundlage ist die
alle vier Jahre – erstmals in 2017 – über die Umsetzung 2008 veröffentlichte Studie „Verbreitung und Qualität von
der LRV zu berichten. Gesundheitsförderung und gesundheitlichen Prävention in
15Hamburg“, für die das UKE etwa 150 Fachleute über Einzelge- 4. Zu guter Letzt: Weiterhin erforderlich
spräche und Gruppendiskussionen nach ihren Einschätzungen Grundsätzlich sind Gesundheitsförderung und Prävention
der Hamburger Gesundheitsförderungssituation befragt durch das Präventionsgesetz auf einem soliden Entwicklungs-
hatte. weg. Zur Weiterentwicklung insbesondere auch der intersekt-
oralen Umsetzung („Health in all Policies“) müssen aber min-
Folgende Empfehlungen für eine umfassende und nachhaltige destens drei Erfordernisse angegangen werden – und das
Gesundheitsförderungsstrategie werden aus den Ergebnissen nicht nur in Hamburg!
abgeleitet:
Lebensbegleitender Ansatz, gesundheitliche Chancen- Was geben die Städte insgesamt aus für Gesundheitsförde-
gleichheit als Kernziel rung? Welche weiteren öffentlichen Mittel – als nur die aus
Beitrittsvoraussetzung ist die Unterzeichnung einer Koo- dem Gesundheitsbereich - müssen sinnvoll dazu berechnet
perationsvereinbarung, die zugleich ein konzeptioneller werden? Eine solche plausible Auflistung könnte auch ande-
Handlungsrahmen wie auch die freiwillige Selbstver- ren Politikbereichen die Einsicht erleichtern, dass Gesundheit
pflichtung auf diesen Rahmen ist durchaus auch für sie ein Handlungsziel ist. Hier ist allerdings
der Pakt für Prävention ist als kooperativer Prozess einer zuerst einmal die Abgrenzung ein echtes Problem. Ein gut
hamburgweiten Gesundheitsförderungs- und Präventi- ausgebautes Radwegenetz ist gewiss förderlich für die Ge-
onsplanung angelegt sundheit – aber können alle dafür eingesetzten Mittel dem
das Vorgehen ist geprägt von gesundheitspolitischen Gesundheitsziel zugeordnet werden? Wie steht es mit dem
Zielvorgaben, Gesundheitsdaten (über Gesundheitsbe- Sportunterricht an Schulen oder Grünzügen zur Erholung?
richte), Bewertung der Daten in Experten/innenrunden, Hier wartet noch eine Reihe von Klärungspunkten auf ihre
Erarbeitung fachlicher Rahmenprogramme, Transparenz Bearbeitung.
von Maßnahmen und Verbreitung guter Praxis
Veranstaltung eines jährlichen Präventions-Kongresses In den Städten entwickeln sich manche gesundheitlichen
Weitgehender Verzicht auf unnötige Organisationsstruk- Probleme in eine positive Richtung. So verbessern sich in
turen, z. B. Steuerungsgremium Hamburg z. B. die vorzeitige Sterblichkeit oder das Überge-
wicht und Vorsorgeverhalten bei Kindern.
Der Pakt für Prävention ist mit seiner Expertise frühzeitig in
die Erarbeitung der LRV eingebunden worden. Er hatte für die Diese Gesundheitssituation ist deutlich zu begrüßen, aber
Hamburger LRV Leitlinien entwickelt, die im Wesentlichen so eine wichtige Frage bleibt auch hier bisher nicht seriös zu
übernommen wurden. beantworten: Welchen Anteil haben gesundheitsfördernde
Aktivitäten an dieser Verbesserung? Angesichts der Fülle
Fachliche Schwerpunktsetzungen sind in der LRV nicht näher möglicher Einflussfaktoren ist diese wichtige Frage schwer zu
beschrieben und sollen vom Pakt für Prävention entwickelt beantworten. Näherungen an Antworten wären aber bereits
werden. Im Rahmen des Pakts für Prävention-Kongresses am sehr willkommen.
13.10.2016 und einer anschließenden Experten/innenrunde
am 01.12.2016 sind diese Empfehlungen erarbeitet worden. Bei einem weiteren Dauerbrenner des Erkenntnisinteresses
sind wir auf den ersten Blick schon weiter: Welche der
Handlungsprinzipien, z. B. gesundheitsfördernden Maßnahmen sind besonders wirk-
Leistungsallokation in sozial benachteiligten Sozialräu- sam? Heute kommt kaum mehr ein gesundheitsförderndes
men, die von der Gesundheitsberichterstattung oder Programm ohne eine Evaluation aus. Der Nachteil: Kaum
über das Hamburger Rahmenprogramm Integrierte eines der Programme muss auf das Kriterium „erfolgverspre-
Stadtteilentwicklung als benachteiligt beschrieben sind chend“ verzichten. Das könnte für deren Qualität sprechen,
Gesundheit lebensbegleitend stärken durch u. a. Zusam- wahrscheinlicher ist aber, dass länger dauernde Wirkungen
menarbeit, Transparenz, Abstimmung von Planungen, nicht oder wenig erfasst werden.
gemeinsame Finanzierung von Aktivitäten
Erkenntnisfortschritte in diesen Bereichen können auch mit
Fachbezogene, lebensphasenübergreifende Ziele dazu beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger bei Fragen der
Psycho-soziale Gesundheit in jedem Lebensalter und Gesundheit zukünftig nicht nur Arzt/Ärztin oder Apotheker/in
deren Rahmenbedingungen stärken. sondern auch Bürgermeister/innen und seine/ihre Verwaltung
Gesundheitsfördernde Bewegung in jedem Lebensalter kontaktieren.
und deren Rahmenbedingungen fördern.
Gesundheitsfördernde Ernährung in allen Lebensphasen
und deren Rahmenbedingungen unterstützen. Klaus-Peter Stender
Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien
Gemäß der Aussage der WHO, es gibt keine Gesundheit ohne und Hansestadt Hamburg (BGV)
psychische Gesundheit (2005, Helsinki) bewertet der Pakt für
Prävention das erste Ziel der psycho-sozialen Gesundheit als
besonders bedeutsam. Die Ziele der Bewegungs- und Ernäh-
rungsförderung sind diesem primären Ziel zugeordnet.
Bei den Aktivitäten zur Zielerreichung wird ein integriertes
Vorgehen empfohlen, d. h. diese Ziele werden nicht isoliert
angesteuert sondern, wo immer möglich und sinnvoll, soll
mehr als ein Ziel erreicht werden.
16Sie können auch lesen