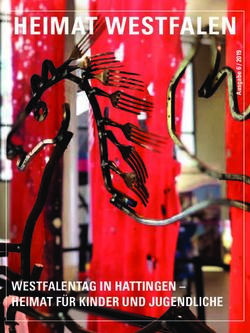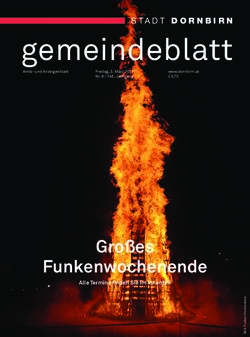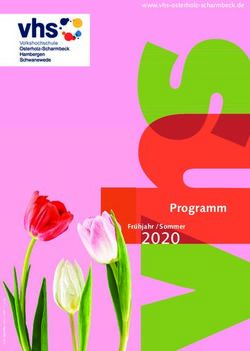MAGAZIN DEZEMBER 2016 - Vielfalt der Sprachen - Schulen und Kindertagesstätten im Kontext sprachlich-kultureller Heterogenität - Zentrum für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
DEZEMBER 2016
MAGAZIN
Vielfalt der Sprachen – Schulen
und Kindertagesstätten im Kontext
t
sprachlich-kultureller Heterogenitä
gkeit und Integration Köln KONZEPTE • NACHRICHTEN
Zeitschrift des Zentrums für Mehrsprachi
PROJEKTE • VERANSTALTUNGEN2
Impressum
Herausgeber: Redaktion: Editorial-Design, Satz & Layout:
Peter Liffers, agentur für unternehmenskommunikation
ZMI Rosella Benati
www.liffers-webdesign.de
Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration Jolanta Boldok
c/o Ariane Schmid Bildnachweis:
Diversity Titelseite: Christiane Wengmann, S. 14 Tim Wolfgarten, San-
dra Tietjens, S. 15-16 Museumsdienst Köln, Sebastiano De
Kommunales Integrationszentrum Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt
Petris, S. 17-18 Magdalena Kaleta, S. 20 Emilia Böttcher, Co-
Kleine Sandkaul 5 bei den Autorinnen und Autoren der jeweiligen Beiträge. rina Volcinschi, S. 22-23 Sylvia Siegel-Kopatz, S. 24-25 Leyla
50667 Köln Auflage 2.000 Cakar-Winkel, S. 30 Brixx, S. 32-33 Gabriele Ceseroglu, Wal-
www.zmi-koeln.de Köln, Dezember 2016 traud Reeder-Dertnig, S. 37 MAIS NRW, S. 38-39 Christiane
Wengmann, S. 40 Elisabeth Schmitz, Rosella Benati, S. 41
Maurice Cox. Alle übrigen Archiv des ZMI.
zmi-Magazin | 2016Inhalt
DEZEMBER 2016
MAGAZIN
Leitwort
4 Vielfalt der Sprachen – Schulen und Kindertagesstätten im Kontext
sprachlich-kultureller Heterogenität von M. Becker-Mrotzek, M. Höhne, N. Rehberg
Wissenschaft und Forschung
6 Klick, klick, Propaganda. Grundzüge eines Präventionsprogramms gegen Radikalisierung
durch Internet-Propaganda an Schulen im EU-Forschungsprojekt CONTRA
von Julian Ernst, Josephine B. Schmitt, Diana Rieger u. a.
7 Interview mit Jim Cummins. Es fragten Rosella Benati und María José Sánchez Oroquieta.
10 Einstellungen pädagogischer Fachkräfte zu Mehrsprachigkeit: ein Fragebogen
von Anja Leist-Villis
12 Transnationale Biographien: Exkursion nach Istanbul
von Stefanie Magdalene Helbert und Sandra Tietjens
Praxis und Projekte: Aktuelles aus dem ZMI
15 Identitäten in Köln – ein Projekt des Museumsdienstes Köln mit dem ZMI-Köln
im Museum Ludwig von Karin Rottmann und Anke von Heyl
17 Kölner Sommerschule für geflüchtete Jugendliche von Diana Gebele und Alexandra L. Zepter
19 Der Gesprächskreis „Deutsch als Zweitsprache“ für Lehrkräfte - Mehr als nur sprachliche
Sensibilisierung von Emilia Böttcher und Corina Volcinschi
21 Das koordinierte Lernen mit BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift)
von Ina-Maria Maahs und María José Sánchez Oroquieta
22 Wie das Konzept der Ferienschule als Literaturwoche in die Schule kam und um den As-
pekt des Generativen Erzählens erweitert wurde – ein Bericht aus dem Verbund „DemeK
mit BiSS“ von Sylvia Siegel-Kopatz
24 Meine Sprachen und Kulturen – Auf Entdeckungsreise mit Fantasmino
Interkulturelles Unterrichtsmaterial für die Grundschule von Maja Scheerer
Stadt und Land: Ideen und Projekte aus der Region
26 Das Positionspapier für Mehrsprachigkeit des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung Nordrhein-Westfalen. Interview mit Christiane Bainski, Leiterin der Landeskoordi-
nierungsstelle Kommunale Integrationszentren (LaKi). Die Fragen stellte Ariane Schmid.
28 „Experiment“ Eine interkulturelle Theatergruppe setzt Sprachenvielfalt in Szene
Interview mit Wladimir Weinberg. Die Fragen stellte Christina Walter.
30 Kreatives Deutsch Lernen mit Rap und Gesang
Ein Interview mit Rapperin Brixx. Die Fragen stellte Jolanta Boldok.
32 „Väter lesen vor“ – ein Projekt für Kölner Väter
von Gabriele Ceseroglu, Waltraud Reeder-Dertnig und Gian Luca Bonucci
Das ZMI-Magazin ist die Zeitschrift des talentCAMPus 2016: Empowerment – kein Kind zurück lassen von Irmgard Coerschulte
35
Zentrums für Mehrsprachigkeit und Integration Köln:
Zuletzt erschienen ...
36 Aktuelle Neuerscheinungen, vorgestellt vom ZMI
Veranstaltungen
37 Das ZMI - Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration und die Arbeitsstelle Migration
der Bezirksregierung Köln beim NRW-Tag
38 Mehrsprachigkeit ist unser Alltag – Sprachfest des ZMI am 26. Januar 2016
40 Mehrsprachiger Lesewettbewerb 2016
40 Fortbildungstag Deutsch am 19. November 2016
41 Ausstellungseröffnung „Identitäten in Köln“ im Museum Ludwig am 30. September 2016
Interkulturelle Glosse
42 „NSU Nummer“ von F. Çevikkollu
zmi-Magazin | 20164 mehrwert:
Vielfalt der SprachenKo–ntext
im
Schulen und Kindertagesstätten
tät
sprachlich-kultureller Heterogeni
a Rehberg
otzek, Manfred Höhne und Nin
von Prof. Dr. Michael Becker-Mr
Köln ist eine Stadt, die schon lange durch Migrationsbewegungen geprägt wird. Das spiegelt sich auch in den Bil-
dungsinstitutionen wider: Knapp über 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren haben eine eigene
Zuwanderungsgeschichte, oder mindestens ein Elternteil hat eine Zuwanderungsgeschichte. Die damit verbundene
sprachlich-kulturelle Heterogenität stellt seit Jahrzehnten erhebliche Anforderungen an das deutsche Bildungswe-
sen, die durch den Anstieg der Neuzuwanderungen der letzten Jahre nochmals erhöht wurden.
zmi-Magazin | 2016Leitwort 5
Schülerinnen und Schüler, die mit einer
anderen Sprache als Deutsch aufwach-
sen, sind häufig schulisch benachteiligt,
mit nachteiligen Auswirkungen auch auf
ihren Bildungserfolg. Um allen Kindern
und Jugendlichen unabhängig von ihrer
Herkunft eine chancengleiche Bildung
zu gewährleisten, ist es erforderlich, die
sprachlich-kulturelle Heterogenität so-
wohl in der Schul- und Unterrichtsent-
wicklung als auch in der Entwicklung der
Bildungsarbeit in den Kindertagesstätten
zu berücksichtigen. Professor Dr. Michael Becker- LRSD Manfred Höhne Nina Rehberg
Mrotzek, Mercator-Institut , Bezirksregierung Köln Dienststelle Diversity, Stadt Köln
Grundlegend für die Entwicklung von Universität zu Köln
Bildungsinstitutionen ist, dass sich jede
einzelne Einrichtung – ob Schule oder
Kindertagesstätte – als ganzes System
entwickelt, also die Organisation, das erarbeiteten Leitlinien derzeit in den Kol- weitere Aktivitäten an der Schnittstelle
Personal und den Unterricht bzw. die legien besprochen und im Jahr 2017 auf von Schul- und Unterrichtsentwicklung
pädagogische Praxis miteinbezieht.1 Um Verbundebene verabschiedet. mit initiiert und begleitet. Als Beispiele
Nachhaltigkeit zu erzielen, müssen die Eine zentrale Rolle in der Schul- und Unter- sind hier zu nennen:
Maßnahmen aufeinander abgestimmt richtsentwicklung sowie der Entwicklung Das Projekt „Identitäten in Köln“ ist in Ko-
werden und so mit dem alltäglichen Ge- der Bildungsarbeit in Kindertagesstätten operation mit Lehrkräften des Herkunfts-
schehen in Schule oder Kindertagesstätte kommt der Haltung und den Umgangsfor- sprachlichen Unterrichts und dem Muse-
verwoben werden. men der Erzieherinnen und Erzieher sowie umsdienst Köln durchgeführt worden. Im
Für die Berücksichtigung der sprachlich- der Lehrkräfte zu. Mit einer im Jahr 2015 Rahmen des Herkunftssprachlichen Un-
kulturellen Heterogenität im Rahmen von durch das ZMI mitfinanzierten Studie zur terrichts haben sich die Schülerinnen und
Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie Mehrsprachigkeit in Kölner Kindertages- Schüler zusammen mit ihren Lehrkräften
der Entwicklung der Bildungsarbeit in den stätten konnte die grundsätzlich offene mit ihrem eigenen Dasein in Köln befasst.
Kindertagesstätten stehen eine Vielzahl Haltung der dort tätigen pädagogischen Der wertschätzende Umgang mit der per-
an Konzepten und Strategien – von der Fachkräfte im Hinblick auf die sprachlich- sönlichen Lebensgeschichte im Kontext
integrierten Sprachbildung im Deutschen kulturelle Heterogenität aufgezeigt wer- von Mehrfachzugehörigkeit stand dabei
bis hin zur Einbeziehung der Mehrspra- den.2 Dies zeigt sich im Allgemeinen auch im Vordergrund.
chigkeit – zur Verfügung. Das Zentrum für die Schule, wobei Studienergebnisse Die diesjährige Sommerferienschule des
für Mehrsprachigkeit und Integration verdeutlichen, dass Lehrerkräfte häufig Sprachförderprojekts der Universität zu
unterstützt Bildungseinrichtungen, die noch unzureichend auf die sprachlich- Köln an der Adolph-Kolping-Hauptschule
sich dazu entschließen, entsprechende kulturell heterogenen Lerngruppen in ih- in Köln-Kalk war ein Angebot für neu zu-
Maßnahmen zu implementieren. So be- ren Klassenzimmern vorbereitet werden.3 gewanderte Schülerinnen und Schüler in
gleitet es Schulen wie den Verbund Köl- Kindertagesstätten und Schulen benö- den Vorbereitungsklassen. Neben der För-
ner Europäischer Grundschulen, die ihren tigen solche Fortbildung, die im Sinne derung der deutschen Sprachkenntnisse
Schülerinnen und Schülern die Möglich- einer ganzheitlichen und nachhaltigen hatte die Ferienschule auch das Ziel, den
keit zur koordinierten Alphabetisierung in Entwicklung gemeinsam mit dem gesam- teilnehmenden Schülerinnen und Schülern
Deutsch und der Herkunftssprache bieten, ten Kollegium bzw. Team besucht werden das Kennenlernen und Erleben des All-
oder die mit dem Unterrichtskonzept „De- können. Im Jahre 2016 hat das ZMI eine tagsgeschehens in den Kölner Stadtvier-
meK: Deutschlernen in mehrsprachigen Fortbildung für Lehrkräfte-Teams zur ge- teln zu ermöglichen.
Klassen“ arbeiten. Um die Maßnahmen lingenden Zusammenarbeit im Kontext Das Zentrum für Mehrsprachigkeit und
der Verbundschulen in der Organisation von sprachlich-kultureller Heterogenität Integration wird auch künftig durch die
der Schule weiter zu verankern, hat das an den Schulen – sowohl in den Klassen fruchtbare Zusammenarbeit der drei Ko-
ZMI im September 2016 gemeinsam mit als auch im Kollegium – durchgeführt. operationspartner Stadt Köln, Bezirks-
den Schulleiterinnen und Schulleitern des Darüber hinaus hat das ZMI im Jahr 2016 regierung Köln und Universität zu Köln
Verbunds eine Klausurtagung zur Aktu- 2 Vgl. Roth, H.-J. et al. (2016): MehrKita - seinen Beitrag dazu leisten, Bildungsein-
alisierung der Leitlinien veranstaltet. In Mehrsprachigkeit in Kölner Kindertagesstätten. richtungen in ihrer Entwicklung im Kon-
einem weiteren Schritt werden die dort Universität zu Köln. text von sprachlich-kultureller Heterogeni-
3 Vgl. SVR- Forschungsbereich und Mercator
1 Vgl. Rolff, H.-G. (2013): Schulentwicklung kom- Institut für Sprachförderung und Deutsch als
tät zu unterstützen.
pakt. Weinheim u. Basel: Beltz. Zweitsprache (2016)
zmi-Magazin | 20167
Aus Wissenschaft
und Forschung
Klick, klick, Propaganda.
Grundzüge eines Präventionsprog
ramms gegen Radikalisierung du
Internet-Propaganda an Schulen rch
im EU-Forschungsprojekt CONTRA
von
.
Julian Ernst, Dr. Josephine B. Sch
mitt, Dr. Diana Rieger, Michalina
Prof. Dr. Peter Vorderer und Prof. Trompeta, Prof. Dr. Gary Bente,
Dr. Hans-Joachim Roth
Das Internet ist längst selbstverständlicher Bestandteil der Lebenswelten Jugendlicher. Auf Plattformen wie YouTube,
Instagram oder Facebook bewegen sich Jugendliche routiniert und in großer Vertrautheit1. Beiträge werden kom-
mentiert, Bilder geteilt. Beliebt ist vor allem auch das Anschauen von Videos via Smartphone und anderer mobiler
Endgeräte2. Doch nicht alle online verfügbaren Inhalte können als unproblematisch eingeschätzt werden. Zunehmend
haben auch extremistische Gruppierungen soziale Online-Netzwerke als effizientes Medium zur Verbreitung ihrer ra-
dikalen Botschaften entdeckt3: Kaum anderswo lässt sich Propaganda anonym und derart einfach mit wenigen Klicks
veröffentlichen und ist mit noch weit weniger Klicks für jede Person mit einem Internetanschluss zugänglich.
Jugendliche laufen hierdurch im medialen Alltag konstant Gefahr, Wirkweisen von Online-Propaganda an und setzt sich zum Ziel,
sich Propagandainhalten auszusetzen – sei es gewollt oder durch Lehrkräften an Schulen wirksame Konzepte und Methoden an
Zufall. Extremistische Propaganda – unabhängig von ihrer ideo- die Hand zu geben, um Schülerinnen und Schüler gegen den Ein-
logischen Ausrichtung – kann in verschiedener Gestalt vorliegen: fluss von vorwiegend audiovisueller Internet-Propaganda stark
Videos, aber auch Musikstücke, Bilder und Kommentare präsen- zu machen.
tieren antidemokratische Thesen, predigen Hass gegen bestimm-
te Gruppen und rufen zu Gewalt auf. Die Inhalte dienen nicht nur Was und wer ist CONTRA?
der Vermittlung von Informationen über die vertretene Ideologie.
Sie sollen begeistern und zur Rekrutierung neuer Anhänger ver- CONTRA (Countering Propaganda by Narration Towards Anti-
helfen. Ziel der Extremistinnen und Extremisten ist es, insbeson- Radical Awareness) ist ein von der Europäischen Kommission
dere bei medienaffinen Jugendlichen Radikalisierungsprozesse zu gefördertes Forschungsprojekt, in dem ein Programm zur Prä-
befördern und diese in letzter Konsequenz davon zu überzeugen, vention der Wirkweisen rechtsextremistischer und islamistischer
sich in den Dienst einer vermeintlich höheren Wahrheit o.ä. zu stel- Internet-Propaganda für den Einsatz in Schulen erarbeitet wird.
len – und damit der demokratischen, wertepluralistischen Gesell- Die derzeit in Entwicklung befindlichen Einheiten und Methoden
schaft, Familie und Freunden den Rücken zu kehren. für den Unterricht werden im Frühjahr 2017 erstmals an Schulen
Wie kann verhindert werden, dass Jugendliche sich durch online in Deutschland eingesetzt. Ihr Erfolg wird dann evaluiert wer-
frei verfügbare Propaganda gewalttätigen und demokratiefeind- den. Die dabei in Deutschland gesammelten Erfahrungen sollen
lichen Ideen zuwenden? Auf diese Frage wollen wir mit dem For- dann auch in anderen EU-Staaten genutzt werden. Das internati-
schungsprojekt CONTRA Antworten geben. Das im März 2016 onal und interdisziplinär zusammengesetzte Forschungsteam be-
gestartete Projekt knüpft an aktuelle Forschungsergebnisse zu steht aus Medienpsychologen und Erziehungswissenschaftlern
1 Vgl. S.172 f. bei Calmbach, M./Borgstedt, S./Borchard, I./Thomas, P. M./Flaig, B. B. (2016). Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter
von 14 bis 17 Jahren in Deutschland. Springer Verlag, Wiesbaden 2016.
2 Vgl. bei Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest (Hrsg.). JIM 2015. Jugend, Information, (Multi-) Media (mpfs). Basisstudie zum Medienumgang 12-
bis 19-Jähriger in Deutschland.
3 Vgl. bei Jugendschutz.net (Hrsg.) (2015a): Islamismus im Internet. Propaganda-Verstöße-Gegenstrategien. Mainz. sowie bei Jugendschutz.net (Hrsg.) (2015b):
Rechtsextremismus online. Beobachten und nachhaltig bekämpfen. Bericht über Recherchen und Maßnahmen im Jahr 2014. Mainz.
zmi-Magazin | 20168 Aus Wissenschaft und Forschung
der Universitäten Köln, Mannheim und Haifa (Israel), interna- Propaganda gelten Musliminnen und Muslime zugleich häufig als
tionalen Experten von Sicherheitsbehörden aus den Niederlan- outgroup, d.h. sie werden pauschal abgewertet und zu Feinden
den (NCTV), Österreich (Österreichischer Verfassungsschutz) und erklärt. Bei Berufsschülerinnen und -schülern stieg das Interes-
Deutschland (Bundeskriminalamt) sowie Praktikern der Präven- se an Propaganda, wenn es sich um Propaganda mit „ingroup“-
tions- und politischen Bildungsarbeit mit Jugendlichen (Ufuq e.V., Bezug handelte.
Bundeszentrale für politische Bildung, 180° Wende). Im Internet finden sich auch zahlreiche Gegenstimmen (Coun-
CONTRA möchte die Aufmerksamkeit Jugendlicher und Pädago- ter-Narratives/Counter-Messages). Zu einem großen Teil werden
ginnen und Pädagogen für radikale Botschaften, sowohl islamis- diese von staatlichen Institutionen und zivilgesellschaftlichen Ak-
tische als auch rechtsextremistische, schärfen, das kritische Re- teuren organisiert und publiziert. So stellen sich zum Beispiel ver-
flexionsvermögen stärken sowie die genannten Gruppen zur Teil- schiedene muslimische YouTuberinnen und YouTuber radikalen
nahme am sozialen bzw. medialen Diskurs über Extremismus be- Argumentationen des rechten und islamistischen Lagers entge-
fähigen. Langfristig soll so Radikalisierungsprozessen entgegen- gen. Die „Datteltäter“ etwa parodieren in ihren YouTube-Videos
gewirkt werden, welche durch – im Schwerpunkt audiovisuelle sowohl Islamfeinde als auch Islamisten und bringen damit die
– Online-Angebote bedingt und gefördert werden. Doch welche Absurdität entsprechender ideologischer Forderungen zum Aus-
Rolle spielen Internetvideos überhaupt in der Hinwendung zu ra- druck. Auch Dominik Musa Schmitz kontert die vermeintlich at-
dikalen Ideologien? traktiven Angebote von Neo-Salafisten: Er ist prominenter Aus-
steiger aus der deutschen neo-salafistischen Szene und erzählt
Radikalisierung durch Internetvideos rückblickend über seinen Radikalisierungsprozess und den Weg
aus der Szene.
Die vorliegenden Forschungsergebnisse zu Radikalisierungspro- Gegenbotschaften haben zum Ziel, Propaganda zu entkräften
zessen erlauben kaum konkrete Aussagen über typische Verläu- und Alternativen zu radikalem Denken aufzuweisen. Die Wege
fe. Soviel ist dennoch klar: Der Einfluss radikaler Propaganda im sind unterschiedlich: So stehen die beiden genannten Beispie-
Internet auf Entwicklungen und Entscheidungen Jugendlicher le für ironisch-performative Inszenierungen und rationale Aufklä-
darf nicht unterschätzt werden. rung durch Information und Lebenserzählung.
Auf Propaganda können Jugendliche über Freunde und Bekann- Doch können Gegenerzählungen auch scheitern? Können sie
te sowie auch durch Zufall bei der Suche nach jugendtypischen Jugendlichen vielleicht sogar indirekt Wege zur Propaganda
Fragestellungen der Identitätssuche stoßen – von „darf ich einen eröffnen?
Freund haben?“ über „was ist eigentlich deutsch?“ wird ein brei-
tes Spektrum an Themen bedient. Sowohl rechtsextremistische Nur einen Mausklick von der Gegenbotschaft
als auch islamistische Akteurinnen und Akteure verknüpfen ihre zur Propaganda
Videobotschaften geschickt mit Schlagworten, die oberflächlich
keinen weiteren Aufschluss darüber geben, ob es sich um Propa- Die Pfade zur Propaganda, etwa auf der Video-Plattform YouTu-
ganda handeln könnte oder nicht. be, verlaufen nicht zwangsläufig gradlinig. So stoßen Jugendli-
Eine grundsätzlich befürwortende Haltung gegenüber Propagan- che nicht nur durch die gezielte Suche auf audiovisuelle Manipu-
davideos lässt sich bei jungen Erwachsenen nicht finden. So geht lationsversuche. Radikale Botschaften sind für viele Jugendliche
aus der Studie „Propaganda 2.0“ hervor, dass viele junge Er- potentiell nur einen Mausklick weit entfernt – dies trifft selbst
wachsene Propagandavideos eher ablehnen und sie häufig gar dann zu, wenn Videos von Gegenstimmen abgerufen werden.
nicht bis zu Ende ansehen4. Größere Zustimmung zu Propaganda Öffnet man zum Beispiel auf YouTube den Kanal von Dominik
zeigt sich in Abhängigkeit zum Ausbildungsstand der Teilnehmer: Musa Schmitz, werden durch den automatisierten Algorithmus
Bei Studierenden stieg die Ablehnung von Propaganda, wenn der Plattform neben den „Datteltätern“ auch Kanäle als ähnlich
sie ein potentielles Zugehörigkeitsgefühl auslöst. Dies kann bei- vorgeschlagen, deren Sender und Inhalte man als überaus pro-
spielsweise der Fall sein bei Propaganda, die Zuschauerinnen und blematisch einstufen kann (s. roter Rahmen in der Abbildung).
Zuschauer als ingroup adressiert. Im Falle rechtsextremistischer Neben dem Kanal des im deutschsprachigen Raum bekannten
Propaganda sind dies „Deutsche“, „Volksgenossen“ oder ähnli- neo-salafistischen Predigers Pierre Vogel, wird auch der Kanal
che Gruppenkonstruktionen, bei islamistischer Propaganda wer- „Die wahre Religion“ empfohlen: Der Videokanal einer für ih-
den Musliminnen und Muslime adressiert oder jene, die sich für re Missionierungsarbeit (auch: Da`wa-Arbeit) bekannten Gruppie-
den Islam als Lebensform interessieren. In rechtsextremistischer rung um den neo-salafistisch ausgerichteten Aktivisten Ibrahim
Abou-Nagie5.
4 Rieger, Diana/Frischlich, Lena/Bente, Gary (2013): Propaganda 2.0. Psycho-
logical Effects of Right-Wing and Islamic Extremist Internet Videos. Luchter- 5 Vgl. bei Wiedl, Nina/Becker, Carmen (2014): Populäre Prediger im deutschen
hand Verlag, Köln. Online abrufbar unter: https://www.bka.de/SharedDocs/ Salafismus. Hassan Dabbagh, Pierre Vogel, Sven Lau und Ibrahim Abou Nagie.
Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_44_ In: Schneiders, Thorsten Gerald (Hrsg.): Salafismus in Deutschland. Ursprünge
Propaganda2.0.html und Gefahren einer islamisch-fundamentalistischen Bewegung. Transcript
zmi-Magazin | 2016Aus Wissenschaft und Forschung 9
Nutzeransicht des Videokanals von Dominik Musa Schmitz, bekannter Aussteiger der deutschen neo-salafistischen Szene. In rot gerahmt sind die von YouTube
als „ähnlich“ vorgeschlagenen Kanäle u.a. des als problematisch geltenden salafistischen Predigers Pierre Vogel und des Aktivisten Ibrahim Abou-Nagie.
Das im Rahmen von CONTRA entwickelte Förderung kritischer Medien- und Wege nicht nur zu kennen, sondern
Präventionsprogramm möchte Jugendliche kompetenz: #weARE auch zu nutzen, beispielsweise den Inhal-
auf solche Herausforderungen und Fall- ten hasserfüllter Videos oder Kommentare
stricke im Umgang mit Online-Angeboten Unter kritischer Medienkompetenz wird in etwas entgegensetzen und die eigene Stim-
aufmerksam machen, für die Verführung CONTRA, nach Ganguin und Sander, „eine me und Position als machtvoll wahrzuneh-
durch einfache Propagandaantworten sen- analytische, reflexive und ethische Einord- men und einsetzen zu können – dies meint
sibilisieren und zu eigener Positionierung nung bzw. Beurteilung medialer Inhalte“7 empowerment.
ermutigen. verstanden, im Speziellen von Propagan- Konkrete Methoden zur Förderung kriti-
da. Schülerinnen und Schüler sollen fä- scher Medienkompetenz und Prävention
Nicht bewahren: Befähigen! hig sein, etwa die im Beispiel (siehe Ab- von Radikalisierung werden bis zum Ende
bildung) dargestellten Verknüpfungen von der Projektlaufzeit von CONTRA im Früh-
Am oben genannten Beispiel wird deutlich, Videos mit zweifelhaften Kanälen zu er- jahr 2018 entwickelt, evaluiert und pub-
dass Jugendliche während des alltäglichen kennen bzw. im Falle des Aufrufens kri- liziert. Bei konkreten Fragen zum Projekt
Surfens jederzeit auf radikale Botschaften tisch hinterfragen zu können. Dies bedarf besuchen Sie die Projektwebseite www.
stoßen können – sei es gewollt oder ein- spezifischen Wissens, Fähigkeiten und Hal- project-contra.org.
fach nur zufällig. Da Mediennutzung ein tungen. Diese spiegeln sich bei CONTRA
bedeutsamer Teil der Freizeitgestaltung in drei Zieldimensionen wider: awareness
Jugendlicher ist6, ist der Versuch, Jugend- (Aufmerksamkeit), reflection (kritische Re-
liche von potentiell radikalisierenden Inhal- flexion) und empowerment (Stärkung eige-
ten fernzuhalten, aus (medien-)pädago- ner Positionierung), eingängig abgekürzt info
gischer Perspektive keine Option. CONT- mit #weARE. Die Dimension awareness be- Kontakt
RA folgt der Auffassung, dass Jugendliche schreibt eine grundlegende Aufmerksam-
nicht vor der Konfrontation mit Propagan- keit für radikale Botschaften im Netz, das Julian Ernst, Universität zu Köln
da im Internet „bewahrt“ werden können. schlichte Wissen darüber, dass man auf Dr. Josephine B. Schmitt, Universität zu Köln
Dr. Diana Rieger, Universität Mannheim
Sie müssen jedoch darauf vorbereitet wer- YouTube und anderen Online-Portalen auf Michalina Trompeta, Universität zu Köln
den, diese Manipulationsversuche im Inter- Propagandainhalte verschiedener Gestalt Prof. Dr. Gary Bente, Universität zu Köln
net erkennen, reflektieren und einordnen stoßen kann. Reflection geht bereits einen Prof. Dr. Peter Vorderer, Universität
Mannheim
zu können. Hierfür zentral ist die Förde- Schritt weiter. Schülerinnen und Schüler
Prof. Dr. Hans-Joachim Roth, Universität zu
rung der kritischen Medienkompetenz. können bestimmte Kriterien an Online-In- Köln
halte (z. B. Videos) anlegen und zu einem
Verlag, Bielefeld 2014. S.187-215. Schluss kommen: Handelt es sich gerade Projektwebsite: project-contra.org
6 Vgl. S.233 bei Ganguin, Sonja/Sander, Uwe
(2015): Zur Entwicklung von Medienkritik. In: von um Internet-Propaganda oder nicht? Die
Gross, Friederike/ Meister, Dorothee M./Sander, Ebene der Handlung und des Aktiv-Wer-
Uwe (Hrsg.): Medienpädagogik – ein Überblick. dens ist ebenfalls berücksichtigt. Mittel
Beltz Juventa, Weinheim und Basel 2015. S.229-
246. 7 Vgl. S.234 ebd.
zmi-Magazin | 201610 mehrwert:
rv ie w m it P ro f. D r. Ji m C u m mins
In te Studies in Education, University
of Toronto
Professor am Ontario Institute for f.
ta. Übersetzung Christina Neuhof
Inte rvie w füh rten Ros ella Ben ati und María José Sánchez Oroquie
Das
Am 30. November und am 1. Dezember 2016 wurde das ZMI - Zentrum für Mehrsprachigkeit und Integration zu der
Konferenz „Great Start in Life“ in Brüssel eingeladen. Diese Konferenz, die von der Europäischen Kommission, Direkti-
on EDUCATION AND CULTURE (EAC), Einheit B.2 - Schools and Educators; Multilingualism organisiert wurde, hatte zum
Ziel, Expertinnen und Experten zu Bildung und Migration aus den Bereichen Wissenschaft, Politik und Praxis zusam-
menzuführen. Gemeinsam wurden die Bedingungen und Erfolgsfaktoren für eine bestmögliche Erziehung und Bildung
in Elementar- und Primarstufe diskutiert.
Frau Benati vom ZMI und von der Arbeitsstelle Migration der Bezirksregierung Köln und Frau Sánchez Oroquieta,
ebenfalls Mitarbeiterin in der Arbeitsstelle Migration, haben über die Kölner Programme zum mehrsprachigen Lernen
(koordiniertes Lernen - KOALA und Gelebte Mehrsprachigkeit) im Rahmen eines Plenarvortrages referiert. An der Fach-
konferenz haben viele renommierte Referentinnen und Referenten teilgenommen; darunter auch Prof. Dr. Jim Cummins,
der in seinem Vortrag mehrmals lobend die fortschrittliche Praxis in Köln aufführte. Anschließend an den Vortrag von
Frau Benati und Frau Sánchez Oroquieta hat Herr Cummins in einem Interview seine Eindrücke und wissenschaftlichen
Erkenntnisse über die Kölner Konzepte und Programme zur Förderung der Mehrsprachigkeit dargelegt.
Prof. Cummins, Sie haben gerade und wie diese geschrieben werden. Wie in Was die wissenschaftliche Basis angeht, in
zwei kurze Ausschnitte aus Filmen dem Beispiel, als die Kinder, die selbst kein Bezug auf die Arbeit, die Sie tun, denke ich,
über die beiden aktuellen Konzep- Arabisch sprechen, von dem Schüler, des- viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass
te „KOALA - Koordiniertes Lernen“ sen Muttersprache Arabisch ist, einige Din- dem ein starkes Fundament an Forschungs-
sowie „Gelebte Mehrsprachigkeit“ ge darüber lernen, wie die arabische Spra- ergebnissen zugrunde liegt und etliche Wis-
gesehen. Welchen Eindruck haben che geschrieben wird und wie sie klingt. Es senschaftlerinnen und Wissenschaftler dis-
Sie daraus gewonnen? liegt hier also ein genereller Fokus auf dem kutieren diese schon seit vielen Jahren.
Bewusstsein für Sprache und das Erlernen Zunächst einmal wissen wir, dass es einen
Es war sehr interessant für mich, diese Bei- und Kennenlernen von anderen Sprachen starken Zusammenhang gibt, zwischen der
spiele Ihrer Arbeit im Schulalltag zu sehen, wird mit Spaß erlebt. Das wird offenkundig Tatsache, wie gut Kinder ihre Mutterspra-
mit ihrem Fokus auf eine Lese- und Schreib- das Bewusstsein der Kinder stärken, wie die che entwickeln und wie erfolgreich sie die
entwicklung, die die Herkunftssprachen der „Hauptunterrichtssprache“ – in dem Falle „Hauptunterrichtssprache“ erlernen wer-
Kinder einbezieht. Es wurde ganz offen- Deutsch – aufgebaut ist und sie werden sich den. Kinder, die aus einem Vorschulpro-
sichtlich – durch die Begeisterung, die die viel zuversichtlicher und entspannter in der gramm oder aus ihren Elternhäusern be-
Kinder zeigen sowie die Tatsache, dass sie Lernumgebung fühlen. Das ist sehr beein- reits mit starken Fähigkeiten in ihrer Mut-
von sich aus Informationen aus ihren jeweili- druckende Pädagogik und ich denke, diese tersprache in die Grundschule kommen,
gen Sprachen einbringen – dass sie sich be- Arbeit ist Pionierarbeit, wegweisend für das, mit in ihrer Muttersprache entwickelten
stätigt fühlen und ihr Wissen über ihre Her- was gemacht werden sollte. Konzepten und vielleicht auch Erfahrungen
kunftssprachen in der Klasse einen Wert mit Büchern in ihrer Muttersprache, werden
hat. Sie wurden ermutigt, Sprachen zu ver- Vielen Dank. Wie beurteilen Sie dies die zweite Sprache in der Schule viel besser
gleichen. Sie lernten über andere Sprachen aus wissenschaftlicher Perspektive? erlernen als Kinder, die diesen Hintergrund
zmi-Magazin | 2016Aus Wissenschaft und Forschung 11
nicht mitbringen. Das ist also der erste schuljahren praktiziert werden, erscheinen
Punkt, dass es eine starke positive Bezie- die gezeigten Ansätze einigen Pädagogin-
hung zwischen den Sprachen gibt: Je bes- nen und Pädagogen unter Umständen als
ser die Muttersprache entwickelt wird, um- recht herausfordernd, wenn sie noch keine
so leichter tun sich die Kinder mit der zwei- Erfahrung damit haben. Die sagen vielleicht
ten Sprache. “Ich weiß nichts über diese Sprachen, wie
Zweitens gibt es viel laufende Forschung soll ich in so einem Kontext unterrichten?
dazu, dass Bilingualität und Mehrsprachig- Ich weiß nicht, wie man diese Sprachen un-
keit die Gehirne von Kindern stimulieren terrichtet.“ Doch ich denke, sie unterschät-
und in Verbindung mit der Zweisprachigkeit zen, was in diesen Situationen möglich ist.
kognitive Vorteile festzustellen sind. Und Die Lehrperson muss die Sprachen nicht
diese Forschung hat in den letzten zehn bis kennen, es dürfte für die meisten unmög-
fünfzehn Jahren dramatisch zugenommen. lich sein, auch nur einen Bruchteil der Spra-
Es ist weithin anerkannt, dass Bilinguali- chen zu kennen, die innerhalb eines diver- dennoch die ganze Idee, was Bildung ist,
tät das Sprachbewusstsein von Kindern er- sen Umfelds in der Klasse zusammen kom- bereichern. Es geht eben nicht nur dar-
weitern kann, ihre Gehirne flexibler macht men. Was Lehrpersonen jedoch tun kön- um, Informationen von der Lehrperson an
und es ihnen erleichtert, weitere Sprachen nen: Sie können den Klassenraum als mehr- die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln.
innerhalb ihrer Schullaufbahn besser zu sprachigen Raum öffnen und den Kindern Es geht darum, einen Raum zu eröffnen, in
erlernen. vermitteln, dass ihre Herkunftssprache ei- dem Kinder zur Lernumgebung beitragen
Ein dritter Punkt ist, dass die gesamte Fra- ne intellektuelle Leistung ist, ein kognitives und voneinander lernen können.
ge nach der Identität und wie Kinder sich Werkzeug und Fundament, nicht nur für ih- Ich möchte den Lehrpersonen, die in die-
mit sich selbst fühlen, sehr wichtig ist in Be- re persönliche, sondern auch ihre akademi- se Arbeit involviert sind, gratulieren. Sie
zug darauf, wie erfolgreich sie sich entwi- sche Entwicklung in der Mehrheitssprache. sind die Speerspitze der Bildung in einem
ckeln werden. Wenn Kinder fühlen, dass sie Wir können voneinander lernen und das Kontext der Diversität. Ich werde ganz si-
in der Klasse akzeptiert werden, dass ihre bezieht die Lehrperson mit ein. cher die Einzelheiten und Beschreibungen,
Kultur und ihre Sprache von ihren Lehrkräf- Es gibt eine Vielfalt an Strategien, die Lehr- was hier passiert, zu meinen kanadischen
ten wertgeschätzt wird und sie diese als Er- personen, Schülerinnen und Schüler in sol- Kolleginnen und Kollegen mitnehmen und
rungenschaft empfinden, dann fühlen sie chen Situationen einsetzen können. Das ich bin sicher, es wird mehr Interaktion zwi-
sich bestärkt in ihrer Identität. Kinder, die „KOALA-Konzept“ und „Gelebte Mehr- schen Pädagoginnen und Pädagogen und
sich in ihrer Identität stark fühlen, beteili- sprachigkeit“ sind Beispiele dafür. Aber Institutionen in der Welt geben, sich zu Ini-
gen sich mehr. schon ganz einfache Dinge, wie zum Bei- tiativen wie diesen auszutauschen.
Diese drei Faktoren umreißen im Kern die spiel, jeden Tag ein oder zwei Kinder zu er-
wissenschaftliche Basis und sie spiegeln muntern, ein Wort aus ihrer Sprache mitzu- Vielen Dank, Professor Cummins!
sich ganz direkt in der Arbeit, die Sie tun. bringen, das ihnen etwas bedeutet. Wenn
Denn die Kinder fühlen sich ganz offen- sie noch klein sind, schreiben die Eltern ih-
sichtlich bestärkt in ihrer Identität, sie sind nen das Wort vielleicht auf. Sie entschei-
info
stolz auf ihre Sprachkenntnisse, ihre Kul- den und erklären selbst, warum sie dieses
Kontakt
tur ist willkommen in der Klasse, sie lernen Wort ausgewählt haben, was es bedeutet
Rosella Benati
voneinander und sie bringen die beiden und dann lernen alle in der Klasse, inklusi- Arbeitsstelle Migration
Sprachen in Kontakt in einer geplanten und ve der Lehrperson, dieses Wort. So haben Bezirksregierung Köln
motivierenden, spannenden Art und Weise. wir jeden Tag unterschiedliche Sprachen Geschäftsführung ZMI
rosella.benati@brk.nrw.de
Auch wenn solche Projekte vielleicht teil- im Klassenraum, die Kinder entwickeln ein
weise einen intuitiven Ursprung haben mö- Bewusstsein für die Worte und wie sie ge-
gen, so gibt es doch auch eine sehr solide schrieben werden, sie finden mehr über die María José Sánchez Oroquieta
wissenschaftliche Basis dafür und die erho- Kulturen ihrer Klassenkameradinnnen und Verbundkoordinatorin des
Verbundes „Koordinierte
benen Daten validieren diese Ansätze. -kameraden heraus und was ihnen wichtig Entwicklung von Lese- und
ist, wie deren Sprachen aussehen und klin- Schreibfähigkeiten in Deutsch
Eine letzte Frage: Möchten Sie den gen. Etwas so Einfaches kann bereits pro- und in der Herkunftssprache
während der Primarstufe“
Lehrpersonen in der Früherziehung funde Auswirkungen auf die Stärkung der
im Programm Bildung durch
und Betreuung etwas sagen? Identität der Kinder sowie auf die Entwick- Sprache und Schrift (BiSS).
lung ihres Sprachbewusstseins haben. Fachberaterin der Arbeitsstelle
Ich denke, wenn wir uns die Art von Päd- Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Es Migration der Bezirksregierung
Köln
agogik anschauen, die in Programmen der gibt eine große Vielfalt an ziemlich einfa- maria.sanchez@brk.nrw.de
Früherziehung und in den ersten Grund- chen Strategien, die nichts kosten und die
zmi-Magazin | 201612 Aus Wissenschaft und Forschung
chen.“
r bei uns sollen die Kinder deutsch spre
„Mehrsprachigkeit finde ich gut, abe
r
Einstellungen pädagogische
keit:
Fachkräfte zu Mehrsprachig
ein Fragebogen
von Dr. Anja Leist-Villis
Die Einstellungen pädagogischer Fachkräfte zu Mehrsprachigkeit sind in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus
der Forschung gerückt. Qualitative Studien können hier in die Tiefe gehen, betrachten aber zumeist nur kleine Stich-
proben, sind dabei zeitaufwändig und in der Praxis nur punktuell zu realisieren. Der hier vorgestellte standardisierte
Fragebogen ermöglicht mit recht geringem Aufwand einen Einblick in die Denkweisen pädagogischer Teams.
„In unserer Schule wird nur deutsch gesprochen, damit die Kinder chung zu schriftsprachlichen Fähigkeiten türkisch-deutscher
mit anderen Muttersprachen es auch gut lernen.“ Ein nachvoll- Grundschülerinnen und -schüler in Köln entstanden.2 Hier wurden
ziehbarer Gedanke: Kinder, die in Deutschland leben, brauchen drei Förderkonzepte miteinander verglichen: die koordinierte Al-
gute Kenntnisse der deutschen Sprache – aber ist das alles? Nein, phabetisierung (KOALA), die Deutschförderung mit und diejenige
denn das deutsche Umfeld ist nur ein Teil der mehrsprachigen ohne muttersprachlichen Ergänzungsunterricht. Der Fragebogen
Lebenswelt dieser Kinder, in der sie all ihre Sprachen brauchen. wurde von 133 Lehrkräften aus zehn Grundschulen beantwortet.
Zudem spielt die Mutter-/ Erstsprache eines Kindes eine wichti- Modifiziert und weiterentwickelt wurde diese Version im Projekt
ge Rolle in seiner Entwicklung – in ihr werden erste Beziehun- „CoLiBi“3 zur Untersuchung der Bedeutung unterschiedlicher Bil-
gen gestaltet, die Welt erkundet, die Persönlichkeit entfaltet. Ent- dungskontexte für die Entwicklung griechisch-deutschsprachiger
sprechend fordert der Nationale Integrationsplan der Bundesre- Schülerinnen und Schüler. Der Fragebogen wurde hier interna-
gierung: „Neben dem Erwerb der deutschen Sprache erkennen tional vergleichend eingesetzt: an einer griechisch-deutschen
die Länder die Bedeutung der Mehrsprachigkeit für alle Kinder Schule in Griechenland, deren gesamtes Konzept auf Zweispra-
und Jugendlichen an. Dies schließt die Herkunfts- oder Familien- chigkeit ausgerichtet ist, und an einer Schule in Deutschland
sprachen der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit griechisch-deutschem Zweig. Auf Basis der hier ausgefüllten
ein. Es sind geeignete Maßnahmen zu identifizieren, die das Prin- 138 Bögen wurde die vorliegende Endfassung des Fragebogens
zip der Mehrsprachigkeit im Schulalltag angemessen verankern.“1 erstellt.
Was aber ist „angemessen“? Unter welchen Bedingungen können Diese enthält 22 Aussagen (Items) zu Mehrsprachigkeit, die zum
sich Kinder in harmonischer Weise zweisprachig entwickeln? Sie einen generelle Einstellungen – Die Zweisprachigkeit zweispra-
brauchen Möglichkeiten, beide Sprachen zu hören und zu spre- chiger Kin der ist als besondere Kompetenz anzuerkennen –,
chen. Und sie brauchen ein Umfeld, in dem Mehrsprachigkeit posi- zum anderen konkrete Umgangsformen – Ich beziehe alle
tiv begegnet wird. Tatsächlich aber geht der Eintritt anders-/zwei- Sprachen der Schülerinnen und Schüler in den Unterricht mit
sprachiger Kinder in den einsprachig ausgerichteten Kindergarten ein – beschreiben. Angesetzt wurde eine vierstufige Likert-Skala
oftmals mit einem Bruch in ihrer sprachlichen – und damit gesam- mit der zusätzlichen Antwortmöglichkeit ich weiß nicht. Die
ten – Entwicklung einher. Schnell bekommen sie den Eindruck, Gesamtskala weist eine Reliabilität von 0.86 (Cronbach’s Alpha)
dass hier allein Deutsch wichtig ist. Ihre andere Sprache stagniert auf. Die Faktorenanalyse zur Prüfung der Validität ergab zudem
oder beginnt zu verkümmern. die Eindimensionalität der Items. Reliabilität und Eindimen-
Nach wie vor sind diese Themen nicht selbstverständlich Inhalt der sionalität sind zentral für die Qualität einer solchen Skala und
Ausbildung von Erzieherinnen und Lehrkräften. So bleibt der Umgang Voraussetzung dafür, dass die einzelnen Werte zusammengefasst
mit Mehrsprachigkeit vor Ort zumeist den einzelnen Personen selbst
2 Initiiert durch die Bezirksregierung Köln und federführend durchgeführt
überlassen. Es lohnt sich also, genauer hinzuschauen: Wie denken
durch Prof. Hans H. Reich, Universität Landau. Reich, Hans H. (2011). Schrift-
sie darüber? Welches Klima schaffen sie in ihrer Einrichtung durch sprachliche Fähigkeiten türkisch-deutscher Grundschülerinnen und -schüler in
ihre Haltung gegenüber und ihren Umgang mit Mehrsprachigkeit? Köln. Ein Untersuchungsbericht. Köln. Abrufbar unter http://www.zmi-koeln.
de/index.php/materialien/Allgemeine-Dokumente/Koala/Evaluation-KOALA.
Entwicklung eines Fragebogens pdf/; Reich, Hans H. (2016). Auswirkungen unterschiedlicher Sprachförderkon-
zepte auf die Fähigkeit des Schreibens in zwei Sprachen. In: Peter Rosenberg
Der hier vorgestellte Fragebogen „Einstellungen pädagogischer und Christoph Schroeder, Mehrsprachigkeit als Ressource in der Schriftlichkeit,
Fachkräfte zu Mehrsprachigkeit“ ist im Rahmen einer Untersu- Berlin, S. 177 – 205.
3 In CoLiBi kooperierten Wissenschaftlerinnen der Aristoteles-Universität
Thessaloniki (Prof. Ianthi Tsimpli und ihr Team) und der Universität zu Köln
1 Die Bundesregierung (2007). Der Nationale Integrationsplan. Berlin, S. 26. (Prof. Christiane Bongartz, Prof. Argyro Panagiotopoulou und Teams).
zmi-Magazin | 2016Aus Wissenschaft und Forschung 13
und Durchschnittswerte, Streuungen, Signifikanzwerte usw. Lehrkräfte Eltern mit nicht-deutscher Muttersprache, mit ihren Kin-
errechnet werden können. dern möglichst viel Deutsch zu sprechen. Tatsächlich finden sich 24
Der Fragebogen ist so konzipiert, dass er sowohl in elementar- Lehrkräfte, die beide Items mit trifft eher zu beantworten, obwohl
pädagogischen als auch in schulischen Einrichtungen eingesetzt es sich doch eigentlich um gegensätzliche Aussagen handelt. Selbst
werden kann. Übertragen in weitere Sprachen eignet er sich für wenn vielleicht unterschiedliche Deutschkenntnisse der Eltern diese
internationale Vergleiche. verschiedenen Ratschläge verursachen, zeigt sich hier eine deutliche
Unsicherheit der Lehrkräfte, die für Rat suchende Eltern hoch prob-
Erste Ergebnisse aus der Forschung lematisch werden kann.
Die zusammenfassende Auswertung der Daten aus den beiden Alarmierend ist schließlich die Bewertung des Items Es ist in Ord-
oben skizzierten Projekten ergibt drei signifikante Zusammenhänge: nung, wenn Kinder gleicher Familiensprache in der Schule au-
ßerhalb des Unterrichtes untereinander ihre nicht-deutsche
• Die Bewertung grundsätzlicher Aussagen zu Mehrsprachigkeit
Sprache sprechen: Dazu gibt es zwar eine hohe Zahl von Zustim-
ist insgesamt positiver, als diejenige praxisbezogener Items.
mungen, jedoch stimmen 17% der Lehrkräfte hier eher nicht und
• Je positiver die Einstellung einer Lehrkraft ist, desto unterstüt-
21% überhaupt nicht zu.
zender ist auch ihr konkreter Umgang mit Mehrsprachigkeit.
• Diejenigen Lehrkräfte, an deren Schulen Zweisprachigkeit ei-
Konkrete Impulse für Teamentwicklung
nen vergleichsweise hohen Stellenwert einnimmt, antworten
signifikant positiver. Aus den Ergebnissen lassen sich konkrete Impulse für die Team-
und Konzeptarbeit an dieser Schule ableiten: Was hindert die
Es fällt also vielen Lehrkräften leichter, Zweisprachigkeit grund- Lehrkräfte daran, die Sprachen ihrer Schülerinnen und Schüler
sätzlich zu akzeptieren und als positiv anzusehen, als dies auch in stärker in den Schulalltag einzubeziehen? Welche ganz konkreten
ihr Handeln umzusetzen. Dabei scheinen es vor allem die institu- Möglichkeiten können hierzu erarbeitet werden? Wie empfinden
tionellen Rahmenbedingungen – etwa die monolinguale Ausrich- die Schülerinnen und Schüler das Klima bezüglich Mehrsprachig-
tung der Bildungseinrichtung – zu sein, die die praktische Umset- keit an ihrer Schule? Ein zentrales Thema für eine Fortbildung
zung der eigentlich positiven Einstellung erschweren. dieses Kollegiums wäre sicher die Bedeutung der Muttersprache
für die kindliche Entwicklung und damit zusammenhängend die
Interne Evaluation pädagogischer Teams Frage, wie man Eltern am besten unterstützt. Die Items aus dem
Zusammengefasste Werte bieten eine gute Basis für vergleichende Fragebogen eignen sich dabei als konkrete Diskussionsgrundlage.
Analysen, zugleich liegt es in ihrer Natur, dass sie die Realität ver-
kürzt abbilden. Es lohnt sich daher der Blick in die Details – hier ex- Fazit & Ausblick
emplarisch anhand ausgewählter Ergebnisse der 83 Lehrkräfte der In der zweisprachigen Entwicklung von Kindern spielen Einstellun-
Schule mit griechisch-deutschem Zweig aus dem CoLiBi-Projekt. gen pädagogischer Fachkräfte eine wichtige Rolle. Es empfiehlt sich
87% der Lehrerinnen und Lehrer stimmen der Aussage zu, dass die daher, diese stärker in den Blick zu nehmen. Wenn immer noch
Förderung der Zweisprachigkeit eine wichtige Aufgabe der Schule zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer der Meinung sind, dass auf dem
ist. Dies spiegelt sich in der konkreten Umsetzung jedoch nur mä- Schulhof auch von anderssprachigen Schülerinnen und Schülern un-
ßig wider: Immerhin noch 58% der Lehrkräfte geben an, dass sie tereinander deutsch gesprochen werden soll; wenn viele Fachkräfte
die Schülerinnen und Schüler ermuntern, all ihre Sprachen in das unsicher sind, wie sie Eltern beraten können, kann dies nur als ein
Schulleben einzubringen. Gefragt, ob sie alle Sprachen der Schü- dringender Appell an Forschung und Lehre aufgefasst werden: Es
lerinnen und Schüler in den Unterricht mit einbeziehen, antworten muss noch besser gelingen, wissenschaftliche Erkenntnisse in die
dann 40% der Lehrerinnen und Lehrer mit überhaupt nicht, und Praxis zu transportieren. Ein höherer Stellenwert dieser Themenbe-
31% mit eher nicht. Für viele Lehrkräfte scheint also trotz Achtung reiche in Aus-/Fortbildung ist dringend nötig: Wissen, aber auch
und Wertschätzung der Zweisprachigkeit generell eine durchgehen- die Auseinandersetzung mit der Entstehung eigener Haltungen
de Trennung der Sprachen erstrebenswert – oder ist es vielmehr die trägt wesentlich zur bewussten Reflexion und Veränderung bei. Der
Unsicherheit, wie Sprachen stärker einbezogen werden können, die vorgestellte Fragebogen bietet sowohl für Forschung, als auch für
sich hier spiegelt? Darauf deutet die mit 18% recht hohe Anzahl (Selbst)reflektion einen strukturierten Einstieg.
von ich weiß nicht-Stimmen bezüglich der Aussage Es gibt im
deutschsprachigen Unterricht Situationen, in denen die Ver- info
wendung von nicht-deutschen Familiensprachen durch die Kontakt
Schülerinnen und Schüler sinnvoll ist. Dr. Anja Leist-Villis
Bonn
Ambivalent fallen die Antworten zur Beratung der Eltern aus: So
geben zwar 69% der Lehrerinnen und Lehrer an, dass sie Eltern www.zweisprachigkeit.net
prinzipiell darin unterstützen, ihre Muttersprache mit ihren Kindern info@zweisprachigkeit.net
zu sprechen. Im Widerspruch dazu raten aber ebenfalls 69% der
zmi-Magazin | 201614 Aus Wissenschaft und Forschung
a n sn a ti o n a le B io g ra p h ie n:
Tr
Exkursion nach Istanbul
t und Sandra Tietjens
von Stefanie Magdalene Helber
Zum zweiten Mal hatten Masterstudierende der Interkulturellen Bildungs- die Befragten beispielsweise als Deutsche,
forschung der Universität zu Köln die Möglichkeit, im Rahmen eines Semi- die in der Türkei leben, oder als Türkinnen
nars an einer Exkursion nach Istanbul teilzunehmen; der einzigen Stadt, die und Türken, die lediglich in Deutschland
auf zwei Kontinenten zugleich liegt. Der thematische Schwerpunkt der von geboren sind – Nationalität war in jedem
Dipl.-Päd. Tim Wolfgarten geleiteten Exkursion lag in diesem Jahr auf dem Gespräch ein Begriff. Wie kommt das? Es
Konzept von Transnationalität. liegt nahe, dass man sich außerhalb von
Universitäten kaum mit solchen Theorien
„Transnational“ – das Wort ist Mit diesen Fragen im Gepäck fuhr die Ex- beschäftigt. Es zeigt auch, dass die Idee der
in aller Munde kursion nach Istanbul, das durch seine be- nationalen Zugehörigkeit und alles, was
Konzerne bezeichnen sich heute als „trans- sondere Transitlage weltweit einmalig ist damit einhergeht, fest in unseren Denk-
national“, wenn sie Geschäftsstellen in ver- und somit ein optimales Forschungsfeld bei strukturen verankert ist. Ob weltweite Mig-
schiedenen Staaten haben; und auch eine län- der Auseinandersetzung mit dieser Thema- rationsbewegungen, die alle Gesellschafts-
derübergreifende Vernetzung terroristischer tik. Aufgesucht wurden deutsch-türkische schichten durchziehen, in Zukunft eine
Organisationen bekommt das Label „trans- Gesprächspartnerinnen und -partner in Veränderung in diesem Gebiet bewegen?
nationaler Terrorismus“ aufgedrückt. Einfach verschiedenen Bildungseinrichtungen und
ein schickes Wort für inter- oder multinatio- kulturellen Institutionen, die jeweils ganz Sprache als Ressource
nal? Was soll der Begriff tatsächlich umschrei- unterschiedliche, aber allesamt zumindest Sprache wurde in allen Gesprächen als eine
ben? Und was ist ein transnationaler Raum per Definition transnationale Biographien der wichtigsten Ressourcen für den berufli-
oder eine transnationale Biographie? besitzen. In den geführten Gesprächen galt chen und privaten Werdegang genannt. Mit
„Transnational“ ist ein Prozess, in dem Be- es herauszufinden, ob und wie sich die je- einer einzigen Ausnahme waren alle Be-
ziehungen, soziale Praktiken und Symbol- weilige Person im Konzept des Transnatio- fragten bilingual groß geworden. Türkische
systeme geschaffen werden, die national- nalismus wiederfindet. Des weiteren sollte Sprachkenntnisse wurden als obligatorische
staatliche Grenzen überschreiten. Doch geklärt werden, welche persönlichen Res- Voraussetzung oder als hilfreiche Zusatz-
umgangssprachlich wird der Begriff recht sourcen die Interviewten als entscheidend kenntnis für die aktuelle berufliche Tätigkeit
konfus verwendet. Oft wird verkannt, dass für ihren beruflichen und privaten Lebens- genannt, waren aber auch bedeutend für das
es hier, anders als bei den Begriffen inter- abschnitt in Istanbul empfinden. Dabei familiäre Zusammenleben und das private
national und multinational, ausschließlich trugen grobe Leitfragen zu einem erfreulich Umfeld. Teilweise wurden Sprachkenntnisse
um zwischenmenschliche Beziehungen und offenen und dynamischen Austausch bei. sogar mit Kenntnissen über eine Kultur oder
Netzwerke geht. Ein Konzern oder eine Or- Den meisten Interviewten könnte der The- Lebensart gleichgesetzt. Aber nicht immer
ganisation könnten demnach selber gar orie zufolge eindeutig eine transnationale wurden Sprachkenntnisse in positivem Licht
nicht transnational sein, lediglich ihre Mit- Biographie zugeschrieben werden, und alle gesehen: Die Befragten sahen in ihnen auch
arbeitenden können individuell transnatio- pflegen privat und beruflich Beziehungen einen Stolperstein. Personen, die das Tür-
nale Netzwerke haben. über die Grenzen der Türkei hinaus. kische nicht als Erstsprache erlernt hatten,
In den Bildungswissenschaften wird ger- Doch das Konzept der Transnationalität bedauerten den begrenzten Rahmen von
ne das Konzept transnationaler sozialer scheint bisher in der Lebenswelt der Men- Ausdrucksmöglichkeiten, der verschiedene
Räume aufgegriffen, zwischenmenschliche schen nicht aufzutauchen. So sahen sich Türen verschlossen hält. Wird die Sprache
Verflechtungen, die multi-lokal sind und
einen neuen Raum konzipieren, der All-
tagspraxis, sowie Biographie und Identität
von Personen leitet und über den sozialen
Zusammenhang der Nationalität hinaus-
geht. Aber ist dies im realen Leben tatsäch-
lich so vorzufinden? Wie darf man sich eine
transnationale Biographie vorstellen? Ver-
orten sich Menschen, die theoretisch eine
solche besitzen, auch in diesem Konzept?
zmi-Magazin | 2016Praxis und PAus
rojWissenschaft und Forschung
ekte 15
gut beherrscht, besteht wiederum die Gefahr, Aktuelles aus dem ZMI
unangenehm aufzufallen, wenn bestimmte
kulturelle Codes oder Alltagspraktiken nicht
bekannt sind, die andere Sprecherinnen und
Specher unhinterfragt voraussetzen. Im wis-
senschaftlichen Bereich wurde auf die gerin-
gere Reichweite von Publikationen verwiesen,
die nicht auf Englisch verfasst werden, sondern
– in diesem Fall – auf Deutsch oder Türkisch.
Kultur wurde immer wieder als Ressource ge-
nannt, die hilfreich bei einer Migration oder
für den Beruf war. Bei genauerem Nachfragen
stellte sich aber heraus, dass viele Personen
unter Kenntnis der Kultur Sprachkenntnis ver-
stehen. Sprache scheint nicht nur als Haupt-
kriterium für den Zugang zu Beruf und Privat-
leben, sondern auch als Basis für kulturelles
Verständnis gesehen zu werden.
Bei einem Besuch in dem regierungskritischen
Kulturzentrum Depo hinterließ die Ausstel- Identitäten in Köln –
lung zum kurdischen Frühjahrsfest noch einen ein Projekt des
Museumsdienstes Köln
weiteren Eindruck in Bezug auf Sprache. Bis-
mit dem ZMI-Köln im Museum
her waren nur Sprachen betrachtet worden, Ludwig
die einen gewissen wirtschaftlichen Nutzen von Karin Rottmann und Anke von
Heyl
mit sich bringen. Doch wie sieht es eigentlich
mit den Sprachen aus, die von Minderheiten
gesprochen werden und diesen Nutzen nicht
bieten? Kurdisch ist bekanntlich ein heikles 99 Schülerinnen und Schüler aus neun verschiedenen Herkunfts-
Thema in der Türkei und wird trotz zahlreicher sprachenklassen beschäftigten sich im Museum Ludwig mit Candi-
Sprecherinnen und Sprecher kaum an Schulen da Höfers Fotoserie „Türken in Deutschland“ und realisierten dort
unterrichtet. In der interkulturellen Bildung eine Ausstellung mit eigenen Arbeiten.
wird die Forderung immer lauter, auch Minder- Ein Schulhalbjahr lang haben sich die Schülerinnen und Schüler im ak-
heitensprachen aktiv in Bildungsinstitutionen tuellen Projekt „Identitäten in Köln“ mit der Frage nach ihrer Identität
anzubieten. in einer deutschen Lebenswelt und den Anteilen ihrer Herkunftskultur
Im Laufe der Exkursion haben die Studierenden darin beschäftigt. Sie stellten sich der Frage, wie sich dies mit den
eine sehr differenzierte Sichtweise auf Sprache Mitteln der Fotografie darstellen lässt. Die berühmte Fotoserie von
als Ressource gewinnen können und diese als Candida Höfer, aber auch andere Kunstwerke aus dem Museum Lud-
Symbol für die Zugehörigkeit zu sozialen Grup- wig halfen dabei, die Thematik formal und inhaltlich zu erschließen.
pen, Ländern und Kulturen, aber auch als po-
tenziellen Stolperstein kennengelernt. Im Fokus der Unterrichtseinheiten, die die einzelnen Kolleginnen geplant haben,
stand die Auseinandersetzung mit dem Umfeld der Kinder. Wie erleben sie sich
info und ihre Herkunftskultur in der kölnischen Gesellschaft? Da wurden Kinderzimmer
Stefanie Magdalene Helbert, B.A. erforscht, die Wohnstraße, Geschäftsviertel und Supermärkte. Es wurden Famili-
s.m.helbert@uni-koeln.de enfeste dokumentiert oder Tagesabläufe untersucht.
Studentin im Masterstudiengang
Mit dem Fotografen Maurice Cox wurde in Workshops die Frage beantwortet,
Interkulturelle Kommunikation
und Bildung
was ein gutes Foto ist. Danach folgte die Motivsuche und es wurden Qualitätskri-
Universität zu Köln terien dafür diskutiert.
Im Museum Ludwig konnten ausgewählte Kunstwerke anhand einiger Leitfragen
analysiert werden: Was erzählt das Bild über den Ort? Was erfahren wir über die
Sandra Tietjens, B.A.
Menschen? Welche Bedeutung haben die Dinge? Mit Hilfe des Creative Writing
stietjen@smail.uni-koeln.de
Studentin im Masterstudiengang gelangen Texte, die für den Unterricht beispielgebend sein können. Vor den Som-
Interkulturelle Kommunikation merferien des Schuljahres 2016 sollten dann aus den Projektklassen jeweils zehn
und Bildung
Fotos für eine Ausstellung im Museum Ludwig eingereicht werden. Die Schüle-
Universität zu Köln
rinnen und Schüler mussten ihre Fotos selbst auswählen. So konnten sie selbst
zmi-Magazin | 2016Sie können auch lesen