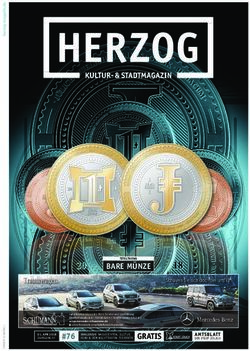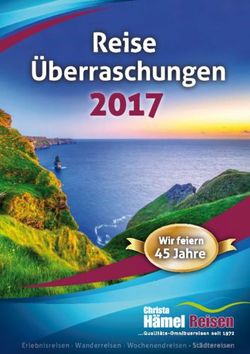WAS MACHT EINE STADT FÜR ALLE AUS? IMPULSE UND EMPFEHLUNGEN FÜR EIN SOLIDARISCHES GÖTTINGEN - STADTLABOR: MIGRATION BEWEGT GÖTTINGEN EIN ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
WAS MACHT EINE
STADT FÜR ALLE
AUS? IMPULSE UND
EMPFEHLUNGEN FÜR
EIN SOLIDARISCHES
GÖTTINGEN
STADTLABOR: MIGRATION BEWEGT GÖTTINGEN
EIN KOOPERATIONSPROJEKT ZWISCHEN WISSENSCHAFT,
KULTUR UND ZIVILGESELLSCHAFT (MÄRZ 2019 – MÄRZ 2020)KURZZUSAMMENFASSUNG 4
1 STADTLABOR: MIGRATION BEWEGT GÖTTINGEN 5
2 STADT, MIGRATION UND DIE GESELLSCHAFT DER VIELEN 8
– EINE HINLEITUNG AUS DER PERSPEKTIVE DER MIGRATIONSFORSCHUNG
3 LABORE ALS KATALYSATOR FÜR DIE POSTMIGRANTISCHE GESELLSCHAFT? 12
DREI THESEN ZUM ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UNTER LABORFORMATEN
4 MIGRATION UND TEILHABE IN GÖTTINGEN 16
I Migrantische selbstorganisationen 17
4.1. Migrationsorganisationen als selbstständige Akteure der 18
Integrationsarbeit - ein Praxisbeispiel
4.2 „Dafür bräuchte es einen Dichter, der das dokumentiert“ - 21
ein Arbeitsbericht
ii integration und PartiziPation – bestandsanalyse des städtischen 25
institutionellen handelns
4.3 Was macht Teilhabe für Alle aus? Defizite und Bedarfe aus 26
der Perspektive der Ehrenamtsarbeit
4.4 Erfahrungsaustausch zum kommunalen Integrationskonzept 28
4.5 Sicherer Hafen „Göttingen“ und seine schleppende Umsetzung 29
4.6 Menschen ohne Krankenversicherung in Göttingen 32
4.7 Monitoring institutionellen Rassismus – ein Erfahrungsbericht 34
iii Kulturelle PartiziPation und (selbst)rePräsentation 36
4.8 Perspektivenvielfalt spiegeln: Theater in der migrantischen 37
Gesellschaft
4.9. „Verschiedenheit ist unsere einzige gemeinsame Chance“ 40
– Theaterarbeit diversifizieren
4.10 Das Museum im Labor. Third Spaces und Contact Zones 42
in der Migrationsgesellschaft
iV alltagserfahrungen Mit disKriMinierung und ausschluss in der stadt göttingen 45
4.11 Auch in Göttingen: Arbeit zwischen Integration und Ausbeutung 46
4.12 Nachhaltige Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Göttingen: 48
Defizite und Errungenschaften in Göttingen seit 2015
4.13 Migrantische Alltagserfahrungen in Göttingen. Ausgrenzung, 50
Allianzen und die Schaffung ,eigener‘ urbaner Orte
4.14 Die Situation von geflüchteten Frauen und Mädchen in Göttingen 53
4.15 Wer hat Angst vorm Waageplatz? Racial Profiling in der nördlichen 55
Innenstadt
4.16 Dann nehmen wir’s eben selbst in die Hand: Nachbarschaftliche 57
Teilhabe in der nördlichen Innenstadt
4.17 Internationale Studierende im Stadtlabor: Göttingen jenseits des 59
Studienalltags
5 IMPULSE UND EMPFEHLUNGEN FÜR EIN SOLIDARISCHES GÖTTINGEN 61
6 EPILOG 63
7 ÜBER DIE BEITRAGENDEN 68
8 LITERATUR 71
9 ANHANG 73Was macht eine Stadt für alle aus?
Impulse und Empfehlungen für ein solidarisches Göttingen
Eine Bilanz des Stadtlabor-Prozesses
KURZZUSAMMENFASSUNG
Die vorliegende Broschüre zieht eine vorläufige Bilanz und reflektiert die Debatten um Göttingen als Einwan-
derungsstadt, wie sie in dem letzten knappen Jahr im Rahmen des Stadtlabors „Migration bewegt Göttingen“
stattfanden: Das Stadtlabor zog im Juni in die alte Kranichapotheke in Göttingen ein als ein Experiment des
Austauschs, der Begegnung und des gegenseitigen Lernens zwischen Wissenschaft, Kulturinstitutionen und
verschiedenen Gruppen und Initiativen der Göttinger Zivilgesellschaft. Dabei ging es zentral um Erfahrun-
gen, Perspektiven, und Zukunftsvorstellungen, was eine „Stadt für Alle“ unabhängig von Herkunft oder Auf-
enthaltstitel ausmacht, die die Vielheit ihrer Stadtbewohner*innen – nicht als Problem, sondern als Normal-
zustand – zum Ausgangspunkt für die Frage nach Teilhabe macht.
Das Stadtlabor wurde von sehr verschiedenen Gruppen, mit und ohne Migrationserfahrung, für sehr ver-
schiedene Veranstaltungen und Projekte genutzt – von der Schreibwerkstatt, über Videoproduktionen, The-
atervorstellungen und Debatten um den Göttinger Integrationsplan. Doch was sich wie ein rotes Band durch
die verschiedenen Aktivitäten und Diskussionen hindurchgezogen hat, war eine Analyse von Stärken und
Schwächen der städtischen Infrastrukturen und Ressourcen der Wohlfahrt, der Bildung, der Arbeit, der Ge-
sundheit oder der kulturellen Teilhabe sowie von Bedarfen – oftmals aus der Perspektive von „Betroffenen“,
von Menschen, die als Migrant*innen und als Flüchtlinge gelabelt, Ausschluss und Diskriminierung erleben,
die aber auch viele Geschichten aus anderen Gesellschaften, von Flucht und Ankommen mitbringen und die
weiterhin dorthin Verbindungen halten. Beteiligt haben sich auch zahlreiche sogenannte „Ehrenamtliche“
und Aktive aus verschiedenen Bereichen der Unterstützungs- und Beratungsarbeit. Zusammengekommen
ist so eine Expertise und Potpourri an Stimmen, welche immer noch in den Debatten über Einwanderung
und Integration zu gerne überhört und nicht wahrgenommen werden. Die vorliegende Broschüre fasst diese
Expertisen und Stimmen zusammen und präsentiert 17 verschiedene Analysen bzgl. der städtischen Einwan-
derungsrealität in Göttingen.
Wie ein roter Faden ziehen sich die Forderungen nach mehr Partizipation, Teilhabe und Solidarität durch die
differenzierte Bestands- und Bedarfsanalyse: 1. Migrantische Selbstorganisationen gelte es mit ihrer Exper-
tise und in ihrer Mittlerrolle verstärkt anzuerkennen und zu fördern. 2. Integration gestalten erfordert auch,
insbesondere seitens städtisch institutionellen Handelns, Zugänge zu öffnen und Mitbestimmung zu ermögli-
chen. 3. Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich verstärkt auch in Kultureinrichtungen und kultureller (Selbst-)
Repräsentation abbilden. 4. Diskriminierung und strukturellen Ausschlüssen – im Alltag, auf dem Arbeits-
und Wohnungsmarkt und in der Gesundheitsversorgung – ist wirksam entgegenzuwirken.
4 | KURZZUSAMMENFASSUNG1. STADTLABOR:
MIGRATION BEWEGT GÖTTINGEN
Dr. Jelka Günther
(Centre for Global Migration Studies, Georg-August-Universität Göttingen)
Was macht eine Stadt für alle aus? Wie kann Göttingen zu einer Stadt für
alle werden? Diese Fragen haben Göttinger Migrationswissenschaftler*innen,
Kunst- und Kulturschaffende, Praktiker*innen und Ehrenamtliche neun
Monate lang in einer ehemaligen Apotheke debattiert.
Was macht eine Stadt für alle aus, in der alle Men- Solidarische Städte
schen unabhängig von Herkunft, Nationalität oder
Aufenthaltsstatus das Recht haben zu leben, zu woh- Seit jeher sind Städte als unterste lokale Verwaltungs-
nen und zu arbeiten? einheit gewissermaßen gezwungen, Antworten auf
die Heterogenisierung der Gesellschaft zu finden.
Um dieser Frage im Austausch mit der Göttinger Be- Integration wird zuallererst auf kommunaler Ebe-
völkerung nachzugehen, haben Wissenschaftler*in- ne gestaltet. Hier entscheidet sich, wie Teilhabe und
nen des Centre for Global Migration Studies (CeMig) Chancengerechtigkeit allen, Alteingesessenen und
an der Georg-August-Universität Göttingen sowie Neuzugewanderten, zuteilwird. Angesichts der zu-
Kunst- und Kulturschaffende vom Freien Theater nehmend restriktiver ausgelegten Migrations- und
boat people projekt, Museum Friedland und Literari- Asylpolitik vieler Nationalstaaten und der neuerli-
schen Zentrum Göttingen e.V. eine ehemalige Apothe- chen Abschottungspolitik der Europäischen Union ist
ke zu einem Veranstaltungs- und Begegnungsraum die Bedeutung der Städte und Kommunen in Migrati-
umfunktioniert. Das „Stadtlabor: Migration bewegt onsfragen jüngst noch weiter gestiegen. Immer mehr
Göttingen“ lud zur Diskussion darüber ein, wie städ- Stadtregierungen und -verwaltungen fordern eine
tisches Zusammenleben, das von zunehmender Di- pragmatischere und liberalere Flüchtlingspolitik. So
versität geprägt ist, im Sinne aller gestaltet werden ist auch Göttingen im September 2019 per Ratsbe-
kann. Entgegen der mit Ressentiments aufgeladenen schluss eine von mittlerweile rund 120 Städten ge-
öffentlichen Debatte um Flucht, Migration und Inte- worden, die sich als „Sichere Häfen“ verstehen und
gration, die spätestens seit dem „langen Sommer der sich somit bereit erklären, aus dem Mittelmeer Geret-
Migration“ 2015 wieder an Fahrt aufgenommen hat, tete direkt aufzunehmen. Sie stellen sich damit gegen
sollten Möglichkeiten, Chancen und Potentiale statt die Schließung der europäischen Außengrenzen und
Probleme in den Blick genommen werden; konkret fordern neben der Ermöglichung legaler Fluchtwege
und praxisnah vor Ort. Inspiration dafür gaben Be- eine Neuregelung der europäischen Verteilungspo-
wegungen aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwal- litik. Graswurzelinitiativen, die sich unter dem Na-
tung, die sich in vielen Städten Deutschlands und men „Solidarity City“ zusammenfinden, unterneh-
Europas aktiv für eine offene Gesellschaft und ein so- men praktische Versuche, Rechte und Zugänge nicht
lidarisches Miteinander einsetzen. Von März 2019 bis entlang nationaler Bürger*innenschaft oder auslän-
März 2020 hat das Niedersächsische Ministerium für derrechtlichem Aufenthaltsstatus zu organisieren,
Wissenschaft und Kultur mit Mitteln aus dem Nie- sondern über Zugehörigkeit zur „Stadtgesellschaft“
dersächsischen Vorab der Volkswagenstiftung diesen („urban citizenship”). Projekte wie die Konkretisie-
Dialog zwischen Hochschule und Zivilgesellschaft rung einer städtischen Identitätskarte für alle Stadt-
um die Zukunft der Einwanderungsgesellschaft ge- bewohner*innen in Bern, die Einführung eines ano-
fördert. nymen Krankenscheins in Berlin oder die Gründung
JELKA GÜNTHER | 5Die Ausstellung „Eine Stadt für alle“ des Museum Friedland im Stadtlabor (Leon-Fabian Caspari)
eines Wohn- und Kulturzentrums für Geflüchtete der Stadtgesellschaft. Das Stadtlabor kam damit ohne
und interessierte Münchener*innen zeigen gangbare die üblichen Einteilungen der Integrationsdebatte
Wege auf, um Ausgrenzungs-, Rechtsradikalismus- aus, in der die Mehrheitsgesellschaft Erwartungen an
und Populismustendenzen entgegenzuwirken. Migrant*innen formuliert. Es bot einen Reflektions-
und Artikulationsraum – ein Labor – um Perspekti-
Das Labor als Kontaktzone zwischen Wissenschaft, ven, Bedarfe und Anstrengungen der Selbsteingliede-
Kunst, Kultur und Praxis rung aus Sicht der Migration bzw. der Alltäglichkeit
der Einwanderungsgesellschaft in den Blick zu neh-
Von Juni 2019 bis Februar 2020 haben die Projektini- men. Das Stadtlabor wurde so zu einem neuen, hy-
tiator*innen eine ehemalige Apotheke in der Göt- briden Raum, in dem unterschiedliches Wissen aus
tinger Innenstadt zum Ausgangspunkt gemacht, um Forschung, Kunst- und Kulturproduktion sowie Pra-
über derartige Praxisbeispiele aus anderen Städten xis gleichermaßen berücksichtigt und wechselseitig
und Erkenntnisse aus der aktuellen Migrationsfor- relevant gemacht werden konnte. Es wurde ein Raum
schung mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kom- der gesellschaftlichen Selbstreflektion und Auseinan-
men. Statt „über“ die Stadtgesellschaft zu forschen dersetzung, in dem Perspektiven und Deutungen aus
und zu sprechen (wie es von einigen seit der „Flücht- unterschiedlichen Kontexten gleichberechtigt mit-
lingskrise“ empfunden wurde), wurden Akteure der einander in Austausch treten konnten. So konnten
Stadtgesellschaft als Expert*innen ihres Felds an- Erkenntnisse aus der aktuellen Migrationsforschung
gesprochen und einbezogen. Professionelle Organi- künstlerisch übersetzt und in neue, für übliche aka-
sationen, aktivistische Initiativen und ehrenamtli- demische Formate schwer erreichbare Zusammen-
che migrantische Selbstorganisationen nutzten das hänge vermittelt werden. Gleichzeitig wurden neue
Stadtlabor nicht nur als physischen Ort für ihre Ple- Forschungsperspektiven direkt aus der Diskussion
nen, Bündnistreffen und Veranstaltungen, sondern mit praktischen Erkenntnissen entwickelt und neue
auch als sozialen Ort der Vernetzung und des Dialogs. Formen der Kooperation auch mit Einrichtungen der
Im Mittelpunkt standen die oftmals überhörten und Stadtverwaltung erdacht. Die Leitbilder Partizipation
vernachlässigten Perspektiven und Stimmen von Ge- und Kommunikation prägten auch das Schaffen und
flüchteten, Migrant*innen aber auch Expert*innen Wirken der Beteiligten aus Kunst und Kultur. Denn
6 | STADTLABOR: MIGRATION BEWEGT GÖTTINGENTheater, Literatur und Museum sind nicht nur Beob- und aus ihrer Sicht eine Bestands- und Bedarfsanaly-
achter gegenwärtiger Aushandlungsprozesse in einer se der migrations- und integrationspolitischen Gege-
Gesellschaft der Vielen, sondern auch Impulsgeber benheiten in Göttingen vorzunehmen. Hieraus erge-
und Visionäre für gesellschaftspolitische Signale in ben sich konkrete Impulse und Empfehlungen in den
die Zukunft. Das Stadtlabor verstand sich auch in die- folgenden Themenbereichen:
ser Hinsicht als Teil eines Suchprozesses und eines
Experimentierens mit neuen Formaten, welche Le- - Migrantische Selbstorganisationen als Akteure der
sungen, Theater und Museen als interaktive contact Integrationsarbeit
zone neu und demokratischer zu gestalten versuchen.
Räumlich wurde das Stadtlabor zwar aufgrund der - Integration und Partizipation – Bestandsanalyse
Finanzierung nur für kurze Zeit geschaffen - die ent- des städtischen institutionellen Handelns
standenen Kontakte, die neuen Verknüpfungen und
Kooperationen sowie die neuen Einsichten werden - Kulturelle Partizipation und (Selbst)Repräsentation
aber mit Sicherheit in der ein oder anderen Form
fortgesetzt. - Alltagserfahrungen mit Diskriminierung und
strukturellen Ausschlüssen in der Stadt Göttingen
Was Göttingen bewegt – zur Broschüre
Gerade in der Vielfalt der unterschiedlichen Zugän-
ge und Positionierungen, die im Stadtlabor erstmals
zusammenkamen, lag die Chance, gemeinsam Bilanz
zu ziehen, einzelne Praxisfelder zu durchleuchten
und Bedarfe und Handlungsideen zu formulieren.
Die praktischen Empfehlungen, wie Teilhabe ver-
bessert und Empowerment gestaltet werden könnte,
stehen hier somit als Visionen, wie Göttingen immer
mehr von allen zu einer Stadt für alle gemacht wer-
den könnte. Für die Broschüre wurden die am Stadt-
labor sich aktiv beteiligenden Gruppen gebeten, aus
den Resultaten ihrer Veranstaltungen im Stadtlabor
Das Stadtlabor in einer ehemaligen Apotheke gegenüber dem Neuen Rathaus in Göttingen (Leon-Fabian-Caspari)
JELKA GÜNTHER | 72. STADT, MIGRATION UND DIE GESELL-
SCHAFT DER VIELEN – EINE HINLEITUNG
AUS DER PERSPEKTIVE DER
MIGRATIONSFORSCHUNG
Prof. Dr. Sabine Hess
(Institut für Kulturanthropologie/ Europäische Ethnologie, Georg-August-Universität
Göttingen)
lichen Graden ihres rechtlichen, sozialen, politischen,
„Nicht die Gemeinschaft der Gleichen ökonomischen und symbolischen Ausschlusses be-
herzustellen, sondern die Gemeinschaft der gleitet ist. Die Grade unterliegen nicht nur zeitlichen
Verschiedenen ist die Herausforderung“ (Ja- Konjunkturen, sondern auch tradierten kolonialen
goda Marinic, SZ 12.2019) Befremdungsmustern und rassistischem Wissen, so
dass einige Gruppen, wie etwa die Romnija, bis zum
heutigen Tage, obwohl sie über mehrere Generatio-
Stadt ist Migration nen in Deutschland leben, nicht als zugehörig aner-
kannt sind. Die Stadt ist daher nicht nur kulturell,
Stadt und Migration, verhalten sich zueinander wie oder bezüglich der verschiedenen nationalen, regio-
siamesische Zwillinge, die aneinandergeknüpft sind, nalen, ethnisch-kulturellen Herkünfte ihrer Bewoh-
sich gegenseitig hervorbringen, konturieren und sich ner*innen „superdivers“, sondern auch bezüglich der
brauchen, die aber auch immer wieder im Clinch mit- verschiedenen rechtlichen Stati und damit zusam-
einander liegen und Kontroversen erzeugen. Bereits menhängenden grundlegenden Chancen zur Teilhabe
die Väter der empirischen Sozialforschung der Chica- (vgl. Vertovec/Römhild 2009).
goer Schule haben für die USA der 1920er Jahre die-
sen Zusammenhang herausgearbeitet. Auch die Väter Ausblendung der Migrationsgeschichte/n – transna-
der deutschen Sozialforschung wie Georg Simmel tionalisierte städtische Wirklichkeit
haben gerade angesichts ihrer heterogenen, vielfäl-
tigen Bevölkerungen Großstädte als paradigmatische Doch zunächst zum ersteren Problemkomplex:
Orte der Moderne beschrieben, als Ansammlung von „Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft
Fremden, wobei Fremdheit hier nicht ethnokulturell mit unvollständigem historischen Gedächtnis,“ kons-
verstanden ist, sondern sozusagen als Strukturfaktor tatiert die Migrationshistorikerin Maria Alexopoulou
urbanen Lebens (Linder 2004; Lebuhn 2019). (2016). Doch nicht nur das, die Migrationsdebatte in
Dass Stadt jedoch nicht grundlegend als paradig- Deutschland ist auch von einer strukturellen (da z.B.
matischer Ort einer Ansammlung von Fremden, durch das Bildungssystem reproduzierten) histori-
bzw. als Gesellschaft der Vielen beschrieben wird schen Vergesslichkeit bzw. besser: Vergesslichma-
und dies als ein selbstverständlicher kommunaler chung geprägt (El-Tayeb 2016). So wurden auch die
Gestaltungsauftrag verstanden wird, liegt an einer jüngsten Zuwanderungsbewegungen der Jahre 2015
grassierenden historischen Amnesie wie auch dem und 2016 als große „Flüchtlingskrise“ inszeniert, als
hierdurch ermöglichten fortdauernden nationalen nie vorher dagewesener Zuwachs, als etwas funda-
Mythos von Deutschland als einer ethnonational ho- mental Neues und Herausforderndes. Keiner wird
mogen zu denkenden Gemeinschaft. Beide Prozesse bestreiten, dass die Entwicklungen von 2015 und 2016
führen zu einer kontinuierlichen Ver-Anderung, dem herausfordernd waren, insbesondere hinsichtlich ei-
Anders-Machen von woanders Herkommenden, wel- ner menschwürdigen Aufnahme und Versorgung der
ches als Othering in der kritischen Kultur- und Sozi- großen Anzahl von Geflüchteten.
alforschung beschrieben wird, und von unterschied-
8 | STADT, MIGRATION UND DIE GESELLSCHAFT DER VIELENDoch das Krisennarrativ und die politische Überfor- Göttinger Stadtbevölkerung längst überholt. Nur die
derung funktionierten jedoch nur so gut, weil sie die Strukturen der Wohlfahrt, der Bildung, der Gesund-
massenhaften Bevölkerungsbewegungen der letzten heit und der Verwaltung hinken immens hinter diesen
Jahrhunderte – wie etwa nach dem 2. Weltkrieg, die Entwicklungen einer Gesellschaft der Vielen, die eher
auch Göttingen als Mittelstadt mithervorgebracht durch Mobilität, Mehrfachzugehörigkeiten, transna-
haben – ausblendeten: Selbst die jüngste Einwande- tionalen emotionalen und kulturellen Verbindungen
rungsgeschichte der aufstrebenden BRD der 1960er sowie Sprachenvielfalt gekennzeichnet ist, hinterher
und 70er Jahre ist in diesem Krisennarrativ ausra- (Hess/Lebuhn 2014). Die Folgen für Chancengleich-
diert. Aber auch Göttingen, gerade auch die Univer- heit und Teilhabesicherung wirken sich drastisch
sität, profitierte von der sogenannten „Gastarbeit“ zum Beispiel in einem Klinik- oder Schulsystem aus,
(Hess/ Näser 2015). Dabei hilft das Selbstimage Göt- das immer noch dem zur Ideologie geronnen Mythos
tingens als „Stadt, die Wissen schafft“ dazu, den in- einer monolingualen Gesellschaft folgt und bis heu-
dustriellen wie den Dienstleistungssektor (Gastrono- te Übersetzungsdienst und Mehrsprachigkeit nicht
mie, Bildung- und Gesundheitsinfrastrukturen etc.) in ihren Regelbetrieb eingebaut hat. So zeigen auch
gänzlich auszublenden, welche beide bis heute auf der die studentischen Recherchen für das Stadtlabor eine
möglichst billigen, weil rechtlich nicht gleichgestell- fortbestehende institutionelle Kultur des Misstrau-
ten, migrantischen Arbeitskraft beruhen. Umgekehrt ens und der Ablehnung in städtischen Behörden ge-
wird die Bildungsmobilität in den problematisieren- genüber migrantisierten Stadtbewohner*innen auf
den Migrationsdebatten meist nicht als „Migration“ (Stadtlabor 2019).
verhandelt und dies obwohl auch die Göttinger Uni-
versität in einem erheblichen quantitativen wie quali- Dieses in der Wissenschaft als institutionalisierter
tativen Sinn zur Pluralisierung der Stadtbevölkerung Rassismus verhandelte Misstrauen sowie eine Kul-
beiträgt. Auch hier greifen klassische Vorstellungen tur der Ablehnung statt des Willkommens haben da-
von Einwanderung im Sinne eines dauerhaften Orts- bei ebenfalls eine lange Geschichte im Zwillingsver-
wechsels aus einem in den anderen nationalen Con- hältnis Stadt und Migration. So zeigt die historische
tainer viel zu kurz. Die meisten Städte sind vielmehr Migrationsforschung, dass städtische soziale Krisen
durch eine höchst fluide, transnational verflochtene und soziale Verwerfungen vor allem in Folge ökono-
und mobile Bevölkerung charakterisiert. Göttingen mischer Transformationen mit schöner Regelmä-
ist in diesem Sinne eher als ein „Transit-Ort“ zu be- ßigkeit, in den 70er, den 80er, den 90er und zuletzt
trachten, wie es Eleonore Roncato in ihrer Reportage in den 2000er Jahren, in „Ausländerkrisen“ umge-
für das Stadtlabor 2019 herausstellt. deutet wurden. Erinnert sei hier nur an die letzte
laute Debatte um Armutsmigration und Ghettobil-
Die jüngste Bevölkerungsstatistik demonstriert die- dung, die EU-interne Mobilitätspraktiken in ras-
sen Trend auch deutlich und fordert dazu auf, Ein- sifizierten Bildern von „Parallelgesellschaften“ im
wanderung als Stadt-mitgestaltenden Faktor auch in Fokus hatte. So wurden auch regelmäßig alle zehn
Göttingen ernster zu nehmen. So liegt der Anteil der Jahre wieder die „Grenzen der Aufnahmefähigkeit“
Bevölkerung mit einem sogenannten Migrationshin- und der Integration ausgerufen und durch Notbau-
tergrund mittlerweile bei 27,3%, und damit über dem ten inszeniert. In den frühen 1990er Jahren dyna-
Bundesdurchschnitt. Hinzu kommen internationale misierte der Münchener Oberbürgermeister Kron-
Studierende und Wissenschaftler*innen, die nicht awitter mit seinen Flüchtlingscontainern auf der
in der städtischen Statistik erfasst sind, aber den- Theresienwiese die nationale „Asyldebatte“, welche
noch das Stadtbild prägen und Dienstleistungen und schlussendlich zur faktischen Abschaffung des indi-
Infrastruktur nachfragen: So kommt mittlerweile viduellen Grundrechts auf Asyl führte (Bayer/Engl/
von den 29.927 im Sommersemester 2017 registrier- Hess 2009). Nicht nur hier zeigt sich, dass sich Städ-
ten Studierenden in Göttingen, was in etwa 22 % der te als Projektionsfläche für derartige Krisennarra-
Stadtbevölkerung entspricht, knapp jede*r achte Stu- tive eines „umkippenden“ sozialen Gemeinwesens
dierende aus dem Ausland (vgl. Roncato 2019). bestens anbieten, wobei sie auch immer wieder von
der Wirklichkeit überholt und eines Besseren be-
„Das Recht auf Sicherheit und das Recht, lehrt werden, wie jüngst durch das rege und in der
sich sicher zu fühlen, gilt nicht für alle.“ Tat divers zusammengesetzte zivilgesellschaftliche
(Fatima El-Tayeb 2016) Engagement der Flüchtlingsunterstützung in 2015
und den nachfolgenden Jahren (Karakayali 2017).
Klassische Vorstellungen von Zugehörigkeit als Kri- Hier war eine Gesellschaft der Vielen erlebbar und
terium für Teilhabe und Rechte, die auf Sesshaftig- hat sich in der Unterstützung neuer Fluchtmigrieren-
keit als Maßstab und am besten noch auf „Blut“ im der auf besondere Weise realisiert.
Sinne von „ius sanguinis“-Vorstellungen des alten
deutschen ethnonationalen Staatsbürgerschaftsver-
ständnisses rekurrieren, sind durch die Realität der
SABINE HESS | 9Die trennenden Logiken des Integrationsimpera- selbst in der 3. Generation nicht als zugehörig aner-
tivs und der Protagonismus der Migration kennen (Hess/Binder 2009).
Dies bringt mich zum zweiten meiner eingangs be- Dabei wandert keiner als „Migrant“ aus. Vielmehr
nannten Problemzonen der deutschen Migrationsde- handelt es sich um eine politische Kategorisierung
batte, nämlich der bis heute und gerade in den letzten und ein vor allem rechtlich hergestelltes soziales
Jahren rechtspopulistischer Diskursproduktion wie- Verhältnis, welches durch Staatsbürgerschaftsrechte
der lauter werdenden Vorstellung von Gesellschaft und Einwanderungsgesetze erst hervorgebracht wird
im Sinne eines ethnonationalistischen Containers: (sonst würde es sich hierbei auch nur um eine Form
innen homogen, nach außen klare Grenzen und Kan- grenzüberschreitender Mobilität, wie bspw. dem Tou-
ten, die derzeit auch wieder militärisch, den Tod von rismus, handeln). Ebenfalls migrieren die wenigsten
Migrierenden in Kauf nehmend, verteidigt werden. Menschen als „Türken“ oder als „Pakistani“, sondern
Diese Vorstellung, die Sozialforscher wie Ulrich Beck aus Not, Krieg, Umweltzerstörung und Vertreibung
als methodologischen Nationalismus bezeichnet ha- oder aus Liebe, aufgrund von Bildungsaspirationen,
ben, hat lange auch die Sozial- und Kulturwissen- der Suche nach einem besseren Leben oder weil es in
schaft und die Stadtforschung dahingehend domi- der Region Tradition ist, dass man begrenzt auf we-
niert, als dass eine homogene Gesellschaft als Garant nige Jahre in der Ferne, wo andere bereits relevan-
für sozialen Frieden galt. Einflüsse von außen galten te Netzwerke und Strukturen etabliert haben, sein
als Störfaktor, die entweder zu assimilieren oder ab- Glück sucht.
zuweisen sind – eine Vorstellung, die bis heute die
Stadtplanung wie das Programm der Sozialen Stadt Ungeachtet dessen haben sich Eingewanderte und
und die Definition von Brennpunktgebieten beein- Deutsche of Colour über ihre beharrlichen Praktiken
flusst (Pasch 2015). und Taktiken ein Leben in Almanya aufgebaut und
somit die deutsche Gesellschaft zu einer post-migran-
Politisch hat sich dies in ein sehr unnachgiebiges tischen Gesellschaft werden lassen (Foroutan/Ka-
Integrationsparadigma übersetzt, welches zwar wis- rakayali 2018). Denn schon damals, in den 1960er
senschaftlich und von Migrant*innenverbänden seit Jahren, waren nicht nur Arbeitskräfte nach Deutsch-
Jahren kritisiert wird (Aced/Düzyol/Rüzgar 2014), land gekommen, sondern durchaus auch politisch er-
jedoch seit den „Herausforderungen der Flüchtlings- fahrene und aktive Menschen, wie es auch der wilde
krise“ von aller Kritik bereinigt scheint. „Integration“ Streik bei Holzhenkel in Göttingen 1963 gegen nicht
ist der zentrale politische Ansatz, wie Migration ge- endende rassistische Schikanen und Arbeitsausbeu-
sellschaftspolitisch bearbeitet und gestaltet wird, wo- tung deutlich macht (Hess/Näser 2015). Nur der Inte-
bei auch dies länger gebraucht hat. Erst im Jahr 2004 grationsimperativ hat diese Selbsteingliederung und
wurde auf Bundesebene der erste „nationale Integra- die Handlungsmacht, in den Wissenschaften spre-
tionsplan“ formuliert. chen wir von agency und dem Protagonismus der
Migration, mit seinem Narrativ der Ethnisierung und
Integration wurde hiermit zum Imperativ. Trotz vie- Fremdmachung von Eingewanderten überschrieben.
ler Bekenntnisse, dass dies keine Einbahnstraßen- In diesem Sinne ginge es darum, Migrant*innen als
bewegung sein kann, wird sie letztlich weiterhin als aktive Mitgestaltende der Stadtgesellschaft wahrzu-
Forderung vor allem an die Eingewanderten und ihre nehmen und den Blick umzudrehen, nämlich „acts of
Nachkommen formuliert, mit der gleichzeitigen Aus- citicenship“ und Akte des Zugehörigmachens zu fo-
rufung eines nach wie vor homogen und feststehend kussieren (Hess/Lebuhn 2014).
gedachten „Wirs“ (was nur aufrechterhalten werden
kann durch eben jene kontinuierliche Ausblendung, „Der Punkt am Horizont ist daher der
dass dieses Wir längst ein superdiverses ist). Die Auf- Übergang von der Migration als Problem zur
zählung der leitkulturellen Werte („bei uns ist es so Freizügigkeit als Menschenrecht. Für eine
und so“) wurde mittlerweile um die Wahrung von Bürgerschaft des Wohnorts“ (Charta von
Menschenrechten, Menschenwürde oder Geschlech- Palermo 2015)
tergleichheit ergänzt, wobei Gleichheit und damit
einhergehend Sicherheit und Würde bis heute den Eine Stadt für Alle – zwischen Utopie,
allermeisten als Migranten gelabelten. Bewohner*in- wissenschaftlichem Konzept und täglicher Praxis
nen in unterschiedlichen Graden vorenthalten wird.
Der differentielle Ausschluss beginnt schon beim Stadtforschungen zeigen, dass Eingewanderte mit
symbolischen und repräsentationellen Ausschluss ihren beharrlichen Praktiken der Selbsteingliede-
u.a. durch Label wie „Mit-Bürger“ oder „Menschen rung und ihren transnationalen Verbindungen zur
mit Migrationshintergrund“, welche als Migrant*in- geo-ökonomischen Positionierung von Städten im
nen gelabelte Bewohner*innen immer wieder aus- Rahmen der internationalisierten Städtekonkurrenz
bürgern, sozusagen „migrantisieren“ und sie damit beitragen (Glick-Schiller 2015) – wenn sie nur dür-
10 | STADT, MIGRATION UND DIE GESELLSCHAFT DER VIELENfen und stadtplanerisch auch in diesem Sinne unter- die nationale Abschiebepolitik. Vielmehr geht es im
stützt werden. Schwierige Anerkennungsverfahren Sinne des zweiten Grundsatzes von „Access without
von Qualifikationen, die trotz Fachkräftegesetz und fear“ (Zugang ohne Angst) auch darum, einen angst-
einigen Verbesserungen weiterhin bestehen sowie freien Zugang zu städtischen Institutionen und Res-
die nach wie vor restriktiven aufenthaltsrechtlichen sourcen unabhängig vom Aufenthaltstitel zu ermög-
Regelungen lassen vermuten, dass das Potential und lichen. Insbesondere soll eine diskriminierungsfreie
die Kompetenzen migrierter Menschen als ökonomi- Stadtverwaltung angestrebt und die Teilhabe an städ-
sche und unternehmerische Kraft immer noch mehr tischen sozialen Dienstleistungen verbessert werden.
oder minder unbeachtet bleiben. Dem entgegen zei- Manches hiervon wird von den ersten Solidarischen
gen Studien, dass migrierte Stadtbewohner*innen in Städten in Europa ausprobiert, wie bspw. eine City
vielen Städten im Sinne eines „urban Recycling“, wie Card in Bern, die für alle den Zugang zu städtischen
es die Stadtforscher Erol Yildiz und Birgit Matausch Einrichtungen möglich machen soll. Auch in Mün-
(2009) ausdrücken, heruntergewirtschaftete und ver- chen, Berlin, Köln oder Osnabrück und Darmstadt
nachlässigte Stadtviertel revitalisiert haben und über sind kommunale Bündnisse aus Zivilgesellschaft und
enorme, kreative urbane Kompetenzen, auch auf- Stadtregierungen und -verwaltungen entstanden,
grund ihres transnationalen sozialen und kulturellen die einen höheren Grad von Partizipation und Teil-
Kapitals verfügen. habe zu entwickeln versuchen – unabhängig von der
Herkunft und dem Aufenthaltstitel. In der Forschung
Und auch umgekehrt wird ein Schuh daraus: Es wa- werden derartige Initiativen als Erweiterung einer
ren (Groß)Städte als doch noch relativ überschauba- urbanen Bürgerschaft („urban citizenhip“) aufmerk-
re soziale Einheiten, die erste Integrationskonzepte sam verfolgt und als Ergänzung und Vorreiter für
entwickelten und lange bevor die nationale Ebene neue postnationale Bürgerschaftskonzepte mit dem
überhaupt Integration buchstabieren konnte umsetz- Potential zu einer Demokratisierung der gesamten
ten. Die soziale Misere und Problemlagen waren nah, Gesellschaft und ihrer Institutionen gesehen (Bau-
konkret erfahrbar und riefen bereits in den 1970er böck 2003, Nyers 2008). Mit dem Stadtlabor haben
Jahren etwa in München, Stuttgart oder Hamburg die wir als Göttinger Wissenschaftler*innen versucht,
Stadtregierungen zum Handeln auf. Und auch in den einen praktischen Schritt in diese Richtung zu gehen.
letzten Jahren wird der Ruf aus den Wissenschaften
wie der Zivilgesellschaft lauter, dass Städte als un-
terste Verwaltungseinheit sich stärker in Einwan-
derungs- und Teilhabepolitiken engagieren sollten,
da sie durchaus über Spielräume und Gestaltungs-
macht im politischen Mehrebenensystem verfügen.
So sprechen die Migrationsforscher*innen Hannes
Schammann und Petra Bendel Städten gar eine „neue
Schlüsselrolle in der Flüchtlings- und Asylpolitik der
EU“ zu (Bendel/Schammann 2019; siehe auch Scham-
mann/ Kühn 2016 zu kommunaler Aufnahmepolitik).
Diese Gestaltungsmacht haben sich einige Städte in
Europa mittlerweile zu Herzen genommen und sich
im Kontext der nationalen und europäischen Blocka-
den der Seenotrettung als „Sichere Häfen“ zu einem
Netzwerk zusammengeschlossen, welche aus Seenot
gerettete Flüchtlinge weiterhin aufnehmen wollen.
2016 wurde ein weiteres Städtenetzwerk auf europä-
ischer Ebene unter dem Titel „Solidarity Cities“ ge-
gründet, welches einen Austausch und die Weiterent-
wicklung von Best Practice-Ansätze der Aufnahme
und Integration zum Ziel hat. In anderen Ländern
wie den USA oder Kanada haben Solidarity Cities oder
Sanctuary Cities bereits eine lange Tradition. Hier
haben sich mehr als 500 Städte und Gemeinden und
ganze Bundesländer der Bewegung angeschlossen,
die ihren Bewohner*innen unabhängig von ihrem
ausländerrechtlichen Status ein angstfreies Dasein
und Teilhabe in der Stadt versprechen. Dabei wen-
den sie sich dem Grundsatz von „Don’t ask, don’t tell“
(Frag nicht und melde nicht) folgend, nicht nur gegen
SABINE HESS | 113. LABORE ALS KATALYSATOR FÜR DIE
POSTMIGRANTISCHE GESELLSCHAFT?
DREI THESEN ZUM ERFAHRUNGSAUS-
TAUSCH UNTER LABORFORMATEN
Stephan Liebscher, M.A.
(Institut für Geographische Wissenschaften, Freie Universität Berlin)
Labore sind in Mode und freuen sich auch im The-
menbereich Migration, Flucht und solidarischen Be- These 1: Vor dem Hintergrund der Krise des Europäi-
wegungen vielerorts zunehmender Beliebtheit, be- schen Migrations- und Grenzregimes und einer emer-
sonders in städtischen Institutionen. In mehreren gierenden solidarischen Bewegung können Labore
Stadtlaboren[1] des Historischen Museums Frankfurt genutzt werden, um Aufmerksamkeit für ausgeblen-
werden seit 2011 mit Stadtbewohner*innen Samm- dete Sichtweisen und Fragestellungen der Kämpfe der
lungsobjekte auf ihre Migrationsgeschichte und die Migration zu binden.
Fähigkeit, kulturelle Diversität zu repräsentieren,
hinterfragt. Mit der Methodologie der Reallabore Die eingangs erwähnten Laborprojekte zeugen von
werden im Forschungsprojekt „KoopLab“[2] nach- der Erkenntnis in migrations- und rassismuskri-
barschaftliche Grün- und Freiräume in migrantisch tischen Kreisen, dass bisherige Akteur*innen des
geprägten Quartieren gemeinschaftlich gestaltet und Migrations- und Grenzregimes nicht willens oder in
begleitend erforscht. Aktivist*innen und NGOs ka- der Lage sind, politisch-administrative Antworten
men im Frühsommer 2019 bei der Zukunftswerk- auf die Bewegung der Migration jenseits von Restrik-
statt[3] des Konzeptwerks Neue Ökonomie zusammen, tionen, Illegalisierung und Kriminalisierung zu kon-
um über Utopien und Handlungswege der Bewe- zipieren. Dabei wird in Laborprojekten eine Strategie
gungsfreiheit nachzudenken. Wenngleich sich unter des Selber-Machens zur Handlungsmaxime gemacht,
dem Laborbegriff diverse Akteure, Zielstellungen und um ‚neue‘ Diskurse, Kooperationen oder Alltagsprak-
Methodiken versammeln, so ist ihnen doch gemein, tiken zu erfinden, zu erproben und zu verbreiten.
dass sie ihren Blick auf die Zukunft richten und meist Labore entstehen in einem Kontext, in dem auch in
in offenen und experimentellen Formaten Neuarti- Stadtverwaltungen aufgrund des Misstrauens gegen-
ges – seien es Methoden, Kooperationen, Praktiken über übergeordneten Politik- und Verwaltungsbenen
oder Perspektiven – erdenken und ausprobieren. Um an eigenen Lösungen gearbeitet wird, wie die mit-
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Labo- unter schnell wachsenden Netzwerke Sichere Häfen
ren sichtbar zu machen, nahmen die genannten und oder Solidarity Cities zeigen. Das Versprechen des
weitere Projekte und Initiativen an einem Austausch ‚Neuen‘ und des ‚Innovativen‘, mit welchen Labore
zu Erwartungen, Experimenten und Erfahrungen im gern assoziiert werden, kann dabei irreführend sein
Stadtlabor Göttingen teil.[4] und bedarf daher näherer Erläuterung. Während das
Laborformat zumeist auf technologische Innovatio-
Der vorliegende Kommentar reflektiert Teilaspek- nen und Optimierungen abzielt (Franz 2015, S. 53), so
te dieser Diskussionen. Die zentrale Frage war da- unterscheiden sich hiervon die eingangs aufgelisteten
bei, wie diese unterschiedlichen Labor-Formate in Projekte grundlegend. Vielmehr rücken hier Alltags-
Beziehung zu Transformationsprozessen der post- kämpfe und Erfahrungen der Migration und solida-
migrantischen Gesellschaft[5] stehen. Auch wenn die rischer Bewegungen in den Vordergrund, die in vor-
vielen lokalen Projekte und Entwicklungen genügend herrschenden Diskursen um Integration, Sicherheit
Material für eine umfängliche Analyse dieser Frage und krimineller Fluchthilfe ausgegrenzt und delegiti-
bieten würden, versuche ich anhand von drei Thesen miert werden. Labore haben dabei in Verbindung mit
zumindest Denkanstöße zu den Chancen und Limita- jenen Neuheitseffekten das Potential, Perspektiven
tionen von Laboren zu geben. aus gegenwärtigen wie vergangenen Kämpfen, um
12 | LABORE ALS KATALYSATOR FÜR DIE POSTMIGRANTISCHE GESELLSCHAFT?Rechte und Repräsentation und daraus resultierende sen unumgänglich. Die Frage ist nur, ob sie das Ende
Innovationen zurück aufs Diskurs-Tableau zu holen. der Kooperation bedeuten oder als Chance, etwas
Labore können als „Plattformen […] Zeit und Raum“ Neues zu kreieren, betrachtet werden. Die Erkennt-
(Schäpke et al. 2017, S. 35) und damit die oft so sehr nisse der Transformationsforschung können hier
benötigten Ressourcen binden sowie Ergebnisoffen- hilfreich sein. So wird hier nach den drei aufeinander
heit und Erprobungen jenseits von Outputorientie- aufbauenden Wissensarten Kritik (Was läuft schief?),
rung legitimieren. Utopie (Wie soll die Zukunft (nicht) sein?) und Trans-
formation (Wie lässt sich die Zukunft gestalten?) un-
These 2: Labore schaffen einen Rahmen für Experi- terschieden (Schäpke et al. 2017, S. 9). Mit Blick auf
mente und Prototypen in unkonventionellen Allianzen die Konflikte und Kämpfe um Migration und Teilhabe
bedeutet dies, dass Kritik stets nur ein erster Schritt
Mit der Verortung von migrantischen Kämpfen in La- in Richtung Veränderung sein kann und sich hieran
borprojekten geht das Versprechen einher, dass von die Arbeit an Utopien der postmigrantischen Gesell-
jenen wichtige Impulse für demokratische (stadt-) schaft sowie den konkreten Handlungspfaden an-
gesellschaftliche Entwicklungen ausgehen. Diese schließen. Das Projekt rund um die Züri City Card[6]
Wissensbestände ‚von unten‘ beinhalten etwa Er- illustriert, wie aus einem künstlerischen Experiment
fahrungen um rassistische und migrationsbezogene eine aktivistische Forderung wurde, die letztlich von
Ausschlüsse, Unsichtbar-Machung, Besonderung der Stadtregierung in eine Verwaltungsmaßnahme
und Delegitimierung, aber auch solche der Mehrspra- umgewandelt wurde. Das Entwerfen von Prototypen
chigkeit oder des Empowerment. In Erkundungen ‚von unten‘ schließt somit die Perspektive mit ein,
und Erprobungen in Laboren können daraus Proto- diese horizontal zu verbreiten und ‚nach oben‘ in Dis-
typen für ein postmigrantisches Handeln erarbeitet kursen und Institutionen festzuschreiben.
und eingeübt werden. Im Zentrum steht dabei die
Frage, wie sich von der Erfahrung der Migration aus- These 3: Labore dienen als Katalysatoren für die post-
gehend individuelles, kollektives und institutionelles migrantische Gesellschaft, indem sie Prototypen zum
Sprechen, Sehen und Hören in der postmigranti- Verlassen gesellschaftlicher Nischen verhelfen.
schen Gesellschaft konzipieren und realisieren lässt.
Laborprojekte werden nicht um die Thematisierung
Antworten auf diese Frage können dabei nur mit vie- ihrer Beziehung zu etablierten Strukturen herum-
len unterschiedlichen Akteur*innen gemeinsam ge- kommen, da sich mit der Erarbeitung postmigranti-
funden werden. Gerade in der Zusammenarbeit in scher Innovationen auch die Frage nach Veränderun-
unkonventionellen Allianzen aus „innovative[n] Ak- gen über die Zeitspanne und den Raum jenseits des
teur[*innen] des gesellschaftlichen Mainstreams mit experimentellen Projekts stellt. So zeigt sich einer-
Vorreiter_innen radikalerer Alternativen“ (Schäpke seits die Gefahr der Verstetigung von Parallelstruk-
et al. 2017, S. 35) besteht das Potential, die Wissens- turen, die anfänglich mit Wandel assoziiert wurden.
bestände in Verbindung mit Fragen der jeweiligen ge- Beispielsweise haben sich Integrationsbeauftragte,
sellschaftlichen Positionierungen der Beteiligten be- die zunächst mit der strukturellen Sensibilisierung
arbeiten zu können. Treten dabei Migrant*innen und und Öffnung der Verwaltung beauftragt wurden, zu-
kritische Aktivist*innen mit etablierten Institutionen meist mit dem System arrangiert, tragen größtenteils
aus Wissenschaft, Kunst, Kultur und auch Verwaltung integrationistische und neoliberale Adressierungen
und Politik in einen möglichst ergebnisoffenen Dialog von ‚Migrant*innen‘ mit und fungieren qua Existenz
um Wissenshierarchien, Abgabe von Definitions- und als Beweis für die staatlichen Fortschritte in Sachen
Entscheidungsmacht sowie Fehlerfreundlichkeit, Migration und Flucht. Andererseits fokussiert die
können die festgefahrenen und zum Selbstzweck mu- kritische Zivilgesellschaft mit dem Verweis auf die
tierten Modi der Reflektion, der Skandalisierung und Unmöglichkeit der Kooperation mit städtischen Ver-
des ‚Forderns und Förderns‘ aufgebrochen werden. waltungen auf den Aufbau selbstorganisierter (In-
Den etablierten Institutionen kommt dabei die Rolle fra-)Strukturen und konzentriert sich von dort aus
des Zuhörens und Akzeptieren der Vorreiter*innen- auf das Skandalisieren von Verwaltung und Politik,
rolle migrantischer Kämpfe zu. Ihre Hauptaufgabe ohne diese jedoch maßgeblich zu beeinflussen. Ana-
besteht im Ver-Lernen ihrer Handlungsroutinen und log hierzu besteht auch in Laboren die Gefahr, diese
Sichtweisen (Terkessidis 2017, S. 58ff.). Bei dem Blick Strategien der Anpassung und der Skandalisierung
auf die am Stadtlabor Göttingen teilnehmenden In- als Selbstzweck zu betreiben. Jedoch werden dann
stitutionen, aber auch das Städte-Netzwerk „Sichere möglicherweise die postmigrantischen Handlungen
Häfen“ oder Verwaltungsmaßnahmen rund um kom- und Innovationen mit Projekt- und Finanzierungs-
munale Ersatzpapiere und Anonyme Krankenschei- ende verschwinden. Um die aus Laboren resultie-
ne wird deutlich, dass sich einige Institutionen – zu- renden Lernschritte, die erwirkten temporären Ein-
mindest in Teilen - dieser Rolle bereits bewusst sind. schreibungen in Diskurse und Institutionen sowie
Konflikte und Widersprüche sind in diesen Prozes- die aufgebauten und gefestigten Kooperationen und
STEPHAN LIEBSCHER | 13Building Solidarity Cities – Praktische Schritte und erste Erfahrungen (Leon-Fabian-Caspari)
Vertrauensbeziehungen unter den beteiligten Ak- anderen Standorten können neue Fragen aufgewor-
teur*innen über den Projektzeitraum hinaus zu ver- fen und die lokalen Laborbemühungen als Teil ei-
stetigen, empfehlen sich drei Strategien. ner transnationalen (postmigrantischen) Bewegung
sichtbar werden. Hierdurch können lokal-übergrei-
Erstens, können in Laboren die beiden Herangehes- fende Dynamiken und Effekte der Verflechtung und
weisen der Anpassung und der Skandalisierung in ei- Überlagerung entstehen, die das Wirken vor Ort im
ner Strategie der kritisch-affirmativen Allianzen mit besten Fall positiv beeinflussen.
engagierten institutionellen Akteur*innen, also mo-
tivierten Einzelpersonen oder einzelnen Abteilungen, Drittens, kann sich auch eine lokale transsektorale
Anwendung finden. Damit werden die vorherr- Kollaboration mit kritisch zivilgesellschaftlichen Be-
schenden Strukturen und Institutionen in ihren wegungen (bspw. Klima, Arbeit) als sinnvoll erwei-
Widersprüchen angenommen, wobei das gemein- sen, um vielfältige Impulse für eine demokratische
same Ziel verfolgt wird, deren Logik und Handlun- und ökologische Transformation zu schaffen. Da-
gen zu unterwandern und zu verändern. Durch eine durch können jene Überlagerungseffekte am eigenen
Umkehrung des Blicks - weg von den migrantischen Standort noch verstärkt werden. Durch themenüber-
Subjekten hin zu den Verwaltungsstrukturen – hat greifende soziale Bewegungen und munizipalistische
beispielsweise der Verein Citizens for Europe mithil- Wahlplattformen in spanischen Städten sind nicht
fe anerkannter statistischer Messverfahren Fragen nur Kommunalverwaltungen repolitisiert worden,
nach Repräsentation und Zugang zu Positionen in sondern auch Prozesse, Zwecke und Logiken in den
staatlichen Institutionen aufgeworfen.[7] staatlichen Institutionen selbst konnten hinterfragt
und verändert werden (Brunner et al. 2017).
Zweitens, trägt ein translokales sowie -nationales
Vorgehen dazu bei, Labore und die jeweiligen städ- Um der Falle selbstreferentieller und -erhaltender
tischen Kontexte nicht als in sich abgeschlossene Projektstrategien zu entgehen, kann sich die Vorge-
Einheiten zu betrachten. Durch den Austausch und hensweise im Labor entlang der drei Strategien der
die Vernetzung zu sinnvollen Praktiken, Strategien kritisch-affirmativen Allianz-Bildung, der transloka-
und Lernerfahrungen mit ähnlichen Projekten an len Vernetzung und der transsektoralen Kollaborati-
14 | LABORE ALS KATALYSATOR FÜR DIE POSTMIGRANTISCHE GESELLSCHAFT?on ausrichten und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, [6] Vgl. https://www.zuericitycard.ch/zuri-city-card.
postmigrantische Prototypen auch jenseits gesell-
schaftlicher Nischen zur Anwendung zu bringen. [7] Vgl. https://vielfaltentscheidet.de/was-wir-tun/.
Schluss
Labore können die Vorreiterrolle migrantischer
Kämpfe für die postmigrantische Gesellschaft beto-
nen. Durch ihre raum- und zeitbindende Wirkung
vermögen sie marginalisiertes Wissen um Exklu-
sion und davon ausgehendes Alltagshandeln sicht-
bar zu machen und konkrete Handlungsszenarien
von Utopien zu festigen. Hierbei können im Sinne
des „Transformationsdesigns“ (Sommer und Welzer
2017) intentional Prozesse angestoßen werden, die ak-
teurs- und themenübergreifende Verflechtungen vor
Ort und mit anderen Standorten stärken, institutio-
nelle Veränderungen anstoßen und sich in Diskurse
um Migration einschreiben. In der Aushandlung von
und dem produktiven Umgang mit Widersprüchen
und Konflikten können Labore wichtige Impulse für
transformatorische Prozesse der postmigrantischen
Gesellschaft geben und diese durch die aufgezeigten
Einschreibepraktiken potenziell beschleunigen. In-
dem die Innovationen festgeschrieben werden und
postmigrantische Praktiken zur Normalität werden,
machen sich Labore und andere Experimentierräu-
me bestenfalls langfristig überflüssig.
[1] Vgl. https://www.historisches-museum-frankfurt.de/de/
stadtlabor.
[2] Vgl. https://www.kooplab.de/.
[3]V gl.https://konzeptwerk-neue-oekonomie.org/bewe-
gungsfreiheit-fuer-alle/.
[4] Herzlichen Dank an das Stadtlabor Göttingen für die Er-
möglichung des Workshops und an alle Beteiligten für die
engagierte Teilnahme.
[5] Mit dem Konzept bezeichnet Foroutan (2018) zum einen
„eine Analyseperspektive, die sich mit gesellschaftlichen
Konflikten, Narrativen, Identitätspolitiken sowie sozialen
und politischen Transformationen auseinandersetzt, die
nach erfolgter Migration einsetzen, und die über die ge-
sellschaftlich etablierte Trennlinie zwischen MigrantInnen
und NichtmigrantInnen hinaus Gesellschaftsbezüge neu er-
forscht“ (ebd.:15). Zum anderen versteht sie es als „gesell-
schaftspolitisch anzustrebende Entwicklung“ (ebd.: 25), in
der Migration nicht mehr als Problem, sondern als der Nor-
malfall gesehen wird. Diese gesellschaftspolitische Perspek-
tive verfolgt auch der vorliegende Kommentar.
STEPHAN LIEBSCHER | 154. MIGRATION UND TEILHABE IN GÖTTINGEN: Eine Bestands- und Bedarfsanalyse aus der Perspektive am Stadtlabor beteiligter Gruppen
I Migrantische selbstorganisationen Im Juli 2019 führte die Deutsch-Russische Gesellschaft Göttingen e.V. als lokaler Partner in dem Netzwerk „Samo.fa: Stärkung der Aktiven aus Migrantenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit“ die Samo.fa-Dialogkonferenz „Angekommen. Teilhabe jetzt!“ im Stadtlabor durch. Im Mittel- punkt standen die effektive und erfolgreiche Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren in der Flüchtlingsarbeit vor Ort und der Erfahrungsaustausch zwischen Migrant*innenselbstorganisati- onen (MSO). Die Rolle der MSO in der Integrationsarbeit und deren Nicht/Einbindung in kommunale Struktu- ren wurde auch danach in vielfältigen Zusammenhängen im Stadtlabor immer wieder aufgegrif- fen und thematisiert. Mit ihren niedrigschwelligen Angeboten und Zugängen sind MSO wie etwa die Deutsch-Russische Gesellschaft und das Haus der Kulturen, das ein sozio-kulturelles Zentrum betreibt, oftmals erste Anlaufstellen für Eingewanderte. Obwohl sie wichtige Lücken in den Bera- tungs- und Unterstützungsstruktur schließen und auch wissenschaftlich als wichtige gesellschaft- liche Akteure anerkannt sind, stehen sie noch vor der Herausforderung mit ihren Erfahrungen und Expertisen als Konsultationspartner, Informationsvermittler und Projektträger stärker aner- kannt zu werden.
4.1 Migrationsorganisationen als selbstständige Akteure der
Integrationsarbeit - ein Praxisbeispiel
Deutsch-Russische Gesellschaft Göttingen e.V.
Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrun- interkulturelle Expertise von MO sehr nachgefragt
gen als migrantische Selbstorganisation arbeitet die war (z.B. Begleitung bei Behördengängen, Überset-
Deutsch-Russische Gesellschaft Göttingen e.V. (DRG) die zungen, Kinderbetreuung, Nachhilfe, Vermittlung
Stärken von Migrant*innenorganisationen (MO) heraus, etc.). Dieses Engagement von MO hat einen Beitrag
die als niedrigschwellige Anlaufstelle Wissen über Pro- zur Stabilisierung der Lage geleistet. Auf diese Erfah-
bleme und Bedarfe aus erster Hand erfahren und als rungen gilt es weiter aufzubauen. Jedoch scheint es,
Scharnier zur hauptamtlichen Integrationsarbeit fun- dass die MO noch nicht als anerkannter und geschätz-
gieren könnten. So zeigt der Beitrag auch, dass die Ex- ter Teil des Integrationsprozesses angesehen werden.
pertise und die Erfahrungen von MO noch viel zu wenig So fanden sie zum Beispiel in der 2. Fortschreibung
nachgefragt und anerkannt werden. des Integrationskonzepts der Stadt Göttingen keine
Erwähnung. Auch gibt es wenig Finanzierungs- und
Die Rolle von Migrant*innenorganisationen in der lo- Fördermöglichkeiten für ihre Arbeit und Angebote,
kalen Migrations- und Flüchtlingsarbeit nicht nur in Göttingen. Die Erfahrung hat hingegen
deutlich gezeigt, dass die Integration von Flüchtlingen
Integration von zugewanderten Flüchtlingen und und Migrant*innen nicht allein über staatliche und
Migrant*innen ist ein langsamer und vielschichtiger kommunale hauptamtliche Tätigkeiten erreicht wer-
Prozess unter Beteiligung zahlreicher verschiedener den kann. Wie kann es daher gelingen, dass MO eine
Akteure auf mehreren Ebenen. Migrant*innenorga- anerkannte Rolle in dem Netzwerk der institutionel-
nisationen (MO) sind juristische Personen nach deut- len Akteure der Integrations- und Flüchtlingsarbeit
schem Recht, die Migrant*innen (bzw. Flüchtlinge) bekommen? MO können als Vermittler und Partner
selbst gegründet haben. MO werden oft zur Durchset- die bestehende Aufgabenverteilung insbesondere mit
zung der eigenen Interessen oder zur gemeinsamen Blick auf die Erweiterung besonders niederschwelli-
Pflege von Sprache und Kultur gegründet. An sich sind ger Hilfsangebote ergänzen. Ihre Stärken gehören an-
MO im Gegensatz zu Wohlfahrtsverbänden, Migra- erkannt und in der Zusammenarbeit mit hauptamtli-
tionszentren und städtischen Einrichtungen nicht chen Akteuren der Integration berücksichtigt.
primär mit Integrationsarbeit betraut. Allerdings er-
fahren die MO alle Schwierigkeiten und Herausforde- Die Stärken von MO
rungen des Integrationsprozesses aus erster Hand.
Die wichtigsten Stärken von MO sind ihre Flexibi-
Dies geschieht durch ständigen Kontakt zu Zugewan- lität, Kenntnisse der Sprache und Kultur sowie der
derten, zum Beispiel im Zuge der Unterstützung bei gute Zugang zur Zielgruppe. Die Deutsch-Russische
Amtsgängen, Arztbesuchen, Schulgesprächen etc. Gesellschaft Göttingen e.V. (DRG) ist zum Beispiel
Aufgrund der gemeinsamen Sprache haben Neuan- die einzige Vereinigung in Göttingen, die russische
kömmlinge fast automatisch erstmal mehr Vertrauen Sprachvermittlung in großem Umfang anbieten kann.
zu ihren jeweiligen Landsleuten. Mit der Zeit sam- Die Mitglieder sprechen die Sprache und haben eine
meln die MO so wichtiges Wissen, so dass sie effektive klare Vorstellung von kulturellen Besonderheiten. Es
Hilfe in Form kontinuierlicher und/oder bedarfsori- herrscht ein besonderer Grad an Vertrauen und die
entierter Angebote für ihre Zielgruppe entwickeln und MO können die realen Bedarfe von schutzsuchenden
anbieten können. Menschen besser einschätzen, verstehen und deswe-
gen direkter helfen. Natürlich herrscht ein solches
Die Erfahrung hat deutlich gezeigt, dass die Vertrauen nicht von Anfang an, es wird erst mit der
Integration von Flüchtlingen und Zeit aufgebaut. Dafür müssten die Vereine in die Lage
Migrant*innen nicht allein über staatliche (auch finanziell) versetzt werden, ein passendes Ange-
und kommunale hauptamtliche Tätigkeiten bot für die Zielgruppe anbieten zu können.
erreicht werden kann.
Die DRG in Göttingen bietet seit zehn Jahren bedarfs-
Insbesondere 2015, während der sogenannten bezogene (inkl. notfallbezogene) und kontinuierliche
„Flüchtlingskrise“, wurden die MO zu einer unver- Angebote für russischsprachige Migrant*innen und
zichtbaren Anlaufstelle. In dieser Zeit waren die heu- Flüchtlinge an. Unser wichtigstes Handlungsfeld ist
tigen hauptamtlichen Strukturen entweder noch nicht der Zugang zu und Teilhabe an Bildung. Ganz wichtig
etabliert oder überlastet, so dass die sprachliche sowie ist für uns z.B. die alltägliche Unterstützung von Kin-
18 | MIGRATION UND TEILHABE IN GÖTTINGENSie können auch lesen