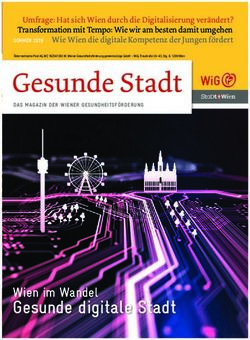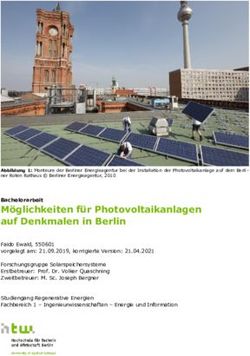Wien, Wien nur Du allein . - Teil 1: Die Ringstraße - Ask Enrico
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„Wien, Wien nur Du allein, tigungsanlagen mit Basteien umzubauen. Ergänzt
wurde das Bauwerk mit einem System von Gräben
sollst stets die Stadt meiner Träume und einer freien Fläche, dem Glacis. Dieses diente
sein …“ dazu Feinde bereits in weiter Ferne auszumachen,
ein offenes Schussfeld zu haben und durfte daher
auch nicht verbaut werden. Zu Beginn des 19.Jahr-
hunderts war jedoch auch diese Anlage überholt,
was sich durch die Sprengung der Burgbastei durch
französische Truppen zeigte. Die Diskussion um die
Schleifung der Anlage begann.
Am 20.Dezember 1857 überraschte Kaiser Franz
Josef I. mit einem Erlass, der die Zerstörung der
Stadtmauern und die Verbauung des Glacis ankün-
digte, um so die Barriere zwischen Innerer Stadt und
den Vorstädten zu entfernen. Die Errichtung einer
Prachtstrasse wurde angeordnet, jedoch auch mili-
tärische Überlegungen spielten bei der Planung eine
Rolle. Ein städtebaulicher Wettbewerb wurde ausge-
Diese Textzeile findet sich in einem bekannten Wie- schrieben, dem 85 Projekte zu Grunde lagen jedoch,
nerlied, das von Rudolf Sieczynski stammt. Ein typi- wie so oft in Wien, wurde keines der siegreichen
scher Wiener, wie man an seinem Namen unschwer Projekte (Sieger waren die Architekten Ludwig Förs-
erkennen kann. Wien, die Metropole des Habsburger- ter, August Siccard von Siccardsburg und Eduard
reiches war ein Schmelztiegel sondergleichen. Ohne van der Nüll) verwirklicht, sondern das Baudepar-
zumindest eine böhmische Urgroßmutter nachwei- tement gestaltete aus den preisgekrönten Entwürfen
sen zu können, kann man sich nicht als „richtiger“ ein eigenes Projekt.
Wiener bezeichnen, hieß es einst. Doch das ist schon Der Ring ist eigentlich kein Kreis, sondern ein
einige Zeit her: Bramburi haben ihren Weg über Oktogon mit geraden Teilabschnitten, die jeweils
Erdäpfel zu der Bezeichnung Kartoffel gefunden, der eine freie Schussfläche gegen eventuelle Aufstän-
„typische“ Wiener versteht kein Wort Tschechisch, dische bieten sollten. Kaiser Franz Josef I. war im
mit etwas Glück vielleicht noch Kroatisch oder -heute Revolutionsjahr 1848 an die Macht gekommen und
eher - Türkisch, einzig die Küche blieb. Sie wird nach dieses Trauma hielt sich bei den Regierenden noch
wie vor als Wiener Küche gefeiert – wobei die Einflüs- lange. Auch die Breite von 57 Metern ist den Über-
se aus Ungarn, Tschechien, der Slowakei, aber auch legungen des Militärs zu verdanken, da man damit
Kroatien und Slowenien nicht außer Acht gelassen den Bau von Barrikaden erschweren wollte und
werden sollten. Truppenverschiebungen erleichtert wurden.
Die Franz-Josephs- und die Rossauer Kasernen,
sowie der – nach dem Kaiser benannte – Franz
Die Wiener Ringstrasse
Josefs Kai waren so angelegt, dass man die Donau-
kanalbrücken unter Artilleriebeschuss nehmen
Der erste Wiener Gemeindebezirk (Innere Stadt)
konnte.
ist von der Ringstrasse – im allgemeinem Wiener
Interessant war auch die Finanzierung: während der
Sprachgebrauch: dem Ring – umgeben, der sich erst
alte Mauerring angeblich durch das Lösegeld für
mit dem Franz Josefs Kai zu eben diesem schließt.
Richard Löwenherz finanziert worden war, „erfand“
Hier wird die Geschichte lebendig, hier zeigt sich die
man nun den Stadterweiterungsfond, der durch den
einstige Größe des Kaiserreichs, das auch in wirt-
Verkauf der Bauparzellen gespeist wurde, die durch
schaftlich und politisch schwierigen Zeiten und trotz
die Zuschüttung der Gräben und die Einbeziehung
ziemlich leerer Staatskassen diesen prächtigen Boule-
des Glacis entstanden waren. Repräsentative Gebäu-
vard errichten ließ.
de entstanden, die unterschiedlichen Stilen huldig-
Die Geschichte der Ringstrasse beginnt Anfang des
ten. Diesem Stilgemisch, das später als Ringstraßen-
13.Jahrhunderts unter den Babenbergern, die – be-
stil bezeichnet wurde und als besondere Ausprägung
dingt durch die Erweiterung der Stadt – einen neuen
des Historismus stilbildend für die Architektur der
Mauerring zur Verteidigung erbauten. Durch die
1860er bis 1890er Jahre galt, konnten die Wiener an-
anhaltende Türkengefahr nach der ersten Belagerung
fänglich nichts abgewinnen. Johann Strauss schrieb
durch Sultan Solimann 1529 war es notwendig, die
aus dem Anlass der Schleifung der Mauer seine
mittelalterliche Mauer zu einer gemauerten Befes-„Demolierer-Polka“ – der Spott der Wiener über die neue Kuppel errichtet.
Staatsoper war so verletzend, dass er Eduard van der Heute finden viele Veranstaltungen und Führungen in
Nüll in den Selbstmord trieb. der Sternwarte für astronomisch interessierte Erwach-
Doch beginnen wir nun unseren Ringstrassen-Rund- sene, aber auch für Kinder und Jugendliche statt. Das
gang. detaillierte Programm finden Sie auf
www.urania-sternwarte.at
Die Urania (1010 Wien, Uraniastraße 1)
Wenn Sie mit kleineren Kindern nach Wien gekom-
Am Beginn des Stubenrings, eigentlich noch am men sind und das Wetter nicht mitspielen sollte,
Franz Josefs Kai befindet sich die Urania, 1909 nach versuchen Sie Eintrittskarten in das Urania Pup-
Plänen Max Fabianis – einem Schüler von Otto Wag- pentheater zu bekommen. Kasperl und Petzi waren
ner – gebaut. Benannt nach der für die Astronomie auch schon Fernsehstars und begeistern ihre kleinen
zuständige Muse – Urania – wurde das Gebäude, in Zuschauer immer wieder. Das Programm und alles
dem noch heute die Sternwarte (neben der Volks- Wissenswerte über die Beiden finden Sie hier:
hochschule, einem Kinosaal und einem Puppenthe- www.kasperlundpezi.at
ater) untergebracht ist, 1910 von Kaiser Franz Josef
eröffnet. Postsparkasse
(1010 Wien, Georg Coch Platz 2)
Ein bisschen abseits von Ring gelegen, sollte man dem
Gebäude und seiner Geschichte aber trotzdem Beach-
tung schenken.
Der niedrige Kassenhallenzubau stammt aus 1935.
Während des 2. Weltkrieges wurde das Gebäude
schwer beschädigt und die Kuppel der Sternwarte zer-
stört, erst 1957 konnte sie wieder eröffnet werden.
Die Wiener Urania Sternwarte wurde als Volksstern-
warte gemeinsam mit dem Volksbildungsinstitut Georg Coch war der Begründer der Postsparkasse in
erbaut und ist die älteste Volkssternwarte Österreichs. Österreich – am 12. Jänner 1883 wurde das k.k.Post-
Im Zuge der Generalrenovierung, die 2003 beendet sparkassen-Amt eröffnet und Georg Coch mit der
wurde, hat man die Sternwarte baulich vollständig Leitung betraut. Die Gründung war ein großer Erfolg
erneuert und anstelle des alten Meridianhauses eine und einige Selbstverständlichkeiten, die aus dem heu-tigen Zahlungsverkehr nicht wegzudenken sind, wie auf die rohe Betondecke wurde direkt eine Schicht
das Postsparbuch, oder der Post-Scheckverkehr – der Asphalt aufgetragen und in diesem noch weichem
eine österreichische Erfindung ist - wurden damals Material ein Eichenbrettelboden sozusagen klebend
eingeführt. verlegt.
Im Februar 1903 wurde ein Wettbewerb für das k.k. Im Kassensaal wurde ein Glasprismen-Fußboden ver-
Postsparkassen-Amtsgebäude als offenes, nicht ano- legt, um darunter befindliche Räume (Postfach und
nymes Verfahren ausgelobt, an dem sich auch Otto Postsortierräume) zu beleuchten.
Wagner beteiligte. Sein Projekt war am genauesten Die Innenausstattung folgt ebenfalls den funktionalen
durchgearbeitet und vereinte auch am besten die Zielen: Ausstattung und Farbgebung wurden darauf
Anforderungen und die Vision der Postsparkasse mit abgestimmt.
der Architektur – trotzdem war es nicht unumstrit-
ten. Auch einige Umplanungen mussten von Wagner
durchgeführt werden - doch am 4. Mai 1904 erfolgte
der Spatenstich und am 17.Dezember 1906 die Eröff-
nung.
Der Direktionsbereich liegt im ersten Stock – der
Große Sitzungssaal bildet den Endpunkt der durch
Doppeltüren verbundenen Raumflucht. Die Farben
Weiß, Grau, Schwarz und Silber dominierten das
Stockwerk, unterbrochen durch die Repräsentations-
Das Gebäude ist ein achtgeschossiger Ziegelbau mit räume: hier herrscht im Direktionszimmer Rot, in
Stahlbetondecken. Die Trennwände sind veränderbar den Empfangsräumen Grün vor.
und nicht tragend. Alles war kostengünstig, dauerhaft Wagner gestaltete für die Postsparkasse die gesamte
und wartungsfreundlich, sollte die Funktionalität un- Inneneinrichtung von den Bodenbelägen über Teppi-
terstützen und den Mitarbeitern einen freundlichen che, Heizkörper, Lampen, Sessel, Kleiderschränke bis
und hygienischen Arbeitsplatz bieten. Noch heute zu den Schreibtischen, Hockern und Safes. Die Mate-
sind Wagners Argumente für ähnliche Bauten gültig. rialien wie auch die Konstruktionsweise wurden auf
Innen- wie Außengestaltung folgen in erster Linie der die größtmögliche Haltbarkeit ausgewählt und unter-
Funktionalität ohne aber ästhetische Grundlagen zu strichen auch die Hierarchie ihrer Nutzer.
vernachlässigen.
Die gesamte Fassade ist mit quadratischen Marmor-
täfelchen und Aluminiumapplikationen belegt. Die
Nieten, mit denen scheinbar die Marmorverkleidung
an der Wand befestigt ist, sind nur Ornament und
gliedern die Fassade. Die ca. 10cm dicken Granit-
platten werden vom Putz gehalten. Da aber sehr
rasch gebaut wurde und man das Haften von selbst
nicht abwarten konnte, wurden sie zur Sicherheit mit
17.000 Nägel aus Eisen, mit Blei verkleidet und mit
Aluminium überzogen, angeheftet. Wagner benutzte
Aluminium auch für andere Schmuckelemente am
Gebäude, wie z.B. die Portikussäule oder das Gebläse
der Zentralheizung.
Wagner legte großen Wert auf modernste technische Im Vestibül befindet sich eine Büste Franz Josephs I.
Lösungen. Neu war auch die Deckenkonstruktion: von Richard Luksch, die 4,3 m hohen, erstmals ausAluminiumguss gefertigten Eckfiguren auf der Attika erst das 2. Museum dieser Art weltweit. Rudolf von
stammen von Othmar Schimkowitz. Eitelberger, Professor für Kunstgeschichte an der
Die Glasfenster sind zum Teil ein Werk von Leo- Universität Wien, wird Direktor.
pold Forstner. Während des 2. Weltkrieges blieb das
Gebäude von Bombentreffern verschont, zwischen
1970 und 1985 erfolgte eine Generalsanierung – eine
weitere in den Jahren 2003-2005 führte das Gebäude
wieder in den Originalzustand zurück, wobei über
dem historischen Fliesenhof ein Schutzdach ange-
bracht wurde. Seit damals ist auch das Wagner:Werk
Museum Postsparkasse im Gebäude untergebracht.
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8.00 bis
15.00 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 17.30 Uhr.
www.ottowagner.com
MAK Österreichisches Museum für ange-
wandte Kunst/Gegenwartskunst, Applied Arts, Am 12. Mai 1864 wird das Museum in Räumlich-
keiten des Ballhauses neben der Wiener Hofburg
Contemporary Art (1010 Wien, Stubenring 5)
eröffnet. Heinrich von Ferstel hatte diese für museale
Zwecke umgestaltet. Das Museum soll als Muster-
sammlung für Künstler, Industrielle und Publikum
und als Aus- und Weiterbildungsstätte für Designer
und Handwerker dienen. Durch die Ausbreitung
der industriellen Revolution gehen mehr und mehr
handwerkliche Fähigkeiten verloren. Die ersten
Ausstellungsstücke kommen aus den kaiserlichen
Sammlungen, aus Klöstern, Privatbesitz, dem k.k. Po-
lytechnikum in Wien. Reproduktionen, Galvanos und
Gipsabdrücke stehen neben Originalen. Sie alle sollen
für künftige Generation als Vorbilder dienen können.
1867 wird die k.k. Kunstgewerbeschule des k.k. Öster-
reichischen Museums für Kunst und Industrie (heute
Universität für angewandte Kunst) gegründet. Theore-
Das MAK gehört zu den wichtigsten und interessan-
tische und praktische Ausbildung sind damit vereint.
testen Museen von Wien. Nicht nur, dass es in einem
Die Kunstgewerbeschule ist vorerst in einer alten Ge-
wunderschönen Bau untergebracht ist, zeigt es mit
wehrfabrik im 9. Wiener Bezirk untergebracht, 1871
seiner Studiensammlung und den Schausammlungen
zieht sie ins Haus am Stubenring, 1877 übersiedelt sie
wunderbare Objekte der Handwerkskunst, Visionen
in den Zubau zum Museum am Stubenring.
zwischen Kunst und Handwerk, deren Geschichte
und Entwicklungen.
Zum 150. Jubiläum des Museums 2014 wurde viel
neu gestaltet und kreiert – es lohnt sich daher immer
wieder vorbei zu schauen.
Die Geschichte
1863 war die Geburtsstunde des MAK. Nach dem
Vorbild des 1852 gegründeten South Kensington
Museum (heute Victoria and Albert Museum), nach
jahrelangen Bemühungen von Rudolf von Eitelberger
und auf Initiative von Erzherzog Rainer, willigt Kaiser
Franz Joseph I. in die Gründung des „k.k. Österrei-
chischen Museum für Kunst und Industrie“ ein. Das
1868 wird endlich mit dem Bau des Gebäudes am
damalige Museum für Kunst und Industrie ist damalsStubenring begonnen, das am 15. November 1871 er- später findet eine Ausstellung über den Stephansdom öffnet wird und nach Plänen von Heinrich von Ferstel statt, bevor das Museum 1949 – nach Behebung der im Renaissancestil errichtet wurde. Es ist der erste am Kriegsschäden - wieder eröffnet wird. Ring errichtete Museumsbau. Die Ausstellungsobjekte 1965 wird das Geymüllerschlössel als Außenstelle werden nun permanent und nach Materialschwer- dem Museum angegliedert und das Museum er- punkten geordnet ausgestellt. hält die Sammlung Franz Sobek – Altwiener Uhren Während der Wiener Weltausstellung 1873 stellen das zwischen 1760 und der zweiten Hälfte des 19. Jahr- Museum für Kunst und Industrie und die Kunstge- hunderts, außerdem Mobiliar aus den Jahren 1800 bis werbeschule gemeinsam am Stubenring aus. Rudolf 1840. von Eitelberger organisiert dabei den weltweit ersten 1993 wird die Schausammlung unter der Beteiligung internationalen kunstwissenschaftlichen Kongress internationaler Künstler neu aufgestellt. und betont damit die Orientierung des Museums an Lehre und Forschung. Die Weltausstellung wird auch Auch wenn Sie nur wenig Zeit für eine Besichtigung für bedeutende Ankäufe für das Museum genutzt, wie haben, sollten Sie auf jeden Fall einen Blick in die Säu- z.B. 60 Blatt der indo-persischen Mogulhandschrift lenhalle werfen und das Gebäude zumindest am Ring Hamzanama. entlang gehen. Hier gelangen Sie an der Verbindungs- 1897 übernimmt Arthur von Scala die Leitung des mauer zwischen der Universität für angewandte Kunst Museums und er kann Otto Wagner, Felician von My- und dem MAK zu einem Wandbrunnen aus Stein mit rbach, Koloman Moser, Josef Hoffmann und Alfred einem Glasmosaikbild und einem Becken aus Wöll- Roller zur Mitarbeit an Museum und Kunstgewerbe- ersdorfer Stein. Der Entwurf stammt von Ferdinand schule gewinnen. Damit wird der Stil der Secession Laufberger, der sich später einen Ruf als Lehrer und auch prägend für die Kunstgewerbeschule. Förderer von Gustav Klimt erworben hat und Hein- Im Jahr 1900 kommt es zur Trennung der Kunstge- rich von Ferstel. Das Mosaikbild stellt die Göttin Mi- werbeschule vom Museum. nerva dar, die nicht nur als Göttin der Weisheit galt, 1904 präsentiert das Museum eine Ausstellung von sondern auch als Schutzgöttin des Kunsthandwerkes. Alt-Wiener Porzellan, dessen Objekte aus dem 1867 übernommenen Nachlass der k.k. Aerarial Porzel- lan-Manufaktur (Wiener Porzellanmanufaktur) und bedeutenden Stücken von Sammlern aus allen Teilen der Donaumonarchie stammen. Mit der Übernahme eines Großteils der Bestände des k.k. Handelsmuseums 1907 kommt die Asiensamm- lung von Arthur von Scala und die Ostasien Samm- lung Heinrich von Siebold zu den Beständen des heutigen MAK. 1909 kommt es zur kompletten Trennung von Muse- um und Kunstgewerbeschule. Im gleichen Jahr wird der Biedermeierstil in Kunst und Kunsthandwerk in Ausstellungen thematisiert. 1919 Nach der Gründung der Ersten Republik be- Wenn Sie weiter Richtung Donaukanal wandern, kommen die Sammlungen des Museums Zuwachs aus finden Sie rechts den Oskar Kokoschka-Platz mit dem ehemals kaiserlichem Besitz. Dadurch entsteht unter Oskar Kokoschka Denkmal, das zu seinem 100. Ge- anderem eine der erlesensten Sammlungen an Orient- burtstag von Alfred Hrdlicka geschaffen wurde. Oskar teppichen weltweit. Kokoschka war damals erst drei Jahre tot. Der Platz, 1920 bis 1922 kommt es zum Austausch und Abgleich der ihm zu Ehren benannt wurde, ist eigentlich kein der Sammlungen mit anderen Museen. richtiger Platz, es gibt auch keine Eingangstür oder Nach dem „Anschluss“ Österreich an das nationalso- Adresse. zialistische Deutschland wird das Museum in „Staat- liches Kunstgewerbemuseum in Wien“ umbenannt. Die Studiensammlung – MAK Design Labor 2014 Von 1939 – 1945 vergrößern sich die Sammlungen des Museums durch zahlreiche beschlagnahmte Pri- Rechtzeitig zum 150-Jahr-Jubiläum wurde der Prä- vatsammlungen. sentation der Studiensammlung ein neues Konzept 1947 wird das Museum in „Österreichisches Museum zu Grunde gelegt – das MAK Design Labor, das am für angewandte Kunst umbenannt“. Bereits ein Jahr 12. Mai 2014 eröffnet wurde. Mit dieser Neupositio-
nierung wird versucht, die umfangreiche Sammlung einer sozial und ökologisch zukunftsfähigen Gesell-
stärker mit Lebenssituationen zu verbinden und schaft aufzeigen sollen, wie Produktion, Geschlechter-
Design auch als zentrale Kraft für die Verbesserung demokratie, Ernährung und Pflanzenvielfalt, Kreis-
von Lebensqualität, aber auch zur Lösung bestimmter laufwirtschaft, Klimaauswirkungen und einiges mehr.
Zukunftsfragen zu positionieren. Und diese Themen sind alle miteinander verwoben:
Kochen, Essen und Trinken, Sitzen, künstlerische,
industrielle oder alternative Produktion, Transport,
Kommunikation, Sammeln, Schützen, Schmücken
und das Ornament. Man findet aber auch Gestalter
wie Josef Hoffmann oder den Modedesigner Helmut
Lang im neuen Konzept mit je einem eigenen Raum
vertreten.
MAK Galerie
In der MAK Galerie können sich die Besucher auf
wechselnde Ausstellungen freuen, die in Zusammen-
arbeit mit der Universität der angewandten Kunst
stattfinden.
Auf 1.900 Quadratmetern wurden die Ausstellungs-
räume neu konzipiert und an die 2.000 Exponate nach Die Schausammlungen
Themeninseln gruppiert. Größtmögliche Flexibilität
soll Veränderungen immer wieder möglich machen Auch die Aufstellungen der Schausammlungen
und den Bezug zwischen historischem Kunsthand- unterliegen einem ständigen Veränderungsprozess.
werk und zeitgenössischen Designschaffen herstellen. 1986 wurde das MAK umgebaut und im Zuge des-
sen entwickelte der damalige Direktor Peter Noever
neue Strategien zur Präsentation der umfangreichen
MAK Design Labor Sammlungen.
So entstand ein chronologisches Ordnungsprinzip,
wobei nicht die dichte serielle Präsentation im Mit-
telpunkt stand, sondern das Ziel die jeweiligen High-
lights der Sammlungen dem Publikum nahe zu brin-
gen. Interventionen zeitgenössischer KünstlerInnen
sollten das Spannungsfeld zwischen künstlerischen
Erbe und heutigen Ansätzen und Lösungen sichtbar
machen.
Während die Studiensammlung zuvor materialspe-
zifisch geordnet war, fließen nun im MAK Design
Labor die Themen und Räume ineinander.
Durch die modulare Umsetzung der Ausstellungsge-
staltung kann das MAK Design Labor in Zukunft im-
mer wieder an aktuelle Themen und Entwicklungen
schnell angepasst werden und so immer auf aktuelle
Zeitströmungen reagieren, ein permanenter Wandel
unter Einbeziehung der Besucher ist ausdrücklich
erwünscht. So werden in der Ausstellung Fragen auf- Folgende Schausammlungen sind im MAK zu sehen:
geworfen, die sich mit aktuellen Problemen beschäfti- In Wien 1900. Design / Kunstgewerbe 1890-1938 fin-
gen und Lösungen zu einem positiven Wandel hin zu den Sie rund 500 ausgewählte Sammlungsobjekte, diekunsthistorische wie gesellschaftspolitische Aspekte Der Stadtpark (1010 Wien, Parkring)
rund um die Wiener Moderne beleuchten. Der erste
Raum widmet sich der Suche nach einem modernen
Stil.
Die große Parkanlage entstand nach der Schleifung
der Wiener Stadtmauer und der Errichtung der Wie-
Die Schausammlung Asien, die als eine der umfang- ner Ringstrasse um 1860. Der Park, im Bereich des
reichsten und bedeutendsten für Kunst und Kunst- ehemaligen Wasserglacis vor dem Karolinenstadttor
gewerbe aus dem asiatischen Raum gilt, wurde im gelegen, war Wiens erste öffentliche Parkanlage.
Februar 2014 neu aufgestellt. Tadashi Kawamata, ei- Der Landschaftsmaler Josef Selleny plante den Park,
ner der wichtigsten Gegenwartskünstler, die Brücken die Durchführung übernahm der Stadtgärtner Rudolf
zwischen Ost und West zu schlagen vermögen, wurde Siebeck, der einen Park mit dem freundlichem Cha-
für Neuaufstellung gewonnen. Große, gerüstartige, rakter eines Ziergartens mit schönen Sträuchern,
geschwungene Vitrinenblöcke im Zentrum des Saals freien Durchsichten, verschlungenen Wegen und
dienen der Präsentation der Sammlungsobjekte. Blumenpflanzungen umsetzen wollte. Die Parker-
Auch die Schausammlung Teppiche wurde 2014 neu öffnung erfolgte am 21. August 1862. Ein Jahr später
aufgestellt. Mit einem neuen, ungewöhnlichen Raum- entstand der schattigere, so genannte Kinderpark, der
konzept von Michael Embacher und einer künstleri- durch die eiserne Karolinenbrücke mit dem Stadtpark
schen Intervention von Füsun Onur wurde die Neu- verbunden wurde.
gestaltung im April 2014 für das Publikum geöffnet.
Die Schausammlung zeigt nun eine Auswahl von über
dreißig Exponaten der MAK-Teppichsammlung, die
mit ihrem Schwerpunkt auf persische und mamluki-
sche Teppiche des 16. und 17. Jahrhunderts zu den
weltweit berühmtesten und wertvollsten zählt. Klas-
sische safawidische und osmanische Teppiche sind die
Highlights der Neupräsentation.
Weitere Schausammlungen: Historismus und Jugend-
stil, Renaissance Barock Rokoko, Empire Biedermeier,
Barock Rokoko Klassizismus und der Kunstblättersaal
mit seinen wechselnden Ausstellungen erwarten den
Besucher.
Öffnungszeiten:
Dienstag von 10:00 bis 22:00 Uhr, wobei der Eintritt Auch heute finden sich großzügige Spielplätze für
zwischen 18:00 und 22:00 Uhr frei ist. Mittwoch bis Kinder und Jugendliche im Stadtparkteil des 3.Bezir-
Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr, Montag geschlossen. kes. Während die Alleebäume für die Begrenzung zur
www.mak.at Ringstraße sorgen, dominieren breite Strauchpflan-
zungen und malerische Wiesen mit umfangreichen
Wasserflächen den Park. Bei der Bepflanzung des
Parks wurde die Blütezeit der Pflanzen berücksichtigt
– so ist eine fast ganzjährige Blüte der Ziersträucher
gegeben. 1941 und 1973 wurde eine Reihe von Gehöl-zen unter Naturschutz gestellt, darunter ein Ginko, einer ausgezeichneten Karte kommen Apfelstrudel
ein Christusdorn, eine seltene Pyramidenpappel und oder Milchrahmstrudel jede Stunde frisch aus dem
eine Kaukasische Flügelnuss. Ofen – probieren!
Kursalon Hübner Der Stadtpark ist reich an Statuen und Denkmälern,
die zu den berühmtesten Fotomotiven der Wienbesu-
cher zählen:
Das bekannteste davon ist wohl die vergoldete Bron-
zestatue von Johann Strauss mit dem Marmorrelief
von Edmund Hellmer, das 1921 enthüllt wurde. Die
Vergoldung wurde 1935 entfernt, 1991 jedoch wieder
aufgetragen. Im Stadtpark finden sich auch die Denk-
mäler von Franz Schubert, Franz Lehar, Robert Stolz,
eine Marmorstandbild des Malers Hans Makart, eine
Bronzebüste des Komponisten Anton Bruckners. Das
Denkmal des Malers Emil Jakob Schindler in Wan-
derkluft wurde von Hellmer geschaffen, die Büste des
Malers Amerling schuf Johann Benk 1902.
Der Wiener Kursalon im italienischen Renaissancestil Auch Bürgermeister Andreas Zelinka, unter dessen
wurde 1867 von Johann Garben erbaut. Regierung der Stadtpark gestaltet wurde, ist im Park
Bereits früher hatte am Wasserglacis ein Kurpavil- verewigt.
lon bestanden, in dem Heil- und Mineralwasser für Brunnen sorgen für kühlendes Nass im Sommer. Sie
Trinkkuren ausgeschenkt worden war. Ursprünglich werden von nackten Riesen (Befreiung der Quelle)
sollte das neue Gebäude auch wieder der Ausschank oder den Donauweibchen geschmückt. Der Stadtpark
von Heilwasser und als Kaffeehaus dienen, Vergnü- hat eine Ausdehnung von 60.000m2 und reicht vom
gungen waren nach der Eröffnung sogar ausdrücklich Parkring im 1. Bezirk bis zum Heumarkt im 3. Wiener
untersagt. Da dieses Konzept aber nicht erfolgreich Gemeindebezirk.
war, fand am 15.Oktober 1868 das erste Konzert von
Johann Strauß (Sohn) statt. Das war der Anfangs- Die Wiener Staatsoper
punkt der langjährigen Tradition als Tanz- und Kon- (1010 Wien, Opernring 2)
zertlokal. Das Lokal wurde zum beliebten Treffpunkt
der Wiener Gesellschaft und ist es bis heute geblieben. Die Oper hat in Wien lange Tradition: bereits Anfang
Der Kursalon gilt als exzellenter Rahmen für Bälle, des 17.Jahrhunderts kam diese Musikgattung aus
Hochzeiten und Events, die auf Exklusivität Wert Italien nach Wien, anfänglich natürlich nur für das
legen. Hier finden aber auch an die 500 Konzerte jähr- Kaiserhaus; Aufführungsstätten waren daher die Hof-
lich statt, die große Terrasse lädt zur Kaffeepause ein burg, die Redoutensäle, aber auch im Freien wurde
und die Clubbings zählen zu den angesagtesten Events gespielt.
in Wien.
Die Meierei
Ein weiteres interessantes Gebäude im Stadtpark ist
die Milchtrinkhalle oder Meierei.
Das Gebäude entstand 1901 bis 1903 nach Plänen der
Architekten Friedrich Ohmann und Josef Hackhofer.
Der villenartige Bau weist barockisierend-secessionis-
tische Formen auf. Das Sockelgeschoss und ein hohes
Mansardendach mit Gitterkrone prägen das Aussehen
des Gebäudes. Im 2.Weltkrieg schwer beschädigt,
wurde die Meierei erweitert wieder aufgebaut und
2004 komplett renoviert.
Mit dem Steirereck ist eines der bestens bewerteten Leopold I. war ein großer Freund der Oper, schließ-
Restaurants in Wien in die Meierei eingezogen. Neben lich komponierte er auch selbst! Er verfasste über 230Kompositionen. Die Aufführungen unterschieden später einem Schlaganfall.
sich allerdings ziemlich von den heutigen Gegeben-
heiten. Die Darbietungen dauerten oft stundenlang, Am 25. Mai 1869 wurde die Staatsoper in Anwesen-
außer dem Kaiser, der auf der Bühne saß, mussten heit von Kaiser Franz Joseph und der Kaiserin
alle anderen das Werk im Stehen genießen. Trotzdem Elisabeth mit Mozarts Don Juan eröffnet. Mit der
wurden schon damals große Inszenierungen mit Feu- Zeit wuchsen auch Anerkennung und Popularität des
erwerk und Flutung von ganzen Plätzen geschaffen. Hauses bei den Wienern.
Maria Theresia öffnete die Oper für alle Bürger. Es
entstanden zwei Häuser: das alte Burgtheater am
Michaelerplatz und das Kärtnertortheater (heute steht
auf seinem Platz das Hotel Sacher). In diesem elegan-
ten Logentheater wurden italienische, französische
und deutsche Opern gezeigt, aber auch Kompositio-
nen von Salieri uraufgeführt, nach der Eröffnung der
Staatsoper wurde das Kärntnertortheater aber abgeris-
sen.
Weit über die Grenzen Wiens ist das „erste Haus“
berühmt: mit rund 50 Opern und 20 Ballettwerken
pro Spielzeit bietet die Wiener Staatsoper das größte
Repertoire eines Opernhauses weltweit. Das ist aber
nicht die einzige Besonderheit des Hauses am Ring: Die Ära unter Direktor Gustav Mahler war einer der
für jede Vorstellung wird ein Kontingent von 25 bis Höhepunkte in der Geschichte der Wiener Staatsoper:
maximal 100 Karten (bei Ballettaufführungen) für er erneuerte das veraltete Aufführungssystem, stärkte
Kinder reserviert, die zu vergünstigten Preisen die den Ensemblegeist und zog erstmals auch bedeuten-
Vorstellungen besuchen können. de bildende Künstler zur Bühnengestaltung heran.
Er pflegte Wagner, gestaltete Mozart und Beethovens
Die Geschichte der Wiener Oper Fidelio neu und förderte österreichische Komponisten
ohne auf Verdi oder Richard Strauss zu vergessen.
Schwere Stunden erlebten die Oper und Wien wäh-
rend der Herrschaft der Nationalsozialisten und im
zweiten Weltkrieg. Gegen Ende des Krieges, am
12. März 1945 erhielt das Haus einen verheeren-
den Bombentreffer, der es stark in Mitleidenschaft
zog. Nur die Hauptfassade, die Feststiege und das
Schwindfoyer blieben verschont, 10 Jahre dauerte
der Wiederaufbau (mit erneuerter Technik und dem
Zuschauerraum) bis die Wiener Staatsoper am 5. No-
vember 1955 mit Beethovens Fidelio unter Karl Böhm
wieder eröffnet werden konnte. In der Zwischenzeit
dienten das Theater an der Wien und die Volksoper
als Ausweichquartiere.
Dabei hatte die Staatsoper oder besser ihre Erbauer
keinen guten Start. August Sicard von Sicardsburg Seither leiteten viele Berühmtheiten das Haus, wie
entwarf den Grundplan, Eduard van der Nüll gestal- Karl Böhm, Herbert von Karajan, Egon Seefehlner,
tete die Innendekoration und auch andere bedeuten- Lorin Maazel, Claus Helmut Drese, Claudio Abbado,
de Künstler wirkten mit, wie Moritz von Schwind Eberhard Wächter und zuletzt Ioan Holender, der
(Fresken im Foyer und „Zauberflöten“-Freskenzyklus 2011 von Dominique Meyer und Generalmusik-
in der Loggia). Die Wiener nahmen das Bauwerk direktor Franz Welser-Möst abgelöst wurde.
anfangs allerdings nur mit Spott zur Kenntnis – Holender ist noch eine Besonderheit der Wiener
„Liegender Elefant“ – wurde es im Volk genannt. Staatsoper zu verdanken: die Kinderoper im Zelt am
Beide Architekten erlebten die Eröffnung der Dach der Staatsoper. Seit 1999 stehen hier Kinder im
Staatsoper nicht mehr: der sensible van der Nüll be- Mittelpunkt: Kindergärten oder Schulklasse können
ging Selbstmord, sein Freund Sicardsburg erlag wenig so Wagners Ring oder die Zauberflöte in einer Stundeerleben oder Opern, wie zum Bespiel das Traumfres- Opernhauses.
serchen von W. Hiller sehen, die speziell für Kinder Seitlich vom zentralen Eingang zu den Parterrebogen
geschrieben wurden. auf dem ersten Absatz der Feststiege sehen Sie die
Porträts der beiden Erbauer der Wiener Staatsoper:
Zahlreiche Größen der Opernwelt wurden in Wien Sicardsburg und Nüll, die vom Bildhauer Josef Cesar
entdeckt oder hatten hier ihren ganz großen Durch- entworfen wurden. Darüber zwei Darstellungen –
bruch wie Angela Gheorghiu, Angelika Kirchschlager, das Ballett und die Oper – von Johann Preleuthner.
Michael Schade, Bo Skovhus oder Ramón Vargas. Beachtenswert ist auch das Deckengemälde „Fortuna,
ihre Gaben streuend“ nach dem Entwurf von Franz
Das Gebäude Doblaschofsky. Die drei Wandgemälde in den Rund-
bögen (Ballett, komische und tragische Oper) stam-
Wenn Sie am Opernring vor der Staatsoper stehen men ebenfalls von ihm.
und auf die Vorderfront blicken, so sehen Sie jenen Die Feststiege wird gesäumt von sieben allegori-
historischen Teil der vom ursprünglichen Bau von schen Statuen, die die sieben freie Künste darstellen:
1869 erhalten geblieben ist. Die Fassaden sind im Baukunst, Bildhauerei, Dichtkunst, Tanz, Tonkunst,
Renaissance-Bogenstil, die Loggia der Ringstraßen- Schauspiel und Malerei. Die von Josef Gasser ge-
seite soll den öffentlichen Charakter zusätzlich unter- schaffenen Statuen wurden in den letzten Kriegstagen
streichen. unversehrt geborgen, ebenso sind die großen Spiegel
Über der Hauptfassade der Loggia wurden 1876 die wie durch ein Wunder erhalten geblieben.
beiden Reiterdarstellungen von Ernst Julius Hähnel
aufgestellt. Sie stellen zwei geflügelte Pferde dar, die Der Zuschauerraum
von der Harmonie und der Muse der Poesie geführt
werden. Die beiden Brunnen rechts und links der
Oper wurden von Josef Gasser gestaltet. Sie stellen
links „Musik, Tanz, Freude, Leichtsinn“ und rechts
„Loreley, Trauer, Liebe, Rache“ dar.
Der im Zweiten Weltkrieg beschädigte Zuschauer-
raum musste vollständig neu aufgebaut werden. Erich
Boltenstein schuf die neuen Stiegenaufgänge auf die
ehemalige 3.Galerie und sämtliche Publikumsräume
in den oberen Rängen, die Architekten Otto Pros-
Der vordere Teil ist schmäler als der hintere Teil des singer, Ceno Kosak und Felix Cevela gestalteten die
Gebäudes: vorne finden sich das Auditorium und alle Pausenräume im ersten Rang. Die Grundgestalt des
dem Publikum zugänglichen Nebenräume, wäh- Logentheaters nach den Plänen von Sicardsburg und
rend sich die Bühne im hinteren Teil befindet. Die van der Nülls wurde beibehalten. Der Zuschauerraum
senkrecht auf den Haupttrakt stehenden Querflügel fasst heute 2284 Plätze, davon sind 1709 Sitz-, 567
dienten ursprünglich als Wagenvorfahrten, an ihren Steh-, 4 Rollstuhl und 4 Begleitplätze. Um die Ein-
Fronten finden sich Wappendarstellungen der öster- zigartigkeit der Akustik des Raumes zu unterstützen
reichisch-ungarischen Monarchie. wurden die Logenbrüstungen aus Eisenbeton mit
Das Kassenvestibül ist – ebenso wie das Hauptves- Holz verkleidet. Die kaiserlichen Farben (Rot-Gold)
tibül, die zentrale Treppenanlage mit ihrem unteren wurden übernommen, der große Mittelluster wurde
Teil, der Feststiege, das Schwindfoyer und Loggia, aus Sicherheitsgründen durch einen in der
sowie der Teesalon im ersten Stock - in seiner ur- Decke eingebauten Beleuchtungskranz aus Kristallglas
sprünglichen Form erhalten geblieben und gibt einen ersetzt. Dieser ist etwa 3000 Kilogramm schwer und
Eindruck vom ursprünglichen Interieur des alten beinhaltet 1100 Glühbirnen, der Durchmesser beträgt7 Meter, er ist 5 Meter hoch und hat einen Raum für Der Freischütz, Der Barbier von Sevilla, Der Wasser-
einen Beleuchterstand und Gänge zur Wartung des träger, Die Weiße Dame, Hans Heiling, Die Vestalin,
Lichtkranzes. Jessonda, Der häusliche Krieg, Armida, Die Zauber-
Der „eiserne Vorhang“: Beachtung verdient auch der flöte, Fidelio, Doktor und Apotheker, Die Hugenot-
sogenannte eiserne Vorhang, der den Zuschauerraum ten, und Die Schöpfung. Eine Büste des betreffenden
von der Bühne trennt. Er wurde von Prof. Rudolf Komponisten findet sich unter jedem Bild. Zwei
Eisenmenger gestaltet wurde und zeigte ursprünglich Gemälde („Kampf um den Kranz“ und „Der Sieg“)
das Motiv aus Glucks Oper Orpheus und Eurydike. von Friedrich Sturm schmücken die Decke, seitlich
1998 entwickelte „museum in progress“ eine Serie von über den beiden Marmorkaminen befinden sich die
Großbildern – die Umsetzung und die Fixierung der Medaillons von Maria Theresia und Kaiser Leopold I.
Bilder erfolgt über ein eigens entwickeltes Verfahren, Im Schwindfoyer finden Sie auch die Büsten bedeu-
das sowohl die Erhaltung des Ursprungsbildes als tender Direktoren des Hauses, wie z.B. Gustav Mahler,
auch die optimale Qualität des neuen Meisterwerkes Richard Strauss, Karl Böhm und natürlich Herbert
garantiert. von Karajan. Der anschließende Marmorsaal wurde
von den Architekten Prossinger und Cevela aus dem
Der Orchesterraum zerstörten Kaisersaal und dem einstigen Rauchsalon
geschaffen – die Marmoreinlegearbeiten stammen von
Der Orchesterraum ist 123m2 groß und bietet etwa Heinz Leinfellner und stellen Szenen aus dem Thea-
110 Musikern Platz – dem Wiener Staatsopern- terleben dar.
orchester. Aus den Mitgliedern dieses Orchesters Weitere Informationen und Programm:
rekrutieren sich die Wiener Philharmoniker. www.wiener-staatsoper.at
Der Orchestergraben ist mit einem hebbaren Fußbo-
den ausgestattet, so dass seine Höhe variiert werden Der Burggarten
kann; - damit können bestimmte akustische Wirkun- (1010 Wien, Burgring-Opernring)
gen erzielt werden und bei kleineren Besetzungen
Auftritte auf der Vorbühne ermöglicht werden. 1816, nachdem die französische Armee Teile der
ehemaligen kaiserlichen Privatgärten verwüstet hatte,
Der Gustav Mahler-Saal wurde von Kaiser Franz I. der Auftrag zum Wieder-
aufbau der Gärten gegeben. Der Plan dafür stammt
Rechts vom Stiegenhaus befindet sich der sogenannte von Ludwig Remy, die Ausführung übernahm Hof-
Gustav Mahler-Saal, der früher Gobelinsaal genannt gärtner Franz Antoine. Kaiser Franz I. nahm wesent-
wurde, da ihn Gobelins mit Motiven aus Mozarts lichen Einfluss auf die Planungen. Bis 1919 war der
„Zauberflöte“ schmücken, die Rudolf Eisenmenger Burggarten, der eine Fläche von 38.000m2 aufweist
entworfen hat. Zwanzig Arbeiterinnen der ehemaligen und zwischen der Hofburg und der Staatsoper liegt,
Wiener Gobelinmanufaktur haben diese, die 13.000 nicht öffentlich zugänglich.
Farbnuancen aufweisen, in sechsjähriger Arbeit her- Heute kann jedermann die Atmosphäre des Parks
gestellt. Bis 1994 befand sich hier die Direktionskanz- genießen, die vielen Denkmäler bewundern oder das
lei. 100 Jahre nach Gustav Mahlers Dirigentendebüt Schmetterlingshaus im Palmenhaus besuchen.
wurde der Raum nach ihm benannt. Die Stelle seines
Arbeitszimmers ziert heute sein Porträt, das der Die Denkmäler im Burggarten
Künstler R.B. Kitaj geschaffen hat.
Insgesamt steht den Besuchern in den Pausen eine Die Statue des Kaisers Franz Stephan von Lothringen
120 Meter lange Kette an zusammenhängenden (Franz I., Gemahl von Maria Theresia) ist das älteste
Räumen zur Verfügung – „sehen und gesehen wer- Reiterstandbild von Wien. Es wurde bereits zu Lebzei-
den“ war und ist in Wien schon immer eine wichtige ten des Kaisers von Balthasar Ferdinand Moll geschaf-
Komponente des Opernbesuches gewesen – nicht nur fen. Ab 1797 stand es im „Paradeisgartl“ – 1819 wurde
beim Opernball. es in den Burggarten übersiedelt.
Kaiser Franz Joseph I.: Seine Statue ist eine Kopie
Das Schwindfoyer und der Marmorsaal des Standbildes, das Johannes Benk 1904 aus Stein
geschaffen hatte. Diese Figur goss ein Schüler Benks,
Das original erhalten gebliebene Foyer (früher „Pro- Josef Tuch, nach und sie wurde zuerst in Wiener Neu-
menadensaal“) schmücken sechzehn Ölgemälde nach stadt aufgestellt. 1938 wollten die Nationalsozialisten
Kartons von Moritz von Schwind. Die Gemälde stel- das auf einem Steinsockel stehende Metallstandbild
len Opern und ein Konzertstück dar: des Kaisers in Uniform verschrotten lassen. Die Statuekam in die Metallhütte nach Liesing, wo sie den Krieg die Habsburger seit dem 13.Jahrhundert, - zuerst als
unbeschadet überstand. Der Präsident der Industriel- österreichische Landesherren, ab 1452 als Kaiser des
lenvereinigung – Hans Lauda – veranlasste 1957 ihre Heiligen Römischen Reiches und ab 1806 als österrei-
Aufstellung im Burggarten. chische Kaiser (bis 1918).
Am Ringstraßen-Eingang befindet sich das Denkmal Heute residiert in einem Teil davon der österreichi-
Wolfgang Amadeus Mozarts, das von Viktor Tilgner sche Bundespräsident, aber auch Museen, Ausstel-
geschaffen wurde. Die Reliefs zeigen Szenen aus Don lungs- und Repräsentationsräume haben nun in der
Giovanni und Mozart als Wunderkind. Ursprünglich ehemaligen kaiserlichen Winterresidenz ihren Sitz.
am Platz vor der Albertina aufgestellt, wurde es im Die Hofburg ist ein gewaltiger Komplex, der sich über
2. Weltkrieg beschädigt, musste daher entfernt und 240.000m2 erstreckt. Er besteht aus 18 Trakten,
restauriert werden, erst 1953 wurde es im Burggarten 19 Höfen und 2.600 Räumen, nahezu jeder Kaiser
aufgestellt. hat die Residenz erweitert und an seine Bedürfnisse
Abraham a Santa Claras Steinfigur wurde von Hans angepasst.
Schwathe 1928 geschaffen. Um 1760 entstand die klei-
ne Bleifigur am Teich, die Herkules mit dem Nemei- Alte Burg
schen Löwen darstellt.
Außerhalb des Burggartens am Opernring sitzt Der älteste Teil ist die Alte Burg – von Ottokar II.
Goethe in einem Prunksessel, geschaffen von Edmund 1275 erbaut – mit Wassergraben, Zugbrücke und Eck-
von Hellmer. (um 1900) türmen. Seit dem 18. Jahrhundert wachte die Schwei-
1822 wurde im Burggarten von Ludwig Remy ein 128 zergarde als Burgwache, was diesem Teil zu seinem
Meter langes Gewächshaus errichtet, das 1901 durch Namen „Schweizertrakt“ verhalf. Die mittelalterliche
das heutige Palmenhaus von Friedrich Ohmann Burganlage ist in ihrem Kern bis auf ihre Ecktürme
ersetzt wurde, das als eines der Jugendstiljuwelen in und die Zugbrücke bis heute erhalten, die Fassade
Wien gilt und zu den schönsten Gewächshäusern sei- wurde 1554 von Ferdinand I. im Renaissancestil er-
ner Zeit gehört. Der Kaiser nutzte es zur Unterhaltung neuert. Pietro Ferabosco gestaltete 1552 das
und Entspannung. Schweizertor, das heute zu der Schatzkammer führt.
1988 musste das Palmenhaus aus Sicherheitsgründen Hier befinden sich die Insignien des Heiligen
gesperrt werden – erst 1998 war die Renovierung Römischen Reiches und der österreichischen Kaiser.
abgeschlossen und der Wiedereröffnung stand nichts Burgkapelle
im Wege. In der Burgkapelle, die 1449 errichtet wurde, können
Die Grundfläche des Palmenhauses beträgt 2020m2: Sie jeden Sonntag die Wiener Sängerknaben bei der
auf dieser Fläche ist ein Café untergebracht, ein La- Messe singen hören. Ursprünglich stammt die Kapelle
gerbereich für die Pflanzen zum Überwintern (dieser aus dem 13.Jahrhundert, wurde im 15.Jahrhundert
Platz wird im Sommer für Ausstellungen oder Veran- vergrößert, später barockisiert, 1802 klassizistisch
staltungen genutzt) und das tropische Schmetterlings- regotisiert. Der einschiffige Innenraum bietet den-
haus. noch ein geschlossenes Bild. Das Netzrippengewölbe
schließt sich über dreigeschossigen Emporen und
Die Hofburg zweigeschossigen Fensterwänden. Unter den Pfeiler-
baldachinen stehen 13 gotische Holzfiguren.
Beachtenswert sind das Bronzekruzifix am Hochaltar
von Johann Känischbauer um 1720 und die Holzma-
donna am linken Seitenaltar (Anfang 15.Jh.). Im Ho-
finneren finden Sie links den Brunnen mit Kaiseradler
von 1553. Eine Säulenstiege aus dem 18.Jahrhundert
führt zur Schatzkammer.
Die Schatzkammer
Hier finden Sie die Herzstücke der Sammlungen der
Habsburger und die Insignien und Kleinodien des
Heiligen Römischen Reiches: die Reichskrone von
magischer Schönheit und Symbolkraft. Ihr Reif ent-
Die Wiener Hofburg war über 600 Jahre das Zent- stand 926 zur Krönung Ottos des Großen, das Kreuz
rum des Habsburgerreiches. Von hier aus regierten unter Otto III um 1000, die Bügel unter Konrad II.um 1030. Kaiser Franz Joseph und seiner Gemahlin Sisi sind
Nicht zu vergessen die anderen Reichsinsignien: das historisch-authentisch gestaltet.
Reichskreuz (um 1025), den Reichsapfel (um 1200), Im Trakt der Kaiserin – in Weiß, Scharlachrot und
die Heilige Lanze mit Kreuzpartikel (8.Jht.), das Zep- Gold gehalten – sind die Schlaf- und Wohngemächer
ter (14.Jht.), das Reichsschwert aus dem zusammengelegt – auch das „berühmte“ Turnzimmer
11. Jahrhundert, das Krönungsevangeliar (um 800) der Kaiserin mit Sprossenwand und Ringen ist zu
und der sizilianische Krönungsmantel von 1134. sehen.
Wunderschön ist die Hauskrone Kaiser Rudolfs II.,
aus seiner Prager Hofwerkstatt stammend, die zur Leopoldinische Trakt
Staatskrone des Erbkaiserreiches Österreich prokla-
miert wurde. Kaiser Leopold I. ließ 1660 den Schweizertrakt mit
Sehenswert auch der Burgunderschatz, der durch die der Amalienburg verbinden. Nach einem Brand
Heirat Maximilians I. mit Maria von Burgund nach wurde er unter G.P. Tencala und Domenico Carlone
Österreich kam und den Schatz des Ordens vom Gol- 1680 fertig gestellt. Dieser neu entstandene und nach
denen Vlies mit einschließt. Bemerkenswerte Stücke dem Kaiser benannte frühbarocke Leopoldinische
sind eine Achatschale aus dem 4.Jh., die als Heiliger Trakt wurde im 18.Jahrhundert von Maria Theresia
Gral gilt und der Stoßzahn eines Narwals, der als bewohnt. Nach ihrem Tod wurden die Räumlich-
Horn eines Einhorns und damit als Christus-Symbol keiten bis zum Ende der Monarchie als prunkvolle
angesehen wird. Repräsentationsräume verwendet.
Seit 1946 befindet sich in diesem Teil der Hofburg der
Stallburg Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten,
daher sind die Räumlichkeiten nicht öffentlich zu-
Mit dem Bau der Stallburg als neue Residenz wurde gänglich.
1559 im Auftrag von Maximilian II. begonnen. Hier
befinden sich seit dem 18.Jahrhundert die Stallungen Nationalbibliothek und Reichskanzleitrakt
der Lipizzaner, die in der gegenüberliegenden Winter-
reitschule ihr Morgentraining oder ihre Vorführungen Die Nationalbibliothek wurde 1723-1735 als Hofbib-
absolvieren. liothek für den kostbaren Bücherschatz der Habsbur-
ger gebaut. Ihr Prunksaal mit seinem barocken Interi-
Amalienburg eur gehört zu den schönsten Bibliotheksälen der Welt.
Karl VI. schloss den Platz durch den Reichskanzlei-
Rudolf II., Sohn Maximilians II., ließ ab 1575 den trakt, den Hildebrandt plante und begann, der auf
dritten Burgkomplex anlegen: die Amalienburg. Die Wunsch des Kaisers aber von Johann Emanuel
Renaissancefassade zum Burgplatz war hauptsächlich Fischer von Erlach 1730 vollendet wurde. 1806 wur-
das Werk Ferraboscos. Die Gemahlin Kaiser Joseph den die Kanzleiräume in Wohnräume für die
I. richtete hier nach dem Tod des Kaisers ihren Wit- kaiserliche Familie umgewandelt. Ab Mitte des
wensitz ein und gab so dem Gebäude seinen Namen. 19.Jhts. residierte hier schließlich Kaiser Franz Josef.
Zuletzt bewohnte Kaiserin Elisabeth diesen Teil der Die Skulpturen an den Portalen entwarf Lorenzo
Hofburg, deren Appartements heute besichtigt wer- Mattielli – sie stellen die Arbeiten des Herkules dar.
den können. Im Mitteltrakt befindet sich das Kaisertor, das den
Zugang zu den Kaiserappartements bietet. Hier sieht
Silberkammer, Sisi-Museum und Kaiserappartements man am Dachrand das imposante Wappenschild
Kaiser Karls VI. mit dem Doppeladler, der den öster-
Verschwenderischen Luxus imperialer Tafelkultur reichischen Bindenschild mit den österreichischen
zeigt die Silberkammer: kostbare Servicen, erlesenes Farben Rot-Weiß-Rot trägt und von der Reichskrone
Porzellan, kunstvoll geschmückte Tische. überhöht ist.
In den Räumen des Sisi-Museums kann man zahlrei-
che originale Exponate aus dem Besitz der Kaiserin Winterreitschule und Redoutensäle
bewundern (darunter ihre Fächer, Handschuhe, Nie-
derschriften ihrer Gedichte, aber auch den Sisi-Stern, In der 1735 von Johann Emanuel Fischer von Erlach
den berühmten Haarschmuck der Kaiserin), sowie vollendeten Winterreitschule finden – wie bereits
einige Repliken ihrer Kleider. erwähnt – bis heute die Vorführungen der Spanischen
Der Trakt des Kaisers folgt gleich anschließend: Hofreitschule statt. In den anschließenden Redouten-
neunzehn Arbeits-, Wohn- und Empfangsräume von sälen fanden und finden große Empfänge, Bälle undandere Festlichkeiten statt, heute dienen sie allerdings
überwiegend als Kongresszentrum. Der wuchtige klassizistische Bau mit dorischen
Ludwig Montoyer errichtete zu Beginn des 19.Jhts. Säulen, zum Ring gerichtet, wurde 1824 nach einem
den prunkvollen Zeremoniensaal, in dem ebenfalls Entwurf von Peter Nobiles vollendet. Errichtet zur
viele Feste des Kaiserhauses stattfanden und der auch Erinnerung an die Völkerschlacht bei Leipzig, nach-
heute noch als Austragungsort vieler Wiener Bälle dem Napoleon die Burgbastei sprengen ließ. Das
dient. Innere ist heute eine Gedenkstätte für die Gefallenen
des Ersten Weltkrieges sowie für Widerstandskämpfer
Michaelertrakt gegen Faschismus.
Dem dahinter liegenden Heldenplatz gaben die zwei
1888 wurde das Alte Burgtheater abgerissen und da- Reiterstandbilder seinen Namen: auf der einen Seite
mit Platz für weitere Erweiterungen geschaffen. Erzherzog Karl, der Sieger über Napoleon bei As-
Ferdinand Kirschner vollendete nach Plänen Fischer pern, auf dem, eine Levade ausführenden und nur auf
von Erlachs den Michaelertrakt, der mit seiner ge- die Hinterhufe gestütztem Pferd, - auf der anderen
schwungenen Fassade und seiner fünfzig Meter hohen Seite das Denkmal von Prinz Eugen, sein Ross noch
Kuppel heute noch das Erscheinungsbild der Innen- konventioneller ausgeführt, da hier der Schweif des
stadtseite der Hofburg prägt. Pferdes noch als zusätzliche Stütze dient.
Vier Heraklesgestalten begrüßen den Eintretenden, Beide Plastiken stammen von Anton Dominik Fern-
die kolossalen Wandbrunnen demonstrieren mit stür- korn, die Sockel von Eduard van der Nüll.
zenden und steigenden Körpern die Macht Habsburgs www.hofburg-wien.at
zur See (links, von Weyr) und zu Lande (rechts, von
Helmer). In der Rundhalle finden sich Allegorien auf Auf der Internetseite der Wiener Hofburg finden Sie
Wahlsprüche von Karl VI., Maria Theresia, Joseph II. neben vielen weiteren Informationen Audioguides für
und Franz Joseph. die Silberkammer, das Sisi-Museum und die Kaiser-
appartements gratis zum Downloaden aufs Handy
Die Neue Burg oder den MP3-Player in den Sprachen Deutsch, Eng-
lisch, Französisch, Holländisch, Italienisch, Japanisch,
Als letzter großer Komplex entstand am Beginn des Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch
20.Jahrhunderts, kurz vor dem Ende der Monarchie, und Ungarisch
die Neue Hofburg, als Teil des von Gottfried Semper http://www.hofburg-wien.at/service/mediathek/au-
und Karl Hausenauer geplanten „Kaiserforums“. dioguides.html
Heute findet sich hier ein Teil der Österreichischen
Nationalbibliothek, das Ephesosmuseum, die Samm- Wer mehr über die Geschichte der Habsburger erfah-
lung alter Musikinstrumente, das Museum für Völker- ren möchte, sollte die Internetseite
kunde und die Hofjagd- und Rüstkammer. www.habsburger.net besuchen.
Bemerkenswerte Ausstellungsstücke dieser Museen
sind vor allem das Partherfries im Ephesos-Museum: Das Kunsthistorische Museum (1010 Wien,
ein 40m langes Monumentalrelief mit lebensgroßen Besuchereingang Maria Theresienplatz)
Figuren, das um 170n.Chr. anlässlich des Sieges des
römischen Kaisers Lucius Verus über die Parther
geschaffen wurde und von österreichischen Archäolo-
gen in Ephesos bei Ausgrabungen 1896 – 1906 gefun-
den wurde.
Das Museum für Völkerkunde birgt als bekanntestes
Stück die sogenannte „Federkrone des Motecuzomas“,
des Herrschers der Azteken, der diese angeblich dem
Eroberer Cortez darbrachte, den er für einen weißen
Gott hielt. Heutige Erkenntnisse verweisen diese
Annahmen allerdings eher in das Reich der Legen-
den – trotzdem finden sich viele kostbare Schätze alter
Stammeskulturen in dem Museum, ein Besuch lohnt
sich.
Das äußere Burgtor und der Heldenplatz Das Kunsthistorische Museum, das gemeinsam mitdem Naturhistorischen Museum zeitgleich mit dem lauf des Lebens“, das Gemälde im Blickpunkt der
Bau der Ringstrasse geplant wurde, gehört zu den Haupttreppe Franz I. von Lothringen, der mit seiner
größten und bedeutendsten Museen der Welt. Naturaliensammlung den Grundstein für die Samm-
Die reichen Sammlungen sind eng mit dem Hause lungen legte. Die frühesten Sammlungen des Muse-
Habsburg verbunden, und gehen auf die Vorlieben ums sind über 250 Jahre alt.
und Interessen von Persönlichkeiten dieser Dynastie
zurück, besonders auf Kaiser Rudolf II. und Erzher-
zog Leopold Wilhelm.
Nach zwanzig jähriger Bauzeit fand 1891 die feierliche
Eröffnung des von Gottfried Semper und Carl von
Hasenauer geplanten Museums statt. Damit waren die
kaiserlichen Sammlungen erstmals unter einem Dach
vereint. Auch an der Innenausstattung wurde nicht
gespart – kostbare Materialien wurden verwendet, um
den Rahmen für die ebenfalls kostbaren und außerge-
wöhnlichen Sammlungen zu bieten, die die
Habsburger über Jahrhunderte zusammengetragen
hatten.
So tritt man durch ein gewaltiges überkuppeltes 20 Millionen Objekte werden heute wissenschaftlich
Vestibül ein, um über eine feierliche, bunt marmorier- betreut. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die
te Treppe zu den Ausstellungsräumen zu kommen. 25.000 Jahre alte Venus von Willendorf, ein steinzeit-
Der erste Blick fällt auf Canovas Plastik „Theseus im liches Fruchtbarkeitsidol oder die Fanny von Galgen-
Kampf mit den Kentauren“, dann das Deckenbild des burg, die 32.000 Jahre am Buckel hat.
ungarischen Malers Michael Munkáczy, die Lünet- Weltbekannt sind auch die Hallstätter Gräberfunde
tenbilder von Hans Makart, die Zwickel-Allegorien von 800-400 v.Chr.
aus der Kunstgeschichte von Ernst und Gustav Klimt In der Paläontologie-Abteilung treten die Saurier wie
sowie Franz Matsch. in Jurassic Park auf: Dominierend ist das rund 100
In der Kuppelhalle zeigt der Relieffries von Weyr die Millionen alte Saurierskelett, das eine Länge von 27m
Habsburger Kunstmäzene von Maximilian I. bis Franz aufweist und aus Kalifornien stammt.
Joseph I. – unglaublich aber die Sammlungen: Hier Es wird aber auch der Frage nachgegangen, ob Basilis-
finden Sie Tizian („Ecce Homo“), Veronese, Tintoretto ken, die in vielen Wiener Sagen auftauchen, wirklich
(„Susanna im Bad“), Giorgiones („Die drei Philoso- gelebt haben – ein „Exponat“ dieser sagenumwobenen
phen“), Raffael („Madonna im Grünen“). Von den Tiere findet sich auch in der Ausstellung.
spanischen Habsburgern kamen viele Herrscherpor-
träts von Velazquez, darunter die „Infantin Margarita
Teresa“; hier ist die weltgrößte Sammlung der Werke
Pieter Brueghels d.Ä. ausgestellt, dann noch Van Eyck,
Rogier van der Weyden, Bosch, aus Prag Bilder von
Dürer und Arcimboldo, Rubensbilder in drei Räu-
men.
Interessant sind auch die Ägyptisch-Orientalische
Sammlung und die Antikensammlung, die Kunstkam-
mer und das Münzkabinett.
Info über aktuelle Ausstellungen unter www.khm.at
Das Naturhistorische Museum (1010 Wien,
Besuchereingang Maria Theresien Platz)
In der Edelsteinsammlung können Sie den Edelstein-
Das dem Kunsthistorischen Museum gegenüberlie- strauß bewundern, den Maria Theresia ihren Gemahl
gende Gebäude ist eigentlich ein Zwillingsbau. schenkte, außerdem sehen Sie einen 117kg schwerer
Ausstattung und Bilder sind hier auf Natur und Wis- Topas, einen 82-karätigen Rohdiamanten und die
senschaft abgestimmt, so zeigt das Deckengemälde „Smaragdstufe Montezumas“.
über dem Treppenhaus von Hans Canon den „Kreis- Außergewöhnlich interessant ist auch die älteste Me-Sie können auch lesen