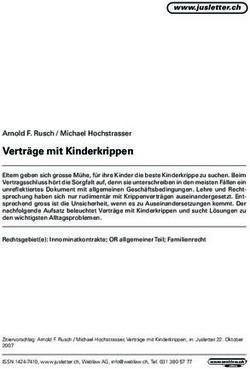Zur Situation von Jugendlichen und jungen Frauen in Frauenhäusern und/oder in der Beratung - AWO
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bundesverband e.V. Zur Situation von Jugendlichen und jungen Frauen in Frauenhäusern und/oder in der Beratung DOKUMENTATION DES WORKSHOPS 2.-3. NOVEMBER 2020 EIN ANGEBOT DES BUNDESVERBANDES DER ARBEITERWOHLFAHRT (AWO) IN KOOPERATION MIT PROF. DR. ANGELIKA HENSCHEL VON DER LEUPHANA UNIVERSIÄT LÜNEBURG
Impressum AWO Bundesverband e. V. Blücherstraße 62/63 10916 Berlin Telefon: (+49) 30 – 263 09 – 0 Telefax: (+49) 30 – 263 09 – 325 99 E-Mail: info@awo.org Internet: awo.org Verantwortlich: Prof. Dr. Jens Schubert, Vorstandsvorsitzender Redaktion: Christiane Völz Layout/Satz: Linda Kutzki – textsalz.de Verfasserinnen: Prof. Angelika Henschel & Birgit Schwarz, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Leuphana Universität Lüneburg @ AWO Bundesverband e. V., Berlin. Das Copyright für Texte und Bilder liegt, soweit nicht anders vermerkt, beim AWO Bundesverband e. V. Abdruck, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung des AWO Bundesverbands e. V. Alle Rechte vorbehalten. Januar 2021
Inhaltsverzeichnis
Christiane Völz
Vorwort und Hintergründe zum Projekt 4
Prof. Dr. Angelika Henschel
Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen 5
Birgit Schwarz, Mag. Mag. phil.
Konzept und Inhalte des Workshops 17
Birgit Schwarz, Mag. Mag. phil.
Workshopergebnisse 19
Birgit Schwarz, Mag. Mag. phil.
Evaluationsergebnisse 38
Prof. Dr. Angelika Henschel
„Was tun?!“ Zusammenfassung
und Ausblick 43
Anhang 52
3ZUR SITUATION VON JUGENDLICHEN UND JUNGEN FRAUEN IN FRAUENHÄUSERN UND/ODER IN DER BERATUNG
4
Christiane Völz
Vorwort und Hintergründe zum Projekt
Wie ist die Verbleibsituation von jugendlichen licher Gewalterfahrung zu gewinnen. Wie die
Kindern, wenn ihre Mütter Zuflucht vor häusli- Ergebnisse des Workshops zeigen, gibt es noch
cher Gewalt im Frauenhaus suchen? Und welche viele Leerstellen und Handlungsbedarfe.
besonderen Anforderungen stellt die Zusam-
menarbeit mit jungen Frauen Anfang zwanzig, Neben der Verbleibsituation junger Menschen im
die – teils bereits mit eigenen kleinen Kindern Falle häuslicher Gewalt und ihren spezifischen
– vor der Familie ins Frauenhaus flüchten? Wel- Bedarfen wurde auch die arbeitsfeldübergrei-
che Spezifik ist kennzeichnend für diese jungen fende Zusammenarbeit von Frauengewaltschutz
Menschen und ihre Lebensphase, um die Mitar- und Jugendhilfe zum Gegenstand der Sondie-
beiterinnen in Frauenhäusern und/oder Fach- rung. Die Erfahrungen in der arbeitsfeldübergrei-
beratungsstellen wissen müssen? Diese Fragen fenden Zusammenarbeit zeigen, dass Koopera-
tauchen in Gesprächen und Arbeitskreisen mit tionsbedarf besteht und es noch allzu oft einer
Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern und Fach- besseren Abstimmung bedarf. Um gute Angebote
beratungsstellen der AWO verstärkt auf. und Lösungen im Sinne der Jugendlichen und
jungen Frauen zu entwickeln, sollen in weiteren
Im Jahr 2019 haben bundesweit mehr als 7.000 Schritten beide Perspektiven – die des Frauen-
Frauen Schutz und Hilfe in einem Frauenhaus gewaltschutzes und der Jugendhilfe – zusam-
erhalten1 sowie mehr als 8.000 mitbetroffene mengebracht werden.
Kinder. 10 % der Kinder waren älter als zwölf
Jahre. Fast 22 % der Frauen waren zwischen 18 Ein herzlicher Dank geht an die Teilnehmerin-
und 25 Jahre alt. Die genannten Zahlen aus der nen des Workshops, die mit ihrer Expertise und
Bewohnerinnenstatistik der Frauenhauskoordi- ihren Erfahrungen die Problemlagen beschrieben
nierung werden weit höher sein, da lediglich 182 und angereichert haben. So konnte ein spezifi-
von den rund 350 Frauenhäusern in Deutschland sches Bild zur Situation von Jugendlichen und
an dieser Statistik teilgenommen haben. jungen Frauen im Frauenhaus bzw. in der Bera-
tung gezeichnet werden. Gemeinsam wurden
Über Mittel aus dem Kinder- und Jugendplan des erste Handlungsanforderungen formuliert und
Bundes hat der AWO Bundesverband die Mög- Ideen gesammelt. Durch die wissenschaftliche
lichkeit und den Auftrag erhalten, vertieft zur Begleitung von Professorin Dr. Angelika Henschel
Situation dieser jungen Menschen zu arbeiten. Im und Birgit Schwarz wurde der Workshop fundiert
Rahmen des Kooperationsverbunds Jugendsozi- konzipiert, durchgeführt und dokumentiert, auch
alarbeit hat der AWO Bundesverband die Feder- dafür sehr herzlichen Dank. Damit liegen hier
führung für dieses Schwerpunktthema über- umfangreiche Ergebnisse vor, die die weitere
nommen. In einem ersten Schritt wurde in dem Arbeit zu diesem Schwerpunktthema bestimmen
Arbeitsfeld Frauengewaltschutz die Sondierung werden. Das Ziel ist dabei stets, die Situation
aufgenommen. Gerade weil dieses Arbeitsfeld von jungen Menschen, die von häuslicher Gewalt
nicht der Jugendhilfe zugeordnet ist, hier aber betroffen sind, durch bedarfsgerechte Angebote
jedes Jahr mehrere tausend Kinder und Jugendli- zu verbessern.
che mit ihren Müttern bzw. junge Frauen Schutz
und Hilfe erhalten, war die Absicht, hier erste Berlin, Dezember 2020
wichtige Erkenntnisse über die Bedürfnisse und Christiane Völz
Bedarfslagen von jungen Menschen mit häus-
1 Frauenhauskoordinierung 2020: Statistik Frauenhäuser und ihre Bewohner_innen. B
ewohner_innenstatistik
2019 Deutschland.
4Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen
Prof. Dr. Angelika Henschel
Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen
„Und wir sind auch noch da …“ Zur Situation
von Jugendlichen und jungen Frauen in
Frauenhäusern und/oder in der Beratung
Seit Ende der sechziger Jahre erfolgte durch In konkreten sozialen Kontexten, in den ver-
unterschiedliche feministische Strömungen in schiedenen gesellschaftlichen Sphären wie
Deutschland eine differenzierte Betrachtung auch im Erwerbs- und Privatleben finden sich
asymmetrischer Geschlechterverhältnisse (vgl. geschlechtsbezogene Hierarchisierungen einer-
Lenz 2014), die nicht nur einen veränderten seits in Strukturen, andererseits aber auch in den
öffentlichen und politischen Diskurs bewirkte, sozialen Praxen von Männern und Frauen wie-
sondern auch Auswirkungen in der Sozialen der, die sich durch wechselseitige Beeinflussung
Arbeit zeigte. Die Neue Frauenbewegung, deren verstärken können (vgl. Henschel 2019; Stiegler
Anliegen es war, Gesellschaftskritik um die Ana- 2006). Die historisch gewachsene, traditionelle
lyse von gesellschaftlich geprägten Geschlechter Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern
asymmetrien zu erweitern (vgl. Maurer 2014), (Produktion/Reproduktion) beinhaltet bis heute
ermöglichte die Enttabuisierung von häuslicher geschlechtsbezogene Bewertungen von Tätigkei-
Gewalt und dadurch ihre öffentliche Thematisie- ten (vgl. CareMachtMehr 2020), die Hierarchisie-
rung, indem sie die Kategorie Gender als Struk- rungen unterliegen und mit jeweils spezifischen
turkategorie verstand (vgl. Ehlert 2012). Benachteiligungen einhergehen können. Die
dadurch entstehende Rangordnung und öko-
Gender bestimmt dabei das Verhältnis der nomische Abhängigkeit von Frauen – insbeson-
Geschlechter zueinander wie auch die Bezie- dere von Müttern mit Familienverpflichtungen
hung innerhalb der jeweiligen Genus-Gruppe. – vermag spezifische Gewaltrisiken in partner-
Dadurch geraten die gesellschaftliche sowie sozi- schaftlichen Beziehungen zu begünstigen (vgl.
ale Hierarchisierung von Frauen und Männern1 Henschel 2019).
nicht nur über Positionierungen innerhalb des
Arbeitsmarktes, sondern auch über die Posi- Der Gewalt gegen Frauen Einhalt zu bieten,
tion innerhalb von Partnerschaft und Familie wurde im Rahmen der zweiten Welle der Frau-
(vgl. Stiegler 2006; Henschel 2015) in den Blick. enbewegung zum politischen Thema, das damit
Sowohl Öffentlichkeit und Privatheit als auch auch Einzug in die Öffentlichkeit hielt („das Pri-
Herrschafts- und Arbeitsverhältnisse gestalten vate ist politisch“). Um das damit verbundene
sich dadurch für Frauen und Männer auch hin- Tabu im Sinne politischer und sozialarbeiteri-
sichtlich der Zugänge zu gesellschaftlichen Res- scher Strategien (feministisch orientierte Sozi-
sourcen in unterschiedlicher Form. Damit stellt alarbeit) aufzubrechen, wird seitdem in der
Geschlecht bis heute ein Organisations- und Ord- konkreten Frauenhausarbeit2 sowie in Fach-
nungsprinzip mit spezifischen gesellschaftlichen beratungs- und Interventionsstellen bis heute
Regeln dar. häusliche Gewalt auch als strukturelles Element
1 Der vorliegende Text verbleibt in der binären Ordnung, wohl wissend, dass in Deutschland auch mittlerweile
gesetzlich „divers“ als drittes Geschlecht Anerkennung erhält. Die hier beschriebenen dualen, polaren und hie-
rarchischen Geschlechterverhältnisse spiegeln jedoch nach wie vor real geprägte Verhältnisse zwischen Männern
und Frauen wider und zeigen das durch wissenschaftliche Studien belegte Ausmaß und die Erscheinungsformen
der Gewalt in diesen heterosexuellen Beziehungen auf. Um den Konstruktionscharakter von Geschlecht aufzu-
zeigen wird im Text jedoch darüber hinaus der Genderstern eingesetzt.
2 Das erste Frauenhaus in der Bundesrepublik Deutschland wurde im November des Jahres 1976 in Berlin als
Modellprojekt eröffnet. Es kann somit auf eine mehr als vierzigjährige Geschichte der Frauenhausbewegung, der
Frauenhausarbeit und ihrer Professionalisierung zurückgeblickt werden (vgl. Henschel 2017).
5ZUR SITUATION VON JUGENDLICHEN UND JUNGEN FRAUEN IN FRAUENHÄUSERN UND/ODER IN DER BERATUNG
6
asymmetrischer Geschlechterverhältnisse und dass Kinder in ihrem Haushalt lebten und dass
als Menschenrechtsverletzung analysiert. Carol ihre Kinder die Gewaltsituation gehört (57 %)
Hagemann-White definiert diese Gewalt bereits oder gesehen (50 %) hätten (vgl. BMFSFJ 2004,
1992 folgendermaßen: S. 277). Die Kinder seien dabei selbst in die
Auseinandersetzungen mit hineingeraten oder
„Gewalt im Geschlechterverhältnis [als] jede Ver- hätten versucht, die Befragten zu verteidigen
letzung der körperlichen oder seelischen Integri- (21-25 %); jedes zehnte Kind wurde dabei selbst
tät einer Person, welche mit der Geschlechtlich- körperlich angegriffen (vgl. BMFSFJ 2011, S. 7).
keit des Opfers und des Täters zusammenhängt So berichteten Frauen in dieser Studie darüber
und unter Ausnutzung eines Machtverhältnisses hinaus auch, dass sie bereits als Kind häusliche
durch die strukturell stärkere Person zugefügt Gewalt erleben mussten und in Folge als Erwach-
wird“ sene auch häufiger von Partnergewalt betroffen
waren (vgl. BMBFSFJ 2011, S. 7).
(Hagemann-White 1992, S. 23).
Die Situation der von Gewalt betroffenen Frauen
und deren Kinder gestaltete sich mitunter auch
Zahlen und Fakten nach der Trennung vom gewalttätigen Partner
für die Frauen, die Opfer von häuslicher Gewalt
Trotz veränderter gesellschaftlich geprägter waren und deren Kinder Kontakt zum Vater hat-
Geschlechterverhältnisse und einer Zunahme von ten, während der Besuche oder bei der Übergabe
Schutz- und Unterstützungseinrichtungen wie erneut als bedrohlich aufgrund von Misshand-
Frauenhäusern, Frauenberatungs- oder Inter- lungen. 58 % der Kinder erlitten Gewalt während
ventionsstellen sowie rechtlicher Verbesserungs- der Umgangszeit mit dem nicht sorgeberechtig-
möglichkeiten zum Schutz und zur Unterstützung ten Elternteil und empirische Untersuchungen
von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kin- zeigen, dass gerade in der Trennungsphase das
dern kann nicht übersehen werden, dass gewalt- Gewalt- und Tötungsrisiko für Frauen und Kinder
förmige Geschlechterverhältnisse und konkrete um ein Fünffaches höher liegt (vgl. ebd.). Das
Partner*innengewalt bislang nicht beseitigt Miterleben von häuslicher Gewalt stellt darüber
werden konnten. So wurden beim Bundeskri- hinaus für die in Familien lebenden Kinder und
minalamt3 im Jahr 2018 140.755 Fälle von Gewalt Jugendlichen einen starken Risikofaktor für spä-
in Beziehungen registriert (gegenüber 2017 mit teres Gewalterleben in der eigenen Partnerschaft
138.893 ein Anstieg von 1,3 %). Davon waren dar (vgl. Kreyssig 2013, S. 15-26).
81,3 % der Opfer Frauen. Das bedeutet, dass vier
von fünf Opfern Frauen sind, dass pro Tag durch-
schnittlich 312 Frauen Opfer von Gewalt in ihrer Kindliches Miterleben von Gewalt
Partnerschaft wurden und dass insgesamt 122 und die Folgen
Frauen getötet wurden (vgl. BKA 2019, S. 4-12).
Über acht Frauen pro Tag wurden vergewaltigt „Kinder sind deshalb nicht nur Zeugen häus-
oder sexuell genötigt. Außerdem erfuhren ins- licher Gewalt, sondern immer auch Opfer. Das
gesamt 28.657 Frauen Bedrohung, Stalking und Miterleben von häuslicher Gewalt stellt i. d. R.
Nötigung (pro Tag 78 Frauen). 2017 erschienen deshalb auch eine Gefahr für das Wohl und die
in der Statistik neue zu berücksichtigende Tatbe- Entwicklung der Kinder dar“
stände, wie Freiheitsberaubung (1.612 Frauen),
Zuhälterei (34) und Zwangsprostitution (49), in (BMFSFJ 2011, S. 7).
denen 2018 insgesamt 1.695 weibliche Opfer
erfasst wurden (vgl. BKA 2019, S. 24). Diese Gewalterfahrungen, die je nach Häufig-
keit, Ausmaß und Schwere der Gewalt kindli-
Bereits die erste und bisher einzige Prävalenz- che Entwicklung individuell unterschiedlich,
studie der Bundesrepublik zur „Lebenssitua- geschlechtsspezifisch und in vielfältiger Form
tion, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in zu beeinträchtigen vermögen, können bis ins
Deutschland“ zeigte, dass über die Hälfte der Erwachsenenleben hinein nachhaltig wirkmäch-
von Partnergewalt betroffenen Frauen angaben, tig sein, wie die repräsentative Prävalenzstudie
3 Das Bundeskriminalamt wertet für die Statistiken die Hellfelddaten aus. Sie repräsentieren damit das Anzeige-
verhalten; die Zahlen des Dunkelfeldes dürften weitaus höher liegen.
6Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen
bestätigte. Für die Mädchen und Jungen, die in einher. Sie können zu körperlichen und kogniti-
diesen familiären Zusammenhängen aufwach- ven Entwicklungsverzögerungen, zu mangelnder
sen, stellt sich die Situation daher aufgrund Konzentrationsfähigkeit, Lernbereitschaft, Schul-
der mehr oder minder direkten oder indirekten absentismus, Schulversagen bis hin zu Süchten,
Gewalterfahrungen4 als bedrohlich, beängsti- Essstörungen, Hyperaktivität, Kopfschmerzen,
gend und die persönliche Entwicklung beein- Magen- und Darmbeschwerden sowie zu Bett-
trächtigend dar. So wird der Ort der Familie, an nässen und schweren Traumata führen und somit
dem sich die Kinder und Jugendlichen eigentlich die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen
geborgen und geschützt fühlen sollten, durch massiv beeinträchtigen. Auch wenn unter dem
eine Atmosphäre von Wut, Hass bzw. Angst und Aspekt des Kindeswohls und des Kinderschutzes
Verzweiflung belastet. Mädchen und Jungen füh- frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden soll-
len sich in diesen Familien oft hilflos, traurig, ten, um die intergenerationelle Weitergabe von
ohnmächtig oder aber sogar schuldig, da sie der Gewalt zu durchbrechen und dazu beizutragen,
Gewalt nicht Einhalt gebieten können oder sich dass der Gewalt Einhalt geboten wird, sodass
gar selbst als Auslöser für die Gewalt verstehen. Sozialisationserfahrungen und -prozesse für die
Hilfestellung ist zudem in dieser Situation von von häuslicher Gewalt betroffenen Mädchen und
den Eltern nur schwer zu erlangen, da sich nicht Jungen verbessert werden, kann eine ausschließ-
an den Vater und die Mutter gewendet werden liche Fokussierung auf das Gefährdungspotenzial
kann, weil diese zum Auslöser der Gefühle von häuslicher Gewalt und die damit verbundenen
Angst, Ohnmacht und Bedrohung durch ihr Entwicklungsrisiken von Mädchen und Jungen
gewalttätiges Verhalten werden. Mädchen und auch die Wahrnehmung vorhandener Ressourcen
Jungen erleben sich daher häufig ihren verwir- erschweren (vgl. Henschel 2019).
renden Gefühlen hilflos ausgesetzt und mit die-
sen allein gelassen, und sie sind der Abwertung Für die mit der Thematik befassten Professio-
der eigenen Mutter durch den Vater oder Partner nellen in den Frauenhäusern, Fachberatungs-
der Mutter und den mittelbar bzw. unmittelbar und Interventionsstellen sollte dies dennoch
erlebten körperlichen, seelischen oder sexuellen bedeuten, sich auf vielfache und unterschiedli-
Misshandlungen schutzlos ausgeliefert. che Ressourcen zu besinnen bzw. diese einzu-
fordern, die eine verbesserte Unterstützung der
Entwicklungsverläufe von Kindern und Jugend-
Folgen der häuslichen Gewalterfahrungen lichen ermöglichen. Durch die Minimierung von
für die Kinder und Jugendlichen Risikofaktoren (Gewaltbeendung durch Schut-
zangebote) und die Stärkung innerer Schutz-
Folgen dieser Gewalterfahrungen können sich faktoren durch positive äußere Schutzfaktoren
bei den Mädchen und Jungen zwar individu- (z. B. vertrauensvolle Beziehungen, eine anre-
ell und geschlechtsspezifisch je nach Schwere, gende Lernumgebung, etc.) können positive Ent-
Häufigkeit und Intensität des Gewaltgesche- wicklungsverläufe ermöglicht werden, die die zu
hens äußern, sie gehen jedoch nicht selten erbringenden psychischen Anpassungsleistungen
mit Verhaltensauffälligkeiten, starker Unruhe, der Mädchen und Jungen im Sinne von Resilienz 5
Aggressivität, Unaufmerksamkeit, Abwesenheit,
überhöhter Ängstlichkeit und sozialem Rückzug
4 Die Zeugenschaft von Partnerschaftsgewalt stellt nur ein Risikofaktor in der Entwicklung der Kinder und Jugend-
lichen dar. Darüber hinaus können Kindesmisshandlung, Kindesvernachlässigung im Zusammenhang mit häus-
licher Gewalt, aber auch zusätzliche weitere Belastungsfaktoren, durch die die Familien gekennzeichnet sein
können, wie z. B. die Suchtmittelabhängigkeit oder die psychische Erkrankung eines Elternteils sowie Armut,
Migrations- oder Fluchterfahrungen, etc. die Situation für diese Kinder zusätzlich verschärfen.
5 Unter Resilienz wird die psychische Widerstandsfähigkeit, also die Fähigkeit einer Person verstanden, mit belas-
tenden Lebensumständen und negativem Stresserleben erfolgreich umzugehen. Sie „…wird heute als ein mul-
tidimensionales, kontextabhängiges und prozessorientiertes Phänomen betrachtet, das auf einer Vielzahl intera-
gierender Faktoren beruht und somit nur im Sinne eines multikausalen Entwicklungsmodells zu begreifen ist“
(Wustmann 2007, S. 131). Resiliente Kinder und Jugendliche sind in der Lage, trotz erfahrener Entwicklungs-
risiken (z. B. häusliche Gewalt) besondere Bewältigungsmöglichkeiten auszubilden, die ihnen eine „gesunde“
Persönlichkeitsausbildung ermöglicht. Durch äußere Schutzfaktoren (z. B. positive Rollenvorbilder, eine stimulie-
rende Lernumgebung, feste Bezugspersonen und Möglichkeiten zu Weiterentwicklung und Bildung) können die
inneren Schutzfaktoren/Persönlichkeitsmerkmale (z. B. Optimismus, Selbstregulation/ Selbstwirksamkeit, Selbst-
verantwortung, Beziehungsfähigkeit) gestärkt und damit auch neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten
entwickelt werden.
7ZUR SITUATION VON JUGENDLICHEN UND JUNGEN FRAUEN IN FRAUENHÄUSERN UND/ODER IN DER BERATUNG
8
und produktiver Realitätsverarbeitung (vgl. Hur- Daher ist es zu begrüßen, dass durch die vor-
relmann/Bauer 2015) unterstützen können und liegende Dokumentation ein erster Anstoß zu
psychische Widerstandskraft ermöglichen. geben versucht wird, um für die Situation dieser
Zielgruppe zu sensibilisieren. Eine Fokussierung
Ein erster Schritt hierfür ist, die spezifischen auf die Situation von Jugendlichen und jungen
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im Frauen in Frauenhäusern und/oder in der Bera-
Kontext von häuslicher Gewalt wahrzunehmen, tung erfolgte in einem zweitägigen Workshop,
wie dies zunehmend innerhalb der Arbeit der der am 2. und 3. November 2020 digital statt-
Fachberatungsstellen und Frauenhäuser auch fand und dessen Ergebnisse in der vorliegenden
ab den neunziger Jahren erfolgt (vgl. Henschel Dokumentation dargestellt werden. Um für die
1993; Strasser 2001; Kavemann/Kreyssig 2006). spezifischen Bedürfnisse der weiblichen und
Es gilt also nachzuvollziehen, anzuerkennen und männlichen Jugendlichen und jungen Frauen zu
pädagogische Maßnahmen zu ergreifen, die das sensibilisieren, ist es hilfreich, sich noch einmal
Kindeswohl unterstützen und den Mädchen und zu verdeutlichen, was die Lebensphase Jugend
Jungen die Ausbildung von Selbstwert, Selbstbe- bedeutet und durch welche Bedürfnisse, Interes-
wusstsein und Selbstwirksamkeit ermöglichen; sen, Entwicklungsaufgaben, Herausforderungen
durch Schutz-, Beratungs-, Förder- und Betreu- und Chancen sie gekennzeichnet ist.
ungsangebote, durch vertrauensvolle soziale
Interaktionen und wertschätzende Beziehun-
gen können so Bindungserfahrungen ermöglicht Lebensphase Jugend – Entwicklungsaufgaben,
werden, die die Handlungsfähigkeit und Per- Herausforderungen und Chancen
sönlichkeitsbildung der Kinder und Jugendlichen
unterstützen, um die gewaltförmigen Erfahrun- Die Lebensphase Jugend ist einerseits durch
gen be- und verarbeiten zu können. gesetzliche Vorgaben und Bestimmungen, z. B.
aus dem KJHG (SGB VIII) und dem Jugendstraf-
recht, definiert und sie wird andererseits in einer
Männliche und weibliche Jugendliche und zunehmend individualisierten und pluralisierten
junge Frauen im Kontext häuslicher Gewalt Gesellschaft zur sozialen Konstruktion, an der die
gesellschaftlich geprägten Generationen- und
Im Zuge der Professionalisierung in der Frauen Geschlechterverhältnisse aktiv beteiligt sind (vgl.
hausarbeit wurde bald erkannt, dass die von King 2002). Jugend meint somit also mehr als die
häuslicher Gewalt betroffenen Frauen in der durch die Pubertät eingeläutete Geschlechtsreife
Regel nicht allein im Frauenhaus Schutz, Bera- mit ihren hormonellen, körperlichen, kognitiven
tung und Unterstützung suchen, sondern als und psychischen Veränderungen. Sie ist geprägt
Mütter auch ihre Kinder mitbringen. In der von spezifischen Entwicklungsaufgaben, bei
konkreten praktischen Frauenhausarbeit muss- denen Mädchen und Jungen der besonderen
ten daher bald pädagogische Antworten gefun- Unterstützung durch die verschiedenen Soziali-
den werden und eine gezielte Übernahme von sationsinstanzen (Familie, Jugendhilfe, Schule,
Verantwortung für die im Frauenhaus lebenden Medien, etc.) und der Beziehungsangebote
Mädchen und Jungen erfolgen. Da zumeist vorü- durch andere Jugendliche (Peers), aber auch der
bergehend mehr Kinder als Frauen wie auch mehr Erwachsenen bedürfen.
Kinder als Jugendliche in den Frauenhäusern
leben6, zudem in vielen Frauenhäusern Jungen Zu den Entwicklungsaufgaben, die auch als Her-
ab dem Alter von 14 Jahren aus konzeptionellen, ausforderungen in dieser spezifischen Lebens
räumlichen und mangelnden finanziellen Res- phase verstanden werden können, da sie auf
sourcen keine Aufnahme finden, kann bis heute eine fragile, störanfällige Phase der Persönlich
festgestellt werden, dass sich die Situation der keitsbildung treffen, gehören neben der Akzep-
männlichen und weiblichen Jugendlichen wie tanz der körperlichen Veränderungen auch die
auch die der jungen Frauen (z. B. im Alter von (Weiter)Entwicklung der Geschlechtsidentität,
18-24 Jahren), die den Schutzort Frauenhaus mit Rollenübernahmen sowie die Ausbildung von
und ohne Kinder aufsuchen, prekär gestaltet. Rollendistanz und Ambiguitätstoleranz. Der
6 Die Frauenhauskoordinierungsstelle weist in ihrer Statistik des Jahres 2019 auf folgende Daten von 180 Frauen-
häusern und Frauenschutzwohnungen aus dem Jahr 2018 hin: 7.172 Bewohner*innen und 7.945 Kinder (vgl.
https://www.frauenhauskoordinierung.de/arbeitsfelder/fhk-bewohner-innenstatistik/ [Zugriff: 23.11.2020]).
8Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen
Ambiguitätstoleranz (Ambiguität = Mehrdeu- und Autonomie gekennzeichnet, wobei zugleich
tigkeit) kommt dabei besondere Bedeutung zu, auch gesellschaftliche Integration in dieser Phase
da sie den Menschen dazu befähigt, sich aktiv der Sozialisation in aktiver Aneignung und Ausei-
mit widersprüchlichen gesellschaftlichen und nandersetzung mit der materiellen und sozialen
sozialen Erwartungshaltungen und mehrdeu- Umwelt vollzogen werden muss. Hierzu bedarf
tigen Interaktionssituationen konstruktiv aus- es psychosozialer Möglichkeitsräume (vgl. King
einanderzusetzen und dabei zu erkennen und 2002):
zu akzeptieren, dass sich eigene Bedürfnisse
und Interessen nicht mit den Erwartungen der „… die Freiheit zur Ablösung und Aufnahme von
anderen decken müssen. Oder wie Krappmann neuen Beziehungen zulassen, die (Geschlechts)
es formuliert: Rollenübernahmen sowie die kritische Abgren-
zung zu traditionellen Geschlechtsstereotypen
„Das Individuum ist gezwungen, sich ständig ermöglichen, die die eigene Zukunftsplanung
damit auseinanderzusetzen, daß Erwartungen unterstützen, das Austesten von Grenzen und das
und Bedürfnisse sich nicht decken und daß zwi- Überschreiten von Traditionen zugestehen sowie
schen persönlichen Erfahrungen und den für sie die Ausbildung von Autonomie, (Geschlechts)
zur Verfügung stehenden allgemeinen Katego- Identität und Selbstbewusstsein unterstützen“
rien eine Lücke klafft. Die Errichtung einer indi-
viduierten Ich-Identität lebt von Konflikten und (Henschel 2006, S. 216f).
Ambiguitäten. Werden Handlungsalternativen,
Inkonsistenzen und Inkompatibilitäten ver- Diese vielfältigen Entwicklungsaufgaben, die
drängt oder geleugnet, fehlt dem Individuum die zugleich Herausforderungen für die Jugendlichen
Möglichkeit, seine besondere Stellung angesichts darstellen können, erfordern von den Jugend-
spezifischer Konflikte darzustellen“ lichen eine Neuorganisation ihrer personalen
und sozialen Ressourcen, die zudem durch bio-
(Krappmann 1978, S. 167). logisch-körperliche und psychologische Verän-
derungen begleitet werden. Für männliche und
Die Ausbildung schulischer Leistungsfähigkeit weibliche Jugendliche bedeutet dies, psychische
und die Gestaltung von Beziehungen zu Gleich- Anpassungsleistungen zu erbringen, die eigen-
altrigen (Peers) prägen diese Sozialisationsphase ständig und aktiv im Sinne der produktiven Rea-
ebenfalls. Zugleich ermöglichen die Kontakte und litätsverarbeitung (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015,
Beziehungen zu den Peers auch die Ablösung vom S. 106ff) bewältigt werden müssen.
Elternhaus, die Zunahme von Selbstbestimmung
und Autonomie sowie den Aufbau von intimen Die Lebensphase Jugend wird zudem durch
Paarbeziehungen. Medien- und Konsumkompe- unterschiedliche soziale Bedingungen und
tenzen, die in einer zunehmend digitalisierten Machtverhältnisse, z. B. zwischen den Gene-
und durch Ökonomie bestimmten Welt ausgebil- rationen und Geschlechtern beeinflusst, die
det werden müssen, um auch gesellschaftliche je nach Lebenslage Entwicklungschancen oder
und soziale Erwartungen einerseits erfüllen zu Entwicklungsrisiken bergen können (vgl. Hen-
können bzw. sich andererseits auch ggf. von die- schel 2006, S. 217). Gewalterfahrungen wie
sen kritisch abzugrenzen, gehören zu den Ent- Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung, die
wicklungsaufgaben ebenso wie die Ausbildung Zeugenschaft von Partnerschaftsgewalt, mate-
eines Werte- und Normensystems, die Fähig- rielle Armut und weitere multiple Problemla-
keit zur politischen Partizipation, die Fähigkeit gen können zu Risikofaktoren in dieser fragilen
zur aktiven Beteiligung an der Gesellschaft, der Entwicklungsphase werden, die die Persönlich-
Aufbau ethischer, politischer Orientierungen und keitsbildung von männlichen und weiblichen
eigene Handlungsfähigkeit und Selbststeuerung. Jugendlichen zu beeinträchtigen vermögen.
Die Aufnahme von einem Studium oder einer Mangelnde Unterstützung durch Erwachsene und
Berufsausbildung stellen weitere Aufgaben in Peers bzw. unzureichende oder fehlende psycho-
der Persönlichkeitsentwicklung dar, die bewältigt soziale Möglichkeitsräume, können die produk-
und aktiv gestaltet werden müssen, um spä- tive Realitätsverarbeitung sowie geschlechtlich
ter einmal auch finanzielle Unabhängigkeit zu geprägte Ich-Identitätsbildung von Jugendlichen
erlangen (vgl. Hurrelmann/Bauer 2015, S. 107ff). beeinträchtigen (vgl. ebd., S. 217ff).
Die Sozialisationsphase Jugend ist durch kogni- Deutlich wird, wie entscheidend es ist, den
tive, emotionale und soziale Entwicklungspro- weiblichen und männlichen Jugendlichen in
zesse hinsichtlich der Zunahme von Individuation dieser Sozialisations- und Persönlichkeitsent-
9ZUR SITUATION VON JUGENDLICHEN UND JUNGEN FRAUEN IN FRAUENHÄUSERN UND/ODER IN DER BERATUNG
10
wicklungsphase insbesondere dann psychoso- So neigen besonders weibliche Jugendliche und
ziale Möglichkeitsräume zu eröffnen und Unter- auch junge Frauen mitunter dazu, die Bewäl-
stützungsangebote zu unterbreiten, wenn sie in tigung der Entwicklungsaufgaben und die Ver-
ihren Familien mit häuslicher Gewalt konfron- arbeitung der Gewalterfahrungen zu internali-
tiert sind, um sie im Sinne von Resilienz durch sieren. Sie versuchen, ihre Probleme selbst zu
äußere Schutzfaktoren bei der Bewältigung der lösen, gehen diesen mitunter auch aus dem Weg,
Gewalterfahrungen und in ihrer Persönlichkeits- oder aber sie versuchen durch autoaggressives
bildung zu unterstützen (vgl. Henschel 2019, Verhalten (z. B. Essstörungen, Süchte, etc.) ihre
S. 47ff). Frauenhäuser und Fachberatungsstellen Ängste und Ohnmachtsgefühle, ihre psychischen
im Gewaltkontext könnten hier als vorüberge- Verletzungen zu bewältigen. Männliche Jugend-
hende Sozialisationsinstanzen, wenn sie für die liche neigen hingegen eher dazu, ihre psychi-
spezifischen Bedürfnisse der weiblichen und schen Verletzungen zu leugnen oder aber durch
männlichen Jugendlichen und jungen Frauen destruktiv-aggressives Gewalthandeln, entspre-
sensibilisiert sind, wichtige Unterstützungsarbeit chend der gesellschaftlich auch zugeschriebenen
leisten, sofern vorhandene räumliche, personelle Rollenvorstellungen zu kompensieren, zu über-
und finanzielle Ressourcen dies ermöglichen. spielen und zu externalisieren (vgl. Hurrelmann/
Daher scheint es hilfreich, sich mit den spezifi- Bauer 2015, S. 113; Henschel 2006, S. 217ff).
schen Erfahrungen, Bedürfnissen und Nöten von
weiblichen und männlichen Jugendlichen und Die kulturell und gesellschaftlich geprägten
jungen Frauen, die im Rahmen der Frauenhaus- Geschlechter- und Generationenordnungen
arbeit oder in Fachberatungsstellen identifiziert beeinflussen das Verhaltensrepertoire von
werden können, auseinanderzusetzen. männlichen und weiblichen Jugendlichen und
können einen unterschiedlichen Umgang mit
Aggressionen bzw. einen unterschiedlichen
Nöte und Bedürfnisse von weiblichen und Zugang zur Gewalt bedingen (vgl. Henschel 1993).
männlichen Jugendlichen und jungen Frauen So gilt offensiv destruktives, gewalttätiges Ver-
in Frauenhäusern und in der Beratung7 halten von Mädchen und Frauen auch heute noch
eher als Kontrollverlust und „unweiblich“, wird
Deutlich dürfte geworden sein, dass sich weibli- als deviantes Verhalten stärker skandalisiert,
che und männliche Jugendliche beim Eintritt in als dies für eben solches männliches Verhal-
ein Frauenhaus oder in eine Fachberatungsstelle ten gilt. Männliche Gewalttätigkeit wird häufig
in einer besonderen Lebensphase mit spezifi- mit Durchsetzungskraft gleichgesetzt, wird als
schen Entwicklungsaufgaben und Herausforde- Kontrollmöglichkeit und als mehr oder minder
rungen befinden, auf die die Professionellen legitimes Mittel der Machtausübung bewertet.
reagieren müssen, wenn sie die Jugendlichen, Männlichkeit und Gewalt gehen gemäß dieser
die unterschiedliche, individuelle, konstruktive Vorstellung eine enge Verbindung ein und kön-
Lösungs- oder aber auch Risikowege bei der nen insbesondere auf männliche Jugendliche, die
Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und den ihre Männlichkeit in der verunsichernden Zeit der
Gewalterfahrungen beschreiten werden, ange- Adoleszenz unter Beweis stellen müssen, Gewalt
messen unterstützen wollen. So kann es hilfreich legitimierend oder gar verstärkend wirken. Der
sein, sich bewusst zu machen, dass es neben „entwicklungsbedingte Widerspruch zwischen
der je individuellen Be- und Verarbeitung der Autonomiebedürfnis und seiner Realisierbar-
Entwicklungsaufgaben und der Gewalterfahrun- keit“ (Enzmann 2002, S. 35) kann dann auch zu
gen auch geschlechtsbezogene Muster und Ver- Frustrationen, zur Überforderung und in Folge
haltensweisen in der Jugendphase geben kann, zu kompensatorischem gewalttätigen Ausagie-
auf die differenziert und professionell reagiert ren bei männlichen Jugendlichen führen, deren
werden sollte. männliche Identität sich als besonders labil
erweist. Aber auch Marginalisierungserfahrun-
gen, gepaart mit tradierten Männlichkeitsnormen
von Dominanz und Herrschaft, wie sie z. B. mit-
7 Die vorliegenden Ausführungen greifen die von Prof. Dr. Angelika Henschel entwickelten 33 Thesen zu den
besonderen Bedürfnissen von männlichen und weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen in Frauenhäusern
und in der Beratung auf, welche online unter https://www.awo.org/jugendliche-und-junge-frauen-mit-haeus-
licher-gewalterfahrung [Zugriff: 04.01.2021] zur Verfügung stehen.
10Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen
unter von männlichen migrantischen Jugendli- was das Sprechen über die Gewaltvorkommnisse
chen erlebt werden, können gewaltt ätige Ver- und die damit verbundenen Gefühle erschwe-
haltensweisen begünstigen (vgl. H
enschel 2004, ren kann. Erschwert wird das Sprechen über die
S. 161-166). Gewalterfahrungen mitunter zusätzlich auch
dadurch, dass sich die Jugendlichen selbst schul-
Weibliche und männliche Jugendliche haben dig oder mitunter sogar als Auslöser der Gewalt
zudem häufig bereits langjährige Gewalt in der Familie begreifen, da es ihnen z. B. nicht
erfahrungen, bevor sie in ein Frauenhaus einzie- gelungen ist, der Gewalt Einhalt zu bieten, oder
hen oder aber eine Beratungsstelle (i. d. R. dann aber denken, dass ihr eigenes Fehlverhalten
mit ihren Müttern)8 aufsuchen. Da sie mitunter zum Auslöser der Gewalt gegenüber der Mutter
seit Kindertagen die Gewalt zwischen den Eltern geführt habe.
erleben mussten, die zudem durch unterschied-
liche Gewaltformen, eine unterschiedliche Häu- Wie bereits verdeutlich wurde, stellen für
figkeit, Intensität und Schwere gekennzeichnet Jugendliche auch der sich in der Pubertät ver-
sein kann, benötigen sie in der herausfordernden ändernde Körper sowie die eigene Sexualität eine
Sozialisationsphase Jugend mit ihren spezifischen herausfordernde Entwicklungsaufgabe dar, die
Entwicklungsaufgaben besondere Unterstützung es konstruktiv zu bewältigen gilt. Daher können
zur Bewältigung dieser Gewalterfahrungen (vgl. weibliche und männliche Jugendliche es auch als
Henschel 2019). Da das Risiko für Kinder und beeinträchtigend empfinden, wenn sie sich in
Jugendliche steigt, zusätzlich Kindesmisshand- ihrer verändernden Körperlichkeit und im Erwa-
lungen und Kindesvernachlässigung zu erfahren, chen der eigenen Sexualität der Enge des Frau-
je länger die Mütter in der Misshandlungsbe- enhauses ausgesetzt sehen und mit den Blicken
ziehung bleiben, können zusätzliche Gewalter- und Kommentaren der B ewohner*innen kon-
fahrungen das Kindeswohl, die körperliche und frontiert sind. Sie fühlen sich in ihrer Intimsphäre
psychische Unversehrtheit und die Möglichkeit beeinträchtigt und unwohl, was durch die i. d. R.
zur Bewältigung der Geschehnisse erschweren räumliche Enge im Frauenhaus noch gesteigert
und auch dazu beitragen, dass weibliche und werden kann. Verstärkt werden diese Emp-
männliche Jugendliche aufgrund der Gescheh- findungen zusätzlich dadurch, dass sich die
nisse gesundheitliche Einschränkungen zeigen Jugendlichen aufgrund der räumlichen Enge in
(z. B. häufiger Infekte aufweisen, etc.). vielen Frauenhäusern mit ihren Müttern und ggf.
Geschwistern ein Zimmer teilen müssen, was sie
Deutlich wird, dass weibliche und männliche in ihren Augen zugleich wieder zu Kindern statt
Jugendliche die Gewalt in der Familie und/oder angehenden Erwachsenen werden lässt.
Partnerschaft als starken und bedrohlichen
Stressor erleben können, auch wenn sie dies Zu den Entwicklungsaufgaben der männlichen
mitunter nicht zeigen möchten oder nicht dazu und weiblichen Jugendlichen gehört es auch, die
in der Lage sind, dies aufgrund von „jugendli- an sie gestellten geschlechtlich geprägten Rol-
cher Coolness“ zu äußern. Dennoch erleben die lenerwartungen erfüllen zu müssen, oder aber
Jugendlichen wie auch Kinder die beobachtete im Sinne von Rollendistanz diese sozialen und
Partnerschaftsgewalt, die Gewalt gegen die gesellschaftlichen Erwartungshaltungen abzu-
Mütter i. d. R. durchaus als bedrohlich. Sie sind wehren. Die Beeinflussung durch Mitbewoh-
verängstigt, fühlen sich hilflos und ohnmächtig, ner*innen und Mitarbeiter*innen in den Frau-
selbst wenn sie dies so nicht immer zum Aus- enhäusern, aber auch durch andere Jugendliche
druck bringen können und ihnen dies von ande- und weitere Sozialisationsinstanzen, wie z. B. die
ren Personen (z. B. Frauenhausbewohner*innen) Schule, sowie das Fehlen von männlichen Rollen-
auch mitunter aufgrund ihres Jugendalters nicht modellen in den Frauenhäusern und Beratungs-
(mehr) zugestanden wird. Darüber hinaus sind stellen, können diesen Prozess daher erschwe-
die Gewalterfahrungen für die Jugendlichen (wie ren. Auch fühlen sich männliche Jugendliche
für viele Mütter auch) mit hoher Scham besetzt, vereinzelt von der „Übermacht des Weiblichen“
8 Jugendliche suchen gemeinhin von sich aus in Gewaltsituationen aus unterschiedlichen Gründen keine Bera-
tungsstellen auf, was ein Hinweis dafür sein könnte, sich die Settings, die Ansprache und Konzepte, etc. der
Interventions- und Beratungsstellen noch einmal genauer dahingehend anzuschauen, inwieweit die Beratungs-
angebote tatsächlich niedrigschwellig und an den Bedürfnissen, wie sie hier für die Lebensphase Jugend geschil-
dert werden, orientiert sind und sie dahingehend zu überdenken und ggf. anzupassen (z. B. Gruppenangebote,
soziale Medien, Online-Sprechstunden, etc.).
11ZUR SITUATION VON JUGENDLICHEN UND JUNGEN FRAUEN IN FRAUENHÄUSERN UND/ODER IN DER BERATUNG
12
in den Frauenhäusern und in den Beratungsstel- sind und i. d. R. für die Persönlichkeitsbildung
len überfordert. Mitunter werden von den weib- stabilisierend wirken, sind häufig in den Frau-
lichen und männlichen Jugendlichen traditionelle enhäusern nicht möglich, was die Situation für
Geschlechterrollen übernommen, die z. B. durch die Jugendlichen zusätzlich erschwert. Auch Kon-
andere Bewohner*innen oder Mitarbeiter*innen takte über die sozialen Medien können mitunter
beeinflusst und verstärkt werden können. nicht nur aufgrund des Fehlens von Internetver-
bindungen in den Frauenhäusern versagt blei-
Männliche Jugendliche, sofern sie überhaupt ben, sondern müssen häufig zudem aus Sicher-
in einem Frauenhaus mit ihren Müttern und heitsgründen unterbleiben.
Geschwistern Unterkunft und Schutz finden
können, sind hier vor besondere Herausforde- Werden diese Nöte der weiblichen und männli-
rungen gestellt, hat sich doch der eigene Vater chen Jugendlichen ernst genommen, so weisen
oder aber der Partner der Mutter aufgrund seiner sie auf wichtige Bedarfe und Handlungsmaß-
Gewalttätigkeit als Identifikationsobjekt dis- nahmen für die Professionellen hin. Es müssen
qualifiziert, oder aber im Gegenteil als ein ver- Wege und Möglichkeiten gefunden werden, um
meintlich durchsetzungsstarkes und besonders den Jugendlichen die für ihre Persönlichkeits-
männliches Rollenmodell angeboten. Männliche bildung wichtigen sozialen Interaktionen und
Jugendliche suchen unterschiedliche Wege, um Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen, da
mit diesen Herausforderungen umzugehen. So sich in den Frauenhäusern zudem nur verein-
äußern sich die mit den Gewalterfahrungen und zelt andere Jugendliche befinden, die diesen
mit dem Frauenhaus verbundenen Herausforde- Kontaktmangel ausgleichen könnten. Bezüglich
rungen und Unsicherheiten für einzelne Jungen der Beratungsstellen ergeben sich hier ebenfalls
auch dahingehend, dass sie sich weitgehend aus Anknüpfungspunkte, ließe sich doch das Bedürf-
dem Frauenhausalltag zurückziehen, in ihrem nis der jungen Menschen nach Kontakten mit
Zimmer verbleiben oder außer Haus die Zeit mit Gleichaltrigen auch für PeerBeratungsangebote
anderen Jugendlichen verbringen, da diese aus nutzen, die daraufhin zu überdenken und zu
Sicherheits- und Anonymitätsgründen keinen konzipieren wären.
Zugang ins Frauenhaus haben (vgl. Henschel
2006, S. 219ff; Henschel 2019, S. 59ff). Aber Die Gewalterfahrungen, die die weiblichen und
auch ein weiteres Problem, das mit der Sexua- männlichen Jugendlichen durch entsprechende
litätsentwicklung der männlichen Jugendlichen pädagogische Maßnahmen in den Frauenhäusern
einhergeht, sollte nicht übersehen werden, denn oder in der Beratung durch ihnen angemessene
männliche Jugendliche erleben mitunter weib- Schutz-, Förder- und Unterstützungsangebote
liches „Begehren“ von Bewohnerinnen in den versuchen können zu bewältigen, sind mitunter
Frauenhäusern und müssen damit klarkommen, auch dadurch gekennzeichnet, dass sie sich selbst
wie sie auch mitunter selbst sexuelle und intime nicht in ihrer „Jugendlichkeit“ erleben können
Beziehungen mit anderen Frauenhausbewoh- und dürfen, da sie bereits in ihren gewaltbelas-
nerinnen eingehen, die für zahlreiche Konflikte teten Familien Elternrollen (Parentifizierung) für
innerhalb des Frauenhauses und in der alltägli- ihre Mütter, Väter und Geschwister übernehmen
chen Arbeit sorgen können. mussten. Diese Rollenumkehr zwischen Eltern
und Kindern findet sich auch in gewaltbelaste-
Dem Kontakt und den Beziehungen zu anderen ten Familien und sie trägt dazu bei, dass explizit
Jugendlichen kommt, so wurde deutlich, in der oder implizit die Verantwortungsübernahme an
Jugendphase besondere Bedeutung zu; sind es die Kinder oder Jugendlichen durch die Erwach-
doch die anderen Peers, die einen wichtigen senen delegiert wird (vgl. Henschel 2019, S. 101).
Beitrag zur Stabilisierung der Persönlichkeit und Sich von dieser Rollenumkehr zu verabschieden,
zur Abgrenzung zu Herkunftsfamilie, Eltern und fällt mitunter nicht nur schwer, weil die Erwar-
Geschwistern sowie eine Zunahme von Selbst- tungshaltungen, Forderungen, aber auch die
bestimmung und Autonomie ermöglichen. Daher Nöte der Mütter dies erschweren, sondern weil
leiden weibliche wie männliche Jugendliche vor hieran auch Lob und Anerkennungserfahrungen
allem darunter, dass sie über ihren vorüberge- geknüpft sind, die das Selbstbewusstsein der
henden Aufenthaltsort aus Sicherheitsgründen, Jugendlichen zu stärken vermögen.
auch aus Scham, nicht sprechen können oder dies
nicht wollen und zudem ihre gewohnte Umge- Vor allem Jugendliche mit Migrationsgeschichte,
bung, mitunter auch die Schule verlassen oder die häufig der deutschen Sprache eher mäch-
aber ihre Ausbildung abbrechen müssen. Treffen tig sind als ihre Mütter, werden dann z. B. in
mit den Freund*innen, die in dieser Lebensphase Frauenhäusern oder Beratungsstellen nicht sel-
und vor allem in dieser schweren Zeit so wichtig ten für Übersetzungstätigkeiten eingesetzt, bei
12Wissenschaftliche Erkenntnisse und Thesen
Behörden mit in die Verantwortung genommen, Jugendlichen ihre Beziehung zur Mutter überden-
hinsichtlich ihrer besseren Medienkompeten- ken können und ggf. neugestalten lernen. Häufig
zen gefordert und werden dadurch weiterhin in erleben die Jugendlichen ihre Mutter im Verlauf
ihrer dominanten Rolle bestärkt. Es gilt daher des Frauenhausaufenthaltes auch neu und ver-
auch, die weiblichen und männlichen Jugend- ändert, sie erkennen, dass sie sich aus der Opfer-
lichen mit Migrations- oder Fluchterfahrungen, rolle zu lösen beginnt, sofern sie sich weiterhin
die aufgrund sozialer, kultureller, sprachlicher vom Gewalttäter trennt. Dass sie zunehmend
und rechtlicher Probleme darüberhinausge- an Selbstbewusstsein und Handlungsfähigkeit
hende Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe gewinnt, indem sie sich aktiv im Frauenhau-
haben, die eventuell nicht nur durch einen salltag und in der dortigen Gemeinschaft ein-
Frauenhausaufenthalt befriedigt werden kön- bringt, behördliche Herausforderungen meistert,
nen, sondern erweiterter Kooperationen mit den Lebensunterhalt für sich und die Kinder (z. B.
anderen Institutionen bedürfen, besonders in auch über Transferleistungen) bestreitet, Sorge-,
den Blick zu nehmen (z. B. Migrationssozialar- Umgangs- und unterhaltsrechtliche Ansprüche
beit, Soziale Arbeit mit Geflüchteten, Terre des durchzusetzen erreicht und wieder stärker die
Femmes, etc.)9. Hierzu gehört auch, anzuerken- eigenen sowie die Bedürfnisse der eigenen Kin-
nen, dass es vor allem jungen Frauen, die aus der der und Jugendlichen wahrnehmen kann. All dies
Gewalt in der Familie in ein Frauenhaus fliehen kann dazu führen, dass sich ein neues Verhältnis
müssen, schwerfallen kann, sich aufgrund von und eine veränderte Beziehung zur Mutter und
Loyalitätskonflikten, traditionellen Vorstellungen den Geschwistern zu entwickeln vermag (vgl.
und kulturell-religiös bedingten Anschauungen Henschel 2019, S. 181ff). Aber auch gegenläu-
zu trennen und die familiären Bande zu kappen. fige Tendenzen in der Beziehung lassen sich
beobachten, wenn sich die Mutter entscheidet,
Loyalitätskonflikte gegenüber Familienangehö- zum Partner zurückzukehren oder sich erneut
rigen, auch gegenüber dem gewalttätigen Vater in eine gewalttätige Beziehung begibt. Weibli-
oder Partner der Mutter, lassen sich jedoch auch che wie männliche Jugendliche benötigen dann
bei den in Frauenhäusern vorübergehend leben- zusätzliche Unterstützungsangebote (z. B. Auf-
den deutschen Kindern und Jugendlichen identi- nahme in einer stationären Einrichtung), wenn
fizieren. So sehnen sich weibliche und männliche sie die Entscheidung der Mutter nicht akzeptieren
Jugendliche mitunter nach dem Vater oder Part- können und sich dann vorzeitig von der Familie
ner und wünschen sich weiterhin eine Bezie- trennen möchten (vgl. Henschel 2019, S. 181ff).
hung zu ihm, was sie wiederum in emotionale Kooperationen mit der Jugend- und Schulsozial-
Ambivalenz und Loyalitätskonflikte gegenüber arbeit, wie auch mit den Jugendämtern können
der Mutter bringen kann (vgl. Henschel 2019, hier helfen, die Angebote an den Bedürfnissen
S. 185ff). Häufig lässt sich diese Ambivalenz dann der Jugendlichen zu orientieren und sie auf ihrem
jedoch mit der emotional betroffenen eigenen weiteren Lebensweg konstruktiv zu begleiten.
Mutter nicht besprechen und klären, weshalb
es hilfreich und wichtig sein kann, dass andere Die Situation für junge Frauen mit Gewalterfah-
Gesprächspartner*innen diese Klärungs- und rungen (mit und ohne Kinder) gestaltet sich für
Beratungsangebote sowie Unterstützungsaufga- diese in besonderer Weise, da sie häufig auch
ben im Frauenhaus oder in einer Beratungsstelle aus anderen Angeboten der Jugendhilfe her-
übernehmen. ausfallen und ihre spezifischen Bedürfnisse in
der Sozialen Arbeit und in der Frauenhausarbeit
Ein Frauenhausaufenthalt oder aber eine unter- bisher unzureichend wahrgenommen werden
stützende Beratungsmöglichkeit außerhalb des und entsprechende Unterstützungsangebote sich
Frauenhauses könnten darüber hinaus auch dazu bisher als unzureichend herausgestellt haben,
beitragen, dass die weiblichen und männlichen bzw. sich als ausbaufähig erweisen. So erleben
9 Die Aufmerksamkeit sollte sich jedoch nicht nur auf jugendliche Migrant*innen oder Jugendliche mit Flucht
erfahrungen und auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Bedarfe fokussieren, sondern sich im Sinne von Inklu-
sion auch mit den Lebenslagen und Bedürfnissen von Jugendlichen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen
auseinandersetzen. Vor allem für weibliche und männliche Jugendliche mit Beeinträchtigungen zeigt sich, dass
aufgrund von materiellen und räumlichen Barrieren häufig kein Zugang ins Frauenhaus für diese Jugendlichen
besteht. Aber auch in Bezug auf die Barrieren in den Köpfen muss hier wichtige Arbeit geleistet werden, denn
mitunter wird der Kontakt zu den Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen durch spezifische Einstellungen und
Haltungen erschwert.
13ZUR SITUATION VON JUGENDLICHEN UND JUNGEN FRAUEN IN FRAUENHÄUSERN UND/ODER IN DER BERATUNG
14
junge Frauen, obwohl sie i. d. R. ein Frauenhaus Ressourcen10 nicht in dem Ausmaß gewähr-
freiwillig aufgrund ihrer Gewalterfahrungen leistet werden kann, wie es die jungen Frauen
aufsuchen – mitunter werden sie jedoch auch eigentlich bedürfen. Kooperationen wären auch
von anderen Institutionen wie dem Jugendamt aus diesen Gründen zukünftig auszubauen (z. B.
oder durch Mädchenhäuser oder andere statio Kooperationen mit Mutter/Vater/Kind-Einrich-
näre Einrichtungen geschickt –, dieses Schutz tungen, § 19 SGB VIII)11.
angebot zugleich als Freiheitseinschränkung in
vielfacher Hinsicht. Wie bei den männlichen Schule und Ausbildung, die häufig aufgrund
Jugendlichen auch, erleben die jungen Frauen der Gewaltvorkommnisse und/oder aufgrund
eine Beschneidung ihrer Freiräume. Sie können der frühen Übernahme der Elternfunktion und
sich nicht jederzeit aus dem Haus entfernen Mutterrolle aufgegeben oder verändert werden
und z. B. Treffen mit Freund*innen nachgehen, müssen, bilden weitere Aspekte hinsichtlich der
diese nicht im Haus empfangen und dürfen den Lebenslagen von jungen Frauen mit Gewalterfah-
Frauenhausort nicht bekannt geben, auch wenn rungen, auf die mit den vorhandenen Ressourcen
sie dies aus Scham häufig gar nicht wünschen. in den Frauenhäusern nur begrenzt eingegangen
Auch ist ihnen der Austausch mit Kontakten werden kann, weshalb auch hier ein Ausbau von
und Freundschaften in den Sozialen Medien Kooperationen mit der Jugendhilfe sinnvoll sein
erschwert, weil sie entweder im Frauenhaus nur könnte (§13 SGB VIII)12.
über unzureichende Internetverbindung verfü-
gen oder aber aus Gefährdungsgründen so nicht Auch wenn Frauenhäuser zwar als notwendige
kommuniziert werden darf. und wichtige Schutzeinrichtung angesehen wer-
den können, sie zudem als vorübergehende Sozi-
Zudem fühlen sie sich mitunter durch die älte- alisationsinstanz für die weiblichen und männli-
ren Bewohner*innen bemitleidet, übermäßig chen Jugendlichen und die jungen Frauen einen
umsorgt und bemuttert, aber auch gegängelt, Resilienz fördernden, wichtigen Schutz- und
oder sie erfahren Erziehungsmaßnahmen, denen Möglichkeitsraum zur Persönlichkeitsentwicklung
sie sich selbst entwachsen fühlen, was den und zur Verarbeitung der Gewalterfahrungen
Zugang und die Beziehungen zu den Frauenhaus für diese Zielgruppe darstellen, dürfen auch die
bewohner*innen erschweren kann. Belastungen, die mit einem Frauenhausaufent-
halt einhergehen können, nicht verschwiegen
In Bezug auf eventuell vorhandene eigene Kinder werden. Neben der bereits beschriebenen räum-
sehen sie sich häufig sozialer Kontrolle durch lichen Enge und den häufig fehlenden perso-
andere Bewohner*innen oder Mitarbeiter*innen nellen und finanziellen Ressourcen, mit denen
im Frauenhaus ausgesetzt und auch hier mehr die Frauenhausarbeit belastet ist, weshalb die
oder minder aus ihrer Wahrnehmung heraus Jugendlichen mitunter aus dem Blick geraten,
dominiert und kontrolliert. Zugleich fühlen sie können weitere Faktoren den vorübergehenden
sich vereinzelt in Bezug auf ihre lebens- und Aufenthalt für die Jugendlichen erschweren. So
alltagspraktischen Kompetenzen zu wenig auf ein werden von ihnen durchaus auch die Erzählun-
Leben mit einem Kind vorbereitet und bräuch- gen der anderen Frauenhausbewohner*innen als
ten hier mehr Unterstützung, die im Rahmen der zusätzlich psychisch belastend erlebt.
Frauenhausarbeit häufig aufgrund der Arbeits-
zeiten der Mitarbeiterinnen und mangelnder
10 Auch ein Mangel an räumlichen Ressourcen kann hier als Problem angesehen werden, denn häufig ist eine
Appartementstruktur in den Frauenhäusern (noch) nicht gegeben, die dazu beitragen könnte, dass den Bedürf-
nissen der jungen Frauenhausbewohner*innen eher Rechnung getragen werden kann. Männliche Jugendliche
hätten dann auch eher die Möglichkeit, mit ihren Müttern aufgenommen zu werden und das Frauenhaus als
gemeinsamen Schutzort zu erfahren.
11 Nach § 19 SGB VIII haben Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben, Anspruch
auf Betreuung und Unterkunft, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form zur
Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
12 Auch wenn die Jugendsozialarbeit bisher nur unzureichend die Gewalt, denen junge Menschen in ihren Fami-
lien ausgesetzt sind, als solche benennt und als soziale Benachteiligung versteht, so ist es doch Aufgabe der
Jugendsozialarbeit nach § 13 SGB VIII, sich insbesondere der Jugendlichen anzunehmen, die durch soziale
Benachteiligungen betroffen und daher in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Für sie sollen
sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, „die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in
die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“ (§ 13, [1] SGB VIII).
14Sie können auch lesen