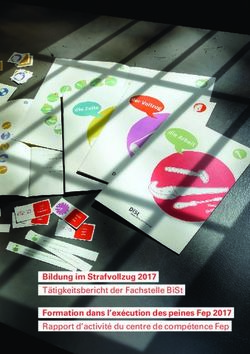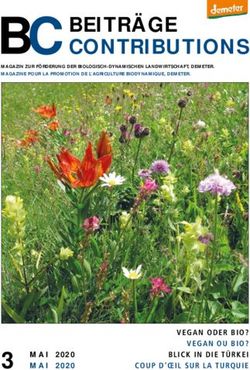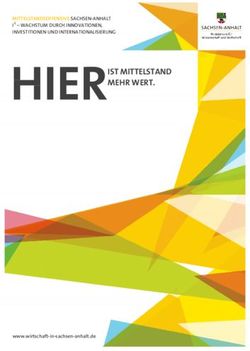AMTLICHES BULLETIN - BULLETIN OFFICIEL - Parlament CH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
04.062
Bundesgesetz
über die Krankenversicherung.
Teilrevision. Managed Care
Loi fédérale
sur l'assurance-maladie.
Révision partielle. Managed Care
Erstrat – Premier Conseil
CHRONOLOGIE
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 05.12.06 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 13.06.07 (FORTSETZUNG - SUITE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 04.12.07 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 04.03.08 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 04.06.08 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 17.09.08 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 18.09.08 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 01.10.08 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 01.10.08 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.10 (FORTSETZUNG - SUITE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.10 (FORTSETZUNG - SUITE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.10 (FORTSETZUNG - SUITE)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 16.06.10 (FORTSETZUNG - SUITE)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 15.12.10 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 03.03.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 30.05.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 12.09.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 14.09.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 22.09.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 29.09.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 29.09.11 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 30.09.11 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 30.09.11 (SCHLUSSABSTIMMUNG - VOTE FINAL)
Forster-Vannini Erika (RL, SG), für die Kommission: Bereits in seiner Botschaft vom 18. September 2000
zur 2. KVG-Revision hat der Bundesrat vorgeschlagen, das Angebot an besonderen Versicherungsformen zu
erhöhen, damit die Versicherten die Möglichkeit haben, sich in einer Behandlungskette umfassend versorgen
zu lassen.
Ziel der Managed-Care-Modelle ist es bekanntlich, durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten eine optimale
Behandlungsqualität zu erlangen und die dafür vorhandenen Ressourcen so effektiv wie möglich zu nutzen.
Die hohe Behandlungsqualität soll durch die verstärkte Zusammenarbeit der Leistungserbringer und spezielle
Vereinbarungen zur Qualitätssicherung erreicht werden. Es geht in diesem Bereich auch darum, unnötiges
oder doppeltes Erbringen von Leistungen zu vermeiden. Die Palette der Modelle geht von Ärztelisten über die
Hausarztlisten, die Callcenter bis zu wirklichen Netzwerken von "Health Maintenance Organisations" (HMO),
wo verschiedene Ärzte im Rahmen neuer Organisationsmodelle zusammenarbeiten. Durchschnittlich werden
in den HMO rund 5000 Versicherte – etwa 1100 pro volle Arztstelle – betreut. HMO-Standorte finden sich vor
allem in den grossen urbanen Zentren. Allerdings ist in Regionen mit hoher Managed-Care-Dichte ein Betrieb
auch in kleineren Städten möglich. So verzeichnet zum Beispiel eine HMO in Wil im Kanton St. Gallen acht
Vollzeitarztstellen und über 9000 Versicherte.
21.12.2018 1/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Mit der Vernetzung sollen idealerweise die vertragliche Einbindung von Spezialärzten im Netz und die selekti-
ve Zusammenarbeit mit Dienstleistungsanbietern gemäss Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien gefördert
werden. In der traditionellen Praxis, in der eine solche Zusammenarbeit nicht organisiert ist, kann die Ange-
botsseite auch dadurch beeinflusst werden, dass der Hausarzt eine sogenannte Türsteher- oder Gatekee-
per-Funktion ausübt, das heisst, dass eine Behandlung durch einen Facharzt entsprechend nur dann von der
Krankenkasse erstattet wird, wenn der Hausarzt den Patienten an diesen Facharzt überwiesen hat. Daneben
gibt es auch besondere Versicherungsformen, bei welchen sich die Versicherten verpflichten, ihre Wahl auf be-
stimmte, vom Versicherer bezeichnete Leistungserbringer zu beschränken, ohne dass dabei ein Gatekeeping
stattfindet und ohne dass die Leistungserbringer eine gemeinsame Budgetmitverantwortung übernehmen.
In Managed-Care-Modellen wird dem Aspekt der Qualitätssicherung oft eine viel grössere Bedeutung beige-
messen als in der herkömmlichen medizinischen Grundversorgung. Die wichtigsten Instrumente zur internen
Qualitätssicherung sind sogenannte Qualitätszirkel, extern ist es eine Qualitätszertifizierung. Nach der anfäng-
lichen Dynamik, die einerseits auf den Prämienschub des KVG und andererseits auf die vermehrten Angebote
zurückzuführen ist, stagnierte der Versichertenbestand bei den besonderen Versicherungsmodellen. In den
Jahren 1999 und 2000 wurden deutlich weniger Verträge der Hausarztmodelle abgeschlossen. Daneben bie-
ten mehrere Versicherer nur noch sogenannte Light-Modelle an, die lediglich wenige Managed-Care-Elemente
enthalten.
Anfang 2006 waren rund 600 000 Versicherte in Managed-Care-Formen versichert, davon rund 17 Prozent in
den 21 HMO, rund 83 Prozent in den 57 Hausarztnetzen. Schweizweit beträgt der Anteil der Managed-Care-
Versicherten etwa 8 Prozent, wobei aber die erheblichen regionalen Unterschiede zu beachten sind. Während
in gewissen Kantonen kaum Managed-Care-Angebote zur Verfügung stehen, haben Managed-Care-Modelle
dort, wo eben eine hohe Versicherungsdichte besteht, sehr viele Leute. Auffällig ist, dass Managed-Care-Mo-
delle dort tendenziell wachsen, wo sie schon relativ gut verankert sind. Interessant an der regionalen Verteilung
ist, dass die höchste Managed-Care-Dichte nicht unbedingt nur in den grossen urbanen Zentren zu finden ist
wie oft angenommen. Auch das Prämienniveau spielt in diesem Zusammenhang keine wesentliche Rolle,
sind doch Managed-Care-Modelle insbesondere in Regionen mit unterdurchschnittlichen Prämien stark ver-
ankert. Entscheidend für die Verbreitung der Versorgungsmodelle scheint vielmehr der Aufbau professioneller
Strukturen im technischen wie im institutionellen Bereich gewesen zu sein. Studien haben gezeigt, dass eine
medizinische Versorgung, die von der Diagnose bis zur letzten Therapie von einer einzigen Hand gesteuert
wird, aus qualitativen und wirtschaftlichen Gründen gefördert werden sollte. Gemäss Bericht der Verwaltung
vom 8. September dieses Jahres belegen Studien, dass die Managed-Care-Modelle grundsätzlich ein risiko-
bereinigtes Einsparpotenzial bergen. Dieses wird für HMO und Hausarztmodelle mit Budgetverantwortung in
der Grössenordnung von bis zu rund 30 Prozent beziffert, während bei den übrigen Hausarztmodellen die
Effizienzgewinne mit lediglich 5 bis maximal 20 Prozent eingestuft werden.
Damit die Krankenversicherer ihre Verträge so ausgestalten, dass neue Organisationsformen in diesem Be-
reich nicht nur behindert, sondern sogar gefördert werden, müssen die Rahmenbedingungen für solche Mo-
delle verbessert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bedingungen für die Versicherten, die Leistungs-
erbringer und die Versicherer gleichermassen attraktiv gestaltet werden. Der Bundesrat ist daher überzeugt,
dass zur Förderung der Managed-Care-Modelle eine Verstärkung der Anreize unabdingbar ist.
Die Stossrichtung der Vorlage des Bundesrates liegt darin, dass die Managed-Care-Modelle weiterhin eine Al-
ternative zur Grundform der obligatorischen Krankenpflegeversicherung darstellen. Insgesamt ist der Vorlage
das Prinzip der Freiwilligkeit und der Vertragsfreiheit, verbunden mit stärkeren Anreizen, zugrunde gelegt. So
soll der Beitritt zu einem Managed-Care-Modell für die Versicherten freiwillig geschehen. Auf eine Verpflichtung
der Leistungserbringer zur Zusammenarbeit und zur Bildung von Versorgungsnetzen soll ebenfalls verzichtet
werden. Zudem soll es den Versicherern freigestellt werden, ob sie Modelle mit Budgetverantwortung der
Leistungserbringer anbieten wollen oder nicht. Die Netzwerke mit Budgetverantwortung sollen als Form von
besonderen Versicherungsformen definiert und unabhängig von der Frage der Vertragsfreiheit gesetzlich ver-
ankert werden. Eine flächendeckende Einführung mindestens einer besonderen Versicherungsform, wie sie in
der 2. KVG-Revision noch vorgesehen war, ist nicht mehr Gegenstand der Vorlage. Der Bundesrat nimmt zu-
dem die im Rahmen der 2. KVG-Revision vorgeschlagenen Massnahmen im Bereich der Medikamente zusätz-
lich wieder auf. Ausserdem ist eine Ergänzung der Regelung bezüglich der Weitergabe von Vergünstigungen,
die ebenfalls im Zusammenhang mit den Medikamenten stehen, vorgesehen.
Ihre Kommission hat die Vorlage des Bundesrates an mehreren Sitzungen beraten. Vorerst hat sie Anhörungen
durchgeführt, an welchen die verschiedensten Vertreter von Leistungserbringern und auch von Versicherern
anwesend waren. Insgesamt wurde Managed Care von allen Hearingsteilnehmenden als Chance für die Qua-
lität und die Steuerung der Leistungen angesehen.
21.12.2018 2/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Die Modelle enthielten unter anderem, so die Hearingsteilnehmenden, ein Optimierungspotenzial vor allem
bei chronischen Krankheiten. Durch die Schulung der Patienten könnten teure Hospitalisationen vermieden
werden. Die
AB 2006 S 942 / BO 2006 E 942
Leistungserbringerdichte würde durch die Nachfrage der Versicherten nach Managed-Care-Netzen geregelt
und die Versorgung der Patienten gewinne an Qualität und Effizienz. In der Kommission wurde betont, dass
unter den besonderen Versicherungsformen derzeit eine Vielfalt von Modellen angeboten wird, bei denen we-
der die Steuerungsverantwortung wirklich wahrgenommen wird noch eine echte Kooperation zwischen den
Leistungserbringern stattfindet. Von solchen Netzen eine effektive Kosteneinsparung bzw. eine verbesserte
Versorgungsqualität zu erwarten sei unrealistisch. Das Ziel der KVG-Teilrevision sollte denn auch sein, nur
diejenigen Modelle zu fördern, von denen ein Kostendämpfungseffekt bzw. eine Qualitätsverbesserung erwar-
tet werden kann.
Bisherige Erfahrungen mit Managed-Care-Modellen haben gezeigt, dass sie einen Risikoselektionseffekt aus-
üben und dank des Prämienrabatts in erster Linie für gesunde Versicherte attraktiv sind. Erfahrungen, die bis
heute mit Managed Care gemacht wurden, zeigen, dass es erstens eine starke Vernetzung braucht, zweitens
ein Care Management da sein muss und drittens eine gewisse Beteiligung am Versicherungsrisiko oder am
Risiko des Versicherers einbezogen werden sollte. Es sollen insbesondere neue Anreize geschaffen werden,
um die Modelle auch für Kranke attraktiv zu machen.
Die Kommission vertrat einhellig die Meinung, dass es ein System braucht, das möglichst offen ist und den
Versicherern den Freiraum gibt, diejenigen Modelle anzubieten, die von den Versicherten gewünscht werden.
Das Einzige, was dabei nicht tangiert werden darf, ist die Solidarität zwischen Gesunden und Kranken. Ge-
nauso wenig darf der Freiraum bei den Verträgen zwischen den Versicherern und den Leistungserbringern
eingeschränkt werden. Der gewünschte Effekt, so Ihre Kommission, tritt nur ein, wenn die Versicherer ver-
schiedenste Managed-Care-Produkte anbieten, aus denen der Versicherte auswählen kann. Nur so wird sich
der Versicherer bemühen, die Produkte zur Verfügung zu stellen, die dem Kunden möglichst gute Qualität
zu einem möglichst tiefen Preis garantieren. Der Wettbewerb, so die Mehrheit, kann sich nur entfalten, wenn
die Modelle frei gestaltet werden können. Eine Kommissionsminderheit hingegen – wir werden darüber si-
cher in der Detailberatung diskutieren – vertritt demgegenüber die Meinung, dass gewisse Anreize von den
Versicherern gesetzt werden müssen. So soll im Gesetz festgehalten werden, dass die Anreize über die Ko-
stenbeteiligung und nicht mehr vorwiegend über die Prämienrabatte gesetzt werden. Die Versicherten sollen
grundsätzlich nur noch 10 Prozent anstatt 20 Prozent Selbstbehalt bezahlen, wenn sie sich in diesen Modellen
einschreiben. Wir haben einen neuen Antrag von Frau Sommaruga, der die Bestimmung erst in Kraft treten
lassen will, wenn über die Frage des Selbstbehaltes entschieden worden ist. Gerade zu Beginn sei es not-
wendig, gewisse Anreize zu setzen. Einig war man sich indessen in der Vorgabe, dass die Versicherten auch
Leistungserbringer ausserhalb des Netzes aufsuchen können, dies allerdings unter stärkeren Kostenfolgen.
Eine weitere Minderheit stellt noch einen zusätzlichen Antrag, er betrifft den Risikoausgleich. Auch darüber
werden wir uns in der Detailberatung unterhalten.
Im Rahmen dieser Revision hat der Bundesrat ausserdem Massnahmen im Medikamentenbereich vorgeschla-
gen. Die Spezialitätenliste soll ergänzt werden durch wichtige Arzneimittel für seltene Krankheiten. Zur Ein-
dämmung der Medikamentenkosten soll der Leistungserbringer zudem verpflichtet werden, sowohl bei der
Verordnung eines bestimmten Arzneimittels wie auch bei der Abgabe eines Arzneimittels durch Wirkstoffver-
schreibung ein preisgünstiges Arzneimittel abzugeben. Da in der Kommission diverse weitergehende Anträge
zum Komplex Medikamente eingereicht wurden, beschloss die Kommission, Massnahmen im Medikamen-
tenbereich abzutrennen und in einer zweiten Vorlage zu behandeln. Diese Vorlage werden wir Ihnen in der
Frühjahrssession vorlegen.
Die Kommission hat einstimmig Eintreten beschlossen. Ich bitte Sie, das ebenfalls zu tun.
Fetz Anita (S, BS): Managed Care – was ist denn das?" Dies werde ich in meinem Umfeld immer wieder
gefragt. Sollen jetzt die Patienten von den Ärzten gemanagt statt behandelt werden? Oder ist das jetzt die
neue Wunderwaffe gegen die Kostenexplosion im Gesundheitswesen? Ich übersetze dann immer vom Neu-
deutschen ins Deutsche, und dann versteht man es auch besser, und das mache ich jetzt hier auch.
Es geht im Wesentlichen um Ärztenetzwerke. Natürlich weiss ich, dass da ein ganzes Konzept dahinter ist.
Aber die Leute verstehen es nicht, und deshalb bleibe ich jetzt beim Begriff Ärztenetzwerke. "Warum über-
haupt ist jetzt eine Gesetzesänderung nötig?" fragen viele. Hausarztmodelle und HMO gibt es ja heute schon.
Man legt ja hier im Rat die Interessen offen: Ich persönlich bin in einem HMO-Modell, und ich mache damit
21.12.2018 3/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
die besten Erfahrungen. Zirka 10 Prozent der Prämienzahler sind heute in solchen Versicherungsmodellen
eingeschrieben. Das sind über eine Million Versicherte, wie unsere Kommissionspräsidentin ausgeführt hat,
natürlich vor allem in den städtischen Gebieten. Warum sind es nicht mehr? Ein Grund dafür liegt, das hat
auch meine Befragung in meinem Umfeld ergeben, ganz bestimmt bei den Kassen, die solche Modelle nicht
offensiv fördern. Besser gesagt: Sie haben sie einmal offensiv gefördert, aber in den letzten Jahren ist die
Anfangseuphorie verschwunden. Von Kassenseite werden solche Modelle zum Teil gar nicht mehr angebo-
ten und sind nur Lippenbekenntnisse. Was spricht auch noch dagegen? Viele Leute haben das Gefühl, bei
Ärztenetzwerken, erst recht wenn sie "Managed Care" genannt werden, handle es sich um Discountmedizin.
Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, aber ich denke, es ist wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass sol-
che Vorurteile in der Öffentlichkeit bestehen. Das ist für mich ein Grund dafür, zu sagen: Ja, es braucht die
Gesetzesänderung, damit es wirklich eine gesetzliche Grundlage für diese Netzwerkmodelle gibt, und zwar
gesetzliche Grundlagen, die die Qualität der Behandlung ins Zentrum stellen. Das scheint mir ganz, ganz
wichtig zu sein.
Das Besondere an den Netzwerken, wenn sie denn gut funktionieren, ist – etwas vereinfacht gesagt –, dass
der Hausarzt die gesamte Behandlung koordiniert, begleitet und überwacht, dass er, wenn nötig, Spezialisten
zuzieht und dass er die Spitaleinweisung sowie nach dem Spitalaufenthalt die Pflegeunterstützung koordiniert.
Alles, die ganze Behandlungskette, kommt aus einer Hand. Das hat wiederum den grossen Vorteil, dass nicht
ständig Mehrfachuntersuchungen gemacht werden und dass eine bessere Koordination eben auch die Qualität
steigert.
Interessant sind solche Netzwerke eben nicht – wie heute propagiert – für die Gesunden. Vielmehr müssen un-
sere Anstrengungen bei der Gesetzesberatung darauf hinzielen, dass sie für die Kranken interessant werden.
Die haben nämlich am meisten davon, wenn die Qualität ihrer Behandlung stimmt, wenn die Koordination ihrer
Behandlung verbessert wird, wenn alle Leistungserbringer sich wirklich koordiniert auf die Behandlung ein-
lassen, keine Mehrfachuntersuchungen mehr passieren und damit Qualitätssteigerungen auch möglich sind.
Dann – ich betone es ausdrücklich –, erst dann wird es möglich sein, auch Kosteneinsparungen mit diesen
Netzwerkmodellen zu erzielen. Dass es möglich ist, zeigen die Erfahrungen in der Schweiz. Es zeigen aber
vielmehr die internationalen Erfahrungen, dass eine Kosteneinsparung durch die Optimierung der Behand-
lungskette möglich ist. Wenn man weiss, dass 10 Prozent der Chronischkranken 60 Prozent der Gesamtkosten
in der OKP auslösen, dann ist einem klar, dass da ein grosses Potenzial liegt, um gleichzeitig die Qualität zu
steigern und sie kosteneffizienter zu gestalten.
Das spricht dafür, dass wir die entsprechende Gesetzesregelung machen. Was die Mehrheit der Kommission
Ihnen vorschlägt, ist so weit gut, aber doch noch etwas harmlos. Damit sich diese Modelle wirklich durchsetzen,
braucht es auch noch so etwas wie kluge Anreize für alle Beteiligten.
Was der Mehrheitsantrag bringt, sind Anreize für die Ärzte. Immerhin ist die Anerkennung der Qualitätsbe-
handlung
AB 2006 S 943 / BO 2006 E 943
geregelt. Es ist auch eine Abgeltung der Koordinationsaufgabe vorgesehen; ich verstehe Ärzte, wenn sie sa-
gen, man müsse dann ja viel mehr koordinieren und nachher habe man nichts dafür. Diese Leistungen können
in den Ärztenetzwerken abgegolten werden.
Dann zum Anreiz für die Kassen: Einige Krankenkassenvertreter hier drin werden Ihnen nachher sagen, das
sei noch zu wenig. Ich denke, das Forcieren von Ärztenetzwerken in dieser neuen, qualitativ guten Form wird
bei den Kassen überhaupt einiges auslösen. Immerhin sieht die Vorlage vor, dass die Vertragsdauer auf drei
Jahre verlängert wird. Man kann also nicht mehr einfach bei günstigen Modellen einsteigen und, wenn man
krank ist, wieder aussteigen. Mir scheint, dieser Anreiz stimmt auch.
In Bezug auf den Risikoausgleich werde ich mich dann in der Detailberatung äussern. Das scheint mir inner-
halb der Ärztemodelle noch nicht das Gelbe vom Ei zu sein.
Was aber der allerentscheidendste Aspekt zur Durchsetzung dieser Ärztenetzwerke sein wird, ist ganz klar
ein kluger Anreiz für die Prämienzahler und insbesondere für jene, die krank sind. Wir alle werden krank, das
vergisst man ja gerne. Manchmal habe ich das Gefühl, bei der ganzen Debatte um die Kosten im Gesund-
heitswesen tue man immer so, als ob die anderen immer krank würden und man selber nicht. Sie wissen alle,
dass das nicht so ist. Wenn wir wollen, dass sich die Ärztenetzwerke sowohl als qualitativ gute wie auch als ko-
stensparende Modelle durchsetzen, dann müssen wir zwingend einen Anreiz für die Prämienzahler schaffen.
Das macht der Minderheitsantrag, indem ein Anreiz geschaffen wird und sich derjenige, der in einem solchen
Netzwerk ist, nur mit 10 Prozent an den Kosten beteiligen muss, während es für die anderen bei 20 Prozent
bleibt.
21.12.2018 4/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Ich bin froh, dass wir darüber entscheiden können; denn ohne diesen Anreiz muss man sich schon fragen, was
die Vorlage zu Managed Care mehr bringt als das, was wir heute schon haben. Denn alle, alle Erfahrungen
zeigen: Die Kostenersparnis wird erst relevant, wenn deutlich mehr als die Hälfte der Leute dort versichert
sind. Das müssen wir erreichen, indem wir aufzeigen, dass die Qualität stimmt, indem wir die entsprechenden
Anreize schaffen. Die 10-Prozent-Regel beim Selbstbehalt hat sich ja beim Generika-Modell bestens bewährt:
Hier haben wir einen Erfahrungshintergrund. Deshalb bitte ich Sie, hier die Minderheit zu unterstützen, na-
mentlich weil wir ja unterdessen wissen, dass eine Verknüpfung mit der Kostenbeteiligungsvorlage stattfindet;
wir wissen aber auch, dass die Minderheit bereit ist, ihren Antrag zu Absatz 3 zurückzuziehen. Dieser war ja
ein Stein des Anstosses. Ich habe ihn immer "Strafabsatz" genannt, denn man bringt die Leute nicht mit Straf-
androhungen in solche Netze, indem man ihren Selbstbehalt verdoppelt, sondern mit Anreizen, indem man
ihnen, erst recht, wenn sie krank werden, im Prinzip den Selbstbehalt verbilligt.
Ich bin für Eintreten auf die Vorlage, unter der Bedingung, dass wir wirklich eine Vorlage mit Zähnen machen.
Damit haben wir kein Wundermittel zur Kostensenkung im Gesundheitswesen, aber wir können – das verspre-
che ich mir ein Stück weit davon – einen Haltungswechsel einleiten, insbesondere auch bei den Kassen, weg
vom Run auf Junge, Gesunde hin zur Optimierung der Wirksamkeit der Behandlung durch Qualität und Koope-
ration. Das ist das Entscheidende und nicht immer die Jagd auf die Gesunden, denn es werden ohnehin alle
krank; das Entscheidende ist die Optimierung der Behandlung durch Qualität und Kooperation. Darauf setze
ich meine Hoffnungen.
Langenberger Christiane (RL, VD): Je dois tout d'abord avouer que, sans les connaître vraiment, les systèmes
de réseau de soins intégrés Managed Care représentaient pour moi la panacée: un traitement de qualité, une
possibilité de réduction des coûts, de responsabiliser aussi les assurés et vraiment de prendre en compte
globalement le malade. J'imaginais que tout malade, ainsi, ferait l'objet d'une attention particulière, les cas
difficiles étant examinés par plusieurs médecins recherchant les racines du mal; le fait d'éviter aussi une
redondance des prestations et des changements de médecins coûteux, favorisant en plus des économies.
Puis, j'ai appris qu'il existait aujourd'hui de multiples modèles: celui qui donne une place centrale à la médecine
de premier recours, au "gatekeeping"; le système dans lequel le patient s'adresse toujours en premier lieu au
médecin de famille auprès duquel les informations sont réunies et qui, si nécessaire, le dirige vers d'autres
maillons de la chaîne des soins; les HMO, soit des cabinets de groupe; les listes de médecins; le tri par
téléphone; les cercles de qualité; et des projets pilotes de pharmaciens qui font des campagnes de dépistage
précoce et de gestion des risques. Par exemple, ce cas-là, nous n'en avons même pas parlé en commission.
Bref, tout existe, et tout bon médecin vous dira que de toute manière il travaille en réseau en faisant appel aux
spécialistes avec lesquels il entretient de bons rapports de confiance. Les choses se compliquent lorsque vous
apprenez que certes les modèles du médecin de famille et les HMO devraient entraîner une diminution des
coûts et une amélioration de la qualité des soins, mais qu'il n'existe que peu d'évaluations, que par ailleurs elles
sont ponctuelles et qu'elles ne permettent pas toujours de conclure que les effets sont positifs et réalisés. On
affirme qu'il y aurait certes des économies, mais qui varieraient passablement, et que ces résultats ne prennent
pas suffisamment en compte la structure des risques. Les chiffres démontrent en tout cas que parmi les dix
caisses d'assurance-maladie les plus importantes, huit proposaient en 2004 un réseau de soins intégrés, mais
que chacune ne les offrait que dans dix cantons au plus. L'extrapolation d'une moyenne suisse à un réseau
représenterait à peine dix pour cent de l'ensemble des assurés, beaucoup d'assurés n'ayant même pas accès
à cette forme d'assurance.
Le manque d'intérêt a même provoqué une réduction des rabais accordés par les assureurs par rapport à
2000. Donc tous les clignotants montrent qu'il faut agir si nous pensons vraiment que ces modèles ont un
avenir devant eux. La difficulté réside dans le fait que nos mesures doivent avoir un attrait aussi bien pour les
assureurs, pour les médecins, ainsi que pour les affiliés de l'assurance obligatoire. Les assureurs devraient
y trouver leur compte, en bénéficiant de certaines réductions de coûts, notamment pour les cas lourds, et en
attirant de nouveaux assurés; les médecins devraient apprécier de travailler en réseau, tout en jouissant de
conventions passées avec les assureurs; et enfin les assurés devraient accepter une limitation du choix de
médecin, mais ils devraient pouvoir obtenir une réduction intéressante, par exemple de leurs primes.
Une fois ces difficultés et revendications surmontées, l'attrait à des réseaux de soins intégrés devrait être
favorisé. Mais arriver à contenter tout ce beau monde, c'est véritablement résoudre la quadrature du cercle.
Nous avons réfléchi à de multiples solutions qui, pour la plupart, ont des qualités mais aussi des défauts. Ainsi,
ce sont surtout les bons risques qui sont attirés par de tels systèmes, alors que nous voudrions précisément
y concentrer les cas lourds. C'est la raison qui nous a incités à étudier une proposition visant à ce que les
économies réalisées grâce aux modèles d'assurance alternatifs soient affectées à la compensation des risques
21.12.2018 5/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
et permettent aux assureurs de recevoir un allègement, mais dans le cadre de la compensation des risques,
et d'en faire bénéficier intégralement les assurés. La majorité dont je fais partie a finalement renoncé à ce qui
pourrait entraîner une surcharge administrative importante et probablement une gestion compliquée. Mais je ne
serais pas opposée à ce que, par le biais d'un projet pilote, on essaie de trouver une solution en commençant
peut-être justement uniquement par un projet.
Une minorité est favorable à une autre forme d'incitation pour les assurés: d'une manière générale, celle de
réduire à 10 pour cent la participation aux coûts des patients faisant partie d'un réseau. Elle permettrait de
mieux cibler les gens qui effectivement consomment des soins. D'ailleurs, c'est
AB 2006 S 944 / BO 2006 E 944
l'une des raisons qui motive la proposition de la minorité, alors que la réduction des primes attire surtout les
bons risques. La majorité dont je fais partie préfère laisser davantage de manoeuvre aux assureurs dans l'état
actuel des choses.
Autre proposition: celle de rendre obligatoire la participation à un réseau à une personne qui a une maladie
spécifique coûteuse, lui permettant de disposer d'une excellente prise en charge par le biais du "disease
management". Nous avons essayé de tenir compte de cette possibilité à l'article 41a alinéa 1.
Au final, nous avons opté pour une prise en compte peu contraignante des formes particulières d'assurance
et renoncé – du moins en ce qui concerne la majorité dont je fais partie – à rendre obligatoire la responsabilité
budgétaire. Nous avons accepté une durée maximale de trois années de rapport d'assurance, afin d'encoura-
ger les assureurs à offrir des formes particulières d'assurance, l'assureur pouvant convenir d'autres modalités
de sortie avec l'assuré.
Est-ce que nos propositions sont suffisantes pour rendre ces formes particulières d'assurance attrayantes pour
les assurés? Nous savons qu'il faudrait atteindre 40 à 50 pour cent d'assurés pour arriver véritablement à une
baisse des coûts. C'est cependant une tentative d'introduire par la toute petite porte une certaine forme de
liberté de contracter. C'est un premier pas qui va dans la bonne direction, en incitant les assureurs à offrir ces
types d'assurance et à faire en sorte que la qualité de traitement s'améliore.
Pour celles et ceux qui pensent que nous avons fait un projet particulièrement "versichererlastig", je dirai que
si nous n'agissons pas, nous prenons le risque que les assureurs finissent par abandonner totalement l'offre
de formes particulières d'assurance, ce qui aboutirait à une augmentation des coûts au lieu de la diminution
escomptée.
Stähelin Philipp (C, TG): Die Managed-Care-Modelle haben es seit ihrer Einführung im Rahmen des KVG
einigermassen schwer gehabt. Im Grunde genommen ist dies erstaunlich, denn auf den ersten Blick leuchtet
es ohne weiteres ein, dass allein schon eine gewisse Einschränkung bei der Wahl der Leistungserbringer zu
Einsparungen führen sollte, da damit Doppeluntersuchungen und Mehrfachbehandlungen und damit das Wan-
dern des Patienten von einem Arzt oder sonstigen Leistungserbringer zum anderen – ein Phänomen, welches
ja erfahrungsgemäss immer wieder festgestellt werden muss – etwas eingedämmt werden können. Ebenso
einsichtig ist, dass vorgegebene Behandlungspfade und die organisierte Weitergabe von Behandlungsdaten
usw. kostenmindernd wirken sollten.
Weshalb verläuft die Einführung von Managed-Care-Systemen aller Art trotzdem so harzig? Ich stelle diese
Frage nicht zuletzt aus der Optik eines Kantons, der, obwohl ein Landkanton, mit an der Spitze der Entwick-
lung steht und flächendeckend über Managed-Care-Modelle verfügt, denen ein vergleichsweise hoher Ver-
sichertenanteil angehört und die eine Grosszahl von Ärzten einbeziehen. Ich bin übrigens – dies zu meiner
Interessenlage, wenn Sie so wollen – in einer Begleitgruppe "Integrierte Managed Care Thurgau". Neben den
von unserer Kommissionspräsidentin genannten Gründen glaube ich für diesen trotz der erkennbaren Vorteile
so langsamen Fortschritt des Managed-Care-Gedankens insbesondere die folgenden Gründe zu erkennen:
Die bestehenden Netzwerke befolgen noch zu wenig den Grundsatz der integrierten Behandlung, und Mana-
ged Care erscheint noch zu wenig integriert in dem Sinne, dass eben nicht nur Hausärzte einbezogen, sondern
auch Spezialisten und vor allem Spitäler in den Behandlungspfad eingebunden und all diese Teilnehmer in eine
Qualitäts- und Ergebnisverantwortung integriert werden.
In diesem Sinne begrüsse ich nicht zuletzt unseren Antrag zu Artikel 57 Absatz 9, der den Grundsatz der al-
leinigen Bindung an die Ärzte – dort Vertrauensärzte – verlässt und die übrigen Leistungserbringer auch in die
Managed-Care-Führung einbezieht. Ich könnte hier beispielsweise an die Chiropraktiker denken. Sodann ist
die Schaffung von Transparenz über die effektiven Kosten zentral. Wir müssen wissen, welcher Behandlungs-
schritt wo wie viel kostet. Bleibt dies unklar, ist es verständlich, dass Leistungserbringer Hemmungen haben,
sich einbinden zu lassen, und dass auch die Versicherten die Vorteile eines Managed-Care-Systems kaum
21.12.2018 6/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
sehen.
Im Sinne eines Ceterum censeo weise ich auch bei dieser Gelegenheit wieder einmal darauf hin, dass unsere
dualistische Spitalfinanzierung nicht nur die Kosten- und Preistransparenz verhindert, sondern, bezogen auf
eine integrierte Managed Care, auch den Hebel verkürzt und damit den Anreiz für Versicherer und Versicherte
massiv verringert. Die Einsparungen bei der Managed Care für stationäre Behandlungen werden ja mehr
oder weniger halbiert. Diese Hebelwirkung kann auch aus der Karte der Verbreitung der Managed Care in
den Kantonen herausgelesen werden. Wollen wir also etwas ganz Mutiges für die Förderung der Managed
Care tun, dann müssen wir für umfassende Kostentransparenz sorgen und damit für den Wechsel bei der
Spitalfinanzierung hin zu einem einzigen Kostenträger bzw. Leistungszahler. Dies steht heute indessen nicht
zur Diskussion. Allerdings kann man immer noch auf die Beratung im Nationalrat im März 2007 hoffen.
Die Anträge der Kommission können deshalb als eher mutlos angesehen werden. Ich unterstütze sie trotz-
dem, denn ihre Richtung stimmt. Der Ausbau der Managed Care ist bisher zu einem guten Teil ohne direkte
Einwirkung der Politik erfolgt. Entscheidend ist für mich deshalb weiterhin, dass von Staatsseite her keine ge-
genläufigen Anreize gesetzt werden. Die Vorlage, die wir nun behandeln, beherzigt dies. Sie schafft einen sehr
lockeren Rahmen für die weitere Entwicklung und überlässt die Hauptrolle den Versicherten einerseits und
den Leistungserbringern andererseits. Diese sollen sich direkt einigen und kreativ Wege suchen, die zugun-
sten der Versicherten Kosten und Prämien tief halten. Dies ist nun der von der Kommission gewählte Ansatz.
Der Staat sorgt dabei für die Aufrechterhaltung der Qualität, für möglichst viel Transparenz und die Einhaltung
des Solidaritätsgedankens.
Ich kann mit dem Grundgedanken dieses Vorgehens leben. Hauptakteure sind die Versicherten einerseits
und die Leistungserbringer andererseits. Es wird wohl eine grössere Zahl recht unterschiedlicher Modelle
entstehen. Diese wiederum stehen im Wettbewerb zueinander. Im Rahmen der Managed Care wird hier auch
eine gewisse Vertragsfreiheit einziehen. Auch damit kann ich sehr wohl leben.
Ich meine zudem, dass die nun mit der rechten Hand gegebenen Freiheiten für unterschiedliche Lösungen
systemrichtig nicht mit der linken Hand wieder genommen werden dürfen. Die Minderheitsanträge sind unter
diesem Aspekt kritisch zu hinterfragen, sie passen nicht ins gewählte Konzept. Freiheiten einräumen bedeutet
andererseits Verantwortung übertragen. Versicherer und Leistungserbringer werden eine höhere Verantwor-
tung erhalten und diese insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung der Solidarität zwischen den
Versicherten auszuüben haben.
Ich vertraue hier den Akteuren und bin für Eintreten.
Frick Bruno (C, SZ): Eine Revolution liegt mit der Managed-Care-Vorlage nicht auf Ihrem Tisch. Managed
Care wird nicht mit dieser Vorlage erfunden, Managed Care gibt es schon viele Jahre. Ich habe noch meine
Interessen zu offenbaren: Ich bin Verwaltungsratsmitglied der Swica-Krankenversicherungen. Bei uns sind 50
Prozent der Versicherten in Managed-Care-Systeme eingebunden, und das nicht etwa in den Städten, sondern
vor allem in ländlichen Gebieten. Mit dieser Vorlage setzen wir uns einen etwas besseren Rahmen. Die Vorlage
ist nötig, auch wenn sie wenig verändert.
Managed-Care-Systeme sollen vermehrt gefördert werden, denn sie sind ein Mittel zur Kosteneinsparung.
Patienten sind bereit, die Wahl der Leistungserbringer einzuschränken und sich auf dem Behandlungsweg
begleiten zu lassen. Damit werden Behandlungen effizienter und günstiger, die Prämien dadurch billiger. Die
Idee ist gut.
AB 2006 S 945 / BO 2006 E 945
Nun ist es auch nicht die erste Vorlage, die wir Ihnen auf den Tisch legen. Bereits bei der grossen Revisi-
on des Krankenversicherungsgesetzes vor drei Jahren war Managed Care eingebaut. Aber wir haben uns
nun, anders als im Jahr 2003, für ein wesentlich freiheitlicheres System entschieden. Zwangsvorschriften wie
beispielsweise die Budgetverantwortung für die Patienten sollen entfallen, Versicherer sollen mehr Entfaltungs-
möglichkeiten haben, aber sie sollen selber aktiv werden und die Anreize selber setzen. Sie können in ihrem
System beispielsweise die Budgetverantwortung wählen, aber es besteht kein Zwang dazu. Es ist auch nicht
mehr zwingend vorgesehen, dass traditionell Versicherte höhere Selbstbehalte bezahlen, wie dies die Minder-
heit beantragt. Wir setzen grundsätzlich auf Freiheit, und das ist richtig.
Aber dennoch hat die ganze Managed-Care-Vorlage und hat auch das Managed-Care-System, soweit es
heute besteht, einen Schwachpunkt: Managed-Care-Systeme sind vor allem attraktiv für gesunde Versicherte.
Sie profitieren von den günstigeren Prämien, und solange man gesund ist, tut es ja nicht weh, in der Arztwahl
nicht völlig frei zu sein. Viele beanspruchen die günstigeren Prämien, solange sie gesund sind, und sobald
sie krank werden und Leistungen beanspruchen, wechseln sie. Das kann man ihnen nicht verübeln; das sind
21.12.2018 7/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
heute, wo der jährliche Wechsel möglich ist, die Anreize. Das geht bis zur Behandlungsplanung vieler Bürger,
die sich klar vornehmen, was sie sich in diesem Jahr noch an Operationen angedeihen zu lassen haben, und
im folgenden Jahr, wenn sie es nicht mehr brauchen, das System wechseln. Die Qualität unserer Vorlage wird
sich also daran messen, ob es gelingt, Kranke in die Managed-Care-Systeme zu bringen. Dann haben wir
etwas gewonnen.
Es liegen Ihnen zwei Minderheitsanträge vor: einer zum Risikoausgleich, zu Artikel 18a, welchen ich vertreten
werde, und einer von Frau Simonetta Sommaruga zu Artikel 64 Absatz 2 bzw. 3. Es wird sich an diesen zwei
Kernpunkten entscheiden, ob es uns gelingt, Managed-Care-Systeme attraktiver zu gestalten, oder ob wir
diese Chance dahingehen lassen. Wir werden uns dort wieder äussern.
Heberlein Trix (RL, ZH): Wie Sie aus den Ausführungen der Kommissionspräsidentin und der Kommissions-
mitglieder, die bis jetzt gesprochen haben, gehört haben, wurde diese Vorlage ohne grosse Begeisterung
verabschiedet; dies wohl auch, weil in wesentlichen Fragen noch Minderheitsanträge bestehen, über die wir in
der Kommission durchaus unterschiedlicher Meinung sind.
Einig sind wir uns aber alle in der Frage einer gezielten Förderung von Managed-Care-Modellen. Wir sind uns
auch bewusst, dass eine kurzfristige flächendeckende Einführung eine Illusion ist, dass es ländliche Regio-
nen wahrscheinlich schwieriger haben werden und diese Modelle dort nur ansatzweise bestehen werden. Aus
diesem Grund vertritt die Kommissionsmehrheit auch die Ansicht, dass eben möglichst offene Modelle angebo-
ten werden sollen, dass zumindest am Anfang den Netzwerken keine Verpflichtung aufgebürdet werden darf,
Budgetverantwortung zu übernehmen – dies allerdings im Wissen und in der Überzeugung, dass verantwor-
tungsvolles und kostengünstiges Verhalten der Anbieter durch die Übernahme einer finanziellen Verantwortung
gefördert wird. Wir wollen auch, dass Versicherte durch gezielte Anreize – sei dies durch Prämienreduktion,
höhere respektive tiefere Selbstbehalte oder Franchisen oder andere mögliche Anreize, welche den Kassen
zur Verfügung stehen – motiviert werden sollen, sich einer angebotenen Netzwerkform anzuschliessen, dies
aber nicht unbedingt tun müssen. Die Verankerung einer obligatorischen Übernahme von 20 Prozent der die
Franchise übersteigenden Kosten für Personen, die sich nicht in einem Managed-Care-Modell versichern,
gegenüber 10 Prozent bei Teilnahme an einem solchen Modell erscheint mir aber zu restriktiv, mindestens
jetzt, am Anfang, wenn und solange die qualitativen Angebote von Managed Care noch nicht bestehen und die
Wahlfreiheit für die Versicherten auch durch die Angebote der Versicherungen immer noch stark eingeschränkt
ist.
Ob der Anreiz für die Kassen, derartige Modelle anzubieten, mit dem Antrag der Mehrheit hoch genug ist,
kann man sehr wohl hinterfragen. Dass man die Modelle aber bereits jetzt und im Sinne eines Obligatoriums
verschärfen muss, scheint mir sehr fragwürdig zu sein. Wir müssen aber – davon bin ich überzeugt – den
Fortschritt dieser Modelle und die Verbreitung dieser Modelle sehr genau beobachten und dann allenfalls
handeln.
Wichtig erscheint mir aber, dass mit diesen vertraglichen Möglichkeiten ein entscheidender Schritt Richtung
Vertragsfreiheit gemacht wird. Er ist noch lange nicht das Ziel für mich, er entspricht aber wohl dem heute
politisch Realisierbaren. Damit das Modell besser funktionieren wird als heute, braucht es neben einer zahlen-
mässig repräsentativen Verbreitung der Modelle eine Kontrolle der Qualität. Voraussetzung ist, dass auch der
stationäre Bereich mit einbezogen werden kann; wir haben das bereits gehört. Dafür brauchen wir als Grund-
lage die Spitalfinanzierungsvorlage, eine Leistungsabgeltung und nicht eine Unterstützung der Institutionen.
Es sind flexible Beitrittsmöglichkeiten vorzusehen: zum Einstieg die Freiheit, Vereinbarungen mit und ohne
Budgetverantwortung zu treffen, und kein Zwang zur Capitation. Die Rechtsform der Leistungserbringer und
die Art der Steuerung der Behandlung können und dürfen zu Beginn nicht vorgeschrieben werden. Ob aber und
in welchem Ausmass diese Vorlage zum Tragen kommen wird, hängt sehr stark vom Verantwortungsbewusst-
sein der Krankenkassen ab, auch von ihrem Willen, diese Angebote zu fördern, die Versicherten zu lenken
und die Qualität zu kontrollieren. Ob die Erwartungen erfüllt werden, dass mit diesen Modellen die Kosten
gedämpft werden, hängt aber auch von der Bereitschaft der Leistungserbringer ab – und zwar einer breiten
Palette von Leistungserbringern, Grundversorgern und Spezialisten, ambulanten und stationären Anbietern –,
sich in solchen Modellen zusammenzuschliessen und miteinander zu arbeiten statt gegeneinander.
Wenn heute nur ein Zehntel der Bevölkerung in Managed-Care-Modellen versichert ist und nur zwei Prozent in
der Form mit einer Budgetverantwortung dabei sind, so haben wir noch einen weiten Weg bezüglich Akzeptanz
und Verbreitung solcher Modelle vor uns. Das soll uns aber nicht daran hindern, auf diese Vorlage einzutreten
und ihre Entwicklung weiterzuverfolgen.
Schwaller Urs (C, FR): 5 stimmen dafür, 6 enthalten sich: Das Resultat in der Schlussabstimmung für die heute
21.12.2018 8/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Morgen behandelte Vorlage zeigt, dass das Ergebnis unserer Kommissionsarbeit keine grosse Begeisterung
ausgelöst hat. An sich spricht alles für Managed-Care-Modelle. Ich führe nur vier Gründe dafür an:
1. Bessere Koordination unter allen Leistungserbringern.
2. Qualitative Gewinne durch eine bessere Zusammenarbeit unter den Ärzten und damit die Förderung ei-
nes regelmässigen Erfahrungsaustauschs und einer kontinuierlichen Weiterbildung der Ärzte und anderer Lei-
stungserbringer. Verschiedene Besuche bei und Gespräche mit Ärzten in Netzwerken haben mich im Übrigen
davon mehr als überzeugt.
3. Effizientere Steuerung komplexer Behandlungsprozesse, gerade von Chronischkranken.
4. Vermehrter Wettbewerb unter den Leistungserbringern, welcher aus der Vertragsfreiheit zwischen Versiche-
rern und den Ärzten der verschiedenen Netzwerke resultieren wird oder würde.
Heute sind rund 8 Prozent der Versicherten in Managed-Care-Modellen, in Netzwerken, eingeschrieben. Anzu-
streben wäre schweizweit ein Anteil von 50 bis 60 Prozent der Bevölkerung, was im Übrigen auch die ganzen
lähmenden Diskussionen um die generelle Vertragsfreiheit auf ein Minimum reduzieren würde. Um nun aber 50
bis 60 Prozent der Bevölkerung zu erreichen, müsste das Gesetz vorschreiben, dass die Versicherer zwingend
Managed-Care-Modelle anbieten. Das Gesetz müsste klarstellen, dass die Versicherten durch ihre Teilnahme
am Netz nicht nur qualitativ,
AB 2006 S 946 / BO 2006 E 946
sondern auch finanziell profitieren. Die Vorlage müsste weiter enthalten, dass die Leistungserbringer in einem
Bonus-Malus-System Mitverantwortung für das Budget übernehmen müssen. Ebenfalls müsste verhindert wer-
den, dass Effizienzgewinne und Einsparungen aus den Netzwerken in Richtung jener Kassen abfliessen, die
sich vor allem durch die Anlockung von jungen und gesunden Kunden fit halten. All diese Punkte fehlen nun
aber mehr oder weniger im Gesetzentwurf, und zwar unter dem Hinweis, dass es gelte, für die Kassen und
die Leistungserbringer möglichst breite Gestaltungsräume offenzuhalten, und dass der Markt genügend dyna-
misch sei, um neue Managed-Care-Modelle zu entwerfen.
Wenn man den heutigen Anteil an Netzwerken sieht, stimmt das Argument offensichtlich nur zum Teil und
nur für einige Kassen bzw. Regionen und Kantone. Ich meine, dass man in einem Versicherungssystem mit
erzwungener Solidarität und damit mit Zwangsabgaben ohne weiteres auch zwingende Anreize zur Effizienz-
steigerung setzen darf und dass man sie hätte setzen müssen. Das ist aber – wir haben es gehört – nicht
passiert. Das Resultat der Kommissionsarbeit ist nun das, was es ist. Der Gesetzentwurf bringt zwar nicht viel,
er verhindert aber glücklicherweise auch wenig.
Was also tun? Keine Lösung ist die blosse Rückweisung an uns, an die Kommission. Obwohl ich mich in
der Gesamtabstimmung aus den vorgenannten Gründen schliesslich der Stimme enthalten habe, meine ich
heute und nach vielen Diskussionen, dass wir nicht nur auf die Vorlage eintreten sollten, sondern dass wir
sie dann auch in der Frage des differenzierten Kostenanteils und des Risikoausgleichs verstärken und so
verbessert hier im Erstrat auch verabschieden sollten. Wenn der Zweitrat auf der gleichen Linie bleibt, so ist
Versicherern und Leistungserbringern eine Frist von maximal zwei Jahren zu belassen, damit sie beweisen
können, dass sie in dieser Zeit tatsächlich in der Lage sind, den heutigen Anteil an effizienten Netzwerken –
und nicht bloss an "Angstnetzwerken" – mindestens zu verdoppeln. Ist dies bis 2009 – ich nenne einmal dieses
Jahr – nicht der Fall, gibt es keinen Grund, dass das Parlament nicht selbst verbindlich und zwingend Anreize
schafft, indem die Versicherer dannzumal zwingend erstens Managed-Care-Modelle mit einer differenzierten
Kostenbeteiligung und eventuell differenzierten Prämien für die Versicherten und zweitens Managed-Care-
Modelle mit Budgetmitverantwortung für die Leistungserbringer anbieten müssen.
Zusammenfassend plädiere ich ebenfalls für Eintreten und werde einer in den vorgenannten zwei Punkten
verbesserten Vorlage in der Gesamtabstimmung auch zustimmen.
Brändli Christoffel (V, GR): Wir haben es bei dieser Managed-Care-Vorlage mit einer sicher wichtigen Vorlage
zu tun, aber es ist beileibe nicht die wichtigste bezüglich des Gesundheitswesens, wenn man Kosten sparen
und die Qualität verbessern will. Diese Möglichkeiten wären vor allem gegeben mit der Frage der Vertrags-
freiheit und dann auch mit der Spitalfinanzierung. Man darf nicht so tun, als ob wir hier jetzt die Lösung aller
Probleme finden würden.
Managed-Care-Modelle können dazu beitragen, Kosteneinsparungen zu erzielen, sie können auch dazu bei-
tragen, Qualitätsverbesserungen zu erreichen. Bei der Kosteneinsparung muss man dann aber auch rasch
relativieren: Sie finden natürlich immer wieder jemanden, der krank ist und ein solches Modell wählt, bei dem
Sie 20, 30 Prozent der Kosten einsparen. Aber es gibt viele Formen, bei denen die Kosteneinsparungen nicht
eintreten werden. Nehmen Sie die ganze Frage des Hausarztmodells: Wenn Sie jemanden haben, der per-
21.12.2018 9/43AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Ständerat • 4715 • Zweite Sitzung • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
Conseil des Etats • 4715 • Deuxième séance • 05.12.06 • 08h00 • 04.062
manent den Arzt wechselt und dann in ein Hausarztmodell übertritt, haben Sie eine Kosteneinsparung. Wenn
Sie hingegen jemanden nehmen wie mich, der sowieso zuerst zum Hausarzt geht, wenn er etwas hat, dann
sparen Sie nichts ein, wenn Sie den Hausarzt dem Hausarztmodell zugehörig erklären. Es ist heute so, dass
etwa 80, 90 Prozent der Schweizer eigentlich schon Hausarztmodelle leben. Deshalb darf man diese Kosten-
einsparungspotenziale jeweils nicht überbewerten. Es ist aber sicher erwünscht, und Managed-Care-Modelle
sind förderungswürdig. Es gibt aber sehr viele Modelle – eben vom Hausarztmodell bis zum Netzwerk mit
Budgetverantwortung.
Wir müssen bei allen Förderungen darauf achten, dass wir kranke Leute in diese Modelle bringen. Und da
besteht natürlich die Gefahr, dass wir jetzt attraktive Modelle für gesunde Leute entwerfen und damit wieder
ein Feld für die Risikoselektion öffnen. Das darf es nicht sein. Kosten sparen können Sie nur bei kranken
Leuten, also bei Leuten, die eben auch Kosten verursachen. Der Gesetzgeber sollte Anreize setzen, aber er
muss sich bei der Ausgestaltung dieser Modelle vor Überregulierungen hüten, diese hemmen jede innovative
Entwicklung in diesem Bereich.
Ich persönlich bin überzeugt davon, dass der beste Anreiz in der Möglichkeit liegt, längerfristige Verträge abzu-
schliessen. Heute ist es ja so – es wurde schon gesagt –, dass Leute wohl in ein solches Modell hineingehen,
aber wenn sie dann eine Operation haben, gehen sie wieder aus dem Modell hinaus, und das nützt natürlich
nichts. Es nützt nur etwas, wenn jemand sich längerfristig bindet.
Wir werden eine Debatte darüber führen, ob die Reduktion der Kostenbeteiligung auf 10 Prozent ein guter
Anreiz ist oder nicht. Ich habe so den Eindruck, man findet eben keine Anreize. Man hat jetzt diese Kosten-
beteiligung genommen, um zu sagen, dass man etwas gemacht hat. Ich muss Ihnen einfach sagen, dass das
Managed-Care-Modell in sich ja aufgehen muss. Sie finanzieren die Kosten mit Kostenbeteiligungen oder mit
Prämien. Sie können die Kostenbeteiligung abschaffen. Doch dann müssen Sie die Prämien erhöhen. Ob es
dann wirklich ein Anreiz ist, wenn Sie am Schluss beim Managed-Care-System höhere Prämien haben als bei
den übrigen Systemen, muss man diskutieren. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Anbieter solcher Mo-
delle frei sein sollten, entweder attraktive Prämien oder attraktive Kostenbeteiligungen anzubieten. Man muss
sicher darüber diskutieren, ob wir hier diese starre, diese fixe Lösung haben wollen oder nicht.
Eine weitere Bemerkung: Der Bundesrat hat diese Vorlage auch mit Fragen, die nicht mit Managed Care zu-
sammenhängen, angereichert. Es geht hier einmal um diese Kostenübernahme von Leistungen im Ausland.
Die ist in der Vorlage stehengeblieben. Der Bundesrat hat dann erfreulicherweise endlich auch gesetzgebe-
risch etwas bezüglich der Arzneimittel vorgeschlagen. Ich habe es bedauert, dass dieser Teil wieder aus der
Vorlage herausgenommen wurde. Die Kommissionspräsidentin hat darauf hingewiesen, dass wir im Januar
diese Frage diskutieren und dann im März eine Vorlage über die Frage der Arzneimittel haben werden. Wenn
dem so ist, ist das gut so. Aber wir müssen immer sehen: Wir haben im Gesundheitsbereich viele Ankündigun-
gen, was wir tun werden, doch wir müssen endlich etwas tun. Ich gehe schon von der Hoffnung aus, dass wir
im März über den Arzneimittelbereich – hier sind viele Kostensparmöglichkeiten enthalten, unabhängig davon,
ob wir in diesem Jahr schon etwas erreicht haben oder nicht – eine eingehende Debatte führen können.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Eintreten auf diese Vorlage.
David Eugen (C, SG): Ich möchte den Fokus auf einen bestimmten Punkt dieser Managed-Care-Frage richten.
Wenn wir die heutige Ausgestaltung dieser Modelle betrachten, stellen wir fest, dass es in erster Linie Prämi-
ensparmodelle für Gesunde sind. Das heisst, sie haben dann auch kaum positive Effekte auf die Qualität und
auf die Kosten. Daraus müssen wir schliessen, dass sich dieser Ansatz so, wie er bisher gewählt wurde, nicht
bewährt hat.
Ich bin jetzt eigentlich froh, dass die neue Gesetzgebung zu Managed Care neue Handlungsspielräume eröff-
net, die eigentlich in Zukunft eine bessere Ausrichtung dieser Modelle ermöglichen sollten. Ich bin überzeugt,
dass Managed-Care-Modelle ihren Hauptanwendungsbereich auf dem Gebiet des Disease Managements ha-
ben. Was heisst Disease Management? Das heisst, die Managed-Care-Modelle sollten sich primär auf die
Chronischkranken fokussieren. Dort kann
AB 2006 S 947 / BO 2006 E 947
man vor allem Managed Care machen, das heisst, dort kann man bessere Behandlungsqualität bereitstellen,
und dort kann man auch die Ressourcen wesentlich effizienter einsetzen. Ich nenne ein ganz konkretes Bei-
spiel: Bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz – das weiss man heute aufgrund der Studienuntersuchungen – ist
es so, dass etwa ein Viertel der Spitaleinweisungen vermieden werden könnte, wenn die Patienten im Medika-
mentenbereich richtig eingestellt wären. Das heisst, wenn man die Qualität bei der Einstellung der Patienten
mit Herzinsuffizienz in den Vordergrund stellt, dann hat der Patient einerseits die bessere Qualität der Versor-
21.12.2018 10/43Sie können auch lesen