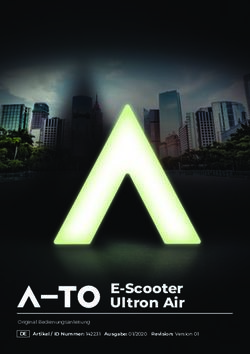AMTLICHES BULLETIN - BULLETIN OFFICIEL - Parlament.ch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
01.419
Parlamentarische Initiative
WBK-NR.
ICT-Umschulungs-Gesetz
Initiative parlementaire
CSEC-CN.
Loi de reconversion dans les ICT
Fortsetzung – Suite
CHRONOLOGIE
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 20.06.01 (ERSTRAT - PREMIER CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 20.06.01 (FORTSETZUNG - SUITE)
STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 04.10.01 (ZWEITRAT - DEUXIÈME CONSEIL)
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 05.06.02 (DIFFERENZEN - DIVERGENCES)
Pfister Theophil (V, SG): Ich stelle fest, dass das grosse Publikum, das heute Morgen versprochen worden
ist, offenbar noch nicht anwesend ist. Aber trotzdem: Die SVP-Fraktion lehnt dieses gut gemeinte, heute aber
überholte Umschulungs-Gesetz nach eingehender Beratung ab. Das ICT-Umschulungs-Gesetz ist im Kern
eine spontane Reaktion auf einen spürbaren Engpass in einer überhitzten Branche, die von drei Parlamen-
tarischen Initiativen aus unserem Rat unterstützt wird. Gemäss dem von der WBK erarbeiteten Text soll die
geplante Umschulung maximal 100 Millionen Franken kosten und während vier Jahren Bildungsmassnahmen
im Informations- und Kommunikationsbereich fördern. Es gibt zu viele Gründe, die gegen solche Massnahmen
sprechen. Grundsätzlich sehen wir es so, dass hier kein tragbares Kosten-Nutzen-Verhältnis mehr vorhanden
ist.
Bevor ich auf einige negative Einzelheiten eingehe, möchte ich die intensive und keineswegs nutzlose Arbeit
der Kommission und der Experten erwähnen und das Neue und Positive dieses Gesetzentwurfes würdigen: die
Nachfrageorientierung in der Weiterbildung. Interessant ist, dass gerade dieses Element der Vorlage vielerorts
auf Misstrauen und Kritik gestossen ist. Die Nachfrageorientierung – genauer: die direkte Unterstützung der
Auszubildenden und nicht der Schulen – ist ein geeignetes Mittel, um den freien Wettbewerb unterschiedlicher
Anbieter im Bildungsmarkt zu fördern. Der Weiterbildungsmarkt und speziell die ICT-Weiterbildung werden von
privaten Anbietern dominiert, was ich keineswegs als negativ betrachte.
Zu den kritischen Punkten: Das ICT-Umschulungs-Gesetz wurde in einer Zeit erarbeitet – von März bis August
2000 –, in der im ICT-Bereich noch übertriebene Euphorie und ein akuter Mangel an Informatikern herrsch-
te. Damals wurde ernsthaft über die Rekrutierung von ICT-Spezialisten aus Russland oder Indien diskutiert.
Die Green Cards waren in aller Leute Munde. Nur Monate ist es her, seit die überhitzte New Economy im
ersten Quartal dieses Jahres einen überraschenden Einbruch erlebte und auf den Boden der Realität zurück-
kehrte. Ich erwähne hier beispielhaft den bekannten, aber keineswegs untypischen Fall der Firma Miracle.
Verschiedenste Grossprojekte in der Software-Entwicklung wurden gestoppt. Seither hat die Branche auf ein
Normalmass zurückgefunden. Nach wie vor sind eigentliche Informatikspezialisten gesucht, wie z. B. Fachleute
auf dem Gebiet von SAP/R3, einem Spezialgebiet, in dem auch der Bund entsprechende Rekrutierungserfah-
rungen machen kann. Aber gerade solche spezialisierte Ausbildungen sollen beim ICT-Umschulungs-Gesetz
nicht im Vordergrund stehen. Mit dem zu weiten Weg über die vorgesehene Grundlagenausbildung – losgelöst
von der ICT-Front – kann das Endergebnis nicht befriedigen. Damit wird, vergleichsweise, am ICT-Haus die
Fassade gestrichen; es reicht aber nicht, um ein neues Haus zu bauen.
Die Gesetzesvorlage weist nach unserer Ansicht aber auch noch weitere Schwachstellen auf:
1. Der tatsächliche Bedarf an Arbeitskräften in der ICT-Branche kann zwar mengenmässig einigermassen
beziffert werden, hingegen ist er in seiner Qualität und Spezialisierung weitgehend unbekannt. 88 Prozent der
heutigen Informatiker und Informatikerinnen sind Quereinsteiger, also Umsteiger aus anderen Berufen. Die
Ausbildung dieser Quereinsteiger erfolgte – so wage ich eine Feststellung – weitgehend anwendungs- und
15.07.2022 1/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
produkteorientiert. Diese direkte und effiziente Schulungsart steht, wie erwähnt, nicht auf dem Programm der
ICT-Umschulungs-Offensive.
2. Das Angebot an ICT-Bildungsmöglichkeiten ist nach allgemeinen Schätzungen heute genügend gross, wenn
auch nicht optimal verteilt. Es fehlt vorab an Transparenz und an Informationen über Inhalt und Qualität der
Ausbildung. Es fehlen auch weitgehend die inhaltlichen Informationen über das Stellenangebot. Wer in die
Schulung investiert, sollte genauer wissen, was am Ende tatsächlich zu erreichen ist.
3. Heute wird mit Recht reklamiert, dass nicht nur die ICT-Branche, sondern auch andere Fachgebiete einen
Mangel an Fachkräften aufweisen. Somit ist auch aus dieser Sicht eine Bevorzugung der ICT-Branche bei der
Umschulung nicht mehr gerechtfertigt.
4. Wir werden uns im Parlament bald wieder mit ähnlichen Vorlagen befassen dürfen. Ich erwähne hier das
Projekt "Public Private Partnership – Schulen ans Netz". Auch hier sind Bundesmittel in der Höhe von 100
Millionen Franken anbegehrt. Oder ich erwähne das neue Berufsbildungsgesetz, bei dem sich gegenüber
heute erhebliche Mehrkosten abzeichnen.
Die Berufsbildung ist ohne Zweifel ein wichtiger Faktor für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Darin eingebettet
sind die neuen Technologien, deren Beherrschung frühzeitig den Anforderungen angepasst werden muss.
Wir stellen fest, dass unsere jungen Leute keineswegs zur Informatikerlaufbahn gezwungen werden müssen,
sondern dass das Interesse allseits vorhanden ist und auch die Möglichkeiten zum direkten Quereinstieg nach
wie vor gut genutzt werden. Ich erachte es heute als vordringlich, nicht allein den ICT-Bereich in den Fokus zu
nehmen, sondern die berufliche Weiterbildung ganz allgemein.
Namens der SVP-Fraktion empfehle ich Ihnen, dem Antrag des Bundesrates und den Stellungnahmen unserer
Wirtschaft und des Gewerbes zu folgen und das Umschulungs-Gesetz abzulehnen. Wir unterstützen auch den
Nichteintretensantrag.
Laubacher Otto (V, LU): Seit bald dreissig Jahren bin ich als Unternehmer in der angewandten Elektronik
und Informatik tätig; deshalb sind mir Personal- und Ausbildungsfragen nicht fremd. Aus- und Weiterbildung
wie auch der Einsatz von rechnergesteuerten Systemen gehören in einer technischen Firma zum täglichen
Brot. Das heisst aber auch, dass die Mitarbeiter im Umgang mit Computern Erfahrung haben. Heute werden
auch immer mehr Lehrstellen im Bereich Informatik angeboten, die den Bedarf an Ausgebildeten zu decken
vermögen.
Der uns hier präsentierte Gesetzentwurf verstösst gegen alle Regeln der Ordnungspolitik und ist auch syste-
matisch falsch. Viele andere Gründe sprechen aber auch noch dagegen. Es gibt immer wieder in einzelnen
Berufsgattungen Mangel an ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
AB 2001 N 848 / BO 2001 N 848
Trotzdem ist es nicht Aufgabe des Staates, hier lenkend einzugreifen und in ein Projekt 100 Millionen Fran-
ken zu investieren. Mit diesem Projekt holt man den innovativen Firmen, die rechnergestützt produzieren, die
gut ausgebildeten Arbeitskräfte aus den Produktionsstätten. Ich frage Sie: Wollen Sie dann ein Projekt star-
ten, das den nun entstandenen Fachkräftemangel in den Produktionsstätten deckt? Die "NZZ" schreibt am
23. April 2001, europaweit fehlten der Wirtschaft zurzeit rund 70 000 Ingenieure. Hier könnte man auch ein
Projekt starten. "Cash" schreibt, die Liste der Internetflops werde länger und länger. Nach Vontobel, Credit
Suisse, Zurich Financial Services reihe sich jetzt auch die UBS in die unrühmliche Serie ein. Allein nur in den
obgenannten Unternehmen beziffern sich die Fehlinvestitionen, diese Flops, gemäss "Cash" auf über 1000
Millionen Franken. Das sind umgerechnet etwa 10 000 Mann- oder Fraujahre.
Viele Informatiker, die freigesetzt worden sind, haben sicher eine neue Anstellung gefunden, aber die Nachfra-
ge nach diesen Berufsleuten hat sich auch wesentlich entschärft. Die Informatiker gehören nicht mehr zu den
meistgesuchten Leuten, die New Economy hat dieses Problem selbst gelöst. Aufgabe des Staates ist nicht die
Ausbildung von Spezialisten, sondern Aufgabe des Staates ist es, für eine solide, gute Grundausbildung auf
allen Stufen der Bevölkerung zu sorgen.
Ich bitte Sie, diese Vorlage abzulehnen, denn Sie lösen mit einer Zustimmung keine Probleme, sondern Sie
schaffen ein unnötiges Präjudiz, das nichts anderes als Folgeforderungen auslösen wird. Auch der Schweize-
rische Gewerbeverband, die Economiesuisse und der Bundesrat empfehlen Ihnen, diese Vorlage abzulehnen.
Simoneschi Chiara (C, TI): Prendo brevemente la parola per motivare il sì del gruppo democratico-cristiano e
mio personale alla legge in esame. Lo farò ricordando alcuni fatti e svolgendo qualche considerazione riguardo
al parere del Consiglio federale. I fatti sono già stati detti, ma vale la pena ripetere che le tre iniziative sono
state inoltrate durante la sessione primaverile 2000 quale sostegno ad una mozione che è passata in Consiglio
15.07.2022 2/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
nazionale a larghissima maggioranza e che il Consiglio degli Stati ha trasformato in postulato. Gli iniziativisti
hanno comunque voluto indicare una soluzione ad un problema, quello della mancanza cronica di specialisti
nelle nuove tecnologie sul mercato del lavoro, partendo dalla valorizzazione delle risorse umane presenti sul
territorio e non cercando invece altre scappatoie.
Passo ora alle considerazioni sul parere del Consiglio federale, parere negativo che, a dir la verità, ci ha
sorpreso assai.
Nous sommes d'accord avec le Conseil fédéral sur une chose, c'est lorsqu'il dit, en effet, dans son avis du
30 mai 2001: "Le Conseil fédéral est pleinement conscient de l'importance des technologies de l'information
.... pour l'avenir de l'économie. Il suit avec beaucoup d'attention les développements sur le marché du travail
qui pourraient laisser présager une pénurie de professionnels qualifiés." De même, nous sommes d'accord
avec les mesures prises en amont qui permettent la formation des jeunes d'aujourd'hui et leur succès de
demain. Nous sommes par contre moins d'accord avec le Conseil fédéral sur le point suivant: nous sommes
convaincus, d'une part, que l'on assiste dans ce domaine à une véritable révolution et non pas uniquement
à un boom général, comme le pense le Conseil fédéral; d'autre part, que la formation continue sera toujours
davantage une pièce maîtresse du développement économique et social de notre pays.
Nous proposons, avec ce projet de loi, une solution rapide, efficace, souple, dynamique et qui fait face aux
besoins actuels, contrairement à ce que fait le Conseil fédéral. Je ne veux pas répéter et entrer dans les détails,
parce que M. Christen, rapporteur, a déjà très bien expliqué comment est le projet. Je voudrais seulement dire
que ce que nous vous proposons dans ce projet, c'est une nouvelle façon de procéder en matière de formation
professionnelle continue en Suisse: le subventionnement entièrement axé sur la demande, avec des bons de
formation. On essaie donc d'abattre deux barrières: les barrières financières que pourraient rencontrer les
personnes qui veulent se former, mais aussi les difficultés des petites et moyennes entreprises.
Je voudrais maintenant passer au sujet sur lequel nous ne sommes pas du tout d'accord avec le Conseil
fédéral. Nous ne partageons pas les commentaires et les constats qui sont écrits dans l'avis.
1. Concernant la problématique de la pénurie de spécialistes, je vous invite à consulter quelques documents
dont voici quelques exemples. Dans une interview parue dans le magazine "Vision", M. Quadri d'IBM Suisse
et M. Zehnder de l'EPFZ confirment le manque d'au moins 10 000 à 25 000 personnes. Un spécialiste des
nouvelles technologies m'a confirmé que les besoins du marché se montent à 10 000 personnes au moins,
étant entendu que d'autres personnes non officiellement qualifiées, les "Quereinsteiger", travaillent également
en masse dans l'informatique. Dans un communiqué de presse du Conseil fédéral du 23 mai passé, on se
réfère explicitement aux besoins de l'économie en spécialistes. Même l'administration fédérale souffre de la
pénurie de spécialistes. Il y a eu un communiqué qui disait qu'il manquait 1500 personnes dans l'administration
fédérale.
2. Le Conseil fédéral a peur de privilégier une branche. La révolution ICT touchant absolument toutes les bran-
ches économiques, du paysan au chirurgien, de l'industrie au tertiaire, elles profiteront toutes des spécialistes
ICT.
3. Enfin, on cite les mesures que la Confédération a déjà prises en matière de formation. Ces mesures étaient
déjà connues l'année passée, mais on sait également que ces mesures n'auront d'effet que dans quatre ou
cinq ans.
Quelles sont alors les conclusions à tirer du refus du Conseil fédéral? D'abord, on pourrait penser qu'on
ne veut pas s'engager dans la formation continue pour une question d'"Ordnungspolitik" – l'Etat n'a rien à
faire là. Pourtant ce projet de loi fédérale limitée dans le temps reprend ce que prévoit la loi sur la formation
professionnelle dont nous débattrons en septembre. Dans le message du Conseil fédéral sur la loi fédérale sur
la formation professionnelle, on souligne que la formation continue est un instrument stratégique très important
pour accompagner les changements structurels, pour maintenir la compétitivité de l'économie, pour diminuer
et anticiper le risque d'exclusion des personnes du marché du travail. Donc, nous voyons que le Conseil fédéral
est en contradiction avec lui-même s'il pense ne pas s'engager.
Ensuite, nous pourrions déduire qu'on préfère réparer le jouet lorsqu'il est cassé, c'est-à-dire dépenser l'argent
de la caisse de chômage quand les personnes sont déjà au chômage et quand c'est peut-être trop tard.
Enfin, on refuse de faire face à la situation actuelle sous prétexte que demain, on sera prêt. Le Conseil fédéral
s'est en effet déjà engagé avec le programme PPP, "Schulen ans Netz" qui coûte aussi 100 millions de francs.
Ce faisant, on forme aux nouvelles technologies des jeunes. C'est très bien, c'est très important, mais nous
ne devons pas jouer un projet contre l'autre. C'est complètement faux, les deux projets sont complémentaires.
Je pense que nous devons préparer l'avenir et donc parer maintenant à la pénurie.
Je vous demande de voter l'entrée en matière.
15.07.2022 3/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Riklin Kathy (C, ZH): Dass mehr als zehntausend Informatikerinnen und Informatiker der verschiedensten Aus-
bildungsstufen fehlen, ist hier und in allen Gremien und Medien immer wieder festgestellt worden. Eine ganze
Reihe von Vorstössen wurde eingereicht. Insbesondere die Kolleginnen und Kollegen Simoneschi, Strahm
und Theiler, welche die drei grossen Bundesratsparteien vertreten, haben mit Parlamentarischen Initiativen
ein nationales Informatik-Ausbildungsprogramm, eine Weiterbildungs- und Umschulungsinitiative verlangt.
Das Parlament und das Bundesamt für Bildung und Technologie haben rasch und effizient gehandelt. Die Sub-
kommission hat mehr als ein Dutzend Vertreterinnen und Vertreter
AB 2001 N 849 / BO 2001 N 849
der verschiedensten Bereiche angehört. Sicher ist inzwischen in der regulären Ausbildung auf Fachhochschu-
lebene und in der Lehre einiges passiert. Doch es herrscht immer noch ein grosser Mangel an Fachleuten,
und zwar in allen Bereichen. Insbesondere sind die KMU davon betroffen, und es arbeiten vor allem viel zu
wenig Frauen im ICT-Bereich. Ihr Anteil soll erhöht werden.
Es geht jetzt um 100 Millionen Franken für vier bis fünf Jahre. Eine gründliche Selektion der Personen und Kur-
se ist extrem wichtig und muss gewährleistet werden. Die Auswahl und Prüfung der Programme, die Steuerung
und Bereitstellung der Fachleute, die Zertifizierung der Ausbildungslehrgänge sollen 20 Prozent des Kredites
erhalten. 80 Millionen Franken sollen in Form von Bildungsgutscheinen an die entsprechenden Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Programme verteilt werden.
Wenn wir diese Ausgaben mit den Lothar-Beiträgen vergleichen, sind sie gering. Leisten wir uns auch etwas
für die Bildung und Weiterbildung in diesem ICT-Anschubprogramm. So viel soll uns die Bildung wert sein. Die
Schweiz droht technologisch zurückzufallen. Extremsituationen verlangen nach Sondermassnahmen. Rund
5000 Personen können und sollen von dieser Weiterbildungs- und Umschulungsoffensive profitieren.
19 Mitglieder der WBK haben diesem Vorstoss zugestimmt; nur 3 lehnen ihn ab.
Wir sind darüber enttäuscht, dass der Bundesrat nun plötzlich nicht mehr bereit ist, in dieses Programm zu in-
vestieren. Er hat anscheinend einen eigenartigen Deal mit dem Programm "Schulen ans Netz" gemacht. Aber
auch dieses Geld ist hier noch nicht bewilligt. Oder hat er etwa zu stark auf den Schweizerischen Arbeitgeber-
verband und Economiesuisse gehört? Mit wenig überzeugenden Argumenten lehnen diese Wirtschaftsvertre-
ter dieses gute Projekt ab. Dabei ist dieser Bundesbeschluss nur als Übergangslösung bis zur Inkraftsetzung
des neuen Berufsbildungsgesetzes gedacht, welches ähnliche Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten soll.
Unverständlich für mich ist auch der Schwenker der SVP-Fraktion, hat doch Theophil Pfister am 24. März
2000 in einer Interpellation energisch Massnahmen für die berufliche Weiterbildung und Umschulung von
Informatikspezialisten verlangt.
Seien wir doch nicht so knauserig mit unserem wichtigsten Gut, dem Brain; stimmen Sie diesem ICT-Umschu-
lungsgesetz zu.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass die CVP-Fraktion dem Bundesgesetz über Sondermassnahmen für Umschu-
lungen und Weiterbildung in den Berufen der Informations- und Kommunikationstechnologien zustimmt.
Kunz Josef (V, LU): Werte Kollegin, sind Sie nicht der Meinung, dass beim heute ausgetrockneten Arbeitsmarkt
Leute mit den Massnahmen, die Sie vorschlagen und unterstützen, dort abgezogen werden, wo sie dringend
gebraucht werden? Wie ersetzen Sie in der Wirtschaft diese Leute? Was geben Sie der Wirtschaft für einen
Rat, wie diese Leute ersetzt werden können?
Riklin Kathy (C, ZH): Es handelt sich hier um Bereiche, die die Zukunft unseres Landes bedeuten. Darum ist
es unbedingt wichtig, dass wir gerade in diesen Bereich investieren. Ich denke, wenn wir etwas tun wollen für
die Wirtschaft, dann ist es hier am besten investiert.
Scheurer Rémy (L, NE): De nombreux exemples montrent que le groupe libéral soutient la formation et la
recherche. De plus, il n'est pas hostile à des interventions ponctuelles de l'Etat lorsqu'il s'agit de réduire un
déséquilibre temporaire entre la demande et l'offre dans des domaines spécifiques de la formation. Malheu-
reusement, même s'il va dans le sens d'idées qui nous sont chères et pour lesquelles nous aimons agir, nous
sommes arrivés à la conclusion que le projet de loi relatif à des mesures spéciales de reconversion et de
formation continue dans les professions des technologies de l'information et de la communications ne résiste
pas à l'épreuve d'un examen critique.
Ce projet de loi répond-il à un besoin qui nécessite l'intervention de l'Etat? C'était vraisemblablement le cas
en 1998 ou 1999 lorsque le thème du manque de professionnels qualifiés dans le domaine de l'informatique
est devenu d'actualité. C'était encore vraisemblablement le cas au début de l'an dernier lorsque trois de nos
collègues ont déposé des initiatives qui sont à l'origine de ce projet de loi. Je dis "vraisemblablement", car le
15.07.2022 4/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
rapport même de la commission relève l'imprécision des statistiques, imprécision expliquée et aggravée par le
fait "que l'on commence seulement à se mettre d'accord sur une définition de la branche ICT".
Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de raison d'agir aujourd'hui spécifiquement dans ce domaine. Sur la base des
évaluations du KOF de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, le Conseil fédéral conclut que "la situation ac-
tuelle ne donne lieu à aucune inquiétude particulière". De même, l'Office fédéral de la formation professionnelle
et de la technologie affirme que "la relève dans le secteur concerné devrait être suffisante d'ici 2003 ou 2004".
C'est donc en définitive le calendrier qui condamne le projet de loi de reconversion dans les ICT. En effet, en
admettant que cette loi soit acceptée cette année encore par les Chambres fédérales, elle ne pourra entrer en
vigueur que dans le courant de l'année 2002. Sa mise en application sera lente. Ce que les rapporteurs en ont
dit le prouve absolument. Avec des formations qui dureront de six mois à deux ans, ce n'est donc pas avant
2003 ou 2004 qu'arriveront sur le marché du travail les premiers diplômés qui seront aussi, vraisemblablement,
presque les derniers diplômés de cette action particulière. C'est donc au moment où l'équilibre entre l'offre et
la demande sera rétabli ou en voie de rétablissement qu'ils y arriveront. Le projet de loi qui souhaite combler
un manque pourrait donc bien provoquer la pléthore.
Un autre argument temporel prouve qu'il y a disproportion entre la durée d'application de cette loi et l'ampleur
des moyens engagés. La loi sera abrogée au plus tard le 31 décembre 2005. Mais ce pourrait être déjà le
31 décembre 2004 si la loi sur la formation professionnelle entre en vigueur le 1er janvier 2003. Initialement
prévue pour durer 5 ans, la loi de reconversion dans les ICT aurait donc une durée de trois ans, au mieux de
quatre. Vaut-il la peine de produire tant d'efforts, et pas seulement financiers, pour une aide d'une aussi courte
durée? Vaut-il la peine de former des maîtres et de prendre toutes les mesures prévues aux articles 4 ou 5 du
projet pour si peu de temps, cela d'autant plus que l'équilibre dans le marché du travail sera rétabli selon toute
vraisemblance?
A ces raisons majeures s'en ajoutent d'autres qui tiennent à des difficultés ou à des impossibilités d'application.
Il est prévu, par exemple, que les mesures subventionnées doivent faire l'objet d'une évaluation. Alors mettez
bout à bout le temps qu'il faudra pour établir ces mesures, pour former les maîtres, etc., le temps qu'il faudra
pour appliquer ces mesures et celui qu'il faudra encore pour les évaluer, et vous constatez qu'avec l'échéance
de 2003, de 2004 ou de 2005, il n'y aura plus de temps pour tirer utilement les leçons de l'évaluation.
Autre exemple de difficulté, voire d'impossibilité: l'obligation de réussite imposée aux bénéficiaires d'un bon de
formation. "Obligation de réussite", c'est au chiffre 1.3 in fine du rapport de la commission. Quelle pression
exercée sur les examinateurs! Lorsque vous avez devant vous une personne à interroger et que vous la faites
échouer, cela veut dire qu'elle doit rembourser les frais de formation. Mais c'est quelque chose de tout à fait
inouï! Et j'imagine que personne à gauche ne peut souhaiter une chose aussi abominable. Quelle dévaluation
aussi du titre, si on sait qu'on passe des examens et qu'on devrait rembourser si on ne réussissait pas! Mais à
ce moment-là, le titre ne vaut plus rien ou presque plus rien! Puis, dans le cas extrême, quelle difficulté pour
exiger du candidat malheureux à l'examen le remboursement de son bon de formation!
AB 2001 N 850 / BO 2001 N 850
Je comprends que le projet de loi n'ait pas repris ce qui est dans le texte du rapport, mais cette contradiction
prouve qu'à tout le moins le projet qui nous est soumis devra être repris et profondément repris, s'il est accepté.
Et cela ne fait que renforcer les arguments pour le refus d'un texte qui aura beaucoup perdu de sa pertinence
au moment de son entrée en vigueur pour une durée éphémère.
Pour terminer, je souligne encore la contradiction entre le point de vue de la commission, qui annonce des
conséquences économiques positives et importantes de cette loi, et le point de vue de l'Union patronale
suisse, d'Economie suisse, qui ne juge pas utile l'affectation de 100 millions de francs sur cinq ans à ce projet.
Enfin, s'il est vrai, comme le suggère le rapport de la commission en page 5, que des bénéficiaires – et cela m'a
paru quelque chose de tout à fait important – d'une reconversion dans les ICT pourraient passer d'un salaire
annuel de l'ordre de 80 000 à 90 000 francs à un salaire annuel de l'ordre de 180 000 à 200 000 francs, eh
bien je ne vois pas pourquoi l'effort de reconversion devrait être payé par les pouvoirs publics. Si l'on m'offre
la possibilité de doubler mon salaire dans un temps aussi restreint, je trouve normal que l'on exige de moi
l'investissement qui me permet de doubler le salaire à brève échéance, parce qu'il s'agit uniquement de brève
échéance et pas de formation fondamentale.
Au nom du groupe libéral, je vous invite donc à ne pas entrer en matière, même s'il s'agit de formation, et aussi
à ne pas entrer en matière parce que la formation aura besoin de cet argent dans d'autres tâches, absolument
nécessaires celles-là.
En définitive, je crains que la Commission de la science, de l'éducation et de la culture, après avoir beaucoup
travaillé, soit victime, je dirai, d'une sorte de syndrome du pont de la rivière Kwaï: elle a fabriqué un bel objet
15.07.2022 5/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
et elle finit par oublier le sens de son utilisation. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de prendre des mesures
spéciales.
Bangerter Käthi (R, BE): Informatiker sind Mangelware: Diese Message hören und lesen wir immer wieder.
Aber auch andere Fachkräfte sind Mangelware, z. B. Polymechaniker, Techniker, Ingenieure. Wir Unterneh-
merinnen und Unternehmer signalisieren dies auch entsprechend, doch nimmt die Politik diese Tatsache nicht
auf. Es bleibt unser ureigenes Problem. Hier stellt sich mir die Frage: Was machen wir Wirtschaftsvertreterin-
nen und -vertreter und was machen die Verbände falsch, dass diese Botschaft nicht gehört wird? Mit neuen
Berufsbildern und neuen Ausbildungsgängen mit integriertem Informatikanteil versuchen wir in der Wirtschaft
die Berufslehre zu attraktivieren. Dabei bin ich überzeugt, dass das neue Berufsbildungsgesetz, das im Herbst
zur Beratung in unseren Rat kommt, auch wesentlich zur allgemeinen Attraktivierung der Berufslehre beitragen
wird. Dieser Weg ist langfristig zu gehen. Es ist keine Sofortmassnahme, aber es ist ein Weg mit nachhaltiger
Wirkung.
Nach diesem Tour d'horizon komme ich zum Kern, zum ICT-Umschulungsgesetz und zu drei grundsätzlichen
Überlegungen, weshalb ich empfehle, nicht auf die Vorlage einzutreten:
1. Es ist unbestritten: Die Wirtschaft braucht gut ausgebildete Informatiker. Aber ich betone nochmals: nicht
nur Informatiker, sondern auch andere Fachkräfte. Ein Grossteil der Wirtschaftsvertreter – ich spreche von
der überwiegenden Zahl der Swissmem-Mitgliedfirmen und von der überwiegenden Zahl der Mitgliedorganisa-
tionen des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes – befürchtet, dass mit dem geplanten ICT-Umschulungs-
gesetz und seinen Umschulungsanreizen Berufsleute aus anderen Branchen abgeworben werden, die dort
ebenso notwendig sind und die dann ebenfalls fehlen.
Es ist erstaunlich, dass Kollegin Riklin besser weiss, was die Wirtschaft braucht, und die Wirtschaftsvertreter
scheinbar intellektuell etwas unterentwickelt sind und die Lage falsch beurteilen. Mich erstaunen Ihre Behaup-
tungen, Frau Riklin, und mich erstaunt, dass Sie den Eindruck haben, den Durchblick zu haben.
2. Heute fehlen uns die erforderlichen Grundlagen um entscheiden zu können, welche Art von Informatik vor
allem fehlt. Sind es die Software-Ingenieure oder sind es Leute im berufsspezifisch angewandten Informatik-
bereich? Denn heute ist in vielen Lehrberufen die angewandte Informatik bereits eingebaut.
3. Der Einbruch der New-Economy-Euphorie dämpft bereits den Druck auf den Informatikermarkt. Wir hören
von Stellenabbau, auch bei den Software-Ingenieuren, sei es bei Miracle, Ascom oder – die neueste Meldung
– bei der Cablecom-Tochter Swissonline, um nur einige Beispiele zu nennen. Das sind neue und neueste
Meldungen, die erst nach dem Begehren, eine ICT-Umschulungs-Initiative zu lancieren, bekannt wurden. Das
heisst, mit diesem Gesetz kommen wir – wie so oft bei staatlichen Interventionen – zu spät.
Nun noch eine Bemerkung zum Gesetz im Speziellen, insbesondere zur Prüfstelle: Erhebung der Bedürfnisse,
Entwicklung von Bildungsmodulen, Prüfung der Eignung von Personen, die eine Bildung durchlaufen wollen,
Koordination und Verteilung der finanziellen Mittel – dies alles soll eine Prüfstelle vornehmen. Diese Prüfstelle
ist bereits bestimmt. Es ist die Informatik Berufsbildung Schweiz mit dem Kürzel I-CH. Diese I-CH erhält 20
Prozent der gesamten Summe von 100 Millionen Franken zugesprochen, die restlichen 80 Millionen Franken
stehen dann für die eigentliche Bildungstätigkeit zugunsten Erwachsener zur Verfügung.
In der Botschaft ist bereits heute stipuliert, dass allfällige Kürzungen des Gesamtkredites nur zulasten dieser
80 Millionen Franken gehen dürften; die 20 Millionen Franken sind somit fest zugesichert. Ein solcher Admini-
strativkostenblock scheint mir sehr hoch – zu hoch –, insbesondere deshalb, weil diese Organisation bereits
Gelder erhält, gestützt auf den Lehrstellenbeschluss II, mit dem auch Informatikprojekte unterstützt werden.
Gewisse Doppelspurigkeiten sind hier vorhanden.
Aus all diesen Gründen beantrage ich Ihnen auch im Namen der Mehrheit der FDP-Fraktion, den Antrag
der Minderheit der Kommission zu unterstützen und auf die Vorlage nicht einzutreten. Wenn wir schon 100
Millionen Franken für die Ausbildung im Informatikbereich ausgeben wollen, wäre dieses Geld für die ICT-
Ausbildung von Lehrpersonen und damit für künftige Schüler zu verwenden. Die 100 Millionen Franken wären
so wesentlich effizienter eingesetzt.
Theiler Georges (R, LU): Im Namen einer guten Minderheit der FDP-Fraktion stelle ich Ihnen den Antrag,
diesem Gesetz zuzustimmen, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen.
Ich kann die jetzt geäusserten ordnungspolitischen Bedenken durchaus sehr gut verstehen. Aber Ordnungs-
politik ist immer nur eine Richtlinie, und es gibt Situationen, in denen man mit gutem Recht gezwungen ist, von
dieser Richtlinie für kurze Zeit abzuweichen – in diesem Fall für fünf Jahre. Die Ausgangslage ist doch folgen-
de: Wir stehen am Eingang zu einer neuen Gesellschaft; die Informationsgesellschaft wird uns alle verändern.
Wir befinden uns in einer rasanten Entwicklung und haben auch vom Staat her die Aufgabe, die Gesellschaft in
15.07.2022 6/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
dieser schwierigen Situation zu begleiten und flankierende Massnahmen zu treffen. Wo sollen wir denn diese
Massnahmen vor allem treffen, wenn nicht in diesem Weiter- und Ausbildungsbereich?
Herr Pfister hat behauptet, das sei alles längst überholt und unnötig, die New Economy sei bereits gestorben.
Ich gehe nicht davon aus, dass wir dieses Gesetz für die New Economy erlassen, Herr Pfister. Wenn wir dieses
Gesetz erlassen, dann tun wir das vor allem auch für die KMU, für die Kleinbetriebe. Es besteht zurzeit ein
Mangel an 10 000 Informatikern. Die Statistik sei nicht abschliessend, sagte man uns in der Kommission. Das
mag stimmen, aber dann frage ich mich, wozu wir so viele Statistiker haben. Es ist doch eine Tatsache: Wenn
Sie heute als Kleinunternehmer einen Informatiker brauchen, bezahlen Sie diesem einen Honoraransatz von
250 bis 350 Franken pro Stunde. Das ist für mich der beste Beweis, dass etwas nicht stimmen kann und dass
wir hier einen Mangel haben. Deshalb habe ich schon im
AB 2001 N 851 / BO 2001 N 851
Jahr 1998 einen Vorstoss eingereicht; 1999 habe ich nachgedoppelt. Jetzt endlich ist etwas Wind in die Sache
gekommen, steter Tropfen höhlt den Stein.
Ich danke der WBK und ihrem Präsidenten, dass sie dieses Anliegen aufgenommen und selber einen guten
Entwurf ausgearbeitet haben.
Ich lege Wert darauf zu betonen, dass die Ausarbeitung des Gesetzes und die Umsetzung in enger Zusam-
menarbeit mit der Wirtschaft erfolgte bzw. zu erfolgen hat. Warum? Das Tempo, mit dem wir uns bewegen, ist
sehr hoch. Wir können nicht warten, bis die nächste Generation mit einer guten Ausbildung bereit ist und uns
in der Wirtschaft unterstützt. Die Ausbildung – auch darauf lege ich grossen Wert – hat praxisbezogen zu sein;
es soll eine Ausbildung in der Praxis und für die Praxis sein.
In finanzpolitischer Hinsicht limitieren wir dieses Gesetz auf 100 Millionen Franken und auf fünf Jahre. In
diesem Saal haben wir praktisch noch kein Gesetz verabschiedet, bei dem in dieser Hinsicht klare Limiten,
eine zeitliche und eine betragliche Begrenzung, gesetzt worden sind; das ist einmalig und auch positiv.
Es geht hier nicht darum, nun eine einzelne Branche zu fördern. Es geht darum, in der Breite jene Leute
auszubilden, weiterzubilden, welche wir alle in allen Branchen der Wirtschaft brauchen. In Schweden hat man
mit diesem Modell sehr gute Erfahrungen gemacht, in einem oder zwei Jahren wurden zehntausend Leute
ausgebildet; das Programm wird fortgesetzt.
Jetzt noch zur Haltung des Bundesrates: Ich kann verstehen, dass man an diesen 100 Millionen Franken keine
Freude hat. Ich habe aber etwas Mühe zu verstehen, dass man im Jahr 1998 ein Papier "Strategie des Bundes-
rates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz" herausgeben und in Ziffer 31, Bildungsoffensive, sagen
kann: "Besondere Aufmerksamkeit ist Angeboten für Erwachsene zu widmen. Die Bildungsoffensive erfordert
zusätzliche Mittel und bedingt eine enge Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Privatwirtschaft."
Das hat der Bundesrat so geschrieben. Ich bin der Meinung, jetzt sollten wir das umsetzen; dieses Gesetz ist
die beste Möglichkeit und der beste Weg dazu.
Ich bitte Sie, dem Gesetzentwurf der WBK zuzustimmen; er ist notwendig, zielgerichtet und wirtschaftsfreund-
lich.
Chappuis Liliane (S, FR): Dans mon intervention, je vais me référer aux rapports des 14 avril 1999 et 16 mai
2000 du groupe interdépartemental de coordination "Société de l'information", qui ont été approuvés par le
Conseil fédéral.
L'utilisation des technologies de l'information et de la communication modifie considérablement l'économie et
le travail dans les petites et moyennes entreprises, tout en influençant durablement l'évolution de la société. La
connaissance est l'une des principales ressources de notre économie nationale, et les services liés au savoir
constituent un facteur déterminant pour la prospérité de la place économique suisse. Le niveau de qualification
de l'ensemble de la population, à savoir l'égalité des chances également pour les personnes défavorisées sur
le plan financier, en rapport avec les technologies de l'information et de la communication, est l'un des plus
grands défis de ces prochaines années.
L'économie, "new economy", et les changements politiques qui se profilent, gouvernement électronique, sup-
posent que les citoyens soient formés dans le domaine du numérique. Il convient en outre de lutter contre
l'apparition d'une société à deux vitesses au moyen d'un système de formation dynamique et novateur. Sur ce
plan-là, il appartient à la Confédération de donner des impulsions et de lancer des programmes ciblés.
Le problème le plus important est d'éviter qu'apparaisse à long terme une fracture dans la société entre les
initiés et les non-initiés. C'est donc dans le domaine de la formation qu'il faut agir en priorité, non seulement
auprès des écoles de tous niveaux, du corps enseignant et des décideurs, mais aussi auprès des institutions
de formation pour adultes. Le plus grand défi consistera à mobiliser les catégories d'individus se situant en
15.07.2022 7/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
dehors des circuits de formation classiques.
Les technologies de l'information et de la communication et particulièrement Internet ont radicalement modifié
notre société. C'est la raison pour laquelle l'avenir de la Suisse, dont l'économie nationale est très développée,
dépend fortement de notre capacité à intégrer de façon dynamique cette transition vers la société de l'infor-
mation et du savoir. Une condition essentielle pour y parvenir est la formation de la population dans toutes
les catégories de prestations et dans tous les groupes sociaux. Il s'agit d'un défi de taille pour le système de
formation qui doit être adapté en priorité.
Le taux de croissance parfois vertigineux enregistré dans le domaine de l'informatique et des télécommunica-
tions a pour conséquence que le marché du travail manque cruellement de spécialistes en informatique et dans
les professions avoisinantes. Ce manque est estimé aujourd'hui entre 10 000 et 20 000 personnes qualifiées.
A cet égard, il importe de fournir de nouvelles possibilités de formation et de perfectionnement professionnels.
La comparaison avec les programmes de formation d'autres Etats européens, dont les budgets s'élèvent à
plusieurs milliards de francs, montre qu'il est urgent de s'attaquer à cette question. La Suisse doit affirmer sa
position de force au sein d'une concurrence internationale de plus en plus aiguë en matière de formation et de
qualification par des actions autonomes et par des innovations dans le domaine de la formation.
Force est de constater que beaucoup d'entreprises, qui auraient dû et qui devraient faire un effort conséquent
pour améliorer les compétences de leur personnel, choisissent souvent de licencier ce personnel qui n'est pas
apte à remplir de nouvelles tâches, pour engager des personnes qui correspondent à ces nouvelles fonctions.
Ce comportement est souvent dû au fait que les PME ne sont pas à même de supporter financièrement la
reconversion professionnelle de leurs employés.
Le projet de loi qui nous est soumis propose, pour une durée limitée, de subventionner des formations de base
et des formations continues axées sur la demande afin de combler le manque de spécialistes dans le domaine
des technologies de l'information et de la communication. Cette loi s'adresse aux adultes, qui doivent changer
de profession pour pouvoir assurer leur avenir professionnel, car la profession qu'ils ont acquise n'existe plus
ou a subi de telles transformations qu'il ne leur est plus possible de trouver un emploi sans suivre une formation
complémentaire ou une nouvelle formation. La loi a aussi pour but de donner de nouvelles compétences aux
personnes dont l'emploi est menacé par les réformes au sein de leur entreprise, si cette entreprise n'est pas à
même d'assurer financièrement la reconversion de son personnel.
Les mesures proposées doivent également permettre aux femmes de réintégrer le monde du travail, car au
moment où elles ont laissé leur travail pour s'occuper de leur famille, les entreprises étaient encore équipées de
machines à écrire. Le monde du travail et les tâches ont tellement évolué qu'il est tout simplement impossible
pour ces femmes de retrouver un travail sans suivre une véritable formation sur l'utilisation des technologies
de l'information et de la communication, ainsi que sur les nouvelles méthodes de travail. Enfin, la loi ne crée
pas de nouvelles structures de formation mais, par un système novateur – le bon de formation –, elle permet
aux personnes concernées d'utiliser ces bons dans les instituts de formation existants.
Convaincu que cette loi répond à une réelle nécessité en cette période de mutation de notre société, le groupe
socialiste vous demande de la soutenir.
Strahm Rudolf (S, BE): Die SP-Fraktion steht geschlossen hinter dieser Vorlage. Sie soll den Strukturwandel
in der Wirtschaft absichern und technologie- und berufsbildungspolitisch flankieren.
Wozu dienen die 100 Millionen Franken für vier Jahre? Es gibt kaum eine Berufsbildungsvorlage, die der Pra-
xis und
AB 2001 N 852 / BO 2001 N 852
der Wirtschaft näher ist als diese hier. Berufsleute sollen berufsbegleitend auf die neuen Technologien im Infor-
matik- und Kommunikationsbereich umgeschult werden – berufsbegleitend! Der Bund bezahlt nicht die Leute,
die das absolvieren, sondern er bezahlt die Entwicklungskosten, die Bildungsmodule, die sehr teuer sind. Der
Bund bezahlt die Kosten für die branchen- und berufsspezifische Entwicklung dieser Kurse. Dieses Programm
ist KMU-orientiert, und es ist wirtschaftsorientiert.
Was bezahlt der Bund? Der Bund bezahlt Leuten, die aus der Praxis kommen und als Kursausbildner und
-lehrer beschäftigt werden, einen Teil des Salärs. Wir haben in den Hearings gehört: Um einen Informatiks-
pezialisten aus der Wirtschaft zu engagieren, muss man 1500 bis 2000 Franken pro Tag rechnen – pro Tag!
Das kann sich keine Schule leisten, aber wir wollten eben gerade praxisorientierte Leute tageweise in die Kur-
se und in die Schulen holen. Der Bund müsste diese Differenz bezahlen. Die Schulen könnten das gar nicht
bezahlen.
Es sind auch Spezialprogramme vorgesehen, um Frauen in die Informatikberufe zu holen. Bei uns sind 6 Pro-
15.07.2022 8/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
zent des Informatikpersonals Frauen, in den USA sind es 50 Prozent; da gibt es ein Rekrutierungspotenzial.
Der Einsatz der Mittel sollte praxisorientiert sein, unter der Obhut von "I-CH Informatik Berufsbildung Schweiz",
der Dachorganisation aller betroffenen Verbände; der Schweizer Automatikpool sowie die Informatik- und Te-
lekomverbände sind dort vereinigt.
Noch ein Vorteil: Der Bund hätte die Möglichkeit, durch Zertifizierungen den Wirrwarr im Weiterbildungsbereich
der Informatik endlich zu beheben.
Wir haben in der Subkommission zwei Tage lang Hearings mit Leuten aus allen Branchen durchgeführt. Mit
Ausnahme einer Person waren alle dafür. Die Ausnahme war Herr Peter Hasler, Direktor des Schweizerischen
Arbeitgeberverbandes. Er hat nicht fachlich, sondern nur ordnungspolitisch argumentiert. Es geht nicht darum,
jetzt irgendwie konjunkturpolitisch zu reagieren. Es geht auch nicht darum, Leute für Softwareunternehmen wie
Think Tools oder Miracle bereitzustellen. Der Strukturwandel läuft quer durch alle Branchen. Es geht darum,
die Leute aus den Branchen berufsbegleitend und mit On-the-Job-Training umzuschulen. Es geht nicht darum,
nur eine Branche zu fördern.
Zu den Einwänden: Der Bundesrat sagt jetzt: Aus ordnungspolitischen Gründen sind wir dagegen. Herr Bun-
desrat Couchepin, ich führte auch Gespräche mit Ihren neoliberalen Stabsmitarbeitern. Ich fand es erschreckend,
einfach die ordnungspolitische Litanei zu hören, aber kaum praxisorientierte Argumente. Ein Argument, das
hier jetzt z. B. auch von Frau Bangerter angetönt wurde, muss Sie aber hellhörig und skeptisch machen: Es
gibt Unternehmer, die sagen, sie hätten Angst, dass man ihnen die Leute abzieht, wenn man sie fragt, ob sie
diese Umschulung brauchen. Ich habe Verständnis für dieses Argument, aber es ist ein Argument der Struk-
turerhaltung. Es geht nämlich darum, dass der Unternehmer seine Leute lieber nicht ausbilden lassen will, weil
er Angst hat, sie würden die Stelle wechseln.
Sie sprechen immer von Strukturwandel, von Mobilität. Nun kommt eine Vorlage, die den Strukturwandel und
die Mobilität begleitet, und plötzlich sagt man: Wir wollen unsere Leute nicht ausbilden, sonst gehen sie weg.
Das ist ein gefährliches Argument.
Zum Schluss dies, Herr Bundesrat: Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass wir auf dem Weg zur Informationsgesell-
schaft im Rückstand sind? An der grössten europäischen Messe für Informatik, an der Cebit in Deutschland,
war die Schweiz nur mit wenig Unternehmen, z. B. der Ascom, vertreten. Hunderte von deutschen Firmen
waren dort.
Ich muss Sie fragen: Wo ist eigentlich Ihre Vision? Sagen Sie einmal auch der Wirtschaft, in welche Richtung
Sie gehen wollen. Sie haben vor drei Jahren den Bericht über die Strategie des Bundesrates für eine Informati-
onsgesellschaft in der Schweiz publiziert. Seither, Herr Bundesrat, ist nichts geschehen. Sie kommen jetzt mit
dem Programm "Schulen ans Netz". Das ist nicht falsch, es nützt wohl der Kommerzialisierung in den Schulen,
aber es ersetzt das Programm für die Begleitung des Strukturwandels, über das wir heute diskutieren, nicht.
Ich bitte Sie, diese Vorlage zu unterstützen. Es ist ein Testfall dafür, ob man den Strukturwandel auch berufs-
bildungspolitisch begleiten will.
Christen Yves (R, VD), pour la commission: Après les propos tenus par les auteurs des trois initiatives par-
lementaires – Mme Simoneschi, MM. Strahm et Theiler –, on n'aurait finalement pas grand-chose à rajouter.
Mais, j'aimerais tout de même donner quelques informations sur le travail de la commission. Mme Riklin a été
surprise de l'attitude des membres du groupe de l'Union démocratique du centre. Mais je dois dire que MM.
Wandfluh et Pfister Theophil ont joué le jeu loyalement dans la sous-commission et ils ont d'emblée fait part
de leur scepticisme quant au projet, tout en essayant de trouver des solutions. Cela a été exprimé ainsi tout à
l'heure.
Que dire par contre de l'attitude de M. Scheurer qui avait bien caché son jeu? J'ai de la peine à accepter
le syndrome du pont de la rivière Kwaï, vous savez, cette histoire d'un officier anglais fou qui a finalement
voulu jouer contre son propre camp en acceptant d'assouvir ses objectifs personnels et de construire le pont.
Alors, si c'est pour remercier la commission ou la sous-commission d'avoir fait son travail que vous deviez
accepter cette loi, je vous conseillerais de ne pas le faire. Ce n'est pas de ce syndrome dont ont été victimes
la commission et son président!
Un mot encore: je constate qu'on a souvent un peu mal compris à quoi servait cette loi. Ce n'est évidemment
pas seulement pour les informaticiens ou les spécialistes des nouvelles technologies de l'information et de la
communication, mais pour l'ensemble de l'économie. Et peut-être aurions-nous pu trouver un autre titre. Il s'agit
de mesures de reconversion pour les métiers confrontés aux mutations dues aux technologies numériques.
C'est donc l'ensemble des métiers.
Quand M. Kunz nous donne une statistique des places ouvertes, "der offenen Stellen": Herr Kunz, "3600 offene
Stellen" haben Sie gesagt. Das ist klar, Sie haben recht, es gibt ja nur ein paar Hundert Reininformatiker, aber
15.07.2022 9/15AMTLICHES BULLETIN – BULLETIN OFFICIEL
Nationalrat • Sommersession 2001 • Dreizehnte Sitzung • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
Conseil national • Session d’été 2001 • Treizième séance • 20.06.01 • 15h00 • 01.419
alle oder fast alle brauchen Umschulung, die 3600 brauchen Umschulung. Und das ist das Ziel des Gesetzes.
Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et puis, pour terminer: nous ne prenons pas un grand risque financier et
nous serions coupables de ne pas le prendre, ce risque. Car si on devait manquer la révolution numérique qui
touche toute la société, civile et économique, alors cela pourrait nous coûter plus cher.
Je vous invite donc à entrer en matière et à accepter cette loi.
Scheurer Rémy (L, NE): En deux mots: le rapporteur de langue française dit que j'ai caché mon jeu. Ce n'est
pas le cas. J'ai toujours manifesté les plus grandes réserves en commission à l'égard de ce projet. J'ai voté
contre ce projet et je revendique aussi la loyauté, parce qu'il y a beaucoup de faiblesses formelles que j'ai fait
corriger, et c'est même à mon instigation que ce texte a été soumis à la Chancellerie fédérale. Car dans la
forme où il était, il n'aurait pas été recevable du tout.
Quant au syndrome du pont de la rivière Kwaï, je l'ai mentionné avec des restrictions qui étaient claires. J'ai
seulement parlé de l'affection que quelqu'un porte à l'objet qu'il a créé et qui, à un certain moment, a tellement
d'affection pour cet objet qu'il en oublie ce qu'il pourrait devenir s'il est encore utile. Je ne vous ai jamais
suspecté d'être un officier britannique qui manquait de clairvoyance face aux Japonais, mon cher collègue!
Widmer Hans (S, LU), für die Kommission: Die Angst ist meistens ein schlechter Berater, und der Neid ist
meistens ebenfalls schlecht. Beide – Angst und Neid – haben ganz stark aus den Voten der Gegner heraus-
geklungen. Sie
AB 2001 N 853 / BO 2001 N 853
haben Angst, man würde Leute abziehen, und Sie sind eigentlich neidisch auf jene, die dann vielleicht Erfolg
haben. Wir haben deutlich gesagt: Jedes Unternehmen kann letztlich profitieren, wenn es Leute ausbildet,
ausbilden lässt oder als Ausbildner zur Verfügung stellt. Diese Zusammenhänge müssen Sie sehen. Ich kann
schon verstehen, dass die Leute von der Economiesuisse dagegen sind. Dort sind vor allem die Mächtigen
organisiert; sie können ohne ICT-Technologien leben. In diesem Zusammenhang überhaupt nicht verstehen
kann ich den Schweizerischen Gewerbeverband und die kleineren Unternehmen, die wirklich profitieren könn-
ten.
Ich bitte Sie, sich von einer Vision eines hohen Sockels an Wissen in ICT-Technologien leiten zu lassen und
nicht von einer kleinkarierten Angst. Stimmen Sie dem Antrag der Kommission zu!
Couchepin Pascal (, ): Comme vous l'avez entendu, le Conseil fédéral recommande de rejeter ce projet
de loi et d'accepter la proposition de non-entrée en matière de la minorité de la commission. Au moment
où on doit justifier cette position, il est bon de s'arrêter quelques instants sur le fameux besoin invoqué de
manière quasi systématique par tous les orateurs qui se sont exprimés en faveur de cette initiative. De combien
d'informaticiens supplémentaires a-t-on besoin en Suisse? Du côté des partisans de cette initiative, tout le
monde a dit que la chose était tellement évidente qu'il n'y avait pas besoin de faire d'enquête supplémentaire.
Tous ceux qui se sont exprimés ont dit qu'on manquait d'informaticiens en Suisse.
Si vous me permettez d'élargir un peu le problème, posez la question à tous les producteurs de tabac de
la Broye. Ils vous diront qu'il manque des travailleurs dans le domaine du tabac et qu'ils ont besoin d'un
certain nombre, de centaines voire de milliers de travailleurs dans les cultures de tabac. L'addition des besoins
respectifs de toutes les entreprises fait qu'on peut publier un chiffre: il manque environ 5000, 10 000 ,15 000
ou 20 000 travailleurs dans l'agriculture. Prenons un autre exemple qui me convainc davantage. Vous avez une
population scolaire de 1000 élèves et, politiquement, vous avez décidé qu'aucune classe ne doit avoir plus de
20 élèves. Eh bien, c'est simple, vous avez besoin de 50 instituteurs. S'il n'y en a que 45, il en manque 5. Et
là, les choses sont tout à fait claires et simples.
Revenons à l'informatique. En réalité, le manque d'informaticiens, c'est l'addition de besoins relatifs. Vous
interrogez une entreprise et vous lui demandez si elle a besoin d'un informaticien. La réponse c'est: "Oui, j'ai
besoin d'un informaticien que je veux payer 3500, 4000 ou 4500 francs." Vous dites: "Mais si vous payez 5000
francs, est-ce que vous le trouvez?" La réponse est: "Oui, mais je ne veux pas payer 5000 francs, je suis
prêt à payer 4000 ou 4500 francs pour cet informaticien." Vous demandez au propriétaire d'une exploitation
de tabac de la Broye: "Si vous payez 4000 francs par ouvrier, est-ce que vous les trouverez?" La réponse est
évidemment: "Oui, mais je ne veux pas payer 4000 francs." Donc, la notion de besoin de personnel est une
notion relative.
Vous ne pouvez pas additionner des besoins relatifs et en faire un besoin absolu, comme ce serait le cas si vous
décidez que, pour chaque groupe de 20 élèves, il faut un instituteur; là, les choses sont claires. Finalement, le
manque d'informaticiens est fonction d'un certain salaire qu'on est prêt à donner. Si une entreprise qui prétend
15.07.2022 10/15Sie können auch lesen