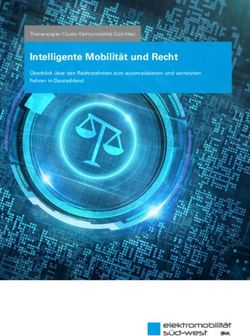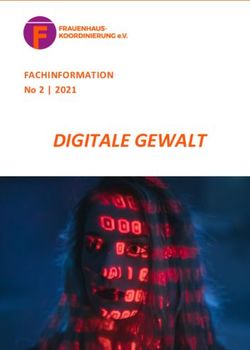Armutssensibles Handeln in Kindertageseinrichtungen - Zwischenergebnisse und Impulse aus dem Modellprojekt "Zukunft früh sichern!" - RAG ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Armutssensibles Handeln in Kindertageseinrichtungen Zwischenergebnisse und Impulse aus dem Modellprojekt „Zukunft früh sichern!“ Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. (Hrsg.)
Wir danken der RAG-Stiftung für die Förderung der wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation des Modellprojekts „Zukunft früh sichern!“ und die Unterstützung bei der Erstellung der vorliegenden Handreichung.
Armutssensibles Handeln
in Kindertageseinrichtungen
Zwischenergebnisse und Impulse aus dem
Modellprojekt „Zukunft früh sichern!“
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V.Inhalt
Zusammenfassung 7
1 Einleitung 11
2 Kernelemente des Modellprojekts:
Projektarchitektur, Ziele, Ansätze und Methoden 15
3 Strategische Bedeutung und praktische Umsetzung
des Modellprojekts aus Sicht der Projektbeteiligten 21
4 Zentrale Befunde zur Ausgangslage im Modellprojekt:
Wie entwickeln sich (arme) Kinder im Alter von vier Jahren? 27
5 Armutssensibles Handeln in der Kita-Praxis:
Theoretische Rahmung 39
6 Armutssensibles Handeln im Rahmen des Modellprojekts:
Tipps aus der Praxis 45
6.1 Armutssensible Ansätze zur Steigerung der Prozessqualität 46
6.2 Die materielle und soziale Teilhabe 51
6.3 Die kulturelle Teilhabe 53
6.4 Die gesundheitliche Lage 55
Literaturhinweise 57
Anlagen 60
Anlage 1: Elternfragebogen des ISS-Frankfurt a. M. 61
Anlage 2: Mehrsprachige Bilderbücher 65
Anlage 3: Fragebogen zur Bestandsaufnahme zum Übergang
von der Kita in die Grundschule 67
Anlage 4: Fallbesprechung nach dem Modell der vier Lebenslagen 68
Anlage 5: Vorlage der Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung
zu Kinderinterview 69
Anlage 6: Entwicklungsmonitoring 70
Anlage 7: Bücher zur Resilienzförderung 76
Impressum 78Zusammenfassung
Ückendorf ist ein sozial hoch belasteter Stadtteil mutskonzept der AWO-ISS Langzeitstudie werden
der Stadt Gelsenkirchen. Im Rahmen des Modell- im Projekt auch die persönlichen Lebenslagen der
projekts „ZUSi – Zukunft früh sichern!“ wird dort Kinder in vier Dimensionen – materielle, kultu-
seit April 2019 in sieben städtischen Kindertages- relle, soziale und gesundheitliche Lage – in die
einrichtungen (Träger GeKita-Gelsenkirchener Analyse einbezogen. Für jedes Kind werden nach
Kindertagesbetreuung) konzeptionell fundiert dem „Lebenslagenmodell“ sowie auf Grundlage
erprobt, armutssensible frühe Bildung zu gestal- des „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters“ (ein
ten. Das Ziel lautet, jedem Kind – unabhängig von in Gelsenkirchen eingeführtes Bewertungs- und
sozialer Herkunft und finanziellen Ressourcen der Begleitungsmodell in der frühen Bildung) in Fall-
Eltern – eine gesunde altersgemäße Entwicklung, besprechungen Informationen zusammengetragen.
soziale Teilhabe und das Recht auf qualitative Bil- Dabei kommen die Perspektiven und Kompe-
dung von den ersten Lebensjahren an zu gewähr- tenzen aller Beteiligter zusammen: die der Erzie-
leisten. Dabei stehen die individuellen Stärken und her*innen und Bildungsbegleiter*innen ebenso wie
Talente der Kinder im Fokus. Das Modellprojekt die der Eltern und der Kinder selbst. Diese Ana-
wird von der RAG-Stiftung finanziert und vom lyse ist die Grundlage für die individuelle Förde-
Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e. V. rung der Kinder durch bedarfsgerechte Angebote.
wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Bildungsbegleiter*innen haben die Aufgabe, die
Kinder in ihren Stärken und Schwächen gezielt zu
»Das Modellprojekt fördern, damit allen Kindern der Übergang in die
nimmt jedes Kind mit Grundschule und am besten auch eine lückenlose
seinen Stärken, Förder- Bildungsbiografie gelingt. Die Eltern sollen für die
bedarfen und seiner
Stärken ihrer Kinder sensibilisiert und zur Förde-
Lebenslage in einen
rung der Kinder aktiviert werden.
individuellen Blick.«
Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung
Das Modellprojekt nimmt jedes Kind mit seinen erhalten die am Projekt beteiligten Fachkräfte pra-
Stärken, Förderbedarfen und seiner Lebenslage in xisrelevante Impulse aus der Forschung und ande-
einen individuellen Blick. Dies und die Umsetzung ren Modellprojekten und werden darin begleitet,
einer passgenauen, individuellen Förderung eines ihre Haltung zu reflektieren und Aktivitäten ziel-
jeden Kindes erfolgt im Zusammenspiel multi- gerichtet zu planen und umzusetzen. Der Fokus
professioneller Teams. Im Modellprojekt unter- liegt dabei auf der Entwicklung und Verankerung
stützen sieben Bildungsbegleiter*innen die Arbeit von Armutssensibilität als ein Aspekt der Prozess-
der pädagogischen Fachkräfte in den sieben Kin- qualität in den Kindertageseinrichtungen. Konkret
dertagesstätten, indem sie an der konzeptionel- handelt es sich um die Wissensvermittlung zu den
len Entwicklung von Angeboten mitarbeiten und Folgen von Kinderarmut zur Vermeidung von Stig-
diese Aktivitäten mit den Kindern durchführen. matisierungen und zur armutssensiblen Gestaltung
Eine Projektkoordinatorin begleitet die Teams in der Angebote für Kinder. Somit werden die Fach-
den sieben Kitas und vernetzt diese im Sozialraum kräfte sensibilisiert, in ihrer Haltung gestärkt und
mit weiteren Akteur*innen wie der Musikschule, darin unterstützt, die Erkenntnisse aus diesem Pro-
Sportvereinen, weiteren Bildungseinrichtungen zess in praktische Handlungen zu überführen und
sowie Künstler*innen. armutsbedingte Barrieren abzubauen.
In Gelsenkirchen werden bereits seit mehreren Der Schwerpunkt der Evaluation liegt in der
Jahren die Entwicklungsfortschritte von Kindern Überprüfung der Wirksamkeit des Modellprojekts.
ab dem Eintritt in die Kita und bis zum Übergang Es geht also um die Fragestellung, inwieweit das
in die Grundschule systematisch erfasst. Der im Projekt einen positiven Einfluss auf die Entwick-
Modellprojekt verfolgte Ansatz geht über diese lung der Kinder bis zum Übergang in die Grund-
Erfassung hinaus. Angelehnt an das Kinderar- schule nimmt.
7Methodologisch ist die Evaluation als Längs- – erfasst. Von einer altersgemäßen Entwicklung
schnittuntersuchung mit einer Vergleichsgruppe wird dann ausgegangen, wenn Kinder 100 % der
angelegt. Die Projekterkenntnisse werden diffe- für ihr Alter relevanten Aufgaben lösen können.
renziert nach Kindern aus armen und nicht armen Werden die erreichten Entwicklungsniveaus der
Familien ausgewertet und zeitnah nach der Daten- Kinder im Modellprojekt differenziert für arme
erhebung zurück an die Projektbeteiligten gespie- und nicht arme Kinder untersucht, so lassen sich
gelt. Somit werden die Daten nicht nur zum Zweck große Differenzen feststellen: Im Durchschnitt
der Erfolgskontrolle generiert, sondern fließen in erreichten die nicht armen Kinder rund 70 %
die Ausgestaltung der Projektaktivitäten ein. Die und die armen Kinder nur 50 % des altersgemä-
ersten Analyseschritte beziehen sich auf die Aus- ßen Entwicklungsniveaus. E ntwicklungsdefizite
gangslage der vierjährigen Kinder, die als Zielgrup- traten bei den armen Kindern in allen fünf
pe des Modellprojekts im Fokus der Evaluation ste- Dimensionen auf. Diese Defizite waren in den
hen. Die Befunde verdeutlichten den Nutzen einer Dimensionen Sprache und Feinmotorik aller-
individuellen Fallbesprechung unter Berücksichti- dings besonders stark ausgeprägt.
gung der Lebenslagen der Kinder. Infolge einer dif-
ferenzierten Analyse der Entwicklungsniveaus der • Die Entwicklungschancen der Kinder werden
Kinder konnten die Handlungsbedarfe in fünf zen- stärker von der Gesamtlebenslage als von der
tralen Entwicklungsbereichen der Kinder konkre- materiellen Armut im Sinne von einem Mangel
tisiert werden. Zudem konnte auf Basis der ersten an Geld bestimmt. Am besten entwickeln sich
Forschungsergebnisse die Gestaltung der Angebote die Kinder, die in nicht armen Familien und im
unter Berücksichtigung der Stärken und Schwä- Lebenslagentyp „Wohlergehen“2 aufwachsen. Sie
chen der Kinder sowie der Wünsche der Eltern erreichten im Schnitt 83 % des altersgemäßen
bedarfsgerecht fortentwickelt werden. Die zentralen Entwicklungsniveaus. Die armen Kinder, die
Erkenntnisse zur Ausgangslage der Projektkinder im Lebenslagentyp „Wohlergehen“ aufwachsen,
lassen sich wie folgt zusammenfassen: erreichen immerhin 66 % des altersgemäßen
Entwicklungsniveaus. Dies ist ein deutlich bes-
• Bei der Zielgruppe des Modellprojekts handelt es seres Ergebnis als bei den armen Kindern, die in
sich um 136 Kinder, die zum Start des Projekts den Lebenslagentypen „Benachteiligung“ und
im Jahr 2019 vier Jahre alt waren und im Jahr „multiple Deprivation“ aufwachsen, denn diese
2021 eingeschult werden. Rund 60 % der Kinder erreichen lediglich 51 % bzw. 41 % des altersge-
wachsen in armen Familien auf, das heißt, dass mäßen Entwicklungsniveaus.
diese Familien auf Transferleistungen der Min-
destgrundsicherung angewiesen sind. • Auch eine Talentförderung im Bereich der frü-
hen Bildung bedarf eines scharfen armutssensi-
• Armut ist ein bekannter Risikofaktor für die Ent- blen Blicks auf die Kinder. Von Armut betroffene
wicklung der Kinder und lässt sich in der vorlie- Eltern sehen die Talente ihrer Kinder eher in den
genden Untersuchung quantifizieren. Die armen Bereichen Sport und Soziales. Einkommens-
Kinder werden im Vergleich zu den nicht armen stärkere Eltern verorten die Talente ihrer Kinder
Kindern institutionell um sechs Monate kürzer hingegen eher in den Bereichen logisches Den-
(24 Monate vs. 18 Monate) und häufiger nur bis ken und Kunst. Begabungen der Kinder wer-
25 Stunden pro Woche institutionell betreut. den allerdings erst dann entdeckt, wenn Kinder
Ihre Entwicklung ist bereits in den ersten vier überhaupt eine Chance bekommen, etwas Neues
Lebensjahren von Einschränkungen, Defiziten auszuprobieren und Spaß an bestimmten Tätig-
und Benachteiligungen geprägt. keiten zu entwickeln. Daher ist es insbesondere
für arme Kinder kaum möglich, ohne externe
• Ob und inwiefern sich die Kinder altersgemäß Unterstützung über den Tellerrand der familiä-
entwickeln, wird mithilfe des „Gelsenkirchener ren Möglichkeiten zu schauen.
Entwicklungsbegleiters“ dokumentiert.1 Dabei
werden die Kompetenzen der Kinder in fünf
Dimensionen – Sprache, kognitive Entwicklung,
soziale Kompetenzen, Grob- und Feinmotorik
8• Die finanziellen Einschränkungen der Fami-
lien sind gravierend und betreffen grundlegen-
de materielle Güter: Zwei Drittel der armutsbe-
troffenen Eltern wünschen sich für ihre Kinder
eine bessere Teilhabe an soziokulturellen und
gesundheitsfördernden Angeboten. Jede vierte
arme Familie sieht sich mit Spielsachen, Bastel-/
Schreibmaterialien, Fahrzeugen (Fahrrad/Drei-
rad) und Sportartikeln (Sportschuhe, Bälle, Hel-
me) nur unzureichend ausgestattet. Mehr Klei-
dung und Schuhe für die Kinder wünscht sich
jede fünfte arme Familie.
• Kindbezogene Armutsprävention ist ein sozial-
und jugendpolitischer Auftrag. Voraussetzung,
um diesen Auftrag annehmen und umsetzen zu
können, ist Armutssensibilität. Während pädago-
gische Fachkräfte strukturelle Armutsursachen
wie Arbeitslosigkeit kaum bekämpfen können,
sind sie sehr wohl in der Lage, in ihren Institu-
tionen den Folgen der Kinderarmut präventiv
entgegenzuwirken. Wie dies gelingen kann, ver-
anschaulichen 14 konkrete Ansätze als Beispiele
guter Praxis. Eine abschließende Bewertung,
ob und inwiefern die Projektaktivitäten dazu
geführt haben werden, die Entwicklungskluft
zwischen Kindern aus armen und nicht armen
Familien zu reduzieren und die Startchancen
der Kinder beim Übergang in die Grundschule
auszugleichen, wird erst nach den anstehenden
Befragungen 2021 und 2022 möglich sein. Vor
dem Hintergrund der massiven Einschrän-
kungen, die die pädagogischen Fachkräfte und
Kinder infolge der COVID-19-Pandemie in Kauf
nehmen müssen, ist diese Zielsetzung besonders
anspruchsvoll.
1 Siehe Infobox „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“ auf Seite 19.
2 Siehe Infobox „Kindbezogenes Armutskonzept“ auf Seite 20.
91 Einleitung
Von Irina Volf
Die Chancen auf gute Bildung und somit höhere Diese grundsätzliche Problematik verschärft sich
Erträge im Berufsleben sowie höheren gesell- in Regionen, Städten und Quartieren mit hoher
schaftlichen Status sind in Deutschland ungleich und langfristiger Arbeitslosigkeit, mit ethnischer
verteilt. Bereits bei der Geburt des Kindes werden und sozialer Segregation sowie mit niedrigen Ver-
seine Chancen maßgeblich durch den Bildungs- sorgungsquoten und schwacher Infrastruktur im
stand und den beruflichen Status der Eltern fest- Bereich der frühen Bildung (vgl. Bildungsbericht
gelegt (vgl. Autorengruppe des Bildungsberichts Ruhr 2020). Diese negativen Rahmenbedingungen
2020: 317 ff.). Bei Kindern, die in sozioökonomisch sind im Ruhrgebiet besonders häufig anzutreffen:
schwachen Familien aufwachsen, lassen sich Die finanziellen Handlungsspielräume der Kom-
bereits in den ersten Lebensjahren herkunftsbe- munen sind hier aufgrund der besonders hohen
dingte Entwicklungsverzögerungen identifizieren. Pro-Kopf-Verschuldung stark eingeschränkt;
Gegenüber Kindern aus soziökonomisch besser das durchschnittliche Haushaltseinkommen ist
gestellten Familien haben Kinder, die in Armut hier mit Abstand das geringste im Vergleich zum
aufwachsen, deutlich häufiger Defizite in sprach- übrigen Nordrhein-Westfalen und besonders
lichen, motorischen und kognitiven Bereichen. viele Menschen sind an Transferleistungen zur
Diese Entwicklungsverzögerungen werden bis zum Mindestgrundsicherung angewiesen (ebd.: 16–17).
Übergang in die Grundschule häufig nicht ausge- Während in Deutschland rund jedes siebte Kind
glichen und können sich sogar über den gesamten in armen Familien aufwächst (Lietzmann/Wenzig
Bildungsverlauf hinweg manifestieren. Untersu- 2020: 10), trifft diese Situation in Duisburg, Essen
chungen zu Folgen der Kinderarmut im Lebens- und Dortmund auf rund jedes dritte Kind zu. In
verlauf belegen: Armut stellt ein hohes Risiko für Gelsenkirchen wachsen 40,4 % der unter 15-Jähri-
eine altersgemäße Entwicklung der Kinder in der gen in armen Familien auf und sind somit einem
frühen Kindheit dar, beraubt ihnen im mittleren hohen Risiko einer brüchigen Bildungsbiographie
Kindesalter zahlreiche Entwicklungschancen, engt ausgesetzt (vgl. Bildungsbericht Ruhr 2020: 36).
in der Jugendzeit den Kreis der Möglichkeiten ein Damit bleibt die Kinder- und Jugendarmut in Gel-
und hinterlässt bis ins junge Erwachsenenalter senkirchen auf dem höchsten Niveau in Deutsch-
hinein deutliche Spuren (vgl. Hock et al. 2000a, land.
Hock et al. 2000b, Laubstein et al. 2012, Laubstein
»Das Modellprojekt
et al. 2016, Volf et al. 2019).
‚ZUSi – Zukunft früh
Mit der Forderung „Bildung von Anfang an“ hat sichern!’ ist Teil der
sich seit Beginn dieses Jahrhunderts das Aufgaben- Präventionskette gegen
feld von Kindertageseinrichtungen verändert. Die Kinderarmut.«
Kindertagesstätte dient nicht nur der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. Vielmehr sollen die kindli- Unter dem Motto „Jedem Kind seine Chance“
che Entwicklung verstärkt in den Blick genommen hat die Stadt Gelsenkirchen bereits im Jahr 2005
und herkunftsbedingte Ungleichheiten reduziert begonnen, eine lückenlose Betreuungs- und Prä-
werden (vgl. Autorengruppe des Bildungsberichts ventionskette aufzubauen, um auf die vielfältigen
2020: 75). Um diesem Anspruch in der Praxis und sich stetig ändernden Herausforderungen
gerecht zu werden, ist eine hohe Qualität der Ange- armer Familien frühzeitig zu reagieren. Seitdem
bote in der frühen Bildung erforderlich. Doch nicht hat die Stadt viele Anstrengungen unternommen,
nur der qualitative Anspruch an die Arbeit der päd- um die kommunale Präventionspolitik zu stärken.
agogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrich- Auch suchte die Stadt Kooperationen mit Partnern.
tungen steigt. Auch die Zahl der von Armut betrof- Gelsenkirchen war eine der ersten Modellkommu-
fenen Kinder nimmt tendenziell zu. Eine besondere nen, die am Landesprogramm „Kein Kind zurück-
Herausforderung stellt der zunehmende Fachkräf- lassen“ zum Aufbau von kommunalen Präventions-
temangel dar. ketten teilgenommen haben. Mit dem Abschluss
11des Landesprogramms setzte die Stadt Gelsenkir- Diesen Fragen stellen sich seit 2019 eine Koor-
chen die Arbeit fort und baute die Präventionskette dinatorin und sieben zusätzliche pädagogische
sukzessive aus (vgl. Stadt Gelsenkirchen 2018). Fachkräfte, die im Modellprojekt die Rolle von Bil-
Das Modellprojekt „ZUSi – Zukunft früh sich dungsbegleiter*innen übernehmen. Die Koordina-
ern!“ wird als Teil der Präventionskette gegen Kin- tion ist bei der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirche-
derarmut zwischen April 2019 und April 2022 in ner Kindertagesbetreuung (GeKita) angesiedelt; die
sieben städtischen Kindertageseinrichtungen im Bildungsbegleiter*innen arbeiten in den Kinder-
Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf umgesetzt. tageseinrichtungen. Einer engen Zusammenarbeit
Das Projekt wird durch die RAG-Stiftung geför- zwischen den Bildungsbegleiter*innen, den päd-
dert. Das Modellprojekt zielt darauf ab, sowohl die agogischen Fachkräften in den Kitas, den Eltern,
individuellen Stärken und Talente der Kinder in den Grundschulen und unterschiedlichen Trägern
Ückendorf durch zusätzliche Angebote zu fördern, vor Ort wird im Rahmen des Modellprojekts große
als auch vielfältige Ansätze zur Vorbeugung und Bedeutung beigemessen.
Bekämpfung von Armutsfolgen bei Kleinkindern Das Modellprojekt wird vom Institut für Sozial-
zu entwickeln und zu erproben. Des Weiteren wer- arbeit und Sozialpädagogik (ISS-Frankfurt a. M.)
den Kooperationen in multiprofessionalen Teams wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Das ISS-
sowohl innerhalb der Kindertageseinrichtungen Frankfurt a. M. greift auf die mehrjährige Erfah-
als auch im Sozialraum gestärkt und ausgebaut. Die rung aus den bundesweit einzigartigen Studien
Projektaktivitäten richten sich in erster Linie an zur Kinderarmut (AWO-ISS Langzeitstudie) sowie
Kinder, die im Jahr 2019 vier Jahre alt waren und zum Aufbau von kommunalen Präventionsketten
demnach im Jahr 2021 eingeschult werden. Durch (Mo.Ki – Mohnheim für Kinder) zurück und stellt
die Übertragung der gewonnenen Erkenntnisse sol- das pädagogische Handeln im Rahmen des Modell-
len möglichst viele Kinder vom Modellprojekt profi- projekts immer wieder auf den Prüfstand, hinter-
tieren. Handlungsfelder sind zusätzliche Aktivitäten fragt einzelne Maßnahmen und gleicht diese mit
mit Kindern, Veränderung bestimmter Abläufe im dem aktuellen Stand der Forschung ab.
Kita-Alltag oder die Etablierung neuer Methoden. In der vorliegenden Handreichung werden die
Im Stadtteil Ückendorf ist fast jedes zweite Kind ersten Erkenntnisse und Impulse aus dem Modell-
von Armut betroffen. Daher erfordert die Arbeit projekt mit Fokus auf das Thema der Armutssen-
mit Kindern sowie ihren Familien seitens der sibilität im Bereich der frühen Bildung dargestellt.
pädagogischen Fachkräfte einen hohen Grad an Aufgrund der zahlreichen Beispiele, wie Armuts-
Armutssensibilität (Stadt Gelsenkirchen 2018). sensibilität in der Kita-Praxis konkret umgesetzt
Dabei sind folgende Fragestellungen zentral: werden kann, richtet sich die Handreichung vor
allem an Kitaleitungen, Erzieher*innen und im
• Wie können die Planung und Gestaltung der Bereich der frühen Bildung tätige pädagogische
Angebote der frühen Bildung armutssensibel Fachkräfte.
gelingen? Die Forschungserkenntnisse zur Ausgangslage
der Kinder bei Projektstart sind besorgniserregend.
• Was braucht es dafür an Haltung, Wissen, Kom- Ein hoher Anteil der Kinder weist starke Entwick-
petenzen, Ressourcen, Entscheidungsbefugnis- lungsverzögerungen auf, dementsprechend hoch ist
sen, Kreativität, Spielräumen und Erprobungs- der Handlungsbedarf im Kampf gegen Kinderar-
möglichkeiten? mut. Daher richtet sich diese Handreichung auch
an freie und öffentliche Träger der Kindertagesein-
• Wie kann es gelingen, Talente der Kinder vor- richtungen, kommunal Verantwortliche im Bereich
urteilsfrei zu identifizieren und individuell zu der (frühen) Bildung sowie politische Entschei-
fördern? dungsträger*innen. Die Handreichung muss insge-
samt als ein Appell an die Gesellschaft verstanden
• Wie können die Startchancen der armutsbetrof- werden.
fenen Kinder noch vor dem Übergang in die
Grundschule so weit verbessert werden, dass Wir dürfen die Zukunft armutsbetroffener
keine oder möglichst geringe Benachteiligungen Kinder nicht verspielen, sondern sind in
entstehen? der Pflicht, diese Zukunft früh zu sichern!
12Infobox: AWO-ISS Langzeitstudie zur Kinderarmut
Was macht die AWO-ISS Langzeitstudie zum einladen, den eigenen Geburtstag feiern oder zu
Thema Kinderarmut so besonders? anderen Kindern zum Geburtstag kommen, weil
Die seit 1997 von der Arbeiterwohlfahrt finanzierte das Geld für ein Geschenk fehlt. Sie wiederholen
und vom Institut für Sozialarbeit und Sozialpäda- häufiger eine Klasse, streben niedrigere Schulab-
gogik e. V. umgesetzte AWO-ISS Langzeitstudie schlüsse an und können seltener auf Unterstüt-
widmet sich der Erforschung von Folgen familiärer zung im familiären Umfeld zurückgreifen. Armut
Armut auf die Entwicklung der Kinder vom Vor- im jungen Erwachsenenalter geht vor allem mit
schulalter bis zum 25. Lebensjahr. Die erste Unter- Einschränkungen in der materiellen Grundver-
suchung fand 1999 mit 893 Kindern statt, die sechs sorgung und Teilhabe sowie schlechter psychi-
Jahre alt waren und 60 bundesweit verteilte AWO- scher Gesundheit einher. Einschränkungen in
Kindertageseinrichtungen besuchten. Die For- den kulturellen und sozialen Lagen sind bei den
schenden untersuchten die Lebensverläufe dieser jungen Erwachsenen insgesamt zwar weniger
Kinder von der Kita bis zum jungen Erwachsenen- ausgeprägt. Sie kumulieren jedoch bei einzelnen
alter. Besonders wurden die kritischen Übergänge Personen, die wiederum häufig in Armut leben.
im Leben analysiert. Dabei wurde nach Lebensla- Langzeitfolgen von Kinderarmut lassen sich ins-
gen und Armutserfahrungen differenziert. Bei der besondere im kulturellen Bereich – schlechtere
letzten Befragung im Jahr 2018 wurden 205 ehe- Bildungs- und Qualifizierungsniveaus – sowie im
malige Sechsjährige und heute junge Erwachse- gesundheitlichen Bereich – insbesondere mit Blick
ne wiedererreicht. Neben den quantitativen Daten auf psychische Gesundheit – feststellen.
wurden auch qualitative Daten in Form von Inter-
views mit 23 Studienteilnehmenden in die Analyse Gab es überraschende Ergebnisse?
einbezogen. Es gibt bislang in Deutschland keine Einige gängige Hypothesen bestätigte die Studie
andere Langzeitstudie, die so viele Zusammen- nicht. Beispielsweise geht es Migran ten
kindern
hänge, Wechselwirkungen und Muster zwischen – die als Gruppe mit erhöhtem Armutsrisiko gilt –
Lebensverläufen der Kinder aus armen und nicht nicht schlechter als Studienteilnehmenden ohne
armen Familien beleuchtet. Migrationserfahrungen. Ferner zeigte sich, dass
mittlere Bildung nicht mehr vor Armut schützt.
Welche Auswirkungen hat es auf Kinder, in Gleichzeitig konnte die Studie belegen, was auf
Armut aufzuwachsen? den ersten Blick kontraintuitiv erscheint: Zwei
Kinder haben in unterschiedlichen Lebensphasen Dritteln der ehemals armen Kinder gelang es, die
unterschiedliche Bedarfe und Bedürfnisse, aber familiäre Armut im jungen Erwachsenenalter hin-
auch verschiedene Entwicklungsaufgaben. Die ter sich zu lassen. Im Umkehrschluss zeigt sich
Unterschiede zwischen den armutsbetroffenen jedoch, dass jedes dritte Kind, das mit sechs Jah-
Kindern und ihren Altersgenoss*innen aus finan- ren in einer armen Familie aufgewachsen ist, auch
ziell besser gestellten Familien lassen sich bereits als junge erwachsene Person arm ist. Das eigene
im Kita-Alter feststellen: Armutsbetroffene Kinder Armutsrisiko im jungen Erwachsenenalter hängt
weisen häufiger Spiel- und Sprachauffälligkeiten eng mit den Armutserfahrungen in der Kindheit
auf, ihre Grob- und Feinmotorik ist schlechter ent- zusammen.
wickelt, sie sind häufiger entweder sehr zurück-
haltend oder aber aggressiv. Im Schulalter erleben Die Kurzfassung der Studie „Wenn Kinderarmut
die Kinder aus armen Familien zudem häufiger erwachsen wird …“ (Volf et al. 2019) finden Sie
Benachteiligung in sozialen und kulturellen Berei- unter www.iss-ffm.de.
chen. Selten können sie ihre Freunde nach Hause
13Abbildung 1: Die AWO-ISS Langzeitstudie im Überblick
1997–2000
I. AWO-ISS-Studie „Armut im Vorschulalter“ 1999
Quantitative Erhebung: auswertbar n = 893
Vertiefungsstudie
Wiederholungsstudie
1
2000–2002
II. AWO-ISS-Studie „Armut im frühen Grundschulalter“
2001 Wiederholungsstudie
2
Quantitative Erhebung: auswertbar n = 107
Qualitative Erhebung: auswertbar n = 27
2002–2005
III. AWO-ISS-Studie „Armut im späten Grundschulalter“
2003/2004
Quantitative Erhebung: auswertbar n = 500 Wiederholungsstudie
3
Qualitative Erhebung: auswertbar n = 10
2009–2012
IV. AWO-ISS-Studie „Armut am Ende der
Sekundarstufe I“ 2009/2010
Quantitative Erhebung: auswertbar n = 449
Qualitative Erhebung: auswertbar n = 14
2017–2020
V. AWO-ISS-Studie „Armut im jungen Erwachsenenalter“
2018/2019
Quantitative Erhebung: auswertbar n = 205
Qualitative Erhebung: auswertbar n = 23
Quelle: Volf et al. 2019: 14.
142 Kernelemente des Modellprojekts: Projekt-
architektur, Ziele, Ansätze und Methoden
Um die Chancengleichheit der Kinder in einer sich schnell verändernden und heterogenen
Gesellschaft zu erhöhen, bedarf es immer wieder neuer Impulse und frischer Ideen. Geför-
derte Modellprojekte werden in der Regel wissenschaftlich begleitet und evaluiert. So kön-
nen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, ob die erprobten Methoden und Konzepte ihre
Ziele erreichen und die angestrebten Wirkungen entfalten. Modellprojekte, die sich in der
Praxis bewähren, können später auf andere Regionen übertragen werden. Wie das Modell-
projekt „ZUSi – Zukunft früh sichern!“ strukturell aufgebaut wird, welche Ziele es verfolgt
und welche konzeptionellen Ansätze dem Projekt zu Grunde liegen, wird in diesem Kapitel
ausführlich dargestellt. Zudem beschreibt dieses Kapitel zwei zentrale methodische Ansät-
ze, die zur Feststellung und Entwicklung individueller Förderangebote für Kinder zum Einsatz
kommen: der Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter und ein kindbezogenes Armutskon-
zept, das auf dem Lebenslagenansatz basiert.
Von Irina Volf
Das Modellprojekt „ZUSi – Zukunft früh sichern!“ Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie Künst-
besteht in seiner Architektur aus vier Ebenen. Die ler*innen qualitativ hochwertige Angebote für die
strategische Steuerung des Projekts wird durch Kinder zu schaffen. Die Architektur des Modell-
eine Steuerungsgruppe gewährleistet. Diese setzt projekts wird in Abbildung 2 grafisch dargestellt.
sich aus Vertreter*innen der RAG-Stiftung, der Inhaltlich setzt das Modellprojekt an der
Stadträtin für Jugend und Bildung der Stadt Gel- Erkenntnis an, dass es Kindern aus sozioökono-
senkirchen, der Betriebsleiterin der Gelsenkirche- misch schwachen oder bildungsfernen Familien
ner Kindertagesbetreuung (GeKita), einer Fachbe- oft an einer anregenden Lernumgebung sowie
raterin der städtischen Kindertageseinrichtungen, Möglichkeiten zur Entwicklung ihrer Potenziale
der Koordinatorin des Modellprojekts sowie Ver- fehlt. Es ist häufig nicht das niedrige Familienein-
treter*innen des ISS-Frankfurt a. M. zusammen. kommen, das sich nachteilig auf die Entwicklung
In diesem übergeordneten Gremium werden die der Kinder auswirkt, sondern die Qualität der
wichtigsten Meilensteine des Modellprojekts fest- häuslichen Lernumgebung, die Eltern-Kind-Bezie-
gelegt, Erkenntnisse aus der Projektumsetzung hung sowie das elterliche Erziehungsverhalten (vgl.
und der wissenschaftlichen Begleitung reflektiert Linver et al. 2002; Rönnau-Böser 2013: 115). Kin-
sowie steuerungsrelevante Entscheidungen getrof- der aus armen Familien haben weniger Zugang zu
fen. Die fachliche Entwicklung des Projekts erfolgt Lernmaterial und entwicklungsförderlichen Erfah-
unter wissenschaftlicher Begleitung des ISS-Frank- rungen und erhalten gleichzeitig weniger kognitive
furt a. M. auf der Ebene der GeKita. Hieran betei- und sprachliche Stimulation (vgl. Heilig 2014) als
ligt sind die Projektkoordinatorin, eine Fachbe- Kinder aus nicht armen Familien. Die Ursachen: In
ratung für städtische Kindertageseinrichtungen Armut lebende Eltern sind häufig mit ihrer schwie-
und sieben Bildungsbegleiter*innen. Die prakti- rigen Lage selbst überfordert und vor allem damit
sche Umsetzung der Aktivitäten erfolgt in sieben beschäftigt, das Leben mit knappen finanziellen
städtischen Tageseinrichtungen in Gelsenkirchen- Ressourcen zu meistern. Je nach Elternhaus haben
Ückendorf in Kooperation zwischen den Bildungs- Kinder beim Eintritt in die Kindertagesstätte unter-
begleiter*innen, Kitaleitungen und pädagogischen schiedliche Prägungen und Vorerfahrungen und
Fachkräften. Zusätzlich zur Arbeit in den Kinder- werden deshalb von den Mitarbeiter*innen unter-
tageseinrichtungen setzt das Modellprojekt darauf, schiedlich wahrgenommen. So werden in der all-
in Kooperation mit Grundschulen, Sportvereinen, täglichen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen
15häufig erst die Kinder als „talentiert“ angesehen, sollen die pädagogischen Fachkräfte das eigene päd-
die bereits durch ihre Familie eine individuelle För- agogische Handeln (z. B. bei Planung und Umset-
derung und Unterstützung erhalten. Bei Kindern, zung der Aktivitäten mit Kindern sowie beim
die erst spät und mit mangelnden Deutschkennt- Aufbau der Erziehungspartnerschaft mit Eltern)
nissen kommen und/oder aufgrund der materiellen reflektieren und systematisch abprüfen, inwieweit
Unterversorgung der Familien keine Erfahrungen die Prozessqualität3 in ihren Einrichtungen auch
mit Bilderbüchern und hochwertigen Spielmateria- die Armutsdimension abbildet. Dabei gilt es, diffe-
lien haben, stoßen pädagogische Fachkräfte schnell renzierte armutssensible Prüffragen zu stellen und
an Grenzen. Im Mittelpunkt einer kindzentrierten zu beantworten (ausführlich Kapitel 5). Langfristig
Förderung müssen allerdings alle Kinder stehen wird somit das Ziel verfolgt, die Prozessqualität in
und ihre Persönlichkeiten müssen vorurteilsfrei den Kindertageseinrichtungen entlang der Armuts-
wertgeschätzt werden – ungeachtet der sozioöko- dimensionen nachhaltig zu steigern.
nomischen Position der Eltern.
In seiner konzeptionellen Umsetzung folgt das »Mittelfristiges Ziel des Modellpro-
Modellprojekt „ZUSi – Zukunft früh sichern!“ einem jekts ist es, die Chancengleichheit
Präventionsansatz auf mehreren Ebenen, in dem durch die individuelle Förderung der
Kinder zu verbessern.«
Strategien der Verhaltens- und Verhältnispräventi-
on miteinander kombiniert werden (Rönnau-Böse/ Um einerseits Potenziale, Stärken und Möglich-
Fröhlich-Gildhoff 2020: 89; Rönnau-Böse 2013: keiten und andererseits Barrieren und Herausfor-
103). Während es sich bei der Verhaltensprävention derungen der Kinder aufdecken zu können, erfolgt
um die Veränderung des individuellen Verhaltens im Modellprojekt eine systematische Beobachtung
handelt (z. B. Veränderung der Haltung pädagogi- der Kindesentwicklung sowie eine Auseinander-
scher Fachkräfte durch Fortbildungen, Steigerung setzung mit der Lebenssituation des Kindes. Dazu
der sozialen Kompetenzen der Kinder durch Trai- wird der „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“
ning), geht es bei der Verhältnisprävention darum, als methodisches Werkzeug genutzt. Das Instru-
das Umfeld und die Bedingungen in Kitas, im Sozi- ment wird bereits seit mehreren Jahren in allen
alraum oder Familien positiv zu verändern (Set- städtischen Kindertageseinrichtungen eingesetzt,
ting-Ansatz). Basierend auf den Erkenntnissen der um die Entwicklung aller Kinder von der Aufnah-
Präventionsforschung zu wirksamen Programmen me in die Kita und bis zur Einschulung zu beglei-
im Bereich der frühen Bildung berücksichtigt das ten. Der „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“
Modellprojekt alle relevanten Ebenen, die für das differenziert nach fünf zentralen Entwicklungsbe-
Kind und seine Förderung eine Bedeutung haben. reichen – kognitive Entwicklung, sprachliche Ent-
Neben der individuellen Förderung der Kinder wicklung, Grobmotorik, Feinmotorik und soziale
werden Ziele mit Blick auf die partnerschaftliche Kompetenz. Ermöglicht wird damit, frühzeitig
Zusammenarbeit mit Eltern, auf die Qualifizierung Stärken und Förderbedarfe der Kinder zu identifi-
der pädagogischen Fachkräfte und auf die Vernet- zieren, auch wird das Instrument bei Reflexionsge-
zung im Sozialraum verfolgt. Die spezifischen Ziel- sprächen mit Eltern und bei der Planung der indi-
setzungen für jede Ebene werden in Abbildung 3 viduellen Förderung der Kinder genutzt.
zusammenfassend dargestellt. Zusätzlich kommt beim Modellprojekt „ZUSi –
Die Zielgruppe des Modellprojekts stellen Kin- Zukunft früh sichern!“ das Lebenslagenmodell aus
der dar, die zu Beginn des Projekts 2019 vier Jahre der AWO-ISS-Langzeitstudie zum Einsatz. Diffe-
alt waren. Durch die Auswahl dieser Altersgruppe renziert nach vier Lebenslagendimensionen werden
wird im vierjährigen Förderzeitraum angestrebt, materielle, kulturelle, soziale und gesundheitliche
zusätzliche Aktivitäten zur individuellen Förderung Lage jedes einzelnen Kindes im Rahmen der Fall-
der Kinder mit jeweils vier, fünf und sechs Jahren besprechungen umfassend thematisiert und in die
zu entwickeln und zu erproben. Zudem werden die Bewertung der individuellen Fördermöglichkeiten
Projektkinder beim Übergang in die Grundschule des Kindes einbezogen. In dieser Kombination
im Jahr 2021 und auch in der ersten Grundschul- aus dem „Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter“
zeit begleitet. Mittelfristiges Ziel des Modellprojekts und des Lebenslagenmodells liegt das Novum im
ist es, die Chancengleichheit durch die individuelle methodischen Ansatz des Modellprojekts „ZUSi –
Förderung der Projektkinder zu verbessern. Zudem Zukunft früh sichern!“.
16Abbildung 2: Architektur des Modellprojekts „ZUSi – Zukunft früh sichern!“
Steuerung des • RAG-Stiftung
Projekts durch die • Stadt Gelsenkirchen, GeKita, Projektkoordinatorin
Steuerungsgruppe
• ISS-Frankfurt a. M.
Fachliche Entwicklung • Projektkoordinatorin, Fachberatung GeKita
des Projekts • Sieben Bildungsbegleiter*innen
• ISS-Frankfurt a. M.
Operative Umsetzung • Projektkoordinatorin und sieben Bildungsbegleiter*innen
des Projekts • Kitaleitungen und pädagogische Fachkräfte der Kitas Bochumer
Straße, Ückendorfer Straße, Flötz Sonnenschein, Heidelberger
Straße, Hohenfriedberger Straße, Munscheidstraße, Leithestraße
Kooperationspartner*- • Gemeinschaftsgrundschulen Haidekamp,
innen im Sozialraum Hohenfriedberger Straße, Glückauf-Ückendorf
• Vertreter*innen aus den Bereichen Sport, Gesundheit, Kultur
Quelle: Eigene Darstellung
3 „Eine hohe Prozessqualität ist gegeben, wenn die pädagogischen
Fachkräfte sensibel und einfühlsam mit den Kindern umgehen
und auf ihre individuellen Bedürfnisse, Interessen und Ent-
wicklungsvoraussetzungen eingehen, entwicklungsangemessene
Materialien auswählen und bereit stellen, Impulse für selbst-
gesteuertes Lernen und Anregungen in verschiedenen Entwi-
cklungs- bzw. Bildungsbereichen geben und wenn sie bestimmte
lern- und persönlichkeitsförderliche Strategien der Interaktion
mit den Kindern anwenden.“ (Viernickel/Schwarz 2009: 10)
17Abbildung 3: Mehrebenenansatz und Ziele des Modellprojekts
„ZUSi – Zukunft früh sichern!“
• Talente und Begabungen der Kinder frühzeitig erkennen
und individuell fördern
• Stärkung der schulischen Vorläuferfähigkeiten zur Gewähr
Kinder leistung von Chancengleichheit bei benachteiligten Kindern
• Entwicklung und Erprobung zusätzlicher Angebote neben
dem Regelangebot, die möglichst viele Begabungsformen
der Kinder ansprechen
• Begleitung von Familien in Form einer Patenschaft, um eine
erfolgreiche Bildungsbiografie der Kinder zu erreichen
• Verstärkung der Elternarbeit im Hinblick auf die Reflexions
Familien gespräche zur Kindesentwicklung, einschließlich der Talent
förderung
• Sensibilisierung der Eltern zur Gestaltung eines gelingenden
Übergangs in die Grundschule
• Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte an den beteiligten
Pädagogische Kindertageseinrichtungen
Fachkräfte • Schärfung der Blickrichtung der pädagogischen Fachkräfte für
die Potenziale und Talente der Kinder
• Vernetzung der Kindertageseinrichtungen mit anderen
Bildungsakteur*innen im Stadtteil
Sozialraum
• Entwicklung eines kindzentrierten Konzepts zum Übergang
von der Kita in die Grundschule
Quelle: Eigene Darstellung
18Infobox: Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter
Der Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter wurde Kinder in den fünf Entwicklungsbereichen Spra-
2004 vom Arbeitskreis „Kinder und Jugendliche“ che, kognitive Entwicklung, soziale Kompetenzen,
der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft (PSAG) Feinmotorik und Grobmotorik. Im Einzelnen ent-
entwickelt. Es handelt sich dabei um einen Beob- hält der Bewertungsbogen 212 Fertigkeiten bzw.
achtungsbogen, der im Elementarbereich einge- zu bewältigende Aufgaben. Die Bewertung beginnt
setzt wird. Er dient zur Feststellung der Stärken mit dem dritten Lebensjahr und endet beim Schul-
und Förderbedarfe der Kinder. So können Erzie- eintritt. Die Bewertungen finden in einem sechs-
her*innen in ihrer konkreten Alltagspraxis schnell monatigen Rhythmus statt. Nachfolgend wird die
und unkompliziert prüfen, wie weit ein Kind ent- Anzahl der Indikatoren für jede der fünf Dimensio-
wickelt ist und ob es sich für seine jeweilige Alters- nen sowie sieben Altersstufen ab drei Jahren und
stufe Defizite oder hingegen Vorsprünge identifi- bis zur Einschulung tabellarisch abgebildet:
zieren lassen. Bewertet wird die Entwicklung der
Aufbau und Anzahl der Indikatoren des Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters
Sprache Kognitive Soziale Feinmotorik Grobmotorik Anzahl
Entwicklung Kompetenzen
3–3,5 Jahren 8 7 7 6 4 32
3,5–4 Jahren 4 5 6 3 8 26
4–4,5 Jahren 10 5 7 10 9 41
4,5–5 Jahren 4 7 6 6 8 31
5–5,5 Jahren 4 7 8 5 4 28
5,5 – Einschulung 7 18 11 8 10 54
Gesamt 37 49 45 38 43 212
Quelle: Eigene Darstellung
Im Alter von drei bis dreieinhalb Jahren gibt es zum Bei der Beobachtung eines Kindes durch Erzie-
Beispiel im Bereich der Grobmotorik vier Indikato- her*innen werden die einzelnen Aufgaben durch
ren. So soll das Kind in der Lage sein, (1.) treppauf ein Kreuz markiert, wenn das Kind diese erfüllen
mit Fußwechsel frei zu gehen, (2.) von der Trep- kann. Wenn ein Kind bestimmte Aufgaben nur „teil-
pe mit den beiden Beinen zu springen, (3.) einen weise“ erfüllen kann, wird die entsprechende Auf-
schwebenden Luftballon gezielt zu schlagen und gabe durch einen Strich markiert. Für jede Alters-
(4.) ein Dreirad koordiniert zu fahren. Im Bereich stufe wird darüber hinaus eine bestimmte Farbe
der sozialen Kompetenzen soll das Kind in diesem genutzt. Wird im Rahmen der Beobachtung fest-
Alter sowohl allein als auch auf Initiative anderer gestellt, dass das Kind noch nicht alle Anforderun-
mitspielen, seine Hilflosigkeit (z. B. Toilette) sig- gen seiner Altersstufe erfüllen kann, wird geprüft,
nalisieren, einfache Anweisungen befolgen, Lob ob die Anforderungen für die früheren Altersstu-
erwarten, das „Ich“ anwenden sowie Geschlechter fen erfüllt werden. Meistert das Kind hingegen
identifizieren können. Die Aufgaben wurden unter alle Aufgaben seiner Altersstufe, wird zusätzlich
Beteiligung des Gesundheitsamtes definiert. Es geschaut, ob das Kind bereits Kompetenzen für
handelt es sich um jeweils durchschnittliche Anfor- die höheren Altersstufen besitzt. Auf Basis der
derungen an Kinder in der jeweiligen Altersgruppe. Erkenntnisse werden für Kinder individuelle För-
Somit wird von einer altersgemäßen Entwicklung derpläne erstellt und mit Eltern abgestimmt.
des Kindes erst dann gesprochen, wenn das Kind Quelle: Vgl. Beyer, Andrea/Fastabend, Sigrid/Liebers, Emilia/
Schilling, Marlies/Sukowski, Petra/Webelseip, Anja/Weiß,
in der Lage ist, alle definierten Entwicklungsaufga- Holle (2004): Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiter.
ben in der jeweiligen Altersstufe zu erfüllen. dgvt Verlag, Tübingen.
19Infobox: Lebenslagen der Kinder im Vorschulalter
Der Lebenslagenansatz ist ein mehrdimensionales fälligkeiten festgestellt, kann davon ausgegangen
Konzept der Armutsforschung, der den Anspruch werden, dass das Wohl des Kindes gewährleistet
verfolgt, Armut als Unterversorgung und Benach- ist. Solche Kinder werden dem Lebenslagentyp
teiligung in einem umfassenderen als dem rein „Wohlergehen“ zugeordnet. Dem Lebenslagen-
ökonomischen Sinne zu begreifen. Nicht nur die typ „Benachteiligung“ werden Kinder zugeord-
materielle Lage des Haushalts oder der Fami- net, bei denen Auffälligkeiten in einer bis zwei
lie des Kindes wird in den Blick genommen, son- Lebenslagendimensionen vorliegen. Werden Auf-
dern die Lebenssituation und Lebenslage des fälligkeiten in drei oder sogar allen vier Dimensio-
Kindes. Die Lebenslagen werden in vier Dimensio- nen festgestellt, ist von „Multipler Deprivation“
nen – materielle, soziale, kulturelle und gesundheit- die Rede.
liche Lagen – anhand einer Vielzahl an Indikatoren Werden die Ergebnisse der Untersuchung zu
empirisch erforscht. Im Rahmen der vorliegen- familiärer Armut und Lebenslagentypen mitein-
den Untersuchung wurden die Ausprägungen der ander verzahnt, lässt sich für jedes Kind ermit-
Lebenslagendimensionen durch 64 Indikatoren teln, welche Zusammenhänge sich zwischen den
erfasst. Armutserfahrungen der untersuchten Familien und
Beim Lebenslagenansatz handelt es sich um den Lebenssituationen der Kinder und Jugendli-
ein relatives Konzept, bei dem je nach Alter des chen aus diesen Familie ergeben. Ein mehrdimen-
Kindes unterschiedliche Indikatoren je Dimension sionales Armutskonzept aus der Kindesperspek-
zu berücksichtigen sind. Zudem werden in jeder tive wurde erstmalig vom Institut für Sozialarbeit
Dimension „auffällige“ Kinder identifiziert, die im und Sozialpädagogik im Rahmen der AWO-ISS-
Vergleich zu ihren Altersgenoss*innen gravieren- Kinderarmutsstudie entwickelt. Die Leitfrage lau-
den Einschränkungen und Benachteiligungen tet: Was kommt (unter Armutsbedingungen)
ausgesetzt sind. Werden in allen vier Lebensla- beim Kind an?
gendimensionen in Bezug auf ein Kind keine Auf-
Abbildung 4: Das kindbezogene Armutskonzept der AWO-ISS-Langzeitstudie
Haushalt ist arm Was kommt beim Kind an?
Lebenslagendimensionen
Materiell
materielle
Eltern/ soziale Sozial
Erwachsene Kind
kulturelle Kulturell
gesundheitliche Gesundheitlich
Ressourcen
Lebenslagetyp
Wohlergehen Benachteiligung Multiple Deprivation
Quelle: Hock et al. 2000a: 12.
Quelle: Vgl. Hock, Beate/Holz,Gerda/Simmedinger, Renate /Wüstendörfer, Werner (2000a): Gute Kindheit – Schlechte Kind-
heit? Armut und Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. ISS-Pontifex 4, Frankfurt a. M.
203 Strategische Bedeutung und praktische
Umsetzung des Modellprojekts aus Sicht
der Projektbeteiligten
Nicht selten werden Ergebnisse von Modellprojekten in Form von Abschlussberichten doku-
mentiert und nur auf wesentliche zentrale Erkenntnisse aus der Sicht der Evaluationsteams
reduziert. Das Wissen darüber, mit welchen Vorstellungen und Erwartungen diese Modell-
projekte von Kooperationspartner*innen initiiert wurden und wie sich diese Ideen im Pro-
jektverlauf verändert haben, geht bei dieser Form der Ergebnisdokumentation häufig ver-
loren. Daher kommen in diesem Kapitel die Projektbeteiligten selbst zu Wort und schildern
aus ihrer jeweiligen Perspektive die strategische Bedeutung des Projekts für das Ruhrge-
biet im Allgemeinen und für die Stadt Gelsenkirchen im Besonderen. Zudem gewähren die
Projektbeteiligten Einblicke in ihre Praxis vor Ort. Neben einer Darstellung der alltäglichen
Projektarbeit in den Kitas thematisieren die Projektbeteiligten ihre bisherigen Erfolge und
Herausforderungen und berichten von ihren Aha-Erlebnissen in der Arbeit mit Kolleg*innen
und Kindern. Schließlich wird der Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Projektarbeit dar-
gestellt. Die Gespräche mit den Projektbeteiligten führten Mitglieder des Evaluationsteams
des ISS-Frankfurt a. M.
Besonders wichtig ist uns die Unterstützung von
Bildungsprojekten, die chancenbenachteiligten
Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven auf-
zeigen. Hierbei fördern wir entlang der gesamten
Bildungskette und setzen seit 2019 vermehrt einen
Fokus auf frühkindliche Bildung. Denn Armutser-
fahrungen wirken sich nachhaltig negativ auf den
Bildungserfolg aus.
Deshalb müssen wir bei den Kindern möglichst
früh ansetzen und bereits unsere Jüngsten im
Revier auf ihrem Bildungsweg begleiten. Hierbei ist
Bärbel Bergerhoff-Wodopia, das Projekt „Zukunft früh sichern!“ ein zentraler
Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung Baustein und wirkt nicht nur in Gelsenkirchen-
© Foto: Lina Nikelowski
Ückendorf, sondern liefert durch die wissenschaft-
liche Begleitung des Instituts für Sozialarbeit und
Frau Bergerhoff-Wodopia, die RAG-Stiftung Sozialpädagogik auch wichtige Erkenntnisse für
fi
nan
ziert das Modellprojekt „ZUSi – Zukunft die pädagogische Arbeit bundesweit.
früh sichern!“. Was hat Sie dazu bewegt, das
Projekt zu unterstützen? Eine der sieben Zukunftsthesen der RAG-Stif-
Die RAG-Stiftung fördert aus der Tradition des tung-Zukunftsstudie lautet: Vitale Bildungs-
Bergbaus kommend chancenbenachteiligte Kinder landschaft für soziale Stabilität! Welchen Beitrag
und Jugendliche in den ehemaligen Bergbauregionen dazu erwarten Sie von diesem Modellprojekt?
an Ruhr, Saar und in Ibbenbüren. Als Förderer neh- Armut ist mehr als ein Mangel an Geld. Armut
men wir dazu aktuelle bildungspolitische Herausfor- beraubt Menschen ihrer materiellen Unabhängig-
derungen in den Blick und stützen uns auch auf die keit und damit der Fähigkeit, selbst über ihr Schick-
Erkenntnisse unserer RAG-Stiftung-Zukunftsstudie. sal und das ihrer Kinder zu entscheiden. Familiäre
21Armut wirkt sich mittelbar auf alle Lebensbereiche
der Kinder aus und verhindert eine kindgerechte
Entwicklung und die volle Entfaltung ihres Poten-
zials. Schon in der Grundschule haben Kinder, die
in Armut leben, deutlich schlechtere Noten und
müssen häufiger eine Klasse wiederholen.
Folglich besuchen Kinder mit Armutserfahrung
auch seltener das Gymnasium als Kinder ohne
Armutserfahrung und haben so geringere Chancen
auf einen höheren Schulabschluss. Fest steht: Ein
guter Schulabschluss – ob am Gymnasium oder
einer anderen Schulform – ist unabdingbar, um Anne Heselhaus,
Beigeordnete des Vorstandsbereichs
beispielsweise eine gute Ausbildungsstelle zu fin-
Kultur, Bildung, Jugend, Sport, und
den oder auch studieren zu können. Integration der Stadt Gelsenkirchen
All diese Faktoren können zu einer sozialen
© Foto: Stadt Gelsenkirchen
Desintegration führen. An dieser Stelle bietet das
Modellprojekt „Zukunft früh sichern!“ einen zen-
tralen Mehrwert, denn es betrachtet explizit die Frau Heselhaus, die Stadt Gelsenkirchen ist von
Disparitäten von Kindern mit und ohne Armuts- der Problematik der Kinderarmut sehr stark
erfahrung und arbeitet dagegen. So bietet das Pro- betroffen. Zur Bekämpfung derselben hat die
jekt konkret Fördermaßnahmen zu Visuomotorik, Stadt bereits viele Maßnahmen ergriffen, die
Sprachförderung, aber auch zur Bewegungsförde- auch anderen Städten mit gleichgelagerter Prob-
rung an. All das sind Bereiche, in denen nach ersten lematik als Blaupausen gedient haben. Was waren
wissenschaftlichen Erhebungen in den beteiligten und sind die Beweggründe für dieses Projekt?
Kindertagesstätten die größten Unterschiede zwi- In Gelsenkirchen wachsen etwa 42 Prozent der
schen armen und nicht armen Kindern und damit Kinder und Jugendlichen in Familien mit SGB-II-
die größte Ungleichheit besteht. Leistungsbezügen auf. Aufgrund dieser sozioöko-
Das Projekt setzt früh an, fokussiert auf die nomischen Situation und den damit verbundenen
Talent- und Potenzialförderung und gewährleis- Lebensführungs- und Lebensbewältigungsprob-
tet einen guten Übergang in die Grundschule. Die lemen haben viele dieser Kinder feststellbar einen
Bildungsbegleiterinnen und -begleiter legen somit hohen Bedarf an zusätzlicher Unterstützung zur
den Grundstein für eine erfolgreiche Entwicklung Erreichung eines Bildungsabschlusses. Aus die-
der Kinder – das macht das Projekt so wertvoll für sem Grunde hat die Stadt Gelsenkirchen mit den
unsere Gesellschaft. unterschiedlichsten Akteuren in der Vergangenheit
Denn es muss stets darum gehen, Kindern Freu- bereits vielfältige Angebote zur frühen Förderung
de am Lernen zu vermitteln, ihnen ihre Erfolge installiert und die städtische Präventionskette zur
und Talente bewusst zu machen und ihnen zu ver- Kinderarmut sukzessive ausgebaut, um für mehr
mitteln, dass sie stolz sein können, wenn sie etwas Chancengerechtigkeit zu sorgen. Seit 2006 ist auch
erreicht haben. Diese Bausteine sorgen nicht nur die Kindertagesbetreuung ein wesentlicher Bau-
für Chancengerechtigkeit, sondern sind auch zwin- stein in der frühkindlichen Präventionsarbeit. Mit
gende Voraussetzung für die wirtschaftliche Kräf- dem Modellprojekt wird nun zusätzlich ein Focus
tigung der Region. auf Armutsindikatoren gelegt, um eine noch bes-
sere Grundlage für eine individuelle, kindschar-
fe Förderung zu schaffen und damit jedem Kind
echte Teilhabechancen zu eröffnen. Es gilt, durch
die frühestmögliche Identifikation der individu-
ellen Potenziale und Fähigkeiten gerade Kinder
mit Armutserfahrung bedarfsgerecht und stärke-
norientiert zu fördern und weiter zu entwickeln,
also – wie es das Projekt auch überschreibt – deren
Zukunft schon früh zu sichern. Damit nicht nur der
22Übergang von der Kita in die Grundschule positiv Wirkungsvolle und gut gelingende Ansätze sol-
verläuft und die Kinder einen gelingenden Start in len bereits im Projektverlauf in die Regelstruktu-
das schulische Bildungssystem erhalten, sondern ren der städtischen Tageseinrichtungen der Kinder
insgesamt ein nachhaltiger Bildungserfolg in Form übertragen werden. Unser Anspruch ist allerdings
eines Schulabschlusses erreicht wird, der wiederum die Entwicklung eines gesamtstädtischen und
die Aufnahme eines Berufes oder eines Studiums zudem überregional anwendbaren stärkenorien-
ermöglicht. tierten und armutssensiblen Konzepts für Tages-
einrichtungen für Kinder. Perspektivisch soll die-
ses auch die Grundschulen miteinbeziehen und die
Bereiche der frühen Bildung und der formalen Bil-
dung besser untereinander verzahnen. Da dies als
ein Prozess zu begreifen ist, ist es wichtig, bereits
frühzeitig solche Chancen strategisch zu nutzen.
Dies geschieht unter anderem durch trägerüber-
greifende Fachtagungen zum Thema Kinderarmut,
bei denen die bisher gesammelten Erfahrungen aus
dem Modellprojekt und regelmäßige Informatio-
nen über den aktuellen Projektstand auf gesamt-
städtischer Ebene einfließen.
Holle Weiß,
Betriebsleiterin der Gelsenkirchener
Kindertagesbetreuung
© Foto: Andreas Weiß
Frau Weiß, als Betriebsleiterin der Gelsenkir-
chener Kindertagesbetreuung haben Sie das
Gesamtprojekt sowohl auf der strategischen Ebe-
ne als auch auf der Praxisebene im Blick. Was ist
aus Ihrer Sicht das Besondere am ZUSi-Modell-
projekt?
Die Folgen von Kinderarmut erleben die pädago-
gischen Fachkräfte in ihrem Berufsalltag jeden Tag
hautnah. Neben den offensichtlichen Problemlagen
findet Armut aber auch verdeckt statt und geht viel-
fach mit Unsicherheiten und Scham für die Fami-
lien einher. Damit feinfühlig und pädagogisch-
fachlich umzugehen, Möglichkeiten zu nutzen und
Grenzen zu erkennen, sind sehr große Herausfor-
derungen.
Dieses Projekt ergänzt also die vielfältigen Maß-
nahmen um ein Modell mit übertragbaren Ergeb-
nissen und weitet hierdurch den Blick sowohl auf
besonders zu unterstützende Kinder als auch auf
den Ansatz der Potenzialförderung. Zu Beginn
des Modellprojektes haben die pädagogischen
Fachkräfte der Ückendorfer Kitas bei einer Kick-
Off-Veranstaltung mit rund 100 Mitarbeitenden
gezeigt, was sie bereits auf diesem Gebiet leisten.
Und dennoch sind sich alle einig: Es ist und bleibt
eine Mannschaftsaufgabe.
23Sie können auch lesen