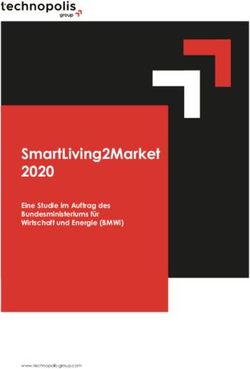Betriebswirtschaft Grundlagen und Probleme der - Helmut Schmalen Hans Pechtl
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Helmut Schmalen·Hans Pechtl Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft 15. Auflage
Helmut Schmalen / Hans Pechtl Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft 15., überarbeitete und erweiterte Auflage 2013 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Autoren: Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Schmalen lehrte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Absatzwirtschaft und Handel an der Universität Passau. Er ist im Oktober 2002 verstorben. Prof. Dr. Hans Pechtl ist Inhaber des Lehrstuhls ABWL, insbesondere Marketing, an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Dozenten finden Lehrmaterialien unter: www.sp-dozenten.de/3235 (Anmeldung erforderlich). Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. E-Book ISBN 978-3-7992-6837-0 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikro- verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © 2013 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH www.schaeffer-poeschel.de info@schaeffer-poeschel.de Einbandgestaltung: Willy Löffelhardt/Melanie Frasch (Abbildung: IFA-BILDERTEAM GmbH) Layout: Ingrid Gnoth | GD 90 Satz: Dörr + Schiller GmbH, Stuttgart September 2013 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Tochterunternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt
Vorwort zur 15. Auflage Das Lehrbuch will Leserinnen und Leser – ohne seien die Stichworte Asset und Share Deals, besondere Vorkenntnisse und mit überschau- Betriebsaufspaltung, Covenants, Country-of- barem Zeitaufwand – in 25 Kapiteln einen Über- Origin-Effekt, Freemium-Angebote, Guerilla- blick über wesentliche Fragestellungen der Marketing, Kultmarke, Marketing-Assets, Obso- Betriebswirtschaftslehre vermitteln. Damit der leszenz, Produktivität, Prozesskontrolle, Ratio- Bezug zur Wirklichkeit nicht verloren geht, nalisierung, Übernahme- und Pflichtangebot, werden die theoretischen Darstellungen mit Web 2.0 oder wertorientierte Unternehmensfüh- Fallbeispielen illustriert. In der Rubrik »Unter rung genannt. Auf die Besteuerung des Unter- der Lupe« finden zudem ausgewählte Sachver- nehmens wird ausführlicher als bisher eingegan- halte eine vertiefende Erörterung. Die Kapitel gen. Das Kapitel zur Investitionsrechnung hat schließen mit Wiederholungsfragen zu den eine grundlegende Neustrukturierung erfahren. dargestellten Sachverhalten. An vielen Stellen hat die aktuelle Rechtslage zu Die vorliegende Schrift setzt das von Prof. Änderungen bei Sachverhalten geführt. Dr. Dr. h. c. Helmut Schmalen (gest. im Oktober Möge das Buch auch in seiner 15. Auflage ein 2002) begründete Lehrbuchkonzept in seinem lehrreicher, aber auch unterhaltsamer Begleiter Kern fort. Im Vergleich zur 14. Auflage sind eine in die Betriebswirtschaftslehre sein. Reihe von in Wissenschaft und Praxis disku- tierte betriebswirtschaftliche Themen neu auf- genommen oder vertieft worden. Exemplarisch Greifswald, im September 2012 Hans Pechtl
Leserhinweise
VI
Leserhinweise
Lernziele und Leitfragen: Jedes Kapitel wird Stichwortverzeichnis: Das Stichwortver-
durch »Lernziele« und »Leitfragen« eingeführt. zeichnis am Ende des Buches dient zum
Diese stimmen inhaltlich auf die folgenden raschen Auffinden von Begriffen, Konzepten
Themen ein. Nach der Lektüre des Textes sollten und Instrumenten.
die Leser in der Lage sein, alle zu beantworten.
Die Investitionsplanung
17.2 Grundlagen der Investitionsrechnung
438
4
materialschonender arbeiten und weniger Ver- zen. Dieser Vergleich ist nur sinnvoll, wenn eine
Kooperation und Konzentration schnitt produzieren oder aufgrund höherer Au-
tomatisierung weniger Personalkosten je Leis-
Investitionsalternative höhere Fixkosten und
niedrigere variable Kosten als die andere Alter-
von Unternehmen tungseinheit als Maschine B verursachen. native besitzt. Liegt die geplante Produktions-
Möglicherweise lässt sich für ein Investiti- menge über (unter) der Break-even-Menge, ist
onsobjekt eine Kostenfunktion aufstellen, die diejenige Investitionsalternative mit den gerin-
Z
Lernziele die Gesamtkosten für eine bestimmte Produkti-
onsmenge x angibt. Unterstellt man Fixkosten
geren variablen Kosten (geringeren fixen Kos-
ten) zu wählen.
쑺 Leitfrage: Worin liegen die Besonderheiten Welche Arten von verbundenen Unternehmen Kfix (leistungsunabhängige Kosten) und variable Die Kostenvergleichsrechnung unterstellt
von Kooperation und Hierarchie als Koordi- gibt es? (leistungsabhängige) Kosten Kvar, die zugleich während der Nutzungsdauer keine Veränderung
nationskonzepte des Wirtschaftens? Was geschieht bei einer Fusion?
Welche betriebswirtschaftlichen Probleme linear bezogen auf die Produktionsmenge x sind, in den kostenbestimmenden Rahmenbedingun-
쑺 Leitfrage: Welche Ausprägungen können
werfen »Mergers« und »Acquisitions« auf? dann besitzt die Kostenfunktion folgende Form: gen. Die (durchschnittlichen) Zahlen einer Peri-
Kooperation und Konzentration zwischen
Was charakterisiert eine feindliche ode sind deshalb repräsentativ für die gesamte
Unternehmen annehmen?
Übernahme? K = Kfix + Kvar x
Welche Ansatzpunkte haben Interessenge- Nutzungsdauer. Dies ist bei einer dynamischen
meinschaften? 쑺 Leitfrage: Was beinhaltet aus ökonomischer Für eine bestimmte (geplante) Produktions- Umwelt zweifelhaft. Ebenso sind die (durch-
Durch was sind strategische Allianzen charak- Sicht ein »Konzern«? menge ist dann diejenige Investitionsalternative schnittlichen) Periodenkosten der Investitions-
terisiert? mit den niedrigsten Gesamtkosten zu wählen. objekte nicht mehr aussagekräftig, wenn die
쑺 Leitfrage: Wie sind aus wettbewerbsrecht-
Inwiefern sind auch Kartelle Kooperationen?
licher Sicht Kooperation und Konzentration Vergleicht man zwei Investitionsalternativen, Investitionsalternativen unterschiedliche Verän-
von Unternehmen zu bewerten? lässt sich diejenige kritische Produktionsmenge derungen in den kostenbestimmenden Rahmen-
(Break-even-Menge) berechnen, bei der beide bedingungen aufweisen. Ferner wird bei unter-
Alternativen die gleichen Gesamtkosten besit- schiedlicher Nutzungsdauer der Investitions-
Beispiel
4.1 Übersicht
Kostenvergleichsrechnung mit Kostenfunktionen
Prinzipiell sind in einer Marktwirtschaft die Be- handelt es sich um Unternehmen der gleichen
Die Kostenfunktionen für drei Anlagen (A; B; C) betragen: Ergebnis:
ziehungen von Unternehmen zueinander durch Wertschöpfungsstufe (»Branche«), bei einer
den Marktmechanismus geprägt: Auf horizon- vertikalen Kooperation um Unternehmen aus A: K = 8 250 + 1,00 x 쑺 Die Anlage B scheidet von vorneherein aus, da die Anlage A
taler Ebene konkurrieren die Unternehmen mit- unterschiedlichen Stufen des Wertschöpfungs- B: K = 9 600 + 1,20 x durchgängig kostengünstiger ist.
C: K = 13 200 + 0,30 x
einander um die knappe Kaufkraft der Nachfra- prozesses eines Produkts. Bei einer diagonalen 쑺 Die kritische Menge x̄ ergibt sich aus einem Kostenvergleich
ger (Wettbewerb). Auf vertikaler Ebene kon- Kooperation führen Unternehmen aus unter- Konkurrenz: »Ich will mich besser Die Kapazitätsgrenze für Anlage A (B; C) liegt bei 8000 (9000; der Anlagen A und C:
stellen, auch wenn ich dich dadurch 13 000) Einheiten. KA = 8 250 + 1,00 x
kretisieren sich die Beziehungen in den Trans- schiedlichen Branchen ihre jeweiligen spezifi-
schlechter stelle«. KC = 13 200 + 0,30 x
aktionen zwischen Zulieferern und weiterverar- schen Fähigkeiten und Ressourcen zusammen Bei einer geplanten Produktionsmenge von 6000 Stück, weist
K A = KC .
beitenden Unternehmen. Hier will jeder Akteur und bündeln diese. Diagonale Kooperationen Anlage A (B; C) Gesamtkosten von K = 12 250 (15 600; 14 700)
auf, weshalb Investitionsalternative A zu wählen ist. Die Kos- 8250 + 1, 00 x = 13200 + 0, 30 x
ein möglichst gutes Verhältnis aus Leistung und finden sich vor allem im Forschungs- und Ent-
tenverläufe lassen sich – für beliebige Produktionsmengen – 13200 − 8250
Gegenleistung erzielen, wobei die Transaktions- wicklungsbereich: Durch die Kombination von auch graphisch darstellen: x=
1, 00 − 0, 30
beziehungen durch das freie Spiel von Angebot Know-how aus verschiedenen Technologiefel-
Kosten (K) KB = 7071
und Nachfrage geprägt sind. Neben dem Markt- dern lassen sich neue Produkte (Innovatio-
mechanismus gibt es allerdings zwei weitere nen) schaffen, die einen hohen technologi- KA 쑺 Für x < x̄ wir die Anlage A eingesetzt.
Koordinationskonzepte: schen Standard aufweisen oder völlig neue KC 쑺 Für x > x̄ wird die Anlage C eingesetzt.
Anwendungsmöglichkeiten erlauben. Insbeson-
쑺 Da die Kapazität der Anlage C jedoch auf 9000 Stück/Jahr be-
Kooperation und Hierarchie sind zum Markt- dere Unternehmen der Informations- und Kom- grenzt ist, könnte eine größere Stückzahl (bis 12 000 Stück)
prozess alternative Koordinationsmechanis- munikationsbranche sind »begehrte« Partner nur mit Anlage B – allerdings relativ unwirtschaftlich – her-
men im Wirtschaften. für solche diagonale Kooperationen. Koopera- gestellt werden.
tionen werden vor allem dann gesucht, wenn
Eine Kooperation ist eine auf freiwilliger Basis man sich im Wettbewerb unterlegen fühlt:
1000
geregelte Zusammenarbeit rechtlich und wirt- Eine Zusammenarbeit von schwächeren Markt-
schaftlich selbstständiger Unternehmen, die teilnehmern macht die Beteiligten insgesamt Kooperation: »Ich helfe dir, weil ich 1000 Produktions-
x
zumeist auf einer vertraglichen Grundlage stärker. Es ist aber auch möglich, dass gemein- mich dadurch selber besser stellen menge (x)
kann«.
basiert. Bei einer horizontalen Kooperation same Aktionen wirkungsvoller als Einzelaktio-
Marginalien: Direkt neben dem Text führen Beispiele veranschaulichen und vertiefen die
Marginalien stichwortartig durch die wesent- in der Theorie erläuterten Sachverhalte.
lichen Inhalte des Buches.
Blaue Kästen: Blau hinterlegte Kästen kenn-
zeichnen besonders wichtige Textpassagen. Sie
enthalten Definitionen, Merksätze oder wichtige
Erläuterungen.Leserhinweise
VII
Unter der Lupe: In zahlreichen Informations- Lösungsvorschläge für die Arbeitsaufgaben
kästen findet der Leser Zusatzinformationen, finden Sie im »Übungsbuch zu Grundlagen und
die der Vertiefung, Veranschaulichung oder Probleme der Betriebswirtschaft«.
Weiterführung eines Themas dienen.
Agieren in einer globalisierten Welt
2.1 Das Phänomen der Globalisierung Arbeitsaufgaben 5
26 127
Arbeitsaufgaben Kapitel 5
Unter der Lupe
Der »Internationalisierungsgrad« eines Unternehmens lässt In qualitativer Sicht unterscheidet man häufig drei Kategorien
sich anhand einer Vielzahl von Kennzahlen zum Ausdruck des »Going International« von Unternehmen: International 1. Erläutern Sie die Aussage: »Keine Entscheidung ohne Planung, 17. Was bedeutet »Dominanz« in einer Entscheidungssituation?
bringen: tätige Unternehmen sind in einigen, wenigen Ländern (selek- keine Planung ohne Ziele, keine Planung und Entscheidung
쑺 Anteil der im Ausland Beschäftigten an der Gesamt- tiv) vertreten. Sie setzen oft regionale Schwerpunkte (z. B. EU). ohne Kontrolle«! 18. Ein Entscheidungsträger hat zwischen drei Alternativen (A, B,
belegschaft,
쑺 Anteil des im Ausland erzielten Umsatzes am Gesamt-
Multinationale Unternehmen haben in vielen Ländern und
Regionen Geschäftsaktivitäten (Produktionsstätten, Absatztä-
C) zu wählen, die folgende Ergebnisse bei drei Entscheidungs-
umsatz, tigkeiten). Globale Unternehmen (»Global Player«) weisen 2. Was sind Bestandteile einer Planungs- und Entscheidungs- kriterien (I, II, III) liefern.
쑺 Anteil der im Ausland erbrachten Wertschöpfung an der ein weltweit verzweigtes Netz an Betriebsstätten auf, die je- situation?
I II III
Gesamtwertschöpfung, weils auf bestimmte Tätigkeitsbereiche spezialisiert sind (geo-
쑺 Anteil des im Ausland erzielten Gewinns zum Gesamt- graphisch fragmentierte Wertkette): So wird z. B. Forschung in 3. Welche Aufgabenfelder hat die Planung? A 50 Schlecht 1500
gewinn, Japan, die Produktion der »einfachen« (qualitätssensiblen) B 20 Mittel 700
쑺 Anteil von Ausländern in den Leitungsorganen des Produktkomponenten in China (Deutschland) und der Zusam- 4. Welche Kriterien müssen eine »gute« Planung und Kontrolle er- C 90 Mittel 600
Unternehmens, menbau des Produkts in Ungarn vollzogen, während die Unter-
füllen?
쑺 Anteil der Auslandsinvestitionen an den Gesamt- nehmenszentrale in Frankreich sitzt. Global Player richten ihre
investitionen. Produkte am Weltmarkt aus, d. h. sie sehen als Absatzmarkt Für die Bewertung der Ergebnisse ist zu unterstellen, dass der
die gesamte Welt (»globale Markterschließung«). 5. Erläutern Sie anhand von Beispielen, was Sie unter Rahmen- Entscheidungsträger bei Entscheidungskriterium I ein Ergebnis
bedingungen einer Planungs- und Entscheidungssituation ver- von 200 (0) mit 1 (0) Punkt(en) bewertet. Einem guten (mitt-
stehen. leren, schlechten) Ergebnis bei Entscheidungskriterium II weist
er 0,8 (0,5 bzw. 0,2) Punkte zu. Bei Entscheidungskriterium III
Trotz Globalisierung und Konvergenz besitzt Effekt) bezeichnet: Demnach stellt das Her- 6. Welche Rolle spielen Rahmenbedingungen für die Planung und bewertet er ein Ergebnis von 1500 (weniger als 400) mit 1 (0)
aber die geographische (nationale oder sogar re- kunftsland eines Produkts für Nachfrager eine Entscheidung? Punkt(en).
gionale) Herkunft eines Unternehmens oder ei- eigenständige (wichtige) Produkteigenschaft Hinsichtlich der Wichtigkeit der Entscheidungskriterien sieht er
nes Produkts zumindest in manchen Branchen dar, weil sie Produkten, die in bestimmten Län- 7. Welche Ansätze zur Prognose von Sachverhalten gibt es? in seinem Zielsystem Entscheidungskriterium I als doppelt so
bei den Nachfragern weiterhin eine große Be- dern gefertigt worden sind, eine besonders gute wichtig wie II und III bzw. II und III als gleich wichtig an.
Country-of-Origin-Effekt: deutung: Dies wird als »Country-of-Origin«- Qualität zuschreiben, was auch objektiv gegeben 8. Erläutern Sie die Begriffe Welche Alternative soll der Entscheidungsträger wählen?
Die länderspezifische Herkunft Effekt (Herkunftslandeffekt; made-in- sein mag. Ferner können Nachfrager einem Pro- 쑺 Zielindifferenz
eines Produkts ist für dessen
dukt einen Sympathiebonus (Antipathiemalus) 쑺 Zielkonkurrenz 19. Aufgabe 18 wird wie folgt modifiziert: Entscheidungskriterium I
Vermarktung wichtig.
geben, wenn sie das Herkunftsland »an sich« 쑺 Zielkomplementarität! ist ein Sollfaktor, II ein Mussfaktor und III ein Wunschfaktor.
Aus der Praxis mögen (hassen) und diese Ländereinstellung auf Wie könnte jetzt die Entscheidung ausfallen?
Produkte dieses Landes übertragen. Ebenso ist 9. Was ist eine Umwegs-Zielerreichung? Nennen Sie Beispiele!
… Es war nur ein Gerücht. Aber der Besucher denkbar, dass Nachfrager im Country-of-Origin- 20. Für drei Entscheidungsalternativen (a1, a2, a3) und drei mögli-
einer Fachmesse in Asien war kürzlich sehr Effekt Teile des Images des Herkunftslands auf 10. Worin besteht ein besonderes Problem von Zielbündeln und wie che Umweltentwicklungen (S1, S2, S3) gelten die folgenden Ge-
besorgt, als ihm zu Ohren kam, nun würden das Produkt im Sinne eines Generalisierungs- ist es zu lösen? winnerwartungen:
auch die Probat-Werke, dieses Urgestein des schlusses übertragen werden. Schließlich mag
deutschen Maschinenbaus, in China fertigen. S1 S2 S3
die Sympathie für ein Land bewirken, dass ein 11. Welche allgemeinen Anforderungen muss ein Zielsystem
Probat ist der weltweit größte Hersteller von Nachfrager Produkten oder Werbung über Pro- erfüllen? a1 4 6 5
Röstanlagen für die Kaffeeindustrie. Sieben dukte aus diesem Land eine größere Aufmerk- a2 3 2 6
von zehn Tassen Kaffee, die irgendwo auf der samkeit entgegenbringt, was wiederum positive 12. Was sind Unternehmensgrundsätze, welche Aufgabe haben sie, a3 7 6 3
Welt getrunken werden, entstanden aus Marketingeffekte für diese Produkte besitzt. und welches sind die Voraussetzungen ihrer Erfolgswirksam-
Bohnen, die auf Anlagen von Probat geröstet Durch die internationale Arbeitsteilung in der keit? Ermitteln Sie anhand der Ihnen bekannten Entscheidungs-
wurden. Die Mitarbeiter des Familienunterneh- Wertschöpfung vieler Produkte ist allerdings de- regeln die optimale Alternative!
mens aus Emmerich am Niederrhein konnten ren Herkunft objektiv kaum noch einem einzel- 13. Was versteht man unter Corporate Identity?
Globalisierung und die Bedeutung den Mann beruhigen: Bei Probat sei nach wie nen Land zuzuordnen. Deshalb orientieren sich 21. Für die Szenarien der Aufgabe 20 gelten folgende Eintrittswahr-
der nationalen Herkunft von Unter- vor alles »Made in Germany«. »Unsere Kunden Nachfrager oftmals daran, wo der aus ihrer Sicht 14. Was versteht man unter einer »deferred choice«? scheinlichkeiten (in Prozent):
nehmen und Produkten schließen verlangen, dass wir in Deutschland produ-
einander nicht aus. wesentliche Wertschöpfungsschritt (z. B. Pro- S1 = 30 %, S2 = 45 %, S3 = 25 %.
zieren, und das machen wir, so wie es in der duktentwicklung oder Endmontage) stattgefun- 15. Wieso sind Ziele zu planen (Zielplanung)? Ermitteln Sie die günstigste Entscheidung nach dem Erwar-
Branche Tradition ist – mit viel Guss und den hat bzw. sie sehen den Geschäftssitz des tungswertkriterium. Was wird bei dieser Entscheidungsregel
wenig Blech«, so Alleingeschäftsführer Wim Anbieters als (vermeintliches) Herkunftsland 16. Was sind Entscheidungskriterien und inwiefern eignen sie sich unterstellt?
Abbing. seiner Produkte an. Der Ort des eigentlichen als Sollgröße für die Kontrolle?
Aus: Süddeutsche Zeitung vom 23.04.2011, Produktionsprozesses verliert dann an Bedeu- 22. Was versteht man unter Risikoneutralität, Risikoscheu und
S. 24.
tung. Risikofreude?
Aus der Praxis: In dieser Rubrik werden Arbeitsaufgaben: Mit den Aufgaben am Ende
aktuelle Einsichten aus und Tendenzen in des Kapitels kann der Stoff wiederholt und
der Praxis dargestellt. vertieft werden.Inhaltsverzeichnis
Vorwort V 3.2.4.2 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Leserhinweise VI (GmbH) 55
3.2.4.3 Die amerikanische Board-Verfassung 57
1 Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe 3.2.4.4 Die Societas Europaea (SE) 58
und Grundtatbestände 1 3.2.5 Genossenschaften 59
1.1 Einführung 1 3.2.6 Sonderformen 60
1.2 Der betriebliche Transformationsprozess 4 3.2.6.1 Die GmbH & Co. KG 60
1.2.1 Die Inputfaktoren 4 3.2.6.2 Die Kommanditgesellschaft auf Aktien
1.2.2 Die Teilaufgaben des betrieblichen (KGaA) 60
Transformationsprozesses 7 3.2.6.3 Die stille Gesellschaft 61
1.2.3 Wertkette und Wertschöpfung 9 3.2.6.4 Die Europäische Wirtschaftliche Interes-
1.3 Die Eckwerte der Unternehmensführung 10 sensvereinigung (EWIV) 62
1.3.1 Das Wirtschaftlichkeitsprinzip 10 3.2.7 Rechtsformen öffentlicher Betriebe 62
1.3.2 Das erwerbswirtschaftliche Prinzip 12 3.3 Corporate Governance 64
1.3.3 Das finanzielle Gleichgewicht 16 3.3.1 Auslöser für die Corporate-Governance-
1.4 Das Stakeholder-Modell 17 Diskussion 64
1.5 Unternehmensethik 18 3.3.2 Inhalte der Corporate Governance 65
3.3.3 Regelungen der Corporate-Governance 67
2 Agieren in einer globalisierten Welt 23 3.3.4 Haftung von Organmitgliedern und die
2.1 Das Phänomen der Globalisierung 23 Business Judgment Rule 68
2.2 Die Wahl des betrieblichen Standorts 27 3.4 Hedge-Fonds und Private-Equity-Gesell-
2.3 Die Standortfaktoren 28 schaften: gefährliche Aktionäre? 70
2.3.1 Logistikkosten 28
2.3.2 Kosten der Arbeitskräfte 29 4 Kooperation und Konzentration
2.3.3 Abschreibungs- und Zinsbelastung 30 von Unternehmen 75
2.3.4 Energiekosten 30 4.1 Übersicht 75
2.3.5 Clusterleistungen 30 4.2 Formen der Kooperation 77
2.3.6 Absatzleistungen 31 4.2.1 Informelle Kooperation 77
2.3.7 Steuern und Subventionen 32 4.2.2 Die Arbeitsgemeinschaft 78
2.3.8 Staatsleistungen 34 4.2.3 Interessengemeinschaft 78
2.4 Der Wirtschaftsstandort Deutschland 35 4.2.4 Vertikale Kooperationen 79
4.2.5 Das Gemeinschaftsunternehmen
3 Rechtsformwahl und Unternehmens- (Joint Venture) 80
verfassung 41 4.2.6 Die strategische Allianz und strategische
3.1 Kaufmannseigenschaften 41 Netzwerke 81
3.2 Arten von Rechtsformen 43 4.2.7 Das Kartell 81
3.2.1 Überlegungen zur Wahl der Rechtsform 43 4.2.8 Wettbewerbsrechtliche Regelungen
3.2.2 Das Einzelunternehmen 46 von Kooperationen 82
3.2.3 Personengesellschaften 46 4.3 Die Formen von Unternehmenszusammen-
3.2.3.1 Die Offene Handelsgesellschaft (OHG) 47 schlüssen 83
3.2.3.2 Die Kommanditgesellschaft (KG) 48 4.3.1 Die verbundenen Unternehmen 83
3.2.4 Kapitalgesellschaften 49 4.3.2 Der Konzern 85
3.2.4.1 Die Aktiengesellschaft (AG) 49 4.3.3 Die Fusion 89Inhaltsverzeichnis
X
4.3.4 Betriebswirtschaftliche Probleme 7.3.1.1 Die Leistungsgerechtigkeit 158
von »Mergers« und »Acquisitions« 89 7.3.1.2 Die Marktgerechtigkeit 160
4.3.5 Feindliche Übernahme 93 7.3.1.3 Die Bedarfsgerechtigkeit 162
4.3.6 Die rechtliche Bewertung von »Mergers« 7.3.2 Die Lohngestaltung 163
und »Acquistions« 94 7.3.2.1 Der Zeitlohn 163
7.3.2.2 Der Akkordlohn 164
5 Planen, Entscheiden und Kontrollieren 99 7.3.2.3 Der Prämienlohn 166
5.1 Vorbemerkungen 99 7.3.3 Die Erfolgsbeteiligung 168
5.2 Die Bestandteile einer Planungs- 7.4 Die Lohnabzüge und die Personal-
bzw. Entscheidungssituation 101 zusatzkosten 169
5.2.1 Die Rahmenbedingungen 101 7.5 Freiwillige betriebliche Sozialleistungen 171
5.2.2 Die Zielvorstellungen 102 7.6 Cafeteria-Systeme 173
5.2.3 Die Entscheidungsalternativen 106
5.3 Der Entscheidungsprozess 107 8 Die Mitbestimmung 177
5.4 Aufstellung von Plänen 115 8.1 Interessenskonflikte zwischen Arbeit-
5.4.1 Die Flexibilität der Pläne 115 nehmer und Arbeitgeber 177
5.4.2 Die Koordination der Pläne 116 8.2 Arbeitsrechtliche Mitbestimmung 180
5.4.2.1 Die Kennzeichen der Teilpläne 116 8.3 Unternehmerische Mitbestimmung 185
5.4.2.2 Die Methoden der Koordinierung 116 8.4 Die Mitbestimmung in der Diskussion 187
5.4.3 Die Fristigkeit der Pläne 117 8.4.1 Vorbemerkungen 187
5.5 Von der Kontrolle zum Controlling 118 8.4.2 Zur Rechtfertigung der Mitbestimmung 187
5.6 Informationssysteme und Wissens- 8.4.3 Zum Umfang der Mitbestimmung 188
management 122
5.7 Risikomanagement 125 9 Die Menschenführung im Betrieb 191
9.1 Arbeit in Gruppen 191
6 Die Organisationsentscheidungen 131 9.1.1 Charakteristik von Arbeitsgruppen
6.1 Vorbemerkungen 131 und Teams 191
6.2 Die Aufbauorganisationsentscheidungen 133 9.1.2 Formelle und informelle Beziehungen
6.2.1 Das Stellengefüge 133 im Betrieb 192
6.2.2 Das Leitungsgefüge 136 9.1.3 Konflikte in Gruppen 193
6.2.3 Mögliche Organisationsformen 138 9.1.4 Führung in Gruppen 195
6.2.4 Das Kommunikationsgefüge 141 9.2 Motivationstheoretische Grundlagen
6.3 Die Ablauforganisationsentscheidungen 143 der Führung 196
6.4 Projektorganisation 146 9.2.1 Die Anreiz-Beitrags-Theorie von Simon 196
6.5 Schnittstellenmanagement 147 9.2.2 Die Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg 197
6.6 Organisatorischer Wandel und 9.2.3 Die Theorie der Leistungsmotivation 197
Change Management 148 9.2.4 Die Instrumentalitätstheorie von Vroom
und Porter/Lawler 198
7 Arbeitszeit und Arbeitsentgelt 153 9.3 Führungsstile, Managementprinzipien
7.1 Beschäftigungsformen 153 und -systeme 198
7.2 Arbeitszeitmodelle 156 9.3.1 Die Führungsstile 198
7.3 Arbeitsentgeltgestaltung 158 9.3.2 Die Managementprinzipien 199
7.3.1 Zum Problem der Lohngerechtigkeit 158Inhaltsverzeichnis
XI
9.4 Der situative Ansatz zur Führungs- 11.3.2.1 Organisationstypen
gestaltung 202 von Fertigungsverfahren 248
9.5 Spezialaspekte der Mitarbeiterführung 204 11.3.2.2 Fertigungstyp 250
9.5.1 Karriereplanung 204 11.4 Operative Produktionsplanung 253
9.5.2 Coaching 206 11.4.1 Optimale Losgröße 253
9.5.3 Personalbeurteilung 207 11.4.2 Termin- und Reihenfolgeplanung 254
11.4.3 Innerbetrieblicher Materialfluss 256
10 Die Bereitstellungsplanung 211 11.5 Qualitätssicherungssysteme 258
10.1 Vorbemerkungen 211 11.6 Umweltorientierung in der Produktion 261
10.2 Bereitstellung des Humankapitals 11.7 Integrative Ansätze der Produktions-
(Personalbedarfsdeckung) 211 planung 264
10.2.1 Inhalt der Personalplanung 211 11.7.1 Produktionsplanungs- und Steuerungs-
10.2.2 Personaleinstellung 213 Systeme 264
10.2.3 Personalentwicklung 217 11.7.2 Computer Integrated Manufacturing (CIM) 265
10.2.4 Personalfreisetzung 218 11.8 Humanisierung der Arbeit – Fiktion
10.3 Bereitstellung von Betriebsmitteln oder Wirklichkeit? 266
und Verbrauchsfaktoren 223
10.4 Besonderheiten der Bereitstellung 12 Die Absatzplanung 273
von Betriebsmitteln 224 12.1 Die Begriffsinhalte des Marketing 273
10.4.1 Die planmäßigen Abschreibungen 224 12.1.1 Marketing als optimale Gestaltung
10.4.1.1 Vorbemerkungen 224 von Transaktionen 273
10.4.1.2 Die lineare Abschreibungsmethode 224 12.1.1.1 Transaktionen: Kooperation mit Ziel-
10.4.1.3 Die geometrisch-degressive konflikt 273
Abschreibungsmethode 225 12.1.1.2 Transaktionsbeziehungen
10.4.1.4 Die digitale Abschreibungsmethode 225 aus informationsökonomischer Sicht 276
10.4.2 Die Intensität 226 12.1.1.3 Objektdefinitionen des Marketing 279
10.4.3 Die Kapazitätsanpassung 227 12.1.2 Marketing als Orientierung des Angebots
10.5 Besonderheiten der Bereitstellung von an den Bedürfnissen der Nachfrager 280
Verbrauchsfaktoren (Materialwirtschaft) 229 12.1.2.1 Verkäufer- und Käufermarkt 280
10.5.1 Vorbemerkungen 229 12.1.2.2 Der Verbrauchswirtschaftsplan eines
10.5.2 Die Bedarfsplanung 230 Haushalts 284
10.5.3 Die Vorratsplanung 231 12.1.2.3 Die Marketing-Instrumente 286
10.5.4 Die Bestellmengenplanung 233 12.1.2.4 Systematische Marktbearbeitung 288
10.5.5 Produktionssychrone Beschaffung 235 12.1.3 Marketing als (Unternehmens-)Philosophie 291
10.5.6 Lieferantenauswahl 237 12.2 Defining the Business 292
10.6 E-Procurement 239 12.3 Zielgruppenbildung und Markt-
segmentierung 297
11 Die Produktionsplanung 243 12.4 Strategischer Wettbewerbsvorteil 301
11.1 Vorbemerkungen 243 12.5 Kundenbindung und Relationship-
11.2 Auftragsproduktion und Marktproduktion 243 Marketing 306
11.3 Strategische Produktionsplanung 244 12.6 Guerilla-Marketing 309
11.3.1 Fertigungstiefe 244
11.3.2 Wahl des Fertigungsverfahrens 248Inhaltsverzeichnis
XII
13 Die Preispolitik 315 14.6 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen
13.1 Aufgabenbereiche der Preispolitik zur Werbepolitik 363
und des Preismanagements 315 14.7 Werbekritik 368
13.2 Behavioral Pricing 317 14.7.1 Werbung als Information 368
13.3 Abbildung des Marktresponses 14.7.2 Werbung als Manipulation 368
auf den Preis 320 14.7.3 Werbung und Konsumlenkung 370
13.4 Grundmodelle der Preiskalkulation 322 14.7.4 Werbung als Geldverschwendung 370
13.4.1 Das magische Dreieck in der Preispolitik 322
13.4.2 Kostenorientierte Preispolitik 323 15 Die Produktpolitik 375
13.4.3 Marktorientierte Preispolitik 325 15.1 Der Produkt-Mix 375
13.4.3.1 Absatz-, Umsatz-, Kosten- und Gewinn- 15.2 Das Produkt als Transaktionsobjekt
treiberwirkung des Preises 325 des Unternehmens 377
13.4.3.2 Preispolitik im Monopol 326 15.2.1 Der generische Produktbegriff 377
13.4.4 Marktorientierte Preispolitik 15.2.2 Der Produktmarktraum 379
im heterogenen Polypol 328 15.3 Planungsinstrumente zur Identifizierung
13.4.5 Marktorientierte Preispolitik von produktpolitischem Handlungsbedarf 381
im heterogenen Oligopol 329 15.3.1 Vorbemerkungen 381
13.5 Preisdifferenzierung 331 15.3.2 Umsatz- und Deckungs-
13.6 Rechtliche Rahmenbedingungen beitragsstrukturanalyse 381
der Preispolitik 335 15.3.3 Die Produkt-Portfolio-Methode 382
13.6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 15.3.4 Der Produktlebenszyklus 383
der Preispräsentation 335 15.4 Innovationsmanagement 388
13.6.2 Rechtliche Rahmenbedingungen 15.4.1 Arten von Produktinnovationen 388
der Preishöhe 336 15.4.2 Systematische Innovationsentwicklung 389
13.6.3 Preisabsprachen 338 15.4.3 Schutzrechte für Innovationen 391
13.6.4 Vertikale Preisbindungen 339 15.5 Die Markenpolitik 393
15.5.1 Begriff und Funktionen der Marke 393
14 Die Kommunikationspolitik 343 15.5.2 Markenwert 398
14.1 Die Kommunikationsinstrumente 343 15.5.3 Markenstrategien 399
14.1.1 Mediawerbung 343 15.6 Die Servicepolitik 402
14.1.2 Verkaufsförderung 348 15.7 Die Sortimentsgestaltung im Handel 403
14.1.3 Direktwerbung 348 15.8 Die Haftung für Produktfehler 405
14.1.4 Werbung »below the line« 349
14.1.5 Öffentlichkeitsarbeit 350 16 Die Vertriebspolitik 411
14.1.6 Technologische Entwicklungen 350 16.1 Charakteristik des Vertriebs 411
14.2 Verhaltenswissenschaftlicher Hintergrund 16.2 Unternehmenseigene Vertriebsorgane 413
zur Kommunikation 351 16.3 Die Absatzhelfer 415
14.3 Werbegestaltung 354 16.4 Der unternehmensgebundene Vertrieb 417
14.4 Die Planung von Umfang und Streuung 16.5 Der Handel als Absatzmittler 421
des Werbebudgets 356 16.6 Vertrieb über Internet (E-Commerce) 424
14.4.1 Der Umfang des Werbebudgets 356
14.4.2 Die Streuung des Werbebudgets 358 17 Die Investitionsplanung 429
14.5 Die Werbewirkungsanalysen 360 17.1 Grundlagen der Investitionsrechnung 429Inhaltsverzeichnis
XIII
17.1.1 Charakter der Investitionsplanung 429 19 Grundlagen des externen Rechnungs-
17.1.2 Die Zinsrechnung 430 wesens 499
17.1.3 Die Idee des Diskontierens von Zahlungen 434 19.1 Die Aufgaben des betrieblichen Rechnungs-
17.2 Statische Investitionsrechenverfahren 436 wesens 499
17.2.1 Die Kostenvergleichsrechnung 436 19.2 Der Zusammenhang zwischen Bilanz
17.2.2 Die Gewinnvergleichsrechnung 439 und Gewinn- und Verlustrechnung 501
17.2.3 Die Rentabilitätsrechnung 439 19.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
17.2.4 Die statische Amortisationsrechnung 439 führung (GoB) 503
17.3 Dynamische Investitionsrechenverfahren 440 19.3.1 Charakteristik der GoB 503
17.3.1 Die Kapitalwertmethode 440 19.3.2 Der Grundsatz der Richtigkeit und Willkür-
17.3.2 Die Methode des internen Zinssatzes 445 freiheit (§ 239 Abs. 2 HGB) 503
17.3.3 Die Horizontwertmethode 446 19.3.3 Der Grundsatz der Klarheit (§§ 238 Abs. 1
17.3.4 Der vollständige Finanzplan 447 Satz 2, 243 Abs. 2 und 247 Abs. 1 HGB) 504
17.4 Die Bestimmung der wirtschaftlichen 19.3.4 Der Grundsatz der Vollständigkeit
Nutzungsdauer und des optimalen Ersatz- (§§ 239 Abs. 2 und 246 Abs. 1 HGB) 504
zeitpunktes 450 19.3.5 Der Grundsatz der Stetigkeit 505
17.5 Zum Problem der Unsicherheit 19.3.6 Der Grundsatz der Vorsicht (§§ 252 Abs. 1
in der Investitionsplanung 451 Nr. 4 und 253 Abs. 1–4 HGB) 505
17.6 Investitionscontrolling 453 19.3.7 Der Grundsatz der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) 506
18 Die Finanzplanung 459 19.3.8 Die Abgrenzungsgrundsätze 506
18.1 Vorbemerkungen 459 19.3.9 Das Prinzip der Geheimhaltung 506
18.2 Die Außenfinanzierung 461 19.4 Internationale Rechnungslegungsstandards 507
18.2.1 Die Beteiligungsfinanzierung 461
18.2.2 Die Finanzierung durch Fremdkapital 20 Der handelsrechtliche Einzelabschluss 511
(Kreditfinanzierung) 467 20.1 Die Verpflichtung zur Rechnungslegung 511
18.2.2.1 Charakteristik 467 20.2 Der Ablauf der Rechnungslegung 512
18.2.2.2 Die Industrieobligation 20.3 Die Bilanz 514
(Teilschuldverschreibung, Anleihe) 469 20.3.1 Der Aufbau der Bilanz 514
18.2.2.3 Die Wandelanleihe 20.3.2 Die Positionen der Aktivseite und ihre
(Wandelschuldverschreibung) 472 Bewertung 515
18.2.2.4 Die Optionsanleihe 20.3.2.1 Die Sachanlagen 515
(Optionsschuldverschreibung) 473 20.3.2.2 Die Finanzanlagen 518
18.2.2.5 Sonstige langfristige Kreditformen 474 20.3.2.3 Das Umlaufvermögen 519
18.2.2.6 Die kurzfristigen Kreditformen 476 20.3.2.4 Die immateriellen Vermögensgegenstände 521
18.2.2.7 Kreditsubstitute 477 20.3.2.5 Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten 523
18.2.3 Mezzanine-Kapital 480 20.3.3 Die Positionen der Passivseite und ihre
18.3 Die Innenfinanzierung 481 Bewertung 524
18.4 Die Liquiditätsplanung 484 20.3.3.1 Das Eigenkapital 524
18.5 Termingeschäfte 486 20.3.3.2 Die Verbindlichkeiten 526
18.6 Zur Frage der »optimalen« Kapitalstruktur 492 20.3.3.3 Die Rückstellungen 527
18.7 Der Preis für Risiko 494 20.3.3.4 Der passive Rechnungsabgrenzungs-
posten 529Inhaltsverzeichnis
XIV
20.3.3.5 Der Sonderposten mit Rücklageanteil 530 23.3.3.2 Die Zuschlagskalkulation 578
20.4 Die Gewinn- und Verlustrechnung 530 23.3.3.3 Die Divisionskalkulation 579
20.5 Der Anhang 534 23.3.3.4 Die Äquivalenzziffernrechnung 580
20.6 Der Lagebericht 535 23.4 Elemente der Kostentheorie 581
20.7 Weitere Berichte des Vorstands auf der 23.4.1 Übersicht 581
Ebene eines einzelnen Unternehmens 536 23.4.2 Die Kosteneinflussgrößen 581
23.4.2.1 Die technisch-organisatorischen
21 Die Konzernrechnungslegung 541 Produktionsbedingungen 581
21.1 Verpflichtung zur Konzernrechnungslegung 23.4.2.2 Die Faktorpreise 581
und Konsolidierungskreis 541 23.4.2.3 Der Beschäftigungsgrad 582
21.2 Handelsbilanz II und Summenbilanz 543 23.4.2.4 Die Betriebsgröße 585
21.3 Die Kapitalkonsolidierung 544 23.4.2.5 Das Fertigungsprogramm 585
21.3.1 Die Neubewertungsmethode 544 23.4.3 Anpassungsstrategien bei Veränderungen
21.3.2 Die Buchwertmethode 546 des Beschäftigungsgrads 585
21.3.3 Die Folgekonsolidierung 547 23.5 Kostenrechnungssysteme 587
21.4 Die Schuldenkonsolidierung 547 23.5.1 Die Vollkostenrechnung 587
21.5 Die Eliminierung von Zwischenerfolgen 548 23.5.2 Die Prozesskostenrechnung 588
21.6 Alternative Kapitalkonsolidierungs- 23.5.3 Teilkostenrechnungen 590
methoden 549 23.5.4 Die Plankostenrechnung 592
23.5.5 Zero-Base-Budgeting
22 Bilanzanalyse und Bilanzkritik 553 und Gemeinkostenwertanalyse 593
22.1 Das Ziel der Bilanzanalyse 553
22.2 Die Kennzahlenanalyse 555 24 Die Unternehmensbewertung 597
22.2.1 Die Bildung von Aggregatdaten 556 24.1 Charakteristik der Unternehmensbewertung 597
22.2.2 Die Bildung von Kennzahlen 558 24.2 Ein konzeptionelles Modell zur Bestimmung
22.3 Der Cashflow 562 von Unternehmenswerten 599
22.4 Die Kapitalflussrechnung 564 24.3 Die Discounted-Cashflow-Methode 600
22.5 Bilanzanalyse als Risikoanalyse 566 24.4 Alternative Unternehmenswerte der Praxis 602
22.6 Die Segmentberichterstattung 566
22.7 Die Bilanzkritik 567 25 Der Lebenszyklus eines Unternehmens 605
25.1 Vorbemerkungen 605
23 Das interne Rechnungswesen 571 25.2 Die Unternehmensgründung 605
23.1 Aufgaben des internen Rechnungswesens 571 25.2.1 Gründungsmodalitäten 605
23.2 Der Kosten- und Leistungsbegriff 25.2.2 Die Unternehmensgründung als betriebs-
im internen Rechnungswesen 573 wirtschaftliches Problem 606
23.3 Die Betriebsabrechnung 575 25.3 Das Unternehmenswachstum 610
23.3.1 Die Kostenartenrechnung 575 25.4 Die Unternehmensnachfolge 612
23.3.2 Die Kostenstellenrechnung 576 25.5 Unternehmenskrisen und Sanierung 615
23.3.2.1 Die Aufgabe der Kostenstellenrechnung 576 25.6 Die Insolvenz 618
23.3.2.2 Die Bildung der Kostenstellen 576
23.3.2.3 Die Kostenumlage auf Kostenstellen 576 Sachregister 625
23.3.3 Die Kostenträgerrechnung 578
23.3.3.1 Die Aufgabe der Kostenträgerrechnung 5781 Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe
und Grundtatbestände
Z
Lernziele
쑺 Leitfrage: Was sind Erfahrungs- und Was versteht man unter der Wertschöpfung im
Erkenntnisobjekt der Betriebswirt- betrieblichen Transformationsprozess?
schaftslehre? Welche Rolle spielen das Wirtschaftlichkeits-
Wie unterscheiden sich Betriebe und Unter- prinzip und das erwerbswirtschaftliche Prinzip
nehmen? Was sind die Erkenntnisziele der im betrieblichen Transformationsprozess?
Betriebswirtschaftslehre? Was besagt das finanzielle Gleichgewicht?
쑺 Leitfrage: Welche Charakteristika weist der 쑺 Leitfrage: Was besagt das Stakeholder-
betriebliche Transformationsprozess auf? Modell für das Wirtschaften eines
Welche Produktionsfaktoren werden als Input Unternehmens?
eingesetzt?
쑺 Leitfrage: Wie passen Betriebswirtschafts-
Aus welchen Teilaufgaben setzt sich der be-
lehre und Unternehmensethik zusammen?
triebliche Transformationsprozess zusammen?
1.1 Einführung
Jede Wissenschaft besitzt ein Erfahrungs- und schaftens ist hierbei das Treffen von Entschei-
ein Erkenntnisobjekt sowie Erkenntnisziele: dungen (wirtschaftliches Handeln), um
Das Erfahrungsobjekt kennzeichnet den wahr- 쑺 eine optimale (bestmögliche) Zielerfüllung
nehmbaren Realitätsausschnitt, der den Hinter- unter Beachtung der begrenzten Mittel zu
grund bzw. Ausgangspunkt des Erkenntnisstre- erreichen bzw.
bens darstellt, bzw. innerhalb dessen sich die 쑺 den Bestand an verfügbaren Mitteln zu ver-
Erkenntnisobjekte manifestieren. Das Erkennt- größern.
nisobjekt beschreibt dann Tatbestände inner-
halb des Erfahrungsobjekts, worüber Wissen ge- In einer pragmatischen Sicht besteht das Er- Wirtschaften: das Umgehen mit
wonnen werden soll. Welcher Art dieses Wissen fahrungsobjekt der Wirtschaftswissenschaften dem Knappheitsproblem
ist, beinhalten die Erkenntnisziele. im Marktprozess und seinen Akteuren. Da es –
In einer abstrakten Definition ist das Erfah- zum Glück – keine geschlossene Hauswirtschaft
rungsobjekt der Wirtschaftswissenschaften der (»Robinson Crusoe«-Welt) gibt, bestehen zwi- Tatbestand der Knappheit: Den
Tatbestand der Knappheit von Ressourcen und schen den Akteuren (Wirtschaftssubjekten) Zielen, die ein Akteur hat, stehen
nur begrenzte Mittel zur Erreichung
das hieraus folgende Erfordernis des Wirtschaf- ökonomische Austauschbeziehungen (Trans- der Ziele zur Verfügung.
tens: Allgemein stehen einem Akteur nur be- aktionen). Der Markt ist hierbei der abstrakte
grenzte Mittel zur Erreichung seiner Ziele zur Ort des Tausches, d. h. der Ort, an dem die Trans-
Verfügung: Eine Person hat ein begrenztes Zeit- aktionsbeziehungen stattfinden.
budget für ihre verschiedenen Freizeitaktivitä- Diese Charakterisierung führt zur prinzipiel- Charakteristik einer Transaktions-
ten; das begrenzte Einkommen des Nachfragers len Unterscheidung von Anbieter und Nachfra- beziehung ist, dass ein Akteur eine
Leistung einem anderen Akteur
verhindert, dass er die Summe seiner Konsum- ger. Je nach Art der angebotenen Leistung las- anbietet und hierfür eine monetäre
wünsche erfüllen kann. Ein Unternehmer hat sen sich verschiedene Märkte unterscheiden: Gegenleistung (Preis) von ihm
nicht das »Geld« (Kapital) all seine Investitions- Auf dem Gütermarkt offerieren Betriebe Kon- erhalten will.
projekte zu finanzieren bzw. nicht genügend ei- sum-, Investitionsgüter oder Dienstleistungen,
genes Kapital, den geplanten Produktionspro- die sie gegen einen Preis privaten Haushalten
zess durchzuführen. Charakteristik des Wirt- (Konsumenten) für ihre Konsumzwecke oderBetriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundtatbestände
1.1 Einführung
2
anderen Betrieben für deren Produktionspro- Ebenso wie der Eigentümer den Gewinn aus
zesse überlassen. Auf dem Arbeitsmarkt bieten seiner unternehmerischen Tätigkeit »ein-
private Haushalte (Arbeitnehmer) gegen Lohn streicht«, muss er aber auch einen etwaigen
ihre Arbeitskraft an. Diesen »Faktor Arbeit« be- Verlust tragen. Dies ist sein unternehmeri-
nötigen wiederum Betriebe, d. h. die Arbeitgeber sches Risiko. Eine etwas anders fokussierte
zur Durchführung ihrer Produktionsprozesse. Begriffsinterpretation des Privateigentums
Auf dem Kapitalmarkt stellen Akteure (Inves- beinhaltet, dass keine staatliche Institution,
toren, Kapitalgeber) anderen Haushalten und d. h. die »öffentliche Hand« Eigentümer des
Betrieben (Kapitalnehmer) »Geld« (Kapital) zur Betriebs ist.
Verfügung, wobei sie als Preis hierfür Zinsen, so-
wie bei befristeter Überlassung des Kapitals des- Neben Unternehmen gibt es gemeinnützige
sen Rückzahlung erhalten wollen. oder öffentliche Betriebe: Gemeinnützige Be-
Während das Erfahrungsobjekt für Betriebs- triebe (Non-Profit-Organisationen) verfolgen
und Volkswirtschaftslehre, die beiden großen aufgrund externer Auflagen oder ihrer Satzung
Der Betrieb ist eine planvoll organi- Teilbereiche der Wirtschaftswissenschaften, iden- keine Gewinnerzielung, sondern streben ledig-
sierte Wirtschaftseinheit, in der tisch ist, unterscheiden sich beide Disziplinen in lich eine langfristige Kostendeckung an: Der er-
Sachgüter und Dienstleistungen
erstellt und an Nachfrager ihrem jeweiligen Erkenntnisobjekt: Die Betriebs- zielte Umsatz aus dem Verkauf der Leistungen
abgesetzt werden. Dies konstituiert wirtschaftslehre will Erkenntnisse über wirt- deckt die Betriebskosten ab. Bei öffentlichen
den betrieblichen Transformations- schaftliches Handeln, d. h. ökonomische Entschei- Betrieben ist wesentlicher Eigentümer die öf-
prozess.
dungen und Prozesse in Betrieben gewinnen. fentliche Hand, wobei diese Betriebe zumeist
Umgangssprachlich werden die Begriffe »Be- auch nach dem Kostendeckungsprinzip (z. B.
Jedes Unternehmen ist ein Betrieb, trieb« und »Unternehmen« (»Unternehmung«) städtische Versorgungsbetriebe) oder sogar nach
aber nicht jeder Betrieb ist synonym verstanden. Die Betriebswirtschafts- dem Zuschussprinzip (z. B. Museen, Theater,
ein Unternehmen.
lehre differenziert hingegen: Unternehmen Sozialeinrichtungen) agieren. Im letzteren Fall
(Unternehmungen) sind marktwirtschaftlich ori- muss die öffentliche Hand einen Zuschuss aus
entierte Betriebe, die sich durch folgende Merk- ihrem Haushalt zur Abdeckung der »Betriebs-
male auszeichnen: kosten« leisten, da der Betrieb selbst über den
쑺 Autonomieprinzip: Der Eigentümer des Un- Verkauf seiner Leistungen keinen hierfür ausrei-
ternehmens ist in seinen betrieblichen Ent- chenden Umsatz erzielt. Wenngleich alle Arten
Unternehmen folgen dem Autono- scheidungen (z. B. Preise, Produkte, Wahl des von Betrieben Erkenntnisobjekt der Betriebs-
mieprinzip, dem erwerbswirtschaft- Mitarbeiters oder der Kapitalgeber) weitge- wirtschaftslehre sind, konzentriert sich das
lichen Prinzip und unterliegen dem
Prinzip des Privateigentums. hend frei und keiner staatlichen Lenkungsbe- Forschungsinteresse auf die Unternehmen, für
hörde unterworfen. Auch das Prinzip der Ver- öffentliche Betriebe hat sich die Spezialdisziplin
tragsfreiheit ist Ausdruck dieser Autonomie. der »Öffentlichen Betriebswirtschaftslehre«
Einschränkungen des Handlungsspielraums herausgebildet.
bestehen allerdings durch die gesetzlichen Weitere zum Betrieb verwandte Begriffe sind:
Rahmenbedingungen. »Firma« beinhaltet den juristischen Begriff für
쑺 Erwerbswirtschaftliches Prinzip: Das un- den Namen, unter dem ein Unternehmer (»Kauf-
Gemeinnützige Betriebe arbeiten ternehmerische Bestreben ist, durch die Pro- mann«) seinen Betrieb im Handelsregister ein-
nach dem Kostendeckungsprinzip, duktion und den Absatz (Vermarktung) von getragen hat (Unternehmensname). »Fabrik«
öffentliche Betriebe mitunter sogar
nach dem Zuschussprinzip. Gütern Gewinne zu erzielen (Gewinnstreben bzw. »Werk« kennzeichnen physische Produk-
bzw. Gewinnmaximierung). tionsstätten. Das Steuerrecht verwendet ferner
쑺 Privateigentum: Die Verfügungsrechte an den Terminus »Gewerbebetrieb« (§ 15 Abs. 2
den Produktionsmitteln und am Gewinn ste- Einkommensteuergesetz, EStG: selbstständige,
hen den Eigentümern zu (kein »Volksvermö- auf Dauer angelegte Beteiligung am wirtschaft-
gen«): Dies sind diejenigen Personen, die lichen Verkehr mit Gewinnerzielungsabsicht).
dem Unternehmen Kapital ohne zeitliche Be-
fristung (Eigenkapital) überlassen. Der Ge- Das Erkenntnisziel beschreibt, welche Art von
winn, den das Unternehmen erzielt, stellt Wissen über das Erkenntnisobjekt gewonnen
den »Zins« auf ihr eingesetztes Kapital dar. werden soll. Für die Betriebswirtschaftslehre alsEinführung 1.1
3
Unter der Lupe
Die Transaktionskostentheorie als Beispiel für eine Typologisierung
betriebswirtschaftlicher Sachverhalte
Transaktionskosten sind »Betriebskosten des Wirtschafts- 쑺 Kontrolle und Anpassung (ex-post Transaktionskosten):
systems« (Kenneth J. Arrow, Nobelpreisträger 1972) bzw. die Kosten für Überwachung der Leistung des Transaktionspart-
»Kosten der Markttransaktionen« (Ronald H. Coase, Nobel- ners (Agency Costs, Monitoring Costs), Verhandlungskos-
preisträger 1991). Sie entstehen in allen »Phasen« einer ten bei Vertragsänderungen, Kosten für die Änderung der
Transaktion: Leistungen des Transaktionspartners.
쑺 Anbahnung (ex-ante Transaktionskosten): Kosten für die Transaktionskosten müssen nicht nur monetären Charakter
Suche nach geeigneten Transaktionspartnern, Kommuni- haben (z. B. Zeitaufwand für das Auffinden eines geeigneten
kationskosten, Screening-Costs (Kosten für Informations- Transaktionspartners), sie lassen sich aber in der Regel mone-
suche), Signalling-Kosten (Kosten, dem Transaktionspart- tär bewerten. Folge von Transaktionskosten ist, dass sie aus
ner den eigenen Leistungswillen und die Leistungsfähigkeit Sicht des Nachfragers als »Kostenbestandteile« auf den Pro-
zu verdeutlichen). duktpreis aufgeschlagen werden bzw. aus Sicht des Anbieters
쑺 Durchführung: Vereinbarungs- bzw. Verhandlungskosten, die Produktionskosten erhöhen. Aus Sicht einer Transaktions-
Absicherungskosten (Risikoübernahme in Transaktionen), beziehung verringern sie den »Einigungsbereich« zwischen
Kosten für die Vertragsdurchsetzung, Beendigungskosten beiden Transaktionspartnern. Zielsetzung ist es, intelligente
(Kosten für die vorzeitige Beendigung einer Transaktions- Transaktionsdesigns zu schaffen, um Transaktionskosten zu
beziehung). reduzieren. Dies ist das Gestaltungsziel der Transaktionskos-
tentheorie.
Wissenschaft lassen sich diese Erkenntnisziele Theorien nur für spezifische Sachverhalte
wie folgt charakterisieren: bilden lassen (Partialerklärungen).
쑺 Beschreibungsziel: Die reine Deskription 쑺 Gestaltungsziel: Gegenstand ist die Formu-
realer (betrieblicher) Sachverhalte stellt für lierung von Handlungsempfehlungen im
sich noch kein eigenständiges betriebswirt- Hinblick auf vorgegebene Ziele. Dies betrifft
schaftliches Erkenntnisziel dar. Sie erhält je- vor allem die Optimierung der betrieblichen
doch durch die Verwendung einer Terminolo- Prozesse und Entscheidungsprobleme, was
gie (»Wortung der Welt« durch Fachbegriffe) auch als entscheidungsorientierter Ansatz
und Systematisierung der Vielfalt betriebs- der Betriebswirtschaftslehre bekannt ist.
wirtschaftlicher Sachverhalte (Klassifizie- Handlungsempfehlungen lassen sich zum ei-
rung, Typenbildung) einen wissenschaftli- nen durch Beobachtung und Erfahrung ge-
chen Charakter. winnen. Ein solches Erfahrungslernen ist der
쑺 Erklärungsziel: Ziel ist die Gewinnung von typische Ansatz, den Unternehmensberatun-
»gesetzesartigen« Aussagen (wenn-dann- gen verfolgen. Ein zweiter Ansatz ist die An-
bzw. Ursache-Wirkungsbeziehungen) über be- wendung von betriebswirtschaftlichen Theo-
triebliche Sachverhalte: So kann eine sehr rien: Aufgrund der »wenn-dann«-Aussagen
einfache Theorie z. B. postulieren, dass der einer Theorie lässt sich bestimmen, welche
Krankenstand in einem Betrieb zurückgeht, Entscheidung unter bestimmten Rahmen- Erklärungsziel: Die Praxis ist nicht
wenn den Mitarbeitern eine flexible Arbeits- bedingungen eine bestimmte Wirkung ergibt der Feind der Theorie, sondern ihr
größter Anreiz.
zeit eingeräumt wird, weil dadurch die bzw. welche Wirkung welche Handlungen
Motivation der Arbeitnehmer ansteigt und erfordert. Einen Spezialfall dieses theorie-
das »Blaumachen« zurückgeht. Theorien ver- gestützten Vorgehens beinhaltet die explizite
wenden für ihre Aussagen häufig ihre eigene Problemlösung durch Anwendung mathemati-
Terminologie, was das Anfangsverständnis scher Optimierungsmodelle oder Simulations-
bisweilen erschwert. Die Probleme betriebs- rechnungen. Dies setzt aber voraus, dass sich
wirtschaftlicher Theoriebildung liegen al- das Entscheidungsproblem ausreichend gut
lerdings darin, dass – anders als z. B. in der (formal) darstellen lässt, was bei vielen, vor
Physik – »Naturgesetze« fehlen und sich auf- allem strategischen betriebswirtschaftlichen
grund der Vielfalt betrieblicher Phänomene Entscheidungsproblemen nicht der Fall ist.Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Grundtatbestände
1.2 Der betriebliche Transformationsprozess
4
1.2 Der betriebliche Transformationsprozess
1.2.1 Die Inputfaktoren aber nicht Bestandteil des Outputs. Dies sind
vor allem Energiestoffe bzw. sonstige Stoffe
Aufgabe eines Betriebes ist, Input aufzuneh- (z. B. Schmiermittel), die für die Funktionsfä-
men, diesen umzuwandeln und als Output abzu- higkeit der Betriebsmittel notwendig sind.
geben (Abbildung 1-1). Diese Umwandlung kon- Auch Verbrauchsmaterial (»Büroartikel«), das
stituiert den betrieblichen Transformations- Mitarbeiter im Rahmen ihrer Tätigkeiten be-
prozess. Mit ihm wird ein wirtschaftlicher Zweck nötigen, haben den Charakter von Betriebs-
verfolgt: die Produktion und der Verkauf von stoffen.
Gütern oder Dienstleistungen. 쑺 Werkstoffe sind alle Roh-, Halb- und Fertig-
fabrikate (Bauteile, Komponenten), die durch
Abb. 1-1 Be- und Verarbeitung im Produktionsprozess
zum Bestandteil des Erzeugnisses werden.
Grundstruktur des betrieblichen Transformationsprozesses Man spricht von Zulieferteilen, wenn diese
Werkstoffe von anderen Betrieben bezogen
werden.
Input Betrieb Output
Arbeitsleistungen lassen sich nach der Art der
Arbeit in objektbezogene (ausführende) und
dispositive (leitende) Arbeitsleistungen glie-
Input sind die betrieblichen Produktionsfakto- dern.
ren, der Output konkretisiert sich in Produkten 쑺 Objektbezogene Arbeitsleistungen befassen
(Güter, Dienstleistungen). Die Aufnahme des In- sich ausschließlich mit der unmittelbaren
puts bzw. Abgabe des Outputs konstituiert die Durchführung der betrieblichen Vorgänge.
Transaktionen des Betriebs auf den Beschaf- Hierzu zählen auch Betriebsdienste, die den
fungs- bzw. Absatzmärkten. Produktionsprozess unterstützen (z. B. Wach-
Ein traditionelles System der betrieblichen dienst, Putzdienst, Pförtner, Kantine, Sekre-
Produktionsfaktoren geht auf E. Gutenberg tariate). Diese Arbeitsleistungen werden
(1897–1984) zurück. Er unterscheidet »elemen- ebenfalls zu den Elementarfaktoren gerech-
tare Produktionsfaktoren« (Elementarfakto- net.
ren) und »dispositive Arbeitsleistungen« (Ab- 쑺 Dispositive Arbeitsleistungen sind die Tätig-
bildung 1-2). keiten, die sich mit der Leitung und Lenkung
Zu den Elementarfaktoren zählt der gesamte der betrieblichen Vorgänge beschäftigen. Dies
Die betrieblichen Inputfaktoren sachliche Input des Betriebs: wird als Management bezeichnet. Die spezi-
sind Betriebsmittel, Betriebs- und 쑺 Betriebsmittel sind alle im Betrieb ver- fischen Managementleistungen setzen sich
Werkstoffe, sowie objektbezogene
und dispositive Arbeitsleistungen. wendeten Anlagen und Gegenstände, die aus der Planung, dem Treffen von Entschei-
nicht Bestandteil des Outputs werden, dungen (Führungsentscheidungen), ihrer
hierzu gehören z. B. Grundstücke, Gebäude, Durchführung (Organisation), der Kontrolle,
Die Managementaufgaben: Planen, Maschinen sowie Werkzeuge. Der Kauf von der Dokumentation und der Mitarbeiterfüh-
Entscheiden, Durchführen, Kontrol- Betriebsmitteln wird als Investition be- rung zusammen.
lieren, Dokumentieren und Führen.
zeichnet. Betriebsmittel verschleißen durch
ihren Einsatz im betrieblichen Transformati- Entscheidungen als »Herzstück« der dispositiven
onsprozess; ihr Nutzungspotenzial wird klei- Arbeitsleistungen weisen eine unterschiedliche
ner, bis es gänzlich aufgebraucht ist. Dieser Tragweite für das Unternehmen auf:
Verschleiß wird als Abschreibung bezeich- 쑺 Originäre Führungsentscheidungen sind
net. solche, die den Weitblick und das »Finger-
쑺 Betriebsstoffe gehen im betrieblichen Trans- spitzengefühl« eines »dynamischen Unter-
formationsprozess physisch »unter«, werden nehmers« erfordern. Solche strategischenDer betriebliche Transformationsprozess 1.2
5
Entscheidungen, die für das Unternehmen Abb. 1-2
eine große Tragweite besitzen, sind nicht -
delegierbar und im Vorhinein auch nicht be- Das System der betrieblichen Produktionsfaktoren
wertbar: Der Markt muss erweisen, ob die
Entscheidung gut (im Gewinnfall) oder
Betriebliche
schlecht (im Verlustfall) war. Typische origi- Produktionsfaktoren
näre Führungsentscheidungen betreffen die
Einführung neuer Produkte oder Produkti-
onsverfahren sowie das Aufspüren neuer Be-
schaffungs- und Absatzmärkte. Konstitutive Dispositive
Elementarfaktoren
Führungsentscheidungen werden einmalig Arbeitsleistungen
oder nur sehr selten getroffen und sind nicht
originäre Entscheidungen objektbezogene
mehr oder nur unter hohen Kosten revidier- Arbeitsleistungen
bar (z. B. Rechtsformwahl; Standortwahl; Fu- derivative Entscheidungen
sion mit anderen Unternehmen). Originäre Betriebsmittel
Führungsentscheidungen trifft das Top- Betriebsstoffe
Management (Geschäftsführung). Gerne se-
hen sich die Top-Manager hierbei als »Unter- Werkstoffe
nehmer«.
쑺 Derivative Führungsentscheidungen sind
solche, die sich aus den originären ableiten
und an Spezialisten delegierbar sind. Sie ab, die mit den betreffenden Entscheidungs-
rechnen oftmals zur Gruppe der leitenden feldern besonders gut vertraut sind (Delega-
Angestellten, die die »zweite Reihe« der Ge- tion). Diese Mitarbeiter zählen zumeist zum
schäftsführung bilden. Viele Entscheidungen »mittleren Management« des Betriebs.
in Betrieben sind allerdings keine eigentli-
chen Führungsentscheidungen, sondern be- Die Leitung und Lenkung der betrieblichen Vor-
treffen deren Umsetzung. Bei diesen operati- gänge erschöpft sich nicht im Treffen von Ent-
ven Entscheidungen tritt die Geschäftsfüh- scheidungen: Weitere, die Entscheidungen vor-
rung Entscheidungskompetenz an Mitarbeiter bereitende bzw. ihnen folgende Aufgaben sind:
Unter der Lupe
Unternehmertum
Die Wirtschaftsgeschichte kennt eine Viel- Schumpeter (1883–1950) hob bei seinem
zahl von Unternehmerpersönlichkeiten, und »dynamischen Unternehmer« vor allem
mancher Name findet sich noch heute in der den Entdecker- und Pioniergeist hervor.
Firmenbezeichnung renommierter Anbieter Heutzutage werden Sozialverantwortung und
(z. B. Siemens, Daimler-Benz, Porsche). Nachhaltigkeit im Handeln als weitere we-
Dass man Unternehmertum »nicht erlernen sentliche Merkmale eines »guten« Unterneh-
könne, sondern hat«, ist weithin akzeptiert. mers angesehen.
Über die Persönlichkeitsmerkmale des Unter- Zu den Persönlichkeitsmerkmalen müssen
nehmers gehen die Ansichten allerdings aber in jedem Fall noch günstige gesell-
auseinander. schaftliche Rahmenbedingungen und persön-
So brachte ihn Max Weber (1864–1920) liche Leistungsbereitschaft hinzutreten:
mit der protestantischen Ethik in Verbin- Die Aussicht auf Gewinne hält die »Unter-
dung und ordnete ihm die Merkmale Kalku- nehmergesellschaft« hellwach und verleiht
lation und Askese zu. Werner Sombart ihr eine Dynamik und Flexibilität, die keine
(1863–1941) sah hingegen Wagemut und andere Wirtschaftsform aufzuweisen hat und
Abenteuerlust als seine herausragenden selbst Schumpeter in dieser Kraft nicht
Charaktereigenschaften an. Joseph A. voraussah.Sie können auch lesen