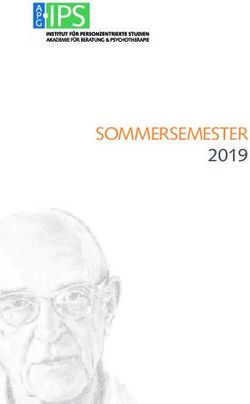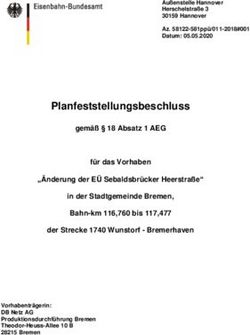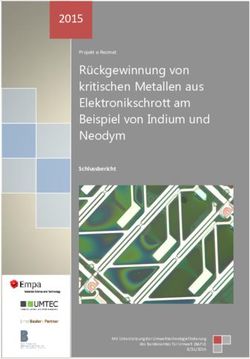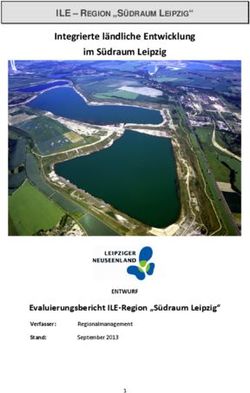Businessplan für Integration gehörloser SeniorInnen in ein Altersheim
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Businessplan für Integration
gehörloser SeniorInnen in
ein Altersheim
Unter dem Aspekt der Sozialen Investitionen
Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Arts in Business
FH Oberösterreich
Studiengang: Sozial-und Verwaltungsmanagement, Linz
Studienzweig: Sozialmanagement
Maria BONIS-BIRO 09/1/0562/034
Gutachter: Mag. Dr. Thomas Prinz
Traun, 25.9.2012
Seite 0Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre an Eides statt, dass ich die Bachelorarbeit mit dem Titel „Businessplan für
Integration gehörloser Seniorinnen und Senioren unter Aspekt der Soziale
Investitionen“ selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und alle den benutzten Quellen
wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche gekennzeichnet habe.
Traun, Oktober 2012 Maria Bonis-Biro
Seite 1Kurfassung
Für Menschen im hohen Lebensalter gibt es mittlerweile ein breites Angebot an Maßnahmen
und Versorgungsangeboten, die sie bei der Bewältigung veränderter Lebensbedingungen
und neuer Anforderungen unterstützen. Doch diese Angebote können von gehörlosen alten
Menschen auf Grund der fehlenden Kommunikationskompetenzen seitens der Anbieter meist
nicht genützt werden.
Aufbauend auf die Erkenntnisse einer oberösterreichweit flächendeckend durchgeführten
Studie zur Situation Gehörloser im Alter (1) wurden gehörlose Seniorinnen und Senioren, die
bereits in einer integrativen Wohnform im Altersheim leben, in einem teilstandardisierten
Verfahren (2) befragt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurde ein Businessplan zur
Integration gehörloser Seniorinnen und Senioren (3) erstellt.
(1) Die Studie zeigte den Wunsch der Befragten Gehörlosen, in Wohnortnähe integriert zu
leben. (2) Die Befragten der teilstandardisierten Erhebung weisen eine hohe Zufriedenheit
mit dieser Wohnform auf. (3) Auf die Phasen der Projektimplementierung wurde im
Businessplan eingegangen.
Die gewonnen Ergebnisse legen trotz des Kostenaufwands die Integration Gehörloser in ein
wohnortnahes Angebot nahe, denn der Zugang zu barrierefreier Kommunikation Gehörloser
sichert den Mehrwert an Lebensqualität und gesellschaftlicher Teilhabe.
Seite IAbstract
By now numerous measures have been implemented to provide guidance and
support to the elderly when they are faced with a change in their needs and living
conditions. However, deaf seniors cannot access these services due to
communication barriers that arise when dealing with service providers.
On the basis of the findings of a nationwide study evaluating the living conditions of
deaf seniors (1) in Austria, deaf seniors who are integrated in a standard nursing
home were questioned in a partially standardized process (2). Based on these
findings a business plan aimed at integrating deaf seniors was developed (3).
(1) The study showed the deaf interviewees' wish to live integrated in a nursing home
close to their former home. (2) The respondents to the partially standardized study
showed a high satisfaction rate with the aforementioned form of placement. (3) The
process of the project implementation was outlined in the business plan.
The study showed that integrating deaf seniors in nursing homes close to their former
homes stands to reason despite the arising costs since accessible communication for
deaf seniors is conducive to a high quality of life and equal participation in society.
Seite IIInhaltsverzeichnis
Einleitung ...............................................................................................................................1
Entstehung der wissenschaftlichen Arbeit ............................................................... 1
Zielsetzung und Aufbau der Arbeit .......................................................................... 3
1 Begriffsklärung................................................................................................................3
1.1. Taubstumm vs. Gehörlos vs. Gebärdensprachig ........................................... 3
1.2. Gebärdensprache .......................................................................................... 5
1.3. Gebärdensprach-/Gehörlosengemeinschaft in Österreich ............................. 6
1.4. Organisationen der Gehörlosengemeinschaft in Österreich und international 7
1.5. GebärdensprachdolmetscherInnen / Gebärdensprachdolmetscher .............. 8
1.6. CODA ............................................................................................................ 8
1.7. Besonderheiten der Zielgruppe/Lebenswelt gehörloser Menschen ............. 10
1.7.1. Bildung .................................................................................................. 10
1.7.2. Familienleben........................................................................................ 12
2 Benchmarking...............................................................................................................13
2.1. Nutzen des Benchmarking .......................................................................... 14
2.2. Arten des Benchmarking ............................................................................. 14
2.2.1. Internes Benchmarking ......................................................................... 15
2.2.2. Externes Benchmarking ........................................................................ 15
2.2.3. Produkt-Benchmarking ......................................................................... 16
2.2.4. Prozess-Benchmarking ......................................................................... 16
2.2.5. Performance-Benchmarking ................................................................. 16
2.2.6. Strategisches Benchmarking................................................................. 16
3 Theorie zur empirischen Sozialforschung .....................................................................17
3.1. Güterkriterien ............................................................................................... 17
3.2. Forschungsablauf ........................................................................................ 18
3.2.1. Problembenennung ............................................................................... 18
3.2.2. Gegenstandsbenennung ....................................................................... 19
3.2.3. Quantitative Forschung ......................................................................... 20
Seite
III4 Der Bussinesplan .........................................................................................................22
5 Soziale Investitionen .....................................................................................................24
5.1. Definitionsmerkmale .................................................................................... 24
5.2. Soziale Investitionen als Finanzierungsmodell ............................................ 28
5.3. Investitionstypen-Handlungsebene.............................................................. 29
5.4. Soziale Investitionen von Zeit/Zivilgesellschaft ............................................ 30
5.5. Fazit............................................................................................................. 31
6 Beschreibung der Organisationen.................................................................................34
6.1. Martineum Evangelisches Seniorenzentrum Essen – Steele ...................... 34
6.2. Evangelisches Christophoruswerk e.V, Duisburg ........................................ 37
7 Empirische Datenerhebung ..........................................................................................39
7.1. Befragung gehörloser Bewohnerinnen und Bewohner ................................ 41
7.1.1. Fragestellungen .................................................................................... 42
7.1.2. Teilnahme am Interview ........................................................................ 42
7.1.3. Persönliche Daten der Befragten .......................................................... 42
7.1.3.1. Altersverteilung/Geschlecht ............................................................ 42
7.1.3.2. Aufenthalt im Heim ......................................................................... 43
7.1.3.3. Wohnsituation vor dem Einzug ins Heim ........................................ 44
7.1.3.4. Schulbildung ................................................................................... 44
7.1.3.5. Angehörige ..................................................................................... 45
7.1.3.6. Freundeskreis / Mitgliedschaft in Gehörlosenvereinen ................... 45
7.1.4. Charakterisierung der Interviewpartner ................................................. 46
7.1.5. Auswertung der Bewohnerbefragung .................................................... 47
7.1.5.1. Zufriedenheit mit der Betreuung, Verpflegung, Einrichtung ............ 47
7.1.5.2. Gebärdensprachkompetenz der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 48
7.1.5.3. Häufigkeit der Kontakte im Wohnbereich ....................................... 48
7.1.5.4. Gruppengröße der gehörlosen Bewohnerinnen bzw. Bewohner im
Wohnbereich .................................................................................................. 49
7.1.5.5. Entscheidungsgründe für die Wahl des Heimes ............................. 50
7.1.5.6. Besuche von Kindern, Angehörigen, Freunden .............................. 50
7.1.5.7. Wunsch nach Besuch von Freunden .............................................. 51
7.1.6. Analyse der Bewohnerbefragung .......................................................... 52
Seite
IV7.1.7. Schlussfolgerung .................................................................................. 53
7.2. Befragung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ......................................... 54
7.2.1. Ziele und Fragestellungen .................................................................... 54
7.2.2. Teilnahme an der Befragung ................................................................. 55
7.2.3. Auswertung der Mitarbeiterbefragung ................................................... 55
7.2.3.1. Einschätzung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ............... 55
7.2.3.2. Art und Häufigkeit von Missverständnissen .................................... 56
7.2.3.3. Schulung der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter .............................. 57
7.2.3.4. Unterschied zwischen gehörlosen und hörenden Bewohnerinnen
und Bewohnern .............................................................................................. 58
7.2.4. Analyse der Mitarbeiterbefragung ......................................................... 59
8 Businessplan ................................................................................................................60
8.1. Überprüfung der Legitimation ...................................................................... 60
8.2. Executive Summary..................................................................................... 61
8.3. Beschreibung der Dienstleistung ................................................................. 62
8.3.1. Problemstellung im aktuellen Kontext ................................................... 62
8.3.2. Beschreibung der Dienstleistung .......................................................... 62
8.3.3. Form des Angebotes ............................................................................. 63
8.3.4. Ziele ...................................................................................................... 63
8.3.4.1. Unternehmensziele ........................................................................ 63
8.3.4.2. Langfristige Ziele ............................................................................ 63
8.4. Unternehmen ............................................................................................... 64
8.5. Marketing ..................................................................................................... 65
8.5.1. Marktanalyse ......................................................................................... 65
8.5.2. Kunden-Analyse.................................................................................... 65
8.5.3. Kundennutzen ....................................................................................... 67
8.5.4. Konkurrenzanalyse ............................................................................... 68
8.5.5. Kooperationen....................................................................................... 68
8.5.6. PR Maßnahmen .................................................................................... 68
8.6. Rahmenbedingungen .................................................................................. 69
8.7. Personalplanung.......................................................................................... 69
8.8. Partnerschaft ............................................................................................... 70
Seite V8.8.1. Gehörlosenvereine ................................................................................ 70
8.8.2. Das Geriatrische Therapiezentrum für Gehörlose ................................. 71
8.9. Realisierungsfahrplan .................................................................................. 71
8.9.1. Aufgaben............................................................................................... 71
8.9.2. Kritischer Pfad....................................................................................... 71
8.9.3. Zeitschiene............................................................................................ 72
8.10. Risikoanalyse und Lösungsansätze ......................................................... 73
8.10.1. Extern ................................................................................................ 73
8.10.2. Intern ................................................................................................. 73
8.11. Finanzplanung .......................................................................................... 74
8.11.1. Investitionen ...................................................................................... 74
8.11.1.1. Anschaffung technischer Hilfsmittel .............................................. 74
8.11.1.2. Schulung des Personals in Gehörlosenkultur ............................... 74
8.11.1.3. Fortlaufende Schulungen in Gebärdensprache ............................. 75
8.11.1.4. Anstellung hörbeeinträchtigter Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter .. 75
8.11.1.5. Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherinnen bzw. -dolmetschern
bei Besprechungen und Schulungen ............................................................. 76
8.11.1.6. Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherinnen bzw. -dolmetschern
bei Veranstaltungen und Feierlichkeiten ........................................................ 76
8.11.2. Investoren & Wirkung ........................................................................ 76
8.11.2.1. Anschaffung technischer Hilfsmittel .............................................. 76
8.11.2.2. Schulung des Personals in Gehörlosenkultur und in
Gebärdensprache .......................................................................................... 77
8.11.2.3. Anstellung hörbeeinträchtigter Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter .. 77
8.11.2.4. Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherinnen bzw. –dolmetschern
bei Besprechungen und Fortbildungen .......................................................... 78
8.11.2.5. Einsatz von Gebärdensprachdolmetscherinnen bzw. –dolmetschern
bei Veranstaltungen und Feierlichkeiten ........................................................ 78
8.11.3. Kapitalbedarfsplanung ....................................................................... 79
Resümee..............................................................................................................................81
Literaturverzeichnis ..............................................................................................................83
Seite
VIAbbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Verteilung der Interviewpartner nach Alter ........................................................43
Abbildung 2: Verteilung der Interviewpartner nach Geschlecht .............................................43
Abbildung 3: Verteilung nach Verweildauer...........................................................................43
Abbildung 4: Verteilung nach Wohnsituation vor dem Einzug ins Seniorenheim ...................44
Abbildung 5: Verteilung nach Bildungsstand .........................................................................44
Abbildung 6: Verteilung nach Ehepartner..............................................................................45
Abbildung 7 : Verteilung nach Anzahl der geborenen Kinder ................................................45
Abbildung 8: Verteilung nach sozialen Kontakten .................................................................46
Abbildung 9: Verteilung nach Mitgliedschaft in Gehörlosenvereinen .....................................46
Abbildung 10: Zufriedenheit der Befragten mit der Betreuung, Verpflegung und Einrichtung 47
Abbildung 11: Zufriedenheit der Befragten mit der Gebärdensprachkompetenz der
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter ..........................................................................................48
Abbildung 12: Häufigkeit der Kontakte im Wohnbereich .......................................................49
Abbildung 13: Einschätzung der Gruppengröße der gehörlosen Bewohnerinnen bzw.
Bewohner im Wohnbereich...................................................................................................49
Abbildung 14 : Entscheidungsgründe für die Wahl des Heimes ............................................50
Abbildung 15: Häufigkeit der erfolgten Besuche der Kinder ..................................................50
Abbildung 16: Häufigkeit der erfolgten Besuche von nahen Angehörigen und Verwandten...51
Abbildung 17: Häufigkeit der erfolgten Besuche von Freunden ............................................51
Abbildung 18: Wunsch nach Besuch von Freunden..............................................................52
Abbildung 19: Anzahl der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter, die vor ihrem Eintritt Erfahrung
mit Gehörlosen hatten ..........................................................................................................55
Abbildung 20: Einschätzung der Zusammenarbeit mit gehörlosen Bewohnerinnen und
Bewohnern ...........................................................................................................................55
Abbildung 21: Einschätzung der Gebärdensprachkenntnisse ...............................................56
Abbildung 22: Anzahl der Missverständnisse ........................................................................56
Abbildung 23: Zufriedenheit mit der Anzahl der Gebärdensprachkurse ................................57
Abbildung 24: Zeitaufwand für Betreuung gehörloser Bewohnerinnen und Bewohner ..........58
Abbildung 25: Mögliches Organigramm Seniorenheim mit einer Gehörlosen-Wohngruppe ..64
Abbildung 26: Zeitschiene Businessplan ..............................................................................72
Abbildung 27: Externe Risiken und Maßnahmen bei der Integration gehörloser
Bewohnerinnen und Bewohner.............................................................................................73
Abbildung 28: Interne Risiken und Maßnahmen bei der Integration gehörloser
Bewohnerinnen und Bewohner.............................................................................................73
Abbildung 29: Kosten technischer Hilfsmittel ........................................................................74
Abbildung 30: Kosten für Schulung in Gehörlosenkultur .......................................................74
Seite
VIIAbbildung 31: Kosten für Schulung in Gebärdensprache......................................................75
Abbildung 32: Gehaltstabelle für eine hörbeeinträchtige Mitarbeiterin bzw. einen Mitarbeiter
.............................................................................................................................................75
Abbildung 33: Dolmetschkosten für Veranstaltungen ............................................................76
Seite
VIIITabellenverzeichnis
Tabelle 1: Nutzen des Benchmarking. ..................................................................................14
Tabelle 2: Benchmarking – Arten ..........................................................................................15
Tabelle 3: Kriterien für die Abgrenzung des Forschungsgegenstands ...................................19
Tabelle 4: Grundlegende Forschungsfragen – Soziale Investition .........................................27
Tabelle 5: Investitionstypen ..................................................................................................30
Tabelle 6: Überblick Angebote Peter-Kuhn Haus ..................................................................39
Tabelle 7: Zufriedenheit der Befragten mit der Betreuung, Verpflegung und Einrichtung .......47
Tabelle 8: Anzahl der Mitglieder im Linzer Gehörlosenverein und geschätzte gehörlose
Population ............................................................................................................................65
Tabelle 9: Kapitalbedarfsplanung erstes Jahr .......................................................................79
Tabelle 10: Kapitalbedarfsplanung zweites Jahr ...................................................................79
Tabelle 11: Kapitalbedarfsplanung drittes Jahr......................................................................80
Seite
IXAbkürzungsverzeichnis
BIZEPS Zentrum für Selbstbestimmtes Leben
BSB Bundessozialamt
CODA Childern of deaf Adults
CSI Centrum für Soziale Investitionen und Innovationen
D Deutschland
DBZ Deutsche Benchmarking Zentrum
EUD European Union of the Deaf
KlaV Klagsverband
LH Landeshauptmann
LVOÖ Landesverband der Gehörlosenvereine in OÖ
ÖAR Dachverband der Behindertenverbände in Österreich
ÖGLB Österreichisches Gehörlosenbund
ÖGLZ Gehörlosenzeitung
ÖGS Österreichische Gebärdensprache
SIGMA Projekt zur Situation gehörloser Menschen im Alter
Vis.Com Schule für visuelle und alternative Kommunikation
WFD World Federation of the Deaf
z.T zum Teil
Seite XEinleitung
„Blindheit trennt von Dingen, Taubheit von den Menschen“. Dieses Zitat der US-
amerikanischen, taubblinden Schriftstellerin Helen Keller verdeutlicht, dass – im Gegensatz
zu Blindheit – Gehörlosigkeit eine unsichtbare Behinderung des Menschen ist und daher im
Alltagsleben häufig als nicht besonders gravierend eingeschätzt wird. Kommunikation ist
jedoch ein existenzielles Bedürfnis des Menschen und ein wesentlicher Faktor für das
Wohlbefinden und eine erfolgreiche Lebensbewältigung.
Die Beweggründe, sich mit dem Thema Altenbetreuung gehörloser Seniorinnen und
Senioren auseinander zu setzen, liegen einerseits am beruflichen Hintergrund der Autorin
und andererseits hat die Autorin gehörlose Eltern im Alter von 68 bzw. 70 Jahren, die zur Zeit
im eigenen Heim sehr gut zurecht kommen und mobil sind. Im Ernstfall gäbe es allerdings
derzeit keine adäquate Lösung für den Fall, dass die gehörlosen Eltern der Autorin den
Lebensalltag nicht mehr selbstständig bewältigen können.
In Anbetracht dessen erschien es der Autorin sinnvoll, im Rahmen des Berufspraktikums ein
Heim in Deutschland, das bereits eine gehörlose Wohngruppe führt, zu besuchen und ein
Konzept zur Integration gehörloser Seniorinnen und Senioren im Altersheim zu verfassen.
Entstehung der wissenschaftlichen Arbeit
Das Thema Versorgungsangebote für gehörlose Menschen im Alter ist auch dem
Landesverband der Gehörlosenvereine in Oberösterreich (LVOÖ)1 ein wichtiges Anliegen.
Dazu wurde ein Forschungsprojekt zum Thema Gehörlosigkeit und Alter an das Institut für
Soziologie, Abteilung für empirische Forschung an der Johannes Kepler Universität Linz, in
Auftrag gegeben.2
Ergebnis dieses Forschungsprojekts war, dass sich gehörlose Seniorinnen und Senioren
kein spezielles Heim wünschen, in dem nur gehörlose Bewohnerinnen und Bewohner betreut
werden, sondern sie präferieren, in ihrer Umgebung in einem „hörenden“ Heim integriert zu
werden. Wichtig ist ihnen dabei, dass in dem Heim zwei oder mehr gehörlose
Bewohnerinnen bzw. Bewohner betreut werden. Weitere bedeutende Aspekte sind die
Rücksichtnahme auf die Kommunikationsbedürfnisse gehörloser alter Menschen sowie die
1
Vgl. LVOÖ (2012)
2
Vgl. Gerich/Menrad (2010)
Seite 1Forderung nach gebärdensprachkompetentem Personal oder gehörlosen Mitarbeiterinnen
bzw. Mitarbeitern.
Ein weiterer Grundstein dieser Bachelorarbeit ist die SIGMA-Studie3, die im Zeitraum von
Dezember 2006 bis Februar 2009 an der Universität Köln durchgeführt wurde. Im Rahmen
des Projekts wurde die Lebenssituation gehörloser Menschen im Alter, ihre Ressourcen und
Bedürfnisse sowie die bestehende Versorgungsstruktur untersucht.
Weitere Erfahrungen konnte die Autorin als Mitarbeiterin in einem geriatrischen
Therapiezentrum für gehörlose Seniorinnen und Senioren4 in Linz sammeln. Die wesentliche
Erfahrung war, dass gehörlose alte Menschen in unterschiedlichen Altersheimen im Raum
Linz untergebracht sind. Diese Tatsache wird durch das oben genannte Forschungsprojekt
Gehörlosigkeit und Alter bekräftigt, aus dem klar hervorgeht, dass 50 % der gehörlosen
Heimbewohnerinnen und Heimbewohner alleine unter Hörenden wohnen.5 Die
Heimleiterinnen bzw. Heimleiter dieser Einrichtungen bemühen sich zwar, den gehörlosen
Bewohnerinnen und Bewohnern die bestmögliche Betreuung anzubieten, sind jedoch
meistens durch das fehlende Hintergrundwissen über kulturspezifische Besonderheiten in
der Betreuung gehörloser Personen sowie durch die fehlende Kommunikationskompetenz
überfordert.
Nach dem Prinzip Best Practice wurde im Rahmen des Berufspraktikums ein Heim, welches
bereits eine Wohngruppe für gehörlose Seniorinnen und Senioren führt und an einem
Austausch interessiert war, ausgesucht. Entscheidungskriterien dabei waren Heimgröße und
Anzahl der Bewohnerinnen und Bewohner in der Gehörlosen-Wohngruppe. Da für ein
Pilotprojekt, gehörlose Bewohnerinnen und Bewohner in ein Seniorenheim zu integrieren,
eher eine kleine Gruppe zu empfehlen ist, sollte die Anzahl an gehörlosen Personen eher
klein sein. Nach einer ausführlichen Recherche im europäischen Raum fiel die Entscheidung
der Autorin auf das Peter-Kuhn-Haus im Evangelisches Christoforuswerk Duisburg (D)6.
Ziel des Berufspraktikums war die Evaluierung der Zufriedenheit gehörloser Bewohnerinnen
und Bewohner mit Hilfe einer empirischen Datenerhebung.
3
Vgl. Kaul at al. (2009)
4
Vgl. Krankenhaus der Barmherzige Brüder Linz (2012)
5
Vgl. Gerich/Menrad (2010), 214.
6
Vgl. Peter-Kuhn-Haus (2012)
Seite 2Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Ziel dieser Diplomarbeit ist die Erstellung einer Informationsquelle für alle Heime, die bereits
gehörlose Bewohnerinnen bzw. Bewohner oder Interesse an der Integration gehörloser
Bewohnerinnen bzw. Bewohner haben.
Die Arbeit wird in einen theoretischen und einen praktischen Teil unterteilt.
Im theoretischen Teil werden die Begriffe Gehörlosigkeit, Gehörlosenkultur und die
Besonderheiten der Zielgruppe näher beschrieben. Weiters werden relevante Themen wie
Benchmarking, Empirische Forschung, Soziale Investitionen und Businessplan erläutert.
Im praktischen Teil werden die besuchten Einrichtungen, die bereits eine
Gehörlosewohngruppe führen, näher beschrieben und die Ergebnisse der empirischen
Erhebung vorgestellt. Anschließend wird ein Sozial-Businessplan für die Errichtung einer
Wohngruppe für Gehörlose unter dem Aspekt der sozialen Investitionen dargestellt.
1 Begriffsklärung
Um die Lebenswelt gehörloser Menschen besser nachvollziehen zu können, ist die Klärung
einiger Begriffe notwendig. Dieses Kapitel soll kurz die Termini Taubstumm, Gehörlos,
Gebärdensprachig, Gebärdensprache, Gehörlosengemeinschaft, CODA und
Gebärdensprachdolmetschen definieren.
1.1. Taubstumm vs. Gehörlos vs. Gebärdensprachig
Eine sehr allgemeine Definition des Terminus Gehörlosigkeit findet sich bei Breiter7, die jene
Menschen als gehörlos bezeichnet, „die die gesprochene Sprache auch mit technischen
Mitteln nicht über das Ohr wahrnehmen können“8.
Der medizinische Begriff Gehörlosigkeit oder Resthörigkeit wird über den Grad der
Hörschädigung definiert. Eine Person wird als gehörlos bezeichnet, wenn ein Hörverlust von
mehr als 90 Dezibel (Maß für Tonwahrnehmung) im Hautsprachenbereich festgestellt wird.9
Aus sonderpädagogischer Sicht spricht man von Gehörlosigkeit, wenn eine Person auf
Grund einer gravierenden Hörschädigung auch mit Verwendung elektroakustischer Hörhilfen
7
Vgl. Breiter (2005), 17.
8
Breiter (2005), 17.
9
Vgl. Leonhardt (1996),16.
Seite 3nur begrenzte auditive Wahrnehmungseindrücke hat. Je nach Eintritt der Hörschädigung wird
dabei zwischen prä-und postlingualer Gehörlosigkeit unterschieden.10
Prälinguale Gehörlosigkeit liegt vor, wenn die Hörschädigung vor der Sprachentwicklung
einsetzt. In diesem Fall ist der Erwerb der Lautsprache extrem erschwert. Bei postlingualer
Gehörlosigkeit ist die Ertaubung erst nach der Phase des Spracherwerbs eingetreten.11
Der Begriff Gehörlosigkeit wurde seit Beginn des 20. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum
in zunehmendem Maß synonym für oder anstelle von Taubheit verwendet. Bis zu dieser Zeit
wurde Taubheit üblicherweise mit Stummheit gleichgesetzt. Die weit verbreitete Meinung der
Gesellschaft war, dass Taubstumme unbildsame Idioten seien. Die etymologische Bedeutung
der Wörter taub und stumm hing mit dumm, schwachsinnig und sprachlos zusammen.12 Der
Begriff Taubstumm stellt also eine veraltete Bezeichnung dar, der in der
Gehörlosengemeinschaft als diskriminierend empfunden und heute noch von nicht
wissenden hörenden Personen verwendet wird.
Ein weiterer Ansatzpunkt besteht darin, die Gehörlosigkeit nicht nur in Bezug auf den
Hörverlust zu betrachten, sondern in die eigene Sprache und Kultur einzubeziehen. Die
Gehörlosengemeinschaft wird demgemäß als kulturelle Gemeinschaft mit eigenen Werten,
eigener Sprache, eigenen Verhaltensmustern und bestimmten Regeln gesehen. In dieser
Kultur gibt es so wie in anderen Kulturen Poesie, Theater, Festivals, Kabarett, Humor - mit
dem Unterschied, dass die Darbietung jeweils visuell in Gebärdensprache erfolgt. Die
Zugehörigkeit zur Gehörlosengemeinschaft ist daher nicht über das Hörvermögen reguliert,
sondern durch die Gebärdensprachkompetenz der Einzelnen bestimmt.13
Diese Sichtweise führte zu der neuen Wortschöpfung gebärdensprachig. In ihrem Buch
Taubstum bis Gebärdensprachig. Die österreichische Gebärdensprachgemeinschaft aus
soziolinguistischer Perspektive führt Krausneker aus14, dass sich die Selbstbezeichnung
gebärdensprachig und GebärdensprachlerIn bzw. Gebärdensprachler zum ersten Mal nicht
auf den Hörstatus, sondern auf die Sprachkompetenz beziehen.
Dieser Meinung ist auch Helene Jarmer15, Präsidentin des Österreichischen
Gehörlosenbundes und grüne Parlamentarierin:
10
Vgl. Leonhardt (1996),17.
11
Vgl. Leonhardt (1996),17.
12
Vgl. Krausneker (2006),21.
13
Vgl. Krausneker/Schalber (2007),77f.
14
Vgl. Krausneker (2006), 23.
15
Vgl. Jarmer (2005)
Seite 4„Wir sind eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft. Was uns eint, ist unsere
Sprache, auf die wir stolz sind und die wir unser ganzes Leben lang benützen.
Wir sind nicht taubstumm, sondern Gebärdensprachbenützerinnen und
Gebärdensprachbenützer!“ 16
1.2. Gebärdensprache
Die Zugehörigkeit zur Gehörlosengemeinschaft basiert also wie oben erwähnt auf einer
gemeinsam verwendeten Sprache, der Gebärdensprache.
Die WissenschaftsAgentur der Universität Salzburg bezeichnet die Gebärdensprache als17:
„ (…) zum Teil die Muttersprache, andererseits auch Kennzeichen der
Gruppensolidarität und damit Mittel der Identifikation“18
Die Gebärdensprachen sind global auf natürliche Weise entstanden und in ihrer Grammatik
und Struktur unabhängig. Dabei gibt es nationale Unterschiede und regionale Dialekte
innerhalb eines Landes. Gebärdensprachen sind also nicht universell, wie die weit
verbreitete irrtümliche Meinung besagt. Sie unterscheiden sich nach Land und Region wie
die Lautsprachensysteme und verfügen über eine eigene linguistische Struktur, die
unabhängig von jener der Lautsprache ist.19
Die Gebärdensprache wird visuell wahrgenommen und bedient sich manueller und nicht
manueller Ausdrucksmittel, wie Hände, Arme, Mimik und Mundbild. Grbić, Leiterin der
Abteilung für Gebärdensprache und Gehörlosenkultur am Institut für Theoretische und
Angewandte Translationswissenschaft in Graz, definiert die Gebärdensprache
20
folgendermaßen :
„(…) natürlich gewachsenen Sprachsystemen, die sich sowohl in ihrer Lexik
als auch in ihrer Struktur von den sie umgebenden gesprochenen
Nationalsprachen unterscheiden und alle Möglichkeiten eines visuell-
manuellen Codes nützen. Sie werden von Kindern gehörloser Eltern als
16
Jarmer (2005), 3.
17
Vgl. Wissenschafts Agentur (1998), 11.
18
Wissenschafts Agentur (1998), 11.
19
Vgl. Boys-Brem (1995), 14.
20
Vgl. Grbic (2002), 181.
Seite 5Muttersprache erworben und sind integraler Bestandteil der Identität und Kultur
von Gehörlosengemeinschaften auf der ganzen Welt.“21
Die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) wurde am 6. Juli 2005 in einer
parlamentarischen Abstimmung einstimmig in die österreichische Bundesverfassung
aufgenommen und somit offiziell anerkannt. Die rechtliche Anerkennung als
Minderheitensprache erfolgte somit 14 Jahre, nachdem die erste Petition dafür im Parlament
eingebracht wurde.22
1.3. Gebärdensprach-/Gehörlosengemeinschaft in Österreich
Nach einem weltweit angewandten Schlüssel, wonach 0,1 % (1 Promille) der Bevölkerung
gehörlos ist, besteht die Gebärdensprachgemeinschaft in Österreich aus ca. 8000
Gehörlosen und etwa 2000 weiteren ÖGS-kompetenten Personen, wie z.B. hörenden Kinder
gehörloser Eltern, hörenden Eltern gehörloser Kinder, Dolmetscherinnen und Dolmetscher,
Forscherinnen und Forscher usw..23
Stalzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrbeauftragter am Institut für
Translationswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität Graz, beschreibt den Aufbau
einer Gehörlosengemeinschaft als eine „heterogene Familie“.24 Das einzige Merkmal, das
alle Mitglieder teilen, ist die Gehörlosigkeit – weitere Charakteristika wie Alter, Geschlecht
oder ethnische Herkunft treten damit in den Hintergrund.
Sprachwissenschaftlerin und Studienautorin Krausneker teilt diese Meinung ebenfalls. Im
Hinblick auf die großen Unterschiede auf Bildung, Schriftsprachkompetenz und
sozioökonomische Situation skizziert die Autorin jene Unterschiede anhand eines
Spektrums.25 An einem Ende des Spektrums befindet sich ein sehr kleines Segment von
„Elite“-Gehörlosen. Zu diesem Segment gehören Leiterinnen bzw. Leiter der
Gehörlosenorganisationen und einige Selbstständige. Alle Personen dieser Gruppe sind
vollkompetente Gebärdensprachlerinnen und Gebärdensprachler und haben ein hohes
Selbstbewusstsein sowie eine gute (z.T. akademische) Bildung. Sie werden regelmäßig von
Personen aus Forschung, Politik, von Entscheidungsträgerinnen bzw. Entscheidungsträgern
sowie Dolmetscherinnen und Dolmetschern konsultiert. Im daran anschließenden Teil des
Spektrums sind alle jene Gehörlose, die sozial und ökonomisch stabil und vernetzt leben,
21
Grbic (2002), 181.
22
Vgl. Krausneker (2005), 3.
23
Vgl. Krausneker (2006), 27.
24
Vgl. Stalzer (1997), 2.
25
Vgl. Krausneker (2006), 28.
Seite 6einer geordneten Arbeit nachgehen und ein finanziell unabhängiges Leben führen. Sie
verfolgen gehörlosenpolitsche Themen, haben Visionen, Ideen und Allgemeinbildung.
Das nächste und größte Segment der Gehörlosengemeinschaft wird von jenen Personen
gebildet, die wenig Informationen und Kenntnis über die internationale
Gehörlosengesellschaft und den Stand der Forschung haben. Die meisten von ihnen haben
Kontakte zu anderen gehörlosen Menschen und sind Mitglieder in lokalen
Gehörlosenvereinen, weil sie den sozialen Umgang und die mühelose Kommunikation in
ÖGS genießen. Im vierten und letzten Segment des Spektrums ordnet Krausneker die
gehörlosen Menschen ein, die isoliert in kleinen Dörfern oder Anstalten leben und von der
Dorfgemeinschaft als behindert wahrgenommen werden. Sie haben selten oder niemals
Kontakt zu anderen Gehörlosen.
1.4. Organisationen der Gehörlosengemeinschaft in Österreich und
international
Viele gehörlose Personen sind Mitglieder in Gehörlosenvereinen, welche den
Landesverbänden angeschlossen sind. Die Landesverbände wiederum sind Mitglieder des
Österreichischen Gehörlosenbundes (ÖGLB), der seit 1913 besteht und gut organisiert ist.
Eine seiner wichtigsten Aufgaben ist26:
„das Selbst-Bewusstsein der Gehörlosen und ihr Ansehen in der Welt der
Hörenden zu stärken“27.
Der ÖGLB ist Mitglied bei der European Union of the Deaf (EUD), bei der World Federation
of the Deaf (WFD), beim Klagsverband (KlaV) und beim Dachverband der
Behindertenverbände in Österreich (ÖAR). Darüber hinaus kooperiert der ÖGLB mit
BIZEPS, dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. In Österreich gibt es für den
Informationsaustausch gehörloser Menschen und insbesondere der Vereine die vom ÖGLB
vierteljährlich herausgegebene Gehörlosenzeitung (ÖGLZ), den elektronischen Newsletter
des ÖGLB sowie regionale Medien der Verbände und Vereine. Nachrichten werden gebärdet
und als News-Videos auf der Homepage des ÖGLB kostenlos zugänglich gemacht.
Wie bereits oben erwähnt, ist die Österreichische Gehörlosengemeinschaft seit dem 19.
Jahrhundert sehr gut organisiert. Die aufblühende Gemeinschaft wurde durch die Herrschaft
des Nationalsozialismus von 1938 bis 1945 unterbrochen. Gehörlose Persönlichkeiten
mussten zurücktreten, Vereine wurden aufgelöst, sogenannte „erbkranke“ Gehörlose wurden
26
Vgl. ÖGLB (2011)
27
ÖGLB (2011)
Seite 7zwangssterilisiert, jüdische Gehörlose wurden verfolgt und ermordet.28 Krauseneker merkt
auch an, dass gehörlose Menschen in dieser Zeit nicht nur Opfer, sondern auch Nutznießer
und aktive Nationalsozialisten waren. Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes
hat sich die Gehörlosengemeinschaft mit Ausnahme der jüdischen Vereine wieder erholt.
Überlebende gehörlose Juden kehrten nicht mehr zurück oder gaben ihre Identität nicht
mehr preis.29
1.5. GebärdensprachdolmetscherInnen / Gebärdensprachdolmetscher
Unter Gebärdensprachdolmetschen versteht man die Tätigkeit von Personen, die zwischen
der Lautsprache und die Gebärdensprache dolmetschen. Die Dolmetschung aus der
Lautsprache in die Gebärdensprache und umgekehrt erfolgt in der Regel simultan, weil die
Kommunikation beider Sprachen über unterschiedliche Kanäle (visuell und auditiv)
stattfindet.
Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmetscher in Österreich arbeiten
in verschiedenen Bereichen und werden zum Teil von der öffentlichen Hand oder von
öffentlichen Organisationen bezahlt. Sie sind einer Berufs und Ehrenordnung verpflichtet, die
auch die Grundlage der Tätigkeit darstellt. Dolmetscherinnen und Dolmetscher sind neutral,
gewissenhaft, unvoreingenommen, unparteiisch und ermöglichen durch ihr professionelles
Auftreten Kommunikation und Verständigung.30
1.6. CODA
CODA bedeutet (hearing) Children of Deaf Adults, also (hörende) Kinder gehörloser
Erwachsener. CODA-Kinder wachsen in zwei verschiedenen Kulturen und mit zwei
verschiedenen (Mutter-)Sprachen auf. Durch ihre Kommunikationsfähigkeit in beiden
Sprachen und die Zugehörigkeit zur gehörlosen Gemeinschaft wie auch zur hörenden
Gemeinschaft werden CODAs häufig, gewollt oder ungewollt, als Dolmetscherinnen und
Dolmetscher bzw. Mittlerinnen und Mittler eingesetzt. Diese besondere und oft unangenehme
Position, zwischen zwei unterschiedliche Welten zu vermitteln, kann für jüngere Kinder oder
Jugendliche einerseits die Selbstständigkeit, Offenheit und Flexibilität fördern. Anderseits
kann diese Stellung aber als erhöhte Belastung erlebt werden und mit Identifikationkonflikten
verbunden sein. CODAs erleben in ihrem sozialen Milieu meist unmittelbar die Ausgrenzung
28
Vgl. Krausneker (2006), 33.
29
Vgl. Krausneker (2006), 33f.
30
Vgl. ÖGSDV (2012)
Seite 8oder Diskriminierung der Eltern und werden von ihrem Umfeld als Kinder von Behinderten
wahrgenommen.31
Ebbinghaus und Hessman sahen hörende Kinder in einer gehörlosen Familie als
Privatdolmetscherinnen und -dolmetscher im Haus und nannten sie natürliche
Dolmetscherinnen bzw. Dolmetscher. Infolge einer Untersuchung definieren die
Wissenschaftler dies wie folgt:
„Mit dieser Bezeichnung bringen sie selbst gern zum Ausdruck, daß ihre
Befähigung zum Dolmetschen nicht in einem formellen Lernprozeß, sondern
gleichsam natürlich in der eigenen Sozialisation erworben wurde“.32
Wie schon erwähnt werden CODAs sehr früh mit alltäglichen Problemen konfrontiert und
müssen daher sehr früh lernen, wie man mit diesen umzugehen hat. Dabei besteht die
Gefahr, von der anfänglichen Rolle der Vermittlung in die der Beratung oder schließlich sogar
Bevollmächtigung gedrängt zu werden – eine Position, in der nicht mehr auf Anweisungen
gewartet, sondern eigen- und selbstständig gehandelt wird. Der CODA bzw. die CODA sieht
sich hier weniger als sprachliche Dienstleisterin bzw. Dienstleister, sondern mehr als
Anwältin bzw. Anwalt, als Fürsprecherin bzw. Fürsprecher, als Helferin bzw. Helfer, Beraterin
bzw. Berater oder gar als Verantwortliche für die Eltern.
Kaul33 erwähnt – und diese Tatsache kann durch die Erfahrungen der Autorin in ihrer
Eigenschaft als CODA bestätigt werden –, dass einige hörende Kinder gehörloser Eltern in
einer Reflexion über ihre Kindheit und Jugend sich häufig in Situationen befanden
„die sie von den sprachlich zu bewältigenden Probleminhalten und
Konfliktgegenständen her überforderten.“34
Aufgrund dieser Tätigkeiten entwickelten CODAs schon früh ein besonders großes
Verantwortungsbewusstsein. Sie erlebten ambivalente Situationen, in denen sie in der
Lebenswelt ihrer gehörloser Eltern als kleine Erwachsene fungierten. Andererseits haben
sich viele Gehörlose kaum oder gar nicht von der Hilfe ihrer hörenden Kinder abhängig
gemacht. In diesen Fällen hatten die gehörlosen Eltern ein gutes familiären Netz oder
verfügten über eine gute Lautsprachkompetenz und konnten selbständig und autonom in der
Gemeinschaft der Hörenden zurechtkommen. Kaul geht davon aus, dass dieses Muster der
31
Vgl. Peter et al. (2010), 10f.
32
Ebbinghaus (1989), 126.
33
Vgl. Kaul et al. (2009), 73.
34
Kaul et al. (2009), 73.
Seite 9Innanspruchnahme der CODAs bis ins hohe Alter bestehen bleibt.35 Dies wird heutzutage
durch die immer besser strukturierten Dolmetschdienste auf jeden Fall erleichtert.
1.7. Besonderheiten der Zielgruppe/Lebenswelt gehörloser Menschen
Gehörlose bilden also eine Minderheit, über die die Allgemeinheit relativ wenig Informationen
besitzt. Auch wenn in den letzten Jahren viel Aufklärungsarbeit seitens der
Gehörlosenorganisationen geleistet wurde, was wiederum zu einer stärkeren Präsenz in der
Öffentlichkeit wie zB. zur täglichen Dolmetschung der ZIB 2 im staatlichen Sender ORF 2
Europa geführt hat, hat – abseits bestimmter Fachdisziplinen wie zB. Sonderpädagogik,
Sozialarbeit, Linguistik, Medizin, Psychologie und Soziologie – die breite Masse kaum
Kenntnisse und Erfahrungen über die Situation Gehörloser.
Gehörlosigkeit wird in den meisten Fällen wie schon erwähnt mit dem Hörstatus bzw. mit der
Unfähigkeit zu hören verbunden. Aus diesem Grund werden gehörlose Menschen wie blinde
Menschen oder Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung als Behinderte
eingestuft.36
1.7.1. Bildung
Da die Gehörlosogkeit meistens angeboren ist, also vor der Sprachentwicklung auftritt,
können gehörlose Kinder in der Regel die Lautsprache als Sprachsystem mit all ihren Regeln
nicht über das Ohr erlernen. So ist der Zugang zu Lautsprache auf einem natürlichen Weg
37
beschränkt. Erschwerend ist auch die Tatsache, dass 90 % der Eltern hörend sind und
keine Kenntnisse über die Gebärdensprache besitzen. Aus diesem Grund ist eine
ungezwungene und spontane Kommunikation zwischen Eltern und Kind nahezu unmöglich.38
Viele Eltern prälingual ertaubter Gehörloser entscheiden sich auf Empfehlung von HNO-
Ärzten und Pädagogen nach wie vor zu einer ausschließlich oralen Erziehung. Doch auch
mit Hilfe einer umfassenden pädagogischen Früherziehung, bei der insbesondere die
Wahrnehmung der gesprochenen Sprache gefördert wird, bleiben der Wortschatz und das
grammatische Regelwissen beeinträchtigt. Aufgrund der Tatsache, dass Gehörlose die
Stimmen anderer Menschen sowie ihrer eigene Stimme nicht hören können, können sie ihre
eigene Sprache nicht in vollem Umfang kontrollieren. Der Ausfall des Sinnesorgans
35
Vgl. Kaul et al. (2009), 74.
36
Vgl. Kaul et al. (2009), 7.
37
Vgl. Ladd (1993), 191.
38
Vgl. Kaul et al. (2009), 8.
Seite
10verursacht bei den Betroffen eine lang andauernde Sprachentwicklungsstörung, die
abgesehen von Ausnahmen nie ganz kompensiert werden kann.39
Trotz intensiver Bemühungen, die im Schulalltag fortgesetzt werden, bleibt also die Sprache
Gehörloser auffällig.40 Aufgrund dieser Sprachauffälligkeit wird automatisch eine geistige
Behinderung vermutet. So wird verständlich, dass Interaktionen mit Hörenden nicht
bevorzugt, sondern eher vermieden werden.41 Selbst wenn die bzw. der Gehörlose eine gute
Lautsprachkompetenz und eine gute Ablesekompetenz erworben hat, bleibt der Kontakt zur
hörenden Welt erschwert. Eine permanente visuelle Aufmerksamkeit, die für das Lippenlesen
unerlässlich ist, wird als äußerst anstrengend empfunden. Nahezu unmöglich machen das
Lippenlesen beispielweise schmale oder breite Lippen, schiefe Zähne oder eine bestimmte
Gesichtsbehaarung.
Ebenso problematisch wie das Erwerben der Lautsprache ist das Erlernen der
Schriftsprache. Die Schriftsprachkompetenz ist jedoch für die gesellschaftliche Teilhabe ein
entscheidender Faktor. Der Grund für die unterdurchschnittliche Schriftsprachkompetenz der
Gehörlosen liegt in der oralen Schulbildung. Krauseneker stellt fest, dass lautsprachlich gut
geförderte Kinder durchschnittlich über einen aktiven/passiven Wortschatz von 250/500
Wörtern verfügen. Hörende Kinder haben in Vergleich dazu 3000 – 3500/ 19.000 Wörter.42
Dieser Stand kann auch in der weiteren Entwicklung der gehörlosen Jugendlichen nicht mehr
aufgeholt werden. 14- bis 16-jährige gehörlose Schülerinnen bzw. Schüler wiesen laut Studie
schließlich einen Wortschatz von ca. 2000 Wörtern auf.
Nach einer im Raum Wien durchgeführten Studie in den Jahren 2001/200243, in deren
Rahmen 30 Frauen im Alter von 17 – 44 Jahren mittels qualitativer Interviews und
Fragebogen befragt wurden, schätzen die Mehrheit (60%) der Befragten ihre
Deutschkompetenz als mangelhaft ein. Besonders groß war der Anteil der Frauen (80%), die
eine Pflichtschule für Gehörlose besucht hatten.
Aufgrund der oben genannten Grundbildungsdefizite wirkten sich diese Sprachmängel
negativ auf zentrale Lebensbereiche Gehörloser aus. Vor allem die Ausbildung und die
Beschäftigung stellen in diesem Zusammenhang ein großes Problem dar.
39
Vgl. Kaul et al. (2009), 65., zitiert nach Wirth (1977), 100.
40
Vgl. Kaul et al. (2009), 9f.
41
Vgl. Prillwitz (1986), 18f.
42
Vgl. Krausneker (2006), 34., zitiert nach Kramer (2001), 46.
43
Vgl. Krausneker (2006), 34., zitiert nach Burghofer/Braun (1995), 78.
Seite
11Im Bereich Ausbildung gibt es für Gehörlose begrenzte Möglichkeiten. Es gibt nur wenige
Fachschulen, die in ihrem Curriculum die Bedürfnisse dieser Personengruppe
berücksichtigen. Die meisten Gehörlosen erlernen einen Lehrberuf, doch auch hier ist die
Auswahl begrenzt. Hier zeigen sich allerdings Unterschiede zwischen älteren Gehörlosen
und der gehörlosen Generation von heute. Die heute 60 bis 65-jährigen Gehörlosen konnten
in den 1960er Jahren nur wenige Berufe wie zB Tischler, Schuhmacher, Schneider,
Goldschmied oder Zahntechniker erlernen. Die Berufsschulen waren an die
Gehörlosenschulen angegliedert. Doch nur wenige schafften ein Abschluss. Und auch diese
gingen später eher als Hilfsarbeiterinnen bzw. Hilfsarbeiter einer Beschäftigung nach.44
Heute ist das Angebot für gehörlose Jugendliche etwas breiter. Und durch den Einsatz von
Dolmetscherinnen und Dolmetschern haben sie vergleichsweise nahezu unbegrenzte
Möglichkeiten. Doch beim Vergleich der Ausbildungsabschlüsse von Hörenden und
Gehörlosen zeigt sich eine wesentliche Benachteiligung der Gehörlosen. Lediglich 4% der
Gehörlosen haben die Matura oder einen universitären Abschluss und 51% einen
Lehrabschluss.45 Im Vergleichsjahr 1999 verfügten hörende Erwachsene zu 16% über
Matura oder Hochschulabschluss und zu 35% über einen Lehrschulabschluss.
1.7.2. Familienleben
Es gibt weder in Deutschland noch in Österreich wirkliche Zahlen über die Häufigkeit von
Eheschließungen zwischen hörenden und gehörlosen Erwachsenen. Doch erfahrungsgemäß
ist diese Konstellation eher gering, denn die meisten Gehörlosen suchen sich Partner aus
der Gehörlosenszene, da für eine gelingende Beziehung eine intensive Kommunikation
notwendig ist. Aus diesem Grund haben die meisten Gehörlosen wiederum gehörlose
Partnerinnen bzw. Partner oder solche, die die Gebärdensprache beherrschen.46 Nach
Beobachtung und Erfahrungen der Autorin kommen in der letzten Zeit immer mehr
Partnerschaften zwischen hörenden und gehörlosen Partnerinnen bzw. Partnern zustande.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Hörende Interesse an der Gebärdensprache
haben und diese auch gerne erlernen.
Ungefähr 90% der Kinder aus Partnerschaften – sowohl hörenden/gehörlosen als auch
gehörlosen/gehörlosen – sind hörend (CODAs).47
44
Vgl. Koch-Bode (1999), 30ff.
45
Vgl. Krausneker (2006), 97., zitiert nach Kramer (2001), 46.
46
Vgl. Prillwitz (1982), 236.
47
Vgl. Peter et al. (2010), 7.
Seite
122 Benchmarking
Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen des Benchmarking.
Benchmarking ist ein junges Managementinstrument und wird als „die Suche nach besten
Praktiken und deren Implementierung“48 beschrieben49. Robert C. Camp, der Begründer der
Benchmarking-Methodik, definiert seine Kerngedanken folgendermaßen50:
„Benchmarking ist die Suche nach Lösungen, die auf den besten Methoden
und Verfahren der Industrie, den „Best Practices“ basieren und ein
Unternehmen zu Spitzenleistungen führen“51.
Mit Unterstützung dieses Modells hat eine Organisation die Möglichkeit, über den Tellerrand
zu schauen und die einzigartige Gelegenheit, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Dabei
muss das Vergleichsunternehmen nicht zwingend aus der gleichen Branche sein.52 Ziel ist
also, die eigene Leistungsfähigkeit durch das Vorbild der Vergleichspartner entscheidend zu
verbessern.
Als ein wichtiger Vorteil des Benchmarking nennen Mertins und Kohl, dass die Motivation der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Einführung neuer Ideen durch Vorbilder erleichtert wird.
Dadurch entstehen im eigenen Unternehmen neue Ideen, die auch unternehmensspezifisch
umgesetzt werden. Damit wird die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens entscheidend
und nachhaltig verbessert.53
48
Seibert/Kempf (2002), 5.
49
Vgl. Seibert/Kempf (2002), 5.
50
Vgl. Mertins/Kohl (2009), 19.
51
Mertins/Kohl (2009), 19.
52
Vgl. Seibert/Kempf (2002), 8f.
53
Vgl. Mertins/Kohl (2009), 20.
Seite
13Sie können auch lesen