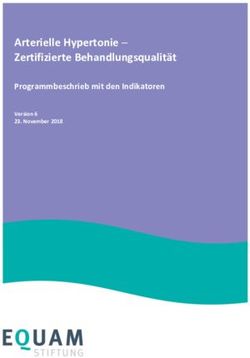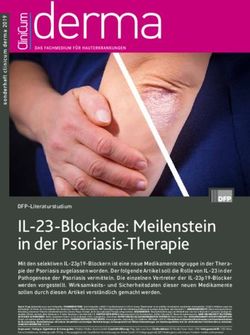Community Reinforcement Approach (CRA) - Dr.med.Christiane Rasmus BUSS-Jahrestagung Berlin 2010
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Community Reinforcement
Approach (CRA)
Dr.med.Christiane Rasmus
BUSS-Jahrestagung Berlin 2010Konzept
CRA ist ein umfassendes
verhaltenstherapeutisches Konzept zur
Behandlung von substanzbezogenen
Störungen. Es basiert auf der
Grundannahme, dass Verstärker aus dem
sozialen Umfeld erheblichen Einfluss
darauf nehmen können, ob ein Mensch
einen Konsum von Alkohol oder Drogen
fortsetzt oder einstellt.Vorgehen
Verstärker aus dem sozialen, familiären,
beruflichen Umfeld und/oder aus dem
Freizeitbereich werden so in den
Behandlungsverlauf integriert, dass die
Motivation zur Abstinenz bzw. zur
Aufrechterhaltung der Abstinenz gezeugt
und gefördert wird.Ziel
Ein abstinenter Lebensstil wird attraktiver
gemacht als die Fortführung des Konsums
von Rauschmitteln.Hintergrund
Die Wirksamkeit des Verfahrens ist
wissenschaftlich belegt.
CRA ist in verschiedenen Settings erfolgreich
einsetzbar, so bei stationären Patienten,
ambulanten Patienten, wohnungslosen
Patienten, Angehörigen, Adoleszenten. Das
Verfahren ist nicht auf Patienten mit nur einem
Rauschmittel beschränkt.
CRA erwies sich in Untersuchungen als eins der
kostengünstigsten Verfahren, die zur
Behandlung von Suchtpatienten zu Verfügung
standen.Behandlungsstrategien
CRA beruht weitgehend auf Lernen am Modell
und auf Rollenspielen.
Therapeuten sind aktiv, engagiert und direkt im
Auftreten. Es geht darum, gemeinsam mit dem
Patienten Lösungen für Probleme zu entwickeln.
Probleme sind daher immer Angelegenheit von
beiden, der Therapeut übernimmt einen Teil der
Verantwortung für entstehende Probleme.
Jeder noch so kleine therapeutische Schritt wird
positiv verstärkt.
Gezielt wird nach positiven Verstärkern in der
sozialen Umgebung des Patienten gesucht.Fazit:
CRA betrachtet den Konsum von Drogen
oder Alkohol nicht als isoliertes Verhalten,
unabhängig vom Rest des Lebens des
Patienten. Das Konsumverhalten ist aus
Sicht von CRA eng verflochten mit vielen
Aspekten des täglichen Lebens des
Patienten, so dass dem Kontext des
Substanzkonsums eine hohe Bedeutung
für die Therapie zugeschrieben wird.Therapiedauer
CRA hat in kontrollierten klinischen Studien
bereits nach drei Monaten Wirksamkeit entfaltet.
Dennoch ist die Therapiedauer prinzipiell nicht
begrenzt.
Die Dauer der Therapie ergibt sich daraus, ob
vordefinierte Ziele erreicht werden konnten.
Von Anfang an wird der Therapieprozess entlang
der subjektiven Ziele des Patienten klar
strukturiert.Setting
In der Regel finden 1x wöchentlich Therapiesitzungen
statt, am Anfang kann die Sitzungsfrequenz allerdings
darüber hinaus gehen. Eine Sitzung dauert in der Regel
eine Stunde.
In den ersten beiden Wochen ist es besonders wichtig,
den Patienten ständig positiv zu verstärken, um
Bereitschaft und Compliance bezüglich der Behandlung
und der Hausaufgaben zu erhöhen.
Im weiteren Verlauf kann die Zahl der Sitzungen/Wo
abhängig vom Verlauf reduziert werden.Die erste Sitzung
Für die erste Sitzung sollten 1,5-2 Stunden
veranschlagt werden, da das
Behandlungsprogramm erklärt wird und
Arbeitsmaterial ausgehändigt wird. Zudem
wird schon jetzt eine Strategie zur
Aufrechterhaltung der Abstinenz bis zur
nächsten Sitzung entwickelt.Das CRA-Assessment
Das erste Assessment besteht aus drei
Hauptbestandteilen:
1. Identifikation und positive Verstärkung
von Veränderungsmotivation
2. Erfassung von basalen suchtspezifischen
Hintergrundinformationen
3. Durchführung der CRA-VerhaltensanalyseIdentifikation von positiven
Verstärkern und
Unter einem positiven Verstärker versteht man
jedes Objekt oder Verhalten, das die Rate eines
nachfolgenden Verhaltens erhöht.
Es ist notwendig, für jeden Patienten die
individuell wirksamen Verstärker zu ermitteln,
insbesondere die, die stark genug sind, um
abstinenzorientiertes Verhalten zu verstärken.
Der Prozess dieser Ermittlung begleitet die
gesamte Therapie. Rückbezug auf die eigenen
Ziele ist im Verlauf immer dann sinnvoll, wenn
die Therapie an einem schwierigen Punkt ist.Festigung von Motivation
Die erste Sitzung sollte möglichst rasch nach der ersten
Anfrage des Patienten erfolgen
Zu Beginn sollten mehrere Sitzungen in kurzem
zeitlichen Abstand durchgeführt werden
Der Therapeut vermittelt Zuversicht hinsichtlich eines
positiven Behandlungserfolgs, er begleitet den gesamten
Behandlungsprozess mit positiver Grundeinstellung und
zeigt Respekt gegenüber der oft spürbaren Abwehr des
Patienten
Die grundsätzliche Lösbarkeit von Problemen sollte
vermittelt werden
Eine nahestehende Bezugsperson wird in den
Behandlungsverlauf mit einbezogen.Merke:
Der Therapeut nimmt im Verlauf jede
Gelegenheit wahr, den Patienten für seine
intensive Mitarbeit und Anstrengung
positiv zu verstärken. Es ist Ausdruck der
CRA-Philosophie, positiv gestimmt zu
bleiben, aktiv zu sein, wertschätzend zu
sein, empathisch zu sein und kontinuierlich
zu motivieren.Erfassung von basalen
suchtspezifischen
Hintergrundinformationen
Vom Patienten berichtete aktuelle Probleme
Art, Menge und Frequenz des Substanzkonsums
Hintergrundinformationen in den Bereichen
Gesundheit (somatisch/psychisch), Ehe, Familie,
Beruf, Hilfssysteme
Konsumassoziierte Probleme in o.g. Bereichen
Motivationsgründe des Pat. für die Veränderung
Erhebung individueller VerstärkerEinführung Verhaltensanalyse
Im Gegensatz zu konfrontativen Methoden fragt
CRA, warum eine Person ein Suchtmittel
konsumiert und wertet den Konsum als einen
Versuch von (nicht optimaler) Anpassung, d.h.
Konsum stellt für den Patienten eine
Überlebensstrategie dar, Angst, Depression oder
unerträgliche soziale Bedingungen werden
aushaltbar gemacht.
CRA fokussiert ursachenbezogen direkt auf diese
Problemfelder, das grundlegende
Arbeitsinstrument hierfür ist die
Verhaltensanalyse.Beschreibung: Verhaltensanalyse
Strukturiertes Interview zur Erarbeitung von Triggern
und Konsequenzen von Konsumverhalten.
Trigger werden in interne und externe Trigger
untergliedert. Die Informationen sind notwendig, um
Risikosituationen und alternative Verhaltensstrategien
herauszuarbeiten. Es soll deutlich werden, dass eine
Trinkepisode das Ergebnis vieler kleiner Entscheidungen
ist.
Es folgt eine Beschreibung des Konsumverhaltens, um im
Verlauf Therapiefortschritte überprüfen zu können.
Als letztes werden die individuellen Konsequenzen des
Konsums untersucht. Unterteilt werden sie in kurzfristig
positive Konsequenzen und langfristig negative
Konsequenzen.
Die VA ist eine umfassende Annäherung an die
betroffene Person im sozialen Kontext auf der Suche
nach Verstärkern, die abstinenzorientiertes Verhalten
unterstützen.Verschiedene Verhaltensanalysen
Klassisch: VA für Konsum
Ebenfalls klassisch: VA für Rückfall
CRA-Innovation in der Suchttherapie:
VA für abstinenzorientiertes Verhalten. Eine Besonderheit
hier ist, dass konträr zum Konsumverhalten nach
kurzfristig negativen Konsequenzen und langfristig
positiven Konsequenzen gefragt wird. Diese VA´s dienen
dazu, Strategien zu entwickeln, abstinenzorientiertes
Verhalten in seiner Häufigkeit zu erhöhen. Dabei
auftretende Hindernisse können durch
Problemlösetechniken bearbeitet werden.CRA-Verhaltensanalyse für Trinkverhalten (initiales Assesment)
Trigger external Trigger internal Verhalten
1. Mit wem sind Sie gewöhnlich 1. Was denken Sie gewöhnlich, kurz 1. Was trinken Sie gewöhnlich?
zusammen, wenn Sie trinken? bevor Sie trinken? 2. Wie viel trinken Sie gewöhnlich?
2. Wo trinken Sie gewöhnlich? 2. Was nehmen Sie gewöhnlich 3. Über welche Zeit hinweg trinken Sie
3. Wann trinken Sie gewöhnlich? körperlich wahr, kurz bevor Sie trinken? gewöhnlich?
3. Was nehmen Sie gewöhnlich
emotional wahr, kurz bevor Sie trinken?
Kurzfristige positive Langfristige negative Konsequenzen
Konsequenzen
1. Was mögen Sie am Trinken 1. Was sind die negativen Folgen von Trinken in den verschiedenen
(mit wem)? Lebensbereichen?
2. Was mögen Sie am Trinken a) Zwischenmenschlich
(wo)? b) Körperlich
3. Was mögen Sie am trinken c) Emotional
(wann)? d)Rechtlich
4.Was sind angenehme e) Arbeit
Gedanken während Sie f) Finanzen
trinken? g) andere
5. Was sind angenehme
körperliche Wahrnehmungen
während Sie trinken?
6. Was sind angenehme
Gefühle, während Sie trinken?CRA-Verhaltensanalyse für Trinkverhalten (Rückfall)
Trigger external Trigger internal Verhalten
1. Mit wem waren Sie zusammen, als 1. Was dachten Sie, kurz bevor Sie 1. Was tranken Sie?
Sie tranken? tranken? 2. Wie viel tranken Sie?
2. Wo tranken Sie? 2. Was nahmen Sie körperlich wahr, 3. Über welche Zeit hinweg tranken
3. Wann tranken Sie? kurz bevor Sie tranken? Sie?
3. Was nahmen Sie emotional wahr,
kurz bevor Sie tranken?
Kurzfristige positive Konsequenzen Langfristige negative Konsequenzen
1. Was mochten Sie am Trinken (mit wem)? 1. Was waren die negativen Folgen von Trinken in den
2. Was mochten Sie am Trinken (wo)? verschiedenen Lebensbereichen?
3. Was mochten Sie am Trinken (wann)? a) Zwischenmenschlich
4.Was waren angenehme Gedanken während Sie b) Körperlich
tranken? c) Emotional
5. Was waren angenehme körperliche d)Rechtlich
Wahrnehmungen während Sie tranken? e) Arbeit
6. Was waren angenehme Gefühle, während Sie f) Finanzen
tranken? g) andereCRA-Verhaltensanalyse für abstinenzorientiertes Verhalten: Aktivität__________
Trigger external Trigger internal Verhalten
1. Mit wem sind Sie gewöhnlich 1. Was denken Sie gewöhnlich, kurz 1. Was ist ihr abstinenzorientiertes
zusammen, wenn bevor Sie____________________? Verhalten ?
Sie_________________? (Aktivität/Verhalten) 2. Wie oft machen Sie
(Aktivität/Verhalten) 2. Was nehmen Sie gewöhnlich gewöhnlich_____________?
2. Wo machen Sie körperlich wahr, kurz bevor 3. Wie lange dauert ihr
gewöhnlich_____________? Sie___________? _____________ gewöhnlich?
3. Wann machen Sie 3. Was nehmen Sie gewöhnlich
gewöhnlich_____________? emotional wahr, kurz bevor
Sie___________?
Kurzfristige negative Konsequenzen Langfristige positive Konsequenzen
1. Was mögen Sie nicht am ________________ (mit 1. Was sind die positiven Folgen von ______
wem)? in den verschiedenen Lebensbereichen?
2. Was mögen Sie nicht am ________________ (wo)? a) Zwischenmenschlich
3. Was mögen Sie nicht am b) Körperlich
_________________(wann)? c) Emotional
4.Was sind unangenehme Gedanken während d)Rechtlich
Sie___________________________? e) Arbeit
5. Was sind unangenehme körperliche Wahrnehmungen f) Finanzen
während Sie___________? g) andere
6. Was sind unangenehme Gefühle, während
Sie_______________________________?Abstinenzkonto: Einführung
Das Abstinenzkonto ist ein Verfahren, das CRA
von den meisten anderen suchtspezifischen
Behandlungsprogrammen unterscheidet.
Grundlage ist die Annahme, dass ein Patient
besser im Programm gehalten werden kann,
wenn man ihn nicht mit zu strengen Regeln,
Ansprüchen oder angstbesetzten Perspektiven
überfordert.
Entsprechend wird dazu motiviert, sich über eine
begrenzte Zeit zur Abstinenz zu verpflichten,
unabhängig davon, ob das Fernziel dauerhafte
Abstinenz oder kontrolliertes Trinken sein soll.Vorteile des Abstinenzkontos
Therapeut und Patient haben die Möglichkeit, eine positive Beziehung
aufzubauen, können die Ernsthaftigkeit des Problems erkennen
Ziele können angemessen definiert werden
Der Weg für die Einführung von Disulfiram wird geebnet
Time-out vom Trinken ermöglicht, zu spüren, wie Abstinenz sich anfühlt,
positive Veränderungen können erfahren werden
Aktive Unterbrechung gewohnter Konsummuster, Einführung neuer positiver
Bewältigungsstrategien
Erlangung von Eigenständigkeit und Kontrolle
Verwirklichung von kurzzeitigen Zielen stärkt das Selbstvertrauen und
motiviert
Demonstration eines Veränderungswillens nach außen – Vertrauen und
Unterstützung durch Familie wird befördert
Positive Auswirkungen auf rechtliche Aspekte
Schwierigkeiten oder Rückfälle können genutzt werden, um zusätzlichen
Hilfebedarf festzustellenPraktisches Vorgehen in zwei
Schritten
1. Hier soll der Patient dazu ermutigt werden, sich auf eine
begrenzte Abstinenzphase festzulegen, die einem imaginären
Konto an Abstinenzzeit gutgeschrieben wird.
Der Therapeut schlägt 90 Tage vor und erklärt, dass die Vorteile
der Abstinenz in einem solchen Zeitraum am besten zum Tragen
kommen, zumal in dieser Phase ein besonders hohes
Rückfallrisiko besteht und 90 Tage damit ein genialer Start wären.
Kann der Patient nicht zustimmen, wird abwärts verhandelt, ein
herausforderndes aber erreichbares Ziel soll ausgehandelt
werden.
Der Patient soll in Bezug auf frühere Abstinenzzeiten und seine
individuellen Verstärker zu einer Abstinenzzusage motiviert
werdenZielerreichung
2. Nun wird verhandelt, wie das Abstinenzziel
erreicht werden kann:
Stellen Sie zeitnah die nächsten Termine sicher
Erarbeiten von Situationen mit hoher
Rückfallgefahr
Erarbeiten eines spezifischen Plans für
alternative Handlungen in Risikosituationen
Entwicklung eines zusätzlichen
Sicherheitsplanes
Verstärkung, Verstärkung, Verstärkung…Einsatz von Disulfiram mit einem
Antabus-Coach
Im ersten Schritt werden die Vorteile einer
unterstützenden Disulfiram-Behandlung vorgestellt:
Reduktion von Rückfällen, Reduktion von
Partnerschaftsproblemen, ggf. Ende täglicher
Auseinandersetzungen, ob man konsumieren möchte
oder nicht.
Die Einnahme von Disulfiram wird vermittelt als
Unterstützung auf dem Weg zum eigenen Ziel, Abstinenz
zu erreichen.
Ein Familienangehöriger, Partner, Freund oder Kollege
wird als unterstützender Antabus-Coach empfohlen.
Aufgabe des Coaches ist die Kontrolle der Einnahme und
– wichtiger noch - die tägliche positive Verstärkung der
Einnahme.Vorteile von Disulfiram
Reduktion von Ärger und Sorgen von Angehörigen
Verstärkung von Vertrauen zwischen Patient und
Familienangehörigen
Verringerung der Gefahr von „Ausrutschern“
Ansprache vieler Trigger für Konsumverhalten
Bessere Fortschritte in den Therapiesitzungen
Vermehrtes Vertrauen auf andere Copingstrategien
Stärkung des Selbstbewußtseins
Reduktion täglicher quälender Entscheidungen
Mehr Möglichkeiten für positive Verstärkung
Bessere Möglichkeit zur Wahrnehmung von
FrühwarnzeichenMerke:
Lehnt ein Patient die Disulfiram-Behandlung ab,
obgleich er hierfür geeignet wäre, orienteirt sich
der Therapeut an dem CRA-Grundsatz, das
Gegebene zu akzeptieren und Machtkämpfe zu
vermeiden.
Eine Möglichkeit ist, einen Vertrag auszuhandeln,
dass der Pat. sich auf Disulfiram einlässt, wenn
er es über einem Monat nicht geschafft hat,
abstinent zu bleiben.Einbeziehung des Hausarztes
Der Einsatz von Disulfiram sollte erst dann
begonnen werden, wenn der Patient eine
spezielle Einverständniserklärung unterschrieben
hat, die ihn ausführlich und verständlich über die
Gefahren und die Wirkungsweise des
Medikamentes aufgeklärt hat.
Auch sollte der Hausarzt kontaktiert werden,
dem das Vorgehen erläutert werden sollte und
der die Möglichkeit hat, den Patienten körperlich
zu untersuchen und ggf. das Medikament zu
verordnen.Einbeziehung einer vertrauten
Person
Der vertrauten Person sollte ihre wichtige Rolle bei der
Unterstützung des Patienten verdeutlicht werden.
Der Therapeut erklärt ausführlich, wie Disulfiram wirkt
und welche Vorteile es hat.
Eine vertraute Person ist dann geeignet, die Therapie zu
unterstützen, wenn sie Interesse an der Fortführung der
Beziehung zum Patienten hat und motivierend und
unterstützend zu wirken bereit ist.
Dann werden Beispiele gegeben, wie die vertraute
Person dem Patienten das Disulfiram anbieten könnte.Der Antabus-Coach
Coach kann eine beliebige beteiligte Person sein,
die bereit ist, dem Patienten zu helfen
(Lebensgefährte, Kollege, Freund, Chef, Polizei,
Bewährungshelfer…)
Beide (Patient und Coach) müssen verstanden
haben, dass die Rolle des Coaches nicht
bestrafend, sondern unterstützend sein soll.
Der Therapeut weist darauf hin, wie wichtig es
ist, dass der Coach bei der Vergabeprozedur
stark unterstützend einwirkt.Die Einnahme
Eingangsdosis über drei Tage 0,5-1g, Erhaltungsdosis 0,2-0,4 g/d
Der Coach löst die Tablette in einem halben Glas Wasser auf, reicht
dem Patienten schließlich das Glas und sieht bei der Einnahme zu,
er lobt den Patienten für die Einnahme und für das, was er bereits
erreicht hat, seit er die Entscheidung getroffen hat, mit dem Trinken
aufzuhören
Der Therapeut bietet Beispiele für eine entsprechende
Kommunikation an und bittet das Paar, in einem Rollenspiel die
Vergabeprozedur zu üben, gibt Rückmeldung und positive
Verstärkung, es wird in der Folge bearbeitet, wie beide sich dabei
fühlten. Dann wird die erste Vergabe noch beim Therapeuten
vorgenommen, für die Folgetage wird eine feste Vergabezeit
vereinbart, die beide in der Regel zusammen verbringen und mit der
beide einverstanden sind.
Das Paar wird gebeten, das Medikament zu den nächsten Terminen
mitzubringen, damit die Einnahme kontrolliert werden kann.Disulfiram-Ritual
Ziel in der Arbeit mit Patienten und
Antabus-Coach ist die Erarbeitung eines
täglichen Einnahmerituals, das beiden
gefällt und das im Rollenspiel eingeübt
werden kann.Behandlungsplan:
1.Zufriedenheitsskala
Die Zufriedenheitsskala stellt die Basis für den
Behandlungsplan dar.
Der Patient wird gebeten, seine aktuelle
Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen
auf einer Skala von 1-10 darzustellen.
Das Instrument schafft einen schnellen Überblick
über die Schwere von Problemen in
verschiedenen Lebensbereichen des Patienten.Zufriedenheit mit:(1-10, 1=katastrophal, 10=himmlisch)
1.meiner körperlichen Gesundheit
2.meinem sozialen Leben
3. meiner Arbeit
4.meinem Schulbesuch /meiner Ausbildung
5. meinen Finanzen
6.meinem Alkoholkonsum und seinen Auswirkungen
7. meiner Drogenkonsum und seinen Auswirkungen
8. meiner Abstinenz
9. meiner seelischen Gesundheit
10. meiner sportlichen Betätigung
11. meiner Beziehung zu meinem Lebenspartner/in
12. meiner Beziehung zu meinen Kindern
13. meiner Beziehung zu meinen Eltern
14. meiner Beziehung zu meinen engen Freunden
15. juristischen Problemen
16. meiner Art, mit anderen zu kommunizieren
17. meinem spirituellen Leben
Allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben aktuell:Behandlungsplan
2: Behandlungsziele
Das nun folgende Arbeitsblatt enthält die selben
Lebensbereiche.
Beim Ausfüllen unterstützt der Therapeut den
Patienten dabei, spezifische Ziele und Strategien
zur Umsetzung in den verschiedenen
Lebensbereichen zu definieren. Es geht hierbei
darum, Lebensqualität und Lebenszufriedenheit
in nicht konsumassoziierten Bereichen des
Lebens zu erhöhen.
Die zur Umsetzung der Ziele notwendigen Skills
werden dann in der Folge konkret entwickelt und
trainiert.Zielformulierung
Ein Ziel sollte in der Formulierung vier
Regeln folgen:
1. Es sollte klar und kurz formuliert sein.
2. Es sollte positiv formuliert sein.
3. Es sollte messbar sein.
4. Es sollte aus eigener Kraft erreichbar
sein.Skills-Training Kommunikationstraining Problemlösetraining Ablehnungstraining
Zusätzliche Angebote Arbeitsberatung Beratung im sozialen und Freizeitbereich Paartherapie Rückfallprävention
Kommunikationstraining
Der CRA-Fokus beim Kommunikationstraining
liegt auf drei Komponenten:
1. Äußerung von Verständnis für den andern
2. Übernahme einer teilweisen Verantwortung für
das gemeinsame Problem
3. Abgabe eines Hilfsangebotes an den andern
In verschiedenen konkreten Situationen wird
die optimierte Kommunikation geplant und
dann im Rollenspiel geübt.Problemlösetraining
Das Problemlösetraining ist ein kleinschrittiges Verfahren
zur Lösung konkreter Probleme (Suchtdruck,
Beziehungswunsch, Entspannungsmöglichkeiten u.a.)
Es beginnt mit einer möglichst exakten Problemdefinition
und wird von einem Brainstorming fortgeführt, in dem
möglichst viele Lösungswege generiert werden. Dann
werden eine realisierbare Lösung identifiziert, die
praktische Umsetzung erarbeitet und Hindernisse
antizipiert. Der Patient probiert die so gefundene Lösung
eine Woche lang aus und berichtet dem Therapeuten in
der nächsten Sitzung davon. Ggf. wird ein alternativer
Lösungsweg in gleicher Weise erarbeitet.Ablehnungstraining
Hier werden Strategien zur Verbesserung
der Durchsetzungsfähigkeit erarbeitet und
im Rollenspiel geübt.Arbeitsberatung
Eine befriedigende Arbeit ist häufig eine
Quelle für viele positive Verstärker
(Selbstwert, soziale Beziehungen,
Finanzen u.a.)
Es werden Skills vermittelt, um eine Arbeit
zu bekommen, zu behalten oder um die
Zufriedenheit mit der Arbeitssituation zu
verbessern. Überwiegend kommen
Techniken des Problemlösens zum Einsatz.Beratung im sozialen und
Freizeitbereich
Zentrale Aufgabe ist es, nicht
konsumassoziierte soziale Aktivitäten
aufzubauen, die mit dem Konsumverhalten
konkurrieren und somit die Abstinenz
unterstützen.
Eingesetzt werden auch hier vorwiegend
Strategien des Problemlösens.Paartherapie
Die Partner/innen sind extrem wichtig, damit
partnerschaftliche Probleme geklärt werden können und
die Unterstützung der Behandlung durch den Partner/die
Partnerin gewonnen werden kann.
Die Behandlung beginnt mit einer speziellen
Zufriedenheitsskala und einem Arbeitsblatt zu
Veränderungswünschen in der Partnerschaft.
Hieraus werden Ziele gebildet, in der Folge werden
basale Kommunikationsfertigkeiten, die Kunst des
Verhandelns, Strategien zur Zielerreichung und
Anregungen zu einem liebevolleren Umgang in der
Partnerschaft vermittelt.Rückfallprävention
Rückfallprävention beginnt direkt im Anschluss
an die Verhaltensanalyse für Konsumverhalten
nach der Identifikation von Triggern und
Risikosituationen.
Lebenspartner werden in Identifikation von- und
Umgang mit Frühwarnzeichen einbezogen.
Gemeinsam werden Handlungsstrategien zum
Umgang mit Triggern und Risikosituationen
erarbeitet.
Im Falle eines Rückfalles werden über
Verhaltensanalysen neue Coping-Strategien
erarbeitet.Sie können auch lesen