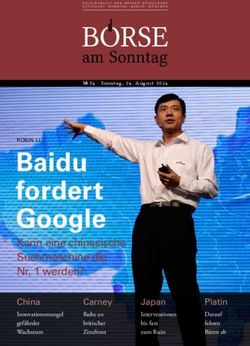Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie - VDI-Statusreport Februar 2019
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Keimreduzierung im klinischen
Umfeld durch Nanotechnologie
VDI-Statusreport
Februar 2019
Bild: © PIXABAY, sasintVorwort
Krankenhausinfektionen werden in den nächsten Jahr- chen zur Keimübertragung und der Beitrag von anti-
zehnten eine der häufigsten Todesursachen in den ent- mikrobiellen Oberflächen zur Keimreduzierung noch
wickelten Staaten darstellen. Eine noch konsequentere relativ unerforscht sind. Sicher ist eigentlich nur, dass
Einhaltung der bestehenden Hygienevorschriften ist der Mensch nicht mit gefährlichen Keimen auf die
deshalb sicherlich ein vorrangiges Ziel. Welt kommt, sondern diese im Laufe seines Lebens
erwirbt. Unbestreitbar ist auch, dass die Kliniken im
Angesichts des bereits aktuellen Ausmaßes des Pro- Moment einen hohen Aufbereitungsaufwand betrei-
blems sollte mit Nachdruck und Engagement an inno- ben, um unbelebte Oberflächen nach genau definier-
vativen Strategien zur Bekämpfung des Problems ge- ten Vorschriften regelmäßig von Keimen zu befreien.
arbeitet werden. Allein diese Tatsache legt es nahe, Oberflächen zwi-
schen zwei Reinigungszyklen so keimarm wie mög-
Die Nutzung der Nanotechnologie kann eine solche lich zu halten.
innovative Strategie darstellen. Bereits 2015 wurde
deshalb ein entsprechender Fachausschuss im VDI Der Fachausschuss will mit seinen Aktivitäten des-
gegründet, um sich des Themas anzunehmen. Der halb aktiv zu einer Strategieentwicklung zur Keimre-
Fachausschuss sollte sich speziell mit der Thematik duzierung auf Basis von Nanotechnologien und anti-
Keimreduzierung im klinischen Umfeld mithilfe der mikrobiellen Oberflächen beitragen und gezielt ein
Nanotechnologie befassen. Problembewusstsein bei Entscheidungsträgern herbei-
führen. Ziel dieses ersten Statusreports ist es, den
Nanomaterialien sind seit jeher Teil unserer Umwelt. Einsatz von Nanotechnologien zur Keimreduzierung
Beispielsweise werden auf jeder Silber- oder Kupfer- im klinischen Umfeld aus allen wichtigen Blickwin-
oberfläche durch natürliche Redoxreaktionen Nano- keln zu beleuchten. Daher setzt sich der Fachaus-
silber- oder Nanokupferobjekte gebildet. Demgegen- schuss aus Ingenieuren, Medizinern, Physikern und
über ist der gezielte Einsatz von Nanomaterialien und Chemikern aus universitären Kliniken, materialwis-
Nanotechnologien zur Funktionalisierung von Materi- senschaftlichen Instituten gemeinsam mit Vertretern
alien und Oberflächen ein noch relativ junges For- von Unternehmen und staatlichen Institutionen zu-
schungsgebiet. Im Hinblick auf die medizintechni- sammen.
schen Anwendungen steht vor allem die antimikrobi-
elle Funktionalisierung von Oberflächen im Fokus. Im An dieser Stelle danke ich allen Fachausschussmit-
Laufe der Erstellung dieses Statusreports wurde deut- gliedern für ihr Engagement bei der Erstellung dieses
lich, dass auch der Beitrag von unbelebten Oberflä- Statusreports.
Düsseldorf im Januar 2019
Dipl.-Kaufmann Adi Parzl
Vorsitzender des VDI-Fachausschusses 202
Keimreduzierung im klinischen Umfeld
durch Nanotechnologie
www.vdi.deAutoren
Dr. Christian Alex, Gesundheits- und Pflegepolitischer Arbeitskreis der CSU, Waal
Dr. Jörg Bossert, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Jena
Dr. Ralph Brückner, HECOSOL GmbH, Bamberg
Prof. Dr. med. Clemens Bulitta, Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden, Amberg
Achim P. Eggert PhD VDI, VDI-Gesellschaft Materials Engineering, Düsseldorf
Dr. rer. nat. Andrea Ewald, Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der Medizin und Zahnheilkunde, Würzburg
Dr. rer. nat. Justus Hermannsdörfer, Nanoinitiative Bayern GmbH, Würzburg
Prof. Dr. Dirk Höfer, Hohenstein Laboratories GmbH, Bönnigheim
Dr. med. Thomas Holzmann, Universitätsklinik Regensburg, Regensburg
Dipl.-Ing. Werner Kexel, TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Darmstadt
Prof. Dr. med. Cornelia Lass-Flörl, Innsbruck Medical University, Innsbruck
Dr. Henning Mallwitz, Bode Chemie GmbH, Hamburg
Dr. Andreas Murr, RAS AG, Regensburg
Dipl.-Kfm. Adi Parzl, Bay Wing GmbH, Regensburg
Dr. Jörn Probst, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg
Dr. Angela Rossi, Fraunhofer Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg
Elisabeth Rüdinger, Margetshöchheim
Gregor Schneider, RAS AG, Regensburg
Prof. Dr. med. Wulf Schneider, Universitätsklinikum Regensburg, Regensburg
Claudia Som M.Sc., EMPA, St. Gallen
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 3
Inhalt
Vorwort 1
1 Einleitung 4
1.1 Problemstellung 4
1.2 Innovative Hygienestrategien 4
1.3 VDI-Fachausschuss 202 und Aufbau des Statusreports 4
2 Nosokomiale Infektionen, aktuelle Vorgehenspraxis bei Infektionen 6
2.1 Nosokomiale Infektionen 6
2.2 Vorgehen bei nosokomialen Infektionen 9
3 Nanotechnologien und Einsatzgebiete 11
3.1 Einsatzgebiete 11
3.2 Wirkmechanismen gegen Bakterien 12
3.3 Nanotechnologien für den Einsatz im klinischen Umfeld 13
3.4 Nanomaterialtechnologien 13
4 Testmethoden 20
4.1 Einführung 20
4.2 Aktuell angewandte Normen 20
4.3 Vor- und Nachteile 21
4.4 Beispiele für Labormethoden (Entwicklung antimikrobieller Methoden) 21
4.5 Ausblick 23
5 Risiko-Nutzen-Bewertung 25
6 Rechtliche Rahmenbedingungen 27
6.1 Einführung 27
6.2 Nanodefinition 27
6.3 Chemikaliengesetzgebung in der EU 27
6.4 EU-Biozidverordnung 27
6.5 Stoffbegriff – Was ist ein Biozid und was nicht? 28
6.6 Relevante Produktarten 28
6.7 Regulierung von Nanomaterialien 28
6.8 Verkehrsfähigkeit von „Nano-Bioziden“ 28
6.9 Die Regelung von Nanomaterialien (neue Medizinprodukteverordnung) 28
7 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 31
Literatur 32
www.vdi.de4 VDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie
1 Einleitung
1.1 Problemstellung Oberflächen überleben können, wird klar, dass sich
hieraus ein besonderes Gefährdungspotenzial ergeben
Krankenhausinfektionen (nosokomiale Infektionen) kann. Da antimikrobielle Oberflächen jedoch nicht in
rücken vor allem aufgrund von spektakulären Fällen der Lage sind, Schmutzreste zu beseitigen, wird die
zunehmend ins öffentliche Blickfeld, beispielsweise Reinigung und Desinfektion auch in Zukunft die zen-
wenn Neugeborene auf Frühchen-Stationen infiziert trale Hygienestrategie in Bezug auf Oberflächen dar-
werden und sterben. In Deutschland führen die ge- stellen. Die nach einer Reinigungs- und Desinfekti-
schätzten 500.000 Krankenhausinfektionen pro Jahr onsmaßnahme verbleibenden Keime, die z. B. über
zu etwa 15.000 Toten. Dies verdeutlicht das hohe Berührungen von Oberflächen weiter verbreitet wer-
Infektionsrisiko im Vergleich zu anderen Bedrohun- den, können aber über antimikrobielle Oberflächen in
gen (Straßenverkehr, Terrorangriffe ...), das heute der Proliferation eingeschränkt werden oder sogar
noch vielfach unterschätzt wird. Legt man die obigen vollständig abgetötet werden. Nanomaterialien eignen
Zahlen zugrunde, wird sich statistisch gesehen jeder sich aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften, auf
zweite Bundesbürger einmal in seinem Leben eine die wir in diesem Statusreport noch eingehen werden,
Krankenhausinfektion zuziehen und 1,5 % der Bun- in besonderer Weise zur Realisation von antimikro-
desbürger werden an einer Krankenhausinfektion biellen Oberflächen.
sterben. Die Problematik multiresistenter Keime, also
der Keime, die gegen mehrere oder alle Antibiotika
resistent sind, wird zunehmen, da kaum neue Antibio- 1.3 VDI-Fachausschuss 202 und Aufbau
tika auf den Markt kommen. Die oft gebrauchte For- des Statusreports
mulierung, dass bestehende Hygienevorschriften nur
konsequent eingehalten werden müssen, greift deshalb Der VDI führt zu gesellschaftlich und wirtschaftlich
viel zu kurz. relevanten Technologien Fachbeiräte. In Fachaus-
schüssen innerhalb der Fachbeiräte werden Informati-
Offenbar werden in unserem aktuellen Medizin- und onen und Daten gesammelt und Empfehlungen erar-
Gesundheitssystemen die Hygienevorschriften nicht beitet. Der VDI-Fachausschuss 202 „Keimreduzie-
konsequent eingehalten, obwohl seit Jahren daran rung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie“
gearbeitet wird. Spricht man mit den Praktikern in den ist einer dieser Fachausschüsse und setzt sich zusam-
Kliniken vor Ort, erhält man plausible und einleuch- men aus Experten aus der Materialforschung, klini-
tende Begründungen, warum bestehende Hygienevor- schen Forschung, Wirtschaft und Politik. Der hier
schriften nicht immer konsequent eingehalten werden vorliegende Statusreport wurde in einer Gemein-
können. Sicherlich gibt es deshalb auch an dieser schaftsarbeit des Fachausschusses erarbeitet. Zunächst
Stelle noch Handlungsbedarf. wird im Abschnitt 1 die aktuelle Problematik der
nosokomialen Infektionen, das aktuelle Hygienema-
nagement und das Vorgehen bei Infektionen, darge-
1.2 Innovative Hygienestrategien legt. Danach werden aussichtsreiche Nanotechnogien
und Anwendungsgebiete zur Reduzierung von Infek-
Es besteht daher der dringende Bedarf, über innovati- tionen vorgestellt. Ein wichtiger Punkt im Hinblick
ve Lösungen des Problems nachzudenken, um beste- auf die spätere Akzeptanz ist der Wirknachweis. Den
hende Hygienestrategien wirksam zu unterstützen. Wirknachweisen wurde deshalb ein eigener Abschnitt
Eine dieser Maßnahmen könnten beispielsweise anti- gewidmet. Die Chancen und Risiken neuer Technolo-
mikrobielle Oberflächen sein. gien müssen immer sorgsam abgewogen werden.
Abschnitt 5 widmet sich dieser Thematik. In der Ge-
Der Grundgedanke ist dabei relativ einfach: Wenn es sundheitsbranche ist es so schwierig wie in kaum
sinnvoll ist, in bestimmten Reinigungs- und Desinfek- einer anderen Branche, Innovationen aus der For-
tionszyklen Oberflächen zu reinigen und zu desinfi- schung und Entwicklung in den praktischen Einsatz
zieren, dann ist es auch sinnvoll, eben diese Oberflä- zu überführen. Abschnitt 6 beschäftigt sich deshalb
chen zwischen zwei Reinigungszyklen so keimarm mit Zulassungen und anderen Markteintrittsbarrieren.
wie möglich zu halten. Hinzu kommt, dass manche Im Abschnitt 7 werden dann schließlich die Ergebnis-
Oberflächen konventionell überhaupt nicht desinfi- se zusammengefasst und Empfehlungen zur weiteren
zierbar (z. B. operativ im Körper eingebrachte Im- Vorgehensweise insbesondere für Politik und Ent-
plantate) oder aber nur sehr schwierig zu reinigen und scheidungsträger aus der Gesundheitsbranche gege-
zu desinfizieren (Ritzen und andere schwer zugängli- ben.
che Oberflächen) sind. Wenn man bedenkt, dass eini-
ge nosokomiale Erreger über mehrere Monate auf
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 5
Die Informationen zum vorliegenden Statusreport Fachausschussmitglied Herr Prof. Bulitta den VDI-
wurden nach bestem Wissen und Gewissen von den Fachausschuss „Management hygienisch relevanter
Mitgliedern unseres Fachausschusses gesammelt und Flächen in medizinischen Einrichtungen“. Eine Ziel-
zusammengestellt. Aufgrund der Komplexität der setzung unserer gemeinsamen Arbeit ist es, eine Dis-
Themenstellung kann trotzdem kein Anspruch auf kussion auf breiter Front voranzutreiben. Über Anre-
Vollständigkeit der Informationen erhoben werden. gungen und Beiträge zur weiteren Verbesserung der
Der Fachausschuss wird weiter an dieser wichtigen Informationslage würden wir uns deshalb sehr freuen.
Themenstellung arbeiten. Zusätzlich leitet unser
www.vdi.de6 VDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie
2 Nosokomiale Infektionen, aktuelle
Vorgehenspraxis bei Infektionen
2.1 Nosokomiale Infektionen nella enterica ssp. enterica Serovar Typhi) und Pest
(Yersinia pestis), aber auch Ebola (Zaire-Ebola virus).
Nosokomiale Infektion oder Krankenhausinfektionen
Fakultativ pathogene Erreger verursachen eine Er-
sind Infektionen, die im Zuge eines Aufenthalts oder
krankung erst dann, wenn das Immunsystem beein-
einer Behandlung in einer Gesundheitseinrichtung
trächtigt ist, z. B. durch Verletzungen oder operative
auftreten („nosos“ – Krankheit, „komein“ – pflegen).
Eingriffe. Diese Gruppe umfasst die häufigsten Erre-
Die häufigsten nosokomialen Infektionen sind Harn-
ger ambulant und im Krankenhaus erworbener Infek-
wegsinfektionen, Infektionen der unteren Atemwege
tionen (z. B. Staphylococcus aureus). Apathogene
und postoperative Wundinfektionen, gefolgt von
Mikroben verursachen Infektionen, wenn das Ab-
Gefäßkatheter-assoziierten Infektionen. Die häufigs-
wehrpotenzial massiv geschwächt ist, wie bei HIV-
ten Erreger von Krankenhausinfektionen sind fakulta-
oder Leukämiepatienten.
tiv pathogene Bakterien, die zur normalen Körperflora
des Menschen gehören. Die Schwere der Grund- Der größte Teil der nützlichen Bakterien besiedelt den
krankheit und die Art der medizinischen Versorgung Dickdarm, der Rest besiedelt den Dünndarm, die
beeinflussen das Infektionsrisiko. Haut, die Mundhöhle, den Rachen und die Scheide.
Damit die Mikrobiota ihren Aufgaben gerecht werden
Das moderne Management der Infektionsprävention
kann, müssen nützliche Bakterien in ausreichender
umfasst ein ganzes Bündel von Maßnahmen, zu wel-
und konstanter Zahl im Milieu vorhanden sein.
chem die Standardhygiene, die aktive Surveillance
mikrobiologischer Daten sowie der kontrollierte Ein-
satz von Antibiotika gehören. Nosokomiale Infektio-
nen werden in den nächsten Jahrzehnten eine der 2.1.2 Infektionen
häufigsten Todesursachen in den entwickelten Staaten
darstellen. Als Infektion bezeichnet man den Eintritt, die Ansied-
lung und Vermehrung von Mikroorganismen in einem
Wirt. Der Verlauf einer Infektionskrankheit hängt von
den Pathogenitätsfaktoren des Erregers und vom All-
2.1.1 Der Mensch und seine Mikroben
gemeinzustand des Wirtsorganismus ab.
Der gesunde Mensch wird von ca. 1014 (hundert Billi- Die Einteilung von Infektionen kann nach verschiede-
onen) Bakterien besiedelt. Die äußere Haut sowie die nen Gesichtspunkten erfolgen, z. B. nach der Art
Schleimhäute des Oropharynx, des oberen Respirati- (Bakterien oder Pilze) oder Herkunft (exogen oder
onstrakts, des Dickdarms und des unteren Urogenital- endogen) der Erreger.
trakts sind von einer Bakterienflora (Mikrobiom)
besiedelt. Diese Mikroflora oder physiologische Flora Die Übertragung erfolgt:
(Normalflora) setzt sich überwiegend aus apathoge-
nen und zu einem geringen Anteil aus fakultativ pa- Durch direkten Kontakt, z. B. durch verunreinigte
thogenen Bakterien zusammen. Die Zahl der Mikro- Nahrung (Salmonellen im Speiseeis), kontami-
ben übersteigt jene der Körperzellen etwa um das 10- nierte Hände (spielt im Krankenhaus eine wesent-
bis 100-Fache. Die physiologische Kolonisation des liche Rolle) und infizierte Patienten. Auch ist ei-
Neugeborenen beginnt unmittelbar nach der Geburt ne Übertragung durch die Luft (Tröpfcheninfek-
mit Bakterien von der Mutter und aus der Umwelt und tion) durch Husten oder Niesen möglich.
bleibt ein Leben lang bestehen.
Durch indirekten Kontakt, z. B. durch Blut oder
Bakterien haben für den Menschen krank machende Blutprodukte oder durch das Mehrfachbenutzen
(pathogene Bakterien, Infektionserreger) oder schüt- von Spritzbestecken.
zende Eigenschaften (apathogene und fakultativ pa-
thogene Bakterien der Mikrobiota). Das Risiko eine Infektion zu erwerben, hängt von
verschiedenen Faktoren ab:
Obligat pathogene Erreger verursachen in der Regel
Infektionen beim gesunden Menschen. Hierzu zählen Infektionsdosis (Anzahl der übertragenen Erre-
die klassischen Infektionserreger wie Typhus (Salmo- ger): Beim Menschen kommt es erst nach Kon-
takt mit hohen Dosen von Typhusbakterien zu ei-
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 7
ner Infektion; andererseits kann schon ein Tuber- durch maschinelle Beatmung. Nach einer 1995 durch-
kulosebakterium eine Infektion auslösen geführten Erhebung in Deutschland (NIDEP-Studie)
betrug die Prävalenz von Harnwegsinfekten 1,46 %,
krank machendes Potenzial des Erregers (Viru- von unteren Atemwegsinfektionen 0,72 %, von posto-
lenz) perativen Wundinfektionen 0,55 % und von primärer
Septikämie 0,29 %. Im Jahr 2006 traten ca. 400.000
Anfälligkeit des Menschen: Neugebore- bis 600.000 nosokomiale Infektionen in Deutschland
ne/Säuglinge, alte Menschen, schwangere Frauen auf, eine im Jahre 2011 durchgeführte nationale Prä-
und Personen mit geschwächter Immunabwehr valenzstudie bestätigt diese Daten.
haben ein erhöhtes Infektionsrisiko
Die Häufigkeit von Krankenhausinfektionen hängt
Expositionszeit vom Typ des Krankenhauses ab. Die Schwere der
Grundkrankheit und die Art der medizinischen Ver-
Eintrittspforte
sorgung beeinflussen das Infektionsrisiko. So haben
Intensivstationen eine mindestens 4-fach höhere Inzi-
denz als andere medizinische Fachbereiche. Mehr als
2.1.3 Krankenhausinfektionen 20 % aller Patienten haben eine nosokomiale Infekti-
on, die mehr als 50 % aller Infektionen auf Intensiv-
Krankenhausinfektionen sind Infektionen, die in kau- stationen ausmachen. Dies hat damit zu tun, dass ein
salem Zusammenhang mit einem Krankenhausaufent- kritischer Allgemeinzustand per se zu grundlegenden
halt stehen, unabhängig davon, ob Krankheitssymp- Änderungen der Immunkompetenz führt, invasive
tome bestehen oder nicht. Nachdem sich nosokomiale Maßnahmen mit erhöhtem Infektionsrisiko einherge-
Infektionen aber nicht nur auf Krankenhäuser be- hen und lebensnotwenige Medikamente wiederum
schränken, sondern in allen Gesundheitseinrichtungen immunsuppressiv wirken und bakterielle Infektionen
(Langzeit-Pflegeeinrichtungen und Rehabilitations- fördern.
zentren, Ambulatorien, Praxen) auftreten, spricht man
auch von „Gesundheitseinrichtungen-assoziierten Davon abzugrenzen sind Infektionen, die außerhalb
Infektionen“ oder „health-care associated infections“. des Krankenhauses erworben werden, aber zu einem
Aufenthalt im Krankenhaus führen. Dazu zählen bei-
Das Europäische Zentrum für die Prävention und die spielsweise Patienten mit ambulant erworbener
Kontrolle von Krankheiten schätzt, dass jedes Jahr Pneumonie, Harnwegsinfektion, Meningitis und Haut-
über 4 Mio. Patienten in Europa an „health-care asso- und Weichgewebsinfektion. Eine Prävalenzstudie aus
ciated infections“ erkranken und dass davon mindes- dem Jahre 1994 ergab, dass von 1,2 bis 1,8 Mio. am-
tens 37.000 Personen sterben. Diese Infektionen ver- bulant erworbenen Infektionen auszugehen ist. Das
längern den Krankenhausaufenthalt, erfordern mehr Verhältnis ambulant erworbene zu nosokomialen
Diagnostik- und Behandlungsaufwand und sind mit Infektionen war 3 :1.
Mehrkosten verbunden. Das Auftreten von multiresis-
tenten Erregern kann die Behandlung zusätzlich ver- Nosokomiale Infektionen haben in der öffentlichen
komplizieren. Nur ein geringer Teil der Patienten, die Wahrnehmung einen starken Eingang gefunden und
eine nosokomiale Infektion erleiden, haben eine In- werden in den Medien vielfach kommentiert. Der Laie
fektion mit einem multiresistenten Erreger. Hoch- hat den Eindruck, dass diese Infektionen nur durch
rechnungen für Deutschland ergaben, dass ca. unsauberes Arbeiten bzw. durch mangelnde Hygiene
29.000 nosokomiale Infektionen durch multiresistente verursacht werden. Das ist in dieser Form aber nicht
Erreger verursacht werden. Ihr Anteil an nosokomia- korrekt.
len Infektionen beträgt ca. 6 %. Die Ursache für die
zunehmend schwierige Resistenzlage ist multipel und Nosokomiale Infektionen stellen vielfach einen Kolla-
findet sich im unkritischen Einsatz von Antibiotika in teralschaden der modernen Medizin dar und können
der Human-, Veterinär- und Umweltmedizin. trotz optimaler Hygiene nie gänzlich eliminiert wer-
den. Das Problem ist Folge des erfolgreichen medizi-
Die Häufigkeit von Krankenhausinfektionen kann in nischen Fortschritts, der höheren Invasivität und Ag-
den Maßzahlen Prävalenz oder Inzidenz dargestellt gressivität der Therapie bei zunehmend multimorbi-
werden. Die Prävalenz beträgt für Akutkrankenhäuser den, betagten und schwerstkranken Patienten.
je nach medizinischer Ausstattung im Durchschnitt
heute etwa 3 % bis 14 %. Die Inzidenz liegt bei 2,5 %
bis etwa 10 %. 2.1.4 Erreger von
Zu den wichtigsten nosokomialen Infektionen zählen Krankenhausinfektionen
Harnwegsinfekte verursacht durch einen Blasenkathe-
ter, postoperative Wundinfekte, Septikämien durch Die häufigsten Erreger von Krankenhausinfektionen
Katheter und Infektionen der tiefen Atemwege etwa sind fakultativ pathogene Bakterien, die zur normalen
www.vdi.de8 VDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie
Körperflora des Menschen gehören. Man spricht hier Augentropfen. Flächen per se können als potenzielle
von sogenannten endogenen Infektionen. Die wich- Infektionsquelle fungieren (Rotaviren im Sanitärbe-
tigsten Erreger nosokomialer Infektionen sind Esche- reich), spielen nach dem heutigen Stand des Wissens
richia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aber eher eine untergeordnete Rolle, sofern die Reini-
aeruginosa, Enterokokken und Candida albicans. Die gung und Desinfektion ordnungsgemäß durchgeführt
Häufigkeit der einzelnen Spezies wird stark durch die werden. Wenn Infektionserreger von außen (also von
Verwendung von Antibiotika an den einzelnen Klini- der Umwelt) an den Patienten gebracht werden,
ken beeinflusst (Selektion). Unter multiresistenten spricht man von einer exogenen Infektion. Etwa 20 %
Erregern versteht man in der Regel methicillinresis- der nosokomialen Infektionen entstehen exogen, hier-
tente S. aureus (MRSA), vancomycinresistente zu zählen auch Kreuzinfektionen.
Enterokokken (VRE) und eine Vielzahl gramnegati-
ver Bakterien mit unterschiedlich stark ausgeprägtem Etwa 2 % bis 10 % aller Krankenhausinfektionen
Resistenzmuster gegen Antibiotika (multiresistente treten als Ausbrüche oder epidemisch auf. Unter ei-
gramnegative Stäbchen (MRGN)). nem Ausbruch versteht man das gehäufte Auftreten
von Infektionen in einem zeitlichen und räumlichen
Die Zuordnung der häufigsten Bakterienarten zu den Zusammenhang. Nach Literaturangaben werden die
wichtigsten Krankenhausinfektionen ist Tabelle 1 zu meisten Ausbrüche durch Bakterien hervorgerufen
entnehmen. (71 %), ca. 21 % sind Virusinfektionen, 5 % werden
durch Pilze bedingt und 3 % durch Parasiten.
Tabelle 1. Zuordnung der häufigsten Bakte-
rienarten zu den wichtigsten Krankenhausinfek- 2.1.6 Hygienemaßnahmen
tionen
Im Krankenhaus müssen besondere Maßnahmen zur
Krankenhausinfektion Erreger
Infektionsverhinderung (Prävention) getroffen wer-
Harnweginfektionen den. Die größte Gefahr einer Infektionsübertragung
gramnegative Bak- geht vom infizierten Patienten aus. Wobei auch hier
terien genau unterschieden werden muss, mit welchen Erre-
gern jemand infiziert ist. Ein Patient mit Durchfall
Postoperative Wundin- benötigt andere Hygienemaßnahmen als ein Patient
fektionen mit offener Tuberkulose. Es braucht ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen, um Patienten zuverlässig vor
Infektionen nosokomialen Infektionen zu schützen: Dazu gehören
der Atemwege die Standardhygiene, die zeitnahe Beobachtung und
Analyse von mikrobiologischen Untersuchungen und
Bakteriämie
Antibiotika-Empfindlichkeiten (sogenannte Surveil-
lance) sowie die Kontrolle des Einsatzes von Antibio-
tika durch Experten (sogenannte Antimicrobial Ste-
wardship). Die wichtigste Maßnahme, und das nicht
2.1.5 Infektionsquellen nur auf der Intensivstation, ist die Desinfektion der
Hände. Fehler im Desinfektionsmanagement oder
Die wichtigste belebte Infektionsquelle ist also der unsachgemäße Desinfektionsmaßnahmen haben
Patient selbst mit seiner Mikrobiota. In absteigender schwerwiegende Folgen für Patienten, da Krankheits-
Folge zählen das stationseigene Personal, stations- erreger nicht korrekt abgetötet werden. Der Einsatz
fremde Personen oder die unbelebte Umgebung im weiterer spezifischer Maßnahmen hängt von einer
Krankenhaus zu den möglichen Quellen einer Infekti- Vielzahl von Faktoren ab. So interessieren im Einzel-
on. Das Krankenhauspersonal kann in der Regel nur fall z. B. das Reduktionspotenzial, die Evidenzlage
dann als Infektionsquelle fungieren, wenn es selbst und die Praktikabilität einer Maßnahme.
erkrankt (z. B. chirurgisch Tätiger mit Panaritium,
Krankenschwester mit Streptokokken-Angina, Perso- In diesem Zusammenhang wird auch der Einsatz von
nal mit offener Lungentuberkulose) oder ausschei- antimikrobiellen Oberflächen im Krankenhaus disku-
dender Träger von Krankheitserregern ist (z. B. tiert. Oberflächen in medizinischen Einrichtungen
S. aureus im Nasenvestibulum von Arzt oder Pflege- können als Reservoir für Erreger dienen und bergen
personal). damit grundsätzlich eine Infektionsgefahr. Im Ver-
gleich zu belebten Reservoiren gibt es wenige evi-
Unbelebte Infektionsquellen können kontaminierte denzbasierte Untersuchungen zur Rolle der Oberflä-
Arzneimittel oder Pflegeutensilien sein, die im und chen bei der Entstehung von nosokomialen Infektio-
am Patienten angewandt werden, wie Infusionen und nen. Die sorgfältige Flächendesinfektion ist Teil der
Standardhygiene und Ausbrüche mit z. B. VRE konn-
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 9
ten unter Einbeziehung von umfangreichen Reini- von antimikrobiellen Oberflächen, z. B. in Kranken-
gungs- und Flächendesinfektionsmaßnahmen sowie häusern oder Arztpraxen. Hierbei wird eine definierte
weiteren Maßnahmen eingedämmt werden. Anzahl an Erregern in einem kleinen Volumen aufge-
nommen und auf den gewünschten Oberflächen ver-
Ziel ist es, den Kontaminationsgrad der Umgebung zu strichen. Die überschüssige Flüssigkeit verdunstet
reduzieren, indem das Anhaften von Mikroben an innerhalb weniger Sekunden, sodass die Erreger im
Oberflächen unterbunden bzw. Mikroben bei direktem direkten Kontakt mit der Oberfläche stehen. Mehrere,
Kontakt mit der Oberfläche abgetötet werden. Die auf dem Markt befindliche antimikrobielle Flächen
infrage kommenden antimikrobiellen Stoffe können wurden mittels Trockenmethode überprüft und zeig-
Antibiotika, Antiseptika, Biozide oder Schwermetalle ten entweder keine oder nur marginale Aktivität bzw.
mit antimikrobieller Wirkung wie Silber und Kupfer waren diese Effekte nach durchgeführter Flächendes-
sein. Jede dieser Stoffgruppen hat bestimmte Vorteile, infektion nicht reproduzierbar.
mit denen aber auch spezifische Nachteile verbunden
sind. Wenngleich diese Produkte eine gewisse In-vi- Die Effektivität dieser Oberflächen unter realen Be-
tro-Wirksamkeit aufzeigen, fehlt für den medizini- dingungen sowie das Ausmaß von deren Effizienz im
schen Einsatz die Evidenz der verbesserten Patienten- Bereich der Infektionsprävention muss anhand von
sicherheit. Des Weiteren fehlen derzeit technische klinischen Studien untersucht werden. Vorstellbar ist,
Spezifika, hygienische Anforderungen, klinische dass antimikrobielle Oberflächen zur Reduktion von
Richtlinien sowie die Regelung der geeigneten Prüf- Reinigungs- und Flächendesinfektionsmaßnahmen
verfahren für den Einsatz antimikrobieller Oberflä- führen könnten bzw. die mikrobielle Kontamination
chen in der Praxis. Bei der Wirkungsbeurteilung an- diverser Oberflächen reduzieren. Dass es durch den
timikrobiell ausgerüsteter Oberflächen muss die vor- Einsatz von antimikrobiellen Oberflächen zu einer
gesehene Praxisanwendung berücksichtigt werden. starken Reduktion nosokomialer Infektionen kommt,
Der Stellenwert der antimikrobiellen Ausstattung von ist schwer vorstellbar, da die Mehrheit der Infektionen
Objekten in der Infektionsprävention ist unklar und endogenen Ursprungs ist. Eine keimarme Umgebung
bisher nicht systematisch untersucht. könnte eine gewisse Eindämmung von exogen be-
dingten Infektionen mit sich bringen, dies muss aber
Aktuelle Studien zeigen, dass metallische Kupferflä- durch Studien überprüft werden. Welche Bereiche im
chen in der Lage sind, dort aufgebrachte Keime um Krankenhaus von solchen Oberflächen profitieren
mehrere Dezimalstufen zu reduzieren. Eine Studie an könnten, ist bislang unklar und muss untersucht wer-
Intensivstationen dreier US-amerikanischer Kranken- den. [1 bis 14]
häuser zeigte sogar, dass der Einsatz von Kupferflä-
chen die Infektionsraten mit MRSA oder VRE verrin-
gern konnte – im Vergleich zu den Räumlichkeiten 2.2 Vorgehen bei nosokomialen
ohne Kupferflächen.
Infektionen
Um die antimikrobielle Wirkung gegen Mikroorga-
nismen im Labor zu prüfen, werden derzeit zwei ver- Die Bekämpfung der nosokomialen Infektion ist im
schiedene Methoden angewandt, die feuchte und die Krankenhausbereich bedeutsam, da diese sehr zeit-
trockene Testmethode. Bei der feuchten Methode und personalaufwendig ist. Zwingend notwendig ist
wird eine definierte Bakteriensuspension auf die zu dafür gut geschultes Personal, das sich exakt an die
untersuchende Oberfläche getropft und inkubiert. Bei Vorgaben des Hygieneplans des entsprechenden Hau-
dieser Testmethode sind nicht alle Erreger in direktem ses hält. Hygienepläne sind Vorgaben der jeweiligen
Kontakt mit der zu untersuchenden Fläche, sondern Gesundheitseinrichtung, in denen standardisierte
diffundieren frei im Volumen des Mediums. Dies gilt Verfahren zur Infektionsbekämpfung, Zuständigkeiten
auch für den japanischen Industriestandard JIS Z 2801, und Verantwortlichkeiten geregelt sind. Damit soll
bei dem die Proben nass auf die Testoberfläche auf- sichergestellt werden, dass neueste Erkenntnisse der
gebracht, mit einer sterilen Folie für 24 Stunden ab- Hygieneforschung sicher von allen beteiligten Perso-
gedeckt und bei 35°C inkubiert werden. Diese Tes- nen angewandt werden können.
tung spiegelt jedoch kaum die Situation einer typi-
Der Ärztliche Direktor eines Krankenhauses ist in der
schen Kontamination von häufig berührten Kontakt-
Regel für die Hygiene der Einrichtung verantwortlich,
oberflächen im Krankenhaus wider. Die allermeisten
unterstützt wird er vom Krankenhaushygieniker und
Produkte werden dennoch mit dieser Untersuchungs-
den Hygienefachkräften. Für die Erfassung und Be-
methode getestet, für die diesbezüglich keinerlei Pra-
kämpfung nosokomialer Infektionen stehen hygiene-
xisrelevanz vorhanden ist.
beauftragte Ärzte zur Verfügung. Diese Fachärzte
Bei der trockenen Methode, auch als „contact-killing“ sind nach einer einwöchigen Schulung für einen um-
bezeichnet, handelt es sich um die Simulation von grenzten Arbeitsbereich zuständig. Die Hygienebeauf-
realen Bedingungen möglicher Anwendungsgebiete tragten in der Pflege rekrutierten sich meistens aus
dem Bereich der Stations- und Bereichsleitungen. Sie
www.vdi.de10 VDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie
absolvieren einen zweitägigen Kurs und sind für die Die hygienischen pflegerischen Maßnahmen zur
Umsetzung der Hygienemaßnahmen in ihrem Bereich Vermeidung nosokomialer Infektionen sollen Be-
verantwortlich. standteil verbindlicher Pflegestandards sein. Diese
sind ständig auf Aktualität zu überprüfen und zu revi-
Um nosokomiale Infektionen gering zu halten, ist ein dieren.
standardisiertes und zeitlich vorgegebenes Reini-
gungs- und Desinfektionsverfahren notwendig. Dieses Regelmäßige Begehungen durch das Hygieneperso-
wird als regelmäßige Unterhaltsreinigung von ge- nal, die Beobachtungen und Durchführungen von
schultem Eigen- und/oder Fremdpersonal durchge- Hygienemaßnahmen durch die hygienebeauftragen
führt. Es bezieht sich auf die patientennahe Flächen- Ärzte und die Hygienebeauftragten in der Pflege sol-
reinigung, die Reinigung von mit Blut, Sekret, Fäkali- len die Anwendung des Hygieneplans sichern. Ab-
en etc. verschmutzten Oberflächen sowie die Reini- weichungen sind abzustellen, eventuell Nachschulun-
gung und Desinfektion von Geräten. Raumlufttechni- gen zu veranlassen und bei Ausbruch von Infektionen
sche Anlagen müssen regelmäßig gewartet, die Filter Meldungen an den Direktor der Fachklinik und den
ausgetauscht und bei Bedarf desinfiziert werden. Das Krankenhaushygieniker zu geben. Diese entscheiden
Wasser und die diversen Wasserentnahmestellen dann über weitere Maßnahmen und Information des
werden auf Keimfreiheit geprüft. Bei Ausbrüchen von Ärztlichen Direktors und des Vorstands.
spezifischen Erregern sind in Absprache mit dem
Krankenhaushygieniker spezielle Desinfektionsmittel Es werden sicherlich auch in Zukunft nosokomiale
und Maßnahmen notwendig. Gemäß Infektionshand- Infektionen im Krankenhaus nicht zu vermeiden sein,
buch kann eine Schlussdesinfektion notwendig sein. insbesondere wenn sich die Vergabe von Antibiotika
Diese wird mit oder ohne Desinfektor als Scheuer- an Menschen und Tieren nicht grundlegend ändert.
Wisch-Desinfektion durchgeführt. Das erfolgt durch Personelle Engpässe und Zeitdruck in den Gesund-
Nass-Wischen mit Druck, eventuell Sprühdesinfekti- heitsberufen, in Notaufnahmen, die in erster Linie der
on bei schwer zugänglichen Flächen und nachwi- schnellen Versorgung zum Teil lebensbedrohlicher
schen. Mit Blut, Sekret usw. kontaminierte Flächen Erkrankungen und Verletzungen dienen, sowie durch
werden mit einem Einmaltuch, das mit Desinfekti- wenig geschultes Reinigungspersonal werden immer
onsmittel getränkt ist, gesäubert und anschließend wieder Schwachstellen sein. Dazu kommen Kreuzin-
sauber gewischt. fektionen durch Aufnahmen und Verlegungen von
Patienten von und in die diversen Gesundheitseinrich-
Patienten mit Infektionen und auch insbesondere tungen, in Heime und das häusliche Umfeld.
Patienten mit MRE werden in Isolationszimmern
unter Anlegen von Schutzkleidung versorgt. Nach Daher wäre es sinnvoll, antimikrobielle Oberflächen
Verlegung oder Entlassung des Patienten wird in der zu schaffen, die durch eine keimarme Umgebung
Regel eine Scheuer-Wisch-Desinfektion durchgeführt. Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen verrin-
Diese Art der Versorgung ist teuer, da zeit- und mate- gern, dadurch die personellen Ressourcen schonen,
rialaufwändig. mittelfristig Ausgaben sparen und vor allen Dingen
den Patienten eine erhöhte Sicherheit vor Kranken-
hausinfektionen geben.
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 11
3 Nanotechnologien und Einsatzgebiete
3.1 Einsatzgebiete
Nanotechnologien zur Keimreduzierung im klinischen
Umfeld werden im Wesentlichen zur antimikrobiellen
Funktionalisierung von Oberflächen eingesetzt. Dabei
werden die entsprechenden Nanotechnologien so ein-
gesetzt, dass die Oberflächen möglichst dauerhaft, im
Idealfall über die gesamte Produktlebensdauer hin-
weg, antimikrobiell oder zumindest bakterienabwei-
send ausgerüstet werden. Grundsätzlich könnten Nano- Bild 1. Dauerhafte Keimreduktion zwischen den
technologien auch in Verbrauchsmaterialien, z. B. in Reinigungsschritten
der Wasseraufbereitung, in Reinigungsmitteln und Des-
infektionsmitteln eingesetzt werden. Da es hier bereits Nanotechnologiebasierte Oberflächenfunktionalisie-
etablierte Lösungen gibt und der zulassungstechnische rungen sind grundsätzlich an allen hygienerelevanten
Aufwand in keinem Verhältnis zum späteren wirt- Oberflächen im klinischen und medizinischen Bereich
schaftlichen Ertrag steht, gibt es aber kaum F&E- denkbar. Entsprechend können die Einsatzgebiete
Projekte, die sich mit diesen Anwendungsgebieten folgendermaßen gegliedert werden:
befassen. Wir beziehen uns deshalb in diesem Status-
report im Wesentlichen auf Nanotechnologien, die für 1 Einsatzgebiete im Körper des Patienten wie funk-
eine dauerhafte oder langanhaltende Funktionalisie- tionalisierte Implantate
rung von Oberflächen eingesetzt werden.
2 Einsatzgebiete am Patienten wie antimikrobielle
Bei den eingesetzten Materialtechnologien handelt es Wundauflagen
sich ganz im Gegensatz zu Reinigungs- und Desinfek-
tionsmitteln und im Gegensatz zu Medikamenten um 3 Einsatzgebiete im Patientenumfeld wie antimikro-
keine Verbrauchschemie, sondern um materialeffizi- biell funktionalisierte Oberflächen im Patienten-
ente, dauerhafte und damit nachhaltige Funktionalisie- zimmer
rungen von Oberflächen. Da entsprechend funktiona-
Die unter 1 und 2 genannten Einsatzgebiete dienen in
lisierte Oberflächen Erreger nur dann abtöten, wenn
der Regel der Therapie des Patienten. Entsprechend
sie mit der Oberfläche in Berührung kommen (also
fallen diese Einsatzgebiete unter die Medizinproduk-
keine Schmutzreste durchdringen), können antimikro-
tezulassung. Einsatzgebiete, die nicht direkt der The-
bielle Oberflächen herkömmliche Reinigungs- und
rapie des Patienten dienen, aber die dazu beitragen,
Desinfektionsmaßnahmen nicht ersetzen, wohl aber
dass sich der Patient während eines Krankenhausauf-
wirksam ergänzen. Während Reinigungs- und Desin-
enthaltes nicht exogen infiziert, fallen in Europa hin-
fektionsmaßnahmen zeitpunktbezogene Hygienestra-
gegen unter die europäische Biozidzulassung. Genau-
tegien darstellen, die nach festgelegten Vorschriften
eres hierzu wird im Abschnitt 6 beschrieben.
ablaufen, in festgelegten Intervallen wiederholt wer-
den müssen und deshalb entsprechende Anforderun- Die Wirkweisen der Nanotechnologien können sehr
gen an die Professionalität des eingesetzten Personals unterschiedlich sein. Während metallische Nanomate-
stellen, stellen antimikrobiell funktionalisierte Ober- rialien und Metalloxide durch die Bildung von Ionen
flächen eine Zeitraumhygienestrategie dar, die zusätz- vorwiegend auf den Stoffwechsel von Bakterien ein-
lich auch zwischen zwei Reinigungsmaßnahmen und wirken, verhindern nanostrukturierte Oberflächen die
unabhängig von der Professionalität des eingesetzten Anhaftung von Bakterien. Fotoaktive Nanomateria-
Reinigungspersonals wirken (siehe Bild 1). lien hingegen erzeugen in der Regel bei UV-Lichtein-
fall Sauerstoffradikale, die die Keime zerstören.
Außerdem erhalten Oberflächenbereiche, die für Rei-
nigungs- und Desinfektionsmaßnahmen nicht oder Die Wirkweise der Nanoteilchen beruht auf ihrem
schlecht zugänglich sind (Ritzen, Ecken, Unterseiten extrem großen Oberflächen-Masse-Verhältnis. Bei
etc.) einen zusätzlichen Hygieneschutz, der z. B. die Metallen werden z. B. nur an der Oberfläche durch
Ansiedlung von Biofilmen verhindert kann. den Kontakt mit Sauerstoff und Feuchtigkeit Ionen
gebildet. Diese Ionen sind es, die den Stoffwechsel
der Keime stören. Je kleiner Partikel sind, desto grö-
ßer wird die Oberfläche pro Masseeinheit und umso
mehr Ionen werden gebildet. Nanosilberpartikel bil-
www.vdi.de12 VDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie
den deshalb mehr Ionen als alle Teilchen die größer sogar dazu führen, dass weniger Nanopartikel in die
sind. Dies bedeutet allerdings nicht, dass man die Umwelt gelangen. [15]
Wirkung zwangsläufig mit Nanoteilchen erhöhen will,
vielmehr soll in den meisten Fällen der Materialein-
satz drastisch reduziert werden und so die Verarbeit- 3.2 Wirkmechanismen gegen Bakterien
barkeit vereinfacht bzw. oft erst ermöglicht werden.
Antibakterielle Wirkung ist verknüpft mit Verbindun-
Eine vollflächige Silberbeschichtung hat beispielswei- gen, die die Bakterien lokal abtöten oder deren
se auch eine sehr gute antimikrobielle Wirkung. Wachstum reduzieren, ohne dabei die gesunden Zel-
Durch den Einsatz von Nanosilber benötigt man aller- len in der Umgebung zu schädigen. Die am häufigsten
dings nur einen Bruchteil des wertvollen Edelmetalls eingesetzten Medikamente mit bakterizider Wirkung
(ca. 200–500 ppm). Außerdem kann Nanomaterial sind chemisch modifizierte Naturstoffprodukte wie
aufgrund der Größe und der geringen Einarbeitungs- die ß-Lactame (u. a. Penicilline), Cephalosporine,
menge in nahezu jede Matrix eingearbeitet werden, Carbapeneme oder die Aminoglycoside. Zu den rein
ohne deren sonstigen Eigenschaften zu beeinflussen. synthetischen Antibiotika gehören die Sulfonamide.
Der Grund für den Einsatz von Nanomaterialien zur Aufgrund ihrer breiten und teils ungezielten Verwen-
Oberflächenfunktionalisierung ist der genau dosierte, dung haben Bakterien gegen diese Medikamente
sparsame Umgang mit wertvollen Rohstoffen und die Resistenzen entwickelt, welche die moderne Medizin
Möglichkeit, die Materialien in nahezu jede Matrix vor große Herausforderungen stellt (siehe Bild 2).
einfach (z. B. über Extrusionsprozesse) einzuarbeiten.
Die Bakterien wehren sich gegen diese Antibiotika
Die Zulassungsverfahren der gesetzgebenden Stellen durch folgende Maßnahmen (siehe Bild 3):
gewährleisten, dass bei der angewandten mikrobiell
wirksamen Dosierung ein Risiko für Menschen wei- reduzierte Aufnahme (Transporter)
testgehend ausgeschlossen wird.
gesteigerten Efflux (Transporter)
An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass
z. B. Silber sehr reaktiv ist und sich Nanopartikel Produktion inaktivierender Proteine inner- und
sowohl auflösen als auch durch die Reduktion von außerhalb der Zelle
Ionen neu bilden können. Wie die EMPA in einem
Forschungsprojekt zu silberbehandelten Textilien verbesserte Reparaturmechanismen
gezeigt hat, wurden nicht etwa im Waschwasser von
Textilien, die mit Nanosilber ausgerüstet wurden, die Hier bieten Nanopartikel einige Vorteile. Die wich-
meisten Silbernanopartikel gefunden, sondern im tigste Eigenschaft der Nanopartikel liegt in ihrem
Waschwasser von Textilien, die mit konventionellen großen Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. Damit
Silberformen ausgerüstet worden sind. Der Einsatz haben diese Partikel besondere physiko-chemische,
von Nanomaterialien heißt deshalb nicht zwangsläu- Eigenschaften. Nanopartikel können z. B. aufgrund
fig, dass mehr Nanopartikel in die Umwelt gelangen, ihrer elektrostatischen Ladung an die Außenmembran
sondern es kann, wie der EMPA-Versuch gezeigt hat, von Bakterien binden und deren Integrität zerstören.
Bild 2. Übersicht zum Abwehrverhalten von Bakterien
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 13
Bild 3. Mechanismen zur Zelltoxizität von Nanopartikeln gegenüber Bakterien
Die Art der Toxizität hängt hierbei stark von der che- organische Nanomaterialien, die antimikrobielle Ef-
mischen Natur des Nanopartikels (Art des Metalls, fekte zeigen. Da sich unseres Wissens nach keines
Elektronegativität, Ionen-/Atomradius, Hydrophilie, dieser Materialien noch im EU-Biozid-Zulassungs-
Oxidationszahl, Polarität, effektive Oberflächenla- verfahren für Altwirkstoffe befindet und eine Neupro-
dung = Zeta-Potenzial), der Art des Zellwandaufbaus duktezulassung im Rahmen der EU-Biozidzulassung
(grampositv: mehrschichtig; gramnegativ: einschich- mit einem immensen zeitlichen und finanziellen Auf-
tig) sowie dem pH-Wert (Einfluss aus Agglomeration wand verbunden wäre, ist nicht davon auszugehen,
der Nanopartikel), der Luftfeuchtigkeit und dem Sau- dass Unternehmen in Europa in der Zukunft in weitere
erstoffgehalt der Umgebung ab. Produktinnovationen in diesem Bereich investieren
werden. Selbst wenn Unternehmen dieses entwick-
Um die Toxizität von Nanopartikeln zu studieren, gibt lungstechnische und zulassungstechnische Risiko
es derzeit zwei Ansätze. Bei dem ersten werden Na- eingehen würden, wäre mit einer Zulassungsdauer
nopartikel mit den zu untersuchenden Zellen oder nicht unter fünf Jahren zu rechnen. Wahrscheinlich
Erregern in einem flüssigen Medium inkubiert und sind eher zehn Jahre und mehr. Am Ende bliebe im-
danach die Vitalität der biologischen Komponenten mer das Risiko, dass das Material nicht zugelassen
bestimmt. Ein Nachteil dieser Methode ist die meist würde. Weitere Nanomaterialinnovationen in diesem
unverhältnismäßig hohe Konzentration an Nanoparti- Bereich sind deshalb vor dem aktuellen Zulassungs-
keln und deren Tendenz zu agglomerieren. Wesent- hintergrund zumindest in Deutschland und Europa
lich näher an der Realität ist das Auftragen der Nano- nicht zu erwarten.
partikel mittels Elektrosprayverfahren auf die zu un-
tersuchende Oberfläche [23] und die Testung der Ein interessantes Forschungsgebiet im Bereich der
keimreduzierenden Beschichtung mittels JIS-Test Nanotechnologien könnten allerdings nanostrukturier-
oder trockener Anschmutzung. [85; 86; 96] te Oberflächen darstellen. Da derartige Technologien
nicht automatisch unter das EU-Biozidzulassungsver-
fahren und die Medizinproduktezulassung fallen,
3.3 Nanotechnologien für den Einsatz entfällt gegebenenfalls eine wesentliche Hürde hin zur
im klinischen Umfeld Markteinführung. Dieser Nanotechnologiegruppe
wollen wir deshalb ein eigenes Kapitel widmen.
Wie bereits erwähnt werden Nanomaterialien und
Nanotechnologien, die der Keimreduzierung dienen,
im klinischen Umfeld vor allem zur Oberflächenfunk- 3.4 Nanomaterialtechnologien
tionalisierung eingesetzt. In den letzten Jahren haben
sich dabei zwei Nanomaterialgruppen herauskristalli- Die einzelnen Materialgruppen werden in der folgen-
siert, die für eine hygienische Oberflächenfunktionali- den Abschnitten näher beschrieben.
sierung in besonderem Maße infrage kommen. Dies
sind silberbasierte Nanomaterialien und fotoaktive
Nanomaterialien (im Wesentlichen vertreten durch
TiO2).
Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe von
metallischen und metalloxidbasierten Nanomateria-
lien, die grundsätzlich für eine antimikrobielle Ober-
flächenausrüstung infrage kommen. Ebenfalls gibt es
www.vdi.de14 VDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie
3.4.1 Metallbasierte Nanomaterialien auf Arbeitsflächen, in medizinischen Geräten, in Fil-
mit Fokus auf silberbasierte tern (z. B. für Staubsauger, Raumluftbefeuchter, Kli-
maanlagen), Folien, Rohren, Klinikmöbeln, Fußbö-
Nanomaterialien
den, in der Rasenpflege, zur Wasseraufbereitung, in
Wand- und Bodenbelägen (antibakterielle Tapeten,
Nanosilber Farben).
Nanosilber bezeichnet Partikel aus metallischem Sil- Der Vorteil von Nanosilber ist die geringe Teilchen-
ber, die zumindest in einer Dimension 1 nm bis größe; sie ermöglicht dünne Schichten und durch die
100 nm messen. Nanosilber-Partikel können sich in Nanoskaligkeit bleibt die Transparenz erhalten. Die
der Natur spontan bilden und abbauen oder gezielt Risikodiskussion der letzten Jahre führte zu umfang-
hergestellt werden. Durch den Nanomaßstab ergibt reichen Studienmaterialien, die in Summe das geringe
sich eine Oberflächenvergrößerung pro Volumenein- Risikopotenzial von Nanosilber bestätigen.
heit und damit einhergehend eine erhöhte chemische,
biologische und katalytische Aktivität. Aufgrund der Der Nachteil ist die Gelbfärbung durch den Plasmonre-
größeren Oberfläche können mehr reaktive Silberio- sonanzeffekt des Nanosilbers. Für den Einsatz im Me-
nen freigesetzt werden. Das günstige Oberflächen- dizinbereich ist die viruzide und sporozide Wirkung
Volumen-Verhältnis führt zu einer effektiveren Wir- deutlich geringer als bei starken Desinfektionsmitteln,
kung bei gleichzeitig geringerem Rohstoffeinsatz. deren Substitution aber nicht zur Diskussion steht.
Die Zahl der Hersteller von Nanosilber hat sich in den Der Wirkstoff Nanosilber ist nach Biozid-Verordnung
letzten Jahren verringert bzw. scheint eine Marktbe- (BPR) (EU) Nr. 528/2012 verkehrsfähig. Durch einen
reinigung im Vorfeld der Biozid-Zulassung und als Eintrag in der ECHA – List of compliant notifications
Folge der Nano-Verunsicherung stattgefunden zu ha- vom 07.11.2016 unter der CA-Substance-Nr. 7440-
ben. In Europa gibt es zwei Firmen, die HeiQ Materi- 22-4 „Elementares Silber (Nanoform)“ ist dies von
als AG in Schlieren (Schweiz) http://heiq.com/techno- EU-Seite offiziell bestätigt. Das für die Bewertung
logies/heiq-fresh-tech und die RAS AG, Regensburg notwendige Wirkstoff-Dossier wurde fristgerecht
http://ras-ag.com/agpure. Namhafte Vertreter in den eingereicht und ist seit September 2015 in der Bewer-
USA sind die NanoHorizons Inc., Bellefonte (USA) tung. Diese wird voraussichtlich nach 2021 abge-
http://www.nanohorizons.com/index-3.html und die schlossen sein. Die Wirkstoff-Zulassung wurde für
NUCRYST Pharmaceuticals Corp, East Princeton die Produktarten (PA) 2, 4 und 9 beantragt.
(USA) http://www.nucryst.com/acticoat_dres-
sings.htm. Die Vermarktung nanosilberhaltiger Bioizidprodukte
läuft dementsprechend ordnungsgemäß.
Die antimikrobielle Wirkung des Silbers beruht auf
den Silberionen Ag+, die an der Oberfläche von Sil-
bernanopartikeln besonders effektiv gebildet werden. Nanokupfer, Nanogold, Nanoeisen,
Grundsätzlich werden drei Wirkmechanismen ange- andere Metalle/Oxide
nommen:
Von den metallischen Nanomaterialien ist Nanosilber
Interaktionen der Silberionen mit der Zellmem-
aktuell das mit weitem Abstand bedeutendste Materi-
bran führen zu einer Verringerung in der Anhef-
al, das für eine antimikrobielle Oberflächenfunktiona-
tung der Mikroorganismen an ihren Untergrund
lisierung infrage kommt. Neben Nanosilber gibt es
und dadurch zu schlechten Wachstumsbedingun-
allerdings noch eine ganze Reihe von weiteren metal-
gen.
lischen Nanomaterialien, die antimikrobielle Eigen-
Silberionen blockieren Schritte im Stoffwechsel schaften zeigen. Diese Materialien werden im Fol-
und verringern dadurch die Vitalität der Mikroor- genden überblickartig vorgestellt.
ganismen.
Nanokupfer
Silberionen verursachen Schädigungen im Zell-
inneren durch eine unumkehrbare Interaktion mit Nanokupfer wirkt auf ähnliche Weise wie Nanosilber,
schwefel- und phosphathaltigen Aminosäuren allerdings weniger effizient, antimikrobiell/fungizid.
und Proteinen. Kupferionen und daraus resultierende reaktive Sauer-
stoffspezies (ROS) reagieren insbesondere mit Schwe-
Nanosilber wird, vor allem in den USA und im asiati-
fel-, Amino- und Carboxylgruppen von Proteinen. Dies
schen Raum, bereits in einer Vielzahl von Produkten
führt zur Inaktivierung essenzieller mikrobieller Protei-
eingesetzt. Die Anwendungsbereiche sind sehr groß.
ne und damit zur Verhinderung mikrobiellen Wachs-
Möglich ist der Einsatz u. a. in Kosmetika, Hygienear-
tums [16]. Kupfer oxidiert sehr schnell und ist daher in
tikeln und Lebensmittelkontaktmaterialien, Textilien,
www.vdi.deVDI-Statusreport – Keimreduzierung im klinischen Umfeld durch Nanotechnologie 15
der Nanoform in der Regel nur als Komposit einsetz- eingearbeitet, so weist dieses Antihafteigenschaften
bar. Kupfer-Nanopartikel werden in verschiedensten und eine signifikante Reduktion von gramnegativen
Bereichen eingesetzt, beispielweise als Katalysatoren, und -positiven Bakterien auf der Oberfläche auf.
in Sensoren, elektrischen Anwendungen oder als
Schmiermittel-Additive. In der medizinischen For-
schung und Anwendung finden sie in der Bildgebung 3.4.2 Metalloxid-Nanopartikel
(MRI, PET) und Theranostik Verwendung [17]. Die
antimikrobielle Wirksamkeit von konventionellem Metalloxide der Haupt- und Nebengruppen haben
Kupfer (nicht in Nanoform) zur Oberflächenfunktio- nicht nur eine sehr weit verbreitete katalytische An-
nalisierung wurde im klinischen Umfeld gezeigt [18]. wendung in der Industrie, sondern sie spielen auch
eine essenzielle Rolle bei Stoffwechselprozessen in
lebenden Organsimen. Die mit diesen Enzymen
Nanogold
wechselwirkenden organischen Substanzen werden
Gold-Nanopartikel können über eine Reihe von Ver- hierbei zunächst physikalisch adsorbiert und anschlie-
fahren erhalten werden, etwa über die nasschemische ßend entsprechend ihrer elektronischen Natur in Re-
Reduktion von Tetrachlorgoldsäure (HAuCl4) oder doxprozessen chemisch reduziert oder oxidiert.
über physikalische und mechanische Methoden [19].
In den vergangenen 15 Jahren konnte gezeigt werden,
Nanogold ist chemisch relativ inert, gut zu beschich-
dass Nano-Metalloxide eine starke antimikrobielle
ten, thermisch sehr leitfähig und hat charakteristische
Wirkung gegen grampositive und -negative Bakterien
optische Eigenschaften. Dadurch ergibt sich eine
haben [21]. Durch die Art der Darstellung, die Oberflä-
Vielzahl möglicher Einsatzgebiete. Au-Nanopartikel
chenmodifikation, die Partikelgröße und die Art der
reagieren – wie Silberpartikel – mit schwefel- oder
kristallinen Form von anorganischen Nanopartikeln
phosphorhaltigen Proteinen, welche infolgedessen
eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Darstellung einer
inaktiviert werden. Es entstehen freie Radikale, die
neuen Generation antibakterieller Materialien [22].
Enzyme der Atmungsketten sowie auch die DNA
schädigen und so zum Zelltod führen. [20] Nanogold Die Toxizität ist abhängig von der Exposition und der
ermöglicht trotz des teuren Ausgangsmaterials durch nanopartikulären Größe von Aluminium, Kupfer,
einen effizienten Materialeinsatz eine Reihe innovati- Gold, Magnesium, Silber, Titan und Zink. Metall-
ver Anwendungen. Die hohe Biokompatibilität von oxide wie Zinkoxid (ZnO), Titandioxid (TiO2) und
Nanogold erlaubt die Anwendung in der medizini- Magnesiumoxid (MgO) sind chemisch stabil und
schen Diagnostik und der Bildgebung. Auch für die gelten als gesundheitlich unbedenklich für den Men-
gezielte Abgabe von Pharmazeutika im Körper sowie schen.
in der Tumortherapie werden Nanogoldpartikel einge-
setzt. Verschiedene biomedizinische Testverfahren
(u. a. Schwangerschaftstests) sind kommerziell erhält-
Aluminiumoxid
lich. Nanogold ist außerdem in Kosmetikartikeln
enthalten.
Aluminiumoxid-Nanopartikel (Nano-Al2O3) haben
Nanogold dient als Katalysator und in der Informa- eine breite Anwendung in der Industrie und in kosme-
tions- und Kommunikationstechnologie zur Herstel- tischen Produkten. Nach bisherigen Ergebnissen be-
lung leitfähiger Tinten. Obwohl Nanogold eine biozi- sitzt Nano-Al2O eine moderate Wirksamkeit gegen
de Wirkung hat, wird es als Flächenbiozid aufgrund das Wachstum von E. coli [24].
des hohen Preises in absehbarer Zukunft keine Rolle
spielen Eine Produktübersicht ist unter folgendem
Link zu finden: http://www.nanotechproject.org/cpi/ Kupferoxid
browse/nanomaterials/gold.
Kupferoxid findet eine weite Verarbeitung als Oxida-
tionsprodukt auf Kupferblechen und -bauteilen oder
Nanoeisen als Additiv in Polymeren. Antimikrobielle Eigen-
schaften von Nanokupferoxid (Nano-CuO) werden
Eisen(0) kann in wässriger Lösung Bakterien inakti- berichtet gegen E. coli, B. subtilis, S. aureus/MRSA,
vieren, jedoch ist die antibakterielle Wirkung auf- und weitere pathogene Erreger [25; 26; 31]. Es wird
grund der schnellen oxidativen Korrosion von Fe(0) angenommen, dass die starke antibakterielle Wirkung
stark eingeschränkt und daher nur begrenzt anwend- von Kupfer und Nanokupfer mit der Bildung einer
bar. Stattdessen werden Oxide oder Komposite getes- Oxidschicht verbunden ist und die toxische Wirkung
tet: Als Bulkmaterial gesundheitlich völlig inert ent- auf der Freisetzung von Kupferionen beruht.
wickelt Eisenoxid (Fe3O4) im Nanomaßstab interes-
sante antimikrobielle Eigenschaften. Wird Nano-
eisenoxid in die Oberfläche eines Trägermaterials
www.vdi.deSie können auch lesen