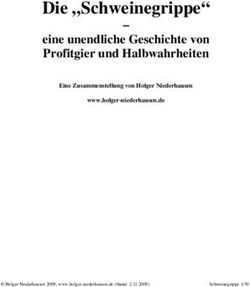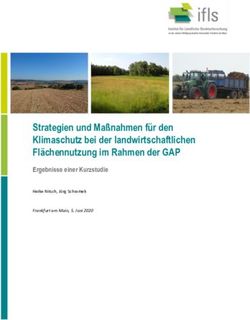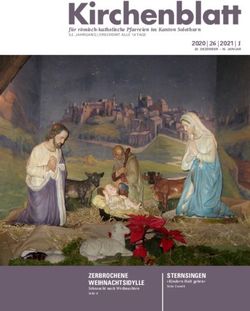Klimaziel 2020 verfehlt: Zeit für eine Neuausrichtung der Klimapolitik? - ifo Institut
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ZUR DISKUSSION GESTELLT
Klimaziel 2020 verfehlt: Zeit für eine
Neuausrichtung der Klimapolitik?
Neue Berechnungen des Bundesumweltministeriums zeigen, dass Deutschland wahrschein-
lich die angestrebten Klimaziele für das Jahr 2020 deutlich verfehlen wird. Wie sollte die Kli-
mapolitik neugestaltet werden, und welche Anreizsysteme sind für eine effektive und ökono-
misch sinnvolle Klimapolitik notwendig?
Claudia Kemfert* onen in Deutschland in den letzten Jahren weder bei
der Stromerzeugung noch in der Gesamtbilanz ausrei-
Schnelles Umsteuern in chend gesunken, um die Klimaschutzziele einzuhalten.
Energiewirtschaft und Der Hauptgrund hierfür sind die Emissionen durch die
konstante Verstromung von Braun- und Steinkohle, die
Verkehrssektor erforderlich seit 1990 auf einem hohen Niveau verläuft. So wurden
die CO2-Einsparungen durch die Stilllegung von älteren
Deutschland verfehlt seine selbst gesteckten Klima- Kraftwerksblöcken zu großen Teilen durch die Emissi-
ziele, bis zum Jahre 2020 40% der Emissionen zu sen- onen von neueren, wenn auch effizienteren Blöcken Claudia Kemfert
ken, wenn keine grundlegende Neuausrichtung der kompensiert (vgl. UBA 2017a).
Klimapolitik erfolgt. Mit dem Klimaabkommen von Die konstante Verstromung von Braun- und Stein-
Paris hat sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, kohle ist vor allem auf den niedrigen CO2-Zertifikats
die globale Erwärmung auf deutlich unter 2°C, mög- preis sowie den Rückgang der globalen Steinkohle-
lichst 1,5°C, zu begrenzen.1 Legt man eine gerechte preise zurückzuführen. Daher liegen die variablen
Verteilung des verbleibenden globalen CO2-Emissi- Kosten von Braun- und Steinkohleanlagen deutlich
onsbudgets zugrunde, müsste Deutschland bis zur unterhalb derer von Gaskraftwerken. Die resultieren-
Mitte des Jahrhunderts nahezu treibhausgasneutral den niedrigen Börsenstrompreise verringern die Wirt-
wirtschaften, um einen angemessenen globalen Bei- schaftlichkeit aller fossilen Kraftwerke. Insbesondere
trag zum Klimaschutz zu leisten. Ein Drittel der der- Gaskraftwerke in Deutschland und anderen Nachbar-
zeitigen Treibhausgasemissionen Deutschlands sind ländern werden dadurch immer seltener eingesetzt
auf die Energiewirtschaft zurückzuführen, davon wer- und aus dem Markt gedrängt.
den wiederum 85% durch die Verstromung von Kohle Deutschland steht vor einer paradoxen Situa-
verursacht (vgl. UBA 2017b). Die klimapolitisch not- tion: Zwar hat es durch die frühzeitige Förderung der
wendige Abkehr von der Verbrennung fossilen Kohlen- erneuerbaren Energien maßgeblich zu deren erfolg-
stoffs impliziert daher mittelfristig (in den nächsten reichen globalen Verbreitung beigetragen. Dennoch
20 Jahren) den Ausstieg aus der CO2-intensiven besteht die Gefahr, dass die eigenen nationalen Klima-
Kohleverstromung und langfristig (in den nächsten schutzziele für 2020 und 2030 nicht eingehalten wer-
30 Jahren) auch den Ausstieg aus den fossilen den. Die Treibhausgasemissionen in Deutschland sind
Energien Erdgas und Erdöl (vgl. Agora Energiewen- seit acht Jahren nicht mehr nennenswert gesunken.
de 2017). Das ist insbesondere auf die nahezu konstant geblie-
Der starke Zuwachs der erneuerbaren Energien bene Verstromung der Kohle zurückzuführen, die mehr
hat in den letzten Jahren die Abschaltung der Atoman- als ein Viertel der nationalen Emissionen verursacht
lagen überkompensiert. Dennoch sind die CO2-Emissi- (vgl. UBA 2017b). Aus diesem Grund muss die Bundes-
regierung nach Auffassung des Sachverständigenra-
* Prof. Dr. Claudia Kemfert ist Mitglied des Sachverständigenrats
für Umweltfragen (SRU) und leitet die Abteilung Energie, Verkehr
tes für Umweltfragen (SRU) zusätzliche Klimaschutz-
und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), maßnahmen beschließen. Ein wichtiger Schritt Rich-
Berlin. Sie ist Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit
an der Hertie School of Governance in Berlin.
tung Zielerreichung wäre hierbei der unverzügliche
1
Der Artikel basiert auf zwei kürzlich veröffentlichten Gutachten Beginn eines Ausstieges aus der Kohleverstromung.
des Sachverständigenrats für Umweltfragen: »Kohleausstieg jetzt
einleiten« (SRU 2017a) und »Umsteuern erforderlich: Klimaschutz im
Die Klimaschutzziele jetzt aufzuweichen, wäre dage-
Verkehrssektor« (SRU 2017b). gen unverantwortlich.
ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018 3ZUR DISKUSSION GESTELLT
KOHLEAUSSTIEG Bundesregierung nicht beim »Ob« eines Kohleaus-
stiegs berät, sondern beim »Wie« entlang des von
Um zügig aus der Kohleverstromung auszusteigen, der Bundesregierung vorab definierten CO2-Emissi-
sind verschiedene Herausforderungen anzugehen: Die onsbudgets. Parallel dazu müssen Strategien erar-
verlässliche Versorgung mit Strom ist zu gewährleis- beitet werden, wie sich die betroffenen Regionen
ten, der Ausstieg für die direkt betroffenen 20 000 bis weiterentwickeln sollen.
30 000 Arbeitsplätze in der Kohleindustrie sowie für
die betroffenen Regionen ist sozialverträglich auszuge- VERKEHRSWENDE
stalten und die Finanzierung der Bergbaufolgekosten
muss abgesichert werden. Der Sachverständigenrat Der Verkehrssektor ist derzeit für etwa ein Fünftel der
für Umweltfragen (SRU) hält alle drei Herausforderun- Treibhausgasemissionen Deutschlands verantwort-
gen für lösbar und stellt in seiner Stellungnahme ent- lich. Während in anderen Sektoren seit 1990 zum Teil
sprechende Maßnahmen dar (vgl. SRU 2017a). Die neue deutliche Emissionsminderungen erzielt wurden, sind
Bundesregierung sollte zudem unmittelbar nach der die Emissionen des Verkehrs im gleichen Zeitraum
Regierungsbildung folgende wichtige Entscheidungen sogar leicht angestiegen. Der größte Teil der Treib-
zur Ausgestaltung eines Kohleausstiegs treffen: hausgasemissionen stammt dabei aus dem Straßen-
verkehr. Verbesserungen der Fahrzeugeffizienz sind
Festlegung eines CO2-Emissionsbudgets für die durch die gleichzeitige Zunahme der Verkehrsleistung,
Kohlewirtschaft der Motorenleistung und des Gewichts der Fahrzeuge
aufgezehrt worden. Spätestens bis zur Mitte des Jahr-
–– Aus wissenschaftlicher Sicht sollten die zukünfti- hunderts sollte auch der Verkehr nahezu vollstän-
gen Emissionen der deutschen Kohlekraftwerke die dig treibhausgasneutral sein. Angesichts eines knap-
Gesamtmenge von 2 000 Mt CO2 nicht überschrei- pen verbleibenden Emissionsbudgets, das noch mit
ten, wenn Deutschland den notwendigen Beitrag den Paris-Zielen vereinbar ist, ist ein unverzügliches
zum in Paris vereinbarten Klimaschutzabkommen und konsequentes Umsteuern erforderlich. Der Kli-
leisten möchte. Die genaue Verteilung der Restmen- maschutzplan 2050 der Bundesregierung hat für den
gen ist mit Verteilungseffekten verbunden, die von Verkehr das ambitionierte Zwischenziel einer Treib-
der Politik mitbedacht werden müssen. Ein Fest- hausgasminderung von 40 bis 42% bis zum Jahr 2030
schreiben des verbleibenden CO2-Emissionsbud- gesetzt.
gets in einem entsprechenden Kohleausstiegsge- Insbesondere der Straßenverkehr hat viele nega-
setz, vergleichbar mit dem Atomkonsens aus dem tive Auswirkungen auf Natur, Umwelt und Gesund-
Jahr 2000, würde Planungssicherheit für Betreiber heit. Mit etwa 38% im Jahr 2015 war er der Hauptemit-
und weitere Betroffene leisten. tent von anthropogenen Stickstoffoxiden (NOx). In den
Städten wird der zulässige Jahresbelastungshöchst-
Wichtig ist ein schrittweises Einleiten eines Kohleaus- wert für Stickstoffdioxid (NO2) vielerorts überschritten.
stiegs. Auch der SRU hält aus Gründen der wirtschaftli- Auch die Feinstaubbelastung wird wesentlich durch
chen Strukturentwicklung und der Versorgungssicher- den Straßenverkehr mitverursacht.
heit einen dreistufigen Kohleausstieg für sinnvoll und Eine innovative und nachhaltige Verkehrspoli-
schlägt in seiner Stellungnahme vor: tik ist nicht nur ein umwelt- und klimapolitisches
Gebot, sondern auch eine zentrale Bedingung für
–– ein schneller Beginn des Ausstiegs mit der kurz- die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
fristigen Stilllegung besonders emissionsintensi- Industrie.
ver Kraftwerke bis 2020,
–– zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit Reform von Steuern und Abgaben
und Abfederung der sozialen Herausforderungen
ein vorübergehender Weiterbetrieb der moder- Das historisch gewachsene System der energiebezo-
neren Kohlekraftwerke bis 2030 mit begrenzter genen Steuern und Abgaben enthält eine Reihe von
Auslastung, Hemmnissen für einen effizienten Klimaschutz im Ver-
–– ein sukzessives Abschalten der letzten Kohlekraft- kehrssektor, gerade auch für eine verstärkte Nutzung
werke im Verlauf der 2030er Jahre unter Einhaltung von erneuerbarem Strom. Der SRU empfiehlt der Bun-
des vorher festgelegten CO2-Emmissionsbudgets. desregierung in seinem Sondergutachten zu Klima-
schutz im Verkehrssektor, ein Reformkonzept zu erar-
Neben der schrittweisen Einleitung eines Kohleaus- beiten, das den Herausforderungen gerecht wird, die
stiegs ist das Einsetzen einer Kohlekommission zur von Klimaschutz, Sektorkopplung und fluktuieren-
parallelen Ausgestaltung des Ausstiegspfades und der der Stromerzeugung ausgehen (SRU 2017b). Die Steu-
Strukturpolitik essentiell. ersätze für die verschiedenen Energieträger im Ver-
kehrsbereich sollten an ihrem jeweiligen spezifischen
–– Die Kommission sollte sich aus Betroffenen aller Treibhausgasgehalt sowie ihrem Energiegehalt ausge-
Bereiche zusammensetzen. Wichtig ist, dass sie die richtet werden. Eine gute Ausgangsbasis hierfür bildet
4 ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018ZUR DISKUSSION GESTELLT
der – letztlich nicht beschlossene – Vorschlag der Euro- vollelektrischen Fahrzeugen verringerten Wertigkeit.
päischen Kommission zur Reform der Energiesteuer- Zudem sollte eine Erhöhung der Quote auf mindes-
richtlinie. Auch der SRU spricht sich für eine verstärkte tens 50% bis 2030 bereits heute festgeschrieben wer-
Ökologisierung des Steuersystems aus. Seit Jahren den, wobei über die exakte Höhe nach einer Zwische-
sinkt der Anteil der umweltbezogenen Steuereinnah- nevaluation spätestens im Jahr 2025 entschieden wer-
men, und die reale Abgabenbelastung von Kraftstoffen den sollte. Dieser deutliche Anstieg der Quote erscheint
nimmt ab. realistisch, da zu erwarten ist, dass sich die Elektromo-
Prioritär sollte das Ende der Dieselprivilegierung bilität nach dem Überwinden einer gewissen Schwelle
eingeleitet werden. Die niedrige Besteuerung von Die- zügig durchsetzen wird.
selkraftstoff ist weder ökologisch gerechtfertigt, noch
berücksichtigt sie die negativen gesundheitlichen Ambitionierte Grenzwerte und fiskalische Anreize
Effekte der Emissionen. Die Dieselprivilegierung hat zur Verbesserung der Fahrzeugeffizienz
dazu beigetragen, dass Dieselfahrzeuge in der Vergan-
genheit immer schwerer und mit immer größerer Moto- Derzeit bilden die europäischen CO2-Flottengrenz
risierung ausgestattet wurden, wodurch der Effizienz- werte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge das zent-
vorteil des Dieselmotors aufgezehrt wurde. Auch die rale Instrument zur Verbesserung der Fahrzeugeffi-
Privilegierung von Erdgas als Kraftstoff im Verkehrs- zienz. Der SRU empfiehlt der Bundesregierung, sich
sektor sollte nicht erneut über 2026 hinaus verlängert für eine rasche Einigung auf anspruchsvolle Zielvor-
werden. gaben für CO2-Flottengrenzwerte für die Jahre 2025
Die höhere Abgabenbelastung von Strom gegen- und 2030 einzusetzen. Um der zunehmenden Diversi-
über fossilen Kraftstoffen hemmt die angestrebte fizierung der Antriebstechnologien gerecht zu werden
Elektrifizierung des Verkehrs. Strom sollte daher als und die Energieeffizienz aller Fahrzeuge weiter zu ver-
Energieträger im Verkehr – zumindest relativ – ent- bessern, sollte die Regulierung strukturell weiterent-
lastet werden. Zudem sollten die Abgaben im Strom- wickelt werden. An die Stelle der CO2-Flottengrenz
bereich dynamisiert werden, damit Nutzerinnen und werte sollten Flottenzielwerte für den durchschnittli-
Nutzer einen stärkeren Anreiz haben, ihren Stromver- chen Endenergieverbrauch treten. Sie sollten zudem
brauch an den Erfordernissen eines auf erneuerba- mit antriebsspezifischen Mindesteffizienzvorgaben –
ren Energien basierenden Energiesystems auszu- insbesondere für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
richten. – kombiniert werden (»duale Effizienzregulierung«).
Generell sollte der Abbau von umweltschäd- Durch die Regulierung des Endenergieverbrauchs
lichen Subventionen ein zentrales Ziel für die neue würden auch für Elektrofahrzeuge Effizienzanreize
Legislaturperiode sein. Allein im Verkehrssektor gesetzt. Zudem würde der Tatsache Rechnung getra-
belaufen sich die umweltschädlichen Subventionen gen, dass jegliche Form von Energieerzeugung mit
auf annähernd 30 Mrd. Euro jährlich. Dabei sind vor Beeinträchtigungen der Umwelt verbunden ist. Durch
allem die Entfernungspauschale sowie die niedrige technologiespezifische Vorgaben kann sichergestellt
pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwa- werden, dass für jede Antriebstechnologie ein Min-
gen zu nennen. destmaß an wirtschaftlichen Effizienzverbesserun-
gen realisiert wird. Die Grenzwerte sollten sich zukünf-
Zulassungsquote für elektrische Antriebe tig am Realverbrauch auf der Straße orientieren und
nicht lediglich Messergebnisse auf dem Prüfstand
Um die notwendige technologische Transformation berücksichtigen. Die herstellerspezifischen Effizi-
zügig einzuleiten, sollte im Segment der Pkw und leich- enzvorgaben sollten außerdem künftig nicht mehr
ten Nutzfahrzeuge eine Quote für elektrische Antriebe gewichtsabhängig sein, um Anreize zur Gewichtsre-
eingeführt und schrittweise erhöht werden. Vorteil duktion zu stärken.
einer Quotenregelung gegenüber anderen Anreizin Für schwere Nutzfahrzeuge des Straßengüter-
strumenten zur Förderung alternativer Antriebe ist, verkehrs existieren auf EU-Ebene, im Unterschied
dass die technologiepolitischen Ziele sicher erreicht zu vielen anderen Fahrzeugmärkten weltweit, bis-
werden. Damit können zum einen Hersteller planungs- her keine CO2-Flottengrenzwerte oder andere Effizi-
sicher in den Markthochlauf dieser Technologien inves- enzvorgaben. Die Bundesregierung sollte die Einfüh-
tieren. Zum anderen wird es wirtschaftlich attrakti- rung ambitionierter europäischer CO2- bzw. Energie-
ver, die benötigte Energieversorgungsinfrastruktur verbrauchsgrenzwerte spätestens bis zum Jahr 2025
aufzubauen. unterstützen. Aufgrund der vergleichsweise schnel-
Der SRU schlägt in seinem Sondergutachten für len Flottenerneuerung schwerer Nutzfahrzeuge lie-
das Jahr 2025 eine verbindliche Quote für den Anteil ßen sich hierdurch die spezifischen CO2-Emissionen
rein elektrischer Fahrzeuge (d.h. batterieelektrische des Straßengüterverkehrs bis 2030 deutlich mindern.
und Brennstoffzellenfahrzeuge) an den Neuwagenzu- Der Regulierungsansatz sollte sich dabei nicht allein
lassungen in Höhe von mindestens 25% vor. Plug-in- auf die Motoreneffizienz fokussieren, weil weitere
Hybrid-Fahrzeuge sollten in dem System ebenfalls Potenziale zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizi-
anrechenbar sein, aber mit einer im Vergleich zu enz im Bereich Aerodynamik, bei der Verringerung des
ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018 5ZUR DISKUSSION GESTELLT
Rollwiderstandes und bei Gewichtseinsparungen ten auf EU-Ebene gemacht werden. Die gegenwärti-
liegen. gen rechtlichen Rahmenbedingungen erschweren Mie-
Als Ergänzung zu ordnungsrechtlichen Vorgaben tern und Gemeinschaftseigentümern den Einbau von
auf europäischer Ebene empfiehlt der SRU eine Stär- Ladestellen für Elektrofahrzeuge an ihrem privaten
kung fiskalischer Effizienzanreize, um die Robustheit Kfz-Stellplatz. Um den Auf- und Ausbau privater Lade-
der Effizienzregulierung zu verbessern und die Flot- punkte zu fördern, sind deshalb, wie durch den Gesetz-
tenerneuerung zu beschleunigen. Es sollte vorüber- geber geplant, Anpassungen im Bau-, Wohneigentums-
gehend ein Bonus-Malus-System eingeführt werden, und Mietrecht notwendig. Zudem sollten auch private
durch das der Kauf besonders energieeffizienter Fahr- Arbeitgeber verpflichtet werden, Ladeinfrastruktur auf
zeuge finanziell unterstützt und der Kauf ineffizienter ihren Firmenparkplätzen bereitzustellen.
Fahrzeuge zusätzlich belastet wird. Zudem sollte die Oberleitungen sind eine technisch umsetzbare
CO2-abhängige Kfz-Besteuerung beibehalten und ihre Option, um im Fernverkehr mit schweren Lkw, der für
Anreizwirkung gestärkt werden. Alternativ sollte eine ca. 80% der CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr
energieverbrauchsabhängige Kfz-Besteuerung einge- verantwortlich ist, die Wirkungsgradvorzüge der direk-
führt werden. ten Elektrifizierung zu nutzen. Studien zufolge kann
bereits durch die Elektrifizierung eines Drittels des
Streckenabhängige Pkw-Maut deutschen Autobahnnetzes (d.h. ca. 4 000 km) ein elek-
trischer Fahranteil von ca. 60% erreicht werden. Sind
Bestehende Mautsysteme dienen bislang überwiegend die (auch in Deutschland durchgeführten) Demonst-
der Deckung von Wegekosten. Zukünftig können sie rationsprojekte erfolgreich, empfiehlt der SRU dem
aber auch als wichtiges Steuerungsinstrument für die Bund, die Elektrifizierung von hochfrequentierten
Verkehrsverlagerung, -vermeidung und -lenkung sowie Autobahnabschnitten mit geeigneten Start-Ziel-Relati-
zur Effizienzverbesserung und Flottenerneuerung fun- onen zu planen und beispielsweise über die Lkw-Maut
gieren. Um die Kostenwahrheit im Verkehr zu fördern zu finanzieren.
und CO2-Emissionen zu vermindern, sollte die in der
letzten Legislaturperiode beschlossene Pkw-Maut zu Gewinnung und Kreislaufführung benötigter
einer streckenabhängigen Maut fortentwickelt werden. Rohstoffe
Die Einführung einer solchen entfernungsabhängigen
Pkw-Maut ist insbesondere auch angesichts einer zu Die Elektromobilität hat in der Nutzungsphase deut-
erwartenden Verbreitung autonomer Fahrzeuge gebo- lich geringere Umweltwirkungen als der Verkehr mit
ten, um unnötige Leerfahrten zu vermeiden, einen wei- Verbrennungsmotoren, da weniger Lärm und gerin-
teren Anstieg der Beförderungsleistung zu verhindern gere Emissionen anfallen (CO2, NOx, Feinstaub). In der
und die intermodale Nutzung autonomer Fahrzeuge in Vorkette – Rohstoffförderung und -aufbereitung – ver-
Kombination mit dem ÖPNV finanziell anzureizen. Die schieben sich die Umweltwirkungen, weil statt Erdöl
weitere Ausdifferenzierung einer solchen Maut nach andere Rohstoffe für die Motor- und Batterietechnik
ökologischen oder verkehrstechnischen Kriterien kann sowie für die Erzeugung erneuerbarer Energien benö-
sinnvoll sein, muss aber im Hinblick auf Datenschutz, tigt werden. Der Bedarf an Lithium, Seltenen Erden,
Erhebungsaufwand und Verbraucherschutz abgewo- Kobalt, Platin und Kupfer wird deutlich steigen.
gen werden. Die Bundesregierung sollte die Zulassung neuer
Fahrzeugtypen (aller Antriebs- und Fahrzeugarten) mit
Ausbau der Energieversorgungsinfrastruktur der Bereitstellung eines »Kreislaufpasses« verknüp-
fen, indem die Hersteller Informationen zu Rohstoffen
Um die Marktdurchdringung elektrischer Antriebe zu (Grundlage für das Inventar), Demontagepläne und
fördern, muss zügig eine bedarfsgerechte Ladeinfra- eine Verwertungsplanung zur Verfügung stellen. Dafür
struktur aufgebaut werden. Diese Investitionen soll- ist bereits bei der Produktentwicklung ein umfassen-
ten durch den Bund vorübergehend staatlich geför- des Konzept zu erarbeiten, das sowohl die Demon-
dert werden. Das derzeitige Programm des Bun- tagefähigkeit als auch die hochwertige Verwertung
des, das 300 Mio. Euro in der Förderperiode 2017 bis ermöglicht.
2020 bereitstellt, sollte daher fortgeführt und erwei- Die Begriffe Recycling und stoffliche Verwertung
tert werden. Wie lange die staatliche Förderung not- sind mit dem Anspruch »gleicher oder höherwertiger
wendig sein wird, lässt sich derzeit noch nicht genau Einsatz« klar zu definieren und in den relevanten Geset-
abschätzen. Da die Wirtschaftlichkeitsschwelle der zes- und Verordnungstexten zu verankern. Die Bundes-
Bereitstellung von Ladeinfrastruktur nicht in allen regierung sollte sich auch auf europäischer Ebene für
Regionen zeitgleich erreicht werden wird, kann eine Konkretisierung dieser Begriffe engagieren. Für
zukünftig ein räumlich differenzierter Förderansatz die Verwertungswege sind beste verfügbare Techni-
erforderlich sein. ken zur Erreichung einer hochwertigen stofflichen Ver-
Da ungefähr 85% aller Ladevorgänge im privaten wertung zu bestimmen. Um die Erarbeitung und kon-
Bereich stattfinden, sollten bindende Vorgaben für die krete Implementierung spezifischer Anforderungen für
Bereitstellung von Ladeinfrastrukturen bei Neubau- Elektrofahrzeuge voranzubringen, sollte sich die Bun-
6 ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018ZUR DISKUSSION GESTELLT
desregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, bare Energien weniger stark zu besteuern. Zudem sollte
dass die Altfahrzeug- und die Batterie-Richtlinie zügig eine Zulassungsquote für elektrische Antriebe, ambi-
an die neuen Herausforderungen der Elektromobilität tionierte Grenzwerte und fiskalische Anreize zur Ver-
und mit Blick auf eine hochwertige Verwertung ange- besserung der Fahrzeugeffizienz sowie eine stre-
passt werden. ckenabhängige Pkw-Maut eingeführt werden und der
Ausbau der Energieversorgungsinfrastruktur voran
Fortentwicklung der Verkehrsinfrastruktur- gebracht werden.
planung zu einer Bundesmobilitätsplanung
LITERATUR
Der Bundesverkehrswegeplan ist das wichtigste Steue-
Agora Energiewende (2017), Energiewende 2030: The Big Picture. Mega
rungsinstrument für die Verkehrsinfrastrukturplanung trends, Ziele, Strategien und eine 10-Punkte-Agenda für die zweite Phase
in der Zuständigkeit des Bundes. Aus Klimaschutz- und der Energiewende, Impulse, Agora Energiewende, Berlin.
Nachhaltigkeitssicht sind Verkehrs- und Mobilitäts- SRU – Sachverständigenrat für Umweltfragen (2017a), Kohleausstieg jetzt
einleiten, Stellungnahme, SRU, Berlin.
konzepte ausschlaggebend, die sich an den jeweiligen
SRU – Sachverständigenrat für Umweltfragen (2017b), Umsteuern erfor
Raum- und Infrastrukturgegebenheiten orientieren
derlich: Klimaschutz im Verkehrssektor, SRU, Berlin.
und deren verkehrliche, räumliche, gesundheitliche
UBA – Umweltbundesamt (2017a), »Daten, Energiebereitstellung und
und umweltbezogenen Wirkungen berücksichtigen. -verbrauch, Energiebedingte Emissionen, Energiebedingte Emissionen
Dies ist bei der derzeitigen Bundesverkehrswegepla- durch Stromerzeugung«, Stand: 24. Mai 2017, UBA, Dessau-Roßlau, ver-
fügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/daten/energiebereit-
nung nicht in ausreichendem Maß der Fall. Die Aus- stellung-verbrauch/energiebedingte-emissionen#textpart-3, aufgerufen
wahl der (Aus-)Bauprojekte erfolgt zudem im Wesent- am 30. Juli 2017.
lichen auf Nutzen-Kosten-Bewertungen, obwohl die UBA – Umweltbundesamt (2017b), »Daten, Klimawandel, Treibhausgase-
missionen in Deutschland«, Stand: 20. März 2017, UBA, Dessau-Roßlau,
Vergleichbarkeit dieser Analysen über verschiedene verfügbar unter: https://www.umweltbundesamt.de/daten/klimawan-
Projektarten und Verkehrsträger methodisch nur ein- del/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#textpart-1, aufgerufen am
22. Juni 2017.
geschränkt möglich ist. Der Bundesverkehrswegeplan
2030 verfehlte zudem elf der zwölf von der Bundesre-
gierung aufgestellten Umweltziele.
Der SRU empfiehlt in seinem Sondergutachten
deshalb, die Bundesverkehrswegeplanung zu einer
integrierten Bundesmobilitätsplanung fortzuentwi-
ckeln, die alle überregionalen Verkehrsträger (Straße,
Schiene, Schiff, Luftverkehr) umfasst, einschließlich
einer konsistenten bundesweiten Flughafenplanung.
Dies erfordert eine Abkehr von der rein nachfragesei-
tigen Begründung der Verkehrsplanung, hin zu einer
integrierten Raum- und Verkehrsplanung. Diese sollte
– unter der Voraussetzung eines leistungsfähigen Ver-
kehrssystems – anstreben, die Verkehrsleistung zu ver-
ringern und die Umwelt- und Gesundheitswirkungen
des Verkehrs unter Beibehaltung der erforderlichen
Mobilität zu minimieren.
FAZIT
Deutschland wird seine Klimaziele bis zum Jahre 2020
verfehlen, wenn keine grundlegende Neuausrich-
tung der Klimapolitik erfolgt. Um den kurzfrstigen
Emissionsminderungzielen zumindest näher zu kom-
men, wäre ein rascher Kohleausstieg notwendig. Auch
der SRU empfiehlt in seiner Stellungnahme, dass im
Stromsektor ein maximales Emissionsbudget von
2 000 Mio. Tonnen nicht überschritten werden sollte,
und ein Kohleausstieg in drei Phasen viele Vorteile brin-
gen würde. Zudem sollte der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien stärker voran gebracht werden. Um die mittelfris-
tigen Klimaziele nicht auch noch zu verfehlen, sollte so
schnell wie möglich eine nachhaltige Verkehrswende
auf den Weg gebracht werden. Dazu ist es notwendig,
eine Reform der Steuern und Abgaben durchzuführen,
die zum Ziel hat, fossile Energien stärker und erneuer-
ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018 7ZUR DISKUSSION GESTELLT
Erik Gawel* lungstäterin« präsentiert. Die drohende Zielverfeh-
lung sollte aber jetzt nicht zu neuer Symbol- oder
Neustart der Klimapolitik gar »Notbremsenpolitik« Veranlassung geben, etwa
erforderlich der symbolträchtigen Ad-hoc-Abschaltung von Koh-
lekraftwerken, die ohne begleitende Reduktion der
Das nationale Klimaziel, in Deutschland bis 2020 40% europäischen Emissionsberechtigungen für den Kli-
der Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einzu- maschutz gar nichts einbrächte. Vielmehr braucht die
sparen, wird deutlich verfehlt werden. Bereits das in Klimapolitik einen strukturellen Neustart. Dazu gehö-
den 1990er Jahren formulierte nationale Ziel, bis 2005 ren in erster Linie ein gesellschaftlicher Konsens über
im Vergleich zu 1990 25% Einsparungen zu realisieren, die Notwendigkeit stringenten Klimaschutzes und die
wurde seinerzeit nicht eingehalten und von der Poli- Wiedergewinnung des klimapolitischen Konsenses
tik unter Verweis auf das bescheidenere und erst spä- auf EU-Ebene. Die unbefriedigenden Ergebnisse der
ter zu erreichende Kyoto-Ziel diskret beschwiegen. Klimaschutzpolitik und ihre wohlfeil zu kritisierende
Erik Gawel Dabei mangelt es nicht an kaum mehr überschauba- disparate Gestalt reflektieren diese gesellschaftlichen
ren Programmen, Aktionsplänen und Maßnahmen, Grunddefizite und lassen sich durch Einzelmaßnah-
allen voran die komplette Energiewende. Gerade des- men nicht aufheben.
halb ist die deutsche Klimaschutzpolitik gescheitert.
Wichtigstes Symptom dieses Scheiterns ist aber KARDINALSÜNDE LAHMENDER EMISSIONSHANDEL
nicht die zu erwartende punktuelle Zielverfehlung
2020, sondern der stagnierende Trend der Emissi- Das Scheitern der Klimaschutzpolitik hat eine euro-
onsentwicklung in Deutschland seit 2009. Seither ist päische und eine deutsche Dimension. Auf europäi-
es nämlich nicht mehr gelungen, erkennbare Minde- scher Ebene wäre in erster Linie der EU-Emissionshan-
rungsfortschritte zu erzielen. Nach einer Nahzeitprog del (ETS) berufen und auch in der Lage, auf effiziente
nose des Umweltbundesamtes (UBA) haben sich die Weise eine gewünschte Emissionsminderung EU-weit
Emissionen 2016 sogar wieder leicht um 0,4% erhöht.1 herbeizuführen. Doch der seit 2005 praktizierte ETS
Für 2016 wird fast exakt mit dem gleichen Emissions- steht in der Kritik, da er die Erwartungen an die von
stand wie 2009 gerechnet. Damit gelingt zwar eine ihm ausgehenden Impulse zu einer kosteneffizien-
gewisse Entkopplung vom zwischenzeitlichen Wirt- ten Dekarbonisierung der einbezogenen Emissions-
schaftswachstum, aber keine weitere absolute Min- sektoren nicht erfüllt. Überausstattung an Emissions-
derung. Besonderes Sorgenkind bleibt dabei der Ver- berechtigungen und anhaltende Niedrigpreise geben
kehrssektor (vgl. Tribisch und Gawel 2017): Nach der aber nur die Symptomatik einer Krise vor, die im Kern
Nahzeitprognose des UBA lagen die Emissionen dort eine Krise der europäischen Klimapolitik selbst ist. Es
im Jahr 2016 sogar um 1,1% über dem Niveau von 1990. fehlt gegenwärtig am gesamteuropäisch politischen
Dies lag vor allem an einem Wachstum des Straßen- Willen, wirklich wirksame Emissionsbeschränkungen
güterverkehrs. Die Emissionslast des Verkehrssektors zu beschließen, die in einzelnen Mitgliedstaaten als
ist von anhaltenden Rebound- und Backfire-Effek- schmerzhaft empfundenen Strukturwandel erzwingen
ten gekennzeichnet, bei denen das Verkehrswachs- würden. Erfolgreicher Klimapolitik wäre gesellschaft-
tum die durchaus beobachtbaren Energieeffizienz- lich vor allem dadurch gedient, dass die vielstimmige
fortschritte u.a. der Verbrennungsmotoren in die- Kritik am ETS in politischen Druck umgemünzt würde,
sem Sektor zunichtemacht. Im Stromsektor bleibt um die notwendigen Entscheidungen dafür zu treffen,
die Minderungsdynamik aufgrund der persistenten dass künftig spürbare Knappheit an Emissionsberech-
Kohleverstromung weit unter ihren Möglichkeiten; tigungen EU-weit organisiert werden kann – und zwar
Ähnliches gilt für die zu geringen Sanierungsraten am besten über einen gestärkten und sektoral deutlich
im Gebäudebestand. Die Energiewende ist bis heute erweiterten Emissionshandel. Denn Heiz- und Kraft-
eine allenfalls »halbe Stromwende« geblieben. stoffe können ohne weiteres in einen Emissionshandel
Vor dem Hintergrund der drohenden Zielverfeh- wirksam einbezogen werden.
lung wurden bereits 2014 mit dem »Aktionsprogramm Die Klimapolitik ringt gegenwärtig aber vor allem
Klimaschutz 2020« sowie dem »Nationalen Aktions- mit dem Problem der Überausstattung an Emissions-
plan Energieeffizienz« abermalig Maßnahmenpro- berechtigungen. Die bereits getroffenen Maßnahmen
gramme mit einer Fülle an Einzelvorhaben aufgelegt, der dritten sowie die beschlossenen und in Aussicht
die aber nur an den Symptomen kurieren. Das erneut genommenen Maßnahmen der vierten Handelsperiode
verfehlte Klimaziel bedeutet vor allem ein Glaubwür- ab 2021 bleiben insgesamt Flickwerk eines bloßen
digkeitsproblem der deutschen Klimapolitik, zumal »Überhang-Managements« und können nicht verhin-
sie sich in ihrer fehlenden Zieltreue als »Wiederho- dern, dass das System durch persistente Angebots-
überschüsse dauerhaft geschwächt bleibt (vgl. Janssen
*
Prof. Dr. Erik Gawel ist Direktor des Instituts für Infrastruktur und
Ressourcenmanagement der Universität Leipzig und Leiter des De-
et al. 2015). Es zeigt sich, dass es politisch kaum durch-
partments Ökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung setzbar ist, auch nur die kumulierten Fehler der Ver-
– UFZ, Leipzig.
1
Verfügbar unter: www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treib-
gangenheit zu bereinigen, geschweige denn über den
hausgas-emissionen-in-deutschland. ETS künftig spürbare Knappheit zu verordnen. Damit
8 ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018ZUR DISKUSSION GESTELLT
bestätigt sich der »politökonomische Hauptsatz« der steuerung eine Art Karbonmindestpreis festzulegen
Dekarbonisierungspolitik. (analog zu dem seit 2013 in UK praktizierten carbon
price floor). Kurioserweise feiert damit jene CO2-Steuer
DER POLITÖKONOMISCHE HAUPTSATZ DER fröhliche Urständ, die in den 1990er Jahren – zugunsten
DEKARBONISIERUNG des Emissionshandels – verworfen wurde. Nunmehr
wird sie aber umstandslos als Ergänzung zum Emis
Denn eine nahezu vollständige Dekarbonisierung sionshandel, ja als dessen Reparaturvehikel diskutiert,
ökonomischer Prozesse, die ausschließlich über die um einen administrierten Mindestpreis zu sichern, den
Zuweisung individueller Lasten an Emittenten, d.h. das ETS nicht zu liefern vermag. Diese Debatte verweist
durch Kaufkraftabschöpfung nach dem Programm ganz nebenbei auch auf die steuerpolitischen Versäum-
der Internalisierung organisiert wird, wird es poli- nisse, die im Bereich der traditionellen Instrumente
tisch wohl niemals geben. Umweltpolitik ausschließ- der Strom- und Energiebesteuerung zu beklagen sind
lich über Lastenzuweisung an politisch einflussreiche (vgl. Gawel und Purkus 2016). Diese längst vorhande-
Emittentengruppen ins Werk zu setzen, wie dies Steu- nen nationalen Instrumente verharren konzeptionell
ern oder Zertifikate tun, gehört zu den großen Illu- noch in den 1990er Jahren (»Öko-Steuer«) und wurden
sionen ökonomisch rationaler Klimapolitik. Vor diesem seither nicht konsequent für das neue Energiewen-
Hintergrund kann eine Politik, die erneuerbare Tech- den-Zeitalter oder gar die Zukunft der Sektorkopplung
nologien stattdessen im Wege von Vorteilszuführung mit Stromnutzung auch im Wärme- und Verkehrsbe-
fördert und zugleich über die vielgeschmähte EEG-Um- reich ertüchtigt. Eine zukunftsweisende Reform der
lage Stromverbrauch wie eine Quais-Stromsteuer Strom- und Energiebesteuerung sollte daher weit oben
in im Übrigen marktwirtschaftlicher Weise belastet, auf der Agenda stehen. Dazu könnte im Übrigen auch
durchaus auch (institutionen-)ökonomisch sinnvoll eine streckenbezogene Pkw-Maut gehören, die jedoch
sein (vgl. Lehmann und Gawel 2013): Denn so werden sinnvoll mit der Energiesteuer auf Kraftstoffe abzu
in dynamischer Perspektive wohl überhaupt erst jene stimmen wäre und die Kfz-Steuer ersetzen könnte.
politischen Spielräume geschaffen, einen Emissions-
deckel fortlaufend nennenswert zu verschärfen, ohne EMISSIONSHANDEL DURCH EINE UNABHÄNGIGE
jene politische Zustimmung einzubüßen, auf die aber EMISSIONSBANK?
Entscheidungsträger in der Praxis repräsentativer
Demokratien dringend angewiesen sind. Doch wird man nicht umhin kommen, auch eine grund-
legende Reform des Emissionshandels vorzunehmen.
POLICY MIX STATT POLICY MESS Der bisher betriebene, diskretionäre und damit gegen-
druckanfällige permanente Reparaturbetrieb des
Damit ist das Feld eröffnet für »zusätzliche« Maßnah- europäischen Gesetzgebers hat zwar gewisse Fort-
men neben dem ETS. Für die derzeit (noch) nicht in schritte erbracht, aber insgesamt nicht überzeugen
den Emissionshandel einbezogenen Sektoren liegt können. Das ETS ist so weder hinreichend flexibel, um
der Bedarf an komplementären Instrumenten auf der rasch auf veränderte Marktbedingungen zu reagie-
Hand, in den sog. ETS-Sektoren bedarf es aber jeweils ren, noch bietet er die notwendige Stabilität, die für
einer sogfältigen Begründung und Abstimmung der die langfristige Erwartungsbildung privater Investoren
Politikmaßnahmen. Anstelle eines sinnvollen Policy unerlässlich ist.
mix präsentiert sich die europäische und nationale Die Notwendigkeit, ggf. kurzfristig in den Markt
Klimaschutzpolitik freilich eher als Policy mess: Eta- zu intervenieren, um Preisausschläge zu moderieren
blierte Instrumente wie die Strom- und Energiesteuer und das Marktgeschehen auf Knappheitskurs zu hal-
liegen klimapolitisch weitgehend brach und sind ten, wurde in der umweltökonomischen Literatur früh
nicht konzeptionell eingebunden, es herrscht zu viel gesehen. Um diese Interventionen allerdings nicht dis-
ordnungsrechtliches Klein-Klein (Stichwort Glühbir- kretionären Politikentscheidungen zu überlassen, die
nen und Staubsauer nach der EU-Öko-Design-Richtli- auf Marktausschläge tendenziell zu langsam regie-
nie) und zu viel symbolische Politik; bewusste Politik- ren (wie zuletzt auf die Mindernachfrage im Zuge der
lücken, etwa im Suffizienzbereich (Verkehrsleistungen) Finanzkrise) und die überdies politischer Opportunität
sowie eine mangelhafte Abstimmung zwischen ETS- sowie Lobbyeinflüssen unterliegen werden, hat Holger
und Non-ETS-Sektoren prägen die Klimapolitik. Man Bonus immer wieder die Idee ventiliert, eine unabhän-
kann im Übrigen auch grundsätzlich die Frage stellen, gige »Emissionsbank« mit der Befugnis zur Schaffung
warum es neben den EU-Klimazielen überhaupt noch und Einziehung von Emissionsberechtigungen zu schaf-
nationale Ziele gibt, die auch die europäisch geregelten fen (vgl. Bonus 1982, in neuerer Zeit u.a. Edenhofer
ETS-Sektoren umfassen. 2014, Perthuis und Trotignon 2014). Mit der Übertra-
gung auf eine unabhängige, doch öffentliche Einrich-
REFORM DER STROM- UND ENERGIEBESTEUERUNG tung lasse sich eine der Verfassung des Geldwesens
(Zentralnotenbank) analoge, institutionelle Absiche-
Eine derzeit intensiv diskutierte Ergänzungsmaß- rung klimapolitischer Steuerung durch Abschirmung
nahme betrifft die Idee, über eine ergänzende CO2-Be- vom politischen Kräftefeld erzielen. Zugleich würde
ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018 9ZUR DISKUSSION GESTELLT
mit der Errichtung einer entpolitisierten »Emissions- durch schlichten Instrumententausch aushebeln: Wer
bank« die Möglichkeit geschaffen, in den Markt für einen spürbaren Knappheitspreis des ETS ablehnt,
Emissionsberechtigungen – wie auf Geld- und Wäh- wird auch einer ergänzenden CO2-Steuer kaum etwas
rungsmärkten – zu intervenieren, um den aktuellen abgewinnen können.
Marktkurs zu beeinflussen. Als unabhängiger Instanz Das Grundübel der Klimapolitik besteht daher
wäre eine solche Emissionsbank allein dem Klima- im Kern in gesellschaftlich unverarbeiteten Zielkon-
schutz verpflichtet. flikten. Auch wenn die Bundesregierung den Klima-
Neben juristischen Fragen der demokratischen schutz tapfer als »Modernisierungsstrategie unse-
Legitimation stellen sich naturgemäß auch Probleme rer Volkswirtschaft«2 verkauft, so fehlt es doch genau
der Funktionsfähigkeit: An die Stelle des Emissions- hierüber an einem gesellschaftlichen Konsens – wie
deckels tritt hier eine bloße Steuerungsvariable einer etwa die schrille und vielfach faktenfreie öffentliche
Emissionsbank, die nach eigenem Ermessen Knapp- Debatte um Strompreis und EEG-Umlage illustriert
heiten auf dem Markt administriert. Ob das früher weit hat. Stattdessen werden sorgsam die sektoralen Kos-
verbreitete Vertrauen in unabhängige Zentralnoten- ten des Klimaschutzes gewogen und in Politikerwar-
banken und ihre Antriebe zur Inflationsabwehr noch tungen der Lobbygruppen geformt. Solange Klima-
vollauf gerechtfertigt sein kann, steht im Übrigen seit schutz vor allem unter dem Gesichtspunkt der Kosten
dem grenzwertigen Agieren der EZB in der europäi- für bestimmte Gruppen in der Gegenwart diskutiert
schen Finanzkrise ebenfalls in Frage. wird, lassen sich Widerstände kaum überwinden, son-
Gegenwärtig krankt aber das System des EU-Emis- dern allenfalls in wenig effektive Symbolpolitik kanali-
sionshandels gerade an der Notwendigkeit zu perma- sieren. Hier tut ein Neustart not.
nenten Regeländerungen, die keine verlässliche Erwar-
tungsbildung gestatten. Zugleich erweist sich das Sys- LITERATUR
tem als zu wenig flexibel, da sich immer wieder die
Bonus, H. (1982), »Emissionsrechte als Mittel der Privatisierung öffent-
Zertifikatnachfrage anders entwickelt, als beim Design licher Ressourcen aus der Umwelt«, in: H. Möller, R. Osterkamp und W.
des Systems Jahre zuvor angenommen wurde, ohne Schneider (Hrsg.), Umweltökonomik, Neue Wissenschaftliche Bibliothek,
Königstein/Taunus, 295–320.
dass »automatische« Anpassungen möglich wären.
Edenhofer, O. (2014), »Climate policy: reforming emissions trading«, in:
Stattdessen müssen diskretionäre Eingriffe über Nature Climate Change 4, 663–664.
schwerfällige und politischen Opportunitäten der Mit-
Gawel, E. (2016), »Der EU-Emissionshandel vor der vierten Handelsperi-
gliedstaaten berücksichtigende EU-Entscheidungsver- ode – Stand und Perspektiven aus ökonomischer Sicht«, Zeitschrift für das
gesamte Recht der Energiewirtschaft 5, 351–357.
fahren gesucht werden. Der ETS ist damit weder stabil
noch flexibel. Gawel, E. und A. Purkus (2015), »Zur Rolle von Energie- und Strombesteu-
erung im Kontext der Energiewende«, Zeitschrift für Energiewirtschaft 39,
Die derzeit vielfach favorisierte ergänzende Preis- 77–103.
steuerung durch eine CO2-Steuer könnte zu einer erra- Gawel, E., S. Strunz und P. Lehmann (2014), »A Public Choice View on the
tisch-diskretionären Kombination von Preis- und Climate and Energy Policy Mix in the EU«, Energy Policy 64, 175–182.
Mengensteuerung sowie zu einem energiesteuerpo- Janssen, M., P. Peichert, J. Perner und Chr. Riechmann (2015), »Reform
der EU-Klimapolitik: Kleiner Schritt oder großer Wurf?«, Energiewirtschaft
litisch inkonsistenten Anreizgefüge unter Gewährung liche Tagesfragen (11), 8–12.
umfangreicher Leakage-Ausnahmen führen. Darüber Jarke, J. und G. Perino (2017), »Do Renewable Energy Policies Reduce Car-
hinaus leistete dieser Ansatz einer weiteren national bon Emissions? On Caps and Inter-Industry Leakage«, Journal of Environ
mental Economics and Management 84, 102–124.
fragmentierten Klimapolitik in der EU Vorschub. Eine
Lehmann, P. und E. Gawel (2013), »Why Should Support Schemes for
unabhängige, auf Klimaschutz verpflichtete Emissi- Renewable Electricity Complement the EU Emissions Trading Scheme?«,
onsbank könnte demgegenüber dazu beitragen, den Energy Policy 52, 597–607.
Grundkonflikt zwischen Flexibilität (Reagieren auf ver- Perthuis, C. de und R. Trotignon (2014), »Governance of CO2 Markets: Les-
sons from the EU ETS«, Energy Policy 75, 100–106.
änderte Marktbedingungen) und Stabilität (Vertrauen
Strunz, S., E. Gawel und P. Lehmann (2015), »Towards a general ›Europea-
in langfristig stabile Dekarbonisierungsanreize) sys- nization‹ of EU Member States’ energy policies?«, Economics of Energy and
temkonform zu lösen. Diese institutionelle Innovation Environmental Policy 4(2), 143–159.
verdient zumindest eine erneute Reflexion. Tribisch, P. und E. Gawel (2017), Klimaschutzpolitik im Bereich des motori
sierten Individualverkehrs in Deutschland: eine ökonomische Analyse, Logos
Verlag, Berlin.
GRUNDÜBEL: UNVERARBEITETE ZIELKONFLIKTE
Doch auch solche Reformen bräuchten politische
Mehrheiten. Naiv wäre jedenfalls die Annahme, polit-
ökonomische Widrigkeiten gegen strikte Klimapoli-
tik ließen sich durch schlichten Austausch der Inst-
rumente »überlisten«: Zwar bieten umweltpolitische
Instrumente durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte
und Potenziale für politische Einflussnahmen, der
Widerstand gegen strikte Emissionsbegrenzungen
2
BMBUB, Klimaschutzplan 2050, verfügbar unter: www.bmub.
und die dadurch ausgelösten Kosten bei einflussrei- bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klima-
chen Emittentengruppen lassen sich jedoch kaum schutzplan_2050_bf.pdf, S. 16 ff.
10 ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018ZUR DISKUSSION GESTELLT
Manfred Fischedick* eine ausgesprochen große Herausforderung. Letztlich
hilft hier nur – wie bei vielen Aufgaben – ein interna
Klimaziel 2020: Eine Rück- tionaler Erfahrungsaustausch: In der Frage der Identi-
kehr zu einer erfolgreichen fikation von robusten Klimaschutzoptionen, dem Auf-
bau und dem Umgang mit Unsicherheiten bei der Ent-
Klimapolitik ist möglich wicklung von Szenarien, der adäquaten Antwort auf
die hohe Komplexität im System und die zunehmende
HINTERGRUND – DER INTERNATIONALE RAHMEN Dynamik.
Für die Umsetzung der Pariser Ziele ist vor diesem Manfred Fischedick
Die Unterzeichnung des sogenannten Paris Agreement Hintergrund zentral, dass Schlüsselländer wie Deutsch-
im Rahmen der internationalen Klimaschutzverhand- land den Weg für die Umsetzung weisen und zeigen,
lungen am 12. Dezember 2015 in Paris hat den globa- wie Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Erhalt der
len Klimaschutzbemühungen Schwung gegeben. Jetzt internationalen Wettbewerbsfähigkeit (oder sogar Ver-
kommt es darauf an, diesen Schwung zu halten und den besserung der Wettbewerbsfähigkeit) zusammenge-
formulierten Zielen und Handlungsaufforderungen hen. Mit den mutigen weitgehend parteiübergreifen-
auch Taten folgen zu lassen. Dass dies kein Selbstgän- den Beschlüssen zur Energiewende, die im nationalen
ger ist, haben u.a. die komplexen zweiwöchigen Ver- Energiekonzept von 2010 (respektive in Bezug auf den
handlungen der internationalen Staatengemeinschaft stufenweisen Ausstieg aus der Kernenergie angepass-
bei der Vertragsstaatenkonferenz (COP 23) im Novem- ten Energiekonzept von 2011) fixiert sind, ist dafür eine
ber 2017 in Bonn gezeigt. Ziel der Verhandlungen in wichtige Grundlage gelegt worden.
Bonn war, eine robuste Basis für ein Regelwerk für die
konkrete Umsetzung der Pariser Beschlüsse zu erar- WO STEHEN WIR HEUTE UND WIE GROSS IST DIE
beiten und damit den Weg für politische Beschlüsse zu KLIMASCHUTZLÜCKE UND WARUM?
eben, die auf der nachfolgenden Vertragsstaatenkon-
ferenz Ende 2018 im polnischen Kattowitz gefasst wer- Nach vorläufigen Schätzungen des Umweltbundesam-
den sollen. Auch wenn erste wichtige Schritte in diese tes lagen die deutschen Treibhausgasemissionen im
Richtung gemacht worden sind, steckt der Teufel u.a. Jahr 2016 knapp 28% unter dem Wert von 1990. Dabei
bei der Festsetzung von Transparenz- und Monitoring- ist zu beobachten, dass sich der Rückgang der Treib-
regeln im Detail. hausgasemissionen in Deutschland im Laufe der letz-
Eine der wichtigen Aufgaben, die die Vereinba- ten 25 Jahre verlangsamt hat. So sind die Emissionen
rung von Paris den Mitgliedstaaten ins Stammbuch zwischen 1990 und 2000 – unter anderem infolge der
geschrieben hat, ist die Zielsetzung, im Verlauf der mit der Wiedervereinigung einhergehenden struktu-
zweiten Hälfte des Jahrhunderts das Stadium der rellen ökonomischen Umbrüche – um durchschnitt-
Treibhausgasneutralität zu erreichen. Letztendlich lich 1,8% pro Jahr gesunken, während der Rückgang
heißt dies nichts anderes als eine vollständige Dekar- zwischen 2000 und 2010 nur noch bei knapp 1,0% pro
bonisierung des Energiesystems zu erreichen, und Jahr lag. Zwischen 2010 und 2016 konnte schließlich
dies bereits bis zur Mitte des Jahrhunderts. Dies gilt nur noch ein durchschnittlicher jährlicher Rückgang
zumindest dann, wenn man davon ausgeht, dass im von 0,6% beobachtet werden. Zudem waren die deut-
Bereich der Energieversorgung schnellere Erfolge schen Treibhausgasemissionen zwischen 2014 und
erreicht werden können und mehr Optionen zur Verfü- 2016 nahezu unverändert. Insofern ist zunächst einmal
gung stehen als etwa im Bereich der Industrie und der zu konstatieren, dass eine Verlangsamung der Klima-
Landwirtschaft, und wenn man davon ausgeht, dass schutzdynamik kein ganz neues Phänomen ist, son-
im Zeitverlauf keine »negativen Emissionen« zu erzie- dern sich seit Jahren klar abzeichnet.
len sind etwa durch eine Kombination einer großmaß- Aufgrund der in den letzten Jahren fehlenden
stäblichen Nutzung von Biomasse in Kombination mit Dynamik bei der Reduktion der Treibhausgase ist
der Abtrennung und Speicherung von CO2. Dass viele mittlerweile das Ziel für das Jahr 2020 in weite Ferne
der heute vorliegenden globalen Klimaschutzszena- gerückt, die Emissionen um 40% zu senken. Zwischen
rien massiv auf eben die Option der »negativen Emis- 2016 und 2020 müssten die Treibhausgasemissionen
sionen« setzen, ist angesichts der hiermit verbun- jährlich um durchschnittlich 4,6% sinken, um das Ziel
denen zahlreichen offenen Fragen und Risiken eher zu erreichen. Eine Minderung in dieser Größenordnung
bedenklich. ist in den letzten drei Jahrzehnten nur zweimal erreicht
Die Pariser Vereinbarung schreibt den Ländern worden. Zum einen im Jahr 1990 in Folge des Zusam-
konkret vor, dass sie bis 2020 ein nationales Konzept menwachsens der beiden deutschen Staaten, zum
vorlegen und in diesem darlegen, mit welchen Strate- anderen im Jahr 2014, als der Winter nahezu vollstän-
gien sie sich den Vorgaben nähern wollen. Diese Auf- dig ausgefallen ist und mit ihm der traditionell in den
gabe ist alles andere als trivial und für zahlreiche Län- Wintermonaten hohe Energiebedarf.
der ohne eine etablierte Energieszenarienlandschaft Bereits seit einigen Jahren ist also klar, dass die
*
Prof. Dr. Manfred Fischedick ist Vizepräsident des Wuppertal Insti-
Erfüllung des deutschen Klimaziels für das Jahr 2020
tuts für Klima, Umwelt, Energie. in Gefahr ist. So ging bereits der Projektionsbericht
ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018 11ZUR DISKUSSION GESTELLT
der Bundesregierung aus dem Jahr 2013 (vgl. BMU ben. Dies könnte nicht nur auf politischer Ebene schäd-
2013) davon aus, dass ohne zusätzliche Klimaschutz- lich sein, sondern auch eine negative industriepoli
maßnahmen bis zum Jahr 2020 lediglich eine Reduk- tische Ausstrahlung auf Entwicklung und Absatz von
tion um etwa 33% gelingen würde, es wurde also von Klimaschutzprodukten auf den Weltmärkten haben.
einer »Klimaschutzlücke« von rund 7 Prozentpunkten So schätzt der im November 2017 veröffentlichte World
ausgegangen. Infolgedessen hat sich die Bundesre Energy Outlook 2017 der Internationalen Energieagen-
gierung Ende 2014 auf einen »Aktionsprogramm Kli- tur (IEA) ab, dass bei einer konsequenten Umsetzung
maschutz 2020« (vgl. BMUB 2014) geeinigt, in dem der sich heute abzeichnenden Politikmaßnahmen
über 100 zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen in (sogenanntes New Policy Scenario) im Zeitraum von
unterschiedlichen Sektoren ankündigt wurden und 2017 bis 2040 mehr als 40% aller kumulierten globa-
seitdem auch umgesetzt worden sind. Naturgemäß len Investitionen im Bereich Elektromobilität und fast
war aufgrund der üblichen Implementierungszyklen 30% der globalen Ausgaben für Wind- und Solarkraft-
allerdings nicht zu erwarten, dass die formulierten werke auf China entfallen dürften (vgl. IEA 2017). Macht
Maßnahmen bereits kurzfristig Wirkung erzielen China ernst, bricht mit traditionellen Entwicklungs-
können. modellen der Industrieländer und orientiert sich statt-
Im Vergleich zum Projektionsbericht gehen zwei dessen an einem neuen Modell einer low carbon urban
aktuellere Studien davon aus, dass die Klimaschutz sisation and economic growth strategy, dann dürften
lücke trotz Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 ver- damit massive Forschungs- und Entwicklungsanstren-
mutlich deutlich größer sein wird (vgl. BMU 2017a; gungen verbunden sein und nicht zuletzt die Chance,
Agora Energiewende 2017). Diese Einschätzung be sich damit auf den globalen Exportmärkten exzellent
stätigen auch aktualisierte (BMUB-interne) Berech- zu positionieren.
nungen der zu erwartenden Klimaschutzlücke (BMUB Auf die Notwendigkeit einer überzeugenden
2017b). Nach diesen Abschätzungen ist zwar zu erwar- Umsetzungsstrategie der Klimaschutzziele in Deutsch-
ten, dass die jährlichen Treibhausgasemissionen bis land aus industrie- und wirtschaftspolitischer Pers-
zum Jahr 2020 weiter sinken werden, nicht jedoch pektive weist auch ein Positionspapier von mehr als
annährend ausreichend stark, um das Klimaziel der 50 großen deutschen Unternehmen hin, das vor der
Bundesregierung für 2020 zu erreichen. Werden die Bonner Klimakonferenz im November 2017 veröffent-
mittleren Werte der jeweiligen Schätzungen herange- licht worden ist (vgl. Stiftung 2 Grad 2017).
zogen, so ergibt sich daraus, dass im Jahr 2020 gegen- Eine aktuelle Möglichkeit der Positionierung in
über 1990 mit einer Minderung im Umfang von rund Sachen Klimaschutz wurde im Dezember 2017 verge-
31 bis 35% zu rechnen ist. ben. Der französische Präsident Macron hatte anläss-
Der Grund für die gegenüber den Abschätzungen lich des zweiten Jahrestages der Pariser Beschlüsse
aus dem Projektionsbericht 2017 größere Klimaschutz- zu einem Klimagipfel (One Planet Summit) wiederum
lücke 2020 liegt an vier zentralen Rahmenannahmen:1 nach Paris eingeladen, um den internationalen Kli-
maschutzbemühungen mit der griffigen Formel Make
–– Das Wirtschaftswachstum in Deutschland wird bis the climate great again jenseits der formalen Ver-
2020 vermutlich höher sein als zunächst erwartet. tragsstaatenkonferenzen Schwung zu verleihen. Das
–– Die Bevölkerung in Deutschland wird 2020 vermut- Treffen, an dem mehr als 50 Staats- und Regierungs-
lich höher sein als zunächst erwartet. chefs, aber auch zahlreiche Unternehmen teilnah-
–– Die CO2-Zertifikatspreise werden 2020 vermutlich men, fand ohne Beteiligung der deutschen Kanzlerin
niedriger sein als zunächst erwartet. statt, nicht zuletzt sicher aufgrund der zu dem Zeit-
–– Der Ölpreis wird im Jahr 2020 vermutlich niedriger punkt noch nicht abgeschlossenen Regierungsbil-
sein als zunächst erwartet. dung in Deutschland und der damit nur eingeschränk-
ten Handlungsfähigkeit. Damit wurde aber eine große
Hierdurch ist wachstumsbedingt aber auch aufgrund Chance vertan, mit Frankreich und Deutschland eine
fehlender ökonomischer Anreize von einem höhe- starke Pro-Klimaschutz Allianz aus Europa herauszu-
ren Energiebedarf als erwartet und damit tendenziell bilden, Motorenfunktion wahrzunehmen und gemein-
emissionssteigernden Effekten auszugehen. sam eine wichtige Mittlerrolle zwischen den Ländern
des Südens, den Schwellenländern und den weiter
WAS IST ZU TUN? entwickelten Ländern zu übernehmen.
Will Deutschland seinen guten Klimaschutzna-
Das Nichterreichen des Klimaschutzziels 2020 wirkt men wieder herstellen, erfordert dies sicher substan-
sich substanziell auf die internationale Glaubwürdig- zielle Signale der neuen Regierungskoalition, maßgeb-
keit der Bundesregierung und Kanzlerin Merkel aus. liche (!) Schritte zum Schließen der Klimaschutzlücke
Der Vorreitereffekt Deutschlands ist nicht weiter gege- umzusetzen zu wollen, mindestens aber deutlich zu
1
Der Projektionsbericht ist zwar erst im Frühjahr 2017 erschienen,
machen, wie man auf den notwendigen Klimaschutz-
seine Rahmendaten zu Bevölkerung, Wirtschaftswachstum, Roh- pfad zurückkehren will und bis 2030 weitergehende
stoff- und CO2-Preisen basieren jedoch auf älteren Empfehlungen
(aus dem Juni 2016) der EU-Kommission zur Erstellung der Projekti-
Ziele realistisch erreichen kann (maßnahmenunter-
onsberichte (vgl. Agora Energiewende 2017). stützter Pfad).
12 ifo Schnelldienst 1 / 2018 71. Jahrgang 11. Januar 2018Sie können auch lesen