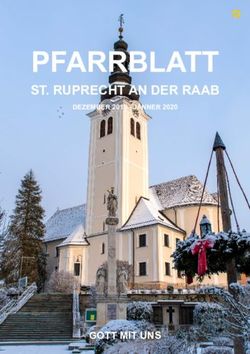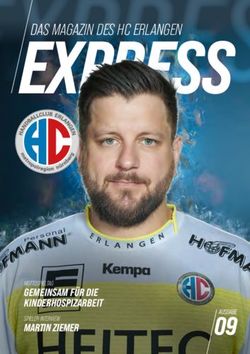Machtstreben und Aggression - unterschätzte Aspekte in der psychotherapeutischen Behandlung der Hysterie - ResearchGate
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Machtstreben und Aggression –
unterschätzte Aspekte in der psychotherapeutischen
Behandlung der Hysterie
Georg Juckel1, Paraskevi Mavrogiorgou1
Abstract
Striving for power and aggression – underestimated aspects in the psychotherapy of hysteria
Question: For decades hysteria has been psychodynamically interpreted sexualized as part of
a frustrated desire with a depressive core. However, this „victim“ side should be faced with the
other often hidden aspects of hysteria with aggression and striving for power.
Method: The basic hypothesis pursued here is that the hysterical/histrionic person was not
primarily „disadvantaged“ in his or her development, but that his or her striving for power
and thus his or her potential for aggression is to be understood above all as a learned mode of
global relationship that the adolescents have learned to respond and assert themselves to an
intra-familiar situation of tension and pressure.
Results: Any therapy that does not take this sufficiently into account falls short and reinforces
the underlying mechanism of the therapeutic relationship dynamics. During treatment the
patient must increasingly feel how much destruction and loneliness this global relationship
implies.
Discussion: Only if the patient experiences that reduction of dominance and self-reference as
well as increase of „true“ felt empathy lead to more satisfying relations, the „imprisonment“
in hysterical mode can be gradually lifted.
Z Psychosom Med Psychother 67/2021, 21–35
Keys words
Hysteria – Aggression – Power – Empathy – Psychotherapy
Zusammenfassung
Fragestellung: Seit Jahrzehnten wird die Hysterie psychodynamisch sexualisiert im Rahmen
eines frustrierten Begehrens mit depressivem Kern gedeutet. Dieser „Opfer“-Seite sollten
jedoch die weiteren oft versteckten Aspekte der Hysterie mit Aggression und Streben nach
Macht gegenübergestellt werden.
Methode: Es wird hier die grundsätzliche Hypothese verfolgt, dass die hysterische/histrionische
Person in ihrer Entwicklung nicht primär „benachteiligt“ worden ist, sondern dass ihr Streben
nach Macht und damit ihr Aggressionspotential vor allem als ein gelernter Modus des Welt-
verhältnis zu verstehen ist, dass die Heranwachsenden auf eine innerfamiliäre Spannungs- und
Drucksituation gelernt haben, so zu reagieren und sich zu behaupten.
1 Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Präventivmedizin der Ruhr-Universität Bochum,
LWL-Universitätsklinikum.
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834922 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
Ergebnisse: Jede Therapie, die dies zu wenig im Blick hat, greift zu kurz und verstärkt den
zugrunde liegenden Mechanismus im Rahmen der therapeutischen Beziehungsdynamik. In
der Behandlung muss zunehmend für den Patienten spürbar werden, wieviel Zerstörung und
Einsamkeit dieses Weltverhältnis mit sich bringt.
Diskussion: Erst wenn für den Patienten erfahrbar wird, dass eine Reduktion von Domi-
nanz und Selbstbezüglichkeit sowie Zunahme „echter“ gefühlter Empathie zu für ihn be-
friedigenderen Beziehungen führt, kann das „Gefangensein“ im hysterischen Modus stück-
weise aufgehoben werden.
1. Einleitung2
Die Geschichte der Hysterie ist lang, schon in der Antike nahm man an, dass Frauen mit
auffallenden, oftmals mit exaltierten Verhaltensweisen (z. B. „Besessenheit“) Probleme
im Bereich des weiblichen Hormonzyklus, einschließlich einer zunehmenden Ver-
selbstständigung der Gebärmutter aufweisen würden. Diese männerdominierte Blick-
weise zieht sich dann über die Historie bis hin zu den in „Trance“ und mit motorischen
Äußerungen (Arc de Cercle, Lähmungen etc.) („dissoziativen Zuständen“) auffallende
„junge Fräuleins“ im 19. Jahrhundert, also in Freuds Zeit (Breuer u. Freud 1893). Ver-
ursachung sei die „mangelnde Zähmung der Gebärmutter“ durch Geschlechtsverkehr
einerseits, durch Austragung von Schwangerschaften andererseits. Auch heute könnte
man meinen, bei vielen alleinstehenden Frauen, die sich in der Arbeitswelt behaupten
oder gar in Führungspositionen befinden, dass Männer in diesen Konstellationen
Frauen eher als „hysterisch“, in ihrem Verhalten als nicht passend, schwierig in der
Kommunikation erleben. Fraglich ist zunehmend geworden, inwiefern die „Sexuali-
sierung“ der Hysterie heutzutage oder auch schon früher tatsächlich den Kern dieser
Verhaltensweise erfasst hat. Wäre die Hysterie nur ein spezifischer Blick „des Mannes“
auf „die Frau“ (überhaupt oder in spezifischen öffentlichen Situationen), dann wäre
dies eine eher rein gesellschaftstheoretische Fragestellung. Oder die Hysterie steht
für das intrapsychische Phänomen, wie der einzelne mit Gefühlen der Unterlegen-
heit umgehen kann. Dabei könnte es sein, dass das organhafte Geschehen der Hyste-
rie in verschiedenen Körperregionen, unter anderem auch im Bereich der sexuellen
Funktionsfähigkeit, nur akzidentell als Ausdruck dieses Grundgeschehens anzusehen
ist. Dann würde die „Ovarienpresse“ von Charcot oder die „Verführungstheorie“ von
Freud mit dem heimlichen Verlangen „junger Fräuleins“ nach der „Vereinigung mit
dem Vater“ sich einmal mehr als unzureichend erweisen. Und es ist für das heutige
Verständnis entscheidend, dass sich Hysterie gleichermaßen und grundsätzlich auf
beide Geschlechter bezieht, da es sich um die geschlechtliche Unsicherheit in der
weiblichen und männlichen Entwicklung im Hinblick auf die Notwendigkeit, zu tri-
angulären Beziehungen befähigt zu werden, bezieht.
2 Die korrekte Genderung bezüglich der Personen mit Hysterie ist schwierig. Wir haben uns
daher entschieden, je nach Kontext, die jeweils passende Bezeichnung zu wählen. Aber es
sind jeweils auch andere Geschlechtsformen selbstverständlich mit gemeint.
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 23
2. Zwei Seiten der histrionischen Persönlichkeitsstörung
Die Hysterie beziehungsweise heute die sogenannte histrionische Persönlichkeits-
störung (beides soll hier synonym gebraucht und verstanden werden) als Cluster B-
Störung mit der spezifischen Problematik im Bereich der Impulsivität, aber auch eines
schwachen Selbst (Kohut 1977), die sich im Gegensatz zur narzisstischen Persön-
lichkeitsstörung eher stärker in agierender Dramatik ausgestaltet, ist über die letz-
ten Jahrzehnte primär als ein eher „Mitleid erregendes, störendes Krankheitsbild“
in der Literatur dargestellt worden. Das Fehlen des Echten, die ewige Sehnsucht,
im Mittelpunkt zu stehen, der oftmals hilflose oder nervige Versuch, sich Gehör zu
verschaffen, beziehungsweise die Dinge/Situationen auf sich beziehend zu gestalten,
sowie der vermutete „Kern“ der Hysterie in der Depression – denn die Hysterie als
Abwehrverhalten müsse aus einem tiefen Urgrund der Verzweiflung und Minder-
wertigkeit (Adler 1924) kommen – greift unseres Erachtens zu kurz. Dann würde
man noch heute entwicklungspsychologisch unterstellen, dass Mädchen und Jun-
gen unterschiedlich erzogen werden, Mädchen grundsätzlich benachteiligt würden
und der ihnen dann immer stärker bewusstwerdende Schwäche und Ohnmacht
nur in „hysterischen/histrionischen“ Verhaltensweisen Ausdruck verleihen könn-
ten. Grundsätzlich könnte dieser Mechanismus aber auch auf Jungen in ähnlichen
biographischen Situationen und Konstellationen zutreffen (Schmidbauer 1999). Die
Frage wäre also, ob die sogenannte Triangulierung und die „Urszene“ mit Vater und
Mutter weiter hinreichend ist, diese spezifische Verhaltensform auch in ihrer Psycho-
pathologie ausreichend zu erklären. Es scheint auch so zu sein, dass hier eine in
unseren Fachgebieten immer wieder verbreitete eher an einem „Defizit“ orientierte
Sichtweise auf Krankheiten mit hereinspielt. Der Patient „könne gar nicht anders
sich verhalten als“, „er habe aufgrund seiner biographischen Konstellation gar keine
andere Chance als“ und ähnliches verdeckt die Möglichkeit, dass psychopathologische
Phänomene wie hier das hysterische Verhalten auch eine positive Ressource, eine von
dem speziellen Individuum gelernte Möglichkeit und Fähigkeit, mit der Welt und
anderen Personen umzugehen, darstellt. Dann stellt die Hysterie auch eine Macht
dar, dann gibt es eben auch die Waffen einer Frau/eines Mannes im Rahmen der
Hysterie. Und vielleicht leidet die/der Hysteriker auch nur daran, dass er mit dem
Einsatz dieser Waffen nicht immer erfolgreich ist. Vielleicht leidet die Umgebung
durch die Versuche dieser Person, die Macht an sich zu ziehen, und beginnt diese
dann kritisch anzugehen, sie auszugrenzen und mit dem normativen Begriff einer
Persönlichkeitsstörung zu belegen. Und vielleicht macht das auch therapeutisch mehr
Sinn, die Patienten dort abzuholen, wo sie wirklich stehen, sie wollen in der Regel die
Familiensituation dominieren, nur so können sie ihr intrapsychisches Gleichgewicht
aufrecht erhalten, sie streben nach Erfüllung ihrer Interessen und Anerkennung,
so wie es im Grund eigentlich alle Menschen tun, jedoch tun sie es nicht offen und
transparent, sondern agieren, arbeiten mit Kulissen und List und Tücke sowie Dra-
matik und „Bühnennebel“. Der hier wesentliche Aspekt der Hysterie ergibt sich
aus dem ständigen Geltungsdrang, nämlich dem Streben der hysterischen Person
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834924 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
nach Macht in einer für diese Person relevanten personellen Konstellation, in der
Regel in der Familie beziehungsweise bei Freunden oder im Berufsalltag. Es ist ein
Modus des Weltverhältnisses, der durch Kampf und Aggressivität gekennzeichnet
ist. Diese Seite der Hysterie ist in der Literatur bislang fast gänzlich unberücksichtigt
geblieben, obgleich Mentzos (1980) früh in einer Anmerkung in seinem klassischen
Hysterie-Buch darauf hingewiesen hat. Die klassische Hysterikerin versucht ihr Leb-
tag in der Familienkonstellation ihren Mann zu unterwerfen und benutzt dabei die
Kinder als Munition. Dabei ist ihr jedes Mittel recht. Und selbstverständlich werden
diese aggressiven Impulse innerlich nivelliert dahingehend, dass sie im Regelfall ja
benachteiligt, unterlegen, das Opfer der Familie seien (dies gilt vice versa auch für
die männliche Hysterie, die im Regelfall in der Konstellation mit der Mutter dieses
Verhaltensmuster lernt bei einem hier immer als schwach vorausgesetzten Vater, und
ausgestaltet in einem exaltiert-homosexuellen oder eher depressiven Modus (siehe
Sartre 1977: Flaubert als „Idiot der Familie“)).
Die Annahme ist also hier, dass die hysterische/histrionische Person in ihrer Ent-
wicklung nicht primär nur allein durch eine Benachteiligung gekennzeichnet ekenn-
zeichnet ist (natürlich ist sie es im Hinblick auf ihre Pathologie, dies ist aber auch ein
Teil der inneren Verschiebung in ihr und der äußeren Darstellungsform), sondern
dass ihr Streben nach Macht und damit ihr Aggressionspotential vor allem als ein
gelernter Modus des Weltverhältnis zu verstehen ist, dass die Heranwachsenden auf
eine innerfamiliäre Spannungssituation und permanente Druck- und Bedrohungs-
situation gelernt haben zu reagieren und sich zu behaupten. Sie haben wie so viele
intrafamiliär keine ausgeglichene und durch sichere Bindung gekennzeichnete Situ-
ation vorgefunden. Sie haben dann erfahren, dass ihr hysterisches Aggressions- und
Machtstreben bei ihnen zu einer ausgeglichenen inneren emotionalen Regulation im
Hinblick auf die Liebe der oder einer der Eltern zum Beispiel gegenüber konkurrie-
renden Geschwistern oder dem anderen Elternteil führte (s. die „kleinen Könige“ in
der Kindheit, verstärkt eventuell bei Einzelkindern). Im Gegensatz zum Beispiel zum
Sadomasochismus oder der narzisstischen Persönlichkeitsstörung wird die Hysterie
psychodynamisch vor allem als pathologische innere Organisation verstanden, in
der Größenphantasien, die um die Urszene kreisen, dazu dienen, die Trennung der
Mutter-Kind-Einheit zu verleugnen. Durch die wechselnde Identifizierung mit Vater
und Mutter überdeckt das Gefühl der Erregung die katastrophischen Ängste, die die
Abwesenheit der Mutter hervorruft. Bei Belastung und Konflikten wird dieses „innere
Theater“, also die Internalisierung einer gleichzeitig erregenden und zurückweisenden
Mutter, verbunden mit einem Versprechen, das in eine unbestimmte Zukunft verweist,
auch später immer wieder in Szene gesetzt. Die hysterische Abwehr wird dabei unter
anderem als Verneinung der eigenen Sexualität verstanden. Während bei der Hysterie
Sexualität aufgrund dieser Grundstruktur nicht wirklich eine Rolle spielt, allenfalls als
Spiel oder Machtmittel, versuchen Patienten mit sadomasochistischen Perversionen
ihren Selbstwert durch das Ausleben von Sexualität, aber unter maximaler Kontrolle
von Zurückweisung und Entwertung zu verbessern und zu stabilisieren. Auch bei
der narzisstischen Persönlichkeitsstörung spielt natürlich die Selbstwertregulation
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 25
eine große Rolle; jedoch hier sicherlich durch den Aufbau einer offensiv-aggressiven
Definitionsmacht, die sowohl in der Selbststilisierung als auch (im Gegensatz zur
Hysterie) auf der Herabsetzung der Anderen basiert.
Druck und Bedrohung durch wen und was? Eventuell durch den vermeintlich
starken Vater, den der männliche Hysteriker ausstechen wollte, um die Mutter zu er-
langen oder sie vor dem starken Vater zu schützen, und daran naturgemäß scheiterte,
oder bei der weiblichen Hysterikerin die starke, unbarmherzige, kalte Mutter, die den
Vater nicht verdient hat, und die Tochter diesen erlangen möchte, da sie die richtige
Frau für ihn sei. Oder Rettung der vermeintlich schwachen Mutter, die eventuell in
ihrer emotionalen Ambivalenz auch schon hysterisch war, damit das Kind prägte, vor
dem starken, bösen oder abwesenden Vater. Also alles Macht- und Spannungsver-
hältnisse, die möglicherweise eine zu starke beziehungsweise einseitige und schiefe
Triangulierung bewirken. Oder ist es das Erwachen des eigenen Willens/Willens
zur Macht in der Auseinandersetzung mit beiden Eltern, das Autonomiestreben
des Kindes, das im „Gebrochen-Werden“ älterer Erziehungsideale und Unterlegen-
heitsgefühl des menschlicher Nesthockers endet, und diese frühe Verwundung sich
als hysterischer Persönlichkeits- und Verhaltensstil im Kampf um Anerkennung
und Aufmerksamkeit manifestiert? Eine offene Frage muss bleiben, inwiefern ge-
netische Disposition, hirnorganische, beziehungsweise neurobiologische Faktoren
mit der Folge einer emotionalen Teilleistungsstörung (Linden u. Vilain 2011) in der
Herausgestaltung solcher Verhaltensweisen als Bedingungsfaktoren/-Konstellationen
hier mit hereinspielen: Unseres Erachtens stellt die Hysterie eine dissoziative Affekt-
störung (angeregt durch Überlegungen von Eckhardt-Henn 2004) dar, bei der der/
die Betroffene das innerliche Abgeschnittene zu seinen Gefühlen, beziehungsweise
eventuell auch das Nichtvorhandensein von Emotionen als Teil zwischenmensch-
licher Interaktionen, beständig und schmerzlich bemerkt und im Gegensatz zu den
beispielsweise defensiven Persönlichkeitsstörungen von Cluster C expressiv, offensiv,
aber auch aggressiv (über)reagiert im ewigen Verlangen, zu diesen zu gelangen; aber
es bleibt stets im instabilen „Quasi und als ob“, was eben den für die Betroffenen
unbewussten, aber einzig möglichen und temporär zufriedenstellenden Modus und
Motor der Hysterie ausmacht.
3. Die aggressive Hysterie
Bislang ist in der gegenwärtigen psychiatrischen und/oder psychodynamischen Li-
teratur wenig zu finden im Hinblick auf den/die aggressiven Hysteriker. So findet
sich in dem bekannten Buch von Fritz Riemann „Grundform der Angst“ (1961) ein
Kapitel mit dem Titel „Der hysterische Mensch und die Aggression“. Er schildert
hier, dass die Aggression beim hysterischen Menschen eher „elastisch, spontan, un-
bekümmert und oft unüberlegt, dafür weniger nachhaltend und nachtragend“ sei.
Hinzu treten „hybride Selbstglorifizierung bis zur Hochstapelei“ (an Thomas Manns
Felix Krull mahnend) sowie eine „ungemeine reizbare Empfindlichkeit gegen narziss-
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834926 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
tische Kränkungen“. Bei dieser Form der Hysterikerinnen mit Aggressionen gegen
den Partner seien „alle Männer Waschlappen und alle Frauen dumm“. Aggression
wird hier zur Geltungssucht, aber auch zur Dramatisierung benutzt. Ein wichtiger
Teil der hysterischen Aggression sei die Intrige. Ausgeprägt seien darüber hinaus
auch noch die Racheimpulse. Man würde vor Rufmord, Geschlechterhass, flammen-
der Entrüstung et cetera sich nicht zurückhalten. „Man wiederholt in ihr unbewusst
die Situation, in der man als Kind zwischen den Eltern und eventuellen Geschwistern
stand, zwischen ihnen hin und her lavieren musste, weil man von einem Elternteil
gegen den anderen oder gegen ein Geschwister ausgespielt und so zum Objekt ungelöster
familiärer Probleme gemacht wurde, zum Objekt, auf dessen Rücken die elterlichen
Konflikte ausgetragen wurden“ (Riemann 1961, S. 211/2). Diese Konstellation trägt
das Kind, die Jugendliche und später die Frau in sich und „schlägt dann zurück“.
Und das innere Wesen der Hysterikerin ist geprägt von Einsamkeit, nur ihrer Rache
verpflichtet, was man ihr angetan habe, andere Menschen sind nur die „Munition“
für diese Kämpfe, eine Stimmung des „alleine gegen den Rest der Welt“ entsteht. Und
hier ist natürlich die wirkliche Tragik der Hysterikerin, sie ist alleine und einsam,
und dies führt natürlich zu depressiven Reaktionen, die wiederum im Rahmen des
hysterischen „Schauspiels“ als entsprechende Kulisse in den verschiedenen Kämpfen
und Konstellationen genutzt werden. Und hierbei ist in der Tat die Aggression der
Ausdruck der spezifischen „Urszene“, das erwachsen gewordene Kind möchte sich
für damals rächen, es versucht über Macht, Aggression und Sadismus seine wei-
chen und schwachen Impulse abzuwerten, da es natürlich auch diese in Form von
Sehnsucht und Anlehnungsbedürfnis, Wunsch nach Nähe und so weiter hat. Und
in dieser Konstellation kommt ein spezifisch-hysterischer „gehemmt-aggressiver“
Verhaltensstil zustande: die Aggressionen der Hysterikerin sind nur selten offen,
sie versteckt sie in „Spitzen“, im Agieren und Intrigieren, im verdeckten, durchaus
aber zielgerichteten aggressiven Vorgehen. Daraus ergibt sich schon ein gutes Bild
der Macht der Hysterie, sie ist manipulativ und untergründig, nicht offen, aggressiv,
wütend und verrauchend und daher möglicherweise klarer zu begegnen, sondern
hinterhältiger mit Widerhaken, dafür umso erfolgreicher und andere Menschen über
Jahre, Jahrzehnte an sich fesselnd und abhängig machend.
In dem Aufsatz von Sigmund „Die Phänomenologie der hysterischen Persön-
lichkeitsstörung“ von 1994 wird Kraepelin zitiert mit der Aussage „Zuerst ist die
Stimmung, welche eine krankhafte Störung erkennen lässt, die Patienten werden reiz-
bar, leicht heftig, launenhaft, aus unmotivierter Ausgelassenheit verfallen sie binnen
kürzester Zeit und bei geringfügigsten Anlässen oder auch ganz ohne den selbigen ins
Zornige, Entrüstete, in bittere, weltschmerzliche oder in schwärmerisch sentimentale
Gefühlsregungen. Dazu kommt, dass der Ausdruck ihrer Gemütsbewegungen den
Charakter des Maßlosen und Exzentrischen gewinnt, während doch der wahre innere
Affekt der Kranken nicht im Entferntesten im äußerlich hoffnungslosen Schmerz, der
exaltierten Freude entspricht.“ So charakterisierte Kraepelin schon 1889 den hyste-
rischen Charakter in allen schillernden Variationen, aber er betonte eben auch die
Reizbarkeit und die aggressive Grundstimmung, die entsprechend hier mit zu Tage
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 27
treten kann. Es ist schade, dass auch ein Stück weit in der psychoanalytischen Literatur
diese aggressiven Impulse seitens des hysterischen Charakters unzureichend bis heute
Niederschlag gefunden haben. Nur in dem sehr lesenswerten Aufsatz von J. P. Haas
(1987) „Bemerkungen zum sogenannten Hysteriegefühl“ werden diese aggressiven
machtbetonten Seiten der Hysterie stärker psychodynamisch ausbuchstabiert und dar-
gestellt. Ausgangspunkt ist hier die Gegenübertragung seitens der Behandler, warum
sich so viel Unlust, Genervt-Sein und Abneigung in der Behandlung von hysterischen
Störungsbildern auf deren Seite bildet. Natürlich passiert dies zum einen, wie schon
angesprochen, innerhalb der Gegenübertragung in der Regel von Männern auf Frauen
und hier entsprechende vielleicht frühkindliche Racheimpulse der eigenen Mutter
gegenüber, aber das, was Ärzte und Behandler bei hysterischen Patienten immer
wieder irritiert und „nervt“, ist die Unechtheit der Darstellung seitens der hysteri-
schen Patienten. Haas meint damit das Unnatürlich-Sein und das nicht ganz und
gar wirklich Gemeint-sein. Und der Behandler würde inneren Ärger wegen diesem
Tarnverhalten spüren. Schon Jaspers (1913) sprach von „mehr Schein als Sein“ bei
solchen Patienten. Das Hysterie-Gefühl seitens der Behandler, was im Kern „durch
einen Zweifel an der Echtheit des Erlebens und Verhaltens eines Gegenübers“ defi-
niert ist, hat verschiedene weitere Schattierungen. Zum einen die Verwirrung und
Faszination und zum anderen die Verführung und Verwicklung sowie der Zweifel und
das Misstrauen. Hier würde „das eigentliche hysterische Erleben und Verhalten aber
erst durch den spezifischen hysterischen Modus der Konfliktverarbeitung konstituiert,
den ich in einem aktiven inter- und intrapsychischen Kampf um die Ausgleichung der
prämordialen Lebensmangel sehe. In diesem Sinne könnte Hysterie geradezu als „Que-
rulation der Liebe“ definiert werden, der Hysteriker bietet leidenschaftlich alles auf, um
etwas zu haben und verschenken zu können, wofür er begehrt und geliebt wird. Da er
aber gerade „zum Gefäß der primären Liebe (Balint) keinen Schlüssel hat“ (Jaspers
1913, S. 96), versucht der Hysteriker vorzugeben, dass „er etwas habe, was er nicht
oder niemals besessen habe“. Es ist halt eben nur „scheinbar“ und zum einen ist
hier die verzweifelte Wut und Ohnmacht des Hysterikers zu sehen, der sich und alle
anderen hasst, weil er das nicht hat, was andere haben, und dafür sein ganzes Leben
lang kämpft durch verschiedene Modi, aber eben auch mit den Waffen der Hysterie,
der Aggression und des Machtstrebens, aber gleichzeitig er zunehmend sieht, dass er
dies niemals erlangen wird, niemals zu einer Homöostase kommen wird. Er sieht sein
Scheitern, dass er schlussendlich verlieren wird, dass er niemals echte Gefühle und
Bindungen entwickeln wird; hier steckt die wahre Tragik und Trauer des hysterischen
Menschen. Und schlussendlich nennt Haas als einen weiteren Aspekt des hysteri-
schen Gefühls auch „Enttäuschung und Vergeltung“, nämlich die aggressiven Seite
des Hysterikers, „die durch diese Enttäuschung [in der therapeutischen Beziehung]
provozierte Verärgerung gibt einen wichtigen Fingerzeig auf die massive unbewusste
bereitliegende Feindseligkeit des Patienten in Folge selbsterfahrener Täuschungen und
Erniedrigungen, die er jetzt in der Rollenumkehr mit dem Arzt wiederholt“ (Haas 1987,
S. 96). Also ähnlich schon wie Riemann formulierte, eine Rache und ein Kampf auf-
grund der frühen familiären Situation kulminieren in dem gewalttätigen Aneignungs-
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834928 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
impuls: „Ich raube dir, was du hast, weil ich es nicht habe“. Und hier lauert nach Haas’
Meinung die große Gefahr in den Beziehungen mit hysterischen Menschen, seien sie
persönlicher oder therapeutischer Natur, nämlich das „Hineingerissen werden in ein
chronisches sadomasochistisches Zusammenspiel“. Und dieses sei dann eine „Neu-
auflage einer ursprünglich pathogenen infantilen Beziehung“ und dabei im Dienst
der Abwehr gegen die Angst vor Liebes-, Sicherheits- und Realitätsverlust. Und so
folgert Haas, dass „hysterische Patienten in querulatorischer Weise dem uneingelösten
Versprechen einer liebevollen Beziehung nachjagen und diese gerade immer wieder durch
den eigenen Hass und Neid an der Wurzel zerstören“ (Haas 1987, S. 97).
Im Rahmen aggressiv-sadomasochistischer hysterischer Konstellationen kom-
men zum einen spezifische Partner- und Ehebindungen mit einer symbiotischen
Anheftung der hysterischen Frauen an ihre Ehemänner (Mentzos 1973) zustande,
aber es tritt auch das Phänomen der Pseudologie als Ausdruck hochgespannter hys-
terischer Verdeckungsmechanismen auf (Henseler 1968). In der Pseudologie werden
belastende, jedoch durchaus ambivalent erlebte Ereignisse aus der Vorgeschichte ent-
stellt. Die Pseudologie ist zugleich Beleuchtung als auch lustvolles Nachleben eines
biographischen Ereignisses, so umgedeutet und erzählt in phantastischer Weise,
dass alle es so glauben und die hysterische Person dann selber auch. Es ist ein intra-
psychischer Kompromiss, der das Verbot der Erinnerung aufrechterhält, aber ein
Wiedererleben dennoch gestattet, aber jedoch auf andere Weise. Shapiro (1991) nennt
dies ein „Als-Ob-Verhalten“.
Anklänge von Machtstreben und aggressiven Impulsen bei der Hysterie finden
sich auch in dem Buch von Heinz Peter Röhr (2015), aber auch bei Alfred Adler (1924)
Bei letzterem steht jedoch immer wieder das aus Minderwertigkeit und schwachem
Selbst geborene Streben nach Geltung und Überlegenheit im Vordergrund, nicht je-
doch allzu stark die aggressiven sadomasochistischen Impulse. Von ihm stammt aber
einer der ersten entwicklungspsychologischen Entwürfe zum sogenannte „Macht-
motiv“ (Scheffer 2004): Menschen mit körperlichem, seelischem oder geistigem
„Makel“ versuchen zeitlebens diese Minderwertigkeit und Ohnmacht mit Streben
und Bedürfnis nach Macht auszugleichen. Weitere Anklänge in Richtung negativer
Affekte bezüglich Wut und Aggression finden sich bei M. Khan (2003). Aspekte der
Aggression im Sinne von Zerstörung und Selbstzerstörung finden sich auch im Buch
von L. Israel (2014) im Kapitel über den Todestrieb bezogen auf die Hysterie, aber
auch in dem Kapitel „Die Hysterie ist ein Kampf “. Interessanterweise eröffnet Israel
hier die Diskussion, dass bei der Hysterie – ähnlich wie bei der Depression – die
Aggression nicht wirklich nach außen gelangt, sondern dass der hysterische Patient/
Patientin Aggressionen gegen sich selbst im Sinne der Suizidalität, Suizidversuch oder
gar vollzogenen Suizid vollzieht. Wobei appellative Formen von Suizidalität sicherlich
häufiger vorkommen, aber vollzogene Suizide sicherlich seltener, denn dann wäre die
Inszenierung ja zu Ende, und der Hysteriker will und muss sich psychodynamisch
immer ein letztes Türchen – in der Hoffnung auf das Gelingen schlussendlich doch –
aufhalten. Zuletzt sei noch auch auf die OPD-2 (Arbeitskreis OPD 2009) verwiesen,
in deren Logik das hier geschilderte Verständnis der Hysterie eher als ein Unterwer-
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 29
fungs- als ein ödipaler Konflikt angesehen wird: Der „Machtwillen“ bei der Hysterie
ist zwar eine pathologische, aber dennoch subjektiv stärkende Ressource.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Stand der Literatur zu den aggressiven
und machtorientierten Seiten der Hysterie recht überschaubar ausfällt. Die Literatur
ist zum Teil älter, es finden sich viele Einzelfallbeobachten, nahezu keine systemati-
schen Studien, geschweige denn entsprechende neurobiologische Untersuchungen. Zu
fordern ist, dass sich die klinische Forschung insbesondere in der Psychiatrie wieder
mehr an den Syndromen und Symptomen unserer Patienten orientieren möge, und
hier insbesondere an wichtigen psychopathologisch-psychodynamischen Details,
die eben stärker Aufschluss über das zugrundeliegende Krankheitsbild des Patien-
ten geben und damit auch für die zielgenaue psychotherapeutische Behandlung von
höchster Relevanz sind. Leider bedingen unsere immer stärker formalisierten ICD-
10- und DSM-5-Klassifikationssysteme eine Vereinfachung psychopathologischer
Vielfalt, denn durch die Vereinfachung unserer Dokumentation wird leider auch
eine Komplexitätsreduktion unserer Wahrnehmung und Erfassung von psychischen
Phänomenen im Detail und ihre wirkmächtige Dynamik verursacht (Juckel 2013).
4. Die Hysterie und der Wille zur Macht
Kurz soll nicht nur vom Sprachgebrauch und von der historischen Nähe von Charcot,
Breuer, Freud und Friedrich Nietzsche her auf den von ihm geprägten Begriff „Willen
zur Macht“, den er allgemeinphilosophisch als Bedeutungs- und Geltungsstreben dar-
gestellt hat, eingegangen werden. Nietzsche selbst hatte bekanntlich ausgesprochen
starke trieb- und evolutionsbiologische Vorstellungen, dies ist zum Beispiel detail-
liert diskutiert auch im Hinblick auf die Rezeption seitens Freuds in dem Buch von
Günther Haberkamp (2000). Die insgesamt doch eher als „heroisch“ anzusehende
Darstellung des „Willens zur Macht“ bei manchen besonderen Menschen („Über-
menschen“) seitens Nietzsche hat beispielsweise Alfred Adler (1924) psychologisch
kritisiert und sieht im Willen zur Macht eine „mögliche Überkompensation eines
verstärkt erlebten Minderwertigkeitsgefühls“. Dies könnten in der Tat auch die hier
dargelegte Deutungsweisen der Hysterie, auch im Hinblick auf ihre sadistischen und
aggressiven Impulse, unterstützen. Es ist nicht das unverbrauchte infantile und in sich
stimmige Gefühl des „Ja“ zur Welt, sondern es ist das Machtstreben, welches aus der
kindlich unglücklich erlebten Minderwertigkeitssituation mit all seiner Wut Rache an
der Welt nimmt. Auf der männlich-hysterischen Seite kann es dann zum Streben nach
Macht ganz im Sinne von Vorherrschaft in Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und so
weiter kommen (s. z. B. Matussek 2001). Bei den hysterischen Frauen verläuft vieles
eher hintergründig und „häuslich“, aber dafür vermutlich umso wirkmächtiger. Auch
hier findet die Kohutsche Selbstpsychologie ihre Wahrheit: Wer wirklich souverän ist,
braucht nicht diese Form von unabdingbarer überall geltender Macht, sondern ruht
in sich selbst und herrscht durch natürliche Autorität. Die hysterische Aggression
und Machtstreben stellt auf jeden Fall eine intrapsychische Schieflage dar, die von
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834930 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
allen als solche auch wahrgenommen und gespürt wird und entsprechend abgewehrt
wird. So lässt sich auch hier nur sagen, dass sich gelingende Beziehung, gelingende
soziale Gemeinschaft mit Hysterikern – und das ist eben leider ihre Tragik – meistens
nicht etablieren lassen, sofern nicht eine tiefgreifende Psychotherapie dieses ändert.
Aber hierüber, inwiefern Psychotherapie hier spezifisch nachhaltig helfen kann, gibt
es unseres Erachtens kein belastbares Zahlenmaterial (s. auch unten).
5. „Die dunklen Seiten der Empathie“ – eine Brücke zur Hysterie?
So lautet der Titel des sehr lehrreichen Buches von Fritz Breithaupt (2017), in dem ein
bislang psychologisch und moralisch hoch besetzter Begriff gegen den Strich gelesen
und seine Schattenseiten dargestellt werden. Ähnlich wie bei er Hysterie, in der man
bislang auch eher den anrührenden, Mitleid erregenden Kern gesehen hat, hat auch
die Empathie ihre dunklen Seiten: „Wir tun Schreckliches mit und aus Empathie“.
Und bei der Hysterie ist sicherlich von vornherein ein Empathie-Defizit zu sehen.
Oder doch nicht, beziehungsweise gibt es hier eine verborgene Brücke zwischen Hys-
terie und Empathie? Denn nach Breithaupt kann Empathie zum Selbstverlust führen.
Empathie tendiert zu einem Schwarz-Weiß, beziehungsweise Freund-Feind-Denken,
da wir aufgrund von Empathie einseitig Partie ergreifen. Empathie wird allzu oft mit
bloßer Identifikation verwechselt, sprich mit dem Retter sich identifizieren, statt mit
dem Opfer mitzufühlen. Empathie kann dazu führen, dass wir mit dem Schmerz
mitfühlen können, aber auch in der sadistischen Weise, dass wir es genießen, wenn
andere leiden durch Schmerzen, Strafen, Demütigungen, Bloßstellungen und ähnli-
ches. Kann es sein, so fragt sich Breithaupt, dass „ein Sadist den Schmerz eines anderen
wünscht oder herbeiführt, um dann mit ihm mitfühlen zu können“ (Breithaupt 2017,
S. 23): „Extreme Handlungen von Grausamkeit verlangen einen hohen Grad von
Empathie“ (Hannibal Lector)“. Benutzt ein Hysteriker also andere, manipuliert und
drangsaliert sie, um sich empathisch in diese und ihre Situation einzufühlen und sich
in und mit diesem Mitleiden zu stabilisieren oder gar libidinös zu stimulieren? Und
die letzte These von Breithaupt führt den Zusammenhang zur Hysterie noch stärker
vor: Er findet die „gefährliche Variante von Empathie“ „in Formen des Vampirismus,
wenn ein Mensch mittels anderer sein Erleben zu erweitern sucht“, spricht Empathie
kann bestens zur Manipulation anderer benutzt werden. Hysteriker tun genau das,
sie benutzen andere, um ihre Machtinteressen zu verfolgen, aber auch darüber Glanz
und Selbstbestätigung zu erhalten. Also nicht durch sich und das eigene So-Sein, son-
dern instrumentalisiert über andere. Und dabei, so ist die These hier, ist ihnen jedes
Mittel recht, sie gehen (versteckt) aggressiv und zum Teil sadistisch vor, die anderen
sind nur Mittel zum Zweck. Dies kann als eine in der Kindheit gute gelernte Über-
lebens- beziehungsweise erfolgreiche Lebensstrategie von Hysterikern angesehen
werden. Sie haben so gelernt, sich und ihre Interessen durchzusetzen, aber um den
Preis der Einsamkeit, des Unechten und der Emotionslosigkeit. Breithaupt stellt eine
Entwicklungskaskade vor, in der das emotionale Verstehen anderer, sprich Empathie,
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 31
zunehmend psychologisch an Sadismus, Manipulation und Unterdrückung gekoppelt
ist. Dieses „Schema des Erlernens sadistischer Empathie offenbart die Attraktion, die
für einen Menschen darin liegen kann, Empathie mit Sadismus zu verbinden. Das Kind
selbst kann in jedem Schritt dieses Lernprozesses Freude und Lust empfinden und wird
somit schnell für seine Taten belohnt“ … „Sadistische Empathie bietet hier also einen
Lern- und Souveränitätsvorteil gegenüber der altruistischen Empathie“ (S. 184). Warum
sollten also Hysteriker ihre erfolgreiche Lebensstrategie der Manipulation, der Aggres-
sion, des Machtstrebens, des sadomasochistischen Agierens ändern, wenn sie sozial
und libidinös so gut auf ihre Kosten kommen? Dafür spricht nicht viel, allenfalls die
von ihnen gespürte Leere und Unerfülltheit, dass sie nicht das Gefühl haben, in sich
zu ruhen und im vollen Sinn für sich und andere da zu sein. Hier wäre dann in der
Tat Leidensdruck und Änderungsmotivation gegeben.
6. Implikationen für die psychotherapeutische Praxis
Aus dem Bisherigen ist deutlich geworden, dass es dringlich geboten ist, in psycho-
therapeutischen Behandlungen diese dunkle Seite der Hysterie, ihre Neigung zu
Aggression und Machtstreben, mitzudenken, im Einzelfall gewahr zu werden und
zu bearbeiten. Es ist zu vermuten, wenn dies zu wenig geschieht, bleibt die Therapie
oberflächlich, zieht sich hin und wird nicht erfolgreich enden, da eine Kernthematik
verpasst wurde, denn bei der Hysterie scheint Aggression und Sadismus ein „Lebens-
elixier“, eine existenziell wichtige Lebensstrategie zu sein. Damit würde man dem
Patienten seine heimliche, nicht besprochene „innere Bühne“ lassen, das depressive
Element im Sinne des „Opfers“ wäre die Facette, mit der der Patient sich den The-
rapeuten „vom Leibe halten“ könnte. Dreh- und Angelpunkt des hier vertretenen
Verständnisses von Hysterie und histrionischer Persönlichkeitsstörung ist bezüg-
lich der Behandlung das Wahrnehmen und Konzentrieren auf diesen „aggressiven
Kern“. Und genauso wie Breithaupt für die Schattenseite der Empathie aus Gründen
der Komplexitätssteigerung dennoch fordert, Empathie zu lernen, denn das würde
zur Verbesserung der Wahrnehmung sozialer Situationen und zur Intensivierung
seines emotionalen Erlebens führen (Breithaupt 2017, S. 210), so sollte Aggression bei
der Hysterie als erfolgreiche Lebensstrategie in diesem Zusammenhang vorsichtig
thematisiert werden – und nicht außer Acht gelassen werden, dass der Betroffene
einsam und allein bleibt und in der Suche nach seinem inneren Wesen erfolglos. Nur
im Ansprechen dieser Ambivalenz kann dann beim Betroffenen das Leiden spürbarer
werden und Änderungsmotivation entstehen.
Der Patient sollte also dort abgeholt werden, wo er steht. Seine Einsicht in die
hier geschilderten Aspekte und Mechanismen wird gering sein. Bions Containing
(Cartwright 2009) wird zunächst nicht nur zu Beginn der Grundmodus für lange Zeit
sein, in dem Vertrauen, Beziehung wachsen kann, um dann in ersten behutsamen
Deutungen der Konfliktdynamik auf diese Problematik einzugehen, von der der Pa-
tient scheinbar bislang profitiert hat, aber dadurch keine wirklich zufriedenstellende
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834932 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
psychische Lösung gefunden hat. Hier wird die Analyse vieler Lebenssituationen
im Mittelpunkt stehen, um zunehmend die Einsicht zu erzeugen, alternative Denk-
und Verhaltenswege aufzuzeigen und echte und nicht nur reaktive Emotionen sich
entwickeln zu lassen. Im Rahmen der familiären Konstellation muss dem Patienten
deutlich werden, wie und warum er „seine Hysterie“ gelernt hat, wie und wann er des-
wegen Formen der Manipulation und Aggression anwendet. Es muss dem Patienten
auch emotional spürbar werden, wie stark er versucht, seine Familie oder einzelne
Familienmitglieder zu dominieren, wie stark er alle seine Beziehungen bestimmt und
wieviel Leid, Brutalität und negative Erfahrungen dies für die anderen mit sich bringt
und im Grunde dann auch für ihn selber. Es muss auch deutlich werden, wie stark
dieses Störungsbild nicht nur ihn selbst, sondern auch zum Beispiel die nachfolgende
Generation, die Kinder, in ihrer Persönlichkeitsstruktur und ihren Verhaltensweisen
prägt und zermürbt. Ziel der Therapie für den Patienten, aber eben auch für sein
Umfeld, kann nur das allmähliche Erarbeiten eines Gleichgewichts von Emotionen
bei ihm sein. Geduldiges langes Üben und Besprechen, Wahrnehmen üben, Gespür
für soziale Situationen entwickeln, sich und seine Intention prüfen, Verhaltensweise
bewerten, Alternativen dazu entwickeln, ausprobieren und Erfolge des besseren und
befriedigenderen Miteinanders sehen. Dazu passen die Ausführungen von Scheffer
(2004): Er geht von der Ansicht Adlers aus, dass „es ein natürliches Streben nach
Überlegenheit und ungehemmtem Ausleben eigener Bedürfnisse gibt, welches jedoch
durch eine soziale Orientierung ausbalanciert werden muss … Die Duldung der Im-
pulse von Kindern durch die Mütter, die normalerweise unterdrückt werden, scheint
also eine Quelle des Machtmotivs zu sein „… Diese Duldung bezieht sich dabei … auf
aggressive Verhaltensweisen, welche sich gegen die Eltern und auch gegen Geschwister
richten … Hieran zeigt sich, dass nicht die frühe Förderung von oder Stimulation mit
machtbezogenen Inhalten für die Motivgenese wicht ist, sondern enger die mütter-
liche Nachgiebigkeit. Letztere kann man auch als eine mangelnde Befriedigung eines …
Bedürfnis von Kindern nach klarer Hierarchie von Seiten der Eltern interpretieren“
(Scheffer 2004, S. 38). Das heißt, Kinder streben natürlicherweise nach Macht, Ein-
fluss und Beachtung. Sie setzen auch aggressive, sich selbst behauptende Strategien
ein. Wenn Kindern nicht rechtzeitig Grenzen und klare Strukturen entgegengesetzt
werden, könnte diese mangelnde Formung kindlicher Impulse Quelle hysterischer
Verhaltensweisen sein. Aber gerade im 19. Jahrhundert, der „Geburtsstunde der
Hysterie“, waren in den Familien soziale Kontrolle, klare Hierarchien und so wei-
ter durchaus stärker – als heute – ausgeprägt. Oder gerieten die vom libidinös ge-
triebenen Vater „verhätschelten jungen Fräuleins“ zu Hause „außer Rand und Band“,
so dass sie von den Müttern, die ja eh nur als „lästige Konkurrentinnen“ bezüglich
des Vaters gesehen wurden, kaum mehr zu stoppen waren? Zudem wird sich diese
Problematik durch die häufige Abwesenheit des Vaters, in der damaligen Zeit nicht
ungewöhnlich, und damit Distanz und Unnahbarkeit, verstärkt haben. Anthropo-
logisch finden sich bei Töchtern verstärkt in Haushalten ohne beziehungsweise mit
selten auftretendem Vater frühes Interesse an Sexualität und sexuellen Aktivitäten,
negative Attitüden gegenüber Männern und verminderte Fähigkeiten, längere und
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 33
stabile Beziehungen zu einem Mann aufzubauen (Draper 1982). Für die psycho-
therapeutischen Bemühungen heißt das je nach psychotherapeutischer Methode,
dass primär eine Nach-Parentisierung mit Verstehen und Lernen von Grenzen und
Strukturen stattfinden muss. Der Patient muss hier lernen, klare Spielregeln in Situa-
tionen zu akzeptieren, sich zurückzunehmen und dass ein In-die-Schranken-weisen
keine Zurücksetzung und Kränkung bedeutet.
Ist nun bei der Hysterie ein Zuviel oder Zuwenig an Empathie vorhanden? Im
Sinne von Breithaupt könnte es eher ein Zuviel an „sadistischer Empathie“ sein, der
Versuch, über ein scheinbares Einfühlen in den anderen und Mitleiden das eigene
Selbst zu spüren, zu stabilisieren und damit die eigenen Interessen zu verfolgen.
Das Ein- und Mitfühlen ist aber nur scheinbar, denn dem hysterischen Menschen
ist eine wirkliche, echte Fähigkeit von Empathie und sozialer Kognition aufgrund
seiner psychischen Struktur versagt. Er ist immer nur bei sich, ein wirkliches „Über-
steigen“ zu anderen – und das ist die Tragik seiner Einsamkeit – gelingt ihm nicht,
nur ein taktisches „als ob“, das merkt der andere, aber auch er selber. Hier psycho-
therapeutisch mit Training sozialer Fähigkeiten, insbesondere von Empathie und
sozialer Kognition, mit den entsprechenden Programmen begleitend zu beginnen,
wäre durchaus sinnvoll. Dadurch könnte der Betroffene lernen, soziale Situationen
und Wirklichkeit besser wahrzunehmen und auch Mitgefühl für andere im positi-
ven Sinn in sich zu wecken. Und ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Einsamkeit und
Isolation des hysterischen Patienten: wenn diese ihm klar bewusst wird, besteht die
Chance und Motivation für eine tiefgreifende existenzielle Änderung (Fromm-Reich-
mann 1959; Yalom 2010).
Insgesamt sind die ausgeprägten, das heißt aggressiven Formen der Hysterie eine
besondere Herausforderung für Therapeuten. Wichtig ist sicherlich, dass nicht un-
bedenklich und unreflektiert verschieden Psychotherapie-Methoden, zum Beispiel
VT und TP, gemischt werden, weil das für den Therapieverlauf und den Patienten
schädlich und riskant sein kann. Aber eher VT-geprägte Strukturierung und Konfron-
tation könnte, bei gleichzeitigem Aufrechterhalten von Empathie und Verständnis,
hilfreich in der Gesamtbehandlung sein. Es geht um beides, den affektiv-emotional
und auch kognitiven Zugang mit histrionischen Patienten zu erarbeiten, und prag-
matische Ansätze wie einfache „Schemata“ können für die Patienten manchmal zu-
gänglicher und damit auch nützlicher sein (Juckel 2018). Man kann als Therapeut die
Rolle des „Opfers“ annehmen, im Containing versuchen, vieles der Inszenierungen
erstmal nur aufzunehmen, auszuhalten und „zu schlucken“. Nach erfolgreichem Be-
ziehungs- und Vertrauensaufbau beginnt oft über viele Jahre vorsichtig die Deutung,
die immer wieder durch Krisen des Patienten und in der Übertragungsbeziehung
unterbrochen wird. Hier Geduld zu bewahren und das Ziel nicht aus dem Auge zu
verlieren, ist oftmals schwer. Oftmals werden Emotionen wie „Verliebtsein“ in den
Therapeuten/die Therapeutin angeboten und Sexualität als „Waffe“, als Spiel der
Verführung oder zum Zwecke der Verführung eingesetzt. Dies verlangt eine starke
Kontrolle und Durchdringung der eigenen Gegenübertragung, aber auch Reflexion
der eigenen regressiven Wünsche, die in Form der „Sexualisierung“ des Patienten
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-834934 G. Juckel und P. Mavrogiorgou
abgewehrt werden. Beginnt man, den angebotenen „Kampf “ an- und aufzunehmen,
kann man sich schnell in die sadomasochistischen Facetten der Hysterie verstricken.
Natürlich ist alternativ daran zu denken, dass histrionische Personen Sexualität auch
als „Gegenleistung für Liebe“ ödipal-regressiv benutzen (Hoffmann 1984), was aber
ebenfalls ein instrumentelles Moment beinhaltet. Diese Modi immer wieder zu ver-
stehen und zu deuten, ist die große Kunst in der psychotherapeutischen Behandlung
der Hysterie, denn der Patient/die Patientin wird gerade dieses – aus gutem Grund –
immer wieder verweigern und mit „großen“ Emotionen und Krise drohen. Aber nur
auf diesem Weg kann das Ziel der Behandlung verfolgt werden, nämlich die langsame
Reduzierung des Machtstrebens und das Raumeinnehmen in sozialen Situationen,
welches in der Regel (versteckt-) aggressiv und auch zum Teil sadistisch in Form des
scheinbaren Masochismus verfolgt wird. Denn eines darf man in der Behandlung
nie vergessen: ein Teil der Hysterie besteht aus dem beschriebenen Machtstreben,
oftmals mit erheblichen Folgen für die Familie auch noch in der zweiten und drit-
ten Generation. Und in der therapeutischen Beziehung wird dies reaktualisiert, und
wenn diese tatsächlich gut ist, spürt der Therapeut in der Tat diese starken Aggres-
sionen. Aber das ist im Wesentlichen sein Material, was in gelungener Bearbeitung
dann aber auch gleichzeitig sein Schlüssel zum psychotherapeutischen Erfolg in der
Behandlung der Hysterie sein kann.
Literatur
Adler, A. (1974 [1927]): Menschenkenntnis. Frankfurt a. M.: Fischer.
Arbeitskreis OPD (2009): Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik OPD-2. Bern:
Huber.
Breithaupt, F. (2017): Die dunklen Seiten der Empathie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Breuer, J., Freud, S. (1991 [1893]): Studien über Hysterie. Frankfurt a. M.: Fischer.
Cartwright, D. (2009): Containing States of Mind: Exploring Bion’s ‚Container Model‘ in Psy-
choanalytic Psychotherapy. Oxford: Routledge.
Draper, P. (1982): Father absence and reproductive strategy: an evolutionary perspective. J An-
thropol Res 38, 255–273.
Eckhardt-Henn, A. (2004): Dissoziative Störungen des Bewusstseins. Psychotherapeut 1, 55–66.
Fromm-Reichmann, F. (1959): Über die Einsamkeit. In: Psychoanalyse und Psychotherapie.
Stuttgart: Klett-Cotta.
Haas, J. P. (1987): Bemerkungen zum sogenannten „Hysteriegefühl“. Nervenarzt 59, 92–98.
Haberkamp, G. (2000): Triebgeschehen und Wille zur Macht: Nietzsche – zwischen Philo-
sophie und Psychologie. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Henseler, H. (1968): Zur Psychodynamik der Pseudologie. Nervenarzt 39, 106–114.
Hoffmann, S. O. (1984): Charakter und Neurose. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Israel, L. (2014 [1983]): Die unerhörte Botschaft der Hysterie. München: Reinhardt.
Jaspers, K. (1973 [1913]): Allgemeine Psychopathologie. Heidelberg: Springer.
Juckel, G. (2013): Aufschreibprozesse in Psychiatrie und Psychotherapie. In: Wübben, Y., Zelle,
C. (Hg.): Krankheit schreiben: Aufzeichnungsverfahren in Medizin und Literatur. Göt-
tingen: Wallstein.
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Macht und Hysterie 35
Juckel, G. (2018): Ein Weg, sich „seelisch zu berühren“ – Grundzüge einer pragmatischen
Psychotherapie in der Psychiatrie (PPP): Annehmen, Zuwenden, Verstehen, Sinnfindung,
Hilfreich-Sein. In: Juckel, G, Hoffmann K, Walach, H.: Spiritualität in Psychiatrie und
Psychotherapie, S. 307–332. Lengerich: Pabst Science Publishers.
Khan, M. M. R. (2003): Der Missmut des Hysterikers. In: Erfahrungen im Möglichkeitsraum.
Psychoanalytische Wege zum verborgenen Selbst, S. 77–90. Eschborn: Klotz.
Kohut, H. (1981 [1977]): Heilung des Selbst. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Linden, M., Vilain, M. (2011): Minimale emotionale Dysfunktion und Bildung des ersten
Eindrucks bei Persönlichkeitsstörungen. Nervenarzt 82, 25–36. doi: 10.1007/s00115-010-
3160-z.
Matussek, P. (2001): Analytische Psychosentherapie. Bd. 2, Heidelberg: Springer.
Mentzos, S. (1973): Zur Psychodynamik der sog. „hysterischen“ Psychosen. Nervenarzt 44,
285–291.
Mentzos, S. (1980): Hysterie. Zur Psychodynamik unbewusster Inszenierungen. München:
Kindler.
Riemann, F. (1961): Grundformen der Angst. München: Reinhardt.
Röhr, H. P. (2015): Die Angst vor Zurückweisung. München: dtv.
Sartre, J. P. (1977): Der Idiot der Familie: Gustave Flaubert 1821–1857. Hamburg: Rororo.
Shapiro, D. (1991): Neurotische Stile. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Scheffer, D. (2004): Entwicklungsbedingungen impliziter Motive: Bindung, Leistung und Macht.
Dissertation Universität Osnabrück. Göttingen: Hogrefe.
Schmidbauer, W. (1999): Der Hysterische Mann – Eine Psychoanalyse. München: Nymphen-
burger.
Sigmund, D. (1994): Die Phänomenologie der hysterischen Persönlichkeitsstörung. Nerven-
arzt 65, 18–25.
Yalom, I. D. (2010): Existenzielle Psychotherapie. Bergisch Gladbach: EHP.
Korrespondenzadresse: Univ.-Prof. Dr. med. Georg Juckel, Ärztlicher Direktor des
LWL-Universitätsklinikums Bochum der Ruhr-Universität Bochum, Alexandri-
nenstr. 1–3, D-44791 Bochum, E-Mail: georg.juckel@rub.de
© Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen, 2021, ISSN 2196-8349Sie können auch lesen