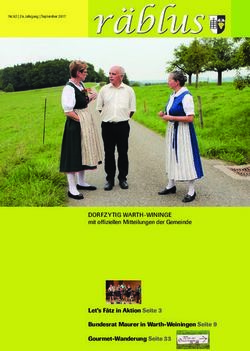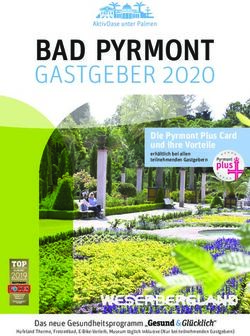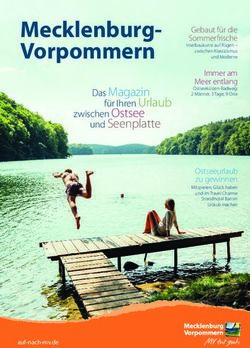Naturschutz ohne Grenzen - 2017 | 2018 - Nabu
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2017 | 2018 Naturschutz ohne Grenzen Die internationale Arbeit des NABU und der NABU International Naturschutzstiftung
Inhaltsverzeichnis
GRUSSWORT 5 EUROPA
Emissionen runter! 45
AFRIKA Es lebe das Land! 46
Mehr als zehn Jahre NABU in Äthiopien 7 Rauchende Schlote 47
Naturschutz macht Schule 8 Rettungsinseln für Zugvögel 48
Zugvogelforschung im digitalen Zeitalter 10 Mit dem Rucksack in die Ferne 49
Wissensspeicher und Kräuterapotheke 11 Naturschützer und Grundeigentümer im Schulterschluss 50
Umweltbildung auf Äthiopisch 12
Ein Ranger erzählt 13 KAUKASUS
Zwischen Pfeffer und Kurkuma 14 Alles bio – echt jetzt! 53
Erfolgreicher Löwenschutz 15 Bilder, die Atem rauben – Die raue
Liberia – der lange Weg zum Gemeindewald 16 Schönheit des Westkaukasus 54
Afrikas Geiern auf der Spur 18 Das Drama im Wald 56
Aus dem Alltag eines Ornithologen 19
Waldschutz in Kenia 20 WELTWEIT
Kraniche in Ostafrika – Dramatischer Schwund 21 Hoffnung für die seltensten Delfine der Welt 59
Auffangstation für den Grauen Kronenkranich 22 Wildes Kuba 60
Zwei Länder, zehn Tage und tausende Erkenntnisse 23 Bunt, nützlich, bedroht 61
Moorschutz wirkt 63
ASIEN
Wiederentdeckt und geschützt 25 Herausnehmbare Weltkarte in der Heftmitte
Berge, Weiden, Yaks 26
Grenzen überwinden 28 DANKSAGUNG 65
Schneeleos wilde Nachbarn 29
Schneeleoparden brüllen nicht, wir hören sie trotzdem 30 IMPRESSUM 66
Verantwortung übernehmen 31
Trompeter der Lüfte 35
Inventur im Riff 37
Wirtschaft stärken und Elefanten schützen 38
Vierbeinige Helfer 41
Ökostrom für Makarti Jaya 42
Indikatoren des Waldzustands 435
Thomas Tennhardt
NABU-Vizepräsident, Leiter Fachbereich Internationales und
Vorsitzender der NABU International Naturschutzstiftung
Liebe Freunde und Unterstützer der internationalen Arbeit,
liebe NABU-Aktive,
Europa erlebt einen dramatischen Verlust an Arten und Le- halbe Strecke bis 2020 ist geschafft, die Verbreitungsländer
bensräumen. Hauptverantwortlich dafür ist die fehlgeleitete haben bisher 23 Schneeleoparden-Lebensräume auf einer
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU, die ihre Fördergel- Fläche von knapp 500.000 Quadratkilometern identifiziert.
der – mit rund 58 Milliarden Euro jährlich immerhin rund
40 Prozent des gesamten EU-Haushalts – mit der Gießkanne 25 Jahre NABU im Kaukasus
verteilt. Pauschale Flächenprämien ohne konkrete ökologi- Bereits seit 25 Jahren engagiert sich der NABU für den
sche Gegenleistungen ermutigen die Landwirte geradezu, Schutz des Weltnaturerbegebiets „Westkaukasus“. In dieser
alles aus den Böden und den Tieren herauszuholen. Zeit haben wir, gemeinsam mit den Behörden und Natur-
schützern vor Ort, viel erreicht. Heute leben wieder über
Über zehn Jahre NABU in Äthiopien 1.200 Bergwisente im Westkaukasus. Allerdings leidet die
Nicht nur in Europa, sondern weltweit ist die biologische Region seit 2012 unter einer massiven Invasion des Buchs-
Vielfalt in Gefahr und damit auch unsere Lebensquali- baumzünslers, die Raupe hat innerhalb von nur drei Jahren
tät – denn die Natur ist Grundlage für Nahrung, sauberes nahezu den gesamten Bestand der Buchsbäume auf einer
Wasser und Energie. Eine alarmierende Entwicklung, auf Fläche von 4.000 Hektar zerstört. Auch dank der Bemühun-
die der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) im März 2018 mit gen des NABU konnten bislang 4,2 Hektar der reliktischen
Nachdruck hingewiesen hat. Zu erkennen ist dieser Trend Buchsbaumbestände erhalten werden, durch Renaturie-
auch und insbesondere in Afrika, für viele Menschen noch rungsmaßnahmen sollen langfristig weitere hinzukommen.
immer ein Idealbild ungezähmter Natur. Die Realität sieht
leider anders aus, deshalb engagiert sich der NABU auf Zehn Jahre NABU International Naturschutzstiftung
dem afrikanischen Kontinent besonders stark. Zum Beispiel Mittlerweile ist unsere Stiftung zehn Jahre alt. Aktuell
in Äthiopien, wo sich der NABU mittlerweile in allen vier engagieren wir uns unter anderem für die letzten Löwen im
Biosphärenreservaten am Management beteiligt. Über die Ngorongoro-Schutzgebiet, den Kampf gegen die Wilderei im
mehr als zehnjährige Geschichte der NABU-Arbeit in Äthio- indischen Assam und die seltensten Delfine der Welt. Bei ih-
pien erzählt die Leiterin des NABU-Afrikaprogramms, Svane rer internationalen Arbeit kann sich die Stiftung immer auf
Bender, in diesem Heft. Weitere aktuelle Schwerpunkte die herausragende Expertise der ehrenamtlichen Bundes
unseres Afrika-Engagements liegen in Kenia, Tansania und arbeitsgruppen im NABU stützen, die sich intensiv und
im westlichen Afrika, wo wir im Projekt AfriBiRds mit kompetent um die Biodiversität in Südostasien und Afrika,
Naturschützern vor Ort eine effektive Methode zur Erfas- den Zugvogelschutz auf Zypern und Malta und um viele
sung von Zugvögeln in afrikanischen Biosphärenreservaten weitere Themen und Regionen kümmern. Ihnen sei an die-
entwickeln. ser Stelle ebenso herzlich gedankt wie den vielen NABU-Ak-
tiven und Unternehmenspartnern, die uns unterstützen –
20 Jahre NABU in Kirgistan und nicht zuletzt unseren Förderern und Spendern, ohne
Seit rund 20 Jahren ist der NABU in Kirgistan und mittler- die wir die so wichtigen Projekte nicht umsetzen könnten.
weile auch in Tadschikistan, Bhutan und Pakistan für den
bedrohten Schneeleoparden und dessen Lebensräume aktiv. Eine erkenntnisreiche Lektüre und viel Spaß beim Lesen
2017 haben sich auf Initiative des NABU im kirgisischen und Weitergeben wünscht Ihr
Bischkek Vertreter der zwölf Schneeleoparden-Verbreitungs-
staaten zur zweiten globalen Schneeleoparden-Konferenz
getroffen. Die weltweite Konferenz hat der NABU 2013 eben-
falls in Bischkek initiiert. Um den Schneeleoparden zu ret-
ten, soll das Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Thomas Tennhardt
Program (GSLEP) Strategien entwickeln und umsetzen. DieAFRIKA | 7
Mehr als zehn Jahre
NABU in Äthiopien
Tolle Partnerschaften, engagierte Kolleginnen und Kollegen und inspirie-
rende Erfolge – aber auch entmutigende Herausforderungen, Krisen und
jede Menge Papierkram waren Teil von mehr als zehn Jahren Projekt
arbeit des NABU in Äthiopien. Wir befragten Svane Bender, Leiterin des
NABU-Afrikaprogramms.
Warum Äthiopien?
2006 wurde der NABU in ein Projekt gebeten, um dort eines von zwei ersten
UNESCO-Biosphärenreservaten des Landes aufzubauen. In weniger als drei Jahren
wurde das scheinbar Unmögliche erreicht: das Kafa-Biosphärenreservat wurde
Realität! Aus diesem Projekt entwickelten sich enge Partnerschaften mit äthiopi-
schen Ministerien, der UNESCO und anderen für weitere Projekte.
Wie arbeitet der NABU eigentlich vor Ort?
Wir sorgen dafür, dass geschädigte Ökosysteme renaturiert werden, Gemeinden
nachhaltige Managementsysteme für ihre natürlichen Ressourcen aufbauen und
selbstständig umsetzen können, die Auswirkungen des Klimawandels reduziert
und vor allem naturnahe Entwicklungsperspektiven geschaffen werden. 2006
haben wir mit einem einzigen äthiopischen Mitarbeiter begonnen, heute haben Svane Bender im Gespräch mit einem
wir fast 40 Mitarbeiter in sechs Büros. Die Kolleginnen und Kollegen setzen die Projektpartner in Äthiopien.
Projekte im Feld um, während wir sie vom Hauptstadtbüro in Addis Abeba und
der NABU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin unterstützen. Seit 2006 haben wir rund
elf Millionen Euro in Äthiopien umgesetzt.
Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit?
Am meisten motivieren sichtbare Erfolge: Eine gewachsene Aufforstungsfläche,
eine zurückgekehrte Tier- oder Pflanzenart oder stolze Gemeindevertreter, die
auf ihre Erfolge und Zukunftsperspektiven blicken. Die zahlreichen großen Nach zehn Jahren Projektarbeit in
und kleinen Projekte zeigen die Vielfältigkeit unserer Arbeit und begeistern die Äthiopien sind Biosphärenreservate
Menschen: ein Medizinalpflanzengarten, Brikett-Entwicklung aus der invasiven heute so etwas wie ‚unsere Kern
Wasserhyazinthe, Honig-Kooperativen, Kräuter- und Töpferwarenproduktion mit kompetenz‘. Wir haben uns zum Ziel
Frauen und Naturcampingplätze. gesetzt, gemeinsam mit den Menschen
und der Regierung vor Ort die letzten
Gleichzeitig stehen viele Regionen in Äthiopien unter großem Druck: Bevölkerungs- intakten Ökosysteme und deren
wachstum, Klimawandel, aber auch ungeregelte Nutzungsformen wie Beweidung Biodiversität zu erhalten.
und industrielles Wachstum in der Land- oder Produktionswirtschaft schaffen Svane Bender
Müll, großflächige Ökosystemzerstörung, Wasser- und Bodenverschmutzungen.
Hier wollen wir mit modernen Konzepten ansetzen und suchen motivierte Geber.
Manfred
Hermsen Das Interview führte Britta Hennigs
Stiftung
für Natur und Umwelt
Ansprechpartnerin:
Svane Bender
Teamleiterin Afrikaprogramm /
stellv. Leiterin FB Internationales
Svane.Bender@NABU.deNaturschutz
macht Schule
Ein frischgebrühter Kaffee – für viele von uns unverzichtbar, bringt er uns
doch am Morgen auf Trab und rettet uns über den Tag. Doch wo kommt
das „schwarze Gold Afrikas“ eigentlich genau her und welchen Weg hat es
hinter sich, bevor es bei uns in der Tasse landet?
Die Ursprungsregion des berühmten Arabica-Kaffees liegt im Südwesten Äthiopi-
ens, im Kafa-Biosphärenreservat. Die abwechslungsreiche Region aus Bergnebel-,
Regen- und Bambuswäldern sowie ausgedehnten Feucht- und Auengebieten ist
nicht nur die Heimat der schwarzen Bohne, sondern vieler weiterer einzigartiger
Projektregion:
Tiere und Pflanzen. Um diesen Artenreichtum zu bewahren, setzt sich der NABU
Kafa-Biosphärenreservat
nun schon seit zwölf Jahren im Kafa-Biosphärenreservat für Naturschutz und
im Südwesten Äthiopiens
Regionalentwicklung ein.
Laufzeit:
1.1.2017 – 31.12.2019 Anfang 2017 startete ein neues, durch das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung gefördertes Großprojekt. Im Fokus früherer
Geber:
NABU-Projektkomponenten standen die enge Zusammenarbeit mit der lokalen
Bundesministerium für wirt-
Bevölkerung und ihr eigenverantwortliches Handeln für den Naturschutz. Darauf
schaftliche Zusammenarbeit und
bauen wir in der aktuellen Projektphase auf und engagieren uns darüber hinaus
Entwicklung (BMZ)
besonders in den Bereichen Biodiversitätsschutz und Klimawandel – zum Beispiel
Projektpartner: durch partizipatives Waldmanagement, gemeindebasiertes Feuchtgebietsmanage-
• Regionale und lokale Ministerien ment oder die Vermarktung von regionalen Naturprodukten.
der Region
• Lokale gemeindebasierte Auch die Umweltbildung bleibt ein wichtiger Teil des Projektes. Um eine Faszi-
Organisationen (CBOs) nation für die artenreiche Umwelt zu entwickeln, sie achten zu lernen und alte
Traditionen aufrecht zu erhalten, ist der Natur- und Artenschutz ein Thema inAFRIKA | 9
Paulos Ejeta (rechts) bringt seinen
Schülerinnen und Schülern das Thema
Recycling näher.
Äthiopische Grünmeerkatzen halten sich
sowohl auf den Bäumen als auch am
Boden auf.
Schullehrplänen für Kinder und Jugendliche. Hierfür wurden bereits im Vorgän- Weitere Aktionsfelder:
gerprojekt zusammen mit Lehrern der Regionen Lehrmaterialien zu Biodiversität • Anpassung der Landwirtschaft an
entwickelt – nun sind die Lehrer bereit, ihren Schülern die Werte und Informatio- den Klimawandel
nen im Schulalltag zu vermitteln.
• Partizipatives Waldmanagement
Einer dieser Lehrer ist Paulos Ejeta. Paulos unterrichtet seit fünf Jahren in • Gemeindebasiertes Feuchtgebiets-
verschiedenen Fächern. Derzeit widmet er sich an der Meliyo-Grundschule management
im Kafa-Biosphärenreservat dem Sozialkundeunterricht. Seitdem der 24-Jäh- • Lokal verankertes Biodiversitäts-
rige zusammen mit vielen anderen Lehrern aus der Kafa-Region vom lokalen monitoring
NABU-Team geschult wurde, ist er einer der Ansprechpartner für das Thema • Vermarktung von regionalen
Naturschutz. Regelmäßig tauscht er sich mit NABU-Mitarbeitern vor Ort über Naturprodukten
Veränderungen, Fortschritte und mögliche Probleme im Rahmen des Fachs aus. • Einbindung von Biodiversitäts-
themen in die Schullehrpläne
Über seine neue Rolle und die Reaktionen seiner Schüler sagt Paulos: „Von Beginn
• Unterstützung der lokalen
an hatte ich viel Spaß daran, den Kindern das Thema Biodiversität nahe zu brin-
Biosphärenreservatsverwaltung
gen. Besonders schön ist es zu sehen, wie schnell die neuen Lernspiele die Schüler
zu heißen Diskussionen anregen.“
Paulos gibt sein Wissen an andere Lehrer ähnlicher Fachbereiche, wie Natur-
kunde und Biologie, weiter. Die Lehr- und Lernmaterialien stehen den Schülern
und Lehrern in der Schulbibliothek frei zur Verfügung. Seit der Einführung des
Themas hat sich das Schulleben außerhalb der Klassenräume sichtlich verändert:
„Noch vor Kurzem gab es in unserer Schule keine Vereine, die sich mit dem The-
ma Biodiversität und Umwelt beschäftigen. Heute engagieren sich 56 Schüler im
Alter von elf bis 16 Jahren in unserem Biodiversity Club“, sagt Paulos stolz.
Autorin und Ansprechpartnerin:
Schüler kultivieren Baumsetzlinge, die sie einige Monate später auf dem Schulge- Anja Teschner
lände einpflanzen. Auch Abfallmanagement und Recycling sind ein Thema. Orga- Projektkoordinatorin
nische Abfälle werden vom Plastikmüll getrennt entsorgt und selbst die Metall- Kafa-Biosphärenreservat
gestelle alter Schulbänke werden in Zäune der Schulgärten umfunktioniert und Anja.Teschner@NABU.de
wiederverwertet – eine Aktion, die nun auch benachbarte Schulen übernehmen.
Paulos ist begeistert vom Engagement seiner Schüler und möchte die gelungenen Mehr Infos:
Aktionen nun auch anderen Schulen vorstellen. www.NABU.de/kafa10
Zugvogelforschung
im digitalen Zeitalter
Mit dem AfriBiRds-Monitoring sollen Zugvögel wie Rauchschwalben oder Trauerschnäpper legen auf ihren
Zugvögel und deren Bestände im afrika-
nischen Winterquartier künftig präziser Wanderungen zwischen afrikanischen Überwinterungs- und europäischen
dokumentiert und beobachtet werden. Brutgebieten jedes Jahr tausende Kilometer zurück und sind dabei oft
extremen Bedingungen ausgesetzt. In den letzten Jahrzehnten ist ein
beunruhigend starker Rückgang wandernder Landvögel zu verzeichnen.
Um ein effektives Vogelmonitoring für afrikanische Biosphärenreser
vate aufzubauen und künftig enger mit afrikanischen Wissenschaftlern
und Schutzgebietsbehörden zu Zugvögeln zusammenarbeiten zu können,
startete der NABU im Dezember 2016 das Projekt AfriBiRds.
AfriBiRds steht für „Afrikanische
Biosphärenreservate als Pilotgebiete Mit dem Projekt vertiefen wir die von der UNESCO gewünschte Zusammenarbeit
für Zugvogelmonitoring und -schutz“ unter afrikanischen Biosphärenreservaten und bauen wichtige Kapazitäten im
und ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Vogelmonitoring auf – ein zentrales Ziel des Schutzprogramms für ziehende
BirdLife International und BirdLife- Landvögel (AEMLAP) der Bonner Konvention zum Schutz wandernder Tierarten
Partnern in zwei afrikanischen Pilot- (CMS). Es geht vor allem um paläarktische Zugvögel, also Vögel, die in Europa,
gebieten. Das Projekt wird vom Bundes- Asien und Nordafrika verbreitet sind. Kernaufgabe des Projekts ist es, gemeinsam
amt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln mit internationalen Partnern wie Observation International oder Southern Bird
des Bundesministeriums für Umwelt, Atlas Project eine einfach anwendbare, kostengünstige und standardisierte Me-
Naturschutz, Bau und Reaktorsicher- thodik zur Erfassung von Vogelbeständen für afrikanische Biosphärenreservate
heit (BMUB) gefördert. Der NABU und zu entwickeln und zu testen.
die Deutsche Gesellschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Im Rahmen einer Studie zu bereits bestehenden Vogelmonitoring-Programmen
unterstützten die Workshop-Teilnahme wurden 97 Biosphärenreservate in Afrika angeschrieben und auf dieser Basis
von Experten aus Benin, der Elfenbein- zwei Biosphärenreservate als Regionen zur Pilot-Umsetzung gewählt: das Comoé-
küste und Äthiopien. -Biosphärenreservat in der Elfenbeinküste und das Omo-Biosphärenreservat in
Nigeria. Anfang 2018 wurden mit Vertretern aus 15 Schutzgebieten und sieben
Autorin: afrikanischen Ländern Trainings- und Methodiktest-Workshops in den Pilot-
Svane Bender Biosphärenreservaten in Nigeria und der Elfenbeinküste durchgeführt. Die Teil-
nehmer waren begeistert in Theorie und Praxis dabei und wollen das Monitoring
Ansprechpartner: auch in weiteren Schutzgebieten einführen.
Samuel Fournet
Projektkoordinator AfriBiRds Nun soll es in die praktische Umsetzung gehen: Die Projektpartner vor Ort in den
Samuel.Fournet@NABU.de Pilotgebieten, SOS Forêts in der Elfenbeinküste und Nigerian Conservation Foun-
dation in Nigeria führen die ersten Jahreserfassungen durch. Die Ergebnisse werden
Mehr Infos: in die digitale Datenbank www.observation.org eingespeist, was einen einfachen
www.NABU.de/afribirds und schnellen Datenaustausch zwischen den Biosphärenreservaten ermöglicht.AFRIKA | 11
Wissensspeicher und
Kräuterapotheke
„Viele Leute schauen neugierig über den Zaun und kommen dann irgend-
wann, um zu fragen, ob sie vielleicht Setzlinge haben können“, erklärt Der Medizinalgarten ist Teil des langjähri-
gen NABU-Engagements in der Kafa-Re-
Asaye, als er uns durch den frisch angelegten Medizinalgarten des NABU gion. An der Erfassung des botanischen
führt. Asaye ist NABU-Referent für natürliche Ressourcen und Wald im Grundlagenwissens haben viele deutsche
NABU-Projektbüro Bonga und begleitete fachlich die Auswahl der Arten und schweizerische Ehrenamtliche mit-
gearbeitet. Das Projekt wurde durch die
sowie den Aufbau des Gartens. NABU International Naturschutzstiftung
unterstützt.
Der Garten ist einzigartig in Bonga, der regionalen Hauptstadt im äthiopischen
Kafa-Biosphärenreservat und wird von der lokalen Bevölkerung dankbar ange-
nommen. Denn das alte, wertvolle Wissen über Wild- und Heilkräuter sowie de-
ren Anbau und Anwendung geht mit der älteren Generation allmählich verloren.
Daher beschloss der NABU, das vorhandene Wissen zu dokumentieren und einen
lebendigen Kräutergarten direkt am NABU-Projektbüro in Äthiopien aufzubauen.
Der Garten ist offen für alle Interessierten, die im Garten herumwandern und
die verschiedensprachigen Schilder studieren können. Ein besonderer Erfolg ist,
dass neben der Bevölkerung auch die Regierungsvertreter aus den nahegelegenen
Büros den Garten gerne nutzen. Zum besseren Verständnis wurde ein Gartenfüh-
rer erarbeitet, der Auskunft über die Heilwirkung und Anwendung der jeweiligen
Pflanze gibt. Hier stehen neben uns vertrauten Kräutern wie Thymian, Pfeffer-
minze und Fenchel auch einheimische sowie nur in der Region vorkommende
Pflanzen wie äthiopischer Kardamom.
Der Aufbau des Gartens war mit Herausforderungen verbunden: Die Planung wurde
von Deutschland aus unterstützt, Setzlinge oder Sämereien mussten mühevoll
zusammengetragen, eine Bewässerung mit einem 2.000 Liter fassendem Regen-
wassertank erarbeitet und eine ständige Pflege gesichert werden. Mit dem An-
pflanzen der Kräuter wurde schnell klar, dass man Vieles erst in der Praxis lernen
musste: Zahlreiche Pflänzchen starben ab, der „lebende“ Zaun aus Wolfsmilch-
stämmen musste erneuert und verdichtet werden, nachdem die Kühe aus der Autorin und Ansprechpartnerin:
Nachbarschaft des Öfteren zu Besuch kamen. Svane Bender
Teamleiterin Afrikaprogramm /
Heute jedoch sind viele Anfangsschwierigkeiten überwunden und die Besucher stellv. Leiterin FB Internationales
sowie das NABU-Team voller Begeisterung für das entstandene Kleinod. Dank des Svane.Bender@NABU.de
unermüdlichen Engagements zahlreicher Unterstützer, harter körperlicher Arbeit
und der Bereitwilligkeit spiritueller Führer der Region, ihre Erfahrungen zu teilen, Mehr Infos und Spendenmöglichkeit:
ist der Medizinalgarten zu einem Ort des Wissens und der Erholung geworden. www.NABU.de/kafa-garten12
Umweltbildung
auf Äthiopisch
Der 9. Juni ist der „Tag des Tanasee-
Biosphärenreservats“: An diesem Tag
soll sich zukünftig in den 389 Schulen der
Region alles um praktischen Natur- und
Umweltschutz drehen.
Die fünf NAJUs (Naturschutzjugend im
NABU) entwickelten gemeinsam mit
22 Lehrern praktische Einheiten zu den
Themen Erosion, Biodiversität oder
Klimawandel.
Im Dezember 2015 wurde das Tanasee-Biosphärenreservat in Äthiopien
Kleingedrucktes #1 feierlich eröffnet. Allerdings muss das junge Schutzgebiet noch viele
Herausforderungen auf dem Weg hin zur Modellregion für nachhaltige
Tanasee – Quell der Artenvielfalt Entwicklung meistern. Jetzt unterstützt die Naturschutzjugend (NAJU) das
Afrikas höchstgelegener und NABU-Projekt im Nordwesten des Landes.
Äthiopiens größter See ist das
wichtigste afrikanische Überwin- Ende Mai 2018 machten sich fünf NAJUs auf den Weg an den Tanasee. Schon am
terungsgebiet des Europäischen ersten Tag begeisterten sie das Team des NABU Bahir Dar in einem Park mit ver-
Kranichs und zahlreicher anderer schiedenen Spielen für ihre Herangehensweise. Plötzlich wurde aus einer Übung
Wasser- und Singvögel. In dem mit dem Team eine Umweltbildungsstunde für fast 100 Parkbesucher, die uns
Gebiet leben Nilpferde, Krokodile, Deutsche erst argwöhnisch, dann hochinteressiert beobachteten. Das äthiopische
Warane, Bergpythons und allein Team übersetzte ins Amharische (Amtssprache Äthiopiens) und informierte ne-
15 Fischarten, die sonst nirgend- benbei über Artenvielfalt, insbesondere über Fledermäuse und Pflanzen.
wo auf der Welt vorkommen.
Doch intensive Landwirtschaft, Zusammen mit 23 einheimischen Lehrern identifizierten wir in einem dreitägi-
große Bewässerungsprojekte und gen Workshop die größten Probleme am Tanasee: Erosion, Entwaldung, Verlust
Wasserkraftwerke werden zuneh- der Biodiversität. Gemeinsam entwickelten wir Aktivitäten, mit denen Kinder
mend zur Gefahr für die „Riviera Probleme selbst erkennen und aktiven Naturschutz leisten können. Alles im Sin-
Äthiopiens“ mit ihren beein ne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, die unter den dortigen Bedingungen
druckenden Wasserfällen. viel schwieriger umzusetzen ist, als wir es uns oft vorstellen konnten. Dennoch
entstanden einige Spiele, Experimente und Ideen für Exkursionen, die ins Hand-
buch aufgenommen werden.
Autorin und Ansprechpartnerin: Die Erfahrungen der NAJU-Gruppe kamen auch den zehn Rangern am Tanasee
Ronja Krebs (NABU) zugute. So ging es einmal morgens um 5:30 Uhr zum Birdwatching. Für viele
Projektkoordinatorin / stellv. Äthiopier ist das immer noch ein ungewöhnliches Hobby, aber die Fortschritte
Teamleiterin NABU-Afrikaprogramm waren offensichtlich und das Interesse an Schlangenhalsvogel oder Riesenfischer
Ronja.Krebs@NABU.de durchaus vorhanden. Mit einer Müllsammel-Aktion haben wir auf die steigende
Plastikflut aufmerksam gemacht und live beobachtet, wie der fruchtbare Boden
Autor und Ansprechpartner: sprichwörtlich den Bach heruntergeht.
Manuel Tacke (NAJU)
NAJU-Referent für Internationales / Abschließend stellten wir unsere Ergebnisse und den Prozess in der äthiopischen
stellv. NAJU-Geschäftsführer Hauptstadt Addis Abeba im Bildungsministerium und der deutschen Botschaft
Manuel.Tacke@NABU.de vor. Zwar gibt es für den Schutz des Tanasees immer noch viel zu tun, aber durch
die NAJU-Unterstützung werden mehr als 280.000 Kinder hoffentlich bald besser
Mehr Infos: über ihre Umwelt Bescheid wissen und können sich dann eigenverantwortlich für
www.NABU.de/tanasee den Schutz des Sees engagieren.AFRIKA | 13
Ein Ranger erzählt
Belay Mulu ist seit August 2017 Ranger im Tanasee-Biosphärenreservat, Belay Mulu ist seit einem guten Jahr
das durch den NABU aufgebaut wurde. Der junge Äthiopier hat nach- Natur-Ranger im Tanasee-Biosphären
reservat.
haltiges Ressourcenmanagement studiert und ist heute im regionalen
Umweltamt angestellt. Neben den einheimischen Schwarzen
Kronenkranichen (Foto) überwintern
auch tausende Eurasische Kraniche am
Ich bin hier aufgewachsen und liebe den See und all seine Bewohner. Mein Lieb- Tanasee.
lingstier ist der Kranich. Schon als Kind habe ich ihn über unserem Dorf gesehen
und seine Rufe gehört. Jetzt betreue ich sechzehn Gemeinden in meinem Bezirk,
die ich regelmäßig besuche. Weil die Menschen hier arm sind, nutzen sie, was die Ich bin stolz darauf, mit meiner
Natur ihnen bietet. Dabei zerstören sie unsere letzten Wälder und Feuchtgebie- Arbeit dazu beizutragen, Äthiopiens
te. Veraltete landwirtschaftliche Methoden und Müll verschmutzen Wasser und größten See zu schützen und hoffe,
Böden. Weil Bäume fehlen, spült der starke Regen fruchtbaren Boden in den See. dass auch meine Enkelkinder
Er wird dadurch immer nährstoffreicher und invasive Arten, wie die Wasserhya- den Kranich bei uns beobachten
zinthe, breiten sich aus. Zwar merken viele Menschen bereits, dass die Fischpopu- können.
lation sinkt und ihre Ernte schlechter ausfällt, aber sie befürchten auch, dass sie Belay Mulu
finanzielle Verluste erleiden, wenn sie beispielsweise ihr Vieh nicht mehr in die
Feuchtgebiete zum Fressen treiben dürfen.
Um eine Veränderung zu erreichen, brauche ich das Vertrauen der Bauern und
Fischer. Ich spreche viel mit ihnen und gebe Tipps, wie sie ein besseres Einkommen
für ihre Familie erzielen und dabei zum Schutz des Tanasees beitragen können.
Oft reicht es, wenn eine Person im Dorf verstanden hat, dass die Einrichtung
einer Null-Nutzungs-Zone in ein bis zwei Jahren dazu beiträgt, dass die Erträge
wieder steigen – und Freunde und Bekannte überzeugt.
Der NABU unterstützt die Tanasee-Region seit 2012 in den Bereichen Naturschutz
und nachhaltige Entwicklung. Als Biosphärenreservat wollen wir eine Modellregion
sein, die zeigt, wie Mensch und Natur im Einklang leben können. Um die Armut
zu bekämpfen, werden kleine, naturverträgliche Tourismusinitiativen, wie z. B. ein
Campingplatz, gefördert. Auch das Rangerprogramm hat der NABU initiiert und
meine Kollegen und mich geschult. Seitdem kann ich Vogelarten bestimmen und Das Gespräch mit Belay Mulu
mit meinen Kollegen Biodiversitätsmonitoring durchführen. Außerdem unter- führte Ronja Krebs
stütze ich die anderen NABU-Aktivitäten, wie die „Green your Garden Campaign“,
in der 200.000 Haushalte Agroforstsysteme in ihrem Heimgarten aufbauen, oder Ansprechpartnerin:
die Renaturierung von über 100 Erosionsrinnen – Furchen in der Erde, die durch Ronja Krebs
Bodenzerstörung entstehen – gemeinsam mit tausenden ehrenamtlichen Helfern. Projektkoordinatorin / stellv.
Teamleiterin NABU-Afrikaprogramm
Ich bin überzeugt, dass sich im Naturschutz schon mit wenig Einsatz viel erreichen Ronja.Krebs@NABU.de
lässt, wenn alle zusammenarbeiten. Mit einem guten Management und einer
informierten Bevölkerung können wir unser Ziel erreichen: ein Gleichgewicht Mehr Infos:
zwischen Naturschutz und Ressourcennutzung. www.NABU.de/tanasee14
Zwischen Pfeffer und Kurkuma
Pfeffer als Quelle für Einkommen für die
Bewohner des äthiopischen Biosphären- Eine bräunlich-gelbe Knolle mit vielen fingerähnlichen Auswüchsen liegt
reservats. auf der Handfläche von Alemayehu, unserem NABU-Kollegen im Yayu-Bio
sphärenreservat. Überrascht schaue ich ihn an. Das ist also die Grundlage
für das derzeitige Trendgetränk Kurkuma-Latte und die vielen Currymi-
schungen, die weltweit verspeist werden?
Kurkuma ist nur eines von mehreren Gewürzen aus dem Sortiment der gewählten
Kleingedrucktes #2 Regionalprodukte, mit dem wir Kleinbauern, besonders Frauen, in den beiden
Biosphärenreservaten Yayu und Sheka im Südwesten Äthiopiens unterstützen
Gefragter Stratege wollen. Schritt für Schritt werden 450 Bäuerinnen und Bauern darin geschult,
In Äthiopien managt der die Kurkuma-Knollen, teuren schwarzen Pfeffer und die schmackhaften Zwerg-
NABU vier von fünf UNESCO- bananen anzubauen. Das zusätzliche Einkommen aus dem Verkauf der Produkte
Biosphärenreservaten, darunter soll ihre Lebensumstände verbessern und gleichzeitig ihre Abhängigkeit vom
die beiden Wald-Biosphären bedrohten Wald in den Schutzgebieten reduzieren. Denn der Wald leidet unter
reservate im Südwesten des der permanenten Nutzung durch die Menschen für Feuer- und Bauholz. Genauso
Landes, Yayu und Sheka. Das setzen ihm die Auswirkungen des Klimawandels zu, wie starke Trockenheit mit
Vorhaben dort ist ein Gemein- verheerenden Feuern.
schaftsprojekt mit UNIQUE
forestry and land use GmbH im Die ausgedehnten, feuchten, afromontanen Bergnebelwälder waren ein wichtiger
Auftrag der GIZ. Grund für die Unterschutzstellung der Gebiete als UNESCO-Biosphärenreservate.
Doch seit der Anerkennung durch die UNESCO hat sich in den Gebieten nicht
mehr viel weiterentwickelt und die Menschen vor Ort warten ungeduldig auf die
angekündigten Veränderungen durch den Schutzstatus. Deshalb arbeiten wir
mit vielen Partnern nicht nur an einer Einkommensverbesserung, sondern auch
daran, fehlende Pläne für die Gebietsverwaltung zu erstellen oder vor Ort zu mar-
kieren, welche Naturzonen für Nutzung zugänglich sind und welche absoluten
Schutzstatus haben.
Die Arbeit vor Ort war für unsere Kolleginnen und Kollegen nicht immer einfach,
denn über mehrere Monate waren die Gebiete immer wieder von politischen
Unruhen betroffen und die Sicherheitslage ließ Feldbesuche nicht zu. Dies hat
Autorin: sich glücklicherweise wieder entspannt, so dass geplante Aktivitäten nun verstärkt
Svane Bender angegangen werden können. So sind beispielsweise erstmalige Erfassungen der
Tier- und Pflanzenwelt mit rund 30 Experten in beiden Gebieten geplant. Auf
Ansprechpartnerin: deren Grundlage soll schließlich das fehlende, regelmäßige Monitoring durch-
Jane Mertens Oliveira geführt werden, das in Biosphärenreservaten vorgeschrieben ist. Alemayehu und
Projektkoordinatorin seine Kollegen freuen sich darauf, denn man kann nur effektiv schützen und
Sheka/Yayu-Biosphärenreservat erhalten, was man kennt. Zudem ist zu erwarten, dass es spannend wird und
Jane.Mertens-Oliveira@NABU.de viele neue Arten gefunden werden!AFRIKA | 15
Erfolgreicher Löwenschutz
Um die Löwen Afrikas steht es nicht gut: rund 80 Prozent ihres einstigen Die Population afrikanischer Löwen hat in
den vergangenen 25 Jahren um mehr als
Verbreitungsgebiets haben sie verloren, in 26 afrikanischen Ländern ist 40 Prozent abgenommen. Nun müssen
der „König der Tiere” bereits ausgestorben. Der fortschreitende Verlust Wege für ein Zusammenleben zwischen
von Lebensräumen wird sich fortsetzen. Laut Schätzungen der Verein- Mensch und Tier gefunden werden.
ten Nationen wird die Bevölkerung Afrikas von derzeit 1,2 auf knapp 2,5
Milliarden im Jahr 2050 anwachsen. Damit die Löwen in den letzten
Savannenhabitaten Afrikas eine Zukunft haben, müssen wir Wege für ihr
Zusammenleben mit dem Menschen finden. Genau dafür setzen wir uns in
Tansania, einer von wenigen verbleibenden Hotspots der Löwen, ein.
Das Ngorongoro-Schutzgebiet im Südosten der Serengeti war einst übergangslos
Kleingedrucktes #3
mit dem weltberühmten Nationalpark verbunden. Doch die Zahl der dort leben-
den Massai hat sich seit dem Jahr 1959 auf 80.000 verzehnfacht. Dadurch wurde
Löwenmütter
das heute von Hirten und Herden dicht besiedelte Gebiet zu einer undurchdring-
Löwinnen ziehen ihre Jungtiere
lichen Barriere für umherstreifende Löwen. Die Population im Krater wurde
im Team auf. Meist stimmen sie
isoliert, was zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit, gestörter Fortpflanzungsfähig-
sogar die Geburtstermine aufein-
keit und einer schrumpfenden Population führte. Natürliche Beutetiere wurden
ander ab und stillen gegenseitig
durch Viehherden der Massai verdrängt, was die Löwen zunehmend dazu zwang,
die Welpen. Dieses Verhalten ist
Haustiere wie Kühe zu erlegen. Bei den sich daraus ergebenden Konflikten mit
bei Katzen einzigartig. Die Weib-
den Massai ziehen die Löwen stets den Kürzeren.
chen werden mit 36–46 Monaten
geschlechtsreif und gebären nach
2015 stellte NABU International das Startkapital für ein ambitioniertes Projekt
einer Tragzeit von 100–119 Tagen
zur Verfügung. In enger Zusammenarbeit mit den Massai soll eine Wende für die
2–4 Jungen.
Löwen im Schutzgebiet und im Nationalpark herbeigeführt werden. Unter der
Leitung der schwedischen Biologin Ingela Jansson hat sich das Projekt inzwischen
zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt.
Junge Massai-Krieger bilden als Späher („Ilchokutis”) ein Frühwarnsystem, das Autorin und Ansprechpartnerin:
potenzielle Konflikte rechtzeitig erkennt, verhindert oder zumindest mildert. Dr. Barbara Maas
Darüber hinaus wurden durch das Projekt 8.398 verlorengegangene Herdentiere Leiterin Internationaler Artenschutz
wieder aufgespürt sowie 195 verwundete Herdentiere tierärztlich versorgt und zu der NABU International
ihren Besitzern zurückgebracht. 137 nächtliche Viehgatter wurden löwensicher Naturschutzstiftung
gemacht und fünf Massai-Tötungsexpeditionen auf Löwen verhindert. Die Ent- Barbara.Maas@NABU.de
schärfung der Situation ermöglichte sogar die Einwanderung neuer Löwen in die
genetisch verarmte Kraterpopulation. Ihre Gesamtzahl im Krater ist inzwischen Mehr Infos:
auf über 80 Tiere angewachsen. www.NABU.de/loewen-ngorongoroDer Durchbruch: Bauern, Stammesälteste,
Dorfchiefs und Förster kommen zur
Unterzeichnung des Vertrages zusammen.
Liberia – der lange Weg
zum Gemeindewald
Der Wald kann von nun an auch von den
Bewohnern nachhaltig genutzt werden.
(Historisches Bildmaterial von 1984)
Mein Leben lang habe ich als Förster gearbeitet. Anfang der 1980er Jahre
reiste ich als Entwicklungshelfer gemeinsam mit meiner Familie für drei
Jahre erstmals nach Liberia. Es ging darum, Grundlagen für die Erhaltung
der Regenwälder zu erarbeiten. Die Wälder des dünn besiedelten, weithin
bewaldeten Landes waren damals fast ausnahmslos Staatsforste. Die lokale
Bevölkerung durfte die Wälder nicht nutzen und fühlte sich daher auch
nicht für ihren Schutz verantwortlich.
Seit den 1960er Jahren begann der liberianische Staat, Konzessionen an interna-
tionale Firmen zu vergeben, die großräumig die wirtschaftlich wertvollsten, oft
uralten Bäume fällten. Die zum Abtransport neu gebauten Forststraßen lockten
Jäger, Farmer, Diamanten- und Goldgräber an. Kontrollorgane waren überfordert.
Deutsche Förster und Botaniker hatten zuvor schon seit Jahren Wälder kartiert,
um einen Überblick über ihren Zustand zu gewinnen. Nun galt es, diese einmaligen
Regenwälder zu retten. Wir mussten zunächst politische Entscheidungsträger
von Erhaltungsmaßnahmen überzeugen und gleichzeitig den wirtschaftlichen
Nutzen aus Regierungsperspektive im Blick behalten und belegen.
Autor und Ansprechpartner:
Dr. Wulf Gatter In dem übernutzten Staatsforst im Osten Liberias führten wir ein Probeflächen-
Mitglied der BAG Afrika system ein. Jeder Baum wurde vermessen, erfasst und bestimmt. Daraus sollten
wulfgatter@aol.com die Gesamtsituation der Wälder, Vorkommen und Zukunft der heranwachsenden,AFRIKA | 17
langsamwüchsigen Mahagonibäume sowie Möglichkeiten ihrer Pflege und För- Die Menschen in den Dörfern Liberias sind
von der Natur abhängig. Hier sieht man die
derung analysiert werden. Die Alternative zum naturnahen Wald waren Forst- Fällung eines Dahoma-Baumes zur Herstel-
plantagen mit schnellwüchsigen „Industrieholzarten“ oder die Rodung für die lung eines „Dug outs“ – eines Einbaums.
(Historisches Bildmaterial von 1981)
Landwirtschaft. Farmen der Dorfbewohner im Staatswald unseres Projektgebietes
wurden auch von mir bekämpft, bis ich mir eingestand, dass sich Ähnliches bei
uns in Deutschland Jahrhunderte vorher abgespielt hatte. Auf der Schwäbischen
Alb hatte ich neben Staatsforsten Gemeindewälder im Einvernehmen mit den
Bürgern betreut und wusste um die Generationen überdauernden Prozesse ihrer
Entstehung.
1984 feierten wir die erfolgreiche Gründung des ersten Gemeindewaldes in der
Grand-Gedeh-Region in Ostliberia. Vorausgegangen war ein Gerichtsverfahren
zwischen Bauern, Stammesältesten, Dorfchiefs und Förstern der Region. Neue
Grenzen wurden ausgehandelt. Das Ergebnis: Die artenreichsten Wälder mit dem
gefährdeten Jentink-Ducker und dem seltenen Zwergflusspferd blieben im Staats-
forst. Dafür gingen 800 Hektar und der „Heilige Berg“ an die Dorfbewohner – auch Kleingedrucktes #4
in der Gewissheit, dass sie ihren „Secret Bush“ erhalten würden. An dessen Felsen
brütet der seltene, sagenumwobene Felshüpfer (Picathartes), ein stelzbeiniger, Ein Leben für den Naturschutz
knapp taubengroßer Vogel, von dem niemand weiß, wie er es schafft, seine Dr. Wulf Gatter, der Forstöko
Lehmnester an überhängende Felsen zu kleben und dem deshalb magische Kräfte loge, Ornithologe, Naturschützer
zugesprochen werden. und Gründer der Zugvogel-For-
schungsstation Randecker Maar,
1989 brach der Bürgerkrieg in Liberia aus, der 14 Jahre lang dauern sollte und das setzt sich seit 1981 in Liberia
weitgehende Ende der Regierungszusammenarbeit mit Deutschland bedeutete. unter anderem für den Erhalt von
Die während des immer wieder aufflackernden Krieges aufgebaute Unterstützung Regenwäldern ein. Er ist Autor des
der in Liberia gerade gegründeten Naturschutzorganisationen durch den NABU Werks „Birds of Liberia“. Für sein
ermöglichte den nicht geflüchteten Organisatoren das Überleben. Die Idee für unerschöpfliches Engagement
Gemeindewälder existierte weiter. Heute gibt es in Liberia Dutzende Gemeinde- hat er bereits zahlreiche Auszeich-
wälder, viele weitere sind geplant. nungen erhalten, darunter die
Ehrendoktorwürde in Deutsch-
Dorfgemeinschaften in Liberia kämpfen für ihren Erhalt und die hier lebenden land und Liberia. 2016 wurde er
Tierarten, führen Besucher und bieten Unterkünfte an. Sie sind stolz auf ihre von der Präsidentin Liberias in
Schimpansen, die sie früher jagten und verspeisten, als sie im Wald keine Rechte den „Order of the Star of Africa“
hatten. In einem Land, in dem Tiere bisher lediglich als „small meat“ oder „big aufgenommen und erhielt den
meat“ klassifiziert wurden, hoffe ich, dass die Idee der Gemeindewälder auch von Status des „Grand Commander“.
der neuen Regierung mitgetragen wird und zu einem breiteren Naturschutzbe-
wusstsein führen wird.18
Afrikas Geiern auf der Spur
Koffi Kouadio (rechts) und Volker Salew- In Afrika gibt es immer weniger Geier – die Gründe dafür sind vielfältig.
ski: Der NABU steht mit seinem Geierpro-
jekt im Comoé-Nationalpark nicht alleine Der Comoé-Nationalpark ist eines der letzten Rückzugsgebiete von Geiern
da. in Westafrika. Hier konnte Volker Salewski 2015 und 2016 einige der am
stärksten bedrohten Geierarten regelmäßig und mit Nachwuchs beobachten.
Weißrückengeier am Nest.
Koffi Kouadio steht unter einem riesigen Kapokbaum und deutet nach oben. „Da
ist ein Nest!“, sagt er zu seinem Begleiter Volker Salewski vom Michael-Otto-Insti-
tut im NABU. Die beiden Naturschützer befinden sich im Nationalpark Comoé in
der nordöstlichen Elfenbeinküste. Ein Blick durchs Fernglas zeigt: Es ist das Nest
eines Weißrückengeiers. Am Ende seines sechswöchigen Aufenthalts in der El-
fenbeinküste im Januar und Februar 2018 wird Salewski insgesamt 27 Nester von
drei vom Aussterben bedrohten Geierarten registriert haben. Das gute Ergebnis
macht Mut für die weitere Arbeit zum Schutz afrikanischer Geier.
Kleingedrucktes #5
Die Situation der afrikanischen Geier stand lange nicht im Fokus der internatio-
nalen Vogelschutzarbeit. Dies änderte sich, als die Ornithologin Darcy Ogada
Geier im Sturzflug
gemeinsam mit Koautoren 2015 eine Studie veröffentlichte, die belegte, dass im
Der Rückgang afrikanischer
Zeitraum von drei Geiergenerationen die Bestände von sieben Arten um 80 Pro-
Geierarten in Zahlen:
zent oder mehr abgenommen haben. Der darin geprägte Begriff der „African Vul-
Sperbergeier - 97 % ture Crisis“ bringt die Situation auf den Punkt. Geier werden vergiftet und gejagt,
(Gyps rueppellii) um Körperteile für traditionelle medizinische Zwecke zu nutzen. Sie kommen an
Wollkopfgeier - 96 % Stromleitungen und Windrädern zu Tode und leiden unter Lebensraumzerstö-
Trigonoceps occipitalis rung und schwindendem Nahrungsangebot. Besonders stark sind die Rückgänge
in Westafrika.
Weißrückengeier - 90 %
Gyps africanus
Das Geierschutzprojekt startete Ende 2016. Zunächst sollte ein Überblick über
Kappengeier - 83 % die Verbreitung der Geier gewonnen werden. Dazu legte Salewski Anfang 2017
Necrosyrtes monachus
und 2018 insgesamt fast 1.000 Kilometer zu Fuß im Park zurück, um alle Geierbe
Schmutzgeier - 92 % obachtungen zu erfassen und die Koordinaten ihrer Nester aufzunehmen.
Neophron percnopterus
Kapgeier - 92 % Die Parkverwaltung, eine Forschungsstation der Universität Würzburg, die Nan-
Gyps coprotheres gui Abrogouain Universität in Abidjan und BirdLife International unterstützen
das Vorhaben. Genaueres über die Verbreitung der verschiedenen Geierarten
Ohrengeier - 80 %
Torgos tracheliotus zu erfahren. In Zusammenarbeit mit der Nangui Abrogouain Universität sollen
Studierende aus der Elfenbeinküste die Fortpflanzung der Geier im Park und die
Rolle der Geier in den lokalen Kulturen untersuchen, um mehr über ihre Gefähr-
Autor und Ansprechpartner: dungsursachen zu erfahren. Der NABU plant, mittels GPS-Sendern zu prüfen, wie
Dr. Volker Salewski weit die Vögel umherziehen, um Nahrung oder geeignete Brutplätze zu finden.
Michael-Otto-Institut im NABU Ziel der Arbeiten ist es, den Comoé-Nationalpark als „vulture safe zone“ auswei-
Volker.Salewski@NABU.de sen zu lassen.AFRIKA | 19
Aus dem Alltag
eines Ornithologen
Beobachten und zählen: Das kann der NABU-Ornithologe Volker S alewski Der Weißscheitelkiebitz ist eine häufige
Wasservogelart an steinigen Uferbereichen
besonders gut. Anfang 2018 war er im Rahmen des Geierschutzprojektes des Comoé-Flusses. Zu beachten ist der
der NABU International Naturschutzstiftung im Comoé-Nationalpark deutlich sichtbare Sporn am Flügelbug.
unterwegs und schulte die Park-Ranger im Zählen und Bestimmen der Diskussion der Artzugehörigkeit beobach-
Wasservögel. teter Wasservögel am Comoé-Fluss.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, mit den Park-Rangern Wasservögel zu zählen?
Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Colonel Amara, der Vorgesetzte der
Ranger, hatte gehört, dass ein Ornithologe im Park ist und ist mit der Bitte an
mich herangetreten, mit seinen Kollegen Wasservögel zu bestimmen und zu zäh-
len. Die Initiative ging also von den Rangern vor Ort aus.
Was war der Hintergrund für diese Bitte?
Die Organisation Wetlands International organisiert standardisierte Wasservogel-
zählungen weltweit. Dazu gehört auch der African-Eurasian-Waterbird Census.
Für Westafrika werden die Zählungen vom Wetlands International Büro in Dakar
in Senegal koordiniert. Die Ranger im Comoé-Nationalpark wollten sich an diesen
Erfassungen beteiligen. Um die Zählungen durchzuführen, benötigt man Arten-
kenntnisse, die ich als Ornithologe an die Ranger weitergeben konnte.
Wie läuft so eine Zählung ab?
Zusammen mit den Rangern war ich drei Tage an der Forschungsstation der Uni-
versität Würzburg im Nationalpark. Wir sind täglich an verschiedene Flussufer-
stellen gefahren und haben Wasservögel beobachtet und ihre Merkmale diskutiert.
Aber wir haben natürlich auch die Vögel gezählt.
Welche besonderen Vogelarten konnten Sie zusammen mit den Rangern beobachten?
Wir haben insgesamt 219 Vögel beobachtet, die wir 27 Arten zuordnen konnten.
Speziell war eine Familie des Schreiseeadlers mit ihren flüggen Jungen. Auch den
gefährdeten Wollhalsstorch konnten wir häufig beobachten. Dass sich ein Nacht-
reiher in der dichten Ufervegetation gezeigt hat, hat uns besonders gefreut. Die
Ergebnisse haben wir an den nationalen Wasservogelkoordinator in der Elfenbein-
küste und an die verschiedenen Büros von Wetlands International weitergeleitet.
Das Interview führte
Planen die Ranger im Comoé-Nationalpark noch weitere Erhebungen? Laura-Sophia Schulz
Die Ranger waren sehr motiviert und würden die Erfassung von Wasservögeln
gern fortsetzen. Das Problem ist die Ausrüstung: Ferngläser sind kaum vorhanden Mehr Infos:
und wenn, dann in nicht ausreichender Qualität. Es fehlt auch an Bestimmungs- Die Ergebnisse der Wasservogel
büchern. Ich plane, zusammen mit einem Ornithologen aus der Elfenbeinküste, beobachtungen im Comoé-National-
eine Bestimmungsbroschüre der Wasservögel des Comoé-Parks herauszugeben park sind online hier zu finden:
und den Rangern zur Verfügung zu stellen. iwc.wetlands.org/index.php/nattotals20
Waldschutz
in Kenia
NABU-Vizepräsident Thomas Tennhardt Der NABU unterstützt seit 2000 die Arbeit von unserem BirdLife-Partner
(rechts) und der Autor im Arabuko Sokoke Nature Kenya und dem staatlichen Kenya Wildlife Service (KWS) im Ara-
Forest.
buko Sokoke Forest. Seit dem Antritt des neuen Jagdaufsehers LK Lenguro
Sie hat sich im Gehölz des Arabuko weht ein frischer Wind: Im Wald wurden drei dauerhaft bestehende Ran-
Sokoke Forest versteckt: Die endemische
Sokoke-Eule. gercamps eingerichtet, von denen aus patrouilliert wird.
Gemeinsam mit Lynn Njeri, wissenschaftliche Mitarbeiterin des KWS, treffe ich in
Jilore Ranger und freiwillige Community-Scouts. Die junge Frau hat ihre Ranger
gut im Griff und diskutiert mit ihnen anstehende Einsätze. Mwalimu, einer der
ehrenamtlichen Scouts, berichtet von einer Wilderer-Handelsroute zwischen
Tsavo East bis an die Küste bei Malindi. Neulich habe er dem KWS einen Wilderer
gemeldet, der ihn danach bedroht habe, nun aber verschwunden sei. Das ungute
Gefühl bleibt. Die jungen Scouts sind entschlossen „ihren“ Wald zu beschützen.
Das touristische Interesse an Arabuko Sokoke wächst und aufgrund ihrer Orts-
Kleingedrucktes #6 kenntnisse und mit ihrem Wissen über den Wald können sie bald als Waldführer
arbeiten oder als Feldassistenten bei wissenschaftlichen Untersuchungen helfen.
Arabuko Sokoke
Wie hat sich die Flora und Fauna Die Menschen, die sich für den Arabuko Sokoke Forest einsetzen, müssen mit
in den letzten zehn Jahren dem Mangel leben. So benötigt der gut 20 Jahre alte Elektrozaun, der den Wald
verändert? Um einen Überblick vollständig umgibt, um Mensch-Wildtier-Konflikte zu entschärfen, dringend
über die Artenvielfalt im Arabuko Reparaturen. Viele der Zaunpfähle sind durch Termiten zersetzt, Photovol-
Sokoke Forest zu bekommen, taik-Paneele müssen erneuert werden. Von den notwendigen rund 64.000 Euro
wird im Herbst 2018 ein Biodi- fehlen noch etwa drei Viertel. Dagegen sind die Wünsche von Lynn bescheiden:
versitätsmonitoring umgesetzt. aufladbare Akkus und Solarladegeräte für ihre sechs Kamerafallen, die sie zur
Die Daten sind wichtig, um die Untersuchung der Elefantenpopulation im Wald benötigt.
Important Bird Area (IBA) fundiert
beurteilen zu können. Zu den Mit Mitteln des NABU wurde 2013 ein Elefanten-Aktionsplan erarbeitet. Nature
Zielarten des Monitoring gehört Kenya ist es durch Lobbyarbeit gelungen, dass der Wildlife Migratory Corridor
auch die Sokoke-Eule. vom Arabuko Sokoke Forest zum Tsavo East in den nationalen Plan für solche
Maßnahmen aufgenommen wurde – eine wichtige Voraussetzung für die Um
setzung. Elefanten-Korridore zwischen den Schutzgebieten haben ein Ziel:
Konflikte zwischen Menschen und Tieren zu reduzieren.
Einen großen Erfolg für den Schutz des Waldes gab es im Februar 2018. Die an
Arabuko Sokoke angrenzende Siedlervereinigung und die Gemeindewald-Gemein-
schaften hatten zuvor mit Nature Kenya ein „Jahr der Waldaktivitäten“ initiiert,
Autor und Ansprechpartner: um Forstleute loszuwerden, die offensichtlich in illegale Aktivitäten verwickelt
Werner Schröder waren. Vom kenianischen Forstdienst wurde die Entlassung korrupter Beam-
Sprecher der BAG Afrika ter gefordert. Im Parlament wurden gezielt Politiker angesprochen und auf die
werner.schroeder.calidris@t-online.de Missstände aufmerksam gemacht. Viele Medien berichteten immer wieder über
unhaltbare Zustände. Unter dem öffentlichen Druck entließ das Hauptquartier
Mehr Infos: der Forstverwaltung schließlich den Forstamtsleiter und zwei weitere Beamte, die
www.NABU.de/arabuko der Korruption überführt worden waren.AFRIKA | 21
Kraniche in Ostafrika –
Dramatischer Schwund
Mit seinem eindrucksvollen Balztanz und dem farbenprächtigen Gefieder Gefahr für den Grauen Kronenkranich:
In beinahe seinem gesamten Verbreitungs-
ist der Graue Kronenkranich vielen europäischen Zoobesuchern wohlbe- gebiet sind seine Bestände gesunken.
kannt. Sein natürlicher Lebensraum liegt im Osten und Süden des afrika- Der NABU beteiligte sich an einem landes-
nischen Kontinents. In Ostafrika brütet die Art das ganze Jahr hindurch weiten Kranichmonitoring in Kenia.
mit einem Schwerpunkt in der Trockenzeit.
Seit 2013 gilt als gesichert, dass die Bestände des Grauen Kronenkranichs im ge-
samten Verbreitungsgebiet, mit Ausnahme von Südafrika, dramatisch abgenom-
men haben. Vom 2. bis zum 13. Dezember 2017 hat der NABU gemeinsam mit
Experten vom Naturkundemuseum in Nairobi, von Nature Kenya und dem Kenya
Wildlife Service (KWS) erstmals seit 40 Jahren ein landesweites Kranichmonito-
ring durchgeführt.
Zuvor fand auf Initiative der Bundesarbeitsgruppe Afrika im NABU eine hochrangig
und international besetzte Kranichkonferenz in Nairobi statt. Dort wurde das vor-
handene Wissen über den Grauen Kronenkranich zusammengetragen. George Muigai
von den Crane Conservation Volunteers berichtete von bis zu 800 Kronenkranichen Kleingedrucktes #7
am Lake Ol’Bolossat, die größte bekannte Ansammlung von Kranichen in Kenia.
Wissenstransfer
Eine gute Nachricht? Nicht für Prof. Nathan Gichuki, der viele Jahre die Kraniche Während des Kranichmonitorings
in Kenia studiert hat. Vor 30 Jahren hätte es solche großen Ansammlungen nicht wurden sechs Jungvögel mit Sa-
gegeben, möglicherweise sei es ein Resultat schwindender Lebensräume, dass sich tellitensendern ausgerüstet. Jetzt
die Kraniche immer stärker in den noch verbliebenen intakten Gebieten sam- sind auch die kenianischen Kolle-
melten. Das allerdings sei gefährlich, etwa bei Krankheiten oder der Verfolgung gen in diese Technik eingeführt.
durch den Menschen. Im Juni 2018 nahm auf Einladung
des NABU ein Doktorand von
Das zwölftägige Kranichmonitoring brachte ein enttäuschendes Ergebnis. In den der Nairobi Universität an einem
43 besuchten Gebieten wurden lediglich 1.234 Graue Kronenkraniche gezählt. Der zweiwöchigen Beringungs- und
Anteil der Jungvögel lag bei knapp über drei Prozent. In den 1980er Jahren waren Besenderungskurs von Kranich-
an den bekanntesten Verbreitungsschwerpunkten innerhalb und außerhalb von schutz Deutschland teil.
Schutzgebieten insgesamt noch bis zu 30.000 Kronenkraniche gezählt worden.
Da 2017 die Brutsaison aufgrund einer anhaltenden Trockenheit sehr spät in
Gang kam, saßen im Dezember noch viele Kraniche auf den Nestern oder huder-
ten ihre Jungen. In dieser Zeit sind die Vögel sehr scheu und können leicht über-
sehen werden. Außerdem konnte im westlichen Kenia aufgrund von politischen Autor und Ansprechpartner:
Unruhen nicht gezählt werden. Deshalb ist für 2019 ein weiteres landesweites Werner Schröder
Monitoring geplant. Sollte sich dann allerdings die 2017 festgestellte Bestandsab- Sprecher der BAG Afrika
nahme bestätigen, sieht es für die Kronenkraniche in Kenia sehr schlimm aus. werner.schroeder.calidris@t-online.de22
Auffangstation für den
Grauen Kronenkranich
Der Bestand des Grauen Kronenkranichs – Der Östliche Graue Kronenkranich (Balearica regulorum gibbericeps) ist
ein eleganter Vogel mit goldgelben
Schmuckfedern – nimmt fast überall in
in weiten Teilen seines Verbreitungsgebietes stark gefährdet. Das gilt auch
Afrika ab. für Ostafrika. So leben in Ruanda gegenwärtig noch maximal 200 Brut-
paare in der freien Natur – nicht genug für eine überlebensfähige Popula-
Der Autor (links im rechten Bild) besucht
2017 Ruanda, um mit Partnern über tion. Die wesentlichen Ursachen für diesen Rückgang sind die Entnahme
Schutzmaßnahmen zu beraten. der Vögel aus der Wildnis für die Haltung in Privat- und Hotelgärten
sowie der illegale Handel mit Kronenkranichen. Zudem geht immer mehr
Lebensraum für den Kronenkranich verloren.
Ein Verbreitungsschwerpunkt von noch frei in Ruanda lebenden Grauen Kronen-
Kleingedrucktes #8
kranichen ist das Rugesi-Feuchtgebiet. Dort führt die Rwanda Wildlife Conserva-
tion Association (RWCA) Bildungsmaßnahmen durch und arbeitet gemeinsam mit
Kranich lockt Besucher an
der lokalen Bevölkerung an alternativen Einkommensquellen und Schutzprojek-
In der künftigen Auffang- und
ten. Unterstützt durch die International Crane Foundation und den Endangered
Zuchtstation mit einem Besucher-
Wildlife Trust hat die RWCA 2014 damit begonnen, illegal erworbene und gehal-
zentrum soll auch Umweltbildungs-
tene Kronenkraniche zu konfiszieren.
arbeit großgeschrieben werden.
Vor allem für Kinder und Jugend-
Die Vögel werden zunächst in einer provisorischen Quarantänestation in der
liche wird hier künftig das Ver-
Hauptstadt Kigali untergebracht und dort veterinärmedizinisch versorgt. In einem
ständnis für den Lebensraum des
nächsten Schritt geht es darum, die Individuen zu identifizieren, die wieder aus-
Grauen Kronenkranichs geweckt,
gewildert werden können. In einem Auswilderungsgehege im Akagera National-
der als attraktive Art für den
park erlangen diese Tiere wieder ihre Flugfähigkeit, bevor sie im oder um den
wachsenden Naturtourismus in
Nationalpark angesiedelt werden.
Ruanda werben soll.
Für die artgerechte Haltung dauerhaft flugunfähiger Kraniche wird in oder nahe
Kigali eine Auffang- und Zuchtstation mit einem Besucherzentrum aufgebaut.
Potenzielle Brutpaare können in separaten Zuchtgehegen untergebracht werden.
Der Nachwuchs könnte so in der Wildbahn zur Stabilisierung einer überlebensfä-
higen Population in Ruanda beitragen. Verbleibende Kraniche werden in natur-
nahen Schaugehegen gehalten und helfen als Botschafter dabei, Naturschutzbil-
dung anschaulich zu gestalten.
Der Zoo Landau in der Pfalz und die Bundesarbeitsgruppe Afrika des NABU haben
begonnen, die Naturschützer in Ruanda fachlich und finanziell zu unterstützen.
Werner Schröder, Leiter der BAG Afrika im NABU, und Dr. Jens-Ove Heckel, Direk-
tor des Zoo Landau in der Pfalz, besuchten deshalb im Januar 2017 Ruanda, um
Autor und Ansprechpartner: mit Partnern vor Ort über Schutzmaßnahmen zu beraten. Die Association pour la
Dr. Jens-Ove Heckel Conservation de la Nature au Rwanda (ACNR), unser BirdLife Partner in Ruanda,
Direktor des Zoo Landau in der Pfalz verfügt über eine große Kompetenz in der Umweltbildung und im Naturschutz
Jens-Ove.Heckel@landau.de und wird eng mit der RWCA zusammenarbeiten.Sie können auch lesen