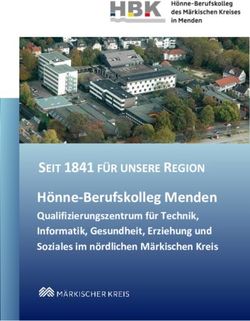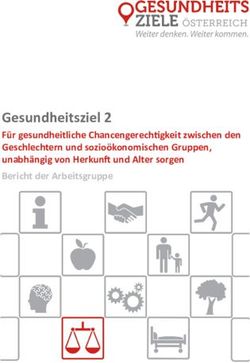Qualifi zierte Vorbereitung Ehrenamtlicher in der Sterbebegleitung - Rahmenempfehlung für Kursleitungen - DHPV
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Deutscher Hospiz- und
PalliativVerband e. V.
Qualifizierte Vorbereitung
Ehrenamtlicher in der
Sterbebegleitung
Rahmenempfehlung für Kursleitungen
Eine Handreichung des DHPV
Rahmenempfehlungen zur
qualifizierten Vorbereitung
www.dhpv.de Inhalt
Vorwort ..................................................... 3 Auswahlprozess der Teilnehmenden .... 29
Motivation der Teilnehmenden ..................29
Einleitung ................................................ 4 Gewinnung von Teilnehmenden ............... 29
Kriterien für die Kursteilnahme ..................30
Eine wissenschaftliche Teilnahmebedingungen ............................ 32
Standortbestimmung ............................. 6
Evaluation .............................................. 34
Hospizliche Haltung ............................. 11
Grundlagen der hospizlichen Haltung ..... 11 Zertifikat ................................................ 36
Die Haltung der Kursleitung .................... 14 Muster für ein Zertifikat ............................ 37
Strukturelemente eines Schlussbemerkung................................. 38
Vorbereitungskurses ............................. 16
Inhalte und Lernfelder .............................. 16 Autor*innen ............................................ 39
Zeitliche Struktur und Einheiten ................ 19
Einstiegsmodul Basiswissen ................... 20 Quellen ................................................... 40
Praktikum im Vorbereitungskurs .............. 21
Junges Ehrenamt ................................... 22 Anhang:
Anerkennung von Qualifikationen ............ 22 Leitfragen für Auswahlgespräche ......... 42
Interkulturalität ........................................ 23
Vertiefendes Wissen ................................ 24
Kursbegleitung ........................................ 24
Didaktik und Methoden .......................... 25
Herausgeber
Deutscher Hospiz- und Erscheinungsjahr: 2021
PalliativVerband e. V. (DHPV) 1. Auflage
2Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Vorwort
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Das hospizliche Ehrenamt sieht sich heute
mit neuen gesellschaftlichen Herausforderun-
die Vorbereitung von interessierten Menschen gen und veränderten Rahmenbedingungen
auf die ehrenamtliche Mitarbeit in der Hospiz konfrontiert. Im Sommer 2019 veröffentlichte
arbeit ist seit Beginn der Hospizbewegung, der DHPV hierzu die Studie „Ehrenamtlichkeit
also seit über 30 Jahren, eine der Kernkom- und bürgerschaftliches Engagement in der
petenzen der ambulanten Hospizdienste und Hospizarbeit – Merkmale, Entwicklungen und
der stationären Hospize. Dabei sind verschie- Zukunftsperspektiven“. Die Ergebnisse, die
dene Kursformen, unterschiedliche Curricula für die Konzeption eines Vorbereitungskurses
und eine Vielzahl von einzelnen Kurseinheiten relevant sind, stellen wir in einem eigenen Ka-
entstanden. pitel dar, zudem finden sie sich in Überlegun-
gen zu Themen wie Interkulturalität und jun-
Das Ziel der vorliegenden Rahmenempfeh- ges Ehrenamt wieder. Und auch den digitalen
lung ist eine Verständigung auf Mindeststan- Angeboten widmet sich die Rahmenempfeh-
dards unter Beibehaltung der Vielfalt, die sich lung – vor dem Hintergrund der Digitalisierung
in den verschiedenen Regionen und Diens- und verstärkt durch die Erfahrungen mit der
ten etabliert hat bzw. zum Einsatz kommt. COVID-19-Pandemie und ihren Folgen. Die-
Sie soll keineswegs bewährte überregiona- se Rahmenempfehlung ist aus der Zusam-
le, regionale oder individuelle Curricula und menarbeit verschiedener Fachgruppen des
Kurspläne ersetzen, sondern ein Werkzeug DHPV sowie der intensiven Diskussion in einer
dafür sein, den eigenen Vorbereitungskurs kri- Steuerungsgruppe unter Einbeziehung von
tisch daraufhin zu überprüfen, ob er den hier Vorstandsmitgliedern sowie der Geschäfts-
vom Deutschen Hospiz- und PalliativVerband stelle des DHPV entstanden. Ich danke allen
(DHPV) formulierten Standards entspricht Beteiligten für ihr Engagement und dem inten-
oder ob er an der einen oder anderen Stelle siven Meinungsaustausch. Die Entwicklung
angeglichen werden muss. Damit wollen wir einer solchen Empfehlung ist ein offener Vor-
die Entwicklung und Sicherung von Qualität gang, der nicht abgeschlossen ist. In diesem
in der Vorbereitung von Ehrenamtlichen un- Sinne freuen wir uns über Rückmeldungen
terstützen. Unsere Mindeststandards sollen an die Geschäftsstelle des Deutschen Hos-
dazu beitragen, dass Ehrenamtliche, die in ei- piz-und PalliativVerbandes unter
nen anderen Dienst wechseln, im Sinne eines info@dhpv.de.
gemeinsamen Verständnisses von Hospizar-
beit auf ihr Ehrenamt vorbereitet sind. Ihr Prof. Winfried Hardinghaus
Vorsitzender des DHPV
3 Einleitung
Ein Vorbereitungskurs ist eine besondere Bil- Vorbereitungskursen greifen individuelle und
dungsveranstaltung, in der es vor allem darum Gruppenprozesse ineinander. Die Auseinan-
geht, gemeinsam eine hospizliche Haltung zu dersetzung mit dem eigenen Lebensweg und
entwickeln. Dabei bewegen wir uns als „Hos- Gewordensein findet in Selbstreflexion und im
pizler*innen“ in einem Spannungsfeld: Eigent- Dialog mit anderen Menschen (in Bezug auf
lich gehen wir von der Annahme aus, dass die die Lebenswege anderer Menschen) statt.
Begleitung von schwerkranken und sterben-
den Menschen eine menschliche Fähigkeit ist, Ziel unserer Rahmenempfehlung ist es, für
die wir alle besitzen. Gleichzeitig behandeln diejenigen in der Hospizarbeit, die die Durch-
wir im Vorbereitungskurs aber auch die Frage, führung von Vorbereitungskursen verantwor-
was das Wesen einer hospizlichen Begleitung ten, ein Konzept sowie einen Rahmen an-
ist und wie diese Haltung in Verhalten umge- zubieten, der sie dabei unterstützt, die vom
setzt werden kann. Die Vorbereitungskurse DHPV vertretenen Grundeinstellungen in kon-
könnten darüber hinaus als „Seelenarbeit“ kretes professionelles Gestalten bei der qua-
beschrieben werden, da wir uns im Wesent- lifizierten Vorbereitung Ehrenamtlicher in der
lichen mit existenziellen Fragen beschäftigen. Sterbebegleitung zu übertragen.
Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass dieje-
nigen, die sich für Hospizarbeit interessieren, Die Vorbereitung von neuen ehrenamtlichen
für sich selbst Antworten auf Lebensfragen Mitarbeiter*innen gehört zur Grundkompe-
suchen: Wo komme ich her, wo gehe ich hin, tenz von ambulanten Hospizdiensten, unab-
gibt es so etwas wie eine Seele, gibt es Gott, hängig von der Frage, ob sie von ehren- oder
was ist der Sinn des Lebens, wo liegen meine hauptamtlichen Koordinationskräften geleitet
Kraftquellen und Ähnliches mehr. Es geht aber werden, die nach § 39a (2) SGB V von den
auch um eine Erweiterung des Wissens rund Krankenkassen finanziell gefördert sind.
um die Themen Sterben, Tod und Trauer.
In der Bundesrahmenvereinbarung zu Förder-
Deshalb bezeichnen wir diese Kurse nicht voraussetzungen, Inhalt, Qualität und Umfang
als Schulung, Ausbildung oder Befähigung, der ambulanten Hospizarbeit1) stehen weni-
sondern als qualifizierte Vorbereitung. In den ge Sätze zu den Vorbereitungskursen. In der
1) Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 8 SGB V zu den Voraussetzungen der Förderung sowie zu Inhalt,
Qualität und Umfang der ambulanten Hospizarbeit vom 03.09.2002, i. d. F. vom 14.03.2016 (hier und im Folgen-
den „Bundesrahmenvereinbarung“ genannt).
2) Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der
4 stationären Hospizversorgung vom 13.03.1998, i. d. F. vom 31.03.2017.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Rahmenvereinbarung für stationäre Hospize2) Kernprozess der Vorbereitung für zukünftige
ist zu dieser Thematik noch weniger ausge- ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. Weiterhin
sagt: In § 5 (7) heißt es dort lediglich: „Das sta- beschäftigen wir uns mit grundsätzlichen The-
tionäre Hospiz setzt Ehrenamtliche entspre- men, Strukturelementen und Kursinhalten von
chend ihrer nachgewiesenen Befähigung ein Vorbereitungskursen und formulieren dafür
und sorgt für deren regelmäßige Begleitung.“ Mindeststandards. Hierin unterscheidet sich
Für den ambulanten Bereich wird in § 3 (5) der ein Vorbereitungskurs für das Ehrenamt von
Bundesrahmenvereinbarung festgelegt, dass einer Schulung oder einem Programm in der
„Ehrenamtliche, die in der ambulanten Hospi- beruflichen Ausbildung. Denn im beruflichen
zarbeit arbeiten möchten, […] vor Antritt ihrer Qualifizierungsprozess erworbene Sach- und
Tätigkeit eine Erstqualifizierung (Befähigungs- Handlungskompetenzen werden abgeprüft
kurs) abgeschlossen haben [müssen]. In der und befähigen in der Regel zu Berufsausübun-
Kinderhospizarbeit ist darauf zu achten, dass gen. Dieser Aspekt hat auch Einfluss auf den
diese die besonderen Inhalte und Anforderun- Auswahlprozess der Kursteilnehmer*innen,
gen der Kinderhospizarbeit berücksichtigt.“ welcher konkret unter den Gesichtspunkten
Nach § 2 (3) obliegt der Fachkraft (Koordina- Motivation und Gewinnung sowie Teilnahme-
tion) die „Gewährleistung der Schulung/Quali- kriterien und -bedingungen beleuchtet wird.
fizierung der Ehrenamtlichen“. Die Wichtigkeit
der Vorbereitung der Ehrenamtlichen zeigt In der gesamten Rahmenempfehlung nehmen
sich jedoch in der Formulierung der „quali- wir immer wieder Bezug auf frühere Publika-
fizierten ehrenamtlichen Sterbebegleitung“ tionen des DHPV, wie die Handreichung der
(z. B. in § 1 (2)), die sich durch die ganze Bun- Fachgruppe Ehrenamt „Qualifizierte Vorbe-
desrahmenvereinbarung zieht. reitung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Hospizarbeit“ (2017) und die
Schwerpunkt der Vorbereitungskurse ist die Arbeitshilfe der Fachgruppe Ambulante Hos-
Entwicklung einer hospizlichen Haltung. Dies pizarbeit „Qualitätsprozesse in ambulanten
findet sich auch als zentrales Element in die- Hospiz- und Palliativdiensten“ (2017).3)
ser Rahmenempfehlung wieder. Im Kapitel
„Hospizliche Haltung“ beschreiben wir diesen
3) DHPV e. V.: Qualifizierte Vorbereitung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hospizarbeit. Eine
Handreichung des DHPV. Berlin, 2017; DHPV e. V.: Qualitätsprozesse in ambulanten Hospiz- und Palliativdiens-
ten. Arbeitshilfe des DHPV. Berlin, 2017. 5 Eine wissenschaftliche
Standortbestimmung
An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Blick Der Teilbereich der Studie „Die Kunst der
auf die aktuelle wissenschaftliche Standort- Begleitung“ beschreibt prägnant die Beson-
bestimmung und Zukunftsperspektive des derheiten und Kompetenzen dieses Ehren-
Ehrenamtes in der Hospizbewegung, um amtes: „In der Konfrontation mit der letzten
daran Orientierungspunkte und Tendenzen Lebenskrise kann jenes Einfühlungsvermögen
für qualifizierte Vorbereitungskurse auszuma- aufblühen, dessen Fehlen im Zentrum der
chen. Zugrunde liegt hier vor allem die DHPV- Gesellschaft beklagt wird. Die größte Stärke
Verbundstudie mit Ergänzungen aus anderen vieler Ehrenamtlicher ist, dass sie offen sind
wissenschaftlichen Erhebungen und Aussa- für das, was offen ist: Die Beziehung zu den
gen zur nachhaltigen Qualifizierung Ehrenamt- Angehörigen, die Frage nach Hoffnung, die
licher in der Hospizbewegung. Frage, ob etwas über den Tod hinausweist,
das Gespräch über Ängste, Wünsche, Sehn-
Im Sommer 2019 veröffentlichte der DHPV süchte. Sie sind damit in gewisser Weise
die Ergebnisse seiner bundesweiten For- die Zuständigen für das Unbestimmte und
schungsstudie „Ehrenamtlichkeit und bürger- Unvorhersehbare und die Wächterinnen der
schaftliches Engagement in der Hospizarbeit Einfühlsamkeit am Rande des Lebens.“5) Eh-
– Merkmale, Entwicklungen und Zukunfts- renamtliche auf diese Offenheit vorzuberei-
perspektiven“.4) Diese bildet eine wichtige ten, ist eine vielschichtige Aufgabe und eine
wissenschaftliche Grundlage für die Weiter- Verantwortung mit einem ganzheitlichen Bil-
entwicklung und Ausdifferenzierung des En- dungsanspruch. Die Entwicklung einer Hal-
gagements in der Bevölkerung für sterbende tung wird hier zur Sprache gebracht und als
Menschen und stärkt gleichzeitig die Hospiz- elementare Eigenschaft dieses Ehrenamtes
vereine als Organisationsform für Ehrenamt- belegt. „Die Herausforderung, denen sich die
lichkeit. Angeführt werden an dieser Stelle nur Ehrenamtlichen in der praktischen Arbeit ge-
Ergebnisse, die für die Konzeption eines Vor- genübergestellt sehen, sind aber oft als un-
bereitungskurses relevant sind. vorhergesehen gekennzeichnet, wo sie auf
ihre eigene Intuition verwiesen sind und nicht
4) Eine umfassende Auswertung der Verbundstudie erschien 2019: Klie, Thomas; Schneider, Werner; Moeller-Bru-
ker, Christine; Greißl, Kristina: Ehrenamtliche Hospizarbeit in der Mitte der Gesellschaft? Empirische Befunde zum
zivilgesellschaftlichen Engagement in der Begleitung Sterbender. Esslingen: der hospiz verlag, 2019. Teilergeb-
nisse wurden bereits im Sommer 2018 veröffentlicht: Schuchter, Patrick; Fink, Michaela; Gronemeyer, Reimer;
Heller, Andreas: Die Kunst der Begleitung: Was die Gesellschaft von der ehrenamtlichen Hospizarbeit wissen
sollte. Esslingen: der hospiz verlag, 2018.
5) DHPV e. V.: Ergebnispräsentation: Ehrenamtlichkeit und bürgerschaftliches Engagement in der Hospizarbeit
6 (EbEH) – Merkmale, Entwicklungen und Zukunftsperspektiven. Berlin, 2018, S. 2.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
auf die ihnen vermittelten Wissensbestände renten Erfahrungen spielt bereits im Vorberei-
zurückgreifen können.“6) tungskurs eine relevante Rolle.
Nach Begemann und Seidel entwickelt sich Ein Aspekt, der hier ebenfalls mitwirkt, ist die
diese Intuition bzw. Haltung aus einer gleich- Stiftung von Identität und Gemeinschaft: Ein
berechtigten Zusammenführung aus Fachwis- wichtiges Motiv für die Ausübung eines Eh-
sen, biografischer Selbstreflexion, praktischen renamtes, das zeigen Studien wie der Freiwilli-
Übungen und Selbsterfahrungseinheiten. Die gensurvey, ist das Erleben einer Gemeinschaft
Auseinandersetzung mit Sinn- und Lebens- und das Zusammenkommen mit anderen
fragen bietet Orientierung und Sicherheit, um Menschen.10) „Der/die typische ‚Hospizler/in‘
Einstellungen zu reflektieren und sich der Kon- wird durch die Kultur und Praxis in der Hos-
frontation mit anderen zu stellen.7) pizbewegung im Sinne einer eigenen Verge-
meinschaftung geformt, wobei die hochindi-
Die Gruppe ist dabei eine angemessene und vidualisierte Hilfegestaltung und die vielfach
kooperative Form des Lernens. „Die Gruppe persönlich geprägten Motive, die den Zugang
ist die Form, in der Menschen sich öffnen, ihre zur Hospizarbeit öffnen, auf diese Weise zu-
Lebenserfahrungen und Leiden zeigen und mindest teilweise aufgefangen und in eine
miteinander in den Dialog, in Rollenspielen, in neue Zugehörigkeit zur Hospizgruppe trans-
einer geschützten Atmosphäre von- und mit- formiert werden. Hier liegen wichtige Funktio-
einander lernen.“8) nen der ambulanten Hospizgruppen mit dem
Ziel der Sicherung von gemeinsamer Identität
Jede*r Einzelne profitiert von der Weitergabe […].“11) Die Qualifizierung von Ehrenamtli-
und dem Austausch über das reichhaltige chen, z. B. in Form von Vorbereitungskursen,
Erfahrungswissen der Hospizbewegung, wel- bildet dabei einen Baustein und kann damit
ches erlebbar gemacht und weitergegeben die Besonderheit dieses Ehrenamtes stärken,
werden sollte.9) Die Reflexion der hochdiffe- weiterentwickeln und Menschen, die interes-
6) Klie et al.: Ehrenamtliche Hospizarbeit, 2019, S. 260.
7) Vgl. Begemann, Verena; Seidel, Sabine: Nachhaltige Qualifizierung des Ehrenamtes in der ambulanten Hospi-
zarbeit und Palliativversorgung in Niedersachsen. Ludwigsburg: der hospiz verlag, 2015, S. 73.
8) Ebd., S. 72.
9) Vgl. Klie et al.: Ehrenamtliche Hospizarbeit, 2019 sowie DHPV: Ergebnispräsentation (EbEH), 2018.
10) Vgl. Simonson, Julia; Vogel, Claudia; Tesch-Römer, Clemens; BMFSFJ (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in
Deutschland: Zusammenfassung zentraler Ergebnisse des Vierten Deutschen Freiwilligen-surveys. Berlin: Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2016, S. 37.
11) Klie et al.: Ehrenamtliche Hospizarbeit, 2019, S. 284 7siert sind, aber noch keinen Zugang gefunden in existenziellen Lebenskrisen von schwe-
haben, motivieren und gewinnen. „17 % der rer Krankheit und Sterben sucht. Um diesen
Befragten [aus der Bevölkerungsbefragung] Wandel, diese Öffnung weiter voranzubringen,
können sich grundsätzlich vorstellen, ehren- muss sich auch die Qualifizierung Ehrenamt-
amtlich in der Sterbebegleitung tätig zu sein; licher damit auseinandersetzen und reagie-
1 % ist bereits in diesem Bereich ehrenamtlich ren. Dabei geht es allerdings weniger um die
engagiert.“12) Inhalte und Strukturen eines Vorbereitungskur-
ses, sondern eher um eine breitere Öffentlich-
Die DHPV-Verbundstudie weist ebenfalls auf keitsarbeit und die Ansprache anderer, neuer
Veränderungen im Ehrenamt hin, das der- Zielgruppen sowie die Öffnung der Tätigkeiten
zeit einem Strukturwandel unterliegt. Es wird und Möglichkeiten des Engagements.
deutlich, dass sich die Hospizarbeit und Pal-
liativversorgung mit gesellschaftlichen Verän- Der Kontakt zu diversen Zielgruppen setzt bei
derungen und Herausforderungen, aber auch der Frage an: „Was würde Menschen motivie-
mit veränderten Rahmenbedingungen aus ren, um in diesem ehrenamtlichen Bereich tä-
einandersetzen sollte, will sie ihre Funktion be- tig zu werden?“ Die Studie des DHPV gibt vie-
wahren. Die Landschaft der ambulanten Hos- le Informationen über die Motivation derer, die
pizdienste in Deutschland ist im Wesentlichen bereits in der Hospizbewegung tätig sind. Die
als mittelschichtsbasierte Organisationspraxis Wahl des Ehrenamtes geschieht nicht zufäl-
charakterisiert, die (immer noch) überwie- lig, sondern ist eine bewusste Entscheidung,
gend von Frauen in der späten Erwerbs- bzw. die nach Thema, Tätigkeit, Gemeinschafts-
Nacherwerbsphase getragen wird. Als Reak- erleben, Wirksamkeit und Weiterentwicklung
tion darauf ist ein Wandel im Ehrenamt not- getroffen wird. Zusätzlich werden Aspekte wie
wendig – hin zu mehr Heterogenität, Vielfalt Freude, anderen Menschen helfen, Erweite-
und Flexibilität, um dadurch verschiedene rung der eigenen Kenntnisse, Persönlichkeits-
Zielgruppen mit unterschiedlichen sozialen entwicklung, Anerkennung, (berufliche) Quali-
und kulturellen Hintergründen zu erreichen. fikation und Erlebnis als Motivation benannt.
Hospizarbeit versteht sich als offen für jede*n,
der/die sich engagieren will, ebenso wie sie Ebenso beeinflussen die gebotenen Rahmen
sich als Unterstützungsangebot grundsätz- bedingungen den Entschluss für ein Ehren-
lich an jede*n richtet, der Hilfe und Begleitung amt und dessen Verbindlichkeit. Der Gestal-
8 12) Ebd., S. 48.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
tungspielraum in der Teilhabe, die soziale ten als wesentliche Vermittler*innen von Eh-
Einbindung, die Vielfältigkeit an Aufgaben und renamt verstärkt in den Fokus rücken, damit
die Möglichkeit des Ausprobierens bzw. epi- ein gegenseitiges Verständnis gefördert wird
sodischen Engagements (wie in der Projektar- und auf Seite der professionell Beteiligten ein
beit) werden von Menschen genau in Augen- praxisnahes und realistisches Bild davon ent-
schein genommen und auf ihre biografische steht, was Ehrenamtliche in der Hospizarbeit
Passung hin überprüft. beitragen können. „Die Teilstudie legt nahe,
dass […] die Kooperation zwischen hospizli-
Der Zugang zu einem Ehrenamt ist weiterhin chem Ehrenamt und den professionellen Ak-
eher milieugebunden, auch bei jungen Leuten. teur*innen der Medizin und Pflege unverzicht-
„Die Entscheidung für ein Engagement von bar ist – im besten Fall im Rahmen regionaler
Jugendlichen hängt vielmehr vom sozioöko- Netzwerke.“14)
nomischen Status, der Bildungsqualifikation
und der Einbindung in soziale Netzwerke, wie Viel Verantwortung liegt hier bei den Hospiz-
Familie, Freundeskreis oder eine Religionsge- diensten und Koordinator*innen. Eine Aufga-
meinschaft, ab.“13) be der Koordinator*innen lässt sich wie folgt
beschreiben: „Sie wählen neue Ehrenamtliche
Diese Gesichtspunkte gilt es zu beachten, aus, bearbeiten Anfragen und bestimmen das
will man Menschen für dieses Ehrenamt ge- Aufgabenspektrum der Hospizhelfer*innen.“15)
winnen. Zudem bedarf es einer lebenswelt- Damit tragen sie eine wichtige Funktion in der
orientierten Ansprache: Man muss bewusst Gestaltung des Strukturwandels. So sollen in
auf neue Zielgruppen zugehen, sie in ihren den Kursen die Ehrenamtlichen darauf vorbe-
Lebenswelten treffen und dort Kontakte auf- reitet werden, die Hospizidee auch dorthin zu
bauen. tragen, wo sie bislang noch kaum oder gar
nicht vertreten ist. „Denn sie sind nach Ein-
Darüber hinaus sollte die Kooperation mit schätzung und Erfahrungen der Ehrenamtli-
anderen regionalen Akteur*innen und Diens- chen in den Fokusgruppen die zentralen Mul-
13) Gille, Martina; Pluto, Liane; Santen, Eric van: Motive und Rahmenbedingungen. Anknüpfungspunkte für
Engagementförderung. In: Zivilgesellschaft und Junge Engagierte. Zivilgesellschaft KONKRET Nr. 6, 2015,
S. 7-13, S. 7.
14) Klie et al.: Ehrenamtliche Hospizarbeit, 2019, S. 267.
15) Ebd., S. 275.
9tiplikator*innen.“ 16) Grundsätzlich sollte der was die Hospizbewegung ausmacht, wie sie
erforderliche Wandel und die Zukunftspers- auf den gesellschaftlichen Wandel reagiert,
pektiven der Hospizbewegung im Kurs the- den sie zu einem bedeutenden Teil selbst vor-
matisiert und reflektiert werden, um gemein- angetrieben hat, und wie sie versuchen sollte,
sam innovative Wege zu gehen. ihn auch weiterhin erfolgreich mitzugestalten.
Abschließend lässt sich Folgendes zusam-
menfassen: Die DHPV-Studie verdeutlicht,
16) Ebd., S. 278. Mit Fokusgruppen sind hier gesellschaftliche Bereiche gemeint, die sich die Hospizbewegung
10 noch nicht erschlossen hat.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Hospizliche Haltung
Grundlagen der hospizlichen Dame Cicely Saunders, die als Begründe-
Haltung rin der modernen Hospizbewegung in den
1960er Jahren gilt, hatte ihre Heimat in eben
Die Menschen und die Organisationen der diesen Überzeugungen. Ihr Herzensanliegen
Hospizarbeit zeichnen sich durch eine Beson- war es, Menschen in ihrer letzten Lebenszeit
derheit aus: Zentrales leitendes Element des bei größtmöglicher Selbstbestimmung und
professionellen und des ehrenamtlichen Han- liebevoller Pflege ein Leben in Würde bis zu-
delns ist die sog. hospizliche Haltung, welche letzt zu ermöglichen.
sich in einem ihr verpflichteten Verhalten zeigt.
Philosophische Wurzeln hat die Hospizidee
Eine Haltung zu haben bedeutet, aus einer desgleichen in den Grundgedanken von Mar-
Grundüberzeugung heraus zu handeln, die tin Bubers „Dialogik der Zwischenmenschlich-
die ganze Person umfasst, ihren Körper, ihren keit“ 17). Die Grundannahme über die mensch-
Geist und ihre Gefühle. Eine Haltung besteht liche Natur spiegelt sich in der grundlegenden
nicht aus einer konkreten Regel, sie ist viel- Haltung wider, dass menschliches Leben bis
mehr eine Handlungsdisposition, die sich im zum Ende wertvoll ist und dass Menschen als
Laufe des Lebens und Erlebens einer Person, soziale Wesen auch bis zuletzt eingebettet
also im individuellen Lebensvollzug, entwi- in soziale Beziehungen sein sollen. Mühlum
ckelt. fasst dies in Anlehnung an Napiwotzky und
Student 18) zusammen:
In der Geschichte der Hospizbewegung las-
sen sich dafür verschiedene Grundlagen fin- „Hospizliche Haltung drückt sich im Respekt
den. Zum einen ist die christliche Tradition der vor der Würde und Selbstbestimmung des
Hospize als Herberge für Pilger und Reisen- schwer kranken und sterbenden Menschen
de, Arme und Kranke zu nennen. „Hospitium“ aus, nimmt seine Anliegen ernst, behält eine
(lat.) bedeutet übersetzt Gastfreundschaft und ganzheitliche Sicht im Sterbeprozess bei, lässt
verweist dabei sowohl auf deren menschliche den Sterbenden nicht allein und unterstützt
als auch spirituelle Dimension. Angehörige und Freunde, von denen der Ster-
17) Höver, Gerhard: Auf ein Versprechen vertrauen – zur Grundlegung hospizlicher Haltung. In: Die Hospiz-Zeit-
schrift Nr. 53 (03/2012), S. 12-16, S. 12.
18) Napiwotzky, Annedore; Student, Johann-Christoph (Hrsg.): Was braucht der Mensch am Lebensende? Ethi-
sches Handeln und medizinische Machbarkeit. Stuttgart: Kreuz, 2007. 11bende Nähe und Geborgenheit erwartet“.19) Eine hospizliche Haltung ist aus der Sicht
Diese Haltung in angemessenes Verhalten zu des DHPV für die Sterbebegleitung
„übersetzen“, wird durch Zuhilfenahme von unabdingbar. Zu ihr gehören:
(Beratungs-)Konzepten und Methoden nach
Carl Rogers sowie Ruth Cohn unterstützt. Liebe zum Menschen im Sinne der Nächs-
tenliebe mit Einfühlungsvermögen und Em-
In der empirischen Untersuchung von Bege- pathie
mann und Seidel zur Qualifizierung Ehrenamt-
licher in der Hospizarbeit werden als Elemen- Sterben als Teil des Lebens anerkennen
te einer grundlegenden hospizlichen Haltung (Leben weder verlängern noch verkürzen)
benannt: „Empathie, […], Nächstenliebe/
Menschenliebe, Offenheit, Toleranz, Ehrlich- Fähigkeit und Bereitschaft zur Selbstreflexi-
keit, Geduld, Wertschätzung, Achtsamkeit on und zur kritischen Auseinandersetzung
und Zuverlässigkeit.“ 20) Diese Grundhaltungen mit der eigenen Person: sich selbst öffnen
stimmen mit den Bedingungen für hilfreiches können (auch z. B. bei Gruppentreffen und
Handeln nicht nur in Beratungsbeziehungen, Supervision)
sondern auch in allgemeinen menschlichen
Beziehungen überein; sie werden vom ame- Wertschätzung und vorurteilsfreie Zuwen-
rikanischen Psychotherapeuten Carl Rogers dung – ergebnisoffene Begleitung mit Auf-
als Empathie (einfühlendes, nicht werten- geschlossenheit und Toleranz gegenüber
des Verstehen), bedingungsfreie Akzeptanz anderen Meinungen und Denkweisen von
und Wertschätzung, sowie Selbstkongruenz Begleiteten, Zugehörigen und Kolleg*innen
(Echtheit) benannt.
Fähigkeit und Bereitschaft zur Zurückhal-
tung: eigene Werte nicht in den Vordergrund
stellen, sondern situationsangemessen ver-
treten und reflektieren
Selbstverständnis als Teil einer Sorgekultur
(im Sinne von „Mitglied“)
19) Mühlum, Albert: Hospiz – Palliative Care – Soziale Arbeit. Das Lebensende als finale Herausforderung. In: Ethik-
Journal 2 (02/2014), S. 1-19, S. 6.
12 20) Begemann; Seidel: Nachhaltige Qualifizierung, 2015, S. 67.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Bewusstheit über (eigene) Grenzen von Angestrebt wird, dass die Kursteilnehmer*in-
Machbarkeit: eine „gewisse Leidensfähig- nen ihre persönlichen Überzeugungen und
keit“ beim Mitaushalten von Nöten des Ge- Einstellungen reflektieren, sie bewusst in Be-
genübers (z. B. körperlichen Symptomen ziehung zur dargestellten hospizlichen Hal-
von Begleiteten) tung setzen und in einem weiteren Lernschritt
üben, ihre Haltung in angemessenes, res-
Resilienz, Selbstvertrauen und psychische pektvolles und achtsames Handeln dem be-
Belastbarkeit gleiteten Menschen gegenüber umzusetzen.
Unter Haltung verstehen wir: Herzensbildung,
Geduld, Ausdauer und Kontinuität Selbstreflexion und Wissen.
Authentizität Echtheit, die Verlässlichkeit Der Vorbereitungskurs dient auch dazu, ge-
herstellen kann meinsam mit der Gruppe der Teilnehmenden
und evtl. schon aktiver Gruppenmitglieder des
Zuverlässigkeit: Verschwiegenheit gegen- ambulanten Hospizdienstes eine gemeinsa-
über Dritten, Termintreue, Einhalten von me Identität (Wir-Gefühl und Identifikation mit
Absprachen, Teilnahme an Gruppentreffen den Zielen der Hospizarbeit) zu entwickeln.
und Supervision, Fortbildungswille
Wenn es um die Entwicklung bzw. die Vertie-
fung von Haltungen geht, kommt deshalb der
Person der Kursleitung (in Abgrenzung zum
Das wichtigste Instrument in der Begleitung rein kognitiven Lernen) eine besondere Be-
sind die Begleiter*innen selbst. Darum sind die deutung und Modellfunktion zu.
Vermittlung und Entwicklung der hospizlichen
Haltung das Kernthema und der rote Faden
in einem Vorbereitungskurs für ehrenamtliche
Sterbebegleitung. Dabei muss wertgeschätzt
und respektiert werden, dass die am Vorberei-
tungskurs Teilnehmenden ihre individuelle Le-
benserfahrung und Persönlichkeit mitbringen.
13Die Haltung der Kursleitung dik und Didaktik von Lehrenden deren eige-
ne Einstellungen, Werthaltungen und Über-
Die beschriebenen Wertvorstellungen in Vor- zeugungen. „Denn Haltung kann nicht durch
bereitungskursen zu „transportieren“, stellt bloße Instruktionen gelehrt werden, sondern
eine große Herausforderung für Kursleitende die Lehrenden müssen diese verkörpern und
dar. Ihr Auftrag ist es, die Teilnehmenden in vorleben“.22)
einem Entwicklungsprozess zu begleiten,
in dessen Fokus vor allem die Reflexion des Deshalb sollten sich auch folgende Elemente
eigenen Menschenbildes und der damit ver- in der Haltung der Kursleitung im hospizlichen
bundenen Haltungen steht. Die Kursleitung Rahmen widerspiegeln:
muss – neben der Erfahrung in der Leitung
von (ehrenamtlichen) Gruppen und im Bil- Kenntnisse und Fertigkeiten analog der
dungsbereich sowie der methodischen und Ziele des Vorbereitungskurses
didaktischen Kompetenz – Kenntnisse, Fähig- Respekt vor den Kursteilnehmenden und
keiten und Fertigkeiten im hospizlichen Feld ihren Anliegen
besitzen.21) Dazu gehören u. a. das Wissen Identifizierung mit der Hospizbewegung
über die Geschichte der Hospizbewegung, Ressourcenorientierung
Hilfen im Sozial- und Gesundheitssystem, Ins- Neugier
titutionen (Hospize, Vereinsstruktur) und deren Allparteilichkeit
Auswirkung auf ehrenamtliches und professi- Demut
onelles Handeln sowie Grundkenntnisse zu Fehlerfreundlichkeit und die Bereitschaft,
Kommunikation, Interaktion und Kooperation, sich selbst infrage zu stellen
über Krankheitsbilder und kleine Handrei- wertschätzendes Handeln
chungen am Krankenbett und menschliche offener Kommunikationsstil (behutsames
Systeme. Nachfragen)
lebensbejahende Grundhaltung
Überzeugend im Lernprozess sind laut den
Rückmeldungen der Kursteilnehmenden und Die Haltung der Lehrenden (Koordinator*in-
den Erkenntnissen der Forschung zur Metho- nen und Referent*innen) schließt ein, dass die
21) Zur Qualifikation (Anforderungsprofil) der Kursleitung vgl.: DHPV: Qualifizierte Vorbereitung, 2017, S. 10.
22) Haller, Susanne; Kasimirski, Kristina: Lehren in der Tradition von Elisabeth Kübler-Ross. In: Die Hospiz-Zeitschrift
14 Nr. 82 (02/2019), S. 18-22, S. 21.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
bei den Teilnehmenden im Vorbereitungskurs
bereits vorhandene Lebenserfahrung und das
damit verbundene Wissen wahrgenommen
und im Kursverlauf gefördert wird. Insofern ist
auch Achtung vor dem, was den Kursleiten-
den fremd oder nicht gegenwärtig ist, vonnö-
ten.
Haltung soll im Vorbereitungskurs gelebt und
nicht nur vermittelt werden: Dies ist im Beson-
deren die Aufgabe der Kursleitung.
15 Strukturelemente eines
Vorbereitungskurses
Inhalte und Lernfelder Bedürfnisse erkennen, benennen und darauf
angemessen eingehen. Außerdem geht es
Wir bauen mit dieser Rahmenempfehlung auf darum, Unterschiedlichkeit wahrzunehmen
der DHPV-Broschüre zur qualifizierten Vorbe- und auszuhalten.
reitung von Ehrenamtlichen von 2017 auf. Die
dort genannten Lernziele und Inhalte sehen Im kommunikativen Lernfeld befassen sich
wir als aktuell und verbindlich an.23) die Teilnehmenden damit, wie sie Beziehun-
gen in Begleitungen bewusst und reflektiert
Vorbereitungskurse sollten sich nach unse- aufbauen, aufrechterhalten und beenden kön-
rem Verständnis immer mit den vier folgenden nen. Sie können empathisch, wertschätzend
Lernfeldern befassen. und authentisch auf Menschen zugehen und
in dieser Begegnung die nötige Balance von
Das biografische Lernfeld schafft eine unver- Nähe und Distanz wahrnehmen und erken-
zichtbare Voraussetzung für einfühlsames Be- nen. Sie vertiefen ihre Fähigkeit, verbale und
gleiten von Menschen mit ihren individuellen nonverbale Kommunikation besser wahrzu-
Lebensentwürfen: die Auseinandersetzung mit nehmen, sie zu verstehen und üben sich dar-
der persönlichen Lebensgeschichte und den in, Stille auszuhalten.
eigenen Erfahrungen von Abschied, Verlust,
Sterben, Tod und Trauer Beschäftigung mit Im informativen Lernfeld werden die we-
anderen Biografien in der Vorbereitungsgrup- sentlichen Informationen zur Hospizarbeit und
pe hilft zu sensibilisieren, die eigenen Erfah- Palliativversorgung in Deutschland sowie zu
rungen nicht auf andere zu übertragen. medizinischen und pflegerischen Grundinfor-
mationen vermittelt. Dazu gehören das Wissen
Das spirituelle Lernfeld trägt dazu bei, dass über die Auswirkungen von unterschiedlichen
die zukünftigen Ehrenamtlichen sensibel für Krankheiten im Lebensalltag, Symptomkon-
Spiritualität als Dimension menschlichen Le- trolle und Schmerztherapie, Essen und Trin-
bens werden. Sie reflektieren dabei Fragen ken am Lebensende sowie Kenntnisse über
der eigenen Spiritualität und Glaubensvorstel- Zusammenhänge und Systeme (wie Fami-
lungen als Basis ihres Wertesystems und kön- lien und Institutionen), die Sterbeorte sind
nen eigene und fremde spirituelle und religiöse (z. B. Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen).
16 23) DHPV: Qualifizierte Vorbereitung, 2017, Lernziele (S. 8-9) und Inhalte (S. 11-13).Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Es werden ethische und juristische Aspekte
in der Hospizbegleitung (wie Patientenverfü-
gung, Vorsorgevollmacht, Sterbewünsche)
angesprochen und über andere wichtige As-
pekte (wie das Bestattungswesen) informiert.
Biografisches Lernfeld Spirituelles Lernfeld
Lerninhalte 24):
Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie
Kontakt und Kommunikation
Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie mit ihren Nahe-
stehenden
Trauer
Begriff des „Helfens“
Nähe und Distanz
Spiritualität und Religiosität
Hospizkonzept und Hospizbewegung
Tätigkeiten und Vernetzung in Hospiz- und Palliativeinrichtungen
Ethische und rechtliche Aspekte am Lebensende
Kommunikatives Lernfeld Informatives Lernfeld
24) Vgl. DHPV: Qualifizierte Vorbereitung, 2017, S. 11-13. 17Die Auseinandersetzung mit der eigenen kus des kommunikativen Lernfeldes können
Person und das Lernen aus persönlichen Er- sich Fragen stellen wie: Wie biete ich Hilfe
fahrungen sowie das Thema Kommunikation an? Nehme ich Appelle und versteckte „Hil-
ziehen sich wie ein roter Faden durch den ge- ferufe“ wahr? Was sind Signale verbaler und
samten Vorbereitungskurs. Selbsterfahrung nonverbaler Art? Wie finde ich eine angemes-
ist ein wiederkehrender Bestandteil aller Lern sene Sprache, ohne mich aufzudrängen oder
inhalte. Darum bilden diese vier Lernfelder zu distanziert zu wirken? Beim informativen
eine Basis des Vorbereitungskurses, zu denen Lernfeld kommen Themen zur Sprache wie:
die Inhalte immer wieder in Bezug gesetzt Welche Hilfesysteme kenne ich in meiner
werden. Sie helfen, die unterschiedlichen Stadt für Schwerstkranke und ihre Zugehöri-
Lerninhalte zu bearbeiten und bestimmte Fa- gen? Wohin oder an wen kann ich sie wei-
cetten besonders zu fokussieren. tervermitteln? Wen kann/muss ich fragen? Im
spirituellen Lernfeld bieten sich Fragen zum
Dabei haben die Lernfelder im Hinblick auf Hilfe geben/nehmen an, z. B.: Von welchen
die einzelnen Lerninhalte eine unterschiedli- Kräften, Mächten und Ideen fühle ich mich
che Gewichtung. Zwei Beispiele verdeutlichen getragen? Was sind meine Überzeugungen
diesen Umstand und bieten eine kleine Um- und Gedanken zum Sinn von Krankheit und
setzungshilfe. vom Angewiesenen auf andere? Welche Ant-
worten habe ich für mich in unterschiedlichen
Weltanschauungen (Religion, Philosophie) zu
Beispiel 1: diesem Thema gefunden?
Lerninhalt „Hilfe geben und Hilfe anneh-
men“
Beispiel 2:
Durch die Brille des biografischen Lernfeldes Lerninhalt „Patientenverfügung“
beschäftigt sich die/der Kursteilnehmer*in mit
Fragen wie: Wo habe ich in meinem Leben Hier spielt das informative Lernfeld eine grö-
Hilfe angenommen/annehmen müssen? Was ßere Rolle: Wie grenzen sich Stellvertretung
fiel mir leicht, was schwer? Von wem kann (durch Vollmacht oder rechtliche Betreuung)
ich Hilfe annehmen? Wie fühle ich mich dabei und Patientenverfügung voneinander ab und
(stark, schwach, ausgeliefert). Was mache ich wie hängen sie zusammen? Was sind die
lieber: Hilfe geben oder annehmen? Im Fo- rechtlichen Grundlagen, was ist in der Praxis
18Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
zu beachten? Dennoch lässt sich auch dieses sind und sich für einen Vorbereitungskurs
Thema nicht ohne die Bezüge zu den eigenen anmelden, bringen in der Regel reichhaltige
Erfahrungen der Teilnehmenden mit An- oder Lebenserfahrung mit, die unabhängig vom
Zugehörigen, egal ob positiv oder negativ, be- Lebensalter zutage tritt. Diese bereits vorhan-
sprechen (biografisches Lernfeld). Auch das denen Kompetenzen, also Fähigkeiten und
spirituelle Lernfeld ist mit der Frage „Woran Fertigkeiten, sind die Grundvoraussetzung für
glaubst Du?“ präsent und zu bearbeiten. Das das angestrebte Kursziel, sich als „Fachleu-
kommunikative Lernfeld zeigt sich in der Be- te für das Alltägliche“ 25) weiterzuentwickeln.
antwortung der Frage, wie solche Themen in Die sog. ‚selbstreflexive Kompetenz‘, also die
den Begleitungen angesprochen werden kön- Fähigkeit, über sich selbst und die eigenen
nen. Haltungen vertieft und kritisch nachzuden-
ken, ist grundlegendes Ziel der Vorbereitung.
Alle Lerninhalte sind also danach anzuschau- Dazu gehört, dass eine Haltung in Handeln
en, wie die vier Lernfelder in der Vermittlung überführt werden kann. Menschen benöti-
jeweils Gewicht und Bedeutung bekommen gen ebenfalls Sachkenntnis z. B. über Krank-
können. heitsverläufe, seelische Nöte, Trauer oder den
körperlichen Sterbeprozess etc. Wichtig und
Mindestens für die ersten beiden Lernfelder notwendig erscheint uns auch, hilfreiches
(das biografische und das spirituelle) ist es Handeln (z. B. Zuhören und Verstehen, Vermit-
für jeden einzelnen Teilnehmenden unbedingt teln von Informationen usw.) in der Interaktion
notwendig, Vertrauen in der Gruppe zu ent- mit Schwerstkranken und ihren Zugehörigen
wickeln. Dies geschieht durch die unmittel- im Vorfeld einzuüben.
bare Interaktion. Unserer Meinung nach sind
diese Lernfelder sowie die damit verbundene
prozessorientierte Form des Lernens nicht Zeitliche Struktur und Einheiten
geeignet für neue Lernformen wie Kurs-Mo-
dularisierung oder E-Learning. Diese können Für die Vorbereitung zur ehrenamtlichen Ster-
jedoch für den Erwerb von Sachwissen im in- bebegleitung werden mindestens 100 Unter
formativen Lernfeld angewendet werden. richtseinheiten (UE) à 45 Minuten und ein
Praktikum empfohlen. Auf dieser Basis hat
Menschen, die an einer ehrenamtlichen Mit- sich eine Dauer der Vorbereitung von 6 bis 12
arbeit in der Hospizbewegung interessiert Monaten als sinnvoll erwiesen.26)
25) Student, Johann-Christoph (Hrsg.): Das Hospiz-Buch. Freiburg im Breisgau: Lambertus, 1989, S. 81-82.
26) Vgl. DHPV: Qualifizierte Vorbereitung, 2017, S. 10. 19Vorbereitungskurse für ehrenamtliche Sterbe- der gestaltet werden. Darüber hinaus sind
begleitung, die optimalerweise in Gruppen zwi- langjährige ehrenamtliche Mitarbeiter*innen,
schen 8 bis 16 Teilnehmer*innen stattfinden, die z. B. aus gesundheitlichen Gründen nicht
können unterschiedliche Abläufe und Formate mehr im gewohnten Ausmaß für Begleitungen
haben. Während das Kurskonzept „Sterben- zur Verfügung stehen, motiviert, den Hospiz-
de begleiten lernen“ (das sog. „Celler Modell“) dienst ihren aktuellen Möglichkeiten entspre-
mit einem Grundkurs (40 UE) und einem Ver- chend zu unterstützen: So dienen sie als Mul-
tiefungskurs (40 UE) mit einer dazwischen- tiplikator*innen der Hospizidee.
liegenden Praxisphase (Praktikum und dazu
gehörende fallbezogene Praxisbegleitungen)
arbeitet, gehen andere Curricula von einem Einstiegsmodul Basiswissen
durchlaufenden Kurs mit einer Praxisphase
aus. Vorbereitungskurse können in einer Mi- Die bereits angesprochene Pluralität der Tä-
schung aus Abendveranstaltungen (2–4 UE), tigkeitsfelder in der Hospizarbeit lässt eine
Tagesseminaren (8 UE) und Wochenendsemi- ehrenamtliche Mitwirkung in den unterschied-
naren (16–20 UE) durchgeführt werden. lichen Bereichen der Hospizarbeit auch ohne
den umfangreichen Vorbereitungskurs zu,
Wir empfehlen besonders für die biografi- welcher der qualifizierten Sterbebegleitung
schen und spirituellen Lernfelder genügend dient. Innerhalb des Kurses besteht die Mög-
Zeit in den einzelnen Unterrichtseinheiten lichkeit das Einstiegsmodul zur Einführung in
einzuplanen. Da bei diesen Themen viele per- die Hospizarbeit separat zu besuchen.27)
sönliche Themen anklingen können, muss
genügend Zeit für Bearbeitung und Reflexion Der erste Teil (12–16 UE) beinhaltet die Ge-
bleiben. schichte der Hospizbewegung, die Grundla-
gen der hospizlichen Haltung, die Vielfalt der
Die bisherige Erfahrung in den Hospizdiensten ehrenamtlichen Hospizarbeit und ihre Ausprä-
zeigt, dass eine Teilnahme am qualifizierten gung im jeweiligen ambulanten Hospizdienst,
Vorbereitungskurs dazu beitragen kann, dass die Versorgungsmöglichkeiten am Lebensen-
Öffentlichkeitsarbeit oder Sponsorensuche de sowie die spezifischen Strukturen der Regi-
kompetenter und damit auch überzeugen- on. Er vermittelt als Einstiegsmodul Basiswis-
27) Vgl. Gratz, Margit; Mayer, Gisela; Weidemann, Anke: Schulung ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Stuttgart: Verlag
20 W. Kohlhammer, 2015, S. 23-27.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
sen auch für Personen, die nicht den ganzen menzerkrankungen oder Beeinträchtigungen)
Vorbereitungskurs besuchen, sich aber in die oder zu speziellen Lebensräumen und -situa-
Hospizarbeit einbringen möchten, wie z. B.: tionen (z. B. Migration und Flucht, Wohnungs-
als Vorstandsmitglieder im Verein losigkeit oder Strafvollzug).29) Dies können
im Büro- oder Telefondienst auch Vertiefungen von Themen aus dem Vor-
in der Öffentlichkeitsarbeit (bei der Erstel- bereitungskurs sein (z. B. Basale Stimulation
lung und Betreuung einer Website o. Ä.) oder Musik in der Begleitung). Anzudenken
im Fundraising sind zudem kooperative Kurse mit Pflegeein-
bei weiteren unterstützenden Tätigkeiten richtungen und Krankenhäusern, um gemein-
sam voneinander zu lernen und weiter für die
Für diese Personengruppen ist es wichtig Hospizkultur zu sensibilisieren.
oder zumindest hilfreich, dieses Basiswissen
evtl. gemeinsam mit zukünftigen Sterbebe-
gleiter*innen zu erlangen, da durch das Erle- Praktikum im Vorbereitungskurs
ben der 12 bis 16 Unterrichtseinheiten schon
ein gemeinsames Kennenlernen erfolgt und Wir empfehlen aufgrund unserer langjähri-
ein gegenseitiges Verständnis für die unter- gen Erfahrung ein Praktikum während des
schiedlichen späteren Tätigkeiten wachsen Vorbereitungskurses. Dieses kann zwischen
kann. 20 und 40 Unterrichtseinheiten dauern und
den Teilnehmenden zusätzliche Erfahrungen,
Die weiteren Einheiten sollen 80 bis 90 Un- Einsichten und Wahrnehmungen eröffnen.
terrichtseinheiten mit den vier Lernfeldern Wer etwa über keine Erfahrungen mit Men-
umfassen. Die Inhalte der qualifizierten Vorbe- schen mit einer Demenz verfügt, kann diese
reitung sind in der Handreichung des DHPV an einigen Nachmittagen in einem Pflegeheim
beschrieben.28) oder einer Wohngemeinschaft sammeln. Bei
Hospitationen bei einem ambulanten Hospiz-
Je nach Bedarf können dann weitere Baustei- oder Pflegedienst lernen die Teilnehmenden
ne zur fachlichen Ergänzung hinzukommen, unterschiedliche Lebensentwürfe „hautnah“
beispielsweise zur Begleitung bestimmter kennen und erfahren zugleich, wie wichtig es
Personengruppen (z. B. Menschen mit De- ist, dabei auf die eigenen Grenzen zu achten.
28) DHPV: Qualifizierte Vorbereitung, 2017, S. 11-13.
29) Vgl. ebd., S. 13. 21Auch ist die aus eigener Anschauung gewon- erleben und sich auszutauschen, ist generati-
nene Erkenntnis, was ambulante Pflege leis- onsübergreifend. Die Wertschätzung und die
tet, hilfreich für die späteren Begleitungen. Ein Teilhabe von Ehrenamtlichen mit ganz unter-
stationäres Hospiz oder eine Palliativstation schiedlichen Erfahrungshintergründen gilt es
bieten die Möglichkeit mitzuerleben, wie die zu stärken. Deshalb müssen wir gemeinsam
letzte Lebensphase für die Erkrankten und mit den jüngeren und älteren Ehrenamtlichen
ihre Zugehörigen gestaltet werden kann. Die daran arbeiten, wie sich die Begleitungstätig-
Praktikumserfahrungen müssen begleitet und keit, aber auch die Vorbereitungszeit an die
reflektiert werden. Dies kann in eigenen Ein- jeweilige Lebenssituation anpassen sowie an-
heiten oder integriert in das Kursgeschehen ders und ggf. neugestalten lässt.
stattfinden.30)
Anerkennung von Qualifikationen
Junges Ehrenamt
Menschen, die zur Hospizarbeit kommen,
Die Veränderungen in der Altersstruktur der bringen unterschiedliche Erfahrungen aus ih-
Ehrenamtlichen, die nach neueren Erhebun- rem Leben, aus ihrer Berufstätigkeit und aus
gen jünger aktiv werden, führen nach unse- Fortbildungen mit. Diese Erfahrungen sind
ren Erfahrungen dazu, dass wir uns anderen ein Schatz, den es im Vorbereitungskurs ge-
Formen der Didaktik und Methodik öffnen meinsam zu heben gilt. Das bedeutet nicht,
müssen. Waren es bis vor einigen Jahren dass wir automatisch solche Erfahrungen als
vorwiegend Menschen in der nachelterlichen bereits ‚abgeleistete Module‘ anerkennen.
und nachberuflichen Lebensphase, so kön- Gleichzeitig gilt in der Hospizarbeit immer
nen wir jetzt feststellen, dass Menschen in der der Grundsatz, dass im Sinne einer respekt-
vorberuflichen oder beruflichen Lebensphase vollen Haltung anderen gegenüber individuell
sowie in der Familienphase verstärkt Interesse abgestimmte und sinnvolle Lösungswege zu
am Ehrenamt in der Hospizarbeit zeigen. Das suchen und gemeinsam zu finden sind. Dies
Interesse, den Themenkomplex um Sterben, gilt auch für die Anerkennung anderer Quali-
Tod und Trauer in die Gesellschaft hineinzu- fikationen.
tragen, sich zu engagieren, Gemeinschaft zu
30) Vgl. Bayer, Bernhard et al.: Sterbende begleiten lernen. Das Celler Modell zur Qualifizierung Ehrenamtlicher
für die Hospizarbeit. Neuausgabe, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2018, S. 89 ff.; Gratz et al.: Schulung
22 ehrenamtlicher Hospizbegleiter, 2015, S. 67 ff.Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Interkulturalität aus unterschiedlichen kulturellen Zusammen-
hängen zu erweitern.
Interkulturalität 31) ist seit Jahren ein gesell-
schaftlich relevantes Thema mit wachsender Fort- und Weiterbildungen sind ein probates
Bedeutung. Auch für die Hospizbewegung Mittel, um ein Verständnis von Interkulturalität
wird es zunehmend wichtiger. In Deutschland zu entwickeln und in Handlungskompetenz
lebt inzwischen ein hoher Anteil an Menschen umzusetzen. So empfehlen wir, im Vorberei-
aus verschiedenen Kulturkreisen und mit tungskurs diesen Themenkomplex zu bear-
sehr unterschiedlichen religiösen Überzeu- beiten und die Inhalte auf die Kultursensibilität
gungen. Aus verschiedenen Gründen nutzen anzupassen. Inhalte eines solchen Themen-
noch nicht alle Menschen dieser Gruppe das blocks können sein: Umgang mit Krankheit,
hospizliche Versorgungsangebot. Es gibt seit Sterben und Tod in anderen Religionen und
Längerem Bemühungen, die Hospizarbeit da- Kulturkreisen, Bestattungsrituale, Besuch ei-
hingehend zu öffnen. „Tendenziell sind Men- nes Waschhauses für Menschen islamischen
schen mit Migrationshintergrund aber eher Glaubens usw. Dabei geht es im ersten Schritt
selten im Ehrenamt vertreten.“ 32) darum, Unsicherheiten durch Wissen und Er-
fahrungen zu relativieren. Weiterhin sollten
Eine Öffnung der Hospizversorgung ist not- eine angeleitete Reflexion des eigenen Han-
wendig, um dem eigenen Anspruch gerecht delns und der eigenen Ängste sowie das sen-
zu werden, für alle Menschen am Lebensende sible Grundverständnis anderer Weltanschau-
und ihre An- und Zugehörigen eine Begleitung ungen und Kulturen im Vordergrund stehen.33)
zu ermöglichen. Ehrenamtlichen kommt bei
diesem Prozess eine wichtige Rolle zu: Inter- Jeder Mensch ist in erster Linie durch seine
kulturell sensibilisierte und interessierte Ehren- eigene kulturelle Perspektive geprägt. Das
amtliche sind (vor allem auf der Beziehungs Wissen darum ist eine gute Basis, um den
ebene) ein wertvoller Türöffner und Kontakt. Prozess einer Öffnung und Toleranz anzusto-
Ein Ziel sollte es deshalb sein, die Vorberei- ßen. Eine Kooperation und Vernetzung mit
tungskurse in ihren regionalen Kontexten um Vertreter*innen verschiedener Kulturkreise ist
den Aspekt des Miteinanders von Menschen hinsichtlich ihres Fachwissens erforderlich.
31) Der Begriff Kultur wird hier an sich nicht nur auf Nationalität und Religion begrenzt, sondern bezieht sich auf das
Individuum, denn jede*r Einzelne hat eine andere Kultur, eine andere Sozialisation und ein anderes Wertesystem.
32) Schade, Franziska; Rieder, Nicola; Banse, Christian; Nauck, Friedemann: Was macht erfolgreiche interkulturelle
Öffnung der Hospiz- und Palliativversorgung aus? Göttingen: Klinik für Palliativmedizin, Universitätsmedizin,
2019, S. 35.
33) Vgl. Schade et al.: Interkulturelle Öffnung, 2019. 23Vertiefendes Wissen jede dieser Personen als ausgleichendes
Element zur anderen von den Teilneh-
Diese Rahmenempfehlung bezieht sich auf mer*innen wahrgenommen wird;
den Vorbereitungskurs zur Sterbebegleitung. das Kursleitungsteam sich gegenseitig als
Es gibt eine Reihe weiterer Tätigkeitsfelder, Korrektiv dienen kann;
für die ebenfalls Vorbereitungskurse bzw. in einem Stuhlkreis (der häufigsten Sitzform
Fortbildungen angeboten werden wie Trau- der Kurse) alle Teilnehmenden im Blick
erbegleitung, Hospiz macht Schule, Letzte- behalten werden können;
Hilfe-Kurse und Ähnliches. Diese Kurse haben Teilnehmer*innen aufgefangen werden kön-
wir nicht in den Blick genommen. Am Anfang nen, wenn Emotionen zutage treten, die
dieses Kapitels haben wir uns mit Fragen be- einer Intervention und/oder kurzer Auszeit
fasst, wie spezielle Themen in die Struktur der bedürfen;
Vorbereitung von Ehrenamtlichen für die Ster- das Kursbegleitungsteam miteinander den
bebegleitung eingepasst werden können. Es Kursverlauf reflektieren und daraus Schlüs-
erscheint uns sinnvoll, vertiefendes Wissen in se für die nachfolgenden Einheiten ziehen
der Begleitung von Menschen mit z. B. Behin- kann.
derungen oder Demenz zu erwerben.
Es wird empfohlen, dass die Kursleitung an
allen Kurseinheiten teilnimmt und ggf. von
Kursbegleitung weiteren Personen unterstützt wird, um die
genannten Anforderungen zu erfüllen. Bei
Die Kursbegleitung sollte aus mindestens Fachthemen wird das Hinzuziehen von Re-
zwei Personen bestehen, von denen wenigs- ferent*innen angeraten (z. B. aus Seelsorge,
tens eine über Erfahrungen in der Kursleitung Psychologie, Medizin, Pflege, Sozialer Arbeit,
bzw. Bildungsarbeit mit Erwachsenen verfü- Bestattungswesen u. a.). Dies gilt ebenfalls für
gen sollte (z. B. einer Befähigung zur Kurs- die fallbezogene Praxisbegleitung (z. B. Su-
leitung). Sie kann durch mindestens eine*n pervisor*in).
aktive*n Ehrenamtliche*n (die/der selbst einen
solchen Vorbereitungskurs absolviert haben Während der gesamten Laufzeit des Vorberei-
sollte) oder die/den Koordinator*in der Grup- tungskurses – und natürlich auch darüber hin-
pe ergänzt werden. Diese Konstellation macht aus – soll den Kursteilnehmenden die „Kultur“
es möglich, dass des Dienstes, bei dem der Kurs stattfindet,
bewusst werden. Die Identifikation mit dem
24Rahmenempfehlung zur qualifizierten Vorbereitung
Hospizdienst ist für alle Beteiligten wichtig: Ein unmittelbar in der Auseinandersetzung mit
„Wir-Gefühl“ kann und soll entstehen. den anderen Gruppenteilnehmenden erlebt.
Die Erfahrungen, Gedanken, Meinungen, Fra-
gen und Bedürfnisse der Gruppe werden zum
Didaktik und Methoden Lernfeld für individuelle Kompetenzen.
Der didaktische Ansatz der Vorbereitungskur- Zur Umsetzung der Ziele und Inhalte werden
se orientiert sich an der Themenzentrierten teilnehmer*innenorientierte, handlungsorien-
Interaktion (TZI) nach Ruth Cohn. Die TZI hat tierte und theoretisch-reflektierende Metho-
ihre Wurzeln u. a. in der Psychoanalyse und den angewandt. So werden die kognitiven,
der Humanistischen Psychologie. Als Konzept kreativen, emotionalen und sozialen Fähig-
für die Arbeit mit Gruppen basiert sie auf der keiten der Teilnehmenden gleichermaßen an-
Annahme, dass lebendiges Lernen durch Er- gesprochen. Außerdem wird eine lebendige
leben und Interaktion geschieht sowie durch Lernatmosphäre geschaffen, die das indivi-
ein Gleichgewicht zwischen der eigenen Per- duelle Leistungspotenzial und die Stärken der
son (Ich), der Gruppe (Wir) und dem Thema unterschiedlichen Teilnehmer*innen berück-
(Es) unter Berücksichtigung des aktuellen sichtigt. „Die Orientierung an den Ressourcen
Umfelds (Globe).34) der Teilnehmenden ist wichtig, damit diese
eine positive Bilanz aus dem Prozess ziehen
Konkret bedeutet das, dass Bildung nicht al- können und gestärkt daraus hervorgehen, vor
lein auf der kognitiven Ebene passiert, also allem, wenn belastende Themen behandelt
reine Wissensvermittlung ist. Die hospizliche wurden“.36)
Haltung und dazu gehörende Fertigkeiten er-
lernen die Kursteilnehmenden, wenn sie diese Die Auswahl und Schwerpunktsetzung der In-
handelnd erproben können. „Eine Entwick- halte und Methoden erfolgt prozessorientiert,
lung von (professioneller) Haltung läuft über das heißt in permanenter Abstimmung auf die
das Selbst“.35) Daher werden die Inhalte im individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden
Vorbereitungskurs beispielsweise nicht allein und auf die gruppendynamischen Entwick-
aus der reflexiven Distanz vermittelt, sondern lungen. Die Kursgestaltung geschieht trans-
34) Vgl. z. B. Langmaack, Barbara; Braune-Krickau, Michael: Wie die Gruppe laufen lernt: Anregungen zum Planen
und Leiten von Gruppen. Ein praktisches Lehrbuch. 6. Aufl., Weinheim: Beltz, PVU, 2000.
35) Kasimirski, Kristina: Die Entwicklung einer professionellen Haltung: Persönlichkeitsentwickelndes Lernen in der
beruflichen Fort- und Weiterbildung. Masterthesis, 2016.
36) Haller; Kasimirski: Lehren in der Tradition, 2019, S. 18-22, S. 22.
25Sie können auch lesen