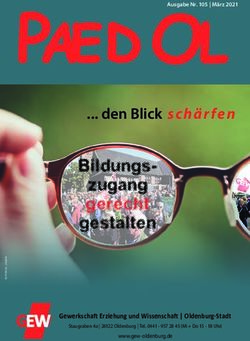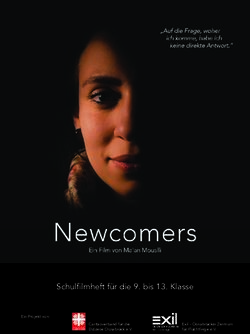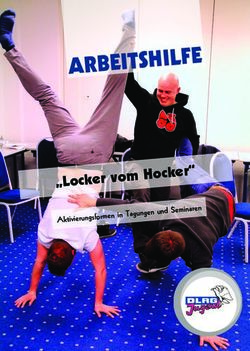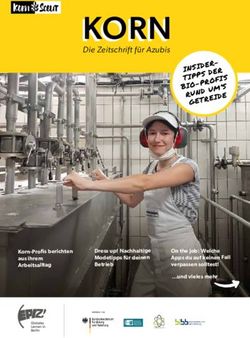SI KOMPAKT Nr. 3*2020 - Sozialwissenschaftliches Institut der EKD
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SI KOMPAKT
Nr. 3*2020
MULTIPROFESSIONALITÄT UND MEHR
Multiprofessionelle Teams in der evangelischen Kirche ―
Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven
Dr. Gunther Schendel
Pastor und wissenschaftlicher Referent
Multiprofessionelle Teams ― mehr Teams auch in der kirchlichen Diskussion an-
als ein Zauberwort? gekommen (Schendel 2020a: 130-134). Nach-
dem die Evangelische Kirche im Rheinland be-
Multiprofessionelle Teams sind heute in aller reits 2005 ein „Gemeinsames Pastorales Amt“
Munde. In Kindertagesstätten, Schulen und verschiedener Berufsgruppen in Rechtsform
Familienzentren hat die Teamarbeit von Fach- gegossen hat (EKiR 2005b), haben in den letz-
kräften aus mehreren Berufen schon seit Lan- ten Jahren auch andere Gliedkirchen der EKD
gem Einzug gehalten (Weltzien 2017; Traut- Konzepte multiprofessioneller Zusammenar-
mann 2017: 6-8; Stähling / Wenders 2015; beit entwickelt. Ein Beispiel ist die Ev.-luth. Kir-
Drosten 2015: 64-72). Gleiches gilt auch für che in Bayern (s. u., 4). Vor dem Hintergrund
den medizinischen Bereich wie z. B. für die Kin- dieses Konzepts hat der bayerische Landesbi-
derheilkunde, wo multiprofessionelle Teams schof und EKD-Ratsvorsitzende Heinrich
besonders im Umgang mit schwerstkranken Bedford-Strohm für die „Einbettung des Pfarr-
und sterbenden Neugeborenen eine wachsen- berufs in multiprofessionelle Teams“ plädiert,
de Bedeutung bekommen (Garten / von der die in übergemeindlicher Vernetzung operie-
Hude 2019). Multiprofessionelle Teams gelten ren sollen (Bedford-Strohm 2017: 151). Er
als geeignete Möglichkeit, um gerade mit schreibt: „Nur zusammen mit Kantorinnen und
komplexen Themen und Situationen adäquat Kantoren, Diakoninnen und Diakonen, Religi-
umgehen zu können. Allerdings wird von Wis- onspädagoginnen und Religionspädagogen,
senschaftler*innen auch eine Kluft von „An- Katechetinnen und Katecheten, Jugendreferen-
spruch und Wirklichkeit“ beklagt. So wird z. B. tinnen und Jugendreferenten und den als Prä-
mit Blick auf den Schulbereich betont, dass dikantinnen und Prädikanten sowie Lektorin-
Deutschland hier im Vergleich zu anderen Län- nen und Lektoren tätigen Ehrenamtlichen kann
dern immer noch ein „Entwicklungsland“ sei die Arbeit so organisiert werden, dass Ziel-
(Trautmann 2017: 7 ).1 gruppenorientierung und Menschennähe opti-
Inzwischen sind die multiprofessionellen mal mit den dafür vorhandenen Kompetenzen
verbunden werden können“ (ebd.: 156).
1 Trautmann bemängelt für den Schulbereich u. a. die fehlende
Selbstverständlichkeit bei der Heranziehung von Sozial- oder Auch in anderen Zusammenhängen stößt der
Sonderschulpädagog*innen bzw. von Psycholog*innen: Selbst Gedanke multiprofessioneller Teams inner-
an Schulen, an denen solche Spezialist*innen beschäftigt sind, kirchlich auf Resonanz. So begeisterten sich
„geben nur 45 % der Lehrkräfte an, mit diesen regelmäßig – Pastor*innen aus der Ev.-luth. Landeskirche
wöchentlich oder monatlich – zusammenzuarbeiten.“ Am
Hannovers beim dortigen Pfarrbildprozess für
häufigsten geschieht diese Zusammenarbeit noch mit den
Sonderpädagog*innen (Trautmann 2017: 7).
„multiprofessionelle Pfarrteams“. Dabei ging es
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 2
nicht nur um die Perspektive einer Arbeitsent- Kirche, die sich nach eigener Wahrnehmung
lastung (z. B. durch den Einsatz von Verwal- in einer Akzeptanzkrise befindet und auf
tungsfachleuten und Geschäftsführer*innen), der Suche nach neuer Relevanz und Akzep-
sondern was im entsprechenden OpenSpace- tanz ist (EKD 2020: 1)?
Workshop ausdrücklich genannt wurde, war
Mit diesen Fragen soll dieses SI-Kompakt auch
das Ziel, auf diesem Wege „ein konstruktives,
einen Beitrag zur Diskussion liefern, die aktuell
ausstrahlungsreiches und lustvolles Miteinan-
um das Miteinander der kirchlichen Berufe ge-
der von Menschen mit verschiedenen Professi-
führt wird (Kasparick / Schulz 2019: 131 f.; vgl.
onen und Kompetenzen“ zu fördern (ELKH
Hauschildt 2013). Die teilweise immer noch zu
2018: 18).
beobachtende Engführung der Pastoraltheolo-
Das Thema „multiprofessionelle Teams“ hat gie auf den Pfarrberuf (vgl. aktuell Karle 2020:
also Konjunktur.2 In auffälligem Kontrast dazu 132-163) wird zunehmend kritisiert (Bubmann
steht die immer noch recht seltene Reflexion 2019: 140; vgl. Grethlein 2018: 234-237). Das
dieser Entwicklung in der Praktischen Theolo- Konzept der multiprofessionellen Teams könn-
gie (vgl. aber Noller 2016; Bubmann 2019), be- te sich hier als Möglichkeit erweisen, bestimm-
sonders aber die wenig ausgeprägte Rezeption te Engführungen zu überwinden und der Dis-
der Erfahrungen, die in den vergangenen Jahr- kussion um die zukünftig erforderlichen Be-
zehnten in außerkirchlichen Handlungsfeldern rufsprofile neuen Schub zu geben.
mit dieser Form der Arbeitsorganisation ge-
macht wurden. In diesem SI-Kompakt kann das Was sind multiprofessionelle Teams?
Themenfeld nicht gründlich erschlossen wer-
Auf der Suche nach einer Definition
den. Vielmehr soll es im Folgenden darum ge-
hen, einige Schneisen zu schlagen, um das Po- Es fällt auf, dass in der kirchlich-theologischen
tential und die Bedeutung dieses Ansatzes zu Literatur in der Regel auf eine Definition des
erkunden. Das soll in Form einer Metastudie Begriffs „multiprofessionelles Team“ verzichtet
geschehen, die außerkirchliche Diskussions- wird. Offensichtlich wird der Begriff als be-
und Evaluationsergebnisse aufnimmt und mit kannt vorausgesetzt. Eine hilfreiche Definition
dem aktuellen kirchlichen bzw. theologischen bietet der Erziehungswissenschaftler Matthias
Diskussionsstand zusammenführt. Dabei soll Trautmann. Er grenzt die Arbeit in multiprofes-
auch ein erster Überblick über die Konzepte sionellen Teams von der Kooperation von An-
gegeben werden, mit denen mehrere EKD- gehörigen derselben Berufsgruppe (z. B. der
Gliedkirchen multiprofessionelle Zusammenar- „Lehrerkooperation“) ab. Dabei greift er auf
beit ermöglichen bzw. erproben. eine Definition zurück, nach der diese Form
der Zusammenarbeit darin besteht, dass bes-
Leitfragen, die in diesem Zusammenhang eine
tenfalls „mehr als zwei Berufsgruppen mit ho-
Rolle spielen, sind:
her Spezialisierung unausweichlich aufeinan-
• Was lässt multiprofessionelle Teams so zeit- dertreffen, dass detaillierte Abstimmungen
gemäß und attraktiv erscheinen? konkreter fallbezogener Handlungen erfolgen
• Inwiefern unterscheidet sich die Arbeit in und dass der Austausch kontinuierlich und
multiprofessionellen Teams von bisherigen zeitlich umfangreich ist“ (Speck u. a. 2011: 185,
Arbeitsformen? nach Trautmann 2017: 6). Diese Definition hält
• Wo liegen die Chancen und Risiken? Wel- fest, dass von einem multiprofessionellen
che Gelingensfaktoren gibt es für die Arbeit Team dann gesprochen werden soll, wenn die
in multiprofessionellen Teams? Zusammenarbeit
• Und nicht zuletzt: Wie lassen sich diese For- • berufsübergreifend,
men der Teamarbeit in die gegenwärtige • nicht zufällig,
Kirchenentwicklung und Kirchentheorie ein- • institutionalisiert und
ordnen? Gibt es einen Mehrwert für eine • fallbezogen ist.
2 Zum katholischen Konzept des überpfarrlichen Personalein-
satzes im Bistum Hildesheim s. Garhammer 2019.
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 3
Profession oder Professionalität? verstanden, die u. a. handlungsrelevantes Wis-
sen, lösungsorientierte Routinen sowie für das
Mit dieser Definition wird das Arbeiten in mul-
Handlungsfeld relevante Werthaltungen ver-
tiprofessionellen Teams nicht nur von der kol-
bindet (vgl. Weinert 2001: 51; nach Heinemann
legialen Zusammenarbeit abgegrenzt (zu
2018: 38 f.).4 Ein solches Professionalitätskon-
Pfarrteams vgl. Nierop 2016), sondern auch
zept wurde im Rahmen der EKD z. B. zur Be-
von der vernetzten Arbeit von beruflich und
schreibung der diakonisch-gemeindepädago-
ehrenamtlich Tätigen. Im Blick ist die Zusam-
gischen Berufsprofile herangezogen (Kirchen-
menarbeit beruflicher Akteur*innen. Der Ter-
amt der EKD 2014: 26).5 Als zusätzlicher Vorteil
minus „multiprofessionelle Teams“ knüpft da-
dieses Konzepts erscheint seine prinzipielle
bei an den Professionsbegriff an – meist, ohne
Offenheit für Ehrenamtliche und ihr Engage-
ihn näher zu definieren. Sehr häufig wird der
ment (ebd.: 28) – nicht unwesentlich in einer
Professionsbegriff in der allgemeinen Bedeu-
Situation, in der ehrenamtliches Engagement
tung des Berufs verwendet (vgl. Trautmann
für kirchliches Handelns immer wichtiger wird.
2017: 6): Dann geht es um die Kooperation
verschiedener beruflicher Fachlichkeiten und Der Vorschlag ist also, den Terminus „multi-
Perspektiven. Ganz vereinzelt findet sich auch professionelle Teams“ auf die Zusammenarbeit
der Rekurs auf den spezifischen Professionsbe- von Menschen unterschiedlicher Professionali-
griff (Schmerr 2017: 26 f.), der eine Profession täten zu beziehen und diese Teams damit
in der Tradition des Strukturfunktionalismus nicht a priori auf das berufliche Feld zu be-
als „Beruf[.] besonderen Typs“ definiert (Nittel schränken. So würden diese Teams z. B. auch
2000: 28). Kennzeichnend für solche Professio- „semiprofessionellen“ Ehrenamtlichen wie Prä-
nen ist ein bestimmtes gesellschaftliches Man- dikant*innen oder den Mitarbeitenden der Te-
dat, also die anerkannte Zuständigkeit für ein lefonseelsorge offenstehen. Immerhin hat
bestimmtes Handlungsfeld.3 In dieser Tradition Eberhard Hauschildt den letzteren attestiert, in
der „freien Berufe“ (Heinemann 2018: 37) wird ihrem Spezialgebiet über eine „teilweise höhe-
in der Pastoraltheologie ja oft auch der Pfarr- re Kompetenz als Pfarrer*innen“ zu verfügen
beruf gesehen (Karle 2020: 141-143). (Hauschildt 2017: 167).
Die damit betonte Sonderstellung des Pfarrbe-
Multiprofessionell, interprofessionell oder
rufs lässt es jedoch als wenig sinnvoll erschei-
transprofessionell?
nen, für die innerkirchliche Kooperation ver-
schiedener Berufsgruppen auf den spezifi- Im Bereich der Kirche wird überwiegend von
schen Professionsbegriff zurückzugreifen. Die multiprofessioneller Zusammenarbeit gespro-
anderen Berufsgruppen jenseits des Pfarramts chen; allerdings gibt es sehr vereinzelt auch
würden den Kriterien dieses „klassischen“ Pro- die Rede von „interprofessioneller“ Teamarbeit
fessionsverständnisses schlichtweg nicht ent- (EKvW 2017b: 7 u. ö., vgl. auch Sommer /
sprechen – und damit per definitionem aus Friedrichs 2019: 81). Liegt hier ein inhaltlicher
dem Team herausfallen (oder eine sekundäre Unterschied vor? Der Blick auf die Gesund-
Rolle spielen). Deshalb erscheint es sinnvoller, heitsberufe zeigt, dass in diesem Bereich der
auf das Konzept der Professionalität zu rekur- Terminus der interprofessionellen bzw. der in-
rieren, das z. B. im Rahmen des kompetenz- terdisziplinären Zusammenarbeit dominiert
theoretischen Ansatzes formuliert wurde (Mahler et al. 2014: 3). Dabei werden diese
(Heinemann 2018: 38). Professionalität wird
4 Karle spricht sinngemäß ähnlich von Professionalität, sieht
hier im Sinne einer „Handlungskompetenz“
in diesem Begriff „Wissen, Kompetenz und eine berufs-
ethisch reflektierte Handlungsausführung zusammenge-
3 Hier wird „multiprofessionelle Zusammenarbeit“ jedoch nicht fasst“. Allerdings bezieht sie die Professionalität lediglich auf
als Kooperation von Akteur*innen unterschiedlicher Professi- die „Professionen, die mit ungewöhnlich existentiellen und
onen verstanden. Die Intention ist vielmehr, die verschiede- dadurch riskanten Fragen zu tun haben (Gesundheit, Recht,
nen pädagogischen Berufe im Sinne einer klassischen Profes- Trost/Glaube)“ (Karle 2020: 143).
sion zusammenzufassen (Schmerr 2017: 26 f.). Hier wäre dann 5 Dieses Konzept der Handlungskompetenz wäre allerdings
von einer intraprofessionellen Zusammenarbeit zu sprechen im Sinne einer religiös-lebensweltlichen Deutungskompe-
(vgl. Mahler et al. 2014: 2). tenz zu erweitern (vgl. unten 5, These 4).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 4
und andere Begriffe (z. B. multiprofessionell) die zitierten Differenzierungen für die Analyse
„oftmals synonym genutzt“ (Schärli et al. 2017: einzelner Modelle, vor allem aber für die Ver-
2). Allerdings wird die Vielfalt dieser Begriffe in zahnung mit bestimmten Modellen der Kir-
der internationalen Diskussion auch dazu ver- chenentwicklung, zu nutzen (s. u., 5).7
wendet, um die „Art“ bzw. die „Intensität der
Zusammenarbeit“ zu charakterisieren: „So be- Warum haben multiprofessionelle
schreibt die ,multiprofessionelle Zusammenar-
beitʻ das Arbeiten der Berufe neben- und weit-
Teams Konjunktur?
gehend unabhängig voneinander“, während Die Diskussion über multiprofessionelle Arbeit
sich bei der interprofessionellen Zusammenar- hat eine lange Tradition: Bereits 1975 nahm
beit „die Kompetenzen der unterschiedlichen der Deutsche Bundestag die sogenannte Psy-
Berufe“ überschneiden.6 Am intensivsten ist chiatrie-Enquete entgegen, in der explizit die
die Zusammenarbeit der transprofessionellen Schaffung multiprofessioneller Teams vor-
Art: Hier „verschwinden die Grenzen der ein- schlagen wurde. Ihre Einrichtung wurde emp-
zelnen Berufe, und die Kompetenzen sind fohlen, um qualifiziert über eine „bedarfsge-
wechselseitig austauschbar“ (Mahler et al. rechte“ Weiterleitung kranker Menschen in
2014: 2); in jedem Fall werden hier aber die entsprechende Behandlungseinrichtungen
professionellen Rollengrenzen überschritten entscheiden zu können („Assessment“). Die
(Goudinoudis 2012: 107-113), was zu neuen entsprechende Diagnostik sollte in einem
Aushandlungsprozessen führt (Selke 2020: „,multiprofessionellenʻ Team von Ärzten ver-
347). schiedener Fachgebiete, Psychologen, Sozial-
multiprofessionell interprofessionell transprofessionell
Akteur*innen aus meh- nebeneinander an ver- … miteinander, unter … überschreiten im
reren Berufen schiedenen Aufgaben Austausch ihrer professi- Miteinander ihre Rollen-
onellen Perspektiven, an grenzen und handeln sie
derselben Aufgabe damit neu aus
Hier wird eine beeindruckende Vielfalt der Be- arbeitern und Krankenpflegepersonal“ stattfin-
zeichnungen und Differenzierungen deutlich, den (Deutscher Bundestag 1975: 252). Auch in
die in der deutschsprachigen Diskussion oft mehreren Gliedkirchen der EKD wurde im Zu-
noch nicht angekommen ist. Das gilt für den ge der Kirchenreform der frühen 1970er Jahre
Gesundheitsbereich (Mahler et al. 2014, Schärli die Arbeit in gemischt-professionellen Teams
et al. 2017), erst recht aber für den Bereich der erprobt, die damals unter Bezeichnungen wie
Kirche. Darum wird hier pragmatisch vorge- Gruppenpfarramt, Gesamtpfarramt oder erwei-
schlagen, mit dem sich in der Einführung be- tertes Pfarramt firmierten (vgl. Behnken u. a.
findlichen Terminus „multiprofessionelle 2011: 402; Roosen 1997: 122-130).8
Teams“ als Oberbegriff weiterzuarbeiten, aber
Warum scheint die Arbeit in multiprofessionel-
6 Die Ev. Kirche in Westfalen greift ebenfalls eine aus dem
len Teams heute, mehr als vierzig Jahre später,
Gesundheitswesen stammende Definition von Interprofessio-
nalität auf. Danach besteht Interprofessionalität in einer
eine neue Plausibilität zu bekommen? Warum
„Lehre und Tätigkeit, die zustande kommt, wenn Fachleute die Renaissance einer Arbeitsform, die inner-
von mindestens zwei Professionen gemeinsam arbeiten und kirchlich zwar erprobt, aber in den seltensten
voneinander lernen im Sinne einer effektiven Kollaboration“, Fällen weitergeführt wurde?9 Bei der Sichtung
die zu Qualitätsverbesserungen im Output führt (BAG 2017: entsprechender konzeptioneller Äußerungen
5, nach: EKvW 2020: 2).
fallen zwei Ansatzpunkte auf. Der eine Ansatz-
7 Wenn die Ev. Kirche in Westfalen unter „interprofessioneller
Teamarbeit“ u. a. versteht, dass im Falle einer Vakanz „einer 8 Damals handelte es sich um Pfarrteams, aber auch um
Gemeindepädagogin oder einem Diakon die Arbeit in Ar- Teams, die andere Berufsgruppen verantwortlich integrier-
beitsfeldern mit pädagogischen, diakonischen oder auch ten (404 ff.).
verkündigenden Arbeitsfeldern zu übertragen“ (EKvW o. J.), 9 Ausnahme ist das Gemeinsame Pastorale Amt der Ev. Kirche
dann steht hier tatsächlich die für die Interprofessionalität im Rheinland, das in Anknüpfung an die ROSTA-Konzepte
typische Kompetenzüberschneidung im Vordergrund. formuliert wurde.
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 5
punkt liegt beim kirchlichen Personal. Die Ar- Die zweite Argumentationslinie setzt beim ak-
beit in multiprofessionellen Teams wird hier als tuellen kirchlichen Auftrag an; multiprofessio-
Möglichkeit gesehen, um auf den aktuellen nelle Teams werden in der Diskussion vielfach
bzw. absehbaren Mangel an Pfarrpersonen zu als Möglichkeit gesehen, das kirchliche Han-
reagieren – oder um Pfarrpersonen von der deln zu optimieren. Orientierungspunkte, die
aktuellen Aufgabenfülle zu entlasten. Die Idee in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen,
ist, den Mangel an Pfarrpersonen durch die sind z. B. „Zielgruppenorientierung und Men-
Übertragung von Aufgaben an andere Berufs- schennähe“ (Bedford-Strohm 2017: 156) oder
gruppen zu kompensieren (EKvW 2017b: 19 u. die „Öffnung in den Sozialraum“, damit
44)10 bzw. die „Lebbarkeit“ des Pfarrberufs „Menschen die diakonische Kirche in ihrem
dadurch zu sichern, dass er in multiprofessio- Lebensumfeld wahrnehmen und sich ange-
nelle Teams eingebettet wird (Bedford-Strohm sprochen fühlen“ (Albrecht 2019: 49). Diese
2017: 154 u. 151). In diesem Zusammenhang Ausrichtung auf die „differenzierter geworde-
wird auch eine Unterstützung durch „verbes- nen gesellschaftlichen Bedingungen kirchlicher
serte Assistenz im Pfarrbüro und andere Ver- Arbeit“ ist keineswegs neu; sie stand auch
waltungsentlastungen“ angemahnt; das Ziel schon bei entsprechenden Überlegungen der
ist, den Pfarrpersonen „zusätzliche Zeit für den Kirchenreform der 1970er Jahre Pate (Pohl
Einsatz in der Seelsorge“ freizuhalten (ebd.: 2016: 21).
155).
Allerdings scheinen sich im Zeitvergleich zwei
Damit knüpfen diese beiden Argumentationsli- Bedingungen kirchlicher Arbeit verändert zu
nien an aktuelle Probleme an, die vor allem die haben: Die (antizipierte) Ressourcenkrise, die z.
Berufsgruppe der Pastor*innen betreffen. Je B. 1970 der Motor für das weitreichende Ko-
höher die Bedeutung dieser Berufsgruppe ver- operationsmodell des Raumordnungs- und
anschlagt wird, umso dringlicher muss für den Strukturausschusses der Evangelischen Kirche
Mangel an Pfarrpersonen und die auch empi- im Rheinland (ROSTA) darstellte (Roosen 1997:
risch feststellbare Arbeitsbelastung (Schendel 123), hat sich derweil verschärft und vielfach
2017: 65-71; Stahl et al. 2019) Abhilfe geschaf- zur Schaffung größerer kirchlicher Einheiten
fen werden. Damit eng verbunden ist die Per- und der Stärkung der mittleren Ebene geführt.
spektive, dass die Professionalität der verschie- Jetzt gibt es an vielen Stellen die Kooperati-
denen Berufe möglichst optimal zum Einsatz onsräume, die zurzeit des ROSTA noch etab-
kommt. Was bei den Pastor*innen die bereits liert werden sollten. Auch wenn sie immer
genannte Seelsorge ist, ist bei den Dia- noch Gegenwehr auslöst,12 scheint „überge-
kon*innen z. B. die Kompetenz für den „Sozial- meindliche Vernetzung“ (Bedford-Strohm
raum“ (Albrecht 2019: 49, vgl. 48). Hier werden 2017: 156) jetzt realistischer als damals. Zu-
z. T. auch berufspolitische Positionierungen gleich ist innerkirchlich, aber auch gesamtge-
deutlich, wenn Pfarrvertretungen mit der sellschaftlich das Bewusstsein für die Komple-
Schaffung von Verwaltungsstellen die Hoff- xität gesellschaftlicher Prozesse gewachsen.
nung auf „mehr Zeit fürs Eigentliche“ verbin-
So wird bei der aktuellen Literatur zu multipro-
den (Matthaei 2018: 390)11 oder eine Reprä-
fessionellen Teams im Bildungsbereich auf die
sentant*in der diakonisch-gemeindepädago-
wachsende Komplexität der Herausforderun-
gischen Berufe das Plädoyer für multiprofessi-
gen und Aufgaben hingewiesen: Inklusion,
onelle Teams mit der Hoffnung verbindet, auf
Ganztagsbetrieb mit Nachmittagsangeboten,
diese Weise eine aufs Pfarramt zentrierte
individuelle Förderkonzepte machten, so wird
„Organisationskultur“ in Richtung einer „Zu-
betont, den Unterricht „zur gemeinsamen Auf-
sammenarbeit auf Augenhöhe“ zu verändern
gabe im multiprofessionellen Team“ (Schäfer
(Albrecht 2019: 49).
et al. 2017: 32). In bemerkenswerter Parallelität
leiten auch Konzepte der Agilität ihre Forde-
10 Explizit genannt werden hier Gemeindepädagog*innen bzw.
rung nach „cross-funktionale[n] Teams“ von
Diakon*innen.
11 Eine grundlegende Skepsis gegenüber multiprofessionellen 12 Vgl. Gisela Kittels aktuelle Kritik an „Großgebilde[n]“ (Kittel
Teams findet sich bei Kittel 2020. 2020).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 6
der Beobachtung gestiegener Komplexität ab. ten Form von entsprechenden Teams (ebd.: 8).
Die Überzeugung ist hier: „Komplexität kann
Soweit der Soziologe Armin Nassehi. Sehr ein-
gemeinsam von verschiedenen Fachpersonen,
dringlich hat der Theologe Steffen Schramm
Blickwinkeln und Ebenen bearbeitet werden“,
solche systemtheoretischen Überlegungen
am besten in einem „Experimentiermodus“, bei
aufgegriffen13 und den aktuellen Verände-
dem am Anfang oft nicht klar ist, „worin das
rungsprozess der evangelischen Landeskirchen
gute Ende besteht“ (Levesque/Vonhof 2018:
analysiert. Er sieht die Kirchen seit den 1990er
19).
Jahren auf dem Weg von der „Differenzie-
Aber worin besteht der Zusammenhang zwi- rungsphase“ zur „Integrations- und Assoziati-
schen der vielberufenen Komplexität und der onsphase“ (Schramm 2015: 476). War die Dif-
Arbeit in multi- bzw. interprofessionellen ferenzierungsphase durch das additive Neben-
Teams? Der Soziologe Armin Nassehi leitet die einander gemeindlicher und funktionaler Ar-
Notwendigkeit interprofessioneller Arbeit und beitsfelder und den „innerkirchlichen Nachbau
einer entsprechenden „Kompetenz für unter- gesellschaftlicher Differenzierung“ (Schramm
schiedliche Logiken“ direkt aus der Komplexi- 2015: 504) geprägt, so ist das Netzwerk das
tät moderner Systeme ab. Er rekurriert auf die Paradigma der aktuellen „Integrations- und
Systemtheorie, der zufolge diese Komplexität Assoziationsphase“. Das gilt innerkirchlich für
das Ergebnis der „funktionale[n] Differenzie- die Vernetzung der einzelnen Arbeitsfelder
rung“ ist. Zu ihren wesentlichen Kennzeichen (Integration), aber nicht für die Kooperation
gehören die „Multiplikation von Perspektiven“ „mit nichtkirchlichen Gruppen/Organisatio-
und die „gleichzeitige Wechselwirkung“ unter- nen“ („Assoziation“, ebd.: 523). Für Schramm
schiedlicher Faktoren, die an die Stelle der ist der Übergang zur Netzwerkorganisation ein
„seriellen Kausalität“ tritt (Nassehi 2019: 119; geeigneter Weg, um angesichts der aktuellen
vgl. Nassehi 2018: 106-113). Diese Komplexität Mitglieder- und Ressourcenentwicklung und
hat nach Nassehi erhebliche Folgen für profes- einer „erhöhten Umweltdynamik“ (ebd.: 490)
sionelles Handeln: Anstelle linearer Steuerung sinnvolle strukturelle Anpassungen vorzuneh-
verlangen „komplexe Systeme indirekte Steue- men.
rungsstrategien“ und ein „Schnittstellen-
Interessant ist nun, dass Schramm mit ganz
management“, das nicht durch „Kontrolle“,
ähnlichen Argumenten wie Nassehi für die
sondern durch die Fähigkeit zur „Übersetzung“
Etablierung multiprofessioneller Arbeitsgrup-
geprägt ist (Nassehi 2016: 5). Damit ist eine
pen plädiert, und zwar gerade im Bereich der
„Kompetenz für unterschiedliche Logiken“ ge-
kirchlichen Leitung. Auch er hält „konsekutiv-
meint, die Nassehi offensichtlich genauso wie
lineare“ und versäulte Entscheidungsprozesse
die interprofessionellen Teams als eine Chance
für ungeeignet, um unterschiedliche Perspekti-
versteht, um Komplexität bewusst in das Sys-
ven zu integrieren (ebd.: 617). Deshalb spricht
tem zu integrieren (ebd.: 8). Das Ziel ist, die
er sich für die Bildung multiprofessioneller Ar-
externe Komplexität bearbeitbar zu machen.
beitsgruppen aus, die ihre Aufgaben „iterativ-
Diese Expertise für unterschiedliche Logiken
zirkulär“ bearbeiten (ebd.: 629) und so der er-
und „Perspektivendifferenz“ ist deshalb rele-
höhten Umweltdynamik gerecht werden sol-
vant, weil nach Nassehi „alle gesellschaftlichen
len. Solche „multiprofessionellen Crews“
Themen mehrfachcodiert“, also durch unter-
schlägt er aber auch für die operative Arbeit, z.
schiedliche Perspektiven geprägt sind (ebd.: 8
B. in den funktionalen Diensten, vor (ebd.:
u. 5). Darum geht der Soziologe schließlich so-
782). Das Ziel ist, so den Abschied vom
weit, den Abgesang auf die „alte[n] Eliten“ an-
„Einzelkämpfertum[.] des Parochialmodells“
zudeuten: Als „versäulte Teileliten“ von Ex-
und vom rein „funktionalen Spezialistentum“
pert*innen mit „genaue[m] Entscheidungswis-
einzuleiten. Ausdrücklich hält Schramm fest,
sen“ werden sie der aktuellen Komplexität
dass zu diesen „Crews“ auch Ehrenamtliche
kaum noch gerecht. Er lässt keinen Zweifel da-
gehören können (ebd.).
ran, dass der Interprofessionalität die Zukunft
gehört – als Haltung und auch in der konkre-
13 Unter Rückgriff auf das St. Galler Managementmodell.
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 7
Diese Vorschläge machen deutlich: Der Ge- Ev. Kirche im Rheinland und in die Ev. Kirche
danke multiprofessioneller Kooperation birgt von Westfalen. Hierbei handelt es sich um
erhebliches Innovationspotential, das gilt für Strukturen optionaler, also freiwilliger Koope-
Kirchenämter und Konsistorien genauso wie ration. Das älteste noch praktizierte Modell
für die operative Ebene an der kirchlichen Ba- multi- bzw. interprofessioneller Zusammenar-
sis. Darum lohnt sich ein Blick auf die Gliedkir- beit ist das Gemeinsame Pastorale Amt
chen der EKD: Welche Regelungen und Projek- (GPA), das 2005 in der Ev. Kirche im Rheinland
te multi- bzw. interprofessioneller Zusammen- eingeführt wurde. Mit diesem Konzept wurden
arbeit gibt es aktuell? Impulse des bereits erwähnten ROSTA aufge-
griffen und weiterentwickelt; die in den 1990er
Ein Blick in die EKD-Gliedkirchen: Jahren formulierte Idee galt der „Integration
des Pfarramtes ins gesamte Mitarbeitergefü-
Welche Konzepte gibt es?
ge“. Das erklärte Ziel war, durch die „konzilia-
Bereits eine oberflächliche Internetrecherche14 re“ Bündelung der „Vielfalt von Kompetenzen“
ergibt, dass fast alle Gliedkirchen der EKD das die gemeindliche Arbeit so zu fördern, um
Thema der multi- bzw. interprofessionellen dem Kontext einer „differenzierten und hoch
Zusammenarbeit „auf dem Schirm“ haben.15 In spezialisierten Gesellschaft“ gerecht zu werden
vielen Gliedkirchen wird diese Form der Zu- (EKiR 2005c, zit. nach Ruddat 2009: 51). Konk-
sammenarbeit als relevantes Zukunftsthema ret ist das GPA, das 2005 nach einer Testphase
diskutiert; das reicht von eher allgemeinen An- per Kirchengesetz etabliert wurde, eine Struk-
regungen und Überlegungen16 bis zur konkre- tur zur gleichberechtigten Teamarbeit von
teren Ankündigung von entsprechenden Expe- Pfarrer*innen und Mitarbeiter*innen mit diako-
rimenten.17 Für unseren Zusammenhang sind nisch-gemeindepädagogischer Qualifikation
allerdings die Konzepte relevant, in denen die (Diakon*innen, Gemeindehelfer*innen18, Ge-
multi- bzw. interprofessionelle Zusammenar- meindepädagog*innen), siehe Abbildung 1.
beit bereits ganz konkrete Gestalt gefunden Diese Teams sind mit „Aufgaben des Pfarram-
hat. Entsprechende Konzepte liegen inzwi- tes aus den Bereichen Verkündigung, Seelsor-
schen aus einer Reihe von Gliedkirchen vor; ge, Bildung, Diakonie oder Leitung beauftragt“
einige dieser Konzepte gehen tatsächlich noch und leiten „in Gemeinschaft mit den anderen
auf Anregungen der Kirchenreform aus den Mitgliedern des Presbyteriums […] die Kirchen-
1970er Jahren zurück. Es lohnt sich, einen ge- gemeinde.19 Dabei können auch Mitarbeiten-
naueren Blick auf einige besonders markante de, die nicht Pfarrer*innen sind, die Leitung
Projekte und Strukturen zu werfen. Auf diese des Presbyteriums, also des gemeindeleiten-
Weise kann auch eine Typologie aktueller mul- den Gremiums, übernehmen (Kirchengesetz
ti- bzw. inter- oder auch transprofessioneller über das Gemeinsame Pastorale Amt, § 6 (2)).
Zusammenarbeit gewonnen werden. Bemerkenswert ist noch, dass diese Mitarbei-
tenden aus dem diakonisch-gemeindepädago-
Strukturen freiwilliger Kooperation: das Ge- gischen Bereich für die Zeit ihres Einsatzes in
meinsame Pastorale Amt und das Pilotpro- einem GPA eine Gehaltsanhebung erhalten.20
jekt „Interprofessionelle Teams“
Dieses Konzept des GPA war bei seiner Etab-
Die ersten beiden Beispiele führen uns in die lierung ausdrücklich mit einer „multiprofes-
14 Onlinerecherche nach den Stichworten: „multiprofessionell / sionell[en]“ Intention verbunden (EKiR 2005a:
interprofessionell / transprofessionell“ in Verbindung mit 441). Dies entsprach nicht nur der Einsicht in
den Namen der 20 EKD-Gliedkirchen. In Verbindung mit die Überlegenheit „multiprofessioneller
dem Stichwort „transprofessionell“ gab es keinen Treffer.
(Stand 07.09.2020). 18 Heute: Mitarbeitende mit missionarischer Ausbildung (Hin-
15 Nur fünf Gliedkirchen weisen bei der sicher nicht erschöp- weis Nicole Ganss, Referentin für Mitarbeitende in der EKiR,
fenden Recherche keine Ergebnisse auf. 07.09.2020).
16 Hannover, Nordkirche. 19 Neufassung 2020: EKiR 2020: LS 2020 Drucksache 5, § 1 (1).
17 Oldenburg https://www.kirche-oldenburg.de/kirche- 20 Anhebung auf Gehaltsgruppe 12 (Allgemeiner Entgeltgrup-
gemeinden/synode/1248-synode/donnerstag-21-november- penplan zum BAT-KF, Anlage 1, www.kirchenrecht-
2019.html#c41205 (Stand 07.09.2020) ekir.de/document/3880).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 8
Abbildung 1: Ev. Kirche im Rheinland: Gemeinsames Pastorales Amt. Quelle: Verfasser
Teams“ (EKiR 2005a: 449), sondern auch be- tung für nichtordinierte Berufsgruppen geöff-
stimmten theologischen Prämissen (Pfarramt net; die Rede ist von Gemeindemanager*innen
als „gemeinsam aufgetragene[r] Zeugnis- oder Personen, die „multiplikatorische Ehren-
dienst“, Hierarchieverzicht nach Barmen IV; vgl. amtskoordination“ übernehmen. Mit dieser
Kirchengesetz über das Gemeinsame Pastorale Änderung sollten Kirchengemeinden „größere
Amt, Präambel). Umso bemerkenswerter ist, Variationsmöglichkeiten“ eingeräumt werden
dass die Teams in der Konzeption von 2005 (EKiR 2020b: 5 f.).
auf bestimmte Berufsgruppen beschränkt wur-
Das GPA ist ein interessantes Modell multipro-
den, nämlich auf die Pfarrer*innen und ordi-
fessioneller Kooperation, das nach wie vor auf
nierte Angehörige der diakonisch-gemeinde-
Freiwilligkeitsbasis operiert (Beschlussfassung
pädagogischen Berufe. Hier war es die im
durch Presbyterium nach Anhörung durch Ge-
Rheinland übliche Ordinationspraxis, die die
meindeversammlung). Durch die aktuelle Wei-
„Gleichrangigkeit“ im gemeinsamen Pfarramt
terentwicklung ist der Weg zu einer tatsächlich
ermöglichte. Diese Engführung auf ordinierte
multiprofessionellen Ausgestaltung geschaffen
Mitarbeitende wurde Anfang 2020 im Zuge
worden, die auch neueren Berufsprofilen of-
einer „Weiterentwicklung“ des GPA revidiert
fensteht21 und sie in eine weithin gleichbe-
(EKiR 2020b: 5): Nach der aktuellen Fassung
rechtigte Zusammenarbeit einbezieht. Konzep-
des entsprechenden Kirchengesetzes ist die
tion und dokumentierte Praxis gehen in Rich-
Ordination nur noch die Voraussetzung für die
tung einer interprofessionellen Arbeit, bei der
Mitarbeit in den Bereichen Verkündigung und
sich die Kompetenzen tatsächlich auch über-
Seelsorge (Kirchengesetz über das Gemeinsa-
me Pastorale Amt, § 2 [2] neu). Dagegen wer- 21 Nach der aktuellen Regelung ist eine kirchliche, etwa ge-
den die Bereiche Bildung, Diakonie und Lei- meindepädagogische oder diakonische, Ausbildung nicht
mehr erforderlich (Auskunft Nicole Ganss, EKiR, 07.09.2020).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 9
Abbildung 2: Ev. Kirche in Westfalen: Pilotprojekt „Interprofessionelle Teams“. Quelle: Verfasser
schneiden (vgl. Pohl 2016: 24; EKiR 2005a: eine entsprechende Änderung des Verständ-
448). Wenn dabei bestehende Pfarrrollen nisses des Pfarramts zu öffnen. Dieser Benefit
überschritten werden, lässt sich auch von einer dürfte durch die aktuelle Öffnung für weitere
transprofessionellen Zusammenarbeit spre- Berufe gesteigert worden sein.24
chen.
Ein weiteres optionales Modell interprofessio-
Zurzeit gibt es in der Ev. Kirche im Rheinland neller Zusammenarbeit stammt aus der Ev. Kir-
elf Kirchengemeinden, die nach dem Modell che von Westfalen. Seit 2016 wurde hier ein
GPA arbeiten.22 Damit ist dieses Modell eine Pilotprojekt „Interprofessionelle Teams“
Option, die nur von einer Minderheit der 668 aufgelegt (siehe Abbildung 2). Das erklärte Ziel
Kirchengemeinden in der EKiR gewählt wurde ist, „zukunftsfähige Formen der Zusammenar-
(EKiR 2020a: 22). Dieses Modell setzte bis zur beit zwischen dem Pfarrdienst und den ande-
aktuellen Neugestaltung eine entsprechende ren Ämtern und Diensten der Kirche zu erpro-
Gemeindegröße und Personalausstattung ben“ (EKvW 2017c: 2).25 Zwei Ausgangspunkte
(mindestens eine ganze Pfarrstelle plus x wei- für diese Erprobungen werden skizziert. Der
tere Stellenanteile)23 voraus. Wichtiger für die erste Ausgangspunkt ist die Vakanz einer
Akzeptanz dürfte aber der erwartete Benefit
24 Fünf der elf GPAs wurden in den vergangenen drei Jahren
sein – und die kulturelle Bereitschaft, sich für eingerichtet. In diesem Jahr kam es bislang zu keiner Neuein-
22 Auskunft Ganss, EKiR, 07.09.2020. richtung, aber zu mehreren Anfragen (Auskunft Ganss, EKiR,
23 Nach der Gesetzesänderung von 2020 wurde auch die Er- 07.09.2020).
richtung eines GPA ermöglicht, wenn eine Gemeinde nur 25 Inzwischen ist geplant, das Projekt in den „Regelbetrieb“ zu
über eine halbe Pfarrstelle verfügt (Kirchengesetz über das überführen (Auskunft Pfr. Michael Westerhoff, Ev. Kirche von
Gemeinsame Pastorale Amt, § 2 [4] neu). Westfalen, 01.09.2020).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 10
Pfarrstelle: Wenn eine Pfarrstelle mangels Be- die Entwicklung bei den Gemeindepäda-
werber*innen absehbar nicht wiederbesetzt gog*innen immer noch durch eine gewisse
werden kann oder aufgrund veränderter „demografische Stabilität“ geprägt, und gera-
Schwerpunkte nicht wiederbesetzt werden soll, de diese Stabilität wird als „besondere Chance
können die Personalmittel für „eine andere für die Entwicklung von Teams und Dienstge-
Berufsgruppe verwendet“ werden (ebd.: 3). Der meinschaften“ herangezogen (ebd.: 44). Damit
zweite Ausgangspunkt ist die konzeptionelle laufen in der Begründung für das Pilotprojekt
Neuaufstellung eines Arbeitsbereichs: „Zusätz- zwei unterschiedliche Argumentationen ne-
lich zu bereits vorhandenen Pfarrstellen oder beneinanderher. Auf der einen Seite steht die
anderen Stellen“ kann dann die Zusammenset- demographische Entwicklung, die den ver-
zung des Teams durch eine Stellenbesetzung stärkten Einsatz von diakonisch-gemeindepä-
interprofessionell verändert bzw. erweitert dagogischen Mitarbeitenden in solchen inter-
werden (ebd.). In beiden Fällen sind einzelne professionellen Teams nahelegt. Auf der ande-
oder mehrere Kirchengemeinden im Blick; im ren Seite steht eine inhaltliche Argumentation,
Unterschied zum GPA wird hier also die Ko- die einen „neuen Personalmix“ begrüßt, „in
operation von Kirchengemeinden explizit er- dem jede Berufsgruppe ihre Fachlichkeit zur
wähnt. Interessant ist zudem, welche Gruppen Stärkung der Aufgabenerfüllung und der
als mögliche Partner*innen für die Teambil- Dienstgemeinschaft einbringt, wie sie in Bar-
dung genannt werden. Genauso wie bei der men IV beschrieben ist“ (ebd.: 43). Hier zeigen
Aktualisierung des GPA ist das Konzept nicht sich Spannungen, die der aktuellen Situation
nur auf die Pfarrer*innen und diakonisch- geschuldet sind. Im Sinne einer breiten Spanne
gemeindepädagogischen Mitarbeiter*innen von Pilotprojekten und Arbeitsformen er-
beschränkt; vielmehr werden hier auch scheint jedoch zweierlei sinnvoll: eine aus-
„Angehörige[.] weiterer Berufsgruppen“ und drückliche Ermutigung zur stärkeren Diversifi-
Ehrenamtliche erwähnt (ebd.). zierung der Teams (weitere Berufsgruppen,
Ehrenamtliche) sowie eine deutlichere Operati-
Auch wenn hier für die Entwicklung der Teams
onalisierung des Konzepts interprofessioneller
ein weiter Raum eröffnet wird, zeigt die bishe-
Zusammenarbeit (eine erste Definition liegt
rige Erfahrung, dass die Kooperation von Pfar-
bislang nur unveröffentlicht vor, EKvW 2020:
rer*innen und diakonisch-gemeindepädagogi-
2).
schen Mitarbeiter*innen im Vordergrund steht.
In zwölf von 14 Teams, die zurzeit im Rahmen Der Vergleich der beiden Projekte zeigt: Als
des Projekts begleitet werden (Stand August Pilotprojekt sind die „interprofessionellen
2020), „arbeiten Gemeindepädagoginnen und Teams“ deutlich offener konturiert als das
Gemeindepädagogen mit stärker verkündigen- GPA. Als Gestaltungsmöglichkeit ist die Team-
den und seelsorgerlichen Schwerpunkten“. In rolle für Ehrenamtliche genauso im Blick wie
zwei weiteren Projekten „werden die Pfarrper- die Kooperation zwischen Gemeinden; damit
sonen durch sog. ,Gemeindemanagerinnen ist auch der Horizont der aktuellen Struktur-
bzw. -managerʻ mit stärker organisatorischen veränderungen präsent. In das Statusgefüge
Aufgaben ergänzt“ (EKvW 2020: 3). der Mitarbeitenden wurde bislang nicht ein-
griffen; jedoch zeigt eine erste Evaluation, dass
Diese Zusammensetzung der Teams geht in
unter anderem bei der Mitgliedschaft in Lei-
jedem Einzelfall auf konzeptionelle Überlegun-
tungsgremien und bei der Anpassung von ta-
gen zurück (ebd.: 3). Allerdings zeigt die Vor-
riflichen Eingruppierungen Klärungsbedarf be-
geschichte des Pilotprojekts, dass den Ge-
steht (EKvW 2020: 4). Dagegen gehörte der
meindepädagog*innen in der Personalplanung
Hierarchieabbau von vornherein zu den be-
der Ev. Kirche in Westfalen eine besondere
sonderen Merkmalen des GPA; dieses Konzept
strategische Rolle zukommt. Während die Kir-
hat jedoch auch nach seiner Revision aus-
chenleitung gerade für die ländlichen Räume
schließlich berufliche Mitarbeiter*innen vor
„Engpässe der Versorgung mit Pfarrerinnen
Augen.
und Pfarrern“ erwartet (EKvW 2017b: 19), ist
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 11
Obligatorisch in der Gemeinde, fakultativ in gemeindliche Ebene. Der Kern einer solchen
der Region: die Dienstgruppen der Ev. Kir- Dienstgruppe sind die Gemeindepfarrer*innen
che in Baden und Gemeindediakon*innen, aber ähnlich wie
beim GPA ist auch hier die Erweiterung um
Während die beiden Modelle aus Westfalen
andere Mitarbeiter*innen möglich, jedenfalls
und dem Rheinland optional ausgelegt sind,
dann, wenn sie auf landeskirchlichen Stellen
weist das Modell der Dienstgruppen, das 2014
arbeiten. Im Blick sind hier Kirchenmusi-
in Ev. Kirche in Baden eingeführt wurde, eine
ker*innen, Seelsorger*innen in Krankenhäusern
deutlich höhere Verbindlichkeit auf (siehe Ab-
oder Gefängnissen oder Religionslehrer*innen
bildung 3). Die Regelung sieht vor, „dass im-
(EKiBa 2017: 12). Hier wird über das Konzept
mer dann, wenn mehrere Personen auf Pfarr-
der Dienstgruppen eine Verzahnung von paro-
oder Gemeindediakonenstellen in der Gemein-
chialer und funktionaler Arbeit möglich, die
de tätig sind, automatisch eine sog. Dienst-
nach dem Willen der Landeskirche künftig
gruppe der Beteiligten entsteht“ (EKiBa 2017:
noch verstärkt werden soll (Landesbischof Cor-
11). Dagegen ist die Einrichtung überparochia-
nelius-Bundschuh in EKiBa 2018: 14). Damit
ler (also gemeindeübergreifender) Dienstgrup-
geht dieses Modell einen Schritt weiter als das
pen oder von Dienstgruppen auf Ebene eines
Pilotprojekt der Ev. Kirche in Westfalen, indem
Kirchenbezirks fakultativ, also in Form einer
auf Ebene der Mitarbeitenden die Versäulung,
Kann-Bestimmung geregelt (Rechtsverord-
also das Silodenken zwischen den verschiede-
nung zur Zusammenarbeit in Dienstgruppen,
nen Arbeitsformen, aufgelöst werden soll.
§§ 4 u. 6).
Interessant sind auch die Regelungen zur Auf-
Was sind die Aufgaben einer solchen Dienst-
gabenverteilung. Ein gemeinsamer Dienstplan
gruppe, und wie ist sie zusammengesetzt? Am
soll sich an den „spezifischen Berufsprofile[n]
detailliertesten sind die Regelungen für die
Abbildung 3: Ev. Kirche in Baden: das Modell der Dienstgruppen. Quelle: Verfasser
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 12
und -kompetenzen der beteiligten Mitglieder“ Übertragung von Assistenz- bzw. Geschäfts-
orientieren, aber zugleich eine abgestimmte führungsaufgaben an professionelle Kräfte, um
Arbeit ermöglichen (Dienstgruppen-RVO, § 7 die Pfarrer*innen und Gemeindepäda-
(1)). Aufgabenbereiche, die gesondert geregelt gog*innen für ihre Kerntätigkeiten zu entlasten
sind, sind die Pfarramtsverwaltung sowie die (Landesbischof Cornelius-Bundschuh in EKiBa
Koordination und Organisation der Dienst- 2018: 14). Hier zeichnet sich eine weitere Pro-
gruppe. Während die letztgenannte Aufgabe fessionalisierung ab. Damit sind wir bei einem
„turnusgemäß zwischen allen Mitgliedern der Kennzeichen des Dienstgruppenmodells: Es ist
Dienstgruppe wechselt“ (EKiBa 2017: 18), liegt auf die beruflichen Mitarbeiter*innen bezogen;
die Pfarramtsverwaltung bei den Pfarrperso- eine mögliche Rolle von Ehrenamtlichen in den
nen bzw. bei den Gemeindediakon*innen. Da- Dienstgruppen wird nicht thematisiert.
bei wird die Pfarramtsverwaltung sehr weit ge-
fasst: Sie beinhaltet nicht nur die konkreten Multiprofessionelle Zusammenarbeit als
Verwaltungsaufgaben, sondern auch konkrete Teil der Kirchenentwicklung: Beispiele aus
Aufgaben der Leitung (Vorgesetztenfunktion den Kirchen in Bayern und Anhalt
für Sekretariatskräfte) und Repräsentation Abschließend sollen hier noch zwei Beispiele
(„Ansprechpartner des Pfarramtes in der Öf- vorgestellt werden, in denen die multiprofessi-
fentlichkeit“ und gegenüber kirchlichen Mitar- onelle Zusammenarbeit ganz dezidiert als Teil
beitenden) (Dienstgruppen-RVO, § 9). der Kirchenentwicklung konzipiert ist. Das ers-
Dieses Modell der Dienstgruppen steht in der te Beispiel stammt aus der Ev.-luth. Kirche in
Tradition der multiprofessionellen Arbeit, die Bayern. Hier ist der Berufsbildprozess
in der Ev. Kirche in Baden seit den 1970er Jah- „Miteinander der Berufsgruppen“ (MdB) in-
ren praktiziert wird. Aktuell gibt es in der be- teressant, der schließlich eine enge Verzah-
treffenden Kirche ca. 200 parochiale Dienst- nung mit dem Kirchenentwicklungsprozess
gruppen, „die überparochialen sind gerade „Profil und Konzentration“ (PuK) erfahren hat
erst am Entstehen“.26 Bemerkenswert an die- (siehe Abbildung 4). Der Berufsbildprozess
sem Konzept ist, dass es auf Gemeindeebene wurde 2016 im Anschluss an den Pfarrbildpro-
eine verbindliche Kooperationsstruktur etab- zess der Ev.-luth. Kirche in Bayern gestartet
liert, die offen für gemeindliche Kooperations- (Bubmann 2019: 147). Der Kirchenentwick-
strukturen und die Verzahnung von parochia- lungsprozess PuK startete etwa zeitgleich, und
ler und funktionaler Arbeit ist und es zugleich in beiden Prozessen spielt die Arbeit multipro-
ermöglicht, dass Gemeindepädagog*innen als fessioneller Teams eine wesentliche Rolle.
potentielle Gesichter der Gemeinde bzw. des Wie wird die multiprofessionelle Arbeit hier
Pfarramts fungieren. Das erinnert an das GPA profiliert? Kennzeichnend für den Kirchenent-
der Ev. Kirche im Rheinland, wo das Pfarramt wicklungsprozess PuK ist, dass er die kirchliche
ebenfalls als gemeinsame Aufgabe verschiede- Organisation und ihre Ressourcen strikt auf
ner Berufsgruppen verstanden wird. den Auftrag der Kirche und die Lebensräume
Allerdings ist der mit den Dienstgruppen in- und die Lebenssituation der Menschen aus-
tendierte Prozess noch längst nicht abge- richten möchte (ELKB 2019a: 6). Um in den Le-
schlossen. Das gilt nicht nur in Bezug auf die bensräumen der Menschen, im Sozialraum,
überparochiale Zusammenarbeit, sondern of- relevant präsent zu sein, soll das kirchliche
fensichtlich auch mit Blick auf die Kooperation Handeln in „Handlungsräumen“27 organisiert
in den bestehenden Dienstgruppen. Hier werden, die „nicht mit den bisherigen Pla-
scheint die „Klärung von Zuständigkeit und
Verantwortung“ eine bleibende Aufgabe zu 27 Heute wird die Formulierung in der Ev.-luth. Kirche in Bayern
sein, damit die Arbeit in „multiprofessionellen so verstanden, dass die Handlungsräume nicht zwangsläufig
Dienstgruppen“ als „hilfreich und entlastend“ mit den bisherigen Planungsgrößen übereinstimmen müs-
sen. Vor Ort soll die Freiheit gegeben werden, das kirchliche
erlebt wird. In der Diskussion ist außerdem die
Leben so zu gestalten, dass es den ggf. veränderten Lebens-
situationen besser entspricht (schriftliche Auskunft aus dem
26 Schriftliche Auskunft KR Dr. Jörg Augenstein, 01.08.2019. Projektbüro PuK, 03.09.2020).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 13
Abbildung 4: Ev. Kirche in Bayern: Multiprofessionalität in den Prozessen MdB und PUK. Quelle: Verfasser, tw. nach ELKB 2019a: 5
nungsgrößen (Regionen, Subregionen, Deka- chen Auftrag und beim Sozialraumbezug hat
natsbezirken) übereinstimmen“ müssen (ELKB für das Arbeiten in multiprofessionellen Teams
2017: 15). Diese Handlungsräume sollen PuK klare Konsequenzen; das zeigen auch die wei-
zufolge der Aktionsraum von multiprofessio- teren Überlegungen aus dem PuK-Prozess und
nellen Teams sein: „In Handlungsräumen ar- dem Berufsbildprozess MdB. Ein abgestimm-
beiten multiprofessionelle Teams. Die Zusam- tes, vernetztes Arbeiten in den Handlungsräu-
mensetzung der Professionen richtet sich nach men ist selbstverständlich; entsprechende
den Erfordernissen der Handlungsräu- „Kompetenzen und Qualifikationen“ sollen ge-
me“ (ebd.: 18). Klar wird gerade mit Blick auf fördert und durch „Zielvereinbarungen“ abge-
ländliche Regionen oder die Diasporasituation sichert werden (ELKB 2019a: 55). Geklärt wer-
formuliert: „Rein pfarrerzentriertes Denken den sollen die Qualifikationen „für die Leitung
führt in Aporien“. Zugleich wird der Blick auf von (multi-)professionellen Teams in Pfarreien
das Engagement von Ehrenamtlichen geöffnet: (Gestaltungsräumen), Dekanatsbezirken und
„Es wird zu klären sein, inwieweit Einrichtungen und Diensten“ (ebd.: 57). Hier
das ,vereinbarte Ehrenamtʻ hier planungs- und wird deutlich, dass an einer bestimmten Kultur
gestaltungsrelevant werden könnte“ (ebd.: der Zusammenarbeit gearbeitet werden soll.
18).28 Dazu gehört auch das Plädoyer für berufsüber-
greifende Ausbildungsmodule sowie für die
Der hier durchgeführte Ansatz beim kirchli-
Entwicklung von „Modellen“ gelingender Ko-
operation in multiprofessionellen Teams (ebd.:
28 Vereinbartes Ehrenamt bedeutet hier: eine ehrenamtliche
Tätigkeit, die mit Rechten und Pflichten einen festen Platz in
56).
den kirchlichen Strukturen hat (z. B. als Prädikant*in) (Schmid Ein weiterer Strang der Überlegungen geht
2019).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 14
von der Bedarfsraumorientierung aus: Die bis- bunden. Multiprofessionalität wird als Quer-
herige Versäulung der unterschiedlichen Be- schnittsthema wahrgenommen; das reicht von
rufsgruppen soll wenigstens partiell flexibili- der Ausbildung über die Arbeit in den Gestal-
siert werden; für 20 % der Stellen wird eine tungsräumen bis zur multiprofessionalen Ge-
„berufsübergreifende Ausschreibung und Be- staltung von „Transformationsprozes -
setzung“ vorgeschlagen (ebd.: 61). Zudem soll sen“ (ELKB 2019b: 31). Dabei geht die Perspek-
es möglich sein, bei der langfristigen Vakanz tive auch über die beruflichen Mitarbeitenden
von Stellen nicht nach Berufsgruppe, sondern hinaus und nimmt ausdrücklich Ehrenamtliche
nach „Qualifikation und dem Berufsprofil“ zu in den Blick. Die Versäulung der Berufsgrup-
besetzen (ELKB 2017: 19). In solchen Öff- pen soll nicht nur durch die Kooperation im
nungsklauseln schlägt sich – ähnlich wie in der Team, sondern auch durch überberufliche
Ev. Kirche von Westfalen – freilich auch die Stellenausschreibung und die Möglichkeit zum
absehbare demographische Entwicklung nie- beruflichen Spurwechsel durchbrochen wer-
der (vgl. ELKB 2019a: 60). Zudem zeigt sich der den. Damit zeigt sich die Möglichkeit einer
Wunsch nach einer Flexibilisierung beruflicher transprofessionellen Personalentwicklung und
Versäulung darin, dass „verschiedenste, auch eines entsprechenden Personaleinsatzes.
berufsübergreifende Weiterqualifizierungswe-
Kennzeichnend für alle diese Überlegungen
ge“ eröffnet werden sollen (ebd.: 61); hier wird
ist, dass sie im Unterschied zu den meisten
die Öffnung für berufsbiografische Spurwech-
anderen Konzepten nicht bei konkreten Struk-
sel und damit ebenso wie bei der berufsüber-
turen ansetzen, sondern eine Kultur im Blick
greifenden Ausschreibung eine transprofessio-
haben. Sie soll sich auf allen kirchlichen Ebe-
nelle Offenheit deutlich.
nen (weiter-)entwickeln, bedarf dazu natürlich
Soweit die Vorschläge und Anregungen aus der strukturellen Abstützung.
beiden Prozessen. Auch wenn PuK ein längst
Ein zweites Modell, das multiprofessionelle
noch nicht abgeschlossener Zukunftsprozess
Zusammenarbeit als festen Bestandteil der Kir-
ist, zeigen die Vorschläge im Vergleich zu den
chenentwicklung konzipiert, ist das Verbund-
bisher skizzierten Kooperationsmodellen aus
system der Evangelischen Landeskirche in An-
anderen Gliedkirchen ein spezifisches Profil:
halt, siehe Abbildung 5. In dieser Landeskirche
Hier wird die Arbeit in multiprofessionellen
hat die Synode 2018 einen umfassenden
Teams programmatisch mit einer auftrags-
„Transformationsprozess“ eingeleitet (ELA
und sozialraumorientierten Ausrichtung ver-
2019b), der die Schaffung von gemeindlichen
Arbeitsgemeinschaften und „Mitarbeiter-
verbünden“ vorsieht. Mit den Arbeitsge-
meinschaften, zu deren Bildung die auto-
nom bleibenden Kirchengemeinden ein-
geladen sind, soll die bisherige Regiona-
lisierung fortgesetzt werden. In diesen
Arbeitsgemeinschaften sollen die Mitar-
beiterverbünde arbeiten, die von vornhe-
rein multiprofessionell gedacht sind und
„zu denen jeweils die Bereiche Pfarr-
dienst, Gemeindepädagogik, Kirchenmu-
sik, Verwaltung und Diakonie gehören“
sollen (ELA 2017b).
Bei der Bildung dieser Arbeitsgemein-
schaften wird genauso wie bei der Etab-
lierung der Mitarbeiterverbünde auf Frei-
willigkeit gesetzt (ELA 2017a). Aber zu-
gleich ist klar, dass für die Ev. Kirche in
Abbildung 5: Verbundsystem der Ev. Kirche in Anhalt. Quelle: Verfasser
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSEITE 15
Anhalt von der möglichst flächendeckenden Mit diesem Modell liegt ein ambitioniertes
Einführung dieses Modells viel abhängt. Das Konzept vor: Geplant ist, dass bis zum Jahr
multiprofessionelle Verbundsystem soll ein 2025 25 Arbeitsgemeinschaften gebildet wer-
grundlegendes Umsteuern der Kirche einleiten den – bei aktuell 133 Kirchengemeinden in der
und einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Zu- Ev. Kirche in Anhalt (ELA 2017b). Die Besonder-
kunftssicherung leisten. Ausgangspunkt sind heit dieses Konzepts besteht in mehreren
nicht nur die „Grundsatzfragen nach der lang- Punkten. Hier soll die aktuelle Entwicklung bei
fristigen Finanzierbarkeit“ kirchlicher Arbeit den Mitarbeitenden nicht defensiv kompen-
(ELA 2017a: 1), sondern vor allem auch die siert werden, sondern strategisch zur gezielten
Probleme beim jetzigen Personaleinsatz Veränderung des kirchlichen Personalmix ge-
(„Überforderung“, „Einsamkeit“ und mangeln- nutzt werden. Für diesen Personalmix wird ei-
de Kooperation der beruflichen Mitarbei- ne klare Vorgabe gemacht, die über die Forde-
ter*innen) (ELA 2017b). Die ruhestandbeding- rung nach Verwaltungshilfe deutlich hinaus-
ten Personalveränderungen der kommenden geht. Mit dem Aufbau einer professionellen
Jahre bis 2025 sollen genutzt werden, um den Gemeindediakonie sollen Chancen im Sozial-
Personalmix gezielt zu verändern: Eine raum genutzt werden. Die Teambildung in den
„spürbare Reduzierung des Pfarrpersonals“ Mitarbeiterverbünden soll der beklagten Ver-
würde so mit einem „moderaten Aufwuchs im einsamung der Mitarbeitenden entgegenwir-
Bereich der Kirchenmusik und Gemeindepäda- ken. Zugleich deutet sich im Konzept eine Auf-
gogik“ einhergehen. Große Hoffnungen rich- gabenteilung zwischen beruflichen und ehren-
ten sich jedoch vor allem auf die „völlige Neu- amtlichen Mitarbeitenden an: Während die
findung der Gemeindediakonie“. Dieser Ar- beruflichen Mitarbeitenden als Angestellte der
beitsbereich soll neu aufgebaut werden, evtl. Gesamtkirche auf Ebene der Arbeitsgemein-
auch „mit möglichen Refinanzierungen durch schaften zum Einsatz kommen sollen, obliegt
öffentliche Gelder“ (ELA 2017a: 2), und als le- den Gemeindekirchenräten eine spezielle Ver-
bensbegleitende und aufsuchende „Diakonie antwortung für das geistliche Leben auf Ge-
in der Gemeinde“ etabliert werden (2019a: 7). meindeebene. Damit wird – noch über das
Die Hoffnung ist, mit dieser Form von Diakonie Konzept PuK hinausgehend – das Ehrenamt
„stärker auch in den säkularen Raum hinein[zu] strategisch in die Kirchenentwicklung einbezo-
wirken“ (ELA 2017b). gen. Noch zu entfalten ist allerdings die kon-
krete Gestalt, die die multiprofessionelle Zu-
Über konkrete Kooperationsformen der Teams
sammenarbeit finden soll.29 Darum ist gegen-
wurde noch wenig veröffentlicht. Angestrebt
wärtig auch nicht ersichtlich, inwieweit hier
wird in jedem Fall „eine engere Zusammenar-
eine Entwicklung in Richtung einer interprofes-
beit von Mitarbeitenden verschiedener kirchli-
sionellen Arbeit im Blick ist.
cher Berufsgruppen“ (ELA 2017b) und damit
die Entlastung durch die Verwaltungsmitarbei-
Zwischenfazit
ter*innen. Damit wird die Hoffnung verbun-
den, dass künftig alle beteiligten Berufsgrup- Die Übersicht über die fünf exemplarischen
pen „in ihrer eigentlichen Profession tätig sein Modelle zeigt eine erhebliche Spannbreite. Die
[…] können“ (ELA 2017a: 2). Komplementär zur Akzentsetzungen unterscheiden sich deutlich,
Arbeit der beruflich Beschäftigten wird die Rol- was mit der jeweiligen Situationswahrneh-
le der Ehrenamtlichen in den Gemeindekir- mung und z. T. auch mit der theologischen
chenräten beschrieben: Ihnen kommt „in den Tradition der betreffenden Kirche zusammen-
weiterhin bestehenden autonomen Kirchenge- hängt. Auf der Suche nach einer Typologie las-
meinden vordringlich die Aufgabe zu, für das
29 Nach Auskunft aus dem Landeskirchenamt der Ev. Landeskir-
geistliche Leben der je eigenen Gemeinde Sor- che in Anhalt ist die Teamleitung durchaus rollierend ange-
ge zu tragen“. Dazu soll ein entsprechendes legt. Allerdings liegt sie momentan bei einer der Pfarrperso-
„Lehr- und Fortbildungsangebot“ geschaffen nen des Verbunds, könnte jedoch auch in die Hände einer
werden (ELA 2017a: 1). der anderen Mitarbeitenden des Verbundes gelegt werden
(schriftliche Auskunft der Assistentin des Kirchenpräsidenten,
03.09.2020).
© Sozialwissenschaftliches Institut der EKDSie können auch lesen