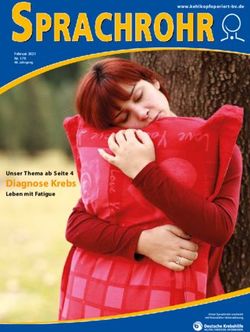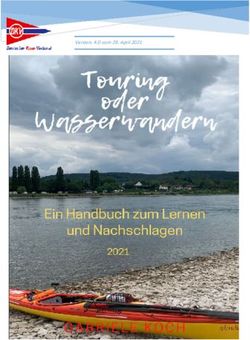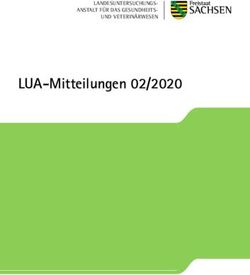37 2021 Deutsches Rotes Kreuz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
37
Beiträge zur Transfusionsmedizin 2021
Gestaltung der Abbildung: Tobias Tertel, Institut für Transfusionsmedizin, Universitätsklinikum Essen
Bereitstellung der elektromikroskopischen Aufnahme: Alain Brisson, Professeur Emérite UMR-CBMN CNRS-Université de Bordeaux
TITELTHEMA
Extrazelluläre Vesikel –
Zelltherapie der nächsten
Generation
WEITERE THEMEN IN DIESER AUSGABE:
• Der demografische Wandel als zuneh-
mende Herausforderung für die Ver-
sorgungssicherheit mit Blutprodukten
• #missingtype – Eine Aktion der
DRK-Blutspendedienste
• Blutspende unter Corona-
Herausforderungen
Deutsches Rotes Kreuz • Erfahrungen nach der Einführung der
DRK-Blutspendedienste Hepatitis-E-Testung für Blutspenden
am Beispiel des DRK-Blutspende-
dienstes WestImpressum Inhalt
Herausgeber:
Die DRK-Blutspendedienste:
Editorial 37/2021 3
DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg –
Hessen, Mannheim
Der demografische Wandel als zunehmende Herausforderung für
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes,
München die Versorgungssicherheit mit Blutprodukten 4–13
Dr. med. Linda Schönborn, Prof. Dr. Andreas Greinacher,
DRK-Blutspendedienst Mecklenburg-Vorpommern,
Prof. Dr. med. Hermann Eichler
Neubrandenburg
Blutspendedienst der Landesverbände des
DRK Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Extrazelluläre Vesikel – Zelltherapie der nächsten Generation 14–25
Oldenburg und Bremen, Springe
Univ.-Prof. Dr. med. Eva Rohde, Prof. Dr. rer. nat. Bernd Giebel
DRK-Blutspendedienst Nord-Ost, Dresden
DRK-Blutspendedienst West, Ratingen
#missingtype – Eine Aktion der DRK-Blutspendedienste 26–27
(gemeinnützige GmbHs) Claudia Müller
Redaktion (verantwortlich):
Blutspende unter Corona-Herausforderungen 28–30
PD Dr. med. Thomas Zeiler, Breitscheid
Dr. med. Markus M. Müller, Kassel Stephan David Küpper
Adresse der Redaktion: Erfahrungen nach der Einführung der Hepatitis-E-Testung für
DRK-Blutspendedienst West gGmbH Blutspenden am Beispiel des DRK-Blutspendedienstes West 31–35
Feithstraße 182, 58097 Hagen
Dr. med. Christian Faber
Tel.: 0 23 31/ 807-0
Fax: 0 23 31/ 88 13 26
E-Mail: redaktion@drk-haemotherapie.de
Leserfrage
Redaktion: Rücknahme und Neuausgabe von Blutkomponenten 38
Dr. med. Andreas Opitz
Univ.-Prof. Dr. med. Tamam Bakchoul, Tübingen;
Dr. med. Christian Faber, Münster;
Claudia Müller, Münster;
Dr. med. Markus M. Müller, Kassel; Die Autoren 39–40
Dr. med. Andreas Opitz, Bad Kreuznach;
Dr. Ernst-Markus Quenzel, München;
Univ.-Prof. Dr. med. Hubert Schrezenmeier, Ulm;
Dr. Franz Wagner, Springe;
Univ.-Prof. Dr. med. Torsten Tonn, Dresden;
PD Dr. med. Thomas Zeiler, Breitscheid.
Mit Autorennamen gekennzeichnete Fachartikel
geben die Meinung des Autors wieder und müssen
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und der
Herausgeber widerspiegeln.
Der Herausgeber der „hämotherapie“ haftet nicht für
die Inhalte der Fachautoren.
Die Fachinformationen entbinden den behandelnden
Arzt nicht, sich weiterführend zu informieren.
Realisation:
deltacity.NET GmbH & Co. KG
SIGMA-DRUCK GmbH In eigener Sache ...
www.deltacity.net Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird davon abgesehen,
bei Fehlen einer geschlechtsneutralen Formulierung sowohl die
Auflagen: männliche als auch weitere Formen anzuführen. Die nachste-
hend gewählten männlichen Formulierungen gelten deshalb
Gesamtauflage: 16.500 Ex.
selbstverständlich und uneingeschränkt auch für die weiteren
ISSN-Angaben auf der Rückseite Geschlechter.
Zitierweise:
hämotherapie, 37/2021, Seite ...
2 37 2021Univ.-Prof. Dr. Nina Worel „Das Leben ist
DGTI-Kongresspräsidentin eine immer dichter
Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin Wien werdende Folge
Dr. Christian Gabriel von Finsternissen.“
DGTI-Kongresspräsident Thomas Bernhard
Universitätsklinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin Graz
LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, die auch in Zukunft helfen den demografischen Wandel zu
bewältigen.
COVID 19 geht in das zweite Jahr und unser Optimismus
Viele Geheimnisse gibt es noch im Beitrag von Eva Rohde
einen prickelnden und erfrischenden Kongress in Wien zu
und Bernd Giebel zu entdecken, aber sie zeigen auch, dass
organisieren, der insbesondere die Vitalität des Faches und
uns noch Einiges verborgen bleibt: Extrazelluläre Vesikel
der Geburtsstadt der Immunhämatologie widerspiegelt, ist
nehmen in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung
in einem „Gemischten Satz“ von Hoffnung, Verzweiflung, Un-
und können schon vielseitig eingesetzt werden. Sie haben
glauben und Resilienz untergegangen, eher ertrunken*. Das
einen zunehmenden Wert in der biomedizinischen For-
Abzählen des griechischen Alphabets erfordert mittlerweile
schung erlangt und gewinnen in der Diagnostik interes-
einige Widerstandskraft und verwundert nimmt man neue
sante Aspekte. Große Erwartungen werden an die thera-
Widerstände zur Wissenschaft und insbesondere der Medi-
peutischen Möglichkeiten geknüpft. Als Zelltherapeutika
zin wahr, die man in ihrer Vehemenz bisher nie vermutet
der nächsten Generation können sie vielleicht die Wirkung
hätte.
von Medikamenten und Impfungen verbessern und in der
Diese neuen Phänomene wirken auf uns alle, sowohl im Onkologie und regenerativen Medizin eingesetzt werden.
privaten Umfeld, als auch im unmittelbaren Arbeitsum- Die Charakterisierung extrazellulärer Vesikel ist definiert,
feld der Transfusionsmedizin. Die Pandemie wird noch offen bleibt aber noch in vielen Bereichen der Wirkmecha-
enorme Änderungen triggern, beispielsweise in der Wirt- nismus. Erfreulicherweise ist in Salzburg bereits eine der
schaft, wie wir arbeiten und wie wir in Zukunft Gesundheit ersten GMP-Einrichtungen für extrazelluläre Vesikel etab-
und Wohlstand sichern werden. Entscheidend für den Lauf liert, worauf in diesem Beitrag ausführlich eingegangen wird.
der Zukunft sind Megatrends, die durch tiefgreifende und
Christian Faber berichtet über den Einsatz der Hepatitis-
plötzliche Ereignisse voll zur Wirkung kommen. Klimaver-
E-Tests in Nordrhein-Westfalen und darüber, wie sich das
änderung, soziale Kohärenz, Digitalisierung – beschleunigt
Stufenplanverfahren auf den Ablauf in der Blutspende-Ein-
durch die Corona-Pandemie und eine noch nicht fassbare
richtung ausgewirkt hat. Dass Hepatitis E kaum mehr über-
gesellschaftliche Wandlung werden uns die kommenden
tragen wird, war auf Grund der hohen Sicherheit und Sta-
Jahre begleiten. Sie alle werden sich im Mikrokosmos der
bilität der PCR zu erwarten. Mit der Erkenntnis der Übertra-
Transfusionsmedizin reflektieren indem wir uns immer mehr
gungswege wurde in NRW das Angebot von Mettbrötchen
die Frage stellen müssen, wie wir die Patienten weiter ver-
bei der Blutspende eingestellt.
sorgen können. War noch Patient Blood Management ein
dominantes Thema der vergangenen Jahre ist in dem Bei- Diese Ausgabe, die Sie in den Händen halten, sollten Sie
trag von Linda Schönborn, Andreas Greinacher und Her- bei der 54. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
mann Eichler, Der demografische Wandel als zunehmende Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI) vom
Herausforderung für die Versorgungssicherheit mit Blutpro- 22.09. bis 24.09.2021 in Wien in der Kongressmappe vor-
dukten der kommende Megatrend der nächsten Jahre klar finden und wahlweise unter dem Riesenrad, dem Stephans-
skizziert. Der bewusst gesteuerte rückläufige Verbrauch dom, im Belvedere oder in Schönbrunn – tunlichst nicht im
an Blutprodukten wird die verminderten Spenderkapazitä- Heurigen bei einem Glas „Gemischten Satz“ – lesen.
ten nicht mehr balancieren. Spender werden weniger, Pati-
Es ließ sich nicht ändern, der Kongress ist digital und nicht
enten immer mehr. Den Bedarf zu planen wird dadurch in
in Wien. Dafür wird er an Ihre Arbeitszeiten zu Hause ange-
Zukunft immer schwieriger. Und wer weiß, ob nicht bald wie-
passt und ermöglicht mit dem neuen Schema eine bes-
der die „Roaring Twenties“ einsetzen werden? Dann wer-
sere Teilnahme an zahlreichen Sitzungen. Versuchen Sie
den auch die Menschen anders. Gesellschaftliche Effekte
die neuen digitalen Interaktionen, die wir uns ausgedacht
wie sie nach der Spanischen Grippe zu bemerken waren,
haben! Als Kongresspräsidenten laden wir Sie zur digitalen
sind sicherlich nicht der ideale Nährboden für Altruismus.
DGTI-Jahrestagung unter www.dgti-kongress.de ein, und
Mit starkem Engagement haben die Blutspendedienste wenn Ihnen Wien abgegangen ist, so versäumen Sie es
sich gegen alle Widrigkeiten der Pandemie gestemmt. Viel nicht den Besuch in Wien unbedingt einmal nachzuholen.
Herzblut ist da geflossen und dies wird von Stephan David
Auf ein baldiges Wiedersehen – vielleicht auch beim Heuri-
Küpper beschrieben. Mit Sicherheit kann man davon aus-
gen – mit einem „Gemischten Satz“
gehen, dass hier wertvolle Erfahrungen gewonnen werden,
Christian Gabriel & Nina Worel
* Der „Gemischten Satz“ ist eine, vornehmlich Wiener Eigenheit des Weinbaus. Verschiedene Reben aus einem Weingarten werden zu einem Wein gekeltert. Mit
der EU-Verordnung 607/2009, konnte sich Österreich die Bezeichnung „Gemischter Satz“ sichern, d. h. kein anderes Land der EU darf Weinflaschen damit
bezeichnen. Womit wir wieder belegen können: Wien ist anders
3Dr. med. Linda Schönborn, Prof. Dr. Andreas Greinacher, Prof. Dr. med. Hermann Eichler
Der demografische Wandel als zunehmende
Herausforderung für die Versorgungs-
sicherheit mit Blutprodukten
Zusammenfassung Summary
Dieser Artikel beschreibt die Auswirkungen des demografischen Wandels auf This article describes the effects of the demographic change on blood supply
die Blutversorgung anhand zweier Modellregionen in Deutschland. In einer and transfusion demand using two model regions in Germany. In a prospec-
prospektiven Longitudinalstudie werden in Mecklenburg-Vorpommern (MV) tive longitudinal study, data on all whole blood donors and recipients of red
seit 2005 und im Saarland seit 2017 Daten zu allen Vollblutspendern und blood cell concentrates (RBCs) in Mecklenburg-Western Pomerania (MV)
Empfängern von Erythrozytenkonzentraten (EK) ausgewertet und zu Bevöl- since 2005 and in the Saarland since 2017 were assessed and the changes
kerungsveränderungen in Beziehung gesetzt. Im Jahr 2015 deckten in MV correlated with changes of the demographic data in the respective popu-
die Vollblutspenden nur noch knapp den Bedarf an Erythrozytenkonzentraten lations. In 2015, whole blood donations in MV barely covered the demand
(+0,96 %), im Saarland bereits 2017 nicht mehr (-9,8 %). Bluteinsparungen for RBCs (+0.96 %). In the Saarland in 2017 already whole blood donations
durch Patient Blood Management sind weitestgehend ausgeschöpft. Die Blut- did not cover the transfusion demand (-9.8 %). We also provide preliminary
spendezahlen werden weiter sinken, gleichzeitig steigt der Transfusionsbe- evidence that patient blood management measures will likely not result in
darf, wenn die Baby-Boom-Generation die Altersgruppen > 65 Jahre erreicht. additional reductions in demand. The number of blood donations will further
decrease, while the need for transfusions will increase when the baby-boom-
generation reaches the age groups > 65 years.
HINTERGRUND früher als in den westlichen Bundesländern. Um den Ein-
fluss des demografischen Wandels auf die Blutversor-
In den letzten zehn Jahren beobachten wir in Deutschland gung untersuchen zu können, wurde an der Universitäts-
einen ausgeprägten Rückgang (-26 %) der Transfusionen medizin Greifswald vor 15 Jahren die Studie zur Blutver-
mit Erythrozytenkonzentraten (EK)1. Dies ist unter ande- sorgung in Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen.
rem auf eine aktive Einsparung der Transfusionen durch Hierbei werden im Abstand von fünf Jahren detaillierte
Patient Blood Management (PBM)–Initiativen zurückzu- Daten zu sämtlichen Vollblutspendern und EK-Empfän-
führen, z. B. durch eine kritischere Indikationsstellung zur gern im Bundesland ausgewertet und zur Bevölkerungs-
Transfusion, einer präoperativen Anämiebehandlung, oder entwicklung in Beziehung gesetzt3 – 5. Als zweites Bun-
durch perioperative Blutwiederaufbereitungssysteme. Der desland schloss sich im Jahr 2017 das Saarland dieser
zeitgleiche Rückgang der Vollblutspenden (VB; seit 2010 Datenerhebung an6. Zusammen machen die Einwohner
-23,6 %) zur Minimierung des Verwurfs scheint bei dieser Mecklenburg-Vorpommerns (ca. 1,6 Millionen Einwohner)
Entwicklung nur naheliegend1. Dennoch sehen sich Blut- und des Saarlands (ca. 0,99 Millionen Einwohner) gerade
spendedienste vor allem in den östlichen Bundesländern einmal 3,1 % der deutschen Gesamtbevölkerung aus2.
Deutschlands zunehmend mit der Situation konfrontiert, Aufgrund der Verantwortung der einzelnen Bundesländer
dass mehr und mehr Aufwand betrieben werden muss, für die Gesundheitsversorgung bilden die ca. 2,6 Millionen
genügend Vollblutspender zu akquirieren, um die Ver- Einwohner beider Bundesländer jedoch weitestgehend
sorgung mit Blutkonserven sicherzustellen. Grund hierfür den Blutbedarf einer größeren Bevölkerungsgruppe ab.
ist der demografische Wandel. Um ca. 50 % gesunkene Wenn sich die Hochrechnungen für die zukünftige Blut-
Geburtenraten nach der deutschen Wiedervereinigung versorgung auf andere Regionen Deutschlands übertra-
1990 und das Älterwerden der geburtenstarken Baby- gen lassen, wird der demografische Wandel sowohl Blut-
Boom-Generation (1955 – 1969) bewirken eine alternde spendedienste als auch Krankenhäuser in den nächsten
Bevölkerung2 (Abbildung 1). Diese Entwicklung ist in den zehn Jahren bei der Sicherstellung der Blutversorgung vor
ehemals der DDR-angehörigen Bundesländern beson- erhebliche Herausforderungen stellen.
ders ausgeprägt und geschieht hier in etwa zehn Jahre
4 37 2021Flächenländer Ost Flächenländer West
87 2030 87
84 84
81 2005 81
78 78
75 75
72
Geburt vor dem 2. Weltkrieg 72
69 < 1940 69
66 66
63 63
60 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit 60
57 1940 – 1955 57
54 54
51 51
48 48
45 Baby-Boom-Generation 45
42 1955 – 1969 42
39 39
36 36
33 „Pillenknick“ 33
30 30
27 27
24 24
21 21
18 18
15 15
12 12
Geburt nach
9 9
6
Wiedervereinigung 6
3 Frauen Männer 1990 Frauen Männer 36.000
Absolute Zahl der Vollblutspenden
5.000
10-Jahres-Shift
der Baby-Boom-Generation
2005
4.000
2015
3.000
2.000
Geburten-
1.000 schwache
Jahrgänge
nach 1990
0
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
Altersgruppe [Jahre]
Abbildung 2: Absolute Anzahl der Vollblutspenden pro Altersgruppe in Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2005 und 2015 (modifiziert nach Greinacher
et al. 2017)
200
180
Vollblutspenden / 1.000 Einwohner
160
MV (2015)
140
SL (2017)
120
100
80
60
40
20
0
18 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79
Altersgruppe [Jahre]
Abbildung 3: Vollblutspenden pro 1.000 Einwohner pro Altersgruppe in Mecklenburg-Vorpommern 2015 und im Saarland 2017 (modifiziert nach Eichler et al.
2020)
Der Rückgang der Vollblutspenden war zwischen den lut -12,9 %, Männer -4,0 %). Daraus lässt sich schluss-
Geschlechtern unterschiedlich stark ausgeprägt. Wäh- folgern, dass junge, männliche Spender vor allem durch
rend bei den < 30-Jährigen die Spenden von weiblichen den demografischen Wandel verloren gegangen sind,
Spendern um 45,8 % zurückgegangen sind, waren es es bei jungen, weiblichen Spendern aber noch andere
bei männlichen Spendern nur 30,8 % Rückgang. Dabei Gründe gegeben haben muss, die zu einem Rückgang
sind aber vor allem die Veränderungen der Spende- der Spenderate / 1.000 Einwohner geführt haben. Hier
rate / 1.000 Einwohner in dieser Altersgruppe beach- besteht gegebenenfalls ein Ansatzpunkt für zukünftige
tenswert. Während diese bei den < 30-jährigen männli- Spender-Werbemaßnahmen.
chen Spendern sogar um 1,2 % angestiegen ist, ist die
Spenderate von < 30-jährigen weiblichen Spendern Unterschiedliche Blutspendedienste
um 22,5 % rückläufig. Dieser Unterschied war bei den Wie auch im restlichen Bundesgebiet wird in Mecklen-
> 30-Jährigen nicht so stark ausgeprägt (Frauen abso- burg-Vorpommern und im Saarland der Großteil der Voll-
6 37 2021blutspenden vor allem von den DRK-Blutspendediensten (ca. 91.700 VB). Die wichtigste Ursache für diese Abwei-
gewonnen, gefolgt von den staatlich-kommunalen Blut- chung war die Lockerung der altersbedingten Spende-
spendediensten, während private Blutspendedienste nur begrenzung zwischen 2005 und 2015. Hierdurch haben
eine untergeordnete Rolle in der Versorgung mit Erythro- mehr Spender im Alter > 65 Jahre weiter Blut gespendet.
zytenkonzentraten spielen. Beachtenswert sind bei den Daraus schlussfolgern wir, dass sich die Zahl der zukünfti-
einzelnen Blutspendediensten Unterschiede bezüglich gen Vollblutspenden durchaus anhand der Bevölkerungs-
des Alters der Spender. Während private und staatlich- struktur vorausberechnen lässt und maßgeblich vom
kommunalen universitäre Blutspendedienste einen gro- demografischen Wandel abhängig ist.
ßen Teil ihrer Vollblutspenden von < 30-jährigen Spendern
gesammelt haben, bezogen die DRK-Blutspendedienste
ihre Spenden vor allem von Spendern der Baby-Boom- ENTWICKLUNG DES
Generation. Diese Unterschiede in den Altersgruppen der TRANSFUSIONSBEDARFS
Spender zeigen sich in Mecklenburg-Vorpommern und
im Saarland. Entsprechend ist zu erwarten, dass beson- Transfusionsbedarf in den einzelnen
ders die Blutspendedienste, deren Spenderpopulation Altersgruppen
vor allem in der Altersgruppe der > 40-Jährigen zu finden Circa zwei Drittel aller Erythrozytenkonzentrate werden
ist, in den nächsten 10 – 15 Jahren besonders stark vom Patienten transfundiert, die 65 Jahre oder älter sind. Auf-
demografischen Wandel betroffen sein werden, wenn die grund des stetig zunehmenden Anteils dieser Bevölke-
Baby-Boom-Generation allmählich altersbedingt oder rungsgruppen (Deutschland ≥ 65 Jahre 2005: 19,3 %;
aufgrund von Komorbiditäten aus dem Spenderpool 2015: 23,0 %; 2030 voraussichtlich 26,0 %), ist davon
ausscheidet. auszugehen, dass sich die Zahl der transfusionspflich-
tigen Patienten erhöhen wird. Trotz dessen wurde der
Vorhersagbarkeit des Blutspendeaufkommens Bedarf an Erythrozytenkonzentraten bei hospitalisierten
Anhand der erhobenen Daten wurde für Mecklenburg- Patienten in MV von 2005 (ca. 95.000 EK) bis 2015 (ca.
Vorpommern 2005 das Spendeaufkommen für das Jahr 82.500 EK) reduziert (-13,5 %). Im Saarland wurden laut
2015 vorausberechnet. Die Grundlage hierfür bildeten Statistik des Paul-Ehrlich-Instituts ebenfalls weniger EK
einerseits die alters- und geschlechtsspezifischen Spen- verbraucht (2008: ca. 58.480 EK, 2017: ca. 47.900 EK;
deraten mit der Annahme, dass sich diese nicht verän- -5,1 %) (Subanalyse aus1 durch O. Henseler, Paul-Ehr-
dern würden, auf der anderen Seite die Bevölkerungsvo- lich-Institut). Dass dies zumindest in MV vor allem auf eine
rausberechnungen des Statistischen Bundesamtes. Fak- aktive Reduzierung im Verbrauch zurückzuführen ist und
tisch war 2015 das tatsächliche Blutspendeaufkommen weniger auf Veränderungen in der Bevölkerungsstruk-
(ca. 97.000 VB) nur 5 % höher als das vorausberechnete tur, zeigt die Abnahme der Transfusionsrate / 1.000 Ein-
300
Transfundierte EK / 1.000 Einwohner
250
MV (2005)
200
MV (2015)
SL (2017)
150
100
50
0
0–4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 ≥ 85
Altersgruppe [Jahre]
Abbildung 4: Transfundierte EK pro 1.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern 2005 und 2015 sowie im Saarland 2017 (modifiziert nach Greinacher et al.
2017 und Eichler et al. 2020)
7wohner von 55,9 auf 51,2 EK / 1.000 Einwohner (-8,4 %). EK (15 %) und einem EK (11 %). Allerdings sind die Pati-
Diese Reduktion findet sich hauptsächlich bei den Pati- enten, die ein bis vier EK erhalten haben (insgesamt 75 %
enten, die 60 Jahre oder älter sind. Noch geringer ist aller transfundierten Patienten), für nur ca. ein Drittel des
die Transfusionsrate / 1.000 Einwohner im Saarland mit Gesamtbedarfs verantwortlich. Die restlichen 25 % der
40,9 / 1.000 Einwohner und auch hier zeigt sich die Dif- transfundierten Patienten, die > vier EK pro Patient erhal-
ferenz wieder vor allem bei den über 60-Jährigen (Abbil- ten haben, verbrauchten zwei Drittel aller transfundierten
dung 4). Diese Differenz des Blutbedarfs in den beiden EK. Dementsprechend ist der Großteil des Verbrauchs
Bundesländern weist darauf hin, dass die medizinische auf relativ wenige Patienten zurückzuführen.
Praxis in diesen beiden Regionen Deutschlands unter-
schiedlich ist. Es wäre von größtem Interesse, die Alters- Transfusionsbedarf nach Krankenhausgröße
verteilung der Transfusionsempfänger in den bevölke- Die Entwicklung des EK-Verbrauchs unterscheidet sich
rungsreichen Bundesländern zu kennen. Dies würde die zwischen den Krankenhäusern hinsichtlich ihrer Größe.
Abschätzung des künftigen Transfusionsbedarfs deutlich In Mecklenburg-Vorpommern bzw. im Saarland entfie-
erleichtern. len im Jahr 2015 bzw. 2017 ca. 45 % der transfundier-
ten EK auf große Krankenhäuser (> 700 Betten). Bei den
Transfusionsbedarf in den Fachrichtungen mittelgroßen Krankenhäusern (400 – 700 Betten) gab es
In beiden Bundesländern wird der Großteil der EK von Unterschiede zwischen den Regionen. In MV haben diese
internistischen Patienten verbraucht (MV: 39,3 %, SL Krankenhäuser zusammen nur ca. 14 % der Blutkonser-
39,5 %), gefolgt von chirurgischen (MV: 33,4 %, SL ven transfundiert, während es im Saarland 37 % waren.
31,7 %) und intensivmedizinischen bzw. Notfallpatien- Auf kleine Krankenhäuser (< 400 Betten) entfielen in MV
ten (MV: 26,2 %, SL 23,2 %) (Abbildung 5). In Mecklen- 30 % aller transfundierten Konserven, wohingegen es im
burg-Vorpommern ist der Großteil der Reduktion des EK- Saarland nur ca. 17 % waren. Interessant ist, dass zwi-
Verbrauchs zwischen 2005 und 2015 auf chirurgische schen 2005 – 2015 die kleinen (-18 %) und mittelgroßen
Patienten zurückzuführen, wenngleich auch bei internis- (-19 %) Krankenhäuser im Vergleich zu den großen Kran-
tischen und intensivmedizinischen Patienten eine Reduk- kenhäusern (-10 %) in MV einen deutlicheren Rückgang
tion zu beobachten war. des Verbrauchs von EK verzeichneten. Auch der Trans-
fusionsbedarf, den der einzelne Patient hat, unterschied
Transfusionsbedarf pro Patient sich hinsichtlich Fachrichtung und Krankenhausgröße
Der mit Abstand größte Teil der transfundierten Patienten (Tabelle 1). Unabhängig von der Krankenhausgröße, wie-
in MV erhielt zwei EK (43 %) pro Patient, gefolgt von vier sen die intensivmedizinischen Patienten den höchsten
100.000
90.000
Absolute Anzahl an transfundierten EK
80.000 24,5 %
70.000 26,2 %
60.000
50.000
37,4 %
39,3 %
40.000
23,2 %
30.000
20.000 39,5 %
35,1 %
33,4 %
10.000
31,7 %
0
MV 2005 MV 2015 SL 2017
Chirurgie Innere Medizin Intensiv- und Notfallmedizin
Abbildung 5: Transfusionsbedarf in den einzelnen Fachrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland mit jeweiligem Anteil am Gesamtverbrauch in
Prozent
8 37 2021Mittelwert Transfusionsindex*
(Median Transfusionsindex)**
Chirurgie Innere Medizin Intensiv- und
Notfallmedizin
Männer 3,7 (2) 4,1 (2) 5,7 (3)
Frauen 3,1 (2) 3,4 (2) 4,7 (2)
Kleine Krankenhäuser (< 400 Betten) 3,2 (2) 2,9 (2) 4,6 (2)
Mittelgroße Krankenhäuser (400 – 700 Betten) 2,6 (2) 3,0 (2) 4,3 (2)
Große Krankenhäuser (> 700 Betten) 3,5 (2) 4,2 (2) 5,7 (3)
Tabelle 1: Mittelwert und Median des Transfusionsindex abhängig von Patientengeschlecht, Krankenhausgröße und Fachrichtung (N = 12.011 Patienten
transfundiert mit 54.665 EK) aus Schönborn et al. 2020
*Transfusionsindex ist definiert als Zahl der transfundierten EK pro transfundiertem Patienten
medianen Pro-Kopf-Verbrauch auf. Unabhängig von der Zwischen den einzelnen Krankenhäusern in MV gab es
Fachrichtung war der mediane Pro-Kopf-Verbrauch in deutliche Unterschiede bezüglich der Entwicklung des
den großen Krankenhäusern (> 700 Betten) am größten. EK-Bedarfs im Beobachtungszeitraum (von 2005 – 2015
Dies ist vor allem auf die Patientengruppe zurückzufüh- +41,4 % Zunahme bis -61,9 % Reduktion des Bedarfs).
ren, die (zum Teil weitaus) mehr als vier EK benötigten. Dies ist wahrscheinlich nicht auf ein unterschiedliches
Der höhere Transfusionsbedarf pro Patienten in den grö- Transfusionsverhalten zurückzuführen, sondern eher auf
ßeren Krankenhäusern ist vermutlich dadurch zu erklären, andere Faktoren, wie beispielsweise auf die Ausweitung
dass diese Krankenhäuser in der Regel die schwerkran- einiger Fachrichtungen, neue Spezialisierungen oder
ken Patienten behandeln. eine andere Zusammensetzung der Patienten. Dies kann
16
UMG gesamt
15
14
Median Median Median Median Median Median Median Median Median
4,8 mmol/l 4,6 mmol/l 4,6 mmol/l 4,5 mmol/l 4,5 mmol/l 4,5 mmol/l 4,4 mmol/l 4,4 mmol/l 4,5 mmol/l
13
12
Hb vor Transfusion (mmol/l)
11
10
0
8
7
6,2 mmol/l =
Implementierung PBM
6 10 g/dl
5
4 3,7 mmol/l =
6 g/dl
3
2
1
0
2014 Q3 & Q4 2015 Q3 2016 2017 2018 2019 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3
Abbildung 6: Prätransfusioneller Hämoglobinwert (mmol/l) an der Universitätsmedizin Greifswald seit 2014
9anhand der aktuell zur Verfügung stehenden Daten nicht analyse liegen nahezu alle Transfusionen im unteren
geklärt werden. Bereich des von der Leitlinie Hämotherapie empfohlenen
prätransfusionellen Hb-Wertes.
Geschlechtsspezifische Unterschiede im
Transfusionsbedarf Diese Zahlen weisen sehr darauf hin, dass die Einsparef-
Obwohl in sämtlichen Beobachtungsjahren in Mecklen- fekte, die durch Optimierung des Transfusionsverhaltens
burg-Vorpommern und im Saarland mehr Frauen als Män- erreicht werden konnten, mittlerweile erreicht sind. Es
ner gelebt haben, wurden zu jeder Zeit mehr EK durch ist nicht zu erwarten, dass hier noch größere Einsparef-
männliche Patienten verbraucht (53,1 – 56,8 %). Dies trifft fekte erzielt werden können. Allerdings können Änderun-
in MV für alle Patientenkategorien zu, wobei vor allem in gen der medizinischen Praxis den Blutbedarf noch weiter
der Intensivmedizin männliche Patienten mehr Blut benö- reduzieren. Beispiele hierfür waren in den letzten Jahren
tigen als Frauen (61,5 % der EK in der Intensivmedizin an die Implantation von Aortenklappen über einen Herzka-
männliche Patienten). Dies liegt einerseits an einer höhe- theter ohne Operation oder der Einsatz von monoklonalen
ren Zahl an männlichen Patienten, die transfundiert wur- Antikörpern und Checkpoint-Inhibitoren in der Onkologie
den, andererseits zeigt sich auch bei männlichen Patien- anstelle einer Chemotherapie.
ten ein höherer Pro-Kopf-Verbrauch als bei weiblichen
Patienten (5,1 EK vs. 4,0 EK). Außerdem gibt es einen weiteren Effekt, der einen anstei-
genden Bedarf durch die alternde Bevölkerung bis-
Vorhersagbarkeit des Transfusionsbedarfs her kompensiert hat. Die geburtenschwachen Jahr-
Im Gegensatz zu den Vollblutspenden zeigt sich bei der gänge 1940 – 1950 (Zweiter Weltkrieg und unmittelbare
Vorausberechnung des EK-Verbrauchs eine deutliche Nachkriegszeit) haben im Jahr 2015 die Altersgruppe
Diskrepanz zwischen Vorausberechnung und tatsäch- der 65 – 75-Jährigen erreicht, die für gewöhnlich eine
lichem Transfusionsbedarf. Anhand der Daten aus dem hohe Transfusionsrate aufweist. Durch die in den letz-
Jahr 2005 wurde für Mecklenburg-Vorpommern im Jahr ten Jahren verhältnismäßig geringe Größe dieser Bevöl-
2015 ein Verbrauch von ca. 104.900 EK prognostiziert. kerungsgruppe, fallen die hohen Transfusionsraten nicht
Tatsächlich wurden aber nur ca. 82.600 EK benötigt. Dies so sehr ins Gewicht. Dies wird sich in den nächsten Jah-
sind 21,3 % weniger als erwartet. Diese Diskrepanz ist ren umkehren, wenn die geburtenstarke Baby-Boom-
Ergebnis der aktiven Reduktion des Verbrauchs, z. B. im Generation die Altersgruppen mit hohen Transfusionsra-
Rahmen des Patient Blood Managements. Wir monito- ten erreicht. Dies wird deutlich, wenn man die prozentuale
ren an der Universitätsmedizin Greifswald seit Jahren den Veränderung der Bevölkerung und des Transfusionsbe-
prätransfusionellen Hämoglobin (Hb)-Wert. Abbildung 6 darfs von 2005 – 2015 in den einzelnen Altersgruppen
zeigt, dass der mittlere prätransfusionelle Hb-Wert mitt- nebeneinander darstellt (Abbildung 7). Eine Zunahme
lerweile bei 4,5 mmol/l bzw. 7,25 g/dl liegt. In der Detail- einer Altersgruppe (bspw. 55 – 65 Jahre) hatte unmittel-
Geburtsjahrgang, der 2015 die entsprechende Altersgruppe erreichte:
100
Nach Baby-Boom- 2. Weltkrieg und Vor 2. Weltkrieg
Veränderungen der Einwohnerzahl
Wiedervereinigung Generation Nachkriegszeit (< 1940)
80 (> 1990) (1955 – 1969) (1940 – 1955)
Transfundierte EK
und des EK-Bedarfs in %
60
Einwohner MV
40
20
0
-20
-40
-60
-80
0–4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 ≥ 85
Altersgruppe [Jahre]
Abbildung 7: Prozentuale Veränderungen der Bevölkerung und des Transfusionsbedarfs in MV von 2005 – 2015 (modifiziert nach Schönborn et al. 2020)
10 37 2021150.000
Absolute Zahl der transfundierten EK
130.000 Prognose bei unverändertem
Transfusions- und Spendeverhalten
MV
bzw. Vollblutspenden
110.000
90.000 -18.000
EK
70.000
50.000
Saarland -18.000
EK
30.000
2005 2010 2015 2020 2025 2030
Transfusionsbedarf Vollblutspenden
Abbildung 8: Prognose der zukünftigen Vollblutspenden und des EK-Bedarfs in MV und im Saarland (modifiziert nach Greinacher et al. 2017 und Eichler et al.
2020)
bar eine Zunahme des EK-Verbrauchs zur Folge. Anders- demografischen Wandels in einer ähnlichen Versorgungs-
herum, reduzierte sich die Größe einer Altersgruppe situation befinden, so müsste man im Jahr 2030 deutsch-
(bspw. 10 – 25 Jahre), zog das auch eine prozentual ähn- landweit mit einem Defizit von über einer Million EK rech-
lich ausgeprägte Reduktion des Transfusionsbedarfs nen. Hierbei handelt es sich allerdings um ein Worst-
nach sich. Nichtsdestotrotz war der prozentuale Rück- Case-Szenario: Die Annahme, dass sich zukünftige
gang im Verbrauch in beinahe allen Altersgruppen stär- Spendezahlen anhand der Bevölkerungsentwicklung vor-
ker ausgeprägt als der Rückgang der jeweiligen Bevölke- ausberechnen lassen, hat sich in unserer Langzeitstudie
rungsgruppe. Diese Differenz spiegelt die aktive Reduk- bestätigt. Die Transfusionsrate reduzierte sich hingegen
tion der Transfusionsraten wider. deutlich, da sie maßgeblich von Änderungen in der medi-
zinischen Praxis abhängig war. Ob diese Entwicklung
jedoch weiter anhält und Transfusionsraten auch zukünf-
PROGNOSE DER ZUKÜNFTIGEN tig weiter sinken, ist fraglich. Wie oben ausgeführt sind
SPENDEZAHLEN UND DES die Möglichkeiten der Reduktion des prätransfusionel-
TRANSFUSIONSBEDARFS len Hämoglobinwerts bereits ausgeschöpft. Dennoch ist
bei unzureichender Datenlage unklar, ob das Potenzial in
Die Vorausberechnung des zukünftigen Spendenauf- kleineren Krankenhäusern ebenso ausgeschöpft ist, wie
kommens und Transfusionsbedarfs erfolgt auf Grund- an den Zentren der Maximalversorgung, bei denen der
lage der Bevölkerungsvorausberechnungen des Statis- prätransfusionelle Hämoglobinwert systematisch gemes-
tischen Bundesamtes und der Annahme, dass Spende- sen wurde. Unsere Studie hat gezeigt, dass es hinsicht-
und Transfusionsraten konstant bleiben (Abbildung 8). lich des Transfusionsverhaltens zwischen verschiedenen
Krankenhausgrößen Unterschiede gibt.
Dies würde für Mecklenburg-Vorpommern und das Saar-
land im Jahr 2030 zusammengerechnet ein Defizit von Dennoch, europäische Nachbarländer haben z. T. deut-
ca. 36.000 EK bedeuten, die aufgrund fehlender Vollblut- lich geringere Transfusionsraten als Deutschland (zum
spenden nicht in diesen Bundesländern gewonnen wer- Vergleich: Deutschland 44 / 1.000 Einwohner 2018, Nie-
den können und aus anderen Regionen importiert wer- derlande 24 / 1.000 Einwohner 20171,7). Die Ursachen da-
den müssen. Daten aus anderen Bundesländern für Vor- für sind aktuell unklar. Ein unterschiedlicher Umgang mit
ausberechnungen liegen derzeit nicht vor. Nimmt man Patienten unter Maximaltherapie oder chronisch transfusi-
aber an, dass sich andere Bundesländer aufgrund des onspflichtigen Palliativpatienten, oder aber eine geringere
114,00
Verhältnis der Bevölkerungsgruppen Stadtstaaten
18 – 64 Jahre / ≥ 65 Jahre 3,50
Westliche Bundesländer
3,00 Gesamtdeutschland
Mecklenburg-Vorpommern
2,50
Östliche Bundesländer
(ehem. DDR)
2,00
Saarland
1,50
2005 2010 2015 2020 2025 2030
Abbildung 9: Ratio der Altersgruppe 18 – 64 Jahre („potenzielle Spenderpopulation“) zur Altersgruppe der ≥ 65-Jährigen („potenzielle Empfängerpopulation“,
> 60% aller EK an diese Altersgruppe) für einzelne Regionen in Deutschland (modifiziert nach Schönborn et al. 2017)
Anzahl an Intensivbetten sowie Operationen, die häufig rungsentwicklung einzelner Regionen Deutschlands wird
mit EK-Transfusionen einhergehen, oder die Indikations- deutlich, dass dasselbe Verhältnis von potenzieller Spen-
stellung für invasive / aggressive Therapien bei Patienten derpopulation zu potenzieller Empfänger-Population in
mit fortgeschrittener Tumorerkrankung können diskutiert den westlichen Bundesländern ca. zehn Jahre (im Saar-
werden. Aus unserer Sicht weisen die bisherigen Daten land ca. fünf Jahre) später eintritt als in den östlichen Bun-
aus Mecklenburg-Vorpommern und dem Saarland aller- desländern (siehe Abbildung 9). Daher ist auch in diesen
dings deutlich darauf hin, dass der oft geäußerte Vorwurf, Regionen mit zunehmenden Problemen in der Blutversor-
dass in Deutschland viel zu unkritisch transfundiert wird, gung zu rechnen, wenn die Zahl der Vollblutspenden nicht
nicht zutrifft. Wenn derzeit in Mecklenburg-Vorpommern in ausreichendem Maße angehoben werden kann.
ein Viertel der Patienten zwei Drittel aller Blutkonserven
benötigt, kann die Reduktion der Transfusionsrate von
ca. 52 / 1.000 Einwohner auf 24 / 1.000 Einwohner wie HERAUSFORDERUNG FÜR DIE
in den Niederlanden nur dadurch erreicht werden, dass ZUKÜNFTIGE BLUTVERSORGUNG
die Transfusion bei Patienten, die sehr viele Blutkonser-
ven benötigen, stark eingeschränkt wird. Dies erfordert In vielen Regionen Deutschlands sind parallel zu einem
eine ethische / gesellschaftliche Diskussion und nicht die sinkenden Transfusionsbedarf in den letzten Jahren die
Entscheidung der Transfusionsmediziner, ausreichend Spenderzahlen aktiv reduziert worden, um den Verwurf
Blutkonserven zur Verfügung zu stellen, wenn der behan- zu minimieren. In persönlicher Kommunikation der Auto-
delnde Arzt eine Transfusionsindikation sieht. ren mit den anderen Blutspendediensten in Mecklenburg-
Vorpommern und dem Saarland wird deutlich, dass es
jetzt jedoch zunehmende Anstrengungen erfordert, die
ZWEI MODELLREGIONEN FÜR DIE Zahl der Vollblutspenden auf dem aktuellen Niveau zu hal-
BLUTVERSORGUNG ten und es noch deutlich schwieriger wird, sie in Hinblick
auf einen steigenden EK-Bedarf zu erhöhen. Diese Situa-
Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland entspre- tion hat sich durch die Corona-Pandemie nochmals ver-
chen zusammen mit 2,6 Mio. Einwohnern nur ca. 3,1 % schärft. Wenn eine alternde Bevölkerung in diesen Regio-
der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Inwieweit sich nen in Zukunft wieder zu einer Erhöhung des EK-Bedarfs
unsere Ergebnisse auf andere Bundesländer übertra- führt, ist aktuell unklar, ob genügend Spender reaktiviert
gen lassen, ist unklar. Vergleichen wir jedoch die Bevölke- werden können.
12 37 2021Grundlage für eine verlässliche Bedarfsplanung sind
solide Informationen zum Transfusionsbedarf in verschie-
denen Altersgruppen und bei unterschiedlicher Grund-
erkrankung. Bereits heute stehen in Deutschland für alle
Patienten Daten zu Alter, Geschlecht, DRG sowie Trans-
fusionsbedarf zur Verfügung. Eine systematische Aus-
wertung, beispielsweise im Rahmen der Berichterstat-
tung nach Transfusionsgesetz § 21, fehlt jedoch bisher.
Ein Monitoring dieser Daten kann die Grundlage darstel-
len, die Strategien für die zukünftige Bedarfsplanung und
-sicherung zu verbessern, drohende Defizite der regiona-
len Blutversorgung rechtzeitig zu erkennen und diesen
lokal oder ggf. überregional entgegenzusteuern.
Die Autoren
Dr. med. Linda Schönborn Prof. Dr. med. Andreas Greinacher
Universitätsmedizin KdöR Greifswald Universitätsmedizin KdöR Greifswald
Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin
Abteilung Transfusionsmedizin Abteilung Transfusionsmedizin
Linda.Schoenborn@med.uni-greifswald.de Andreas.Greinacher@med.uni-greifswald.de
Prof. Dr. med. Hermann Eichler
Institutsdirektor, Facharzt für Transfusionsmedizin,
Hämostaseologe
Institut für Klinische Hämostaseologien und
Transfusionsmedizin
Universität des Saarlandes
hermann.eichler@UKS.eu
Die Literaturhinweise zu diesem Artikel finden Sie im Internet zum
Download unter: www.drk-haemotherapie.de
13Univ.-Prof. Dr. med. Eva Rohde, Prof. Dr. rer. nat. Bernd Giebel
Extrazelluläre Vesikel – Zelltherapie der
nächsten Generation
Zusammenfassung Summary
Neben Partikeln und löslichen Faktoren werden extrazelluläre Vesikel (EVs) Among particles and soluble factors, extracellular vesicles (EVs) are secreted
von vielen Zellarten im menschlichen Organismus sezerniert. EVs vermit- by virtually all human cells. EVs mediate complex and targeted intercellular
teln komplexe und zielgerichtete interzelluläre Kommunikationsprozesse communication and essentially participate in physiological and pathophysio-
und kontrollieren physiologische und pathophysiologische Prozesse. EVs von logical processes. EVs of various cells may counteract pathogenic processes
geeigneten Zellen können pathophysiologischen Prozessen entgegenwirken and thus serve as a novel class of therapeutic agents in different approaches,
und als neue Wirkstoffklasse in verschiedenen Anwendungsgebieten dienen: including drug-delivery, pathogen-vaccination, anti-infectious, anti-tumour,
optimierte Wirkstoffverabreichung, Impfungen, anti-infektiöse, Anti-Tumor-, immune-modulatory or regenerative therapies. Translating EV-based thera-
immunomodulatorische oder regenerative Therapien. Die Translation EV- peutics into clinical evaluation requires the focus on efficacy, safety and a
basierter Therapeutika in die Klinik erfordert den Fokus auf Wirksamkeit, tight control of manufacturing and quality assurance. Here, we highlight sci-
Sicherheit und die Kontrolle von Herstellungsprozessen durch Qualitätssiche- entific achievements and strategies for the clinical investigation of EV-based
rungsmaßnahmen. In diesem Artikel werden bisherige Erkenntnisse und zu- therapeutics. We will illustrate how EVs as novel therapeutic entity perfectly
künftige Strategien für die klinische Testung von EV-Therapeutika aufgezeigt. fit into the aegis of Transfusion Medicine experts.
Wir werden darstellen, warum die Entwicklung neuartiger EV-Therapeutika
fachlich perfekt mit der Expertise von Teams in transfusionsmedizinischen
Einrichtungen umzusetzen ist.
EINLEITUNG men, um multivesikuläre Strukturen (multivesicular bodies,
MVBs) zu bilden. Bei der Fusion von MVBs mit der Plas-
Im Wesentlichen haben alle Zellen eines Organismus die mamembran, die erstmals 1983 am Beispiel von Reti-
Fähigkeit, eine Vielzahl von Vesikeln (z. B. Exosomen, kulozyten beschrieben wurde, werden die intralumina-
Mikrovesikel, apoptotische Körperchen) mit einer Größe len Vesikel als Exosomen in die extrazelluläre Umgebung
von etwa 70 Nanometern bis zu einigen Mikrometern in freigesetzt5 – 7. Da mithilfe unterschiedlicher Labormetho-
ihre extrazelluläre Umgebung freizusetzen. Diese sezer- den verschiedene Vesikel-Arten mit überlappenden Grö-
nierten Vesikel werden zusammenfassend als extrazel- ßenbereichen angereichert werden, wird in diesem Arti-
luläre Vesikel (EVs) bezeichnet. EVs übertragen Informa- kel die allgemeine Bezeichnung extrazelluläre Vesikel (EV)
tionen zwischen Zellen, Organen und sogar zwischen verwendet, auch wenn in Originalarbeiten die kleinen EVs
unterschiedlichen Organismen. Sie finden sich in vielen oftmals als Exosomen bezeichnet werden. Nach einer
Körperflüssigkeiten einschließlich Blut, Urin, Liquor, Milch, wegweisenden Publikation von 2007 (Valadi et al.), in der
cerebrospinaler Flüssigkeit und Speichel1 – 4. Des Weite- gezeigt wurde, dass humane mRNA über EVs in Mäuse
ren transportieren sie mutmaßlich nicht prozessierbare übertragen werden konnten, sind EVs in den Fokus der
Metabolite von Zellen zum Abbau in die Leber. EVs sind biomedizinischen Forschung gerückt8. Seither gibt es
bläschenartige Strukturen, die von Phospholipidmembra- einen exponenziellen Anstieg von Veröffentlichungen zum
nen umgeben sind. Sie können unterschiedlichste zellty- Thema. Unterschiedliche Methoden zur Charakterisierung
pische Kombinationen von Proteinen, Enzymen, Wachs- von EVs, die Suche nach adäquaten Ausgangsmaterialien
tumsfaktoren, kodierenden oder nicht-kodierenden RNAs, für EVs und die pharmazeutische Entwicklung von naiven
Rezeptoren, Zytokinen, Lipiden und Metaboliten enthal- oder modifizierten EVs sind zentrale Punkte der Entwick-
ten. Kleine EVs werden oft auch Exosomen genannt und lung von EV-Therapeutika (siehe Abb. 1: Charakterisie-
sind als 70 – 150 nm große, nanovesikuläre Strukturen rung, pharmazeutische Produktion und klinische Entwick-
definiert, die aus dem endosomalen Kompartiment von lung von EV-Therapeutika). Die Forschung an EVs kann im
Zellen aktiv ausgeschleust werden. Während der Reifung Feld der Biomarker und für diagnostische Zwecke (Stich-
knospen Teile der endosomalen Außenmembran als int- wort liquid biopsy) wertvolle Entwicklungen ermöglichen.
raluminale Vesikel in das Innere der reifenden Endoso- EVs als Zelltherapeutika der nächsten Generation können
14 37 2021Abbildung 1: Charakterisierung, pharmazeutische Produktion und klinische Entwicklung von EV-Therapeutika
im Sinne einer zellfreien Zelltherapie innovative Behand- tätssicherung von biologischen Arzneimitteln (beispiels-
lungsoptionen für vielfältige klinische Herausforderungen weise Blutprodukten und Zelltherapeutika), die mit unse-
liefern. Die therapeutischen Konzepte reichen von Mög- rem Fach verbunden ist, hat die Suche nach und die Her-
lichkeiten optimierter Wirkstoffverabreichung über Imp- stellung von effizienten und sicheren EV-Therapeutika ein
fungen bis hin zu Anti-Tumor-, anti-infektiösen, immunmo- spannendes und innovatives Kapitel für die Transfusions-
dulatorischen oder regenerativen Therapien4. Eine Auflis- medizin eröffnet.
tung der in der Datenbank registrierten klinischen Studien,
Indikationsstellungen und Verabreichungsformen auf
www.clinicaltrials.gov des National Institute of Health (NIH, MODIFIZIERTE EVS UND SPEZIFISCHE
USA) ist in der Tabelle 1: Klinische Studien mit Prüfpräpa- WIRKSTOFFABGABE (DRUG DELIVERY)
raten „Extrazelluläre Vesikel, EV oder Exosomen“ zusam-
mengefasst. Die klinische Erprobung von EV-Therapeu- EVs rücken als Systeme zur gezielten Wirkstoffverabrei-
tika befindet sich derzeit meist im Stadium der Phase- chung von Arzneimitteln mit pharmakologisch schwieri-
I- oder Phase-II-Prüfung. Angesichts der Expertise für gen Profilen in den Vordergrund. Herausforderungen wie
pharmazeutische Produktion, Entwicklung und Quali- eine zu hohe Toxizität für den Organismus, geringe Anrei-
15cherung des Wirkstoffs im Zielgewebe oder kurze Halb- ten in Frankreich zur Durchführung einer klinischen Phase-
wertszeiten könnten durch Wirkstoffverpackung in EVs I-Studie bei Melanompatienten und einer klinischen
überwunden werden9 – 11. Potenzielle Vorteile von EVs Phase-I-Studie gegen Lungenkrebs in den USA 23,24.
gegenüber synthetischen Vesikeln wie Liposomen kön- Beide klinische Studien verwendeten GMP-kompatible
nen unter anderem durch verringerte Immunogenizität Protokolle (Good Manufacturing Practice) zur Herstellung
und Toxizität, durch erhöhte Stabilität im Gewebe und von EV-Präparaten aus Kulturüberständen von Patien-
durch intrinsische Homing-Fähigkeiten von EVs gege- ten autologer, entsprechend konditionierter dendritischer
ben sein12. Substanzen, die durch den EV-gestützten Zellen25. Mit einer kleinen Anzahl an Patienten zeigten
Transport besonders gut am Zielort wirken können, sind diese klinischen Studien hauptsächlich die Durchführbar-
kleine RNA-Therapeutika, einschließlich miRNAs und siR- keit und Sicherheit der EV-Verabreichung. In der Folge
NAs, entzündungshemmende Mittel sowie Krebsmedika- wurde eine Studie der Phase II (NCT01159288) geplant
mente10. RNAs können durch RNA-Interferenz die Hem- und an Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
mung spezifischer Genexpression in Zielzellen bewirken. durchgeführt26 (siehe Tabelle 1: Klinische Studien). Auch
Die Aufnahme in die Zielzellen ist jedoch für die großen wenn die Therapie zu vielversprechenden NK-Zell-Effek-
und hydrophilen Nukleinsäure-Moleküle durch die Zell- ten führte, erfüllten die erzielten Ergebnisse leider nicht
membran eingeschränkt. Daher werden EVs als Schleu- die Erwartungen; mutmaßlich wurde ein nicht optimales
sensysteme benötigt. Im Vergleich zu viralen und kationi- Adjuvans verwendet27.
schen Carrier-Systemen können EVs die Wirkstoffe ohne
die Gefahr der unkontrollierten Virusintegration in die Ziel- Ein anderes Konzept einer EV-basierten Anti-Tumor-The-
zellen beziehungsweise ohne Toxizität für das Zielgewebe rapie verfolgt eine laufende Phase-I-Studie zur Behand-
anliefern13. lung von metastasierendem Pankreas-Karzinom mit
nachgewiesener KRAS G12D-Mutation. Hier soll die
Um EVs zu modifizieren und mit therapeutischen Molekü- onkogen-wirkende KRAS-Mutation mithilfe von kurzen
len zu beladen, werden hauptsächlich zwei Verpackungs- (short) interferierenden RNAs (siRNAs) in ihrer Wirkung
Strategien untersucht: (1) in Post-Loading-Ansätzen wer- neutralisiert werden; genauer, EVs von genetisch modifi-
den EVs nach der Isolierung beladen, diese Strategie ist zierten mesenchymalen Stromazellen sollen KRAS G12D-
auch als exogene Beladungsmethode bekannt14; (2) mit siRNA in die Pankreastumorzellen transportieren und
Pre-Loading-Methoden werden Zellen modifiziert, bevor hierdurch die Translation konstitutiv aktiver KRAS-Prote-
oder während sie EVs abgeben, auch endogene Bela- invarianten unterbinden (NCT03608631). Ergebnisse ste-
dungsmethode genannt9, 10, 15. Einige Gruppen berichten hen aus, so dass die sehr vielversprechende Ergebnisse
einen funktionellen siRNA-Transport in Empfängerzellen aus Tierstudien noch nicht durch klinische Daten unter-
durch EVs, die mittels Elektroporation mit entsprechen- mauert worden sind.
den RNA-Molekülen beladen worden sind16 – 18. Die Effizi-
enz der Beladung ist aufgrund der möglichen Aggregation Auch gibt es weitere therapeutische Ansätze, die bereits
von siRNAs im Elektroporationspuffer mutmaßlich deut- in klinischer Erprobung sind. EVs von genetisch modifi-
lich überschätzt worden19. Andere Arbeiten stellen die zierten Zellen (human embryonic kidney cells, HEK 293)
Elektroporation als Methode zur Beladung von EVs mit werden mit einem für seine Anti-Tumor-Wirksamkeit
RNAs in Frage14, 20. bekannten STING Agonisten, dem small molecule CDN
(cyclic di-nucleotide) beladen. Freie STING-Agonisten
besitzen jedoch nur eine begrenzte Wirksamkeit (nied-
EVS UND MALIGNE ERKRANKUNGEN rige Tumorretention und schlechte Membranpermeabili-
tät). Assoziiert mit EVs (ExoSTING™) wurde in Tumormo-
Die Idee, EVs als Anti-Tumor-Impfstoffe zu verwenden, dellen eine 100-fach erhöhte Wirksamkeit erzielt. Entspre-
entwickelte sich bereits vor 25 Jahren21, 22. EVs wur- chend wurde eine EV-basierte Therapie mit ExoSTING™
den durch Ultrazentrifugation von konditionierten Medien entwickelt, die nun in einer multizentrischen, nicht verblin-
von Antigen-präsentierenden dendritischen Zellen geern- deten Phase I/II klinischen Studie erprobt werden soll. Bis
tet, die mit antigenen Peptiden stimuliert wurden. Diese zu 180 Patienten sollen intratumorale Injektionen bei fort-
EVs enthielten MHC-Peptid-Komplexe, die in Tiermodel- geschrittenen, metastasierenden soliden Tumoren wie
len eine CD4- und CD8-T-Zellantwort hervorriefen. In der zum Beispiel bei Plattenepithelkarzinom von Kopf oder
Tat wurde eine Abstoßung wachsender Tumore in immun- Hals oder bei triple-negativem Mammakarzinom erhalten
kompetenten Mäusen durch aktivierte tumorspezifische (NCT04592484, siehe Tabelle 1: Klinische Studien).
zytotoxische T-Zellen beobachtet21. Diese Befunde führ-
16 37 2021EVS UND INFEKTIÖSE ERKRANKUNGEN NATIVE MSC-EVS UND
GEWEBEREGENERATION DURCH
Krankheitserreger wie Pilze, Helminthen (Platt- und Spul- IMMUNMODULATION
würmer) und Bakterien sowie parasitäre Protozoen ein-
schließlich Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma, Die Rolle von EVs als wichtige Akteure bei der Vermittlung
Leishmania und Trichomonaden sezernieren ebenso wie der biologischen Aktivität von MSCs wird zunehmend
menschliche Zellen EVs. Sowohl grampositive als auch klarer. Ursprünglich wurden MSCs als Subpopulation von
gramnegative Bakterien können EVs freisetzen, diese stromalen Knochenmarkszellen mit osteogenem Poten-
werden allgemein als outer membrane vesicles (OMVs) zial beschrieben43, 44. MSCs wurden aufgrund ihrer ein-
bezeichnet28 – 32. Darüber hinaus können pathogeninfi- fachen Handhabung und ihrem breiten in vitro-Differen-
zierte Zellen Vesikel freisetzen, die pathogenspezifische zierungspotenzial vielfältig in regenerativen Therapien ein-
Antigene tragen. EVs mit erregerspezifischen Antigenen gesetzt45 – 49. Sie können aus verschiedenen Geweben
wurden beispielsweise aus Makrophagen isoliert, die mit wie Knochenmark, Fettgewebe und Nabelschnurblut und
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis BCG, -gewebe gewonnen werden50–53 und vermitteln in vielen
Salmonella typhimurium oder Toxoplasma gondii sowie Modellen lokale bzw. systemische immunmodulierende
aus murinen Retikulozyten, die mit Plasmodium yoelii infi- Effekte. 2002 wurde erstmals beschrieben, dass MSC
ziert wurden. Ähnlich wie in den Anti-Tumor-Studien wur- die Proliferation von mitogen-stimulierten T-Zellen unter-
den solche EVs als Impfstoffe in zahlreichen präklinischen drücken54. Es stellte sich ebenso heraus, dass MSCs die
Mausmodellen untersucht28, 33 – 39. Reifung und Aktivierung von dendritischen Zellen hem-
men, B-Zell- und NK-Zellfunktionen modulieren, die regu-
Vor mehr als zehn Jahren hat Novartis bereits einen Impf- latorische T-Zell-Bildung fördern und die Polarisierung
stoff namens Bexsero entwickelt, der auf OMVs basiert, von klassisch aktivierten proinflammatorischen M1-Mak-
die aus Neisseria meningitidis gewonnen werden. Bex- rophagen zu alternativ aktivierten anti-entzündlichen
sero wird als Impfstoff gegen Meningokokken-Erkran- M2-polarisierten Makrophagen bewirken55 – 62. Nachdem
kungen der Serogruppe B bei Kindern verwendet40, 41. applizierte MSCs im Wesentlichen im Lungengewebe und
Außerdem, wurden in präklinischen Modellen Nanovesi- nur äußerst selten in betroffenen Geweben gefunden wur-
kel, die aus bakteriellen Komponenten ohne äußere Bak- den, die von der MSC-Therapie profitieren63 – 65, unter-
terienmembranen bestehen, als Impfstoff getestet. Es suchten diverse Gruppen parakrine Wirkmechanismen
wurde festgestellt, dass diese bei Mäusen einen Schutz der MSCs. In der Tat ließen sich ähnliche therapeutische
gegen bakterielle Sepsis induzieren42. Aktivitäten in MSC-Kulturüberständen nachweisen wie
sie nach Applikation der Zellen beobachtet wurden66 – 68.
Seit Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie sind weltweit Auf der Suche nach den aktiven Komponenten in den
Millionen von Menschen von der COVID-19-Erkrankung Kulturüberständen sind dann zwei Gruppen unabhängig
betroffen, wobei die Anzahl der Todesfälle weltweit die voneinander auf EVs als Wirkstoffe gestoßen, die Gruppe
Millionengrenze übersteigt. Neben vielfältigen Studien von Sai Kiang Lim und Dominique de Kleijn im Kontext
in den Lebenswissenschaften, gibt es auch etliche EV- von myokardialen Infarktmodellen und die Gruppe von
basierte Studien. Beispielsweise wird in einer klinischen Giovanni Camussi in einem akuten Nierenschädigungs-
Phase-I-Studie die Wirkung von durch Inhalation appli- modell61, 69. MSC-EVs werden jedoch, ebenso wie EVs
zierte T-Zell abstammenden EVs auf die COVID-19-in- von anderen Zellarten, selten als homogene Fraktion iso-
duzierte Pneumonien untersucht (NCT04389385). Auch liert, sondern werden oft in unterschiedlichen Größen und
hier sind noch keine klinischen Ergebnisse berichtet wor- gemeinsam mit löslichen Faktoren und Partikeln als para-
den. Im Gegensatz hierzu gibt es wie im nächsten Kapitel krine Sekretomfraktion von Zellen gewonnen (siehe Trans-
detailliert beschrieben, eine Reihe von publizierten Arbei- missionselektronenmikroskopie in Abb. 1).
ten, die die Sicherheit und Wirksamkeit von EVs aus mes-
enchymalen Stromazellen (MSC-EVs) als anti-inflammato- Aufgrund des präklinisch therapeutischen Potenzials und
risches Agens bei der Therapie von COVID-assoziierten dem Fehlen von Behandlungsalternativen wurde 2011 die
Lungenschäden beschreiben. erste dokumentierte klinische MSC-EV-Gabe in einem
Heilversuch am Universitätsklinikum Essen (Forschungs-
gruppe Bernd Giebel) durchgeführt. In dieser experimen-
tellen Heilbehandlung einer steroidrefraktären GvHD-Pati-
entin wurden MSC-EVs in steigenden Dosen in Abstän-
den von zwei bis drei Tagen über einen Zeitraum von
17Sie können auch lesen