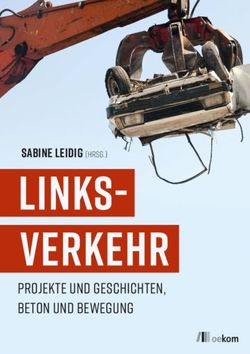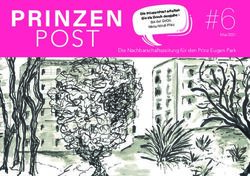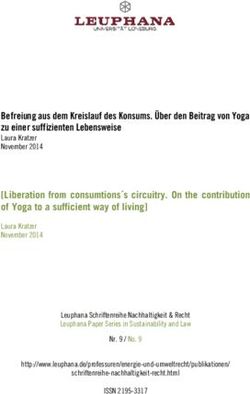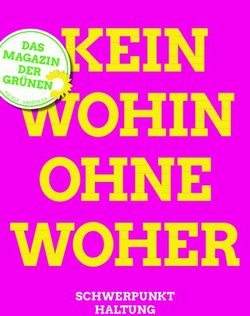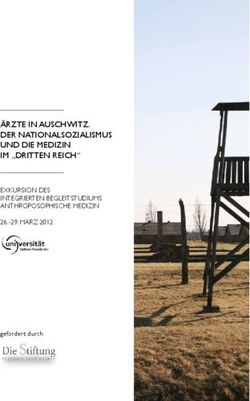TEXTE PUBLIC VALUE - MEDIENQUALITÄT IN ZEITEN VON CORONA
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PUBLIC VALUE
TEXTE
24
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE
QUALITÄT IM DISKURS
BETRIFFT: CORONA
MEDIENQUALITÄT
IN ZEITEN VON
CORONAPUBLIC VALUE 2020
DIE 5 QUALITÄTSDIMENSIONEN
INDIVIDUELLER WERT GESELLSCHAFTSWERT ÖSTERREICHWERT
VERTRAUEN VIELFALT IDENTITÄT
SERVICE ORIENTIERUNG WERTSCHÖPFUNG
UNTERHALTUNG INTEGRATION FÖDERALISMUS
WISSEN BÜRGERNÄHE
VERANTWORTUNG KULTUR
INTERNATIONALER WERT UNTERNEHMENSWERT
EUROPA-INTEGRATION INNOVATION
GLOBALE PERSPEKTIVE TRANSPARENZ
KOMPETENZ
Public Value, die gemeinwohlorientierte Qualität der öffentlich-rechtlichen
Medienleistung des ORF, wird in insgesamt 18 Kategorien dokumentiert, die
zu fünf Qualitätsdimensionen zusammengefasst sind.
Mehr dazu auf zukunft.ORF.at.
– gedruckt nach der
DESIGN:
Richtlinie „Druckerzeugnisse”
HERAUSGEBER UND HERSTELLER: ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG
des Österreichischen
Österreichischer Rundfunk, ORF FÜR DEN INHALT VERANTWORTLICH: Umweltzeichens,
Würzburggasse 30, 1136 Wien ORF-Generaldirektion Public Value ORF Druckerei, UW 1237
1. Auflage, © ORF 2020 Reaktionen, Hinweise und Kritik bitte an: zukunft@ORF.at
2CORONA ALS BEWÄHRUNGSPROBE
DER MEDIEN
Welche Folgen hat die weltweite Pandemie für die Medien, insbesondere
für die Qualitätsmedien? Haben sie angesichts der ebenso unerwarteten
wie außerordentlichen Herausforderungen standgehalten? Sind sie
ihrem Selbstverständnis als „4. Gewalt“, die Regierung und Macht kon-
trolliert, gerecht geworden? Haben öffentlich-rechtliche Medien ihren
Auftrag erfüllt? Waren sie glaubwürdig, zuverlässig und nützlich? Und
nicht zuletzt: Was lässt sich aus der monatelangen und nach wie vor an-
dauernden Krise etwas lernen? Wie können und sollen Qualitätsmedien
in Zukunft auf derartige Szenarien reagieren?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich die aktuelle Sonderausgabe der PUBLIC
VALUE TEXTE.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch maßgebliche
Chefredakteure aus ORF und NDR erörtern von unterschiedlichen Stand-
punkten aus die Kompetenz der Medien in Zeiten der Krise.
Einige der in diesem Heft vorliegenden Beiträge wurden bereits im
Frühjahr verfasst, andere in den letzten Sommertagen 2020. Entspre-
chend unterschiedlich sind auch die Annäherungen, die Meinungen, die
Perspektiven. Für die Medien könnte die verheerende Krise der letzten
Monate jedenfalls auch eine Gelegenheit zur Selbstreflexion und Lern
fähigkeit darstellen. In diesem Sinn wünschen wir allen Leser/innen
eine nicht nur aktuell fundierte, sondern zukunftsorientierte Lektüre.
Wie immer finden Sie die Beiträge dieser Ausgabe, PDFs aller vorange-
gangenen Editionen der PUBLIC VALUE TEXTE sowie zahlreiche weitere
Zahlen, Daten und Fakten zu Public Value, zu öffentlich-rechtlicher Me-
dienproduktion auf zukunft.ORF.at.
KONRAD MITSCHKA KLAUS UNTERBERGER
ORF GENERALDIREKTION PUBLIC VALUEPUBLIC VALUE 2020
INHALT
5
„ALLES SEHR UNKLAR UND NEU ...“
DR.IN BEATE GROSSEGGER, INSTITUT FÜR JUGENDKULTURFORSCHUNG
14
KRISE, ABER DIESMAL WIRKLICH
DR. STEFAN GADRINGER, UNIVERSITÄT SALZBURG
20
ZEIGEN, NICHT ERKLÄREN!
DR.IN ANGELIKA SIMMA-WALLINGER, MSC, FH VORARLBERG
24
WO DER PROFESSOR RUND UM DIE UHR „HALLO!“ SAGT
ANDREAS CICHOWICZ, CHEFREDAKTEUR NDR FERNSEHEN
27
DATEN, MODELLE UND MEDIEN
DR. NIKI POPPER, TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN & DWH GMBH
34
MÄRZENBECHER UND TRANSISTORRADIO
MATTHIAS SCHROM, CHEFREDAKTEUR DER ORF 2-INFORMATION
37
BERICHTERSTATTUNG IM AUSNAHMEZUSTAND
HANNES AIGELSREITER, ORF-RADIOINFORMATION
40
ZAHLEN ZUM ORF IM ZUSAMMENHANG MIT CORONA
(AUSWAHL)
42
ORF-LANDESSTUDIOS ESSENZIELL IN DER KRISE
LISA STADTHERR, BA BA MA UND PAUL SCHMIDINGER, MA, FH CAMPUS WIEN
45
ENGAGIERTES BEKENNTNIS ZUM PUBLIC SERVICE
PROF.IN DR.IN MARLIS PRINZING, MACROMEDIA HOCHSCHULE KÖLN
49
ÖFFENTLICH-RECHTLICHE SIND NICHT BLOSS LAUTSPRECHER
PROF.EM ROGER BLUM, UNIVERSITÄT BERN
51
VON DER BERICHTERSTATTUNG IN KRISENZEITEN
ZUR KRISE DER BERICHTERSTATTUNG?
UNIV.-PROF.IN DR.IN LARISSA KRAINER, UNIVERSITÄT KLAGENFURT
53
DER RITT AUF DER RASIERKLINGE
UNIV.-PROF. DR. WOLFGANG DUCHKOWITSCH, UNIVERSITÄT WIEN
4ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
„ALLES SEHR UNKLAR UND NEU ...“
CORONA-NEWS AUS SICHT DES
JUNGEN WEIBLICHEN PUBLIKUMS
DR. IN BEATE GROSSEGGER
INSTITUT FÜR JUGENDKULTURFORSCHUNG
Die Corona-Krise ist zweifellos eine epocheprägende Erfahrung, vor al-
lem für junge Menschen. Durch den Corona-Shutdown im Frühjahr 2020
wurden sie nahezu über Nacht aus ihrem gewohnten Leben herausge-
rissen. Social Distancing, Home Learning und Teleworking veränderten
ihren Alltag radikal. Die Angst vor Verzögerungen in ihren Bildungsbio-
graphien, wachsender Arbeitslosigkeit und einer möglicherweise dro-
henden Weltwirtschaftskrise grub sich in die Köpfe der österreichischen
Jugend ein. Auch in Sachen Mediennutzung Jugendlicher und junger Er-
wachsener hinterließ Covid-19 deutliche Spuren. WhatsApp, TikTok und
Co. schienen vielen zunächst ein Rettungsanker in der sozialen Isolati-
on. Doch schon bald verdichtete sich das Gefühl, dass Social Media den
direkten persönlichen Kontakt mit FreundInnen nicht ersetzen können.
Selbst eingefleischte Social-Media-Kids fühlten sich in den eigenen vier
Wänden eingesperrt und von der Gesellschaft der Altersgleichen entkop-
pelt. In gaming-affinen Milieus stieg der Videospiel-Konsum im Corona-
Shutdown markant an. Zeitgleich tat sich bei jungen MediennutzerInnen
im Bereich der klassischen Medien, also TV, Radio und Tageszeitung, et-
was Unverhofftes. Das breite junge Publikum entdeckte in der Akutpha-
se des Shutdown den Qualitätsjournalismus für sich. Das Interesse an
aktuellen News über das Coronavirus wie auch über politische Maßnah-
men zur Eindämmung der Corona-Pandemie war vor allem zu Beginn
der Krise, im März und April 2020, enorm – auch und gerade bei jungen
Frauen, die, wie die Jugendmedienforschung zeigt, normalerweise nicht
Kernzielgruppe tagesaktueller Nachrichten sind.
EIN KURZER RÜCKBLICK: NEWS VOR DER KRISE
Herbst 2019: Die österreichische Nationalratswahl war geschlagen. Die
Jugendforschung hatte Daten zum Interesse an politischer Information
in den Medien erhoben und diese bestätigten einmal mehr, was Jugend-
forscherInnen und MedienmacherInnen bereits wussten: Das Vertrauen
junger Menschen in die Politik ist gering. Nur eine kleine Minderheit
bezeichnet Politik als persönlich sehr wichtigen Lebensbereich. Viele
5PUBLIC VALUE 2020
Jugendliche und junge Erwachsene gehen zu Politik klar auf Distanz.1
Und auch Nachrichten in Tageszeitung, Fernsehen und Radio stehen zu-
nehmend mehr junge Menschen distanziert gegenüber.2 Bei jungen Frau-
en zeigt die Forschung insgesamt ein noch geringeres Politikinteresse als
bei jungen Männern. Ausgenommen vor Wahlen artikulieren junge Frau-
en auch vergleichsweise geringeres Interesse an politischer Information,
sprich: eine, gemessen an ihrem aktiven Interesse an Nachrichten über
aktuelle politische Ereignisse in Österreich und der Welt, geringere Poli-
tik-News-Affinität.3
Im Herbst 2019 gab – trotz Aktualitätsbezug der österreichischen Nati-
onalratswahl – lediglich ein Fünftel der jungen Frauen im Alter von 16
bis 29 Jahren (20%) an, über die politischen Ereignisse in Österreich und
der Welt immer topaktuell informiert sein zu wollen. 31% zeigten zwar
vor Wahlen und am Wahltag Interesse an aktuellen politischen News,
nach der Wahl ließ ihr Interesse aber schnell nach. Rd. jede zweite 16-
bis 29-jährige ging zu aktueller politischer Information in redaktionel-
len Medien hingegen völlig auf Distanz.4 Als Hauptgrund nannten die
jungen Frauen übrigens nicht, wie man vielleicht vermuten würde, ei-
nen Mangel an politischer Bildung bzw. fehlendes Vorwissen, um die
berichteten Ereignisse einordnen zu können. Auch Argumente, die auf
eine Entfremdung von redaktionellen Medien schließen lassen, standen
nicht im Zentrum. Vielmehr argumentierten sie vor dem Hintergrund ei-
nes tiefgreifenden Vertrauensverlustes in die Institutionenpolitik: Jun-
ge Frauen aus der Gruppe der News-Distanzierten sehen die politische
Kultur überaus kritisch und machen daher von ihrem demokratischen
Recht, politisch desinteressiert zu sein, Gebrauch. Politik-Entfremdung
und News-Distanz gehen bei ihnen Hand in Hand.
1 Institut für Jugendkulturforschung/tfactory: Jugendwertestudie 2019, Wien, 2019;
Deutsche Shell (Hg.): Jugend 2019. Eine Generation meldet sich zu Wort, Weinheim:
Beltz, 2019
2 vgl. fög – Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft/Universität Zürich (Hg.):
Qualität der Medien. Bedeutungsverlust traditioneller Newsmedien und die Entste-
hung neuer Nutzungsmuster – wie Digitalisierung Newsrepertoires verändert. Reihe
Studien 1/2019, Zürich, 2019
3 Deutsche Shell (Hg.): Jugend 2019. Eine Generation meldet sich zu Wort, Weinheim:
Beltz, 2019, S. 14; Institut für Jugendkulturforschung: Generation Rückzug? Jugend vor
Corona. Tabellenband, Wien, 2020, S. 11ff
4 Diese jungen Frauen reihen sich in die Gruppe der Hard-News-Avoider und Entkop-
pelt-News-Deprivierten ein, vgl. Institut für Jugendkulturforschung: Generation Rück-
zug? Jugend vor Corona, Wien, 2020
6ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
20% interessierte Info-Nutzerinnen, der Rest Gelegenheits-Info-Scanne-
rinnen und News-Distanzierte – vor allem für öffentlich-rechtliche Me-
dien, deren Auftrag die informative Grundversorgung ist, bedeutet dies
eine Herausforderung. Man muss nichts beschönigen: Vor der Krise war
Informationsqualität im öffentlich-rechtlichen Kontext für einen Gutteil
des jungen weiblichen Publikums wenig greifbar oder zumindest wenig
lebensweltrelevant. Doch dann kam Covid-19 und plötzlich war alles an-
ders. Die Corona-Krise erhöhte schlagartig den Bedarf an Qualitätsinfor-
mation und, wie die Forschungsdaten zeigen, konnten dabei vor allem
öffentlich-rechtliche Angebote punkten.
„SITUATION MATTERS“: DIE CORONA-KRISE VERÄNDERT
ZUMINDEST KURZFRISTIG DAS INFORMATIONSVERHALTEN
JUNGER FRAUEN
Die Covid-19-Pandemie traf uns so unerwartet, für viele war dies ein
echter Schock: auch und gerade für junge Menschen. Der Shutdown gab
uns allen Zeit zum Nachdenken. Junge Frauen taten dies ausgiebig, und
zwar ausgehend von ihrer persönlichen Betroffenheit. Direkt darauf an-
gesprochen, wie es ihnen in der aktuellen Situation denn gehe, kamen
Statements wie „Ich weiß nicht, was ich glauben soll ...“ (weiblich/25 bis
29 Jahre/Region West/niedrige und mittlere Bildung), „Ungewissheit ist
das größte Übel“ (weiblich/25 bis 29 Jahre/Region Süd/höhere Bildung)
oder „Alles sehr unklar und neu“ (weiblich/25 bis 29 Jahre/Region West/
niedrige und mittlere Bildung).5
Es waren viele und zum Teil sehr unterschiedliche Fragen, die die jungen
Frauen beschäftigten, etwa:
• Was hat zur Corona-Krise geführt? (im Wording eher verschwörungs-
theoretisch Gesinnter: Wer ist an der Corona-Krise schuld? oder in dif-
ferenzierterer Betrachtung: Welche politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen haben die Krise begünstigt?)
• Was tun EntscheidungsträgerInnen, um uns aus dieser Krise möglichst
rasch wieder herauszuführen?
• Welche Corona-Maßnahmen wurden beschlossen, welche kommen
noch auf uns zu, für wen und wo sind sie gültig und was bedeuten sie
für mich und meinesgleichen?
5 Institut für Jugendkulturforschung: Jugend Frauen und Corona (Eigenstudie – laufen-
des Projekt), Wien, 2020
7PUBLIC VALUE 2020
• Was erwartet mich: Wie sehr bringt die Krise meinen Lebensplan
durcheinander? Wie wird sich mein Leben durch die Corona-Krise ver-
ändern? Und wie wird sich unsere Gesellschaft verändern?
• Was ist mein ganz persönlicher Beitrag zur Bewältigung der Krise?
Kann ich überhaupt einen Beitrag leisten? Und: Will ich einen Beitrag
leisten?
• Aber auch: Was ist mit den Medien? Berichten sie objektiv, verheim-
lichen sie etwas, schüren sie Angst, liefern sie wirklich die Informa-
tionen, die ich brauche, um mir ein Bild von der Situation machen zu
können?
Das Interesse an aktueller Information über das Coronavirus wie auch über
politische Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wuchs.
Zugleich waren sich zunächst viele nicht sicher, wie ehrlich und umfas-
send die Politik informiert. „Ich glaube, dass uns die Politik über das wah-
re Ausmaß der Corona-Pandemie im Unklaren lässt“, meinte zu Beginn
der Corona-Krise jede zweite 16- bis 29-jährige (53%). Und so wandte sich
das junge weibliche Publikum dem Qualitätsjournalismus zu.
Die Suche nach Antworten auf ihre Fragen zu Covid-19 und den Folgen
führte die jungen Frauen zu Medien, die vor der Krise keine herausragen-
de Rolle im Medienrepertoire junger Zielgruppen gespielt hatten: allen
voran dem ORF. In Zusammenhang mit klassischen Informationsforma-
ten in Fernsehen, Radio und Tageszeitung nannten zu Beginn der Coro-
na-Krise, im März und April 2020, zwei von drei jungen Frauen (65%),
die sich auf eine besonders glaubwürdige Hauptinformationsquelle fest-
legten, Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als ihre Hauptin-
formationsquelle zu Corona, wobei ihre Präferenz erwartungsgemäß in
Richtung TV-Information ging (ORF-Fernsehen als Hauptinformations-
quelle in der Corona-Krise: 53% Nennungen).6
Freilich legten sich nicht alle auf eine bevorzugte Medienmarke in der
Corona-Krise fest. Angesichts der hochdifferenzierten Medienlandschaft
mit enormer Informationsdichte und hohen Dynamiken krisenbezoge-
ner Breaking News ist das nur zu verständlich. Für so manche war auch
im Corona-Shutdown ein informationsorientiertes Switchen zwischen
den Angeboten und Anbietern Alltagsroutine: 15% der jungen Frauen
gaben an, spontan nicht sagen zu können, welches Medium für sie im
Shutdown die persönlich wichtigste Info-Quelle zum Corona-Virus und
zu den Corona-Maßnahmen sei.7
6 Institut für Jugendkulturforschung: Generation Corona. Tabellenband, Wien, 2020, S. 7
7 Institut für Jugendkulturforschung: Generation Corona. Tabellenband, Wien, 2020, S. 5
8ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
Jedoch unabhängig davon, ob sie eine persönliche Hauptinformations-
quelle in der Corona-Krise nannten oder sich aus dem breiten Informa-
tionsangebot ihren persönlichen Info-Cocktail mixten, haben 70% der
jungen Frauen ORF-Fernsehen, 31% ORF-Radio und 32% orf.at in ihren
persönlichen Corona-Info-Cocktail integriert.
Social Media spielten zu Beginn der Corona-Krise in den Info-Menüs jun-
ger Frauen ebenfalls eine wichtige Rolle: 54% der 16- bis 29-jährigen Ös-
terreicherinnen nannten Social Media als eine der für sie persönlich rele-
vanten Info-Quellen über das Corona-Virus und seine Folgen. Wenn auch
mit deutlichem Abstand liegen Social Media im Ranking der genutzten
Info-Angebote damit an zweiter Stelle nach ORF-TV-Information.8
Alles in allem setzten junge Frauen erstaunlich stark auf redaktionelle
Angebote in Fernsehen, Radio und TV. Dennoch blieb jede fünfte junge
Frau im Alter von 16 bis 29 Jahren (21%) auch in der Akutsituation des Co-
rona-Shutdown zu redaktionellen News-Medien auf Distanz.9 Vor allem
für diejenigen, die den Corona-Shutdown als persönliche Krise erlebten,
war Informationsvermeidung eine Strategie, um Ängste abzuwehren
oder sich nicht noch stärker verunsichern zu lassen. Sie entschieden sich
gegen Breaking News – häufig mit dem Argument: „Mittlerweile bin ich
durch die andauernd schlechten Nachrichten nur mehr genervt.“ (weib-
lich/20 bis 24 Jahre/Region West/höhere Bildung)
In einem Punkt war sich die breite Mehrheit des jungen weiblichen Pu-
blikums jedenfalls einig: In der Krise sind Boulevard-Medien nicht der
richtige Info-Partner. 83% der 16- bis 29-jährigen jungen Frauen waren
der Ansicht, dass reißerische Boulevard-Berichterstattung in der Bevöl-
kerung Panik schüre.10 Und Panik wollten sie nicht. Sie hielten vielmehr
Ausschau nach Informationen, die ihnen ein ungefähres Einschätzen
der Situation ermöglichte, was zumindest ein klein wenig die Illusion
stützte, dass man alles sicher im Griff habe.
8 Institut für Jugendkulturforschung/tfactory: Jugendwertestudie 2020: Der Corona-
Report. Tabellenband, Wien, 2020, S. 23
9 Bei jungen Männern liegt der Anteil mit 28% Nennungen sogar noch höher; Institut
für Jugendkulturforschung: Generation Corona. Tabellenband, Wien, 2020, S. 5
10 Dementsprechend spielen Boulevardmedien wie die Kronen Zeitung (print und
online), Österreich (print und online) und Heute (print und online) als Info-Partner im
Corona-Shutdown eine unbedeutende Rolle; vgl. Institut für Jugendkulturforschung/
tfactory: Jugendwertestudie 2020: Der Corona-Report. Tabellenband, Wien, 2020, S. 18
und S. 23
9PUBLIC VALUE 2020
IN DER KRISE VERSCHIEBEN SICH MEDIENFUNKTIONEN: WIE
JUNGE FRAUEN DIE CORONA-BERICHTERSTATTUNG ERLEBEN
Corona-News funktionieren anders als klassische tagesaktuelle Nach-
richten, das zeigt sich sehr deutlich, wenn man sich näher damit be-
schäftigt, wie junge Frauen die Corona-Berichterstattung erleben bzw.
was sie sich von ihr erwarten. Interessant zu beobachten ist, wie sich
aus Sicht des jungen weiblichen Publikums Medienfunktionen im News-
Bereich in der Krise verschieben.
Der Shutdown wird von jungen Frauen als Ausnahmesituation gesehen.
Alles ist anders, gewohnte Routinen sind außer Kraft gesetzt. Erfahrun-
gen, die bislang als Richtschnur zur Alltagsbewältigung dienten, scheinen
entwertet. Im Shutdown geht es jungen Frauen daher allem voran um per-
sönliche Orientierung. Die Kritik- und Kontrollfunktion, eine Leistung re-
daktioneller Medien in demokratisch organisierten Gesellschaften, die die
Kommunikationswissenschaft klassischerweise in der tagesaktuellen Be-
richterstattung verortet, oder die Artikulationsfunktion, durch die Medi-
en den Interessen wenig gehörter und/oder kritischer Gruppen öffentlich
Gehör verschaffen, treten in den Hintergrund. Qualitätsjournalismus wird
für junge Frauen vielmehr zum persönlichen Wegweiser durch den Shut-
down: Was bedeutet die Krise für mein Leben? Wie wirkt sich die Krise
auf Arbeitsmarkt und Wirtschaft aus und was bedeutet dies für meine Zu-
kunftschancen? Welches Risiko habe ich, zu erkranken? Wie schütze ich
mich und mir nahestehende Menschen vor Covid-19? Von Corona-News
erwarten sich junge Frauen Informationen, die es ihnen ermöglichen, sich
in der Krise zu orientieren, und die dem Gefühl des Kontrollverlustes da-
mit zumindest ein klein wenig entgegenarbeiten.
Worum es also zunächst ging, war, sich im Ausnahmezustand des Shut-
down zurechtzufinden. Dabei standen u.a. auch praktische Fragen im
Vordergrund, beispielswiese die Frage, was man darf und was man nicht
darf. Hier gab es gegenüber den Medien, vor allem aber gegenüber den
politischen EntscheidungsträgerInnen auch Kritik: „Ich fühle mich un-
informiert. Die Medien erzählen von den Gesetzesentscheidungen der
Regierung, jedoch ohne Details, einfach weil die Regierung keine Details
äußert. Irgendwie fürchte ich mich auch, rauszugehen, weil ich mit einer
Anzeige der Polizei rechnen kann.“ (weiblich/16 bis 19 Jahre/Region Mit-
te/höhere Bildung)
Wenig später rückte die Frage, was man tun soll und worauf man besser
verzichtet, in den Fokus, Stichwort: solidarisch-eigenverantwortliches
Verhalten. Nun kommt die vielzitierte (wenngleich angesichts wach-
10ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
sender gesellschaftlicher Differenzierung heute oftmals als nicht mehr
zeitgemäß aufgefasste) Integrationsfunktion des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks zum Tragen. Der ORF informierte nicht nur über Corona-
Maßnahmen, sondern appellierte auch an die österreichische Bevölke-
rung und sprach sie als Corona-Schicksalsgemeinschaft und „Team Ös-
terreich“ an: mit der klar adressierten Bitte, Loyalität gegenüber den mit
den Corona-Maßnahmen verbundenen Verhaltensnormen zu zeigen.11
Und die jungen Frauen zogen mit: 96% der 16- bis 29-jährigen Österrei-
cherInnen vertraten die Ansicht, dass jede und jeder Einzelne einen Bei-
trag leisten müsse, um die Corona-Epidemie einzugrenzen.12
Dann aber kam die Beendigung der Ausgangsbeschränkung und der
Aufbruch in die so genannte „neue Normalität“. Und die Voraussetzun-
gen für die Corona-Berichterstattung änderten sich.
HERAUSFORDERUNGEN FÜR NACHRICHTENMACHERINNEN AM
WEG IN DIE „NEUE NORMALITÄT“
Nach dem Shutdown folgten erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen,
die uns Schritt für Schritt zurück in die neue Normalität führen sollten.
Je länger dieses Zurück dauerte, desto stärker veränderte sich das Stim-
mungsbild in der Bevölkerung. Wie die Ergebnisse des Corona-Panel
der Universität Wien zeigen, ging in den Folgemonaten des Shutdown
sowohl das Vertrauen in die Politik bzw. die politischen AkteurInnen,
die von der Bevölkerung als zuständige KrisenmanagerInnen angesehen
werden, als auch das Vertrauen in den ORF zurück.13
Die Menschen, vor allem die jungen Menschen, waren der Krise müde ge-
worden. Sie suchten Ablenkungen und fanden diese, wie man weiß, zum
Teil in wenig corona-risikobewusstem Freizeitverhalten. Kritik kam am
Krisenmanagement, das manchen zu sehr nach dem Motto „Machen wir
mal, dann sehen wir schon“ zu laufen schien. In der medialen Bericht-
erstattung wurde das Corona-Thema nun auch mehr und mehr von an-
deren tagesaktuellen Themen überlagert. In der Berichterstattung über
11 Zur Integrationsfunktion siehe Burkart, Roland: Kommunikationswissenschaftliche
Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft
(4., überarbeitete und aktualisierte Auflage), Wien/Köln/Weimar: Böhlau, 2002, S. 388
12 Institut für Jugendkulturforschung: Generation Corona. Tabellenband, Wien, 2020, S. 9
13 Kowarz, Nikolaus; Pollak, Markus: Wer vertraut dem Staat? Institutionenvertrauen in
Zeiten von Corona, Blog-Beitrag im Corona-Blog der Universität vom 29.7.2020 (https://
viecer.univie.ac.at/corona-blog/corona-blog-beitraege/blog70/; Zugriff am 4.8.2020)
11PUBLIC VALUE 2020
Corona-Maßnahmenpolitik ließ sich schon bald wieder jenes gewohnte
Politik-Hickhack beobachten, welches junge Frauen, wie die Forschung
zeigt, zu Politik und Politikberichterstattung so oft auf Distanz hält.
Nach einem guten halben Jahr Krise ist eine gewisse Erschöpfung und
auch Abstumpfung gegenüber dem andauernden Krisenmodus spürbar
– in der Gesamtbevölkerung und auch bei jungen Frauen. In den Medien
wird nach wie vor ständig über Covid-19 berichtet. Aber plötzlich stehen
so viele Info-Puzzle-Teile nebeneinander, dass es zunehmend schwieri-
ger wird, daraus ein in sich geschlossenes, schlüssiges Bild zu kreieren.
Während sich der Wissenschafts¬journalismus darum bemüht, aktuel-
le Erkenntnisse der Coronavirus-Forschung in die Sprache des breiten
Publikums zu übersetzen, nehmen kontinuierliche politische Neube-
wertungen der Corona-Situation und, damit verbunden, Anpassungen
der Maßnahmen wie auch diesbezügliche politische Differenzen in der
Berichterstattung gefühlt immer mehr Raum ein. Dazu kommen ständig
irgendwo aufpoppende Cluster, die die Hoffnung auf ein rasches Ende
der Krise schwinden lassen. Die Orientierungsfunktion, die junge Frau-
en dem Qualitätsjournalismus in der Akutphase des Shutdown zuschrie-
ben, bleibt zweifelsohne auch auf dem Weg in die „neue Normalität“
wichtig. Und dennoch definiert das junge weibliche Publikum den Infor-
mationsauftrag nun neu.
Viele fühlen sich coronamäßig „overnewsed, but underinformed“. Hier
gilt es anzusetzen. Seit Monaten strömt Information zum Corona-Thema
unaufhörlich – allzu oft bieten die Corona-News nicht wirklich Neues,
sondern „more of the same“. Oder sie setzen das zu Berichtende wie in
einem Corona-News-Rap einfach nebeneinander, ohne die Informati-
onen zu kontextualisieren und/oder in ihrer Bedeutung für den Alltag
zu bewerten. Damit werden Corona-News für viele irrelevant. Was sich
junge Frauen von den Medien wünschen, ist kompetente und kompakte
Selektion des für sie persönlich Wichtigen.
Für den Qualitätsjournalismus heißt das, die Fragen, die die jungen Frau-
en in ihrer aktuellen Lebenssituation und zum aktuellen Zeitpunkt der
Corona-Pandemie beschäftigen, in den Mittelpunkt zu rücken und aus
der Summe der potentiell zu berichtenden News das für das Publikum
Relevante herauszufiltern und zu verdichten (wobei sich die Relevanz-
setzungen des Publikums situationsbedingt schnell ändern können).
12ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
Die thematischen Bausteine der Corona-Berichterstattung sind dabei
eigentlich klar:
• Politische Maßnahmen interessieren vor allem dann, wenn sie in ihren
Konsequenzen für den persönlichen Alltag gezeigt werden.
• Aktuelle Daten zur Entwicklung des Infektionsgeschehens vermitteln
einen Überblick über die Situation und regen zum Nachdenken über
das Leben mit Corona morgen und übermorgen an (wobei hier vor al-
lem auch lokale Szenarien und ihre Folgen für den persönlichen Alltag
interessieren, aber auch der Vergleich von Region zu Region – frei nach
dem Motto: Wie sieht es bei uns aus und wie geht es den Menschen in
anderen Teilen Österreichs?).
• Seriöser Wissenschaftsjournalismus und ExpertInneneinschätzungen
stehen für fachlich solide Information über Ansteckungsrisiken wie
auch mögliche Therapie- und Präventionsansätze (diese Information
ist nicht nur interessant, sie dient auch als wichtige Entscheidungs-
grundlage im Kontext der viel beschworenen Eigen- und Fremdverant-
wortung jedes und jeder Einzelnen zur Bewältigung der Corona-Krise).
• Service-Information für all jene, die durch Corona in eine schwere per-
sönliche Krise geschlittert sind, bleibt auf dem Weg in die „neue Nor-
malität“ selbstverständlich auch weiterhin wichtig.
Darüber hinaus braucht es natürlich Informationsformate, die den Re-
zeptionsgewohnheiten und Medienästhetiken des jungen weiblichen Pu-
blikums entsprechen. Dass sich diese zum Teil völlig anders darstellen
als die der guten alten TV-Generation, muss man kaum eigens betonen. •
13PUBLIC VALUE 2020
KRISE, ABER DIESMAL WIRKLICH
DR. STEFAN GADRINGER
UNIVERSITÄT SALZBURG
Das neue Jahrzehnt begann mit schwungvollen Ereignissen. Erstmals
sollte eine Regierungskoalition zwischen der ÖVP und den Grünen die
Weichen für die großen, zukünftigen Herausforderungen stellen. Bei-
spiele wären die Digitalisierung sämtlicher Gesellschaftsbereiche, Re-
aktionen auf die Klimakrise oder die Aufrechterhaltung der starken
Konjunkturlage. Wenige bezweifeln im Jahr 2020, dass sich die Gesell-
schaft in einem strukturellen Wandel befindet. Gleichzeitig zeigt sich
hier auch gleich die Bedeutung einer terminologischen Einordnung bei
der Verwendung von Schlüsselwörtern. Betrachtet man den Medien- und
Nachrichtensektor, so bezieht sich der strukturelle Wandel vor allem
auf konvergierende Produktions- und Distributionskanäle, veränder-
te Nutzungsmuster und die stärkere Konkurrenz von zuvor weitgehend
getrennten Akteuren. Diese Entwicklungen und Trends wurden konti-
nuierlich durch wissenschaftliche Studien begleitet und beschrieben.
Im Jahr 2011 startete das schweizerische Kompetenzzentrum SwissGIS
(Swiss Centre for Studies on the Global Information Society der Univer-
sität Zürich) ein Forschungsprojekt mit dem Titel „Die Krise der Mas-
senmedien“ (Meier, Bonfadelli, & Trappel, 2012). Damit zeigt sich das
negativ konnotierte Wort des Wandels – die Krise. Das schweizerische
Forschungsprojekt ging vor allem der Frage nach, ob der strukturelle
Wandel und die Folgen der globalen Finanzkrise ab 2008 auch eine Krise
der (Nachrichten-)Medien zur Folge hätten. Die Forschungsergebnisse
zeigten, dass sowohl Vertreter der Nachrichtenmedien, Regulierungsbe-
hörden und andere medienpolitische Akteure sehr darauf bedacht wa-
ren, hier explizit nicht von einer Krise zu sprechen (Wenzel, Gadringer,
& Trappel, 2016). Latente Problemfelder wie die nachhaltige Finanzie-
rung von Online-Ausgaben, die Ressourcenkürzungen in den Redaktio-
nen oder journalistische Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten waren
keine drängenden Probleme und wurden auf die lange Bank geschoben.
Das sollte auch so bleiben und bis dato wenig medienpolitische Reakti-
onen hervorrufen. Bis zum März 2020, nachdem die COVID-19-Pandemie
auch in Österreich drastische Maßnahmen forderte. Der Lockdown war
für Österreichs Nachrichtenmedien ambivalent. Selten zuvor war das
Nachrichteninteresse und der Bedarf an Information derart hoch. Das
Wegbrechen von Werbeschaltungen und damit die finanzielle Grundlage
der meisten österreichischen Nachrichtenorganisationen ist jedoch die
Kehrseite der Medaille. Und damit ist sie da, eine Krise der Nachrichten-
medien.
14ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
In den jährlichen Berichten des Digital News Report (www.digitalnews-
report.at bzw. www.digitalnewsreport.org) zeigten sich bereits latente
Problemfelder in der österreichischen Nachrichtenlandschaft. Die Coro-
na-Pandemie wirkte hier wie ein Brandbeschleuniger und bestrafte auf
drastische Weise jene, deren Organisationsstrukturen an einen zuneh-
mend digitaler werdenden Rezipientinnen- und Rezipientenmarkt noch
nicht angepasst sind.
WEGBRECHENDE WERBEEINNAHMEN UND GERINGE
ZAHLUNGSBEREITSCHAFT FÜR ONLINE-NACHRICHTEN
März 2020, steigende Covid-19-Fallzahlen in Tiroler Wintersportorten
und auch in anderen Teilen des Landes, dazu dichter werdende Gerüch-
te, dass ein kompletter Lockdown erfolgen wird. In dieser Krisensitua-
tion ist gut aufbereitete Information essenziell. Die österreichischen
Nachrichtenmedien kamen dem auch nach und verzeichneten Rekord-
Nutzungszahlen. Am stärksten wurden Rundfunkbeiträge und die je-
weiligen Online-Ausgaben genutzt. Die Nutzung letzterer bringt zwar
erhöhten App-/Website-Traffic, eine Refinanzierung der eingesetzten
Ressourcen ist aber problematisch, weil die meisten Inhalte kostenlos
zur Verfügung gestellt werden. Einnahmen kommen aus dem Verkauf
von Online-Werbung bzw. über Querfinanzierung durch andere Distribu-
tionskanäle der jeweiligen Nachrichtenmarken (zumeist Print). Die Ein-
nahmen auf dem Werbemarkt sind aufgrund des strukturellen Wandels
ohnehin schon rückläufig, zusätzlich wurden Werbeschaltungen in der
Lockdown-Zeit massiv reduziert. Am konkreten Beispiel der Werbeein-
nahmen für den ORF zeigt sich dieser Rückgang: von 2017 auf 2019 gab es
einen Rückgang der Werbeeinnahmen von 216 auf 203 Mio. – Einnahmen
aus der Online-Werbung blieben mit 16 Mio. konstant. Wenngleich der
ORF auch noch auf Einnahmen aus der Rundfunkgebühr zurückgreifen
kann, offenbarte sich bereits vor der Corona-Krise ein Finanzierungspro-
blem, das für rein werbefinanzierte Medien umso schwieriger zu bewäl-
tigen ist. Generell gilt: direkte Bezahlung für Nachrichteninhalte bzw.
Modelle dafür stecken noch in der Anfangsphase.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich am Horizont. Die Bereitschaft
für Online-Nachrichten zu bezahlen steigt. Die Daten des Digital News
Report zeigen einen konstanten Anstieg von 2016 bis 2020 um 4 Prozent-
punkte (2016: 6,6 %; 2017: 7,4 %; 2018: 8,5 %; 2019: 9,1 %; 2020: 10,6 %).
Etwas stärker ist dieser Trend sogar in der Altersgruppe von 18-34 Jahren.
15PUBLIC VALUE 2020
PUBLIC SERVICE ELEMENTE
Die Schwierigkeit, nachhaltige Direkt-Bezahlmodelle zu etablieren, ist in
der österreichischen Medienmarkt besonders hoch. Die öffentlich-recht-
lichen Angebote des ORF, die eben auch mit Gebühren finanziert sind,
werden kostenlos zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Dabei ist der ORF
in den Bereichen Rundfunk sehr dominant (80 % der Befragten nutzen
ORF-Marken offline, 36 % nutzen das Online-Angebot; vgl. Digital News
Report 2020).
Die starke Dominanz der öffentlich-rechtlichen Angebote lässt sich mit
der Lenkungswirkung für den gesamten Medienmarkt und dem Setzen
von journalistischen Standards rechtfertigen (Trappel, 2012). Öffentli-
che Medien unterliegen erhöhten Anforderungen was Integrität, Sorg-
falt und Seriosität in der Berichterstattung, im Umgang mit Quellen und
in der Interaktion. Fehlverhalten fällt daher in der öffentlichen Debatte
oftmals auf das gesamte öffentlich-rechtliche System und deren Legi-
timation zurück. Im Hinblick auf eine Neuausrichtung der öffentlich-
rechtlichen SRG SSR in der Schweiz führt Kurt Imhof folgende Punkte an
(Imhof, 2012):
• Vermeidung der Anpassung an den Softnews-Mainstream
• Verstärkte Integrationsleistungen
• Versachlichung der politischen Auseinandersetzung
• Verstärkung der außenpolitischen Berichterstattung, sowie der Kultur-
und Wirtschaftsberichterstattung
• Ausbau der Online-Berichterstattung
Im Hinblick auf die Corona-Pandemie und die Rahmenbedingungen für
den ORF müssten noch weitere Aspekte hinzugefügt werden. Es hat sich
gezeigt, dass die Einbeziehung von Expertinnen und Experten (Wissen-
schaftlerInnen, ÄrztInnen etc.) wesentlich dazu beitragen, glaubwürdi-
gere Berichterstattung bereitzustellen und damit das Vertrauen in Nach-
richten zu stärken. Allerdings erfordert die Interaktion mit Expertinnen
und Experten hohes Fachwissen und Vermittlungskompetenz. Speziell
die Wissenschaftsressorts wurden oft aufgrund von Sparmaßnahmen
ausgedünnt. Zur speziellen Informationsvermittlung, die den Gesund-
heitsbereich und die Auswirkungen der Pandemie betreffen, sind diese
Ressorts jedoch ein wichtiger Baustein.
Beim Ausbau der Online-Berichterstattung entstehen weitere Problem-
felder für die österreichische Medienlandschaft. Einerseits ist Rundfunk
und die Verbreitung von Inhalten über das Rundfunknetzwerk relativ
16ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
stark und eindeutig reguliert. Im Onlinebereich zeigen sich die Eigen-
schaften eines konvergierenden Medienmarkts mit unterschiedlichen
Konkurrenzsituationen. Öffentlich-rechtliche Angebote konkurrieren
mit privat-kommerziellen Angeboten. Hier ist ein adaptierter und zeit-
gemäßer medienpolitischer Rahmen erforderlich, der über die Jahre hin-
weg kaum angepasst wurde.
MEDIENFÖRDERUNG UND SUBVENTIONEN
Eine Anpassung – zurecht von mehreren Seiten gefordert – betrifft auch
die Neuregelung der Medienförderung. Gerade die Corona-Pandemie
machte deutlich, dass speziell für Qualitäts-Tagespresse die Medienför-
derung ein wesentlicher Baustein in der Finanzierung ist. Da wirkte es
umso verwunderlicher, die erste Tranche einer Sonderausschüttung frei
nach dem Gießkannenprinzip an alle Medien zu vergeben. Diese Vorge-
hensweise ist mehr als veraltet, wird der Zweckmäßigkeit, die sich durch
den strukturellen Wandel ergeben hat, nicht gerecht und wurde auch in
früheren Studien widerlegt (etwa durch die vom Bundeskanzleramt in
Auftrag gegebene Haas-Studie aus dem Jahr 2013).
Im digitalen Nachrichtenbereich wären mögliche Förderkriterien die
Ausrichtung an bestimmten Qualitätsstandards, die Etablierung von
inhaltlicher Vielfalt und die Sicherstellung von Aus- und Weiterbildung
von Journalistinnen und Journalisten. Zudem würde sich die Möglich-
keit ergeben, Kooperationen zu fördern. Diese Kooperationen könnten
sowohl zwischen etablierten Playern entstehen, oder auch für kleine
journalistische Projekte ein Anreiz sein. An dieser Stelle ist anzumerken,
dass gerade am österreichischen Medienmarkt sehr wenig Digital-Born/
Digital-Only-Nachrichtenmarken existieren bzw. sich erfolgreich etablie-
ren konnten.
NACHRICHTENNUTZUNG ÜBER ETABLIERTE MARKEN VS.
INFORMATION IN SOCIAL MEDIA
VERTRAUEN IN NACHRICHTEN UND NACHRICHTENMEDIEN
Das anfangs erwähnte, schweizerische Forschungsprojekt stellte in einer
Folgepublikation zurecht die Frage „Gehen in den Leuchttürmen [den
Leitmedien] die Lichter aus?“. Erste Studienergebnisse zeigen, dass die
Leitmedien gerade zu Beginn der Pandemie bzw. des Lockdowns die we-
sentliche Anlaufstelle für die Informationsbeschaffung waren (Nielsen,
Fletcher, Newman, Brennen, & Howard, 2020). Dabei kam es aber zu un-
17PUBLIC VALUE 2020
terschiedlichen Nutzungsmustern zwischen Angeboten von Leitmedien
und Informationen, die über Plattformen und Social Media veröffent-
licht und abgerufen wurden.
Das dahinterstehende Problem ist die Verbreitung von Desinformation,
Fake News und bewusster Irreführung. Grundsätzlich besteht die Mög-
lichkeit, dass Desinformation über sämtliche Kanäle verbreitet wird. Al-
lerdings sind redaktionelle Strukturen und journalistische Routine effizi-
ente Mittel zur Vermeidung. Im Gegenteil dazu gab in der Untersuchung
des Reuters Institute etwa ein Drittel der Befragten an, mit „bottom-up-
misinformation“ konfrontiert gewesen zu sein (Nielsen et al., 2020). Si-
gnifikante Nutzungsunterschiede, entweder eine stärkere Nutzung von
etablierten Nachrichtenmarken oder eine stärkere Informationsnutzung
über Social Media und Plattformen zeigten sich anhand von drei sozi-
odemografischen Aspekten: Alter, Einkommen und formaler Bildungs-
grad. Tendenziell nutzen verstärkt ältere Personen mit höherem Einkom-
men und höherem formalen Bildungsgrad die Angebote von etablierten
Nachrichtenmarken. Umgekehrt zeigte sich, dass bei jüngeren und nied-
riger gebildeten Personen die Nutzung von Informations- und Kommuni-
kationsangeboten in sozialen Netzwerken stärker ausgeprägt war.
Die Coronavirus-Pandemie bietet demnach auch eine Chance für etab-
lierte (Leit-)Medien, die Markenreputation zu stärken bzw. aufzubauen.
Umgekehrt besteht auch das Risiko, dass sich Desinformation und be-
wusste Falschmeldungen in sozialen Netzwerken verbreitet und es da-
durch zu polarisierten Öffentlichkeiten kommen kann.
CONCLUSIO – EIN ADAPTIERTER RAHMEN FÜR NACHRICHTEN
Die Coronavirus-Pandemie stellt eine Krise für sämtliche Nachrichten-
medien dar. Die wohl größte Gefahr ist das Wegbrechen der Geschäfts-
grundlage aufgrund fehlender oder reduzierter Werbeeinnahmen. Die
österreichische Nachrichtenlandschaft ist immer noch geprägt durch
eine starke Nutzung von Printprodukten, wenngleich dieser Trend kons-
tant rückläufig, aber im internationalen Vergleich immer noch hoch ist.
Diese „bequeme“ Situation erfordert nun umso größeren Handlungsbe-
darf und größere Anstrengungen, digitale Angebote abseits von Werbefi-
nanzierung zu schaffen.
18ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
Für die etablierten Leitmedien besteht im digitalen Bereich wohl die Not-
wendigkeit der Kooperation, um gegen internationale Player bestehen
zu können. Die aktuelle Lage bietet eine Chance, mit gesteigertem Inte-
resse an Nachrichten und höherem Vertrauen in die Berichterstattung
eine starke Reputation bei Nutzerinnen und Nutzern zu erlangen.
Nichts desto trotz ist eine Anpassung der medienpolitischen Rahmen-
bedingungen notwendig. Angekündigte und wieder verschobene Refor-
men müssen angegangen werden, um einen Nachrichtenmarkt zu eta-
blieren, der im digitalen Bereich attraktiv ist und den vorherrschenden
Nutzungsmustern entspricht. •
LITERATUR
Imhof, K. (2012). Krise des Nielsen, R. K., Fletcher, R., Newman, N., Bonfadelli, & J. Trappel (Eds.), Gehen in den
Informationsjournalismus. In W. A. Meier, Brennen, J. S., & Howard, P. N. (2020). Leuchttürmen die Lichter aus? Was aus den
H. Bonfadelli, & J. Trappel (Eds.), Gehen in Navigating the ‘Infodemic’: How People in Schweizer Leitmedien wird (pp. 277-295).
den Leuchttürmen die Lichter aus? Was aus Six Countries Access and Rate News and Wien/Zürich/Berlin: LIT Verlag.
den Schweizer Leitmedien wird (pp. 69-80). Information about Coronavirus. Retrieved
Wien/Zürich/Berlin: LIT Verlag. from Oxford: https://reutersinstitute.politics. Wenzel, C., Gadringer, S., & Trappel, J.
ox.ac.uk/sites/default/files/2020-04/ (2016). Media Policy and Regulation in Times
Meier, W. A., Bonfadelli, H., & Trappel, J. Navigating%20the%20Coronavirus%20 of Crisis. In S. Simpson, M. Puppis, & H. Van
(Eds.). (2012). Gehen in den Leuchttürmen Infodemic%20FINAL.pdf den Bulck (Eds.), European Media Policy for
die Lichter aus? Was aus den Schweizer the Twenty-First Century. Assessing the Past,
Leitmedien wird. Wien/Zürich/Berlin: LIT Trappel, J. (2012). Baustellen der Setting Agendas for the Future (pp. 95-117).
Verlag. Medienpolitik. Die Krisenfolgen im New York: Routledge.
Medienpolitikdiskurs. In W. A. Meier, H.
19PUBLIC VALUE 2020
ZEIGEN, NICHT ERKLÄREN!
DR. IN ANGELIKA SIMMA-WALLINGER, MSC
FH VORARLBERG
Die Welt ist in einer höchst außergewöhnlichen Lage. Das Corona-Virus
hat unser soziales Leben in Österreich binnen weniger Märztage stärker
verändert, als alles, woran sich die Nachkriegsgeneration sonst erinnern
kann.
Die Medien sind besonders gefordert: Wieso sollen wir niemandem mehr
die Hand schütteln – eine Geste des Friedens, die wir seit römischen Zei-
ten pflegen? Wieso sollen wir im Alltag Masken tragen, die unsere Emoti-
on und damit die wechselseitige Einschätzbarkeit verbergen? Das waren
und sind drastische Maßnahmen, die schneller, umfassender und vor
allem zuverlässiger Erklärung sowie kritischer Beleuchtung bedürfen.
Die hohen Einschaltquoten beweisen den enormen Informationsbedarf
in dieser Zeit.1
Ein Format, das diese schnelle und umfassende Erklärung besonders
unterstützt, ist die Informationsgrafik. Wir leben in einem visuellen Zeit-
alter (Paul 2016) und die affektive Erfassbarkeit einer Grafik sowie deren
scheinbare Eindeutigkeit passen perfekt zum zunehmenden Bedürfnis
der schnellen Informationsverarbeitung (Waralak 2013). Infografiken
haben zudem eine hohe Wahrnehmungswirksamkeit, das heißt, Infor-
mationen werden nicht nur schneller, sondern auch besser verstanden
und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Sachverhalt der Grafik entspre-
chend von Rezipient*innen weitergegeben werden kann, ist hoch (Tunez
+ Nogueirra 2017). Absichtlich wird hier der Begriff „wahrheitsgemäß“
vermieden, denn gerade diese hohe Wahrnehmungswirksamkeit erfor-
dert große journalistische Expertise, um nicht zur Propaganda und da-
mit „bloß zu Lautsprechern“2 zu werden. Genau, dicht und anschaulich
sollen Informationsgrafiken sein (Jansen 1999).
1 https://zukunft.orf.at/show_content2.php?blog_mode=single&blog_
id=293&sid=176&s2id=338&blog_group=3 sowie https://zukunft.orf.at/show_
content2.php?s2id=333 und https://medien.srf.ch/documents/20142/2175971/
Halbjahresbilanz_2020.pdf/a994ff8f-11c6-5763-58cd-98392937ce69
2 https://zukunft .orf.at/show_content .php?sid=147&pvi_id=2 204&pvi_
medientyp=t&oti_tag=TEXTE%20Corona
20ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
Eine These: Nach der Präsentation dieser Grafik in der ZiB 2 am 10.3.2020
haben in Österreich mehr Menschen die Bedeutung der Schutzmaßnah-
men im Zusammenhang mit der Kapazität des Gesundheitssystems ver-
standen, als zuvor über Presseerklärungen, Moderationen oder durch
mit Genrebildern unterstützte Beiträge. Zwei Kurven und eine Linie, über
die keine der beiden Kurven darf. Das leuchtet auf einen Blick ein.
Abbildung 1 Screenshot Infografik ZiB 2 vom 10.3.2020; Zahlenbasis Nikolaus Popper TU Wien
Gespeist wird die Infografik, wie auch in diesem Fall, aus unterschied-
lichen Expertisen: Es gibt das Rohmaterial, die Daten, die aus öffent-
lich zugänglichen Quellen und Fachstudien stammen. Expert*innen,
die den Sachverhalt erläutern, Datenjournalist*innen, die sich mit der
Datenauswertung befassen, und schließlich geht es um die visuelle
Umsetzung. Das können Karten, Infografiken, Animationen oder Illus-
trationen sein. Hier plädiere ich für den verstärkten Einsatz der Berufs-
bezeichnung „visueller Journalist/visuelle Journalistin“ mit fach- und
kanalübergreifender Expertise in der Informationsdarstellung. Ob es
Informationsgrafiker*innen sind, die sich auch journalistisch fortbilden
oder ob es Journalist*innen sind, die sich mit visueller Aufbereitung von
Information auseinandersetzen, ist letztlich eine Frage der jeweiligen
Biografie und zweitrangig. Durch den Bedarf in der andauernden Covid-
Krise, komplexe Vorgänge einem breiten Publikum zu erklären, und
durch das mögliche Bevorstehen weiterer Wellen kann diese Form des
Journalismus an Bedeutung gewinnen.
21PUBLIC VALUE 2020
Digitale Informationswege werden wichtiger, und die Infografik erlaubt
neben der schnellen Erfassbarkeit von Zahlenreihen, deren Sinn sich
uns sonst weitgehend entzieht, auch die Vertiefung dieser Information.
Sie ist geradezu der Klassiker eines transmedialen Contents, der in pla-
kativer Form in Bewegtbild- und Textmedien Platz findet, in auditiven
Medien erklärt wird und mit Erweiterungs- und Ergänzungsmöglichkei-
ten, also dem Medium entsprechend interaktiv, online verfügbar bleiben
kann und soll (dem/der geneigten Leser*in sind die entsprechenden Res-
triktionen des Herausgebers dieser TEXTE-Reihe bewusst). Online ist In-
teraktion möglich, die nochmals zu einem tieferen Verständnis sowie zu
mehr Eindeutigkeit führt. Diese Vertiefung kann zeitliche Ergänzungen
bringen, oder, wie z.B. bei Wahlen üblich, regional heruntergebrochen
sein. In beiden Fällen steigt das Involvement mit dem Sender sowie mit
der zu vermittelnden Information.
Abbildung 2 Interaktive Infografik zur Corona-Situation in Österreich auf orf.at; zuletzt abgefragt
am 5.8.2020
In einem nächsten Schritt könnte die Zugänglichkeit zur Datenbasis für
die Erstellung solcher Infografiken diskutiert werden. In der Covid-Krise
hat sich gezeigt, dass die selben globale Konzerne, die zunehmend Infor-
mationsfunktionen für die Gesellschaft übernehmen wollen, wie Google3
oder facebook, aufgrund ihrer Algorithmen und wirtschaftlichen Basis
3 Vgl. z.B. Google Mobilitätstrends für Österreich https://www.gstatic.com/covid19/
mobility/2020-07-31_AT_Mobility_Report_de.pdf
22ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
über bessere Daten zur Virus-Verbreitung verfügen als staatliche Struk-
turen (Cinnamon 2020). Sie beziehen über geobasierte Services Daten in
Echtzeit, die möglicherweise in einigen Fällen schneller oder präziser
sind, als die Daten öffentlicher Institutionen und Forschungseinrichtun-
gen, die für Medien frei zugänglich sind.
Aktuell wertet Google „Covid Mobilitätstrends“ auf Länderebene aus,
die zurzeit nur durch spezifische Suche aufgefunden werden können.
Aber wer könnte das Unternehmen daran hindern, sich selbst Covid-
Ampelsysteme auszudenken, die über die vielen Ausspielwege des Kon-
zerns (YouTube, Maps,…) ganze Regionen samt Wirtschaft beeinflussen
könnten? Die visuelle Erklärung ist kein Monopol der Medien. Brands,
NGOs und Regierungen erkennen längst die Kraft dieser Darstellungs-
form4. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann aber anders als die zu-
vor genannten Entitäten durch Bündelung seiner Kompetenzen die volle
Power der Infografik auf allen Kanälen entfalten und sie im Sinn seiner
Aufgaben gerade auch zur Erklärung komplexer Sachverhalte, wie der
Ausbreitung von Viren und zur möglichen Wirksamkeit von Gegenmaß-
nahmen einsetzen. •
4 https://sproutsocial.com/adapt/visual-journalism-data-storytelling/
23PUBLIC VALUE 2020
WO DER PROFESSOR RUND UM
DIE UHR „HALLO!“ SAGT
ANDREAS CICHOWICZ
CHEFREDAKTEUR NDR FERNSEHEN
Im Corona-Sommer 2020 kam ein kurzer Clip im Netz gut an. Darin zu
hören: Der Virologe Professor Christian Drosten, von manchen verehrt,
von anderen zum Sündenbock gemacht. Eine Quintessenz aus 50 Dros-
ten-Interviews, allerdings reduziert auf die Begrüßungsworte. Wahlwei-
se „Hallo!“, „Guten Tag!“ oder „Hallo, guten Tag“. Das ganze 48 Mal in
Folge. Ein ironischer Seitenhieb auf den Rummel um den aktuell wohl
bekanntesten Mediziner Deutschlands und ein Lacher in einer ansons-
ten ernsten Zeit. „Professor Drosten sagt Hallo!“, so der Titel. Mehr als
30.000 Mal wurde das Nonsens-Hallo bisher bei Youtube angeklickt.
Das ist allerdings nichts gegen das Original. Fast 60 Millionen Abrufe
erzielte „Das Coronavirus Update“, ein werktäglicher Podcast des Nord-
deutschen Rundfunks mit einem einzigen Gesprächsgast: Prof. Christian
Drosten. Seit Ende Februar 2020 versorgt der Norddeutsche Rundfunk
das Publikum regelmäßig mit den aktuellen Einschätzungen des Exper-
ten. Nie zuvor erzielte ein deutscher Podcast eine solche Reichweite und
Beachtung. Dem verantwortlichen Team des NDR wurde inzwischen der
Grimme-Online-Award verliehen.
Der richtige Interviewpartner zur richtigen Zeit, dazu der richtige Ver-
breitungsweg in dieser Zeit: So übertraf der Zuspruch alle Erwartun-
gen. Prof. Drosten berät die Bunderegierung, beim NDR aber auch die
Hörer*innen. Sein Podcast stieg in der Pandemie auf zu einer der popu-
lärsten Informationsquellen und macht Wissenschaft quasi live erlebbar.
Gerade in Krisenzeiten haben wir für die Öffentlichkeit da zu sein. Ob als
Audio oder in der guten alten „Tagesschau“. Sie mag betagt sein, aber
sie ist vitaler denn je. In der Corona-Krise erreichte die Hauptausgabe
um 20 Uhr bis zu 18 Millionen Zuschauer*innen – nur auf dem linearen
Verbreitungsweg! Wegen Corona schuf die ARD auch eine neue Marke:
„ARD Extra: Die Corona-Lage“. Eine tägliche Sondersendung des NDR
und anderer ARD-Häuser im Ersten. Daraus wurde für viele ein Abend-
ritual: Erst die „Tagesschau“, dann die vertiefende Information im „ARD
Extra“. "Wir haben gemeinsam ein Programm gestemmt, wofür das Pu-
blikum uns extrem viel Zuspruch entgegenbringt", so fasst es der ARD-
Vorsitzende Tom Buhrow zusammen. Der Senderverbund wurde für die
„Extra“-Sendungen zur Corona-Lage mit dem Deutschen Fernsehpreis
ausgezeichnet.
24ME D IE N QUA L I TÄT IN ZE I T E N VO N CO RO N A
„Wenn’s drauf ankommt, hat’s die ARD noch drauf“ schrieb der Medien-
journalist Danilo Höpfner. Gerade die Verunsicherung der Gesellschaft in
der Corona-Krise habe gezeigt, wie aktuell die Idee des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks in Deutschland immer noch ist. „Das Publikum ver-
sammelt sich in der Not nicht im Netz, sondern bei seinem Leitmedium,
dem es vertraut.“ Das folgert der ehemalige Leiter der Landesmedien-
anstalt NRW, Norbert Schneider. Und er schränkt zugleich ein: „Wenn
und solange es sich ernsthaft um dieses Publikum kümmert.“ Ausruhen
dürfen wir uns also nicht auf diesem Zuspruch. Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk kann nur dann erfolgreich bleiben, wenn er dort ist, wo er die
Nutzer*innen erreicht. Im Fernsehen, im Hörfunk, auf Online-Seiten und
in den sozialen Netzwerken. Auch der Drosten-Podcast wird daher auf all
diesen Ausspielwegen verbreitet. Ein Hörfunk-Interview im Fernsehen?
Selbst das funktioniert, wenn es den Nerv der Zeit trifft. So erreichte der
Podcast auch in bebilderter Form ein Publikum.
Mit zunehmender Dauer der Krise melden sich aber auch Stimmen, die
die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien problematisieren. So auch
eine Studie zweier Medien- und Literaturwissenschaftler an der Univer-
sität Passau. In den aktuellen Formaten „ARD extra“ und „ZDF spezial“
erkannten sie eine „Verengung der Welt“. ARD und ZDF hätten in der Co-
rona-Krise eine „permanente Problematisierung“ betrieben, die geeignet
sei, „Panik in der Bevölkerung“ auszulösen. Im Spätsommer 2020 stelle
ich fest: „Panik in der Bevölkerung“ ist bisher nicht ausgebrochen. Im
Gegenteil: Ansätze von Hysterie, messbar etwa in Hamsterkäufen, haben
abgenommen. Dies hat nach meiner Einschätzung viel mit der Verbrei-
tung verlässlicher Information zu tun, die eben nicht immer nur alarmie-
ren, sondern auch Ängste relativieren kann. ARD und ZDF haben dem
hohen Informationsbedürfnis der Bürger*innen in einer historischen
Krise nach Kräften entsprochen. Andernfalls hätten sie ihren Auftrag
nicht erfüllt. Ich halte es für verkürzt, ein Qualitätsurteil über den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk allein auf der Basis zweier aktueller Forma-
te abzugeben. Einige Beobachter jedoch scheinen auf die kritische Be-
standsaufnahme geradezu gewartet zu haben. Sie erheben den Vorwurf
des „Staatsfunks“. Dabei lehnt es auch die Passauer Studie explizit ab,
ARD und ZDF in pauschaler Form eine „Staatshörigkeit“ zu unterstellen.
Sie hebt vielmehr auf die Folgen einer anhaltenden Krisenberichterstat-
tung ab, die den „starken Staat“ als Akteur zwangsläufig ins Zentrum rü-
cke. Ein Hinweis, über den es sich nachzudenken lohnt. Sachliche Kritik
gilt es immer ernst zu nehmen. Gerade deshalb muss die Berichterstat-
tung auf das Urteil anerkannter, unabhängiger Expert*innen aufbauen.
Auch deren Einschätzung kann und darf selbstverständlich hinterfragt
werden. Eine offene Diskussion über den richtigen Weg ist unerlässlich.
25Sie können auch lesen