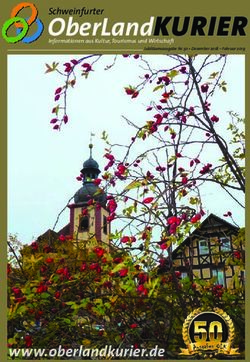Berufswettbewerbe 2019 Die ausgezeichneten Beiträge - Das Sportfoto des Jahres von Sebastian Wells: "Der Schrei" - Verband Deutscher ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Berufswettbewerbe 2019
Die ausgezeichneten Beiträge
Das Sportfoto des Jahres von Sebastian Wells: „Der Schrei“Vorwort
Liebe Mitglieder,
die Hauptversammlung des VDS musste bekanntlich wegen der Corona-Pandemie
abgesagt werden, somit entfielen auch die Ehrungen in den Berufswettbewerben.
Um Ihnen aber einen Überblick über die Besten des Jahres 2019 zu geben, haben wir alle
Gewinner und ihre ausgezeichneten Beiträge zusammengestellt. Die eigentliche Ehrung
ist verschoben. Sie soll wahrscheinlich im Oktober stattfinden, falls bis dahin die Welt
wieder normal ist.
So haben Sie nun die Gelegenheit, sich in Ruhe mit gutem Journalismus zu beschäftigen.
Viel Spaß wünscht Ihnen
Erich Laaser, VDS-Präsident
Inhalt
Großer VDS-Preis …………………………………………………………………………………………... 3
VDS-Nachwuchspreis …………………………………………………………………………………... 22
Herbert-Zimmermann-Preis – Bereich Hörfunk ………………………………………….. 34
VDS-Fernsehpreis ………………………………………………………………………………………… 36
Großer Online-Preis …………………………………………………………………………………….. 38
Die Sportfotos des Jahres …………………………………………………………………………….. 40
2Großer VDS-Preis
Förderer: reservix
1. Preis (2.000 Euro)
Peter Wenig (Hamburg): Der Kampf ums Traumschiff
erschienen am 27. Juli 2019 im Hamburger Abendblatt
Den Text lesen Sie ab Seite 4 in diesem pdf.
2. Preis (1.500 Euro)
Lars Spannagel (Berlin): Die Zeit ist reif
erschienen am 12. Oktober 2019 im Tagesspiegel
Den Text lesen Sie ab Seite 12 in diesem pdf.
3. Preis (1.000 Euro)
Johannes Knuth (München): Zeit und Liebe
erschienen am 20. März 2019 in der Süddeutschen Zeitung
Den Text lesen Sie ab Seite 17 in diesem pdf.
Die Jury:
Andreas Dach, Remscheider General-Anzeiger (Vorsitz)
Arno Boes, VDS-Präsidiumsmitglied, freier Journalist
Sebastian Conrad, reservix
Heike Meier-Henkel, Hochsprung-Olympiasiegerin
Thiemo Müller, kicker-sportmagazin
Dr. Robert Peters, Rheinische Post
Torsten Rumpf, Sport Bild
Thomas Weiß, Allgäuer Zeitung
Ihr Urteil:
Der Kampf um Gold dauert fünfeinhalb Minuten. Maximal. Bei den Olympischen
Spielen will sich der Deutschland-Achter belohnen. Für brutal anmutende
Trainingseinheiten, für den erbarmungslosen Kampf um den Platz im Paradeboot,
für Verzicht und für Rückschläge. Peter Wenig beleuchtet, welche Bedeutung der
Ruder-Achter für das Publikum und die Sportler hat. Aktuell und in der Historie.
Er berichtet über menschliche Schicksale und Dramen, nennt Gewinner und
Verlierer, hält die Lupe über das Innenleben der Mannschaft. Dabei ist die
Sprache klar, unmissverständlich und in den Bann ziehend. Fast hat man das
Gefühl, selbst mit über das Wasser zu gleiten. Genau fünfeinhalb Minuten lang.
3Platz 1 – Peter Wenig:
Kampf um das Traumschiff
Deutschlands Ruder-Achter schrieb große Sportgeschichte. Jetzt geht die Crew mit dem
Hamburger Torben Johannesen die „Mission Olympia-Gold 2020“ an. Brutal ist das
Trainingspensum, erbarmungslos das Ringen um einen Platz im Boot.
Peter Wenig (59) ist Autor beim Hamburger
Abendblatt (Foto: Andreas Laible)
Durch das weit geöffnete Rolltor lugt die Morgensonne, ein paar Schritte weiter stampft
ein Containerschiff den Dortmund-Ems-Kanal Richtung Norden hinauf. Doch die acht
Hünen in der Bootshalle schauen nur zu Boden, lauschen betreten den Worten ihres
Steuermannes. „Der Worte sind genug gewechselt“, spricht Martin Sauer, 55 Kilogramm,
170 Zentimeter, das Leichtgewicht im Kreis der Riesen. Wie am Vortag hat einer in der
Umkleide getrödelt – für Sauer ein Zeichen mangelnden Respekts: „Ich erwarte von
niemandem, dass er 24 Stunden am Tag an den Achter denkt. Aber in dem Moment, wo
er die Bootshalle betritt, erwarte ich das.“
An diesem Donnerstagmorgen im Mai trennen den Deutschland-Achter im Dortmunder
Ruderleistungszentrum noch 447 Tage vom Olympischen Finale in der Bucht von Tokio
am 31. Juli 2020. Doch die Stimmung wirkt so angespannt, als stünde der Kampf um die
Medaillen unmittelbar bevor. Wortlos tragen die acht Männer das grüne Boot, 17,5
Meter lang, 96 Kilogramm schwer, 69.000 Euro teuer, an den Steg, legen es ins Wasser
und schwingen sich auf ihre Rollsitze. Wer hier Platz nehmen darf, will diesen um fast
jeden Preis verteidigen. Siebenmal wurde der Achter als Deutschlands Mannschaft des
Jahres geehrt – einzig die Fußball-Nationalmannschaft gewann diesen Titel noch öfter.
Es ist der 3. September 1960, als auf dem Lago Albano bei Rom ein Mythos entsteht. Der
Olympiasieg der Männer vom Ratzeburger See gehört zur Nachkriegs-Sportgeschichte
wie der WM-Titel der „Helden von Bern“ 1954 oder der Gold-Ritt 1956 in Stockholm von
Hans Günter Winkler auf Halla, der Wunderstute.
Karl Adam, als Ruderprofessor geadelt, obwohl er selbst nie bei einem Wettkampf in
einem Boot saß, hatte den ersten Achter geformt, der bei Olympischen Spielen die
Phalanx des Seriensiegers USA brechen konnte. Kraftübungen zeigte er mit seinem
vernarbten linken Unterarm, Granatsplitter hatten ihn im Krieg verwundet. Der
4Studenten-Boxweltmeister und Hammerwerfer drillte „seine Burschen“, wie er sie
nannte, bis zur Erschöpfung. Acht Jahre später holte die Adam-Crew wieder Gold, auch
1988 (Seoul) und 2012 (London) siegte Deutschland.
Der Achter – Traumschiff und Galeere zugleich. Acht Ruderblätter, die absolut synchron
eintauchen. Eine Mannschaft, die die Riemen bis zur totalen Erschöpfung durch das
Wasser zieht – und doch mit der Präzision eines Metronoms.
Im Dortmunder Leistungszentrum hängt das Poster mit den Olympiasiegern von Seoul
direkt neben dem Bild der Goldmedaillen-Gewinner von London – die Helden von einst
sind allgegenwärtig. Maximilian Planer (28), ein bärtiger 1,95-Meter-Mann, 95
Kilogramm geballte Muskelkraft, deutet auf ein schwarzes Sofa in der Ecke des
Konferenzraums. „Dort habe ich gesessen, als der Trainer den Kader für den Achter
bekannt gab“, sagt Planer. Es war der Tag, den Bundestrainer Uwe Bender den
„härtesten Tag der gesamten Saison“ nennt. Der Tag, an dem er die Teams nominiert: für
die beiden Zweier, für den Vierer – und eben für den Achter. Es ist das Zwischenzeugnis
nach der Wintervorbereitung. Journalistik-Student Planer erfuhr an jenem April-Tag,
dass er seinen Platz im Boot abgeben muss.
Bender strich neben Planer auch noch Felix Wimberger (29), holte Laurits Follert (23)
und Christopher Reinhardt (22) ins Paradeboot. „Das war schon krass. Ich habe mich
gefragt, wo wir es verbockt haben“, sagt Planer. Für ihn ein bitteres Déjà-vu, bereits vor
den Spielen in Rio de Janeiro 2016 hatte er seinen Platz im Achter verloren. Doch Planer
will nicht nachkarten, die jüngeren Konkurrenten seien in der Vorbereitung stärker
gewesen, Benders Begründung („Wir haben jetzt mehr PS im Boot“) nachvollziehbar. Mit
Wimberger holte er im Vierer Anfang Juni Bronze bei der EM in Luzern. Und doch haben
beide nur ein Ziel: noch härter trainieren, um in Tokio wieder im Achter zu sitzen. Im
deutschen Traumschiff.
Bundestrainer Bender spricht von „schlaflosen Nächten“ vor der Nominierung. Keiner
kann die Qualen im Kampf ums Traumschiff besser einschätzen. Wie Schwimmen gilt
Rudern als Fleißsportart, zwischen 6500 bis 7000 Ruder-Kilometer spult jeder Athlet in
einer Saison ab, dazu die ständige Schinderei im Kraftraum. Dennoch entspricht Bender
so gar nicht dem Schleifer-Klischee. Der Karlsruher redet ruhig und bedächtig, holt für
den Reporter, der ihn im Trainer-Motorboot begleitet, stets ein wärmendes Sitzkissen.
„Ich gehe auf die Athleten ein, spreche mit ihnen über ihre Sorgen“, sagt Bender.
„Ich habe das Gefühl, dass es zwischenmenschlich
nicht mehr passte, dass ich nicht mehr erwünscht
war.“ Eric Johannesen über sein Aus
Bei Nominierungen habe er schon alles erlebt. Tränen, Wut, Resignation. Planer und
Wimberger hätten vergleichsweise gefasst reagiert: „Sie haben den Bus, der auf sie
zufuhr, kommen sehen.“ Dennoch hätte er den bequemeren Weg gehen können:
festhalten an der alten Crew, die zweimal Weltmeister wurde, nach Rio kein Finalrennen
mehr verlor und 2017 die Weltbestzeit aufstellte. Andererseits zeigt ein kurzer Blick
zum Fußball den schmalen Grat zwischen Treue und Verrat am Leistungsprinzip:
Joachim Löw vertraute bei der WM in Russland seinen 2014er-Weltmeistern – und
erlebte ein Debakel.
5Der Blick durch bodentiefe Fenster fällt auf den Dortmund-Ems-Kanal. In Reih und Glied
stehen Ergometer in der Sporthalle des Leistungszentrums, Maschinen, die mit Rollsitz
und Schwungrad das Rudern simulieren. Volker Grabow, in den 1980er-Jahren zweimal
Weltmeister im Vierer, hat viele Jahre selbst auf solchen Geräten Kondition gebolzt. Jetzt
prüft er als Trainingswissenschaftler, was die Ruderer leisten können, wie belastbar sie
sind. Wie Politiker nach Prognosen an Wahlabenden gieren die Sportler nach diesen
Werten, von ihnen hängt entscheidend ab, wer im Achter sitzt. Und wer nicht.
Keiner war in diesem Frühjahr auf dem Ergo stärker als Christopher Reinhardt. Der
Medizinstudent holt sich in der Kantine des Leistungszentrums noch einen Nachschlag
Nudeln mit Hähnchenbrustfilet. Bis zu 6500 Kalorien verbrennt ein Top-Ruderer an
einem Trainingstag. „Ich bin es gewohnt, über meinen Appetit zu essen“, sagt Reinhardt.
Im November 2017 stand seine Karriere auf der Kippe. Wachstumsfugen in den Knien
hatten sich verschoben, nach der Operation fiel er neun statt der prognostizierten drei
Monate aus. Umso erstaunlicher sein Comeback: Bestwert auf dem Ergo, dritter Rang bei
den Deutschen Kleinbootmeisterschaften im Zweier an der Seite von Schlagmann
Hannes Ocik – das ersehnte Ticket für den Achter. „Das Glücksgefühl über die
Nominierung war genial. Übertroffen werden kann das nur noch durch Medaillen bei
einer WM oder Olympischen Spielen“, sagt Reinhardt.
Wie hart dieser Weg wird, zeigt sich in diesen Wochen. Der Laie sieht nur von
Erschöpfung und Schmerz gezeichnete Athleten, die die Riemen bis zu 48-mal pro
Minute durch das Wasser peitschen. Experte Bender beobachtet dagegen aus seinem
Motorboot genau, wie das Boot fährt, wenn die Riemen über der Wasseroberfläche
schweben. Rund 800 Kilogramm Körpergewicht rollen im Freilauf gegen die
Fahrtrichtung des Bootes. Geschieht dies nicht nach jedem Schlag absolut synchron,
tauchen die Blätter ungleich ein. Im Orchester hört vielleicht ein Kritiker einen falschen
Ton, im Achter kann ein minimaler Wackler den Sieg kosten.
Sensoren messen die Kraftkurve jedes Einzelnen
Ein schnauzbärtiger Mann spürt genau diese Fehler auf. Stefan Weigelt, promovierter
Sportwissenschaftler und begnadeter Tüftler, rüstet das Boot bei Messfahrten mit
Sensoren aus. Auf seinem Laptop zeigt er die Kraftkurven der Ruderer. Im Idealfall, sagt
er, liegen sie deckungsgleich übereinander.
Die alte Crew, das kann man sagen, kam diesem Ideal sehr nah. „Physisch waren andere
stärker, technisch wir aber besser“, sagt der Hamburger Torben Johannesen (24/RC
Favorite Hammonia), seit Rio fester Bestandteil des Deutschland-Achters. Benders
Mission lautet nun, die durch die Umbesetzungen gewonnenen PS wirklich aufs Wasser
zu bringen. Verspielt der neue Achter seinen Vorsprung durch Technik, ist alles
verloren. „Das Boot läuft noch nicht wirklich gut“, sagt Bender. Reinhardt gab nach den
ersten Einheiten ehrlich zu: „Die Mannschaft zeigt einem die Defizite gnadenlos auf.“
Knapp fünf Wochen vor der WM Ende August im österreichischen Ottensheim gibt die
Frage nach der Gold-Reife für Tokio Rätsel auf: Den Siegen bei der EM in Luzern sowie
beim Weltcup im polnischen Posen folgte vor zwei Wochen eine klare Niederlage gegen
die Briten beim Weltcup in Rotterdam. Steuermann Martin Sauer war entsprechend
6bedient: „Wir haben eine richtige Klatsche bekommen. An den entscheidenden Stellen
war kein Saft da.“
Einer wie er kann nur Klartext reden. Sauer, wichtigster Mann Benders bei der
Operation Olympia-Gold, gibt den Kurs nicht nur auf dem Wasser vor. Wer mit den
Achter-Athleten über Sauer spricht, hört Bewunderung („Der Beste der Welt“), Respekt
(„Der ehrgeizigste Mensch auf diesem Planeten“) und leise Kritik: „Martin muss
aufpassen, dass er den Bogen nicht überspannt.“ Bender weiß das, jüngst forderte er von
seinem engsten Vertrauten mehr Nachsicht ein, zu viel Kritik verunsichere die
Mannschaft.
Als der „Tagesspiegel“ Sauer einmal bat, einen Ruderwitz zu erzählen, konterte der
Steuermann: „Sorry, ich kenne gar keinen. Wir erzählen uns im Achter keine.“
Nein, der Berliner taugt nicht zum Stimmungsmacher. Dafür weiß er mehr über
Personalführung als viele Autoren kluger Ratgeber. Schon als Elfjähriger steuerte Sauer
das erste Mannschaftsboot, sechs Jahre später führte er den deutschen Junioren-Achter
zum WM-Sieg. Seit 25 Jahren gibt der Berliner nun gegenüber Athleten, die ein, zwei
Köpfe größer sind, den Ton an. Das kann nicht gelingen, wenn man unkontrolliert
herumbrüllt. Auftritte wie an jenem Morgen im Bootshaus geschehen mit kaltem Kalkül.
Der Steuermann spürt, wenn Mangel an Disziplin den Kurs gefährden könnte. Er hasst
unprofessionelles Verhalten.
Die Niederlage gegen die Briten in Rio 2016 wurmt ihn noch heute. „Das war eine
Katastrophe mit Ansage.“ Der Verband hätte das Quartier viel näher an die
Regattastrecke legen müssen: „Die Briten schlenderten entspannt zum Training. Wir
saßen bis zu zweieinhalb Stunden im Bus.“
Ein Mitglied der Silber-Crew von 2016 nimmt an einem warmen Juli-Nachmittag auf der
Terrasse des Ruder-Clubs Favorite Hammonia Platz, ein paar Schritte entfernt legt
gerade ein Zweier an. Eric Johannesen, in London mit Sauer im Achter Olympiasieger,
hat das Restaurant seines Vereins an der Alster als Treffpunkt vorgeschlagen. Dabei
könnte es ihm niemand verdenken, wenn er momentan einen großen Bogen um jedes
Ruderboot machen würde.
Zehn Tage zuvor erlebte Johannesen in Posen den wohl bittersten Moment seiner
Karriere. In einem kurzen Gespräch informierte ihn das Trainerteam, dass er ab sofort
nicht mehr zum Kader gehöre. Zu schwach seien seine Leistungen auch bei diesem
Weltcup im Zweier gewesen.
Die Entscheidung hatte sich schon angedeutet. „Eric ist aktuell noch immer weit entfernt
von der Leistungsfähigkeit, die ihn in den Olympiazyklen vor London und Rio
ausgezeichnet hat. Seine Physis war damals ein wahnsinniges Pfund, jetzt liegt er unter
dem Durchschnitt des Teams“, sagte Cheftrainer Bender bereits im Juni.
Der Rudersport im Verein wird medial kaum beachtet
Das Aus für Johannesen zeigt den gnadenlosen Wettbewerb unter den Ruderern. Nach
einem selbst verordneten Pausenjahr, das er für den Abschluss seines
Wirtschaftsingenieur-Studiums nutzte, hatte sich Johannesen Anfang 2018 wieder in die
7Elite zurückgekämpft, wurde aber dennoch nur als Ersatzmann für EM und WM
nominiert. Für sein erneutes Comeback im A-Kader trainierte der 31-Jährige so hart,
dass er sich eine Sehnenscheidenentzündung im rechten Arm einhandelte: „Ich habe viel
für das Team geopfert. Ich habe meine Familie fünf Tage die Woche in Hamburg
zurückgelassen, mir eine Wohnung mit meinem Bruder in Dortmund genommen, alles
dem Ziel, wieder ins Team zu kommen, untergeordnet.“
Umso größer nun die Enttäuschung, dass sein Traum vom Sieg in Tokio in einem Boot
mit seinem jüngeren Bruder Torben so abrupt endet. „Ich muss die Entscheidung der
Trainer akzeptieren, auch wenn sie für mich schwer nachvollziehbar ist“, sagt Eric
Johannesen. Bei der Selektion, also bei den Kleinboot-Meisterschaften, sei er zumindest
im Mittelfeld gewesen, auf dem Ergo sogar besser als zwei andere Athleten aus dem
jetzigen Achter. Sein bitteres Fazit: „Es spricht vieles dafür, dass es keine rein sportliche
Entscheidung war. Ich habe das Gefühl, dass es zwischenmenschlich nicht mehr gepasst
hat, dass ich nicht mehr erwünscht war.“
Insgesamt, sagt er, hätte er sich vom Trainerteam mehr Unterstützung gewünscht: „Ich
bin mir bewusst, dass ich auf dem Ergometer noch nicht auf meinem alten
Leistungsstand bin. Leider wurde nicht individuell darauf eingegangen, dass ich
gegebenenfalls andere Reize gebraucht hätte. Letztes Jahr erst aus dem Team raus zu
sein, dann wieder drin, bis Dezember keinen festen Zweierpartner zu haben, die
Geringschätzung durch den Trainer zu spüren, das alles zehrt.“
Nun gehört Scheitern zum Leistungssport wie Pokale und Medaillen. Und doch ist die
Drucksituation im Rudern eine andere. Im Fußball kann Weltmeister Mats Hummels,
aussortiert aus dem Nationalteam, beim FC Bayern nicht mehr als Stammspieler gesetzt,
als Hoffnungsträger zum Rivalen Borussia Dortmund wechseln. Im Rudern wird der
Vereinssport medial kaum beachtet. Und bei einer Regatta gibt es keinen Joker, der
durch eine einzige Tat vom Ersatzspieler zum Helden werden kann. „Im Achter sind wir
ein Team, aber eben doch Konkurrenten, die um ihren Platz kämpfen müssen“, sagt
Johannesen.
Sein Comeback bereut er dennoch nicht: „Die Erfahrungen, die ich machen musste,
waren für mich immens wichtig.“ Denn Johannesen will nach der Karriere im Sport
bleiben: „Ich glaube nicht mehr, dass ich glücklich werde, wenn ich dauerhaft im Büro
arbeite. Ich mache meine Trainerscheine, würde gern im Leistungsbereich arbeiten.“
Torben Johannesen lebt ein Leben am Limit
Doch noch, sagt er zum Abschied, sei das nächste Comeback möglich. Niemand könne
wissen, wohin der Achter nach Tokio sportlich steuert. Deshalb wird er auch
weitertrainieren, statt auf dem Dortmund-Ems-Kanal eben auf der Alster im Verein.
Seine Freundin würde jede Entscheidung respektieren – schließlich war sie selbst eine
exzellente Ruderin.
Für seinen Bruder ist die Entscheidung in doppelter Hinsicht bitter. Torben Johannesen
verliert seinen engsten Vertrauten im Boot, Erics Erfolge animierten ihn zum Rudern.
Bei dessen Olympiasieg 2012 baten ihn die Eltern, alle Zeitungen mit Fotos von Eric auf
der Titelseite zu kaufen. Vom Kiosk kehrte er mit einem großen Stapel zurück: „Jedes
Blatt hatte den Achter-Triumph auf der ersten Seite.“
8Zudem büßt er seinen WG-Partner ein. Die Brüder hatten sich gemeinsam eine
Wohnung im Dortmunder Kreuzviertel gesucht, um Miete zu sparen.
Dabei führt er ohnehin ein Leben am Limit. Aus der aktuellen Achter-Crew pendelt nur
er: zwei Tage Hamburg, fünf Tage Dortmund. Der Wechsel an eine Uni im Ruhrgebiet
würde ihn zwei Semester kosten, zudem wohnt seine Freundin an der Elbe. Die Trainer
sehen die Fahrerei nicht gern, aber tolerieren sie, weil sie Torbens unbändigen Ehrgeiz
kennen. Als ihn das Abendblatt in Hamburg an einem Montagmorgen um 8.30 Uhr zum
Frühstück in Uni-Nähe trifft, hat er sich bereits 90 Minuten auf dem Ergometer gequält.
Und nach dem Termin geht es direkt zum Seminar. Am späten Abend wieder nach
Dortmund. Nun muss er überlegen, ob er die Wohnung nach dem bevorstehenden
Auszug seines Bruders ganz aufgeben soll. Oder sich einen anderen Ruderkameraden
sucht.
Nur ein paar Straßen entfernt von der Johannesen-WG trocknen Trainingsklamotten
über Wäscheständern, im Wohnzimmer steht ein mächtiger Billardtisch. Schlagmann
Hannes Ocik, Achter-Neuling Follert und Marc Leske aus dem Riemen-Zweier wohnen
ebenfalls im Kreuzviertel zusammen, zehn Autominuten vom Leistungszentrum
entfernt. Der Zufall will es, dass alle auf der Backbord-Seite rudern. „Eigentlich müsste
ich euch beiden was ins Essen tun, um in den Achter zu kommen“, ruft Leske unter dem
Gelächter seiner WG-Mitbewohner, als er Obst für den Salat schnippelt.
Ocik, ausgebildeter Polizist, hat deutlich mehr Humor als sein Steuermann, dem er als
Schlagmann gegenübersitzt. Doch beim Ehrgeiz sind sie Seelenverwandte. Ociks
Karriere schien schon vorbei, bevor sie begann – als B-Junior infizierte er sich mit
Pfeifferschem Drüsenfieber: „Die Ärzte wussten nicht, ob es noch was wird mit
Leistungssport.“ Zwei Jahre später – Ocik hatte sich wieder an die Spitze gekämpft – der
nächste Rückschlag: Bei der Qualifikation zur Junioren-WM steuerte er im Zweier gegen
eine Boje und kenterte – die Höchststrafe im Wettkampf. 2014 dann das „Seuchenjahr“,
wie Ocik es nennt. Der Schweriner verschleppte einen Virus, lag wochenlang flach: „Ich
fühlte mich wie ausgewrungen.“ Doch Ocik kam erneut stärker zurück, mit ihm als
Schlagmann holte Deutschland 2016 in Rio Silber.
„Das waren vier Jahre Arbeit für eine Silbermedaille.
Da fragt man schon: Warum?“ Hannes Ocik, Schlagmann,
zu Rio 2016
Allerdings zeigen gerade die Minuten nach dem Finale in Brasilien den fast
unmenschlichen Druck im Achter: Statt sich über den so knapp erkämpften zweiten
Platz zu freuen, steigen die Ruderer tief enttäuscht aus ihrem Boot. „Das waren vier
Jahre Arbeit für eine Silbermedaille. Da fragt man schon: Warum?“, klagt Ocik in ersten
Interviews.
Ein Mythos, der bei Olympischen Spielen entstand, kann nur bei Olympischen Spielen
fortgeschrieben werden. Nur dann richten sich alle Scheinwerfer auf die Ruderer – zur
EM in Luzern im Juni schickten nicht einmal die Nachrichtenagenturen Reporter.
Richard Schmidt (32), nunmehr im zehnten Jahr in Folge im Deutschland-Achter,
inzwischen Athleten-Sprecher, stellt sich die Frage nach dem Warum derzeit besonders
oft. Sein Gang in die Bootshalle führt vorbei an einem gelben Renn-Einer mit dem
9Schriftzug „Max Reinelt“. In diesem Boot wollte Reinelt, mit Schmidt Olympiasieger von
London 2012, nach dem Karriereende und Medizinstudium noch zum Spaß auf der
Donau rudern. Doch der Arzt starb im Februar mit nur 30 Jahren auf der Langlaufloipe
in St. Moritz an plötzlichem Herzversagen, das gesamte Team kam zur Trauerfeier nach
Ulm. „Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, in seinem Boot zu rudern“, sagt
Schmidt.
Ein paar Tage vor seinem Tod hatte Reinelt seinem Freund noch eine Handy-Nachricht
geschickt. Schmidt schrieb kurz zurück, er rufe bald an, gerade so viel zu tun. Zu dem
Telefonat kam es nicht mehr. Als vor Jahren ein Vertrauter aus seinem Trierer
Ruderverein starb, wäre Schmidt gern zur Beerdigung gefahren – es ging nicht, wieder
war das Training gerade wichtiger. „Ich weiß gar nicht, wie viele Hochzeiten und
Geburtstage ich durch den Leistungssport verpasst habe“, sagt Schmidt.
Nach einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln trainieren Ruderer im Schnitt
35,8 Stunden die Woche, dazu kommen 24,2 Stunden für Arbeit, Ausbildung oder
Studium. Schmidt, der gerade seine Doktorarbeit über erneuerbaren Strom und
Wasserstoff schreibt, hält eine 70-Stunden-Woche für realistischer. Dank der Förderung
durch Sporthilfe, Bundeswehr – der Wirtschaftsingenieur ist Sportsoldat – und
Sponsoren komme er finanziell über die Runden: „Ruderer, die am Anfang ihrer Karriere
stehen, haben es viel schwieriger.“
„Mein größter Sponsor sind meine Eltern“, bestätigt Christopher Reinhardt. Fast
entschuldigend fügt er hinzu, dass er für Olympia im Medizinstudium eine Pause
einlegen werde, die er aber für die Promotion nutzen möchte. Und natürlich will er
weiter jeden Freitag Fagott spielen mit seinem Orchester in Marl. Es ist der Moment, wo
man sich fragt, welche Eruptionen eine Schlagzeile wie diese auslösen würde: „Marco
Reus: Für die EM unterbreche ich mein Studium – aber meine Doktorarbeit schreibe
ich“.
Leistungsdiagnostiker Grabow sieht die Belastung mit Sorge, besonders im
Trainingslager, wenn die Ruderer zwischen kräftezehrenden Einheiten Klausuren unter
Aufsicht schreiben. „Der Schlaf kommt zu kurz“, warnt Grabow.
Ausgerechnet bei Olympia darf der Sponsor nicht werben
Wenn Torben Johannesen über seine 70-Stunden-Woche spricht, hört er mitunter,
niemand dürfe erwarten, dass die Gesellschaft sein Hobby finanziere: „Aber auf der
anderen Seite wird Gold von uns verlangt, das passt nicht zusammen.“ Sein Bruder Eric
klapperte nach dem Olympiasieg 2012 Hamburger Autohäuser ab, um ein gesponsertes
Auto für die Fahrten nach Dortmund zu bekommen – vergebens. Der Achter funktioniert
allein als Marke, die Männer im Boot erkennen nur Insider. Kein Ruderer kann sich
guten Gewissens allein auf seine sportliche Karriere konzentrieren.
Dass der Achter überhaupt unter so professionellen Bedingungen trainieren kann, hat
das Team einem inzwischen 88 Jahre alten Ingenieur zu verdanken: Jochen Opländer
initiierte als Chef des Dortmunder Pumpenherstellers Wilo (7800 Mitarbeiter, knapp 1,5
Milliarden Umsatz) die Partnerschaft mit dem Deutschland-Achter. Opländer sagt, er sei
nie in seinem Leben in einem Fußballstadion gewesen: „Rudern ist mein Lebenselixier.“
10Beim Olympiasieg in London standen die Wilo-Bänder still, die Belegschaft verfolgte das
Rennen auf Großbildschirmen. Doch wenn der Achter am 31. Juli 2020 in Tokio um Gold
kämpft, wird der Wilo-Schriftzug überklebt – ausgerechnet an dem Tag, wo sich der
mediale Fokus weltweit auf den Achter richtet, sperrt das IOC-Reglement die nationalen
Sponsoren aus.
Sauer wird an jenem Freitag, dem Schlusstag der Olympischen Ruder-Wettkämpfe, auf
eine Motivationsansprache verzichten, der Worte sind dann wirklich genug gewechselt:
„Bis dahin werden wir uns ungefähr hundertmal angeschrien haben.“ Der Steuermann
wird die Konkurrenz genau beobachten, Schlagzahlen vorgeben, ruhig bleiben, auch
wenn der Achter zurückliegen sollte: „Panisches Geschreie sorgt nur für Hektik und stört
den Rhythmus.“
Auf etwa 22 km/h wird das grüne Boot durch die Bucht von Tokio beschleunigen,
angetrieben von acht Ruderern, die am Ende in den berüchtigten Tunnel geraten, wenn
ihnen schwarz wird vor Augen, weil jeder Muskel brennt. „Du hast einen Geschmack von
Blut im Mund“, hat Eric Johannesen einmal gesagt. Er musste sich nach dem Sieg 2012 in
London übergeben, das Überschreiten der „Kotzgrenze“ habe sich gut angefühlt: „Dann
weißt du, dass du alles gegeben hast.“
Sollte der Achter 60 Jahre nach Rom wieder Gold holen, weiß Sauer, was ihm blüht. Sie
werden sich den Kleinsten aus ihrer Crew schnappen und ihn ins Wasser werfen. Der
Steuermann kann mit dem Ritual nichts anfangen: „Meistens ist es saukalt im Wasser.“
Er wird auch das verschmerzen.
11Platz 2 – Lars Spannagel:
Die Zeit ist reif
Frischer Asphalt, 41 Tempomacher, keine Gegner. Eliud Kipchoge soll das Unmögliche
gelingen: ein Marathon unter zwei Stunden. Das Projekt „1:59“ in Wien kostet Millionen –
aber was hat das noch mit Sport zu tun?
Lars Spannagel (41) ist Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin.
Die vier Männer laufen in schweigender Konzentration, nur ihre neongrünen
Turnschuhe rascheln durch das Laub der Kastanienbäume. Eliud Kipchoge läuft
vorneweg, er atmet gleichmäßig, sein Schritt wirkt leichtfüßig und gleichzeitig kraftvoll,
die dünnen Beine tragen ihn scheinbar mühelos voran. Die Sonne über Wien ist an
diesem Mittwochmorgen gerade erst aufgegangen, der Prater-Park liegt im Halbdunkel,
noch geht es um nichts, ein lockeres Morgentraining. Drei Tage noch, dann soll es um
alles gehen.
Die vier Läufer passieren Absperrgitter, Lastwagen, Baumaschinen. Auf dem Asphalt der
Prater-Hauptallee ist mit oranger Farbe eine Ideallinie aufgemalt, am Rand der Straße
sind in Grün kryptische Markierungen auf den Boden gesprüht, Zahlen und Buchstaben.
Weiter vorne, wo Kipchoge an diesem Samstag ins Ziel laufen soll, ist ein Teil der Straße
abgesperrt. In der Nacht haben Bauarbeiter die oberste Schicht des Asphalts weggefräst,
die Oberflächenstruktur war ein wenig zu rau. In der nächsten Nacht wird neu
asphaltiert, dann wird, dann muss alles perfekt sein.
Denn es ist Perfektion, um die es hier geht. Die Hauptallee wird zur Rennstrecke
umgebaut, alles muss optimal vorbereitet sein, damit Eliud Kipchoge – 34 Jahre alt,
Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekordhalter, größter Marathonläufer aller Zeiten – am
Samstag Geschichte schreiben kann. Als erster Mensch will der Kenianer einen
Marathon unter zwei Stunden absolvieren, eine der letzten als unüberwindbar
geltenden Schallmauern des Sports durchbrechen. Kipchoge erklärt immer wieder, der
erste Mensch unter zwei Stunden, das sei so etwas „wie der erste Mensch auf dem
Mond“.
Für dieses Ziel und das Projekt „1:59“ geben der britische Chemiekonzern Ineos und
dessen Chef Jim Ratcliffe, reichster Mann Großbritanniens, eine zweistellige
Millionensumme aus. Ratcliffe leistet sich auch das Radteam, für das der Kolumbianer
Egan Bernal in diesem Jahr die Tour de France gewonnen hat. Für Kipchoges
Rekordversuch bezahlt das Unternehmen ein Team aus Wissenschaftlern, Trainern und
Meteorologen, das seit Monaten auf diesen Tag hinarbeitet. 41 Tempomacher,
12Spitzenläufer aus aller Welt, sollen Kipchoge zum Rekord führen, viele von ihnen sind
direkt von der Leichtathletik-WM in Katar nach Wien gereist. Für die Menschen, die bei
dem Projekt mitarbeiten, stellt der Rekordversuch einen Triumph des Fortschritts dar,
die Essenz des Sports, die ultimative Zuspitzung des olympischen Mottos „höher,
schneller, weiter“. Puristen des Laufsports halten das Ganze für eine Perversion, eine
reine PR-Kampagne.
Laufen.
Tee und Maisbrei.
Laufen.
Um 21 Uhr Licht aus
Während Kipchoge und seine Gefährten im Prater ihren Morgenlauf beenden, haben sich
im Zielbereich Fotografen und Kameraleute versammelt. Das Projekt wird in jeder
Einzelheit dokumentiert: Kipchoges Training in Kaptagat im Westen Kenias, die Anreise,
die letzten Vorbereitungen in Wien. Das Rennen am Samstagmorgen wird in 200
Ländern im Fernsehen und im Internet live übertragen.
Eliud Kipchoge wird langsamer, bleibt stehen, dehnt seine Beine und Hüften. Die
Kameras klicken, ein britischer Fotograf fragt, wo hier eine gute Position für einen „hero
shot“ sei.
In der Welt des Laufsports ist Kipchoge spätestens seit dem 16. September 2018 ein
Held, damals stellt er beim Berlin-Marathon in 2:01:39 Stunden einen neuen Weltrekord
auf, mehr als eine Minute schneller als die alte Bestzeit. Olympiasieger ist er bereits zwei
Jahre zuvor in Rio de Janeiro geworden, Weltmeister über 5000 Meter schon 2003.
Kipchoge wirkt mit seinen 1,67 Metern und 57 Kilogramm fast zerbrechlich, auf den
wichtigsten Marathonstrecken der Welt, in Berlin, London oder Chicago, hat er sich aber
als unzerstörbar erwiesen.
Kipchoge ist ein leiser Held, die meiste Zeit des Jahres trainiert der Vater von drei
Kindern in Kenia. Getrennt von seiner Familie lebt er mit anderen Läufern unter
spartanischen Bedingungen, liest Fachliteratur über Psychologie und Motivation,
spirituelle Romane von Paulo Coelho. Ein Morgenlauf, Tee und Maisbrei, ein langer
Mittagsschlaf, ein Nachmittagslauf, Licht aus um 21 Uhr. Selbst seinem Trainer ist
manchmal fast unheimlich, wie diszipliniert, pünktlich und zuverlässig Kipchoge ist.
Die offiziellen Fotos sind gemacht, Kipchoge soll jetzt schnell zurück ins Hotel, bloß nicht
auskühlen. Ein zufällig vorbeigekommener Hobbyläufer will vorher aber noch unbedingt
ein Selfie mit dem Kenianer, Kipchoge nickt und lächelt, um seine Augen bilden sich
Lachfalten. Dann macht sich die Laufgruppe im lockeren Trab auf den Rückweg.
Fans auf der ganzen Welt eifern Kipchoge nach, analysieren seinen Laufstil. Sie kennen
die Namen aus dem All-Star-Team, das für Kipchoge das Tempo machen und
Windschatten spenden soll: die drei Ingebrigtsen-Brüder aus Norwegen! Der fünffache
Weltmeister Bernhard Lagat aus Kenia! Der 19- jährige Äthiopier Selemon Barega, der
gerade erst WM-Silber gewonnen hat! Und sie kennen die Rahmendaten dessen, was
Kipchoge in Wien vorhat. Um unter zwei Stunden zu bleiben, muss er eine konstante
Geschwindigkeit von 21,1 km/h halten, das entspricht 2:50,6 Minuten pro Kilometer, 42
Mal hintereinander. 185 Schritte pro Minute, eine Schrittlänge von 1,90 Meter, 22.000
Schritte bis zur Ewigkeit.
13Die Zahlen sind wahnwitzig, außerhalb der Reichweite nahezu jedes anderen Athleten.
Und trotzdem kann sich fast jeder Hobbyläufer mit Kipchoge identifizieren. Der britische
Autor Ed Caesar, der der Jagd nach dem Marathonrekord mit seinem Buch „Two hours“
ein Denkmal gesetzt hat, nennt die Marathondistanz „demokratisch“. Jeder Läufer trete
auf den 42,195 Kilometern gegen seine eigenen Grenzen an, jeder müsse Schmerz
aushalten, verborgene Reserven aktivieren. „Egal, wie groß das Talent ist, wie gut die
Vorbereitung“, schreibt Caesar. „Niemand läuft einen einfachen Marathon.“
Robby Ketchell ist der Mann, der es Eliud Kipchoge so einfach wie möglich machen soll.
Der 37 Jahre alte US-Amerikaner sitzt müde und angespannt in der Lobby des
Teamhotels, die Farbspritzer auf seiner Jeans, orange und grün, wollen nicht zum edlen
Ambiente passen. Ketchell ist gelernter Mathematiker und Sportwissenschaftler, zehn
Jahre lang hat er Profiradteams beraten. In Wien hat er anhand der Wettervorhersage -
niederschlagsfrei, Windgeschwindigkeit weniger als zwei Meter pro Sekunde, 5 bis 9
Grad Celsius – die perfekte Startzeit um 8.15 Uhr ausgewählt. Außerdem hat er die
Aerodynamik der Tempomacher und die Gestaltung des Kurses optimiert. „Ich bin sehr
optimistisch. Aber wir müssen perfekt sein. Eliud muss perfekt sein“, sagt Ketchell. „Es
wird auf jede Sekunde ankommen, jedes Detail.“
Ketchell hat bereits beim ersten groß angelegten Versuch mitgearbeitet, die Zwei-
Stunden-Marke zu unterbieten. Der Sportartikelhersteller Nike schickte 2017 Kipchoge
und zwei andere Läufer unter dem Namen „Breaking2“ auf die Formel-1-Rennstrecke in
Monza nahe Mailand, trotz ähnlich intensiver Vorbereitung und einer Investition von
angeblich 30 Millionen US-Dollar verpasste Kipchoge die Fabelzeit um 25 Sekunden. Die
perfekte Werbung für die neueste Laufschuh-Generation – vermeintliche
Leistungssteigerung: 4 Prozent, Preis pro Paar: 250 Euro – blieb aus.
Ketchell hat seine Lehren aus dem Scheitern von Monza gezogen. Mit Tests im
Windkanal und in Computersimulationen hat er eine neue Formation für die
Tempomacher erdacht: Jeweils sieben von ihnen werden Eliud je fünf Kilometer
begleiten, fünf Männer in einem V vor ihm, zwei leicht versetzt hinter ihm. Damit
niemand von der Idealposition abweicht, gibt das Führungsfahrzeug nicht nur die
Geschwindigkeit vor, sondern projiziert auch mit einem grünen Laser ein Raster auf den
Asphalt.
Mit dem, was Ketchell und seine Kollegen erdacht haben, verstoßen sie gegen eine Reihe
von Regeln des Leichtathletik-Weltverbands IAAF. Für einen offiziellen Weltrekord
schreibt die IAAF einen Rundkurs vor, ein größeres Läuferfeld und feste
Verpflegungsstationen. Wechselnde Tempomacher sind verboten.
Eliud Kipchoge sagt, den offiziellen Weltrekord halte er ohnehin schon, darum gehe es
auch gar nicht. „Ich will Geschichte schreiben, der Nachwelt etwas hinterlassen, andere
Menschen inspirieren.“ Als Analogie führt das Ineos-Team gerne die Erstbesteigung des
Mount Everest an: Würde Sir Edmund Hillary heute etwa vorgeworfen, dass er 1953 auf
dem Weg zum Gipfel die Unterstützung von Sherpas und Sauerstoffflaschen hatte?
Dass die Wahl der Organisatoren auf Wien gefallen ist, hat viel mit der Hauptallee im
Prater zu tun. Schnurgerade und flach führt sie durch den Park, der Höhenunterschied
von einem Ende zum anderen beträgt nur 1,6 Meter, die großen Kastanien schützen vor
Wind, für das Rennen müssen nur wenige Straßen gesperrt werden. In London hatte
14Ineos keinen optimalen Kurs gefunden, auch Berlin war im Gespräch, doch weder das
Tempelhofer Feld noch die Straße des 17. Juni genügten den Ansprüchen. Am Ende war
es Berlins Marathon-Chef Mark Milde, der Wien vorschlug.
Am südöstlichen Wendepunkt der Strecke, im engen Kreisverkehr um das historische
Lusthaus, haben Bauarbeiter in der vergangenen Woche eine Art Steilkurve errichtet.
Der Neigungswinkel beträgt etwa ein Prozent und ist mit bloßem Auge kaum zu
erkennen. Robby Ketchell hat fünf Monate lang verschiedene Modelle durchgerechnet,
immer wieder. Jetzt ist er überzeugt, dass die Steilkurve Kipchoge zwölf Sekunden
bringen wird.
Fünf Wetterstationen, die seit dem Sommer im Prater Wind, Luftfeuchtigkeit und
Temperaturen aufzeichnen. Ein elektronisches Führungsfahrzeug mit Spezialtempomat.
Ein Chip in Kipchoges Schuh, der jedes Training der vergangenen drei Jahre
aufgezeichnet hat. 1,2 Kilometer neuer Asphalt auf der Hauptallee. Eigens entwickelte
magenschonende Energiegetränke. Perfekte Witterung, kein Gegner außer der Zeit.
Was kann da noch schiefgehen? „Man darf nicht vergessen, dass in dem Projekt überall
das menschliche Element steckt“, sagt Ketchell und wirkt nicht mehr ganz so
optimistisch. „Wir müssen auf alles vorbereitet sein.“
Fünf Monate
Arbeit für die
Steilkurve,
zwölf
Sekunden
Zeitgewinn
Schon ein Schnupfen könnte das Unterfangen gefährden, die Millionen wären verpulvert.
Kipchoge hat wohl nur noch diese Chance. Welcher Sponsor wird wieder so viel Geld
aufbringen? Nächstes Jahr will Kipchoge erneut Olympiagold holen, kurz darauf wird er
36 Jahre alt. Auch Wunderläufer kommen irgendwann in ein Alter, in dem sie langsamer
werden.
In der Hotellobby riecht es nach Krankenhaus, am Empfang steht eine große Flasche
Desinfektionsgel bereit. Um das Übertragungsrisiko von Infektionen zu minimieren,
schütteln sich die Ineos-Mitarbeiter nicht die Hände. Auch die Tempomacher, die jetzt
ihre Ausrüstung einsammeln – schwarze „Ineos“- Leibchen, knallrosa Laufschuhe –,
begrüßen sich, indem sie kurz die Fäuste gegeneinander stoßen. Schilder an einer
Pinnwand weisen darauf hin, wie wichtig es ist, sich regelmäßig die Hände zu waschen
und den Toilettendeckel vor dem Spülen zu schließen.
Daneben hängt die Liste mit den Terminen für die Dopingproben: Am Donnerstag und
am Samstag werden Kipchoge und alle Tempomacher getestet. Alle Zweifel werden auch
diese Tests nicht ausräumen können – wer in der Leichtathletik Außergewöhnliches
leistet, steht automatisch unter Verdacht. Für Kipchoge spricht, dass er seine Leistungen
kontinuierlich gesteigert hat, auf unterschiedlich langen Strecken erfolgreich war und
seit Jahren auf konstant hohem Niveau läuft.
Blutprofile von Kipchoge gibt es seit 2001, auch Jos Hermens begleitet den Kenianer
schon so lange. Der 69 Jahre alte Niederländer hat schon viele afrikanische Läufer als
15Manager betreut, einige hat er reich und berühmt gemacht. Als junger Läufer stellte
Hermens selbst einen Weltrekord auf, für die weiteste in einer Stunde zurückgelegte
Strecke. „20.944 Meter, am 1. Mai 1976“, sagt er und grinst stolz. Vom Zwei-Stunden-
Marathon träumt er schon lange.
Robby Ketchell hetzt durch die Lobby, Hermens springt auf, Faust gegen Faust, Ketchell
hetzt weiter. „Das ist ein Verrückter“, sagt Hermens anerkennend. „Wir brauchen
Verrückte.“
Hermens kennt die Kritik der Traditionalisten. Er ist selber irgendwie Traditionalist,
schwärmt davon, wie der Äthiopier Abebe Bikila 1960 barfuß zu Olympiagold im
Marathon lief, die Tempomacher nennt er „Hasen“. Die Kritik an dem 1:59-Projekt sei
okay, sagt Hermens. „Aber wer bestimmt denn, was Sport ist?“
Die Leichtathletik sei eine altmodische Sportart, das habe man doch gerade erst wieder
bei der WM in Doha gesehen, wo „alte Männer mit weißen und roten Fahnen“ über die
Gültigkeit von Weitsprungversuchen entschieden hätten. „Ich bin selber ein alter Mann“,
sagt Hermens und wuschelt sich demonstrativ durch die weißen Haare. „Aber das
bedeutet doch nicht, dass ich nichts Neues mehr ausprobieren will.“ Bereits der Versuch,
1:59 zu laufen, eröffne doch für Läufer auf der ganzen Welt einen ganz neuen Horizont.
An diesen Effekt glaubt auch Eliud Kipchoge. 22.000 kleine Schritte für ihn, ein
Riesensprung für die Menschheit.
16Platz 3 – Johannes Knuth:
Zeit und Liebe
Felix Neureuther war Deutschlands bester Skirennfahrer – er war aber auch immer mehr.
Ist dieser Typ Sportler in Zukunft noch vorstellbar?
Johannes Knuth (33) ist Sportredakteur bei der Süddeutschen
Zeitung in München.
Ein alpines Skirennen, hat der ehemalige Skirennfahrer Aksel Lund Svindal einmal
erzählt, sei etwas sehr Spezielles. Die Fahrer stürzen sich einen Hang hinunter, die Natur
rauscht an ihnen vorbei, oft hören sie nur, wie ihre messerscharfen Kanten übers Eis
rattern. Oder den dumpfen Knall, wenn sie im Fangnetz landen. Sie sind immer bei sich,
es hat etwas Friedliches und Quälendes zugleich: „Du kennst ja keine Zwischenzeiten, du
hast null Feedback von den Trainern“, sagt Svindal, „du siehst deine Zeit erst im Ziel.“
Und während jeder Fahrer im Ziel erst mal die Anzeigetafel sucht, wissen die Zuschauer
im Stadion und vor dem Fernseher längst, wie es ausgegangen ist. „Alle starren dich an“,
sagt Svindal, „und warten auf deine Reaktion.“
Die Bedeutung dieses Moments begriff Svindal früh: Skirennen sind immer auch ein
Labor für menschliche Dynamiken, und der Zielraum ist der Ort, in dem sich die
Emotionen verdichten. Eine grün unterlegte Zeit auf der Anzeigetafel: Bestzeit. Eine rote
Zeit: Rückstand. Wie ein Faustschlag ins Gesicht, jedes verdammte Mal. Meist leuchtet es
rot, weil es so viele gute Fahrer gibt. „Da musst du mental ganz schön stark sein“, sagt
Svindal, „weil sich deine Reaktion ja auch auf deine Konkurrenten bezieht, mit denen du
monatelang durch den Weltcup reist.“ Jede Ankunft nach einer alpinen Winterreise ist
auch eine Lebensschule. Demut, Respekt, Gelassenheit. Und Dankbarkeit, wenn das Licht
endlich grün aufflackert.
Auf Entdeckungsreise war er immer,
nicht selten endete sie für ihn im Krankenhaus
Als Felix Neureuther am Wochenende seinen letzten Slalom fuhr, da bespielte er diese
Bühne so, wie er sie immer bespielt hatte: emotional, aber nie aufreizend. Er breitete die
Arme aus, als wolle er alle umarmen, die zum Saisonfinale nach Andorra gekommen
waren. So hatte er früher oft auch seine Siege zelebriert. Und bei rotem Licht: winkte er
17immer noch mal ins Publikum, als wolle er allen fürs Kommen danken. Als Neureuther
mal im österreichischen Fernsehen interviewt werden sollte, gleich nach dem Rennen,
und der Moderator nicht auftauchte, stellte er sich die Fragen nach seiner Form und
seinen österreichischen Rivalen einfach selbst. Und als er vor neun Jahren seinen ersten
Weltcup gewann, den Slalom im Ski-Kolosseum von Kitzbühel, da plumpste er in den
Schnee, der Vater umarmte ihn, der 31 Jahre zuvor an selber Stelle gewonnen hatte.
Mutter Rosi trafen sie später vor dem Stadion, und als Rosi Mittermaier, die Doppel-
Olympiasiegerin von Innsbruck 1976, sah, wie Neureuther in Turnschuhen durch den
Schnee stapfte, da schrie sie, der Bua solle sich doch erst mal g’scheite Schuh’ anziehen
in der Herrgottskälte!
Man musste an das Leitmotiv aller Lebenskünstler denken, wenn man die Neureuthers
erlebte: Vergiss ruhig auch mal den Ernst der Lage.
Die Schiebetür am Münchner Flughafen surrt auf, Felix Neureuther tritt heraus, grauer
Pullover, dunkelgrüne Hose, Rucksack und Rollkoffer, den er hinter sich herzieht. Es ist
der erste Tag, an dem der 34-Jährige ein Skirennfahrer in der Vergangenheitsform ist, 13
Weltcup-Siege, einmal WM-Silber, zweimal Bronze, aber auch ein Körper, der längst
älter ist als dessen Inhaber. Neureuther geht immer ein wenig langsamer, im Hohlkreuz;
er war nie ein Trainingsweltmeister, aber 16 Jahre auf Eispisten und in Fangnetzen
machen jeden mürbe. Was er jetzt, wie so oft, mit einem Spruch kontert. „Ich muss
morgen sofort mit dem Abtrainieren anfangen, weil mein Körper das noch so gewohnt
ist.“
Skirennfahrer erlangen selten große Bekanntheit, aber es gibt ein paar, die sich ins
öffentliche Gedächtnis gebrannt haben. Der Schwede Ingemar Stenmark war einst
unverschämt erfolgreich, Fragen beantwortete er in maximal drei Worten, als sei er sich
seiner Größe gar nicht bewusst. Lindsey Vonn, die Amerikanerin: war unverschämt gut,
begriff den Weltcup auch als ihre eigene Reality-TV-Show. Bode Miller, ihr Landsmann:
wuchs in einem Haus ohne fließendes Wasser und mit Plumpsklo auf, donnerte später
lieber eine waghalsige Fahrlinie ins Eis, anstatt noch eine Medaille zu gewinnen, und,
Pardon, schiss auch sonst auf die Maßstäbe des Sportbetriebes. Und: Felix Neureuther,
der war immer der Neureuther, ein großer Unverbogener in einem zunehmend glatten
Sportbetrieb. War Felix Neureuther der Letzte seiner Art?
Wie Kinder sich entwickeln, liegt ja vor allem an der Erziehung, und bei den
Neureuthers war das immer ein wenig spezieller. Rosi Mittermaier und Christian
Neureuther waren erfolgreiche Skirennfahrer, Mittermaier ist eine der bekanntesten
Deutschen überhaupt. Sie wollten nicht unbedingt, dass ihr Sohn denselben Beruf
ergreift, sie wussten ja, dass er immer auch gegen das Erbe der Eltern fahren würde.
Aber sie wollten ihm natürlich auch nichts verbauen. Eigentlich habe es nur ein
Leitmotto gegeben, sagt Christian Neureuther, „Aufmerksamkeit und Zeit“.
„Zeit“, findet Christian Neureuther, „ist Liebe.“
Der Sohn kam 1984 zur Welt, die Kinder in Bayern waren früh im Skiverein, das
Privatfernsehen lief gerade erst an. Die Eltern nahmen ihn immer mit in die Natur, und
wenn es schneite und der Felix im Kinderwagen lag, sagte die Mutter: „Ein paar
Schneeflocken im Gesicht tun ihm gut.“ Er war noch keine drei Jahre alt, da kurvte er mit
18seinem ersten Paar Ski zwischen den Leuten auf schwarzen Pisten herum, je wilder das
Gelände, desto besser. Er war immer auf Entdeckungsreise, er mochte es, wenn die
Natur vorbeirauscht. Eine Zeit lang waren sie fast jede Woche mit ihm im Krankenhaus,
der Sohn probierte ja alles aus, ob mit dem BMX-Rad oder den Ski. Aber war das zur
aktiven Zeit der Eltern nicht ähnlich gewesen? Slalomläufe mit Pudelmütze; die Rosi auf
Abfahrtspisten, die nur mit Heuballen gesichert waren, die von der Kälte so festgefroren
waren, dass man als Fahrer besser das Ziel erreichte. Die Eltern ließen den Sohn also
seine Grenzen testen, bis zu einem gewissen Grad, das fanden sie wichtig.
Christian Neureuther lenkt bis heute die Familie, seine Frau und er sind beruflich noch
immer Christian Neureuther und Rosi Mittermaier. Wenn man ihn trifft oder anruft, ist
er fast immer auf dem Sprung, wobei die Rosi, die personifizierte Antithese der
Überhöhung, das nicht so mag mit all den Terminen. Als die beiden einmal in Afrika ein
Waisenhaus besuchten, sagte sie: „Wenn ich keine Familie hätte, könnte ich hier als
Betreuerin arbeiten. Mir würde nichts abgehen.“
Materielles war in der Familie nie wirklich wichtig,
ein neues Paar Ski gab es nur zu Weihnachten
Ihre Prominenz? Hielten sie lange von den Kindern fern. Der Vater versuchte sich
früher mal bei Hans Rosenthals „Dalli Dalli“ und kommentierte Skirennen, den
Schickimicki-Betrieben in München oder Kitzbühel blieben beide fern. Der Sohn wurde
erst auf die einstigen Erfolge aufmerksam, als jemand bei einem Jugendrennen mal ein
Olympiabuch dabeihatte, das auch Bilder der Doppel-Olympiasiegerin Rosi Mittermaier
zeigte. Materielles war nicht wichtig, ein neues Paar Ski gab es nur zu Weihnachten.
Dafür war auf anderes immer Verlass, sagt Christian Neureuther, und zwar ein
gemeinsames Frühstück und ein gemeinsames Abendessen, viel Zeit für alle Sorgen und
Nöte der Kinder. Man könnte auch sagen: Lieber nicht der Öffentlichkeit treu sein,
sondern sich selbst.
Als Felix Neureuther mit 18 dann doch den Beruf der Eltern annahm, erforschte er auch
diese Welt so, wie er aufgewachsen war: auf Entdeckungsreise. In St. Moritz, bei seiner
ersten WM vor 16 Jahren, berichtete er auf der Pressekonferenz sichtlich stolz von den
„Super-Hasn“ im Teamhotel. Er fuhr meist schnell, je wilder, desto besser, auch wenn er
nicht immer das Ziel erreichte. 2007, im Slalom bei der WM in Åre, lag er prächtig im
Rennen, Silber wäre es wohl geworden, wäre er kurz vor dem Ziel nicht ausgeschieden.
Aber Neureuther, geistesgegenwärtig, erkannte noch etwas Gutes, wo gerade nicht viel
Gutes zu erkennen war: Er übergab einem Adjutanten des schwedischen Königshauses
seine Startnummer, die Prinzessin hatte sich das Leibchen gewünscht. Und plötzlich, der
Adjutant war schon weg, hüpfte Neureuther über eine Absperrung und machte den
Diener noch mal ausfindig.
Die deutschen Betreuer schauten ihm verdattert hinterher, sie dachten noch immer an
die vergebene Medaille, an entgangene Sponsoren- und Fördergelder. Neureuther
dachte: „Hab’ ganz vergessen, meine Handynummer auf das Trikot zu schreiben.“
Er fuhr weiter, und er fuhr couragiert, aber er gewann erst mal nichts, zumindest keine
Medaille, wenn es zählte. Er gewann auch nicht, als die WM 2011 in Garmisch-
Partenkirchen stattfand, seiner Heimat, weil er so sehr ans Gewinnen dachte. Wer
19immer knapp scheitert, den lässt die Sportöffentlichkeit in Deutschland schnell fallen,
der Neureuther packt es nicht, hieß es, solche Sachen. Neureuther sagte: „Das tangiert
mich nicht.“ Aber tief drinnen tat es das natürlich schon, jede Niederlage, jedes rote Licht
im Ziel ist ein Schlag, der einen vielleicht gar nicht stärker macht, sondern deformiert.
Aber er kam zurück, immer wieder.
Die Silbermedaille bei der WM 2013 in Schladming war eine Befreiung, auch wenn es
eher der externe Druck war, der abfiel, die Vergleiche mit den Eltern, die Spitznamen
der Kollegen, die ihn früher mal Rosi riefen. Geschenkt. Deutsche Rodler und Biathleten
konnten fortan doppelt und fünffach bei Olympia gewinnen, Neureuther stieg zum
großen Gesicht des Wintersports auf. Er fuhr noch immer diesen famosen Schwung,
nicht kraftvoll, sondern immer mit dem richtigen Gefühl, wann er den Ski wie ins Eis
pressen musste. Aber die Siege und Medaillen, das war nur das eine. Während die
Konkurrenten bei der Massage lagen, schrieb er Autogramme. Während andere vor
Olympia 2014 nichts dem Zufall überließen, rauschte er hastig zum Flughafen, erwischte
eine Eisplatte – Leitplanke, Schleudertrauma, alle Goldchancen futsch. Er war sich schon
seiner Größe bewusst, aber er sonnte sich nicht darin, sondern kritisierte
Sportfunktionäre, die Olympische Winterspiele in sommerliche Gegenden verpflanzten,
wo sie Schneisen durch geschützte Wälder frästen, um eine Abfahrtspiste für zwei
Wochen zu errichten. Wenn das so weitergehe, sagte Felix Neureuther, „dann versinken
Olympias Werte im Schutt“.
Deutsche Sportler sollen eigentlich immer glatt gewinnen und vorbildlich auftreten; als
der Diskuswerfer Christoph Harting nach seinem Olympia-Gold in Rio auf dem Podium
zur Nationalhymne schunkelte, war das Gezeter groß. Neureuther schunkelte nie bei der
Hymne, er gewann bis zuletzt ja auch keinen großen Einzeltitel. Aber mit seiner Art, da
wirkte er dem Publikum immer näher als all die Seriensieger, die Entrückten. Und wenn
es im deutschen Team mal schlecht lief, dann redeten nur wenige über die falsche
Abstimmung, sondern über den Neureuther, der sich im Fernsehen gerade selbst
interviewt hatte.
Wie einer wahrgenommen wird, ist auch eine Frage des Zeitpunkts; auch der Sport
jenseits des immer abgehobeneren Fußballs entwickelt sich gerade zu einem immer
glatteren Geschäft. Wintersportler werden über den Globus zu Wettkämpfen gescheucht,
um neue Märkte zu erschließen, wie das im Sportwirtschaftsdeutsch heißt. Die
Verbände erfinden immer noch mehr Disziplinen, Parallelslaloms, Single-Mixed-Staffeln,
mehr Vermarktung, mehr Umsatz, mehr Medaillen. Wer keine Medaillen gewinnt, wird
schlechter gefördert. Die Athleten müssen sich da schon für den Erfolg trimmen, sie
trainieren sehr früh schon sehr spezifisch. Interviews? Werden auch zunehmend von
Managern geglättet, wenn auch nicht so sehr bei den Alpinen. Aber was geglättet ist,
wirkt immer auch austauschbar und kalt. Wie der Schnee auf der Streif.
Felix Neureuther war nie geglättet. Er sprach noch immer von Super-Hasn, wenn etwa
die Rede auf Ana Ivanović kam, die ehemalige Tennisspielerin und Frau von Bastian
Schweinsteiger. Wenn im Zielraum alle auf ihn schauten, ließ er sie an seiner Freude und
seinem Ärger teilhaben, wie Boris Becker, der auch immer dann besonders gut war,
wenn sich auf dem Platz alles gegen ihn verschworen hatte. Er ging auch dann, als er
längst im Weltcup fuhr, immer mal wieder auf Entdeckungstour, heizte in Neuseeland
20Sie können auch lesen