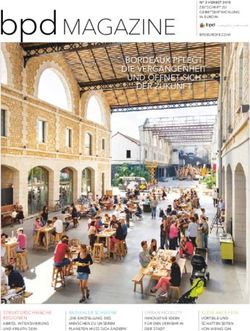Lila Reihe Ernährung in der Onkologie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Lila Reihe Ernährung in der Onkologie Gudrun Zürcher
© Nutricia 2. Auflage Mai 2012
Ernährung in der Onkologie
Verantwortliche Autorin:
Dr. med. Gudrun Zürcher
Medizinische Universitätsklinik
Abteilung Innere Medizin I
Schwerpunkt Hämatologie / Onkologie
Sektion Ernährungsmedizin und Diätetik
Hugstetterstraße 55
79106 Freiburg
gudrun.zuercher@uniklinik-freiburg.de
Unter Mitarbeit von:
Prof. Dr. rer. nat. Dorothee Volkert
Institut für Biomedizin des Alterns
Universität Erlangen-Nürnberg
Heimerichstraße 58
90419 Nürnberg
dorothee.volkert@aging.med.uni-erlangen.de
3 ___Inhalt
1 Einleitung 6
2 Grundlagen der Onkologie 7
2.1 Epidemiologie von Krebserkrankungen 7
2.2 Tumorentstehung und Tumorwachstum 8
2.3 Rolle der Ernährung bei der Tumorentstehung 12
2.4 Ernährungsempfehlungen zur Minderung des Krebsrisikos 18
3 Mangelernährung bei Tumorpatienten 20
3.1 Definition 20
3.2 Häufigkeit von Mangelernährung bei Tumorpatienten 21
3.3 Folgen von Mangelernährung bei Tumorpatienten 22
3.4 Ursachen von Mangelernährung bei Tumorpatienten 23
3.4.1 Unzureichende Energie- und Nährstoffaufnahme 23
3.4.2 Stoffwechselstörungen 32
3.5 Erfassung und Diagnose von Mangelernährung 33
4 Ernährung bei Tumorerkrankungen 35
4.1 Empfehlungen zur Ernährung bei Tumorerkrankungen 35
4.1.1 Allgemeines 35
4.1.2 Empfehlungen zur Energie- und Nährstoffzufuhr 37
4.1.3 Bedeutung der Ernährungsberatung 39
4.1.4 Die sogenannten „Krebsdiäten“ 39
4.2 Grundlagen der Ernährungstherapie 41
4.2.1 Allgemeines 41
4.2.2 Ziele 41
___ 4Inhalt
4.2.3 Indikationen 42
4.2.4 Formen der Ernährungstherapie 42
4.2.5 Refeeding-Syndrom 44
4.2.6 Förderung des Tumorwachstums durch Ernährungstherapie? 45
4.3 Ernährung bei Operationen 45
4.3.1 Indikationen 45
4.3.2 Art der Nahrung 47
4.3.3 Operationen mit speziellen Ernährungsrichtlinien 48
4.4 Ernährung bei Chemotherapie 58
4.5 Ernährung bei Radio- und Radio-/Chemotherapie 61
4.6 Ernährung bei hämatopoetischer Zelltransplantation:
Knochenmarktransplantation (KMT), autologe und allogene
hämatopoetische Zelltransplantation (HZT) 62
4.7 Ernährung mit speziellen Substraten 64
4.8 Medikamentöse Therapie zur Stoffwechselmodulation 64
5 Ernährung nach der Tumortherapie 65
6 Ernährung in der Palliativsituation 66
6.1 Enterale und parenterale Ernährung außerhalb antitumoraler Therapie 66
6.2 Ernährung in der Sterbephase 67
Weiterführende Literatur 68
5 ___1 Einleitung
Tumorerkrankungen sind mit 26 % nach American Institute for Cancer Research
den Herz-Kreislauf-Erkrankungen (45 %) „Nahrung, Ernährung, Bewegung und
die zweithäufigste Todesursache in die Prävention von Krebs: eine globale
Deutschland. Bei vielen Krebserkran- Perspektive“ („Food, Nutrition, Physical
kungen ist die Ernährung in allen Phasen Activity and the Prevention of Cancer:
der Erkrankung von Bedeutung: bei der a Global Perspective“), die im November
Entstehung, als unterstützende Maßnah- 2007 zum zweiten Mal erschienen ist.
me bei den Behandlungen und in der Von besonderem Interesse sind auch die
Erholungsphase, bei Langzeitproblemen Ergebnisse der seit 1992 in 23 Zentren in
mit der Ernährung und bei einem Teil der 10 europäischen Ländern durchgeführten
Tumore, um das erneute Auftreten der EPIC-Studie („European Prospective In
Erkrankung zu verzögern oder zu ver vestigation into Cancer and Nutrition“),
hindern. an der aus Deutschland über 50.000 Per
sonen aus zwei Zentren (Heidelberg und
Ziel unseres Leitfadens ist es, den Pa- Potsdam) teilnehmen.
tienten zu ihren möglichen Problemen
Lösungen aufzuzeigen und häufig ge Die Erkenntnisse zur Ernährung während
stellte Fragen zu beantworten. Wir möch- und nach der Tumortherapie basieren
ten aber auch den Angehörigen und den überwiegend auf den evidenzbasierten
Betreuenden aus allen Fachgebieten das Leitlinien der Deutschen Gesellschaft
Thema „Ernährung und Onkologie“ nahe für Ernährungsmedizin (DGEM) und der
bringen. Aus langjähriger Erfahrung wis- Europäischen Gesellschaft für Klinische
sen wir, wie wichtig die Ernährung für an Ernährung und Stoffwechsel (ESPEN),
Krebs erkrankte Patienten ist. ergänzt durch aktuelle Fachliteratur. In
die Empfehlungen eingeflossen ist aber
Wissenschaftliche Grundlage der Aus auch die Erfahrung aus der jahrelangen
führungen zur Prävention von Krebser- ernährungsmedizinischen Betreuung von
krankungen ist die Dokumentation des Tumorpatienten.
World Cancer Research Funds und des
___ 62 Grundlagen der Onkologie
2.1 Epidemiologie von Nachsorge nach einer Tumorbehandlung
zur Früherkennung eines Rezidivs, aber
Krebserkrankungen
auch zur Minderung eines Rezidivrisikos.
Die Epidemiologie in der Onkologie gibt
Was ist Krebs?
Auskunft über die Häufigkeit des Auftre-
tens und die geographische Verteilung Krebs ist eine Gruppe von mehr als 100
von Krebserkrankungen und untersucht Krankheiten, die als Folge von Verände-
mögliche Zusammenhänge zwischen rungen der genetischen Information der
dem Auftreten einzelner Erkrankungen Zellen durch ein unkontrolliertes Wachs-
und Risikofaktoren. Aus den gewonnenen tum gekennzeichnet ist. Krebs greift viele
Erkenntnissen werden Vorsorgemaßnah- verschiedene Gewebe und Zellarten an.
men abgeleitet. Unterschieden werden Wenn er bösartig ist, wächst er in das
die primäre Prävention, die eine Tumor umgebende Gewebe ein und kann in
entstehung verhindern soll, die sekun einem vom Ort der Entstehung entfernten
däre Prävention, die Tumorfrüherken- Gewebe weitere Tumore, so genannte
nung, und die tertiäre Prävention, die Metastasen, bilden.
Männer Frauen
Prostata 25,4 27,8 Brustdrüse
Darm 16,2 17,5 Darm
Lunge 14,3 6,4 Lunge
Harnblase* 9,3 5,7 Gebärmutterkörper
Magen 4,8 4,7 Eierstöcke
Niere 4,7 4,1 M. Malanom der Haut
Mundhöhle und Rachen 3,3 3,8 Magen
Non-Hodgkin-Lymphome 2,9 3,6 Harnblase*
M. Malanom der Haut 2,8 3,2 Bauchspeicheldrüse
Bauchspeicheldrüse 2,7 3,2 Niere
Leukämien 2,1 3,0 Gebärmutterhals
Hoden 2,1 2,9 Non-Hodgkin-Lymphome
Speiseröhre 1,7 2,1 Leukämien
n = 230 500 Kehlkopf 1,7 Schilddrüse n = 206 000
2002: n = 218 250 Schilddrüse Mundhöhle und Rachen 2002: n = 206 000
Morbus Hodgkin Speiseröhre
Schätzung der Dachdokumentation Krebs
Morbus Hodgkin
im Robert-Koch-Institut Kehlkopf * ohne nicht melanotischen Hautkrebs
25 20 15 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30
RKI 2008
Abbildung 1: Prozentualer Anteil ausgewählter Tumorlokalisationen
an allen Krebsneuerkrankungen* in Deutschland 2004
7 ___Nach Schätzung der Dachdokumentation 2.2 T
umorentstehung und
Krebs im Robert-Koch-Institut von 2008
Tumorwachstum
sind in Deutschland 2004 insgesamt
436.500 Krebsneuerkrankungen aufge-
Die Zellen jedes Lebewesens befinden
treten, 230.500 bei Männern und 206.000
sich in einem genau geregelten Gleich-
bei Frauen. Gegenüber der Schätzung
gewicht von Wachstum (Proliferation),
von 2002 waren das bei den Männern
zellulärer Spezialisierung (Differenzierung)
12.250 Neuerkrankungen mehr. Bei den
und Zelltod (Apoptose beziehungsweise
Frauen war die Anzahl der Neuerkran
Nekrose). Diesen Erscheinungsformen
kungen gegenüber 2002 unverändert
einer Zelle liegen genau festgelegte
(Abbildung 1).
genetische Anleitungen zugrunde, die
Im internationalen Vergleich steht Deutsch- das Wachstumsverhalten und den Ablauf
land damit bei den Männern an zehnter der Zellteilung (Zellzyklus) steuern. Diese
und bei den Frauen an elfter Stelle der genetischen Programme werden wesent-
Häufigkeit von Neuerkrankungen. An Krebs lich durch Signale außerhalb der Zelle
verstorben sind 2004 110.745 Männer, beeinflusst. Sie bestimmen die Aktivität
1.114 mehr als 2002. Von den an Krebs der Gene einer Zelle. Eine Fehlregulation
erkrankten Frauen verstarben 2004 da- der Genaktivität, bedingt durch Verän-
gegen 1.866 Frauen weniger als 2002 derungen (Mutationen) von Struktur und
(98.079 versus 99.945 Frauen). Funktion des im Zellkern enthaltenen DNS
(Desoxyribonukleinsäure)-Erbmaterials
Bei den Tumorneuerkrankungen steht an
kann zu einem unkontrollierten Zellwachs-
erster Stelle bei den Männern der Prosta-
tum führen. Zudem unterstützt jeder
takrebs, bei den Frauen der Brustkrebs,
Mechanismus, der das Überleben DNS-
bei beiden Geschlechtern gefolgt von den
geschädigter Zellen erhöht, zum Beispiel
Darmtumoren an zweiter und dem Lun-
durch Verhindern des apoptotischen
genkrebs an dritter Stelle (Abbildung 1).
Todes solcher Zellen, den Prozess der
Betrachtet man die Krebssterbefälle, so Krebsentstehung, der Kanzerogenese.
versterben die Männer am häufigsten an Bösartige (maligne) Tumoren entstehen
Lungenkrebs, die Frauen an Brustkrebs. in mehreren Schritten, sogenannte Mehr
Zweithäufigste Krebstodesursache ist der schritt-Theorie der Krebsentstehung
Darmkrebs, und erst an dritter Stelle bei (Abbildung 2). Diese Schritte entspre-
den Männern der Prostatakrebs und bei chen jeweils dem Auftreten zusätzlicher
den Frauen der Lungenkrebs. Zellschädigungen. Substanzen, die schon
in sehr geringen Mengen bleibende DNS-
Veränderungen hervorrufen, werden als
Initiatoren oder Karzinogene bezeichnet.
Vorstufen von Karzinogenen, sogenann-
te Pro-Karzinogene, rufen selbst keine
Schäden hervor, können aber im Orga-
nismus durch enzymatische Umsetzung
___ 8Normale Zelle
Prä Dysplasie Maligne Zelle Neoplasie Generalisierung
neoplastische
Zelle
Invasion
Initiation Promotion Transformation Progression Metastase
Genetische Klonale Genetische Genetische Genetische
Veränderung Expansion Veränderung Veränderung Veränderung
• erblich • endokrin • Telomerase • Wachstums- • Angiogenese
• Chemikalien • Entzündung • Onkogene faktoren • Proteinasen
• Strahlen • Ernährung • Suppressorgene • Heterogenität • Matrixproteine
• Bakterien, • Apoptosestörung
Viren, Pilze
Berger, Martens 2008
Abbildung 2: Modell der Mehrschrittkarzinogenese
in Karzinogene umgewandelt werden und Asbest und Medikamente. Eine bedeutende
außerdem die krebserzeugende Wirkung Quelle für reaktive Sauerstoffspezies ist
anderer Substanzen verstärken. der Zigarettenrauch. Physikalische Kan-
zerogene sind ionisierende, radioaktive
Am Anfang einer Tumorentwicklung steht
und UV-Strahlung.
die Initiation, die irreversible Veränderung
der molekularen Struktur der DNS einer Biologische Karzinogene sind Bakterien,
einzelnen normalen, differenzierten und Viren und Pilze, insbesondere bei chro-
teilungskontrollierten Zelle durch chemi- nischen Infekten. Beispiele hierfür sind
sche, physikalische und/oder biologische Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus
Karzinogene. als Ursache für das Burkitt-Lymphom,
mit Helicobacter pylori als Ursache für
Chemische Karzinogene sind zum Bei-
Magenkarzinome und MALT-Lymphome
spiel reaktive Sauerstoffspezies, auch als
des Magens, mit dem Human Immunode-
„Sauerstoffradikale“ bezeichnet. Diese
ficiency Virus (HIV) für Lymphome und mit
entstehen normalerweise im Organismus
humanen Papillomviren als Ursache für
in den Mitochondrien als Nebenprodukt
das Gebärmutterhalskarzinom.
der Zellatmung, aber auch in Lymphozy-
ten zur Keimabwehr. Weitere chemische Wird die initiierte Zelle nicht repariert oder
Karzinogene sind Nitrosamine, polyzykli- zerstört, kommt es durch die Zellteilung
sche aromatische Kohlenwasserstoffe, zu einer Vermehrung des neu gebildeten
Mykotoxine (toxische Stoffwechselpro- veränderten Zellklons.
dukte von Schimmelpilzen), Formaldehyd,
9 ___Im Mittelpunkt der Krebsentstehung Basenfehlpaarungen, es kommt zu einer
stehen vier Klassen von Genen: Pro- genetischen Instabilität, einem sogenann-
toonkogene, Tumorsuppressorgene, ten „Mutatorphänotyp“. Damit steigt die
Apoptose-regulierende Gene und DNS- Wahrscheinlichkeit für Mutationen an On-
Reparaturgene. kogenen und Tumor-Suppressor-Genen
und auch das Risiko für Zellentartungen.
Protoonkogene sind normale Gene, die
physiologische Vorgänge wie das Wachs- Um eine Krebserkrankung entstehen
tum und die Spezialisierung der Zellen zu lassen, reicht die Initiation nicht aus.
regulieren. Durch Mutationen entstehen Bleibt eine initiierte Zelle erhalten, ist der
Onkogene, wodurch veränderte Proteine, nächste Schritt zur Krebsentwicklung die
sogenannte Onkoproteine, gebildet wer- klonale Expansion einer zunächst noch
den. Die Folge sind vielfältige Störungen homogenen Zellpopulation während der
der normalen Regulationsmechanismen Promotion. Je größer die Anzahl initiierter
und Signalwege. Zellen ist, umso größer ist das Risiko
Tumorsuppressorgene oder Anti-Onko einer Tumorprogression. Promotoren wie
gene haben in normalen Zellen eine Hormone, Wachstumsfaktoren, in dieser
wachstumshemmende Wirkung. Kommt Phase besonders auch Ernährungsfakto-
es zu einem Funktionsverlust, entsteht ren und nicht genotoxische Karzinogene,
ein Verlust der Wachstumskontrolle. die keine gezielte Mutation im Genom
auslösen, aber das Wachstum stimulie-
Apoptose-regulierende Gene sorgen für ren, wirken als Wachstumsförderer für die
den programmierten Zelltod, die „Apop- entarteten Zellen. Promotoren stören die
tose“. Eine gestörte Apoptose und damit metabolische Zellkooperation initiierter
eine unvollständige Beseitigung verän- Zellen mit Nachbarzellen, indem sie die
derter Zellen ist eine wesentliche Ursache physiologische interzelluläre Kommu-
einer Tumorentstehung. nikation über die Kanalverbindungen
DNS-Reparaturgene sind für die Repa- zwischen den Zellen, die „gap junctions“,
ratur der auch in einem gesunden Orga- unterbrechen. Gap junctions ermöglichen
nismus aufgrund von Fehlern bei der Ver- ein konstantes Milieu und eine geordnete
vielfältigung der DNS oder durch mutage- Stoffwechselkoordination.
ne Effekte (zum Beispiel durch chemische
Der Informationsfluss dient als Kontrolle
oder physikalische Karzinogene) immer
für das Wachstum initiierter Zellen. Da
wieder entstehenden genetischen Defekte
er durch den Einfluss von Promotoren
verantwortlich.
unterbrochen wird, können die Zellen
Entsprechende Reparaturenzyme entfer im proliferativen Stadium bleiben. Damit
nen die fehlerhaften Abschnitte aus der regen die Promotoren das Wachstum
DNS und ersetzen sie durch die richtigen entarteter Zellen an. Oft entstehen dabei
Folgen. Ist die Funktion dieser Repara zunächst präkanzeröse Veränderungen,
turenzyme vermindert, häufen sich zum Beispiel intraepitheliale Neubildungen,
___ 10Fehlbildungen oder Adenome (gutartige und Nährstoffen versorgen, sie brauchen
von Drüsen oder Schleimhäuten ausge- die Fähigkeit zur Bildung von Blutgefäßen.
hende Tumore). Bricht der Kontakt einer Die Bildung tumoreigener Blutgefäße wird
Zelle mit dem Promotor ab, bevor sie teilweise von den Tumorzellen selbst, teil-
sich vermehren kann, unterbleibt die weise aber auch von Entzündungszellen
Tumorzellbildung. Somit müssen Pro- in der Umgebung des Tumors beeinflusst.
motoren vom Initiationsereignis an bis
Der Vorgang des Einwachsens eines Tu-
zur klinischen Manifestation des Tumors
mors in das umgebende Gewebe (Invasi
andauernd vorhanden sein. Während
on, Infiltration) erfolgt in vielen Schritten
der Vorgang der Initiation ein einmaliges
und führt schließlich zu einer Zerstörung
Ereignis ist und nur eine kurze Zeitspanne
des Normalgewebes. Tumorzellen bilden
umfasst, kann die Promotion über Jahre
Enzyme, die die Gewebematrix auflösen
bis Jahrzehnte dauern.
und ihnen erlauben, in das angrenzende
Infolge weiterer Veränderungen der DNS Gewebe einzudringen. Dazu haben sie
kommt es schließlich zur Konversion in die Fähigkeit zum Einwandern erworben.
maligne Zellen mit dem Erwerb tumor- Die Metastasenbildung schließlich erfolgt
biologischer Eigenschaften (Transforma durch Einbrechen in Lymph- und/oder
tion). Zu diesen Eigenschaften gehören Blutgefäße (lymphogene bzw. hämatoge-
eigene Wachstumssignale, Unempfind- ne Aussaat), teilweise auch über Körper-
lichkeit gegenüber Antiwachstumssigna- höhlen (kavitäre Aussaat).
len, eine unbegrenzte Möglichkeit zur Ver-
vielfältigung (Replikation), das Umgehen
des programmierten Zelltodes (Apoptose),
eine ununterbrochene Neubildung von
Gefäßen (Angiogenese) und das Einwach-
sen (Invasion) in das umgebende Gewe-
be. Aus dieser Transformation entwickelt
sich letztlich eine weitere Progression
mit Ausbildung von Tochtergeschwülsten
(Metastasen) und Ausbreitung im ganzen
Körper (Abbildung 2).
Die Bildung von Blutgefäßen bei Erwach-
senen ist ziemlich konstant und eng
durch ein Gleichgewicht zwischen die
Gefäßbildung fördernden und hemmen-
den Faktoren kontrolliert. Ab einer Größe
von 1 bis 2 mm können sich Tumore zur
Weiterentwicklung nicht mehr aus der
Umgebung durch Diffusion mit Sauerstoff
11 ___2.3 Rolle der Ernährung bei esearch auf der Grundlage wissen-
R
schaftlicher Veröffentlichungen einen
der Tumorentstehung
umfangreichen Bericht über den Zusam-
menhang zwischen Ernährung, Bewegung
Unter den Risikofaktoren für eine Tumor
und Krebsprävention veröffentlicht und
entstehung werden innere (endogene)
auch daraus abgeleitete Ernährungsemp-
und äußere (exogene) Ursachen un-
fehlungen ausgesprochen. Dabei wird
terschieden. Zu den inneren Ursachen
deutlich, dass eine „gute“ Ernährung –
gehören beispielsweise das Alter, eine
definiert als angemessene Versorgung
ererbte genetische Disposition, Erkran-
mit Nahrung und Nährstoffen des gesam
kungen mit einem erhöhten Krebsrisiko
ten Körpers bis hin zur zellulären und
(zum Beispiel die Colitis ulcerosa oder
intrazellulären Ebene – für einen normalen
Dickdarmpolypen), oxidativer Stress
Aufbau und eine normale Funktion bereits
oder eine chronische Entzündung. Unter
vor der Geburt notwendig ist. Ist eine
den äußeren oder Umwelt-Faktoren sind
Person nicht geeignet ernährt, entweder
Ernährung und Bewegung sowie Rauchen
durch Unter- oder Überernährung, hat das
für die Krebsentstehung von besonde-
Auswirkungen auf die Mikroumgebung
rer Bedeutung. Der Einfluss einzelner
des Gewebes durch Beeinträchtigung von
Ernährungsfaktoren für die Entstehung
Struktur und Funktion.
der verschiedenen Tumore ist dabei
sehr unterschiedlich. Überschätzt für die Von besonderem Interesse sind die
Krebsentstehung wird die Bedeutung von Ergebnisse epidemiologischer Untersu-
Lebensmittelzusatzstoffen, Arzneimitteln, chungen im Bezug auf den Zusammen-
ionisierenden Strahlen, Industrieabfällen hang zwischen der Entstehung einzelner
und der Umweltverschmutzung. Tumore und Ernährungsfaktoren, vor allem
auch einzelner Lebensmittel, Lebensmit-
Über die Zusammenhänge zwischen der telgruppen und Nahrungsinhaltstoffe.
Ernährung und dem Krebsgeschehen gibt
es eine Vielzahl von Untersuchungen, die Dazu ist in den letzten Jahren eine Fülle
zeigen, dass Nährstoffe und Nahrungs- von Arbeiten verschiedener Arbeits-
inhaltstoffe die grundlegenden zellulären gruppen erschienen, u. a. auch von den
Vorgänge in allen Stadien einer Tumor- beiden an der EPIC-Studie (European
entwicklung fördernd und hemmend Prospective into Cancer and Nutrition-
beeinflussen. Studie) beteiligten deutschen Zentren.
Die bis Ende 2005 vorliegenden Studien
Bereits zweimal, 1997 und 2007, haben
sind im o. g. Bericht des WCRF zusam-
der World Cancer Research Fund (WCRF)
mengefasst.
und das American Institute for Cancer
___ 12In Deutschland wurden in den Ernäh-
rungsberichten der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) 2004 und
2008 die Beziehungen zwischen aus-
gewählten Lebensmittelgruppen und
Nährstoffen sowie der Entstehung von
Organtumoren auf der Grundlage von
Veröffentlichungen bis 2007 dargestellt
und bewertet. In allen Berichten erfolgt
die Bewertung der Studienergebnisse
auf der Basis der Einteilung des Grades
der Beweise (Evidenz) nach den Kriterien
der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Danach werden die Beweise folgen
dermaßen eingeteilt:
• überzeugende Beweise für eine
risikobeeinflussende Wirkung,
• wahrscheinliche Beweise für eine
risikobeeinflussende Wirkung,
• mögliche Beweise für eine risiko
beeinflussende Wirkung und
• unzureichende Beweise für eine
risikobeeinflussende Wirkung.
Die risikobeeinflussende Wirkung kann
dabei risikosteigernd oder risikosenkend
sein. Empfehlungen zur Verminderung der
Krebsinzidenz werden nur aufgrund über-
zeugender und wahrscheinlicher Beweise
für eine Beeinflussung des Krebsrisikos
gegeben. Tabelle 1 gibt die verschiede-
nen Evidenzgrade zwischen Ernährungs-
faktoren und der Entstehung bösartiger
Tumore in verschiedenen Organen auf der
Grundlage des WCRF-Berichtes 2007 und
des Ernährungsberichtes 2008 wieder.
13 ___Steigerung des
Betroffenes Organ Senkung des Krebsrisikos
Krebsrisikos
Bauchspeicheldrüse Bewegung ▼ allgemeines Übergewicht
Obst ▼ abdominelles Übergewicht
Lebensmittel mit Folat ▼▼ Fleisch (rot)
Blase Obst ▼
Brust Bewegung (postmenopausal) ▼▼ allgemeines Übergewicht
Bewegung (prämenopausal) ▼ (postmenopausal)
Alkohol
Abdominelles Übergewicht
(postmenopausal)
Fleisch (rot)
Fleischwaren
Eier
Fett
gesättigte Fettsäuren
(postmenopausal)
Dickdarm Bewegung ▼▼▼ allgemeines und
Obst- und Gemüse ▼▼ abdominelles Übergewicht
Knoblauch ▼▼ Alkohol
Milch, Milchprodukte ▼▼ Fleisch (rot)
Ballaststoffe ▼▼ Fleischwaren
Fisch ▼
langkettige ω-3-Fettsäuren ▼
Enddarm Bewegung ▼▼▼ allgemeines und
(weniger stark als Dickdarm) abdominelles Übergewicht
Milch und Milchprodukte ▼▼ Alkohol
Obst und Gemüse ▼ Fleisch (rot)
Knoblauch ▼▼ Fleischwaren
Fisch ▼
langkettige ω-3-Fettsäuren ▼
Ballaststoffe ▼
Eierstöcke
Gebärmutter (Hals und Bewegung ▼▼ Allgemeines Übergewicht
Schleimhaut) Abdominelles Übergewicht
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten und dem Erkrankungsrisiko
für einzelne Krebsarten
___ 14Keine Beziehung Unzureichende Hinweise
zu einem Krebsrisiko auf Beeinflussung des Krebsrisikos
▲▲▲ Fett ◆◆ Alkohol, Gemüse, Fleischwaren, Fisch,
▲▲ gesättigte Fettsäuren ◆◆ Geflügel, Eier, langkettige ω-3-Fettsäuren,
▲ Milch, Milchprodukte, Ballaststoffe,
Glykämischer Index
Alkohol, Gemüse, Fleisch (rot), Fleischwaren,
Fisch, Geflügel, Milch, Milchprodukte, Eier,
Fett, gesättigte Fettsäuren, langkettige ω-3-
Fettsäuren, Ballaststoffe, Glykämischer Index,
Alkohol
▲▲▲ Obst- und Gemüse ◆ Geflügel, langkettige ω-3-Fettsäuren, Milch,
Fischverzehr ◆ Milchprodukte, Glykämischer Index
▲▲▲ Ballaststoffe (postmenopausal) ◆
▲▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲▲▲ Fett ◆◆ Geflügel, Eier
gesättigte Fettsäuren ◆◆
▲▲▲ Glykämischer Index ◆
▲▲
▲▲
▲▲▲ Fett ◆◆ Geflügel, Eier
gesättigte Fettsäuren ◆◆
▲▲▲ Glykämischer Index ◆
▲▲
▲▲
Fett ◆◆ Obst und Gemüse, Fleisch (rot), Fleischwaren,
gesättigte Fettsäuren ◆◆ Fisch, Geflügel, Milch und Milchprodukte, Eier,
langkettige ω-3-Fettsäuren ◆ Ballaststoffe, Glykämischer Index
Alkohol ◆
▲▲▲ Fett (Schleimhaut) ◆◆ Obst und Gemüse, Fleisch (rot), Fleischwa-
▲▲ gesättigte Fettsäuren (Schleimhaut) ◆◆ ren, Ballaststoffe, Fisch, Geflügel, Milch und
Milchprodukte, Eier, Fett (Hals), gesättigte
Fettsäuren (Hals), langkettige ω-3-Fettsäuren,
Alkohol, Glykämischer Index
15 ___Steigerung des
Betroffenes Organ Senkung des Krebsrisikos
Krebsrisikos
Leber Alkohol
Lunge Bewegung ▼
Obst ▼▼
Gemüse ▼
Lebensmittel mit Carotinoiden ▼▼
Magen Ballaststoffe ▼ Alkohol
Grünes Gemüse ▼▼ Salz
Zwiebelgemüse ▼▼ Fleischwaren
Mund und Rachen Obst- und Gemüse ▼▼ Alkohol
Grünes Gemüse ▼▼
Lebensmittel mit Carotinoiden ▼▼
Niere Obst und Gemüseverzehr ▼ Allgemeines Übergewicht
Prostata Lebensmittel mit Lycopen ▼▼ Milch und Milchprodukte
Lebensmittel mit Selen ▼▼
Speiseröhre Obst und Gemüse ▼▼ Alkohol
Grünes Gemüse ▼▼ Allgemeines Übergewicht
Lebensmittel mit Beta-Carotin ▼▼ Fleisch (rot)
Lebensmittel mit Vitamin C ▼▼ Fleischwaren
Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten und dem Erkrankungsrisiko
für einzelne Krebsarten
▲▲▲(▼▼▼) überzeugende Evidenz für einen risikoerhöhenden (-senkenden) Effekt
▲▲(▼▼) wahrscheinliche Evidenz für einen risikoerhöhenden (-senkenden) Effekt
▲(▼) mögliche Evidenz für einen risikoerhöhenden (-senkenden) Effekt
◆(◆◆) mögliche (wahrscheinliche) Evidenz für keine Veränderung des Krebsrisikos
___ 16Keine Beziehung Unzureichende Hinweise
zu einem Krebsrisiko auf ein Krebsrisiko
▲▲▲ Obst und Gemüse, Fleisch (rot), Fleischwaren,
Fisch, Geflügel, Milch und Milchprodukte, Eier,
Fett, gesättigte Fettsäuren, langkettige ω-3-Fett-
säuren, Ballaststoffe, Glykämischer Index
Fett ◆◆ Fleisch (rot), Fleischwaren, Fisch, Geflügel,
gesättigte Fettsäuren ◆◆ Milch und Milchprodukte, Eier, langkettige
Alkohol ◆ ω-3-Fettsäuren, Ballaststoffe, Glykämischer
Index
▲▲ Glykämischer Index ◆ Fleisch (rot), Fisch, Geflügel, Milch und Milch-
▲▲ produkte, Eier, Fett, gesättigte Fettsäuren,
▲ langkettige ω-3-Fettsäuren
▲▲▲ Fisch, Geflügel, Milch und Milchprodukte,
Eier, Fett, gesättigte Fettsäuren, langkettige
ω-3-Fettsäuren, Ballaststoffe, Glykämischer
Index
▲▲▲ Alkohol ◆◆ Fleisch (rot), Fleischwaren, Fisch, Geflügel,
Milch und Milchprodukte, Eier, Fett, gesättigte
Fettsäuren, langkettige ω-3-Fettsäuren,
Ballaststoffe, Glykämischer Index
▲ Fisch ◆ Obst und Gemüse, Fleisch (rot), Fleischwaren,
Fett ◆◆ Geflügel, Eier, Ballaststoffe, Glykämischer
Gesättigte Fettsäuren ◆◆ Index
langkettige ω-3-Fettsäuren ◆
Alkohol ◆
▲▲▲ Fisch, Geflügel, Milch- und Milchprodukte, Eier,
▲▲▲ Fett, gesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, lang-
▲ kettige ω-3-Fettsäuren, Glykämischer Index
▲
WCRF 2007, Ernährungsbericht der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 2008
17 ___2.4 Ernährungsempfehlungen zur 1. Bleiben Sie so schlank wie möglich!
Minderung des Krebsrisikos Die Energiezufuhr soll so gestaltet wer
den, dass Übergewichtige ihr Gewicht
Der World Cancer Research Fund (WCRF) allmählich dauerhaft vermindern, nor
und das American Institute for Cancer malgewichtige Patienten ihr Gewicht
Research (AICR) haben in ihrem zwei- halten, und untergewichtige Patienten
ten, im November 2007 veröffentlichten ihr „persönliches Normalgewicht“ wieder
Bericht zur Krebsprävention die folgenden erreichen.
persönlichen Ernährungsempfehlungen
Bei Übergewicht empfiehlt es sich, fach-
zur Minderung des Krebsrisikos zusam-
liche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um
mengestellt:
einseitige und Crash-Diäten zu vermei-
den, da diese nicht dauerhaft eingehalten
1. Bleiben Sie so schlank wie möglich!
werden können und es regelmäßig erneut
2. Beziehen Sie körperliche zu einer Gewichtszunahme kommt.
Aktivität in Ihren Alltag ein!
2. Beziehen Sie körperliche
3. Begrenzen Sie den Verzehr Aktivität in Ihren Alltag ein!
energiedichter Lebensmittel
•M
indestens 30 Min./Tag moderate kör-
(> 225 kcal/100 g). Meiden
perliche Aktivität (z.B. schnelles Gehen)
Sie zuckerhaltige Getränke!
•Z
iel bei verbesserter Leistungsfähigkeit:
4. Essen Sie überwiegend Lebens- mindestens 60 Min./Tag moderate oder
mittel pflanzlichen Ursprungs! mindestens 30 Min./Tag intensive
körperliche Aktivität
5. Schränken Sie den Verzehr von
rotem Fleisch ein und meiden
3. B
egrenzen Sie den Verzehr
Sie verarbeitetes Fleisch!
energiedichter Lebensmittel
6. Begrenzen Sie den Konsum (> 225 kcal/100 g). Meiden
alkoholischer Getränke! Sie zuckerhaltige Getränke!
•S
eltener Verzehr energiedichter
7. Begrenzen Sie den Salzkonsum
Lebensmittel
und meiden Sie den Konsum
von verschimmeltem Getreide, • Meiden zuckerhaltiger Getränke
Getreideprodukten und Hülsen
•S
eltener Verzehr von Fast Food,
früchten!
wenn überhaupt
8. Bemühen Sie sich, den Nährstoff-
bedarf ausschließlich über die
normale Ernährung zu decken!
9. Sonderempfehlungen
___ 184. Essen Sie überwiegend Lebensmittel 8. Bemühen Sie sich, den Nährstoff-
pflanzlichen Ursprungs! bedarf ausschließlich über die
normale Ernährung zu decken!
• Täglicher Verzehr von mind. 5 Portionen
mit mind. insgesamt 400 g Gemüse •K
eine Empfehlung von Nahrungs-
und Obst ergänzungsmitteln
• Verzehr von mind. 25 g Ballastoffen/
9. Sonderempfehlungen
Tag bei einer Zufuhr von relativ unver
arbeitetem Getreideprodukten und/oder •S
äuglinge sollten sechs Monate aus-
Hülsenfrüchten zu jeder Mahlzeit schließlich gestillt werden, auch um
das spätere Krebsrisiko von Mutter
5. Schränken Sie den Verzehr von und Kind zu verringern
rotem Fleisch ein und meiden
•K
rebskranke sollten, wenn es keine
Sie verarbeitetes Fleisch!
andersartigen Empfehlungen gibt, die
• Pro Woche nicht mehr als 500 g Verzehr genannten Empfehlungen für Ernäh-
von Fleisch und Fleischwaren, davon rung, Körpergewicht und körperliche
wenig, wenn überhaupt, verarbeitet Aktivität ebenfalls einhalten.
(geräuchert, gepökelt)
6. Begrenzen Sie den Konsum
alkoholischer Getränke!
• Konsum für Männer: nicht mehr
als zwei Gläser/Tag
• Konsum für Frauen: nicht mehr als ein
Glas/Tag (1 Glas Wein = ca. 10-15 g
reiner Alkohol)
• Kinder und Schwangere sollen Alkohol
meiden
7. Begrenzen Sie den Salzkonsum
und meiden Sie den Konsum von
verschimmeltem Getreide-/Getreide
produkten und Hülsenfrüchten!
• Salzaufnahme von max. 6 g/Tag
• Vermeiden gepökelter, gesalzener oder
salziger Lebensmittel
• Lebensmittel ohne Salz haltbar machen
19 ___3 Mangelernährung bei Tumorpatienten
3.1 D
efinition wiedergibt, ist er für Tumorpatienten kein
guter Parameter zur Bestimmung der
Als Mangelernährung wird ein anhalten- Mangelernährung (vergleiche Kap. 3.5
des Defizit an Energie und/oder Nähr- Diagnose von Mangelernährung). Ein
stoffen im Sinne einer negativen Bilanz Gewichtsverlust ist auch bei adipösen
zwischen Aufnahme und Bedarf mit Tumorpatienten prognostisch ungünstig.
negativen Auswirkungen auf Ernährungs- Ein Gewichtsverlust von 40 % der fettfreien
zustand, physiologische Funktionen und Körpermasse ist mit dem Leben nicht
Gesundheitszustand verstanden. mehr vereinbar.
Neben einem geringen Körpergewicht ist Ein schwerer Gewichtsverlust bei Tumor-
ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust ein patienten wird häufig als „Kachexie“
zentrales Kriterium für Mangelernährung. (griechisch: „schlechter Zustand“) be-
zeichnet. Dieser Begriff ist allerdings un-
Nach einer Definition der Deutschen Ge-
scharf und wird uneinheitlich verwendet.
sellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM)
Einer neueren Definition zufolge besteht
besteht bei Tumorpatienten eine Mangel
eine Kachexie beim Vorliegen eines ödem-
ernährung (engl.: malnutrition) in Form
freien Gewichtsverlustes von mindestens
eines „krankheitsassoziierten Gewichtsver-
5 % in 12 Monaten oder weniger (bei
lustes“, „eines ungewollten, signifikanten
Tumorpatienten 3-6 Monate!) bei einer
Gewichtsverlustes mit Zeichen der Krank-
zugrunde liegenden Erkrankung sowie
heitsaktivität“ („unintended weight loss
dem Vorhandensein von mindestens
wasting“). Ein unbeabsichtigter Gewichts-
drei der folgenden Kriterien:
verlust über 10 % in den vergangenen
6 Monaten gilt als schwere Mangeler- • eine verminderte Muskelkraft
nährung.
• „Fatigue“ (anhaltende Erschöpfung
Ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust und Müdigkeit)
selbst kann Ausdruck der Krankheits-
• „Anorexie“ (Gesamtenergieaufnahme
aktivität beziehungsweise erstes Symp-
unter 20 kcal/kg Körpergewicht und Tag,
tom einer gravierenden Erkrankung sein.
< 70 % der üblichen Nahrungsaufnahme
Auch Personen mit einem normalen oder oder ein schlechter Appetit)
erhöhten BMI können in Zusammenhang • eine geringe fettfreie Körpermasse
mit einem Gewichtsverlust einen klinisch
bedeutsamen Verlust an Magermasse • erhöhte inflammatorische Marker
haben. Da der BMI das Ausmaß einer (CrP > 5,0 mg/dl, IL-6 > 4,0 pg/ml),
Mangelernährung nur unzureichend Anämie (Hb < 12 g/dl) oder erniedrigtes
Serum-Albumin (< 3,2 g/dl)
___ 203.2 Häufigkeit von Der Gewichtsverlust war größer bei Tu-
moren im oberen Magen-Darm-Trakt, im
Mangelernährung bei
fortgeschrittenen Tumorstadium und bei
Tumorpatienten Patienten mit einem schlechten „Perfor-
Die Angaben zur Häufigkeit einer Mangel- mance Status“ (Skala zur Beurteilung des
ernährung bei Tumorpatienten liegen zwi- Allgemeinzustandes von Tumorpatienten).
schen 30 und 90 %, in Abhängigkeit von der Der Bedarf an Ernährungsinterventionen
Art, der Lokalisation und dem Stadium der war besonders hoch bei Speiseröhren-
Tumorerkrankung und der Tumortherapie. und Bauchspeicheldrüsentumoren und
wieder bei Patienten mit schlechtem
Ein ungewollter Gewichtsverlust ist oft der „Performance Status“. Das Ausmaß des
erste Hinweis auf eine Krebserkrankung. Gewichtsverlustes korrelierte gut mit der
Schwere der Appetitlosigkeit (Anorexie)
In der größten europäischen Untersuchung
der Patienten. Die meisten Patienten mit
zum Gewichtsverlust in den sechs Mo-
keinem oder einem Gewichtsverlust unter
naten vor der Diagnosestellung hatten je
10 % waren nicht appetitlos.
nach Tumorart 32 bis 87 % von über 3400
Tumorpatienten an Gewicht verloren. Am In einer großen, multizentrischen deutschen
seltensten an Gewicht verloren hatten die Erhebung zur Häufigkeit der Mangeler-
Patienten mit einer Blutkrebs-Erkrankung, nährung im Krankenhaus nahmen nach
Brustkrebs und Sarkomen, während von den geriatrischen Patienten mit 56 % die
den Patienten mit Tumoren des Magen- Tumorpatienten mit 38 % den zweiten
Darm-Traktes (Bauchspeicheldrüsen-, Rang ein. Eine weitere Untersuchung zum
Magenkarzinome) bis 87 % Gewichtsver- Vorliegen einer Mangelernährung in einem
luste zeigten. Patienten mit Dickdarm-, deutschen Krankenhaus der Maximalver-
Prostata- und Lungentumoren lagen mit sorgung ergab bei 24 % der 1308 unter-
einer Häufigkeit von 54 bis 61 % dazwi- suchten internistischen Patienten Zeichen
schen. Mit einem Gewichtsverlust von einer Mangelernährung. Bei den Patienten
über 10 % vom gesunden Ausgangsge- mit gutartiger Erkrankung lag diese Rate
wicht waren 16 % der Patienten bereits bei 16 %, während 53 % der Tumorpatien-
zum Zeitpunkt der Diagnosestellung ten mangelernährt waren.
schwer mangelernährt.
Im Verlauf ihres Krankenhausaufenthaltes
Vorläufige Ergebnisse einer prospektiven verlieren etwa 45 % der Tumorpatienten
italienischen Untersuchung ambulanter über 10 % ihres Gewichtes.
Tumorpatienten – bisher 1000 Patienten
aus 12 Zentren – ergaben eine schwere In einer Untersuchung von ambulanten
Mangelernährung mit einem Gewichtsver- und stätionären Patienten mit fortgeschrit-
lust von über 10 % bei 40 % der Pati- tenem metastasiertem Tumorleiden war
enten. Bei Anwendung des „Nutritional das häufigste Symptom ein Gewichtsver-
Risk Scores“ (NRS ≥ 3 – siehe Kap. 3.5 lust bei 85 % der Patienten. 71 % dieser
Erfassung und Diagnose von Mangel- Patienten hatten über 10 % ihres Gewichts
ernährung) hatten 34 % der Patienten ein vor der Diagnose der Erkrankung verloren.
Ernährungsrisiko.
21 ___Obwohl bei fortgeschrittener Tumorer- Bei mangelernährten Patienten ist die
krankung die Mehrzahl der Erkrankten humorale und zelluläre Immunantwort ver-
mangelernährt ist, besteht kein eindeutiger mindert, die Infektneigung erhöht und die
Zusammenhang zwischen dem Ernäh- Wundheilung vermindert, was zu vermehr-
rungszustand und der Größe, der Ausbrei- ten Komplikationen durch Wundheilungs-
tung und dem Differenzierungsgrad des störungen, Infektionen und Sepsis sowie
Tumors sowie der Erkrankungsdauer. Somit häufigeren und längeren Krankenhausauf-
ist das Auftreten einer Mangelernährung enthalten und zu höheren Kosten führt.
in jedem Stadium der Erkrankung möglich
und im Einzelfall nicht vorhersehbar. Mangelernährung führt zu einem schlech-
teren Ansprechen auf Chemotherapien, zu
mangelnder Compliance, Therapieunter-
brechungen und dadurch unzureichenden
3.3 Folgen von Mangelernährung Gesamttherapien, wodurch die Sterblich-
bei Tumorpatienten keit steigt und die Prognose der Patienten
sich verschlechtert. Die Überlebenszeit ist
Mangelernährung hat einen ungünstigen signifikant verkürzt.
Einfluss auf die Körperzusammensetzung,
Krankheitshäufigkeit, Sterblichkeit und Gewichtsverlust ist ein eigenständiger
Lebensqualität von Tumorpatienten. Prognosefaktor für die Sterblichkeit bei
Non-Hodgkin-Lymphom, Bronchialkar-
Die bei onkologischen Patienten auftre-
zinom, Mammakarzinom, Kolon- und
tenden Änderungen der Körperzusam-
Prostatakarzinom.
mensetzung unterscheiden sich von den
Veränderungen im Hungerzustand. Im
Mangelernährung ist darüber hinaus mit
Hungerzustand wird vorwiegend Körperfett
Depressionen sowie einer signifikanten
abgebaut und die Muskelmasse bewahrt.
Minderung von Leistungsfähigkeit und
Tumorpatienten verlieren dagegen Kör-
Lebensqualität assoziiert. Mangeler-
perfett- und Körpermagermasse, primär
nährung ist für den Patienten und seine
Skelettmuskelmasse. Organgewebe, vor
Familie auch eine Ursache psychischer
allem das Lebergewebe, bleibt erhalten.
Probleme. Bereits ein Gewichtsverlust
Die intrazelluläre Flüssigkeit nimmt ab, eine
von nur 5 % bei unzureichender Energie-
kompensatorische Zunahme der extra-
und Eiweißaufnahme korrelierte in einer
zellulären Flüssigkeit kann das tatsäch-
Studie signifikant mit einer Minderung der
liche Ausmaß einer Gewichtsabnahme
Lebensqualität. Patienten mit fortgeschrit-
verschleiern, ebenso wie Wassereinlage-
tenen Tumoren, die zu den Erfahrungen
rungen im Rahmen einer Krebsbehandlung
mit ihrer Ernährungssituation und zum
oder Änderungen des Hydratationsstatus,
Grund für die Entscheidung zu einer
zum Beispiel bei Herz-, Leber- und Nie-
heimparenteralen Ernährung (HPN) befragt
reninsuffizienz oder bei schwer Kranken.
wurden, bezeichneten ihre Ernährungs-
Der Verlust an Körperzellmasse führt zu
situation vor der HPN als eine Quelle von
körperlicher Schwäche, Abnahme der res-
„Quälerei und häufiger Verzweiflung“.
piratorischen Muskelfunktion und langfris-
Sie wollten und versuchten zu essen,
tig zu Immobilität.
___ 22waren dazu aber nicht fähig. Die Familie des Magen-Darm-Traktes nahmen in
erlebte Machtlosigkeit und Frustration frühen Tumorstadien (Stadium I und II der
dadurch, dass sie ihren Angehörigen das Erkrankung) lediglich zwischen 20 und 64
Essen nicht ermöglichen konnte. Das kcal/Tag weniger auf als vor der Erkran-
positivste Merkmal der HPN war das kung, in fortgeschrittenen Stadien (III bzw.
Gefühl von Erleichterung und Sicherheit IV) jedoch zwischen 491 und 1095 kcal/
befriedigter Ernährungsbedürfnisse, was Tag weniger. Die Eiweißzufuhr (wünschens-
einen direkten positiven Einfluss auf die werte Eiweißzufuhr bei Tumorpatienten:
Lebensqualität, Gewicht, Energie, Kraft 1,2-1,5 g/kg Körpergewicht und Tag) war
und Aktivität hatte. Diese positiven Effekte im Stadium I und II nur minimal zwischen
der HPN glichen die negativen in Form von 0,2 und 1,0 g/Tag vermindert, im Stadium III
Einschränkungen im Familienleben und und IV allerdings zwischen 64 und 94 g/Tag.
den sozialen Kontakten für die gesamte
Dass auch das Ernährungsmuster von
Familie aus.
Tumorpatienten die Energie- und Nähr-
stoffzufuhr und folglich das Körperge-
wicht beeinflusst, konnte eine kanadische
3.4 Ursachen von Mangeler- Arbeitsgruppe zeigen. Sie untersuchten
nährung bei Tumorpatienten Patienten mit fortgeschrittenen soliden
Tumoren (80 % der Teilnehmer litten an
Die Mangelernährung onkologischer Tumoren der Lunge, des Magen-Darm-
Patienten hat viele Ursachen. Hauptsäch- Traktes, der Brust oder der Prostata), die
lich beteiligt sind eine unzureichende nicht mehr mit Bestrahlung oder Che-
Energie- und Nährstoffaufnahme sowie motherapie behandelt wurden, zuhause
Stoffwechselstörungen auf der Grundlage lebten und dort ihre Speisen auswählten.
von humoralen und entzündungsartigen Die Auswertung der über jeweils drei Tage
(inflammatorischen) Reaktionen. ausgefüllten Essprotokolle ergab drei
unterschiedliche, aber typische Muster für
die Kombination der verzehrten Nah-
3.4.1 Unzureichende Energie- rungsmittel: ein normales Muster, „Fleisch
und Kartoffel“-Typ, einen „Früchte-Weiß
und Nährstoffaufnahme brot“-Typ mit bevorzugt weicher Kost
und einen „Milch und Suppe“-Typ mit
Eine unzureichende Nahrungsaufnahme
bevorzugt flüssiger Kost. Die aufge-
ist bei onkologischen Patienten gut belegt.
nommene Energiemenge variierte von 4
So ergab eine Bestimmung der Energie
bis 53 kcal/kg Körpergewicht und Tag.
zufuhr onkologischer Patienten eine
Zwischen den Ernährungsmustern ergab
mittlere tägliche Energieaufnahme von
sich vom Typ der normalen über die
26 ± 10 kcal/kg und Tag (wünschens-
weiche zur flüssigen Kost eine Abnahme
werte Energiezufuhr bei Tumorpatienten:
der Energieaufnahme von 27 vs. 24 vs. 20
30-35 kcal/kg und Tag), ohne Unterschied
kcal/kg und Tag und eine Zunahme des
zwischen normometabolischen und hyper
Gewichtsverlustes von 11 vs.16 vs. 21 %.
metabolischen Patienten. Patienten mit
Besonders beachtenswert war, dass der
Kopf- und Halstumoren sowie Tumoren
23 ___mittlere Body Mass Index (BMI) in den 3 nahme zum einen durch die Erkrankung
Gruppen vergleichbar war (23,5 vs. 23,8 selbst verursacht sein, z.B. als Folge einer
vs. 22,8 kg/m2), der mittlere Gewichts- direkten Beeinträchtigung durch Obstruk-
verlust in den letzten 6 Monaten jedoch tionen im Mund- und Halsbereich oder im
deutlich unterschiedlich (11 vs. 12 vs. oberen Magen-Darm-Trakt oder infolge
21 %). Die Untersuchung unterstreicht einer durch den Tumor ausgelösten Appe-
die Unzulänglichkeit des BMIs zur Be- titlosigkeit.
stimmung des Ausmaßes einer Mangel
In vielen Fällen führt die Therapie der Tu-
ernährung bei Tumorpatienten.
morerkrankung zu einer unzureichenden
Viele Faktoren tragen dazu bei, dass on- Nahrungsaufnahme. So können Opera
kologische Patienten sehr häufig ungenü- tionen im Bereich von Kopf-, Hals- und
gende Nahrungsmengen zu sich nehmen. Magen-Darm-Trakt in Abhängigkeit vom
So kann eine verminderte Nahrungsauf- Ort und der Ausdehnung des Eingriffs zu
Operation Effekte
Mundhöhle/Hals • Kau- und Schluckstörungen
• Geschmacksstörungen
Speiseröhre • Appetitlosigkeit
• Angst vor dem Essen
• Empfindlichkeit gegen Scharfes und Saures
• Motilitätsstörungen des Magens, Völlegefühl
Magen • Störung von Appetit- und Sättigungsregulation
• Nahrungsmittelaversionen
• Reflux-Ösophagitis
• Dumpingsyndrom
• Milchzuckerunverträglichkeit (Laktoseintoleranz)
• Fettstühle (durch unzureichende Mischung des
Speisebreies mit den Pankreasfermenten)
• Malabsorption: Eisen, Calcium, Zink, Folsäure,
Vitamine B12, C, A, D, E, K, Carotinoide
Bauchspeicheldrüse • Diabetes mellitus
• Maldigestion: Fett
• Malabsorption: Vit. B12, A, D, E, K, Carotinoide
Dünndarm • In Abhängigkeit vom Ort und Ausmaß der Resektion:
bei Resektion von > 50 %: generalisierte Malabsorption
• chologene Diarrhö
• Malabsorption: Vit. B12, A, D, E, K, Carotinoide
• enterale Hyperoxalurie mit Gefahr der Nierensteinbildung
• Blähungen bei unzureichendem Kauen
Dickdarm • Lebensmittelintoleranzen, Diarrhoe
• Wasser- und Elektrolytverluste
Tabelle 2: Ernährungsrelevante Folgen von Operationen
___ 24stattfindende Behandlungen (kombinierte
• Anorexie (praktisch alle Zytostatika)
Radiochemotherapie) und zusätzliche No-
• Geschmacks- und Geruchsstörungen xen (Alkohol und Nikotin) Art und Ausmaß
• Übelkeit, Erbrechen der Nebenwirkungen.
• Nahrungsmittelaversionen Bei den Strahlenreaktionen des Normal-
gewebes unterscheidet man in Abhän-
• Sodbrennen, Blähungen, Völlegefühl
gigkeit vom zeitlichen Verlauf akute und
• Schleimhautentzündungen/ späte, chronische Nebenwirkungen
-ulzerationen (Tabelle 4). Akute Nebenwirkungen
treten innerhalb von 90 Tagen nach
• Abdominalschmerzen
Bestrahlungsbeginn auf, chronische
• Durchfall, Verstopfung, Ileus nach mehr als 90 Tagen. Die Ursachen
• Organschäden: Lunge, Herz, der akuten und späten Nebenwirkungen
Leber, Niere sind unterschiedlich. Akutreaktionen sind
die direkte Folge der Verminderung der
• Sekundär bei Infektionen,
Zahl funktionsfähiger Parenchymzellen
Sepsis, Atemnot
in rasch wachsenden Geweben (Epi-
Tabelle 3: Ernährungsrelevante thelgewebe, Knochenmark). Typische
Nebenwirkungen einer Chemotherapie Akutsymptome nach Strahleneinwirkung
sind Entzündungsreaktionen, Ödembil-
einer Vielzahl von Beeinträchtigungen der dung, Haut- und Schleimhautreaktionen
Nährstoffaufnahme und Nährstoffverwer- sowie spezifische Veränderungen an
tung führen (Tabelle 2). Ebenso können strahlensensiblen Geweben wie Knochen-
Chemo- und/oder Strahlentherapie von mark, Dünndarmepithel und Keimdrüsen.
ernährungsrelevanten Nebenwirkungen Chronische Strahlennebenwirkungen sind
begleitet sein (Tabelle 3, Tabelle 4). die Folge einer irreversiblen Schädigung
gewebstypischer Parenchym-, Endo-
Nebenwirkungen einer Strahlentherapie
thel- oder Bindegewebszellen. Ursächlich
treten in der Regel lokal organbezogen
angesehen werden Veränderungen am
auf (Tabelle 4). Gleichzeitig kann eine
Gefäßbindegewebe und der Durchblu-
Bestrahlung Ursache für allgemeine
tung. Letztere können auch noch nach
Symptome wie Anorexie, Übelkeit, Er-
Jahren auftreten und zeigen häufig einen
brechen, Fieber, Fatigue-Syndrom oder
fortschreitenden Verlauf.
Mangelernährung sein. Dabei besteht eine
ausgeprägte Dosis-Wirkungs-Beziehung Schon vor Beginn der Tumortherapie kann
für das Auftreten von Nebenwirkungen. auch die Lebensführung eines Patienten
Von Bedeutung sind neben der Gesamt- mit einer zu geringen Nahrungszufuhr,
dosis die Einzeldosis, die Fraktionierung, einseitiger Ernährung und einem erhöhten
Art und Anteil mitbestrahlter Organe Nährstoffbedarf Ursache einer Mangeler-
und Gewebe sowie das Bestrahlungs- nährung sein. Besonders gefährdet sind
volumen. Gleichzeitig beeinflussen Alter Patienten mit chronischem Nikotin- und Al-
und Begleiterkrankungen des Patienten, koholkonsum. Schließlich können Schmer-
vorangegangene Therapien, gleichzeitig zen, lange Nüchternphasen im Rahmen
25 ___Akuteffekte Späteffekte
ZNS • Hirndrucksteigerung, Übelkeit, • Hirnnekrose
Erbrechen
HNO • Schleimhautentzündungen • Mundtrockenheit (Xerostomie)
• Speichelveränderungen • Karies
• Mundtrockenheit • vermindertes / fehlendes
• Anorexie Geschmacksempfinden
•G eschmacks- / Geruchsstörungen
• Schluckstörungen
• Laryngitis
• Oesophagitis
Thorax • Oesophagitis • Oesophagitis
• Pneumonitis • Fibrose
• Stenose
• Fisteln
• Lungenfibrose
Abdomen/ • Übelkeit • Ulzera
Becken • Erbrechen • Diarrhoe, Malabsorption
• Diarrhoe • chronische Enteritis
• Meteorismus • Strikturen
• Tenesmen • Obstruktion
• Enteritis • Fisteln
• Zystitis
Endokrinum • Funktionelle Insuffizienz • Endokrine Insuffizienz:
thyreoidal, adrenokortikal,
gonadal
Tabelle 4: Ernährungsrelevante Nebenwirkungen einer Strahlentherapie
der Diagnostik, psychische Faktoren In einer neueren Untersuchung zur Symp
(Angst, Depressionen) und Bewegungs- tomhäufigkeit bei Patienten mit Tumoren
mangel Grund für eine unzureichende in der Lunge und im Magen-Darm-Trakt
Energie- und Nährstoffaufnahme sein. ohne Chemo- und Radiotherapie fand
sich als häufigstes Symptom Appetitlosig-
Viele Faktoren, die die Nahrungsaufnah-
keit bei 38 % der Patienten, gefolgt von
me negativ beeinflussen, sind bereits bei
vorzeitigem Sättigungsgefühl (27 %),
der Diagnosestellung vorhanden. 40 %
Schmerzen (23 %), Geschmacksverände-
der Patienten leiden bereits unter einer
rungen (20 %), Übelkeit (18 %), Mund
Anorexie, 61 % unter einem Völlegefühl,
trockenheit (17 %), Verstopfung (14 %),
46 % unter Geschmacksveränderungen,
Erbrechen und Durchfall (jeweils 11 %),
41 % unter Verstopfung, 40 % unter
Schluckproblemen (9 %), Geruchsstörun-
Mundtrockenheit, 39 % unter Übelkeit
gen (7 %), sowie Mundsoor (1 %).
und 27 % unter Erbrechen.
62 % der Patienten hatten ein oder mehrere
Symptome. Von Symptomen betroffen
___ 26waren alle Patienten mit einem Pankreas- ist sie das Ergebnis eines durch Zytokine
karzinom, 75 % der Patienten mit einem und Serotonin (einem Neurotransmitter)
Tumor im oberen Gastrointestinaltrakt, vermittelten Ungleichgewichts zwischen
66 % der Patienten mit einem Lungentu- zentralen Signalen von Neuropeptid Y
mor und 41 % der Patienten mit kolorek- (appetitfördernd) und Pro-Opiomelano-
talen Tumoren. An Gewicht verloren 48 % cortin (appetithemmend) zu Gunsten von
der Patienten mit gastrointestinalen und Pro-Opiomelanocortin.
19 % mit Lungen-Tumoren. Die meisten
Weitere mögliche Ursachen einer Ano-
appetitlosen Patienten (fast 60 %) waren
rexie sind Nebenwirkungen der Tumor-
Patienten mit Lungentumoren.
therapien, Infekte, Fieber, Schmerzen,
Elektrolytstörungen (Hyperkaliämie,
Anorexie
Hyperkalzämie), Störungen des Säure-
Ein besonderes Problem stellt bei Tumor- Basen-Haushalt, zerebrale Störungen
patienten die Anorexie oder Appetitlosig- (toxisch, entzündlich, tumorbedingtes
keit dar, meist verbunden mit vorzeitigem Hirnödem, Hirnmetastasen), Magen-,
Sättigungsgefühl, Nahrungsmittelaversi- Darm-, Nieren-, Nebennieren-, Leber-
onen sowie Geschmacks- und Geruchs und Lungenerkrankungen sowie endo
störungen, die ebenfalls eng miteinander krinologische Erkrankungen.
in Wechselbeziehung stehen.
Geschmacks- und
In einer Untersuchung bestand bei 40 % Geruchsveränderungen
der Patienten bereits zum Zeitpunkt der
Unter Chemotherapie klagen 36 bis 75 %
Erstdiagnose eine Anorexie. Das Auftre-
der Patienten über Geschmacksverän
ten war abhängig vom Typ und der Lage
derungen in allen Formen. Dabei ist eine
des Tumors sowie dem Stadium der
Hypogeusie (partieller Geschmacksver-
Tumorerkrankung. Von 186 nacheinander
lust) häufig mit einer Dysgeusie (Miss-
aufgenommenen Patienten waren 1/3 der
empfinden des Geschmacks) verbunden.
Patienten mit Lungen- oder Dickdarm-
Zu Geschmacksveränderungen führen
karzinom oder einem Lymphom und alle
hauptsächlich folgende Zytostatika:
Patienten mit einem Tumor im Bereich von
Carboplatin, Cisplatin, Cyclophosphamid,
Speiseröhre, Magen oder Leber betroffen.
Doxorubicin, 5-Fluorouracil, Methotrexat
Die höchste Prävalenz bestand im Spätsta-
und Paclitaxel. Am häufigsten wird unter
dium der Tumorerkrankung, zu 80 % bei
Cisplatin und Doxorubucin über schwere
Patienten mit Speiseröhren- und Magen-
Geschmacksveränderungen berichtet.
karzinomen sowie Lymphomen, zu 30 %
Bei autologer Stammzelltransplantation
bei Patienten mit Tumoren, die nicht den
ist unter Hochdosistherapie ein völliger
oberen Magen-Darm-Trakt betrafen. Beson-
Geschmacksverlust beschrieben.
ders im fortgeschrittenen Stadium einer Tu-
morerkrankung ist die Anorexie signifikant Die Geschmacksveränderungen können
mit dem Ernährungsstatus verbunden. während der Zytostatikagabe auftreten
und von wenigen Stunden bis zu mehre-
Nach neuen Vorstellungen zur Entste-
ren Tagen, Wochen oder sogar Monaten
hung der Anorexie bei Tumorpatienten
27 ___Sie können auch lesen