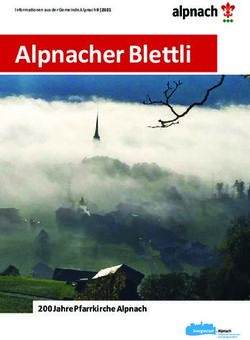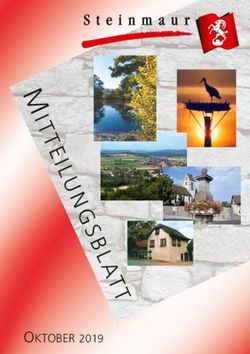Hochwasserschutz für Kommunen - Inhalt - Erläuterungen Thesen Tipps Beispiele - Landkreis Kronach
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
Hochwasserschutz
Praxisratgeber
für Kommunen
Erläuterungen
Thesen
Tipps
Beispiele
Praxisratgeber Hochwasserschutz für KommunenDem Arbeitskreis „Hochwasserschutz“
beim Bayerischen Gemeindetag gehören an:
Herausgeber: Bayerischer Gemeindetag Dr. Jürgen Busse
Bayerischer Gemeindetag, München Dr. Franz Dirnberger
Zeichnung: Werner Schmid (Leiter des Arbeitskreises)
Marion Kipfelsberger, Grafing
Papier: Bayerisches Staatsministerium für Stephan März
Umschlag elementar chlorfrei Landesentwicklung und Umweltfragen Andreas Holderer
Innenteil aus 100 % Altpapier
Katrin Horn
Druck und grafische Gestaltung: Dr. Günther Knopp
kelly-druck GmbH, Abensberg
Karl Schindele
Bezugshinweis: Theo Schlaffer
Bayerischer Gemeindetag
Dreschstraße 8 Hans-Joachim Weirather
80805 München
Telefon 089/360009-0
Telefax 089/365603 Bayerisches Staatsministerium für Ingeborg Bauer
www.bay-gemeindetag.de Ernährung, Landwirtschaft, Forsten Dr. Paul Dosch
baygt@bay-gemeindetag.de
Wolfgang Ewald
BayGT, München Josef Wein
Oktober 2003
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck Bayerisches Staatsministerium des Innern Hans Ellmayer
und Wiedergabe nur mit Genehmi-
gung des Herausgebers. Bernd Zaayenga
Oberste Baubehörde Thomas Engel
im Staatsministerium des Innern
Landesamt für Wasserwirtschaft Karlheinz Kraus
Gemeinden
Stadt Miltenberg Joachim Bieber, 1. Bürgermeister
Markt Schmidmühlen Peter Braun, 1. Bürgermeister
Stadt Tittmoning Dietmar Cremer, 1. Bürgermeister
Markt Frickenhausen Ludwig Hofmann, 1. Bürgermeister
Markt Regenstauf Dagobert Knott, 1. Bürgermeister
Stadt Schrobenhausen Josef Plöckl, 1. Bürgermeister
Gemeinde Stockheim Albert Rubel, 1. Bürgermeister
Gemeinde Neuhaus a. Inn Josef Schifferer, 1. Bürgermeister
Stadt Windsbach Wolfgang Seidel, 1. Bürgermeister
Markt Diedorf Otto Völk, 1. Bürgermeister
Bayerische Versicherungskammer Wolfgang Raab
Finanzielle Unterstützung durch
Bayerische Versicherungskammer
und Bayerisches Staatsministerium des Innern
2Vorwort
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
manch eine(r) von Ihnen mag im ersten Augenblick denken: Schon wie-
der eine Broschüre? Wer soll dies lesen?
Es ist nicht unsere Absicht, die oft beklagte „Informationsflut“ mit einer
schön bebilderten, aber inhaltsarmen Hochglanzbroschüre weiter anzu-
reichern. Es ist uns an einem aktiven „Mehrwert“ für Sie gelegen.
Das verheerende Hochwasser im August 2002 war für uns der aktuelle
Anlass, verbandspolitisch zu handeln und einen Arbeitskreis Hochwas-
serschutz ins Leben zu rufen. Auftrag und Ziel bestanden darin, einen
Praxisratgeber „Hochwasserschutz für Kommunen“ zu erstellen. Aus dem Blickwinkel des kommunalen
Praktikers sollte den Fragen nachgegangen werden:
• Was kann ich als Gemeinde beim Hochwasserschutz tun?
• Wer hilft mir dabei?
• Wie setze ich die Planungen fachlich um?
• Wie kann ich die Umsetzung finanzieren?
Der Ratgeber setzt seinen Schwerpunkt auf Maßnahmen an Gewässern 3. Ordnung, für deren Unterhal-
tung und Ausbau die Gemeinden zuständig sind. Das Thema Hochwasserschutz ist so vielfältig, dass
manche Aspekte nur angerissen werden konnten. Wegen der akuten Finanznot von Staat und Kommu-
nen kann auch keineswegs alles, was wünschenswert ist, umgesetzt werden. Selbst die Umsetzung der
als notwendig erkannten Maßnahmen wird seine Zeit brauchen. Nicht verantwortbar wäre es jedoch,
untätig zu verharren. Der Ratgeber soll dazu beitragen, dass dies nicht passiert.
Mein Dank gilt dem Arbeitskreisleiter Direktor Werner Schmid und den Mitgliedern des Arbeitskreises
Hochwasserschutz für ihre engagierte Mitarbeit und ihre Beiträge, dem Bayerischen Staatsministerium
des Innern und der Bayerischen Versicherungskammer für die gewährte finanzielle Unterstützung.
In der Erwartung, dass der Leitfaden Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt
Ihr
Dr. Uwe Brandl
Präsident des Bayerischen Gemeindetags
3Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
– Anlass, Ziele und Schwerpunkte des Praxisratgebers
– Aufbau und Struktur des Ratgebers
– Gefahrenlage bei großen Flüssen (Gew I)
– Gefahrenlage bei mittleren Flüssen (Gew II)
– Gefahrenlage bei Gewässern mit kleinen Einzugsgebieten (Gew III)
– Konsequenzen in Thesenform
II. Krisenmanagement bei Hochwasser
– Einführung
1. Wettervorhersage und Warnungen
– fachliche und rechtliche Grundlagen
– Konkretisierung des Vorhersagegebietes, landkreisgenaue Warnungen
– Einführung des Vorhersagesystems KONRAD für die bayerischen Katastrophenschutzbehörden
– Einbindung der Gemeinden in das Unwetterwarnsystem
– Unwetter-Frühwarnsystem der Versicherungskammer Bayern
2. Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr
– Entwurf künftiges Unwetterwarnsystem in Bayern
3. Hochwassernachrichtendienst
– Aufgaben der Gemeinden im Hochwassernachrichtendienst
– Entwicklungen im Hochwassernachrichtendienst
– Muster eines gemeindlichen Melde- und Einsatzplanes
III. Nachhaltiger integrierter Hochwasserschutz – Maßnahmen des Staates
– Einführung
1. Überschwemmungsgebiete
– planerische Grundlagen und Verfahren
– Beispiel einer kartografischen Darstellung
2. Vorranggebiete für Hochwasser in Regionalplänen
– Grundlagen und Verfahren
– Beispiel aus einem Regionalplan
3. Ermittlung und Bereitstellung von Basisdaten
IV. Nachhaltiger integrierter Hochwasserschutz – Maßnahmen der Gemeinden
– Einführung
1. Gewässerentwicklung: Planen und Ausführen
– Erhaltung und Wiederherstellen naturnaher Zustände an Gewässern und ihren Auen
– Bedeutung einer qualifizierten Planung
– Reduzierung des Unterhaltungs- und Pflegeaufwands
– Schrittweises Vorgehen
– Planungsablauf
2. Baulicher Hochwasserschutz
– Palette möglicher Maßnahmen
– Beispiel eines Rückhaltebeckens Hausen
43. Hochwasserschutz in der Bauleitplanung
– Bindung der Bauleitplanung durch Ziele der Raumordnung und förmlich festgesetzte
Überschwemmungsgebiete
– Hochwasserschutz in der bauleitplanerischen Abwägung
– Hochwasserschutz und Flächennutzungsplan
– Hochwasserschutz und Bebauungsplan
– Darstellung in Flächennutzungsplan am Beispiel des Marktes Diedorf
4. Interkommunale Zusammenarbeit
– verschiedene Modelle
– Praxisbeispiele aus dem Landkreis Cham und dem Landkreis Aichach-Friedberg
V. Umsetzung und Finanzierung eines kommunalen Hochwasserschutzkonzepts
sowie von Maßnahmen an Gew III
– Einführung
1. Förderung über die Wasserwirtschaftsverwaltung
2. Förderung über die Verwaltung ländliche Entwicklung
– Regionale Landentwicklung
– Flurneuordnung
– Dorferneuerung
3. Förderung der Flächennutzung für die Land- und Forstwirtschaft
– Landwirtschaft
– Forstwirtschaft
4. Refinanzierung gemeindlicher Aufwendungen
5. Gemeinsames Informationsblatt von Umwelt- und Landwirtschaftsministerium:
Schwerpunktprogramm aktiver Wasserrückhalt in der Fläche
VI. Kommunale Haftung und Versicherbarkeit kommunaler Risiken
1. Kommunale Haftung
2. Gebäudeversicherung gegen Hochwasserschäden
3. ZÜRS – Risikoanalyse als Voraussetzung für Hochwasserversicherung
VII. Bürger und Kommunen – effiziente Öffentlichkeitsarbeit
am Beispiel des Marktes Diedorf
1. Ausgangslage
2. Aus Betroffenen werden Beteiligte
3. Die Öffentlichkeitsarbeit im Einzelnen
4. Fazit der Gemeinde
5. Eigenverantwortung der Bürger
VIII. Kommunaler Klimaschutz
1. Klima- und energiegerechte städtebauliche Planung
2. Ökologische Bestandssanierung
3. Ökologische Energieversorgung in kommunaler Verantwortung
IX. Veröffentlichungen, Quellenverzeichnis und weitere Informationen
5I. Einleitung
Anlass, Ziele und Schwerpunkte der bauliche und technische Schutz vernachlässigt
des Praxisratgebers werden dürfen.
Der Ratgeber versucht deshalb, die ganze Band-
breite des kommunalen Hochwasserschutzes abzu-
decken, wobei Entstehung, Ursachen und Erschei-
nungsformen von Hochwässern nur angerissen wer-
den können.
Aufbau und Struktur des Ratgebers
Der Aufbau des Praxisratgebers geht vom Konzept
eines integrierten Hochwasserschutzes aus. Hierzu
gehören als Handlungsfelder die 3 Kernbereiche:
Überschwemmung in Neustadt an der Donau Natürlicher Wasserrückhalt/vorbeugender
Hochwasserschutz
Unter dem Eindruck des Augusthochwassers 2002
haben wir als Bayerischer Gemeindetag im Septem- Technischer Hochwasserschutz
ber 2002 einen Arbeitskreis Hochwasserschutz ein-
gerichtet. Wir wollten – nicht zuletzt wegen der Weitergehende Hochwasservorsorge.
Dimension der Überflutungen und der Schäden –
auch verbandspolitisch Handlungsbedarf signali- Im Text der Kapitel III und IV wird zwischen den
sieren. Maßnahmen des Staates und den Handlungsmög-
lichkeiten der Gemeinden unterschieden.
Der Arbeitskreis steckte sich die Ziele, Schwachstel-
len beim Hochwassermanagement zu analysieren, Die Möglichkeiten, wie ein integriertes Hochwas-
kommunalspezifische Handlungsmöglichkeiten auf- serschutzkonzept umgesetzt und finanziert wer-
zuzeigen und einen Praxisratgeber als Arbeitshilfe den kann, werden in Kapitel V beschrieben. Umwelt-
für die Kommunen zu entwickeln. und Landwirtschaftsministerium bieten den
Gemeinden als Hilfestellung eine umfassende „Ein-
Der Schwerpunkt sollte dabei bei den Gewässern stiegsberatung“ an. Ausführlich werden im Kapitel
3. Ordnung (Gew III) liegen. Die kreisangehörigen V auch die verschiedenen Fördermöglichkeiten dar-
Gemeinden sind in Bayern für die Unterhaltung und gestellt.
den Ausbau von mehr als 60.000 Kilometern Fließ-
gewässer zuständig. Die bisherigen „Hilfen“ für die Diesen Fachkapiteln vorangestellt ist die Darstel-
Gemeinden waren spärlich. Kommunalpolitiker, aber lung eines wirksamen Krisenmanagements, um
auch Verwaltungen sollten deshalb Informationen, die Gefahren und Auswirkungen – unvermeidba-
Tipps und Handlungsempfehlungen mit Beispielen rer – Hochwässer zu mindern. Hervorzuheben
erhalten, die auf ihre Bedürfnisse, ihre Strukturen sind insbesondere die Verbesserungen bei Wet-
und ihre Aufgaben zugeschnitten sind. tervorhersagen- und -warnungen sowie die Ein-
bindung der Gemeinden in das Unwetterwarn-
In den Arbeitskreis wurden „hochwassererfahrene“ system.
Bürgermeister aus allen Regierungsbezirken beru-
fen. Vertreter der Staatsministerien des Innern, für Angereichert werden diese Aussagen durch Infor-
Landwirtschaft und Forsten sowie für Landesent- mationen und Empfehlungen zur interkommuna-
wicklung und Umweltfragen und des Landesamts len Zusammenarbeit, zu Fragen der kommunalen
für Wasserwirtschaft bereicherten die „Ideenschmie- Haftung und Versicherbarkeit sowie zur Öffentlich-
de“ mit ihrem Sachverstand. keitsarbeit, dargestellt am Beispiel des Marktes
Diedorf.
Hochwasserschutz ist ein komplexes Thema. Viel
zu kurz griffe deshalb die Reduzierung des Ratge- Schließlich betont der Ratgeber den Zusammen-
bers auf technische Maßnahmen. Der Vorbeugung hang zwischen Hochwasserschutz und Klimaschutz.
kommt zentrale Bedeutung zu, ohne dass jedoch Wichtig ist aktives klimarelevantes Handeln gera-
6 Einleitungde der Gemeinden, Märkte und Städte, auch wenn wässer auf die Hochwasserentwicklung der gro-
Maßnahmen nur langfristig greifen. Beispielhaft ßen Flüsse verdeutlicht.
werden deshalb auf kommunaler Ebene Handlungs-
möglichkeiten aufgezeigt. An den großen Flüssen befinden sich zudem alle
dringlichen Maßnahmen des technischen Hoch-
Immense Schäden durch Hochwasser entstehen wasserschutzes im Stadium der Planung bzw.
vor allem bei großflächigen Überschwemmungen Umsetzung. Die künftige Vorsorge konzentriert sich
an den großen Flüssen. Nachfolgend wird auf die auf die Schaffung zusätzlicher Retentionsräume.
aktuelle Gefahrensituation eingegangen. Gleich- Großvolumige steuerbare Flutpolder spielen dabei
zeitig wird die Gefahrenlage an den mittleren Flüs- eine wesentliche Rolle. Die räumliche Konzentra-
sen und den Gew III beleuchtet, vor allem um die tion auf wenige Gemeinden mit Auswirkungen auf
Zusammenhänge der Gesamthochwasserentwick- ihre Entwicklungsmöglichkeiten und der hohe Flä-
lung aufzuzeigen. chenbedarf führen allerdings teilweise zu Akzep-
tanzproblemen.
Gefahrenlage bei großen Flüssen (Gew I)
Gefahrenlage bei mittleren Flüssen (Gew II)
Die Einzugsgebiete dieser Gewässer sind zwar im
Vergleich zu Main und Donau kleiner, die Hochwas-
sergefahr ist jedoch keineswegs geringer. Gerade
Voralpen- und Mittelgebirgsflüsse können beson-
ders im Frühjahr und Sommer aufgrund der spezi-
fischen Wetter- und Klimasituationen sehr rasch
Hochwässer aufbauen. Besondere Bedeutung
kommt deshalb für die an diesen Gewässern von
Überschwemmungen betroffenen Kommunen
Überschwemmung in Neustadt an der Donau einem funktionierenden Frühwarnsystem zu.
Hochwässer an den großen bayerischen Flüssen
Donau (z. B. 1988, 1999 und 2002) und Main (z. B. Gefahrenlage bei Gewässern mit kleinen
1995) haben Tradition. Bilder der überschwemm- Einzugsgebieten (Gew III)
ten Stadt Passau gehören nach schweren Regen-
fällen zur Standardberichterstattung in den
Medien und zeigen den Handlungsbedarf deutlich
auf. Die bisherigen Investitionen in den baulichen
Hochwasserschutz konnten bei den letzten Hoch-
wässern noch höhere Schäden in Bayern verhin-
dern, auch wenn die Schadenshöhe beim August-
hochwasser 2002 immerhin ca. 185 Mio. Euro Scha-
den betrug. Die großen Einzugsgebiete insbeson-
dere der Donau, die zahlreichen Zuflüsse mit der
Gefahr großer Abflusssteigerungen und die jah-
reszeitlich bedingten Abflussszenarien erschwe-
ren ein Beherrschen der Wassermassen gerade bei
lang anhaltenden Regenfällen oder bei langem
Tauwetter, so dass auch in Zukunft Überschwem-
mungen größeren Ausmaßes drohen. Zudem lie-
gen sowohl an Donau als auch am Main große Bei Gewässern mit kleinen Einzugsgebieten stel-
Siedlungsschwerpunkte wie Regensburg, Passau len vor allem kurze, sehr kräftige Regengüsse eine
oder Würzburg, die aufgrund ihrer Nähe zum Fluss Gefahr dar. In kurzer Zeit kommt es häufig zu enor-
stets gefahrenträchtig bleiben werden. Gerade die men Abflusssteigerungen. Die Rückhalte- und
Ereignisse 1999 und 2002 haben auch den erheb- Abflusskapazitäten der Bäche und Flüsse sind dann
lichen Beitrag der Abflusssituation der Seitenge- meist schnell erschöpft. Erhebliche Gefahrenlagen
Einleitung 7und überproportional hohe Schäden können dann als abflussbeschleunigend und damit besonders
die Folge sein. Paradebeispiel ist die Gemeinde Die- für die Unterliegergemeinden als zusätzliche
Kapitel VII, Seite 34 dorf im Landkreis Augsburg im Jahr 2002 mit drei Gefährdung auswirkt.
getöteten Personen und 3,2 Mio. Euro Schaden.
Ausreichend genaue und rasche Vorhersagen der Die hautnahe Betroffenheit der Gewässeranlieger
Hochwasserentwicklung sind oft nicht möglich und und die Zuständigkeit für die Unterhaltung und den
stellen die Anliegergemeinden vor große Proble- Ausbau der Gew III fordert die Gemeinden in beson-
me. Eine „hausgemachte“ Ursache für besondere derem Maße. Dies ist jedoch auch eine Chance, da
Gefahrenlagen stellt die Bebauung hochwasserge- eine wirksame kleinräumige Vorsorge und Schutz-
fährdeter Flächen dar. Auch die Gewässer selbst maßnahmen von den Betroffenen unmittelbar
wurden häufig wenig naturnah ausgebaut, was sich erlebt werden.
Konsequenzen in Thesenform
Aus der Sicht des Arbeitskreises haben die vergangenen Ereignisse vor allem folgendes gezeigt:
Hochwässer können nicht verhindert, aber in ihren Wirkungen abgemildert werden
Das Vorsorgedenken und –handeln muss verstärkt werden
Anstelle isolierter Maßnahmen sind ein Denken in Einzugsgebieten und integrierte Hochwasser-
konzepte gefragt
Hochwasser macht nicht vor Gemeindegrenzen Halt – solidarisches Verhalten und interkommunale
Zusammenarbeit sind unverzichtbar
Präzisere Unwetterwarnungen und die Aktualisierung von Meldeplänen sind wichtige Bausteine
eines wirksamen Krisenmanagements
Zusätzliche Messpegel und Niederschlagsabflussmodelle können auch für Gewässer dritter Ord-
nung wichtige Hilfsmittel sein
Eine integrierte Gewässerentwicklungsplanung stellt eine gute Basis für effektive Hochwasser-
schutzmaßnahmen dar
Gemeinden brauchen funktionierende Instrumente, um ihre Aufwendungen verursachergerecht
umlegen zu können
Staatliche Haushaltsmittel sind verstärkt für Planungen und Maßnahmen an Gewässern dritter
Ordnung einzusetzen
Eine gezielte kommunale Öffentlichkeitsarbeit erhöht die Akzeptanz bei den Betroffenen
8 EinleitungII. Krisenmanagement bei Hochwasser
Den folgenden Fachkapiteln zur weitergehenden
Hochwasservorsorge vorangestellt wird das wich-
tige Kapitel Krisenmanagement. Sein Funktionie-
ren ist eine Grundvoraussetzung für eine spätere
Schadensminderung und eine effektive Schadens-
abwehr. Parallel entwickelt und mitbeeinflusst
durch den Arbeitskreis Hochwasserschutz sind
wichtige Neuerungen bei der Unwettervorhersa-
ge und Unwetterwarnung bereits umgesetzt oder
in Entwicklung. Auch der Hochwassernachrichten-
dienst wird fortentwickelt. Im Bereich Katastro-
phenschutz werden die Strukturen für eine stärke-
re Einbindung der Gemeinden gerade geschaffen.
Die verheerenden Hochwasser der letzten Zeit
(Pfingsthochwasser 1999 und Augusthochwasser
2002) haben verdeutlicht, dass der Katastrophen-
schutz zwar gut vorbereitet war, aber auch die Not-
wendigkeit aufgezeigt, die Gemeinden in das
Unwetterwarnsystem einzubinden und auf örtlicher
Ebene bei Bedarf entsprechende Katastrophen-
schutz-Sonderpläne aufzustellen. Fachliche und rechtliche Grundlagen
Es hat sich zudem erwiesen, dass ein erfolgreiches Das Bayerische Staatsministerium des Innern hat
Krisenmanagement in besonderem Maße von in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetter-
dienst (DWD), Regionalzentrale München, in den
– einer rechtzeitigen und fundierten Information letzten Jahren in Bayern ein umfassendes Unwet-
bzw. Warnung sowie terwarnsystem aufgebaut. Der DWD nutzt hierzu
– einer vorbereiteten Katastrophenschutz-Sonder- einen leistungsfähigen Faxverteiler. Während und
planung abhängig ist. außerhalb der Dienstzeiten informiert er die vor-
aussichtlich betroffenen Katastrophenschutz-
behörden, die Polizei, das Technische Hilfswerk, das
1. Wettervorhersage und Warnungen Bayerische Rote Kreuz, die Forstdirektionen und
die Bundeswehr. Innerhalb von wenigen Minuten
Unwetter kommen für die Betroffenen oft über- werden so alle wichtigen Stellen erreicht, die dann
raschend, aber keineswegs aus heiterem Himmel. Die diese Warnungen in eigener Zuständigkeit bewer-
Profis der Wetterdienste erfassen das Gewitter bereits ten und umsetzen können. In der Anlage wird in
in der Entstehungsphase. Für einen funktionierenden einem Entwurf das künftige Unwetterwarnsystem
Unwetterwarndienst stellen sich folgende Fragen: in Bayern dargestellt. Kapitel II, Seite 12
– Wie wird sich das Gewitter entwickeln?
– Wohin wird es zielen? Die Bevölkerung wird vor Unwettern bayernweit
– Wie können die betroffenen Gebiete rechtzeitig über den Rundfunk gewarnt. Dies geschieht durch
gewarnt werden? den Deutschen Wetterdienst unter Nutzung des
– Wie können die Gemeinden in das Warnsystem Verkehrswarndienstes. Geregelt ist das Verfahren
eingebunden werden? durch Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern vom 19. April 1991, Nr. I
Diese recht einfachen Fragen sind wegen der Kom- D 4 – 3041/1 1c/71 (AllMBl. S. 362).
plexität des Wettergeschehens eine große Heraus-
forderung für alle Beteiligten. Das Unwetterwarnsystem orientierte sich in der Ver-
gangenheit vor allem an den Aufgaben und Bedürf-
Gerade für Gew III besteht für präzise Vorhersagen nissen der Katastrophenschutz- und Sicherheitsbe-
ein besonderer Bedarf, da dort häufig Beobach- hörden. Sie müssen die notwendigen Maßnahmen
tungspegel nicht vorhanden sind und auch nicht vorbereiten oder einleiten, um Personen- oder Sach-
eingerichtet werden können. schäden zu vermeiden oder zu vermindern. Die gro-
Krisenmanagement 9ßen Schäden der Unwetterereignisse des Jahres Hohenpeißenberg entwickeltes System für die
2002 sind Anlass für das Innenministerium, zusam- Gewittervorhersage. Es handelt sich um ein de-
men mit dem DWD an einer Fortentwicklung und tailliertes radargestütztes Gewitterdiagnose- und
Verbesserung des Verfahrens zu arbeiten. -prognosesystem, das insbesondere auf die Über-
Schwerpunkte sind dabei die Verbesserung der „Tref- wachung von Gewitterlagen ausgelegt ist. Aus
fergenauigkeit“ von Unwetterwarnungen, die Kon- den Daten von 16 Radarmessgeräten des Deut-
kretisierung des Vorhersagegebiets und die Einbin- schen Wetterdienstes berechnet KONRAD zuver-
dung der Gemeinden in das Unwetterwarnsystem. lässige Prognosen über den Fortgang des Unwet-
ters für die nächste halbe Stunde und stellt dies
am PC-Bildschirm dar. Mit dem System können die
Konkretisierung des Vorhersagegebietes, Auswirkungen eines starken Gewitters bzw. Stark-
landkreisgenaue Warnungen regens mehr ortsbezogen und genauer dargestellt
werden. Nach einer Testphase bei verschiedenen
Hierzu hat der DWD zunächst in seinem Internet- Katastrophenschutzbehörden und Feuerwehren
auftritt die Vorhersagegebiete kleinräumiger gestal- wurden im Juni diesen Jahres in Zusammenarbeit
tet und die Warnung auf die betroffenen Landkrei- mit dem Deutschen Wetterdienst die Vorausset-
se abgestellt. In Kürze soll diese landkreisgenaue zungen geschaffen, allen bayerischen Katastro-
Warnung auch dem vorgenannten Unwetterwarn- phenschutzbehörden den Zugang zu KONRAD zu
system zu Grunde gelegt werden, so dass jeweils ermöglichen. KONRAD schafft eine noch bessere
nur die voraussichtlich von einem Unwetter bedroh- Grundlage für abgestimmte und kurzfristige Alar-
ten Landkreise über Fax vom Deutschen Wetter- mierungs-, Warn- und Einsatzmaßnahmen. Dies
dienst gewarnt werden, statt wie bisher ganze sollte für Gemeinden Anlass sein, die Aufstellung
Regionen oder Regierungsbezirke. Dadurch ist eine eines Katastrophenschutz-Sonderplans Unwetter
bessere und deutlich höhere „Treffergenauigkeit“ einschließlich der Alarmierungsplanung für die
der Unwetterwarnungen zu erwarten. benötigten Einheiten, Personen und sonstige Stel-
len zu prüfen.
Einführung des Vorhersagesystems KONRAD Die bayernweite Einführung von KONRAD ent-
für die bayerischen Katastrophenschutzbehörden spricht sowohl einem Beschluss des Bayer. Land-
tags als auch Forderungen des Arbeitskreises Hoch-
Das System KONRAD (= Konvektionsentwicklung wasserschutz des Bayerischen Gemeindetags sowie
in Radarprodukten) ist ein beim Observatorium des Bayerischen Städtetags.
KONRAD – Prognose eines Unwetterverlaufs
10 KrisenmanagementEinbindung der Gemeinden die Alarmierungskarte Unwetter aus und informiert
in das Unwetterwarnsystem auf diese Weise die Ansprechpersonen bzw. -stel-
len aller Gemeinden in ihrem Zuständigkeitsbe-
Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdien- reich über die Unwetterwarnung. Telefongesprä-
stes erreichen bisher direkt und schnell die Bevöl- che sind häufig zeitaufwändig. Die o. g. Ansprech-
kerung sowie die betroffenen Katastrophenschutz- personen bzw. -stellen sollten deshalb für die Ent-
behörden (Kreisverwaltungsbehörden, Regierun- gegennahme von Unwetterwarnungen mit Funk-
gen, Bayerisches Staatsministerium des Innern), meldeempfängern ausgestattet sein.
die Polizei, das Technische Hilfswerk, das Bayerische
Rote Kreuz, die Forstdirektionen und die Bundes-
wehr. Unwetter-Frühwarnsystem
der Versicherungskammer Bayern
Die Erfahrungen der Unwetter aus den letzten Jah-
ren haben jedoch deutlich gemacht, dass auch auf Neben dem oben dargestellten amtlichen Unwet-
Gemeindeebene wesentliche Schutz- und Vorkeh- terwarnsystem stellt die Versicherungskammer
rungsmaßnahmen schnell und zielführend mög- Bayern versicherten Personen und Kommunen auf
lich sind. Im Regelfall weiß nur die Gemeinde, ob Wunsch ein Unwetter-Frühwarnsystem zur Verfü-
auf ihrem Gebiet Veranstaltungen (z. B. Jugendzelt- gung, das auf der gleichen Datengrundlage, näm-
lager, Märkte u. ä.) stattfinden oder Örtlichkeiten lich den 16 Radarstationen des Deutschen Wetter-
bestehen, die in besonderem Maße anfällig für ein dienstes, aufgebaut wurde. Durch den ständigen
sich näherndes Unwetter sind. Es ist daher erfor- Einsatz einer Unwetterwarnzentrale, die Nutzung
derlich, auch die Gemeinden in das Unwetterwarn- zusätzlicher Wetterstationen und einer speziellen
system einzubinden und sie über die Unwetter- Prognosesoftware werden auch kleinräumige und
warnungen zu informieren. Dazu müssen die ortsgenaue Vorhersagen ermöglicht. Dieses System
Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdien- kann das amtliche Unwetterwarnsystem ergänzen
stes in geeigneter Form und zeitgerecht auch an und bietet vor allem die Möglichkeit einer aktiven
zuständige Stellen in der Gemeinde gelangen. Die- Zustellung von Warnmeldungen an einzelne Per-
se Information kann für die Gemeinde von Bedeu- sonen.
tung sein, um im Einzelfall auch als örtliche Sicher-
heitsbehörde handeln zu können. Auf das Thema Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurde das
Haftung wird in Kapitel VI näher eingegangen. Unwetterwarnsystem „WIND“ (Weather Informa-
tion On Demand) durch die Versicherungskammer
Art. 6 LStVG Bayern realisiert und nach dem Test durch Kunden
Die Gemeinden… haben als Sicherheitsbehör- zur Anwendungsreife gebracht. Die Versicherungs-
den die Aufgabe, die öffentliche Sicherheit und kammer Bayern bietet ihren kommunalen Kunden
Ordnung durch Abwehr von Gefahren und gebührenpflichtig über Internet den Zugang zu
durch Unterbindung und Beseitigung von Stö- einem geschützten Bereich, in dem ausführliche
rungen aufrecht zu erhalten. Warnungen und Radarvorhersagen enthalten sind.
Zur Unterstützung von Hochwasservorhersagen
werden in diesem System auch Gebietsniederschlä-
Hierzu wird im Laufe des Jahres 2003 die Unwet- ge ausgewiesen und vorhergesagt. Zusätzlich kön-
terwarnung in das System der Alarmierung im nen Warnungen auch aktiv zugestellt werden (SMS,
Brand- und Katastrophenschutz eingebunden. Fax, Pager). Über ein Nutzerprofil im Internet kön-
nen diese Abonnements ständig aktualisiert und
Jede Kreisverwaltungsbehörde erstellt hierzu im angepasst werden.
Rahmen ihrer Alarmierungsplanung im Brand- und vgl. Entwurf Künftiges
Katastrophenschutz eine so genannte „Alarmie- Unwetterwarnsystem in
rungskarte Unwetter“ in die jede Gemeinde einge- Bayern, Seite 12
bunden wird. Die Gemeinde benennt hierfür eine
Ansprechperson oder -stelle (z. B. Bürgermeister,
Gemeindemitarbeiter, Feuerwehr, Bauhof, nachalar-
mierende Stelle), die Unwetterwarnungen entge-
gen nimmt. Geht eine Unwetterwarnung bei der
jeweiligen erstalarmierenden Stelle ein, löst diese
Krisenmanagement 112. Katastrophenschutz und Gefahrenabwehr wetter zum Schutz der Bevölkerung und von Sach-
werten daran anschließt. Jede Gemeinde sollte des-
Eine Unwetterwarnung kann erst dann ihren vol- halb auf ihrem Gebiet die bereits bekannten, sowie
len Zweck erfüllen, wenn ein auf das örtlich vor- die künftig denkbaren Auswirkungen von Unwet-
handene Gefahrenpotenzial abgestellter und vor- tern erfassen und analysieren. Ergibt sich dann ein
bereiteter Katastrophenschutz-Sonderplan Un- entsprechendes Gefahrenpotential, sollten die not-
Entwurf
Künftiges Unwetterwarnsystem
in Bayern
12 Krisenmanagementwendigen und möglichen Einsatzmaßnahmen ein- über die verfügbare Informationen rasch weiter-
schließlich der Alarmierungsplanung abgestimmt, gegeben werden können.
festgelegt und vorbereitet werden.
Rechtsgrundlagen:
Nach Eingang einer Unwetterwarnung bei der Art. 67 Bayerisches Wassergesetz
Ansprechperson bzw. -stelle der Gemeinde ent-
Verordnung über den Hochwassernach-
scheidet diese Person oder Stelle, ob und – bei
abgestuften Planungen – welche Stufe des Kata- richtendienst (HNDV) vom 23.05.1990 (GVBl.
S. 159)
strophenschutz-Sonderplans ausgelöst werden soll
und verständigt dann die jeweils zuständige alar- Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
mierende Stelle im Brand- und Katastrophenschutz ministeriums des Innern vom 04.01.1991, Nr.
zur Durchführung der entsprechenden Alarmie- II E 3 - 4502.505 - 001/90 zum Vollzug der Ver-
rung. ordnung über den Hochwassernachrichten-
dienst (VBHNDV)
Die Gemeinden werden hierbei in ihrer Eigenschaft
als untere Sicherheitsbehörden gem. Art. 6 LStVG tätig.
Gemeindebezogene Katastrophenschutz-Sonder-
pläne Unwetter können auch durch die Katastro-
phenschutzbehörde bzw. den Ansprechpartner Füh-
rungsgruppe Katastrophenschutz – FüGK – aus-
gelöst werden.
Das Konzept zur Erstellung der oben dargestell-
ten Katastrophenschutz-Sonderplanungen Un-
wetter wird im Laufe des Jahres 2003 durch das
Bayer. Staatsministerium des Innern in Abstim-
mung mit den beteiligten Stellen eingeführt. Es
soll auch ein Muster eines Katastrophenschutz-
Sonderplans Unwetter mit Hinweisen veröffent-
licht werden.
3. Hochwassernachrichtendienst
Wenn große Niederschlagsmengen niedergehen,
ist erhöhte Aufmerksamkeit geboten. An den gro-
ßen und meisten mittleren Flüssen können der
Wasserstand und die Hochwasserentwicklung
gemessen werden. Hierfür existiert ein organisier-
tes Meldesystem mit Pegeln und Meldestellen, der
Hochwassernachrichtendienst (HND). Er hat die
Aufgabe, betroffene Landkreise, Gemeinden, Bevöl-
kerung und die Verantwortlichen rechtzeitig und
auf kurzen Wegen über die Hochwasserentwick-
lung zu informieren.
An Gew III sind nur vereinzelt Messpegel eingerich-
tet. Häufig sind die Vorhersagezeiträume an sol-
chen Gewässern so kurz, dass Pegel zu einer effek-
tiven Gefahrenabwehr nichts beitragen können. Im
Einzelfall kann es jedoch hilfreich sein, eine infor-
melle Nachrichtenkette zwischen Gemeinden in
einem Gewässereinzugsbereich zu vereinbaren,
Krisenmanagement 13Aufgaben der Gemeinden
im Hochwassernachrichtendienst 3. Verzeichnis der Eigentümer, Besitzer und Betrei-
ber der vom Hochwasser bedrohten Gebäude
Die Hochwasserereignisse in den letzten Jahren und Anlagen.
haben gezeigt, dass den gemeindlichen Meldeplä-
nen, in denen die Warnung der Betroffenen durch 4. Verzeichnis der zuständigen Behörden sowie der
die Gemeinde geregelt wird, als letztem Glied in der örtlichen und überörtlichen Hilfsdienste.
Meldekette eine besondere Bedeutung zukommt.
5. Kommunaler Organisationsplan für die Hoch-
Zur Aufstellung und Aktualisierung dieser Melde- wasserabwehr.
pläne sind die Gemeinden gem. § 8 der Verordnung
über den Hochwassernachrichtendienst (HNDV) 6. Hinweis auf den Aufbewahrungsort der für die
verpflichtet. Katastrophenabwehr erforderlichen Unterlagen.
Zur Vorbereitung auf Hochwasserereignisse müs- Die Wasserwirtschaftsämter unterstützen die
sen die Gemeinden festlegen, ➙ wer ➙ wann und Gemeinden bei der Aufstellung gemeindlicher Mel-
➙ wie zu warnen ist und ➙ welche Maßnahmen depläne und stellen auch Beispiele und Planmu-
bei ➙ welchen Wasserständen an den Pegeln zu ster zur Verfügung.
veranlassen sind.
In besonders gefährdeten Bereichen sollte unter-
In einem gemeindlichen Meldeplan sollten folgen- sucht werden, ob es für die Gemeinde zweckmäßi-
de Punkte enthalten sein: ger ist, einen Katastrophenschutz-Sonderplan
Unwetter aufzustellen. Ein derartiger Katastrophen-
1. Zusammenstellung: schutz-Sonderplan kann gemeindliche Meldeplä-
- Art und Weise der Bekanntmachung der Hoch- ne ergänzen oder ersetzen.
wassernachrichten,
- Lage und Höhe der örtlichen Hochwassermarken,
- bemerkenswerte Pegelstände des Meldepegels Entwicklungen im Hochwassernachrichtendienst
und deren örtliche Auswirkungen (z.B. Straßen-
überflutungen) und Im Innovationsprogramm gewässerkundlicher
- Bezug zwischen den Vorhersagen der Scheitel- Dienst wird der Freistaat Bayern bis Ende 2004
wasserstände des Meldepegels und der zu 320 automatische Niederschlagsmessstationen
erwartenden Scheitelwasserstände vor Ort. bauen, mit Datenfernübertragung kombinieren
2. Lagepläne: und mathematische Vorhersagemodelle für alle
- Überschwemmungsbereiche größerer Hoch- großen Flüsse entwickeln. Zusätzlich wird geprüft,
wasser bzw. festgesetzte Überschwemmungs- ob auch an Gew III weitere Pegel eingerichtet oder
flächen vorhandene auf den beschriebenen Stand
- Rückstaubereiche im Untergrund gebracht werden können.
- Hochwasserbedrohte Objekte und
- Lage der Hochwassermarken.
14 KrisenmanagementMuster
Gemeindlicher Melde- und Einsatzplan im
Hochwassernachrichtendienst
Gemeinde Donautal - Ortsteil Auendorf
Stand: ..........................
1. Meldebeginn : .............. cm (Pegelmessstelle .......................................................... )
Meldung erfolgt durch Alarm-Einsatzzentrale, Landratsamt .................. ,
Tel: Nr .............. Telefax
Meldung erfolgt an: a) Bgm ...............................
Tel.-Nr. dienstl.:...........................
privat :...........................
b) FFW ............................... Tel. -Nr dienstl. :...........................
privat :...........................
c) ....................................... Tel.-Nr.dienstl.:...........................
privat :...........................
Unterlagen befinden sich: ..........................................................
Erste Maßnahmen
Zu verständigen sind folgende Anlieger ( bei .. cm Pegelstand .......................... )
Name Telefon-Nr. Maßnahmen
xxxxx Räumung Parkplatz
Zugang zum Haus sichern
Weitergabe der Meldung an Verwaltung und Bauhofleiter:
Tel.-Nr. dienstl.: ...
z. Meldestufe 2 ab .............. cm Pegelstand
Weitere Hilfs- und Einsatzkräfte
Verständigung von
............................................................... ...Tel.-Nr. privat :
Die Feuerwehr/Sonstige: .......................verständigt die nachfolgend aufgeführten Anlieger:
Muster eines gemeindlichen Melde- und Einsatzplanes im Hochwassernachrichtendienst der Gemeinde Donautal, Ortsteil Auendorf
Wasserstand Ortsbezeichnung Wirkung Flurstück-Nr. Name, Anschrift Telefon-Nr. Auswirkung
cm 28/2 Huber; Lange Straße 5 Zugangsbereich überschwemmt
400 Windorf Überflutung der Zufahrt zur Donauinsel
440 Vilshofen - Windorf Überflutung des Radweges 32 Maier; Flutstraße 3 nur Gartenland betroffen
450 Vilshofen Verkehrslandeplatz gefährdet
450 Vilshofen Rückstau in Kanalisation Bereich Donaustaße 44 Müller; Bachweg 22 Keller unter Wasser
455 Hofkirchen Überflutung Vorländer
23 Propper; Zitronenweg 5 Absichern der Badfenster
700 Hofkirchen Standsicherheit der Deiche im Stadtbereich gefährdet
78 Sommer; Zitronenweg 7 gesamtes EG unter Wasser,
Hofkirchen beginnende Überströmung der Deich im Stadtbereich
keine Zufahrtsmöglichkeit
65 Appelt; Donaustraße 10 Zugangsbereich überschwemmt
- schwerbehindert ! -
HQ,oo...
Krisenmanagement 15III. Nachhaltiger integrierter Hochwasserschutz –
Maßnahmen des Staates
Hochwasserschutz als natürliches Geschehen lässt
sich nicht verhindern. Staat und Kommunen kön- Definitionen:
nen aber „hausgemachte“ Ursachen vermeiden,
Hochwasservorsorge betreiben und den techni- Unter natürlichem Rückhalt/vorbeugender
schen Schutz optimieren. Damit Maßnahmen von Hochwasservorsorge versteht man Maßnah-
der Bevölkerung auch akzeptiert werden, ist eine men im Einzugsgebiet/Aue, die zu einer
Schärfung des „Hochwasserbewusstseins“ notwen- Erhöhung der Speicherfähigkeit und Vermin-
dig. derung der Abflussgeschwindigkeit führen
Wirksamer Hochwasserschutz kann nie nur aus Ein- Der technische Hochwasserschutz umfasst
zelmaßnahmen bestehen. Vielmehr bedeutet inte- Maßnahmen wie Bachbettausbau, Flutmul-
grierter Hochwasserschutz eine Kombination ver- den, Hochwasserschutzmauern und Rückhal-
schiedener Maßnahmen, mit denen ein einheitli- tebecken usw.
ches Ziel erreicht wird.
Die weitergehende Hochwasservorsorge
Bereits 1995 ist von der Landesarbeitsgemeinschaft umfasst Maßnahmen zur Verringerung und
Wasser (LAWA) eine Kombination der 3 (Kern-) künftigen Vermeidung des Schadenspotenti-
Handlungsfelder als in hochwassergefährdeten Gebieten. zur
Vorsorge zählt man die Flächenvorsorge, Ver-
natürlicher Rückhalt/vorbeugender Hochwas- haltensvorsorge, Bauvorsorge und Risikovor-
sorge
ser-schutz
technischer Hochwasserschutz und
weitergehender Hochwasservorsorge Für die Kommunen stellen sich folgende Fragen:
als „Dreisäulenmodell“ beschrieben worden. Der Wie können sie in ihrem Zuständigkeitsbereich
Siehe unter Freistaat Bayern hat dies in seinem (Hochwasser)- (Gew III) integrierten Hochwasserschutz betrei-
Veröffentlichungen, Aktionsprogramm 2020 aufgegriffen und als Leit- ben? Wie sollen sie dabei vorgehen?
Seite 39 bild formuliert.
Eine zwingende Verpflichtung zur Aufstellung eines
bestimmten Konzepts oder zu einer bestimmten
integrierten Planung kann es nicht geben. Soll
Hochwasserschutz jedoch auf Dauer angelegt sein,
ist den Gemeinden die Aufstellung eines integrier-
ten kommunalen Hochwasserschutzkonzepts zu
empfehlen. Dieses kann auch in einen Gewässer-
entwicklungsplan integriert werden. Die Gemein-
de wird sich hierfür in der Regel eines qualifizier-
ten Fachbüros bedienen.
Die grobe Vorgehensweise kann wie folgt skiz-
ziert werden:
Gespräche mit Wasserwirtschaftsamt/
Verwaltung für ländliche Entwicklung über
Schwerpunkt fachlicher Maßnahmen
Beiziehung eines Fachbüros
Auslotung von Fördermöglichkeiten
Details finden sich
in Kapitel V, Seite 24 Konzepterstellung für Umsetzung
16 Hochwasserschutz – Maßnahmen des StaatesDie nachfolgenden fachlichen Beiträge unterschei- wirtschaftsämter den Kreisverwaltungsbehörden
den zwischen Maßnahmen des Staates und der die Überschwemmungslinie in der Regel für ein
Gemeinden und beziehen sich jeweils auf Teilaspek- Hochwasserereignis mit, das statistisch gesehen
te des integrierten Hochwasserschutzes. alle 100 Jahre auftritt (HQ100). Die Gemeinden wer-
den frühzeitig darüber informiert und verfahrens-
mäßig beteiligt. Sie erhalten – falls gewünscht –
1. Überschwemmungsgebiete weitere Erläuterungen, bevor die Rückhalteräume
förmlich als Überschwemmungsgebiete festgesetzt
Ein wichtiges Instrument der Flächenvorsorge ist werden. Dies ist besonders wichtig, haben Gemein-
die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten. den doch bei ihrer Bauleitplanung festgesetzte
Sie dient der Sicherung von Hochwasserrückhalt- Überschwemmungsgebiete zu berücksichtigen.
räumen und des schadlosen Wasserabflusses. Über- Damit wird sichergestellt, dass im Hochwasserfall
schwemmungsgebiete werden von den Kreisver- ausreichend Raum für die Rückhaltung und das
waltungsbehörden durch Rechtsverordnung fest- schadlose Abfließen von Hochwasser zur Verfügung
gesetzt. Nach jetziger Rechtslage sind Über- steht.
schwemmungsgebiete Flächen, die bei Hochwas-
ser durchflossen werden. Sie enthalten parzellen- Ansprechpartner: Örtliches Wasserwirtschaftsamt
scharfe Festlegungen und sind gegenüber jeder- Landesamt für Wasserwirtschaft,
mann verbindlich. Teilweise enthalten sie einschnei- Projektschwerpunkt Hochwasser
dende Nutzungsverbote. Insbesondere ist die
Errichtung von Gebäuden in festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten grundsätzlich verboten.
Rechtsgrundlagen:
§ 32 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Art. 61 Abs 1 Bayerisches Wassergesetz
(BayWG)
In Bayern werden – zusätzlich zu den teilweise
ermittelten und festgesetzten Überschwemmungs-
gebieten – an allen größeren Gewässern 1. und 2.
Ordnung mit einer Gesamtlänge von 9.000 Kilome-
tern sowie vor allem in den Siedlungsgebieten an
den Gewässern 3. Ordnung bis zum Jahr 2006 wei-
tere Überschwemmungsgebiete ermittelt. Die vom
Flugzeug aus gemachten Luftaufnahmen werden
mit der Photogrammetrie ausgewertet.
Kartografische Darstellung eines Überschwemmungsgebietes
2. Vorranggebiete für Hochwasser
in Regionalplänen
Ebenfalls der Flächenvorsorge dient die Auswei-
sung von Vorranggebieten Hochwasser in der
Regionalplanung. Sie unterstützt die Freihaltung
und die Rückgewinnung von Rückhalte- und
Abflussräumen auf der regionalen Ebene.
Im Gegensatz zu den Verordnungen für Über-
Unterschiedliche Höhenlagen werden so genau schwemmungsgebiete findet keine parzellenschar-
erfasst. In Form von Lageplänen teilen die Wasser- fe Festsetzung statt. Die Darstellung erfolgt in Kar-
Hochwasserschutz – Maßnahmen des Staates 17ten 1: 100 000. Gemeinden haben festgesetzte Vor- wenn z. B. ein Siedlungsdruck auf die maßgeben-
ranggebiete Hochwasser bindend in die Bauleit- den Flächen erkennbar ist.
planung zu übernehmen. Auch bei der Festsetzung
von Vorranggebieten ist in der Regel ein Be- Vorranggebiete sind kein stumpfes Schwert. Sie
messungshochwasser HQ100 maßgeblich. schließen andere konkurrierende Nutzungen aus,
wenn sie mit den Belangen des vorbeugenden
Rechtsgrundlagen: Hochwasserschutzes nicht vereinbar sind. Dies gilt
Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung z. B. für die Störung des Wasserabflusses (z. B.
vom 15.12.1997 (BGBl I S. 2902) hochwasserabflusshemmende und – beschleuni-
Bayerisches Landesplanungsgesetz gende Maßnahmen), die Verminderung der natür-
(BayLPlG) in der Fassung vom 25.4.2000 lichen Hochwasserrückhaltung und die Ausweitung
(GVBl S. 280) von Siedlungsflächen. Möglich ist – im Gegensatz
Landesentwicklungsprogramm Bayern vom
zu den wasserrechtlich festgesetzten Überschwem-
12.03.2003 (GVBl 2003, S. 173)
mungsgebieten – auch die Sicherung künftiger
(re)aktivierbarer Flächen.
Zuständig für die Aufstellung von Regionalplänen
und die Ausweisung von Vorranggebieten sind die Ansprechpartner: Regionaler Planungsverband
regionalen Planungsverbände, in denen alle Land- Örtliches Wasserwirtschaftsamt
kreise und Gemeinden einer Region zusammenge-
schlossen sind. Bei der Aufstellung von Regional-
plänen können die Belange des Hochwasserschut- 3. Ermittlung und Bereitstellung
zes mit konkurrierenden anderen Belangen abge- von Basisdaten
stimmt und für eine gesamte Region gesichert wer-
den. In erster Linie werden Vorranggebiete Hoch- Der Freistaat hat ein Interesse an einem wirksa-
wasser an Gew I und II ausgewiesen. Aber auch men kommunalen Hochwasserschutz. Bei kommu-
Gew III kommen für Vorranggebiete in Betracht, nalen Planungen, der Erstellung kommunaler Hoch-
wasser-Kataster und der Entwicklung von Nieder-
schlagsabflussmodellen unterstützt die staatliche
Wasserwirtschaft deshalb die Gemeinden. Sie stellt
hydrologische Grundlagendaten zur Verfügung
oder erarbeitet sie im Bedarfsfall. Weiterhin wer-
den für den Ausbau von Gew III Bemessungsda-
ten, wie z. B. die Jährlichkeiten von Abflüssen,
angeboten.
Der Freistaat erstellt derzeit mathematische
Abflussmodelle für alle großen Flüsse. Er prüft, ob
dies in Einzelfällen auch für Gew III möglich ist,
wenn z. B. die Einrichtung neuer Pegel in Frage
kommt. Für Gemeinden können Niederschlagsab-
flussmodelle darüber hinaus dann sinnvoll sein,
wenn ein kommunales Hochwasserflächenkataster
zu erstellen ist oder wenn im Rahmen eines Kon-
zepts Gefährdungspotentiale wie unterdimensio-
nierte Durchlässe, überbaute Bereiche oder zu klei-
ne Verrohrungen ermittelt werden sollen. Für einen
rechtzeitigen und zielgerichteten Einsatz von Hilfs-
kräften im Krisen- oder Katastrophenfall kommt
der Kenntnis derartiger Schwachstellen besonde-
re Bedeutung zu.
Ansprechpartner: Örtliches Wasserwirtschaftsamt
Auschnitt aus dem Regionalplan Allgäu (Region 16) Landesamt für Wasserwirtschaft,
Vorranggebiete sind blau gerastert Referat 16
18 Hochwasserschutz – Maßnahmen des StaatesIV. Nachhaltiger integrierter Hochwasserschutz –
Maßnahmen der Gemeinden
Die Palette der Handlungsmöglichkeiten der Erhalten oder Wiederherstellen naturnaher
Gemeinden ist umfangreich und reicht von der qua- Zustände an Gewässern und ihren Auen
lifizierten Planung bis zu Modellen der kommuna-
len Zusammenarbeit. Eine aus den Reihen des Ar- Die Renaturierung von Bächen oder die Erhaltung
beitskreises Hochwasserschutz genannte Möglich- eines bereits vorhandenen naturnahen Zustands
keit ist, den Gemeinden ein wirksames Instrument hat eine Doppelfunktion – eine ökologische und
der Flächensicherung bzw. des Flächenerwerbs für eine im Sinne eines vorbeugenden Hochwasser-
bauliche Maßnahmen außerhalb von Bebauungs- schutzes.
plänen an die Hand zu geben. Denkbar erscheint
die Schaffung eines solchen Instruments im Rah- Der naturnahe Ausbau eines Gewässers oder der
men des Wasserrechts. Der Bayerische Gemeinde- Erhalt eines solchen vorhandenen Zustandes
tag hat vorgeschlagen, eine solche Regelung in ein bedeutet die Schaffung oder Sicherung vielfältiger
künftiges Bundesgesetz zur Verbesserung des vor- Lebensräume von Tieren und Pflanzen in und am
beugenden Hochwasserschutzes aufzunehmen. Wasser. Die Gewässerentwicklung ist damit prak-
tizierter Artenschutz. Zur Gewässerentwicklung
gehört auch die Anlage oder Wiederherstellung von
1. Gewässerentwicklung: Bach- und Flussauen. Uferstreifen mit einer stand-
Planen und Ausführen ortgerechten Vegetation helfen Nährstoffe und
Oberboden zurückzuhalten und führen zu einer Ver-
Das Ziel einer Deregulierung auf staatlicher und besserung der Selbstreinigungskraft und Qualität
kommunaler Ebene und die knappen Finanzen nöti- von Gewässern. Schließlich prägen naturnahe
gen auch bei der Gewässerentwicklungsplanung Gewässer mit ihren begleiteten Ufergehölzen und
zur Prüfung folgender Fragen: Auen auch den Erholungswert und das Landschafts-
bild.
Ist ein Gewässerentwicklungsplan (GEP) erfor-
derlich? Die beschriebenen Maßnahmen tragen zum vor-
beugenden Hochwasserschutz bei, weil mehr Hoch-
Welchen Nutzen bringt er für die Gemeinde? wasser zurückgehalten werden kann.
Wie ist er zu finanzieren?
Bedeutung einer qualifizierten Planung
Die Gewässerentwicklungsplanung ist eine freiwil-
lige, gewässerbezogene Fachplanung der Gemein- Überzeugende Lösungen erfordern Sachverstand.
de und dient dem vorbeugenden Hochwasser- Die Einschaltung qualifizierter Planungsbüros ist
schutz. Der GEP zielt zunächst auf die Durchfüh- deshalb von Vorteil. Sowohl Gründe der Effizienz,
rung fachgerechter Pflege-, Unterhaltungs- und als auch Kostengesichtspunkte machen die Bildung
Ausbaumaßnahmen für ein Gewässer. Empfehlens- von Planungsgemeinschaften sinnvoll.
wert ist allerdings die Betrachtung aller Gewässer
im Gemeindegebiet, die zu einem Einzugsgebiet Bei einer qualifizierten Planung sollte die Beteili-
gehören. Dies entspricht auch dem Denken und gung von Behörden, Verbänden und Einzelperso-
Handeln in Flusseinzugsgebieten, wie es der euro- nen selbstverständlich sein. Je nach Lage, örtlicher
päischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zugrun- Situation und Planungsstadium kommt die Ein-
de liegt. Besondere Aktualität gewinnt die Gewäs- schaltung von Unterer Naturschutzbehörde, Amt
serentwicklungsplanung durch Aussagen zum für Landwirtschaft, Direktion für ländliche Entwick-
Hochwasserschutz. Der GEP kann aufzeigen, wo lung, Fischereiverband, Bauernverband, Natur-
ein Wasser- bzw. Nährstoffrückhalt notwendig ist, schutzverbänden und Jagdpächtern in Frage. Die
wo Gewässer naturnah umgestaltet werden sollen Planaufstellung wird vom zuständigen Wasserwirt-
und wo ein „technischer“ Hochwasserschutz unab- schaftsamt im Rahmen der Beratung begleitet.
dingbar ist. Der Wasserrückhalt in der Fläche und
am Gewässer ist eine wesentliche Voraussetzung Eine effektive Öffentlichkeitsarbeit hilft die Akzep-
für eine Abflussminderung. Es liegt nahe, den GEP tanz zu erhöhen. Grundstückseigentümer und Nut-
mit der Erstellung eines Rückhaltekonzepts zu ver- zer sollten deshalb frühzeitig informiert und im
binden. Rahmen von Ortsterminen und regelmäßiger Pres-
Hochwasserschutz – Maßnahmen der Gemeinden 19seberichterstattung frühzeitig eingebunden wer- Planungsablauf
den.
• Erhalten und Bewerten von Gewässern und Aue
Reduzierung des Unterhaltungs-
und Pflegeaufwandes
Nicht zuletzt unter Kostengesichtspunkten ist eine
Erhaltung oder Wiederherstellung naturnaher
Zustände sinnvoll.
Dies kann erreicht werden durch:
• Formulieren eines Leitbildes
Rückbau von technischen Ufer- und für Gewässer und Aue
Sohlsicherungen zur Förderung der Eigen-
dynamik der Gewässer.
Umbau von Abstürzen zur Wiederherstellung
der Durchgängigkeit.
Soweit notwendig, Ufer- und Sohlsicherung
in ingenieurbiologischer Bauweise. Sinnvol-
ler ist die Ausweisung breiterer Uferstreifen
(mind. 5 m) und Duldung von Uferanbrüchen. • Ausarbeiten von Entwicklungszielen und Maß-
nahmen, die sich unter den gegebenen Rahmen-
bedingungen umsetzen lassen
Gehölzpflege nach ökologischen
Gesichtspunkten, wie z. B. turnusmäßiges
auf den Stock setzen bei Erlen und Weiden.
Abschnittsweises Entfernen von Pappeln und
Fichten.
Schrittweises Vorgehen
Nach dem Prinzip Erhalten – Entwickeln – Gestal-
ten wird ein Vorgehen in folgenden Schritten emp-
fohlen:
Ansprechpartner: Örtliches Wasserwirtschaftsamt
Erhebung und Bewertung des Ist-Zustands: Landesamt für Wasserwirtschaft,
Hydrologische Daten, Gewässerstruktur, Gewäs- Referat 41
sergüte, Nutzungen von Aue und Gewässer,
schützenswerte Lebensräume von Pflanzen und
Tieren, Landschaftsbild. 2. Baulicher Hochwasserschutz
Formulierung des Leitbildes – Definition des Ein ausreichender Schutz vor Hochwasser
natürlichen Zustandes des Gewässers – bezo- bedingt auch und oft sogar in erster Linie bauli-
gen auf die „Gewässerlandschaft“. che Maßnahmen,. Wasserrückhaltung in der Flä-
che allein reicht in den meisten Fällen nicht aus.
Ausarbeiten der Ziele und Maßnahmen, Um Bebauung und hochwertige Infrastruktur vor
Beschreibung des innerhalb einer absehbaren Hochwasser bis zu einem in der Regel 100-jähr-
Zeitspanne schrittweise erreichbaren Zustan- lichen Ereignis zu schützen, können erforderlich
des des Gewässers und seiner Aue. sein
20 Hochwasserschutz – Maßnahmen der Gemeinden ein Ausbau des Gewässerbetts auf ein ent-
sprechendes Abflussvermögen
eine Umleitung von Hochwasser über
Flutmulden
die Errichtung von Hochwasserdeichen
und/oder Mauern
der Bau von Hochwasserrückhaltebecken
eine Kombination von Gewässerausbau und
Hochwasserrückhaltebecken
auch bauliche Maßnahmen an den Gebäuden
selbst (Objektschutz)
Beispiel für einen Rückhalt in einem Hochwasserrückhaltebecken:
Hochwasserschutz Hausen
Der bauliche Hochwasserschutz kostet Geld. Dies
gilt für Planung, Umsetzung von Maßnahmen
und die erforderliche Unterhaltung von Anlagen. 3. Hochwasserschutz in der Bauleitplanung
Aufwand und Nutzen sollten deshalb bereits in
der Planungsphase intensiv berücksichtigt wer- Hochwasserschutz betrifft die Planungsträger
den. Planungsalternativen helfen bei der Beur- aller Planungsebenen. Der gemeindeübergrei-
teilung. fende Hochwasserschutz ist eine Aufgabe der
Landesplanung, die z. B. über die Ausweisung
In manchen Fällen kann ein Hochwasserschutz bzw. von Vorranggebieten Hochwasser umgesetzt
eine Schadensminderung auch durch bauliche Maß- wird. Daneben steht die Fachplanung. Im Bereich
nahmen an den Gebäuden ergänzt werden (Abdich- des Wasserrechts stellt die Festsetzung von Über-
tung der Gebäude bzw. Gebäudeöffnungen, dich- schwemmungsgebieten durch Rechtsverordnung
te und ausreichend hohe Kellerlichtschächte, Ver- das effektivste Instrument für den Hochwasser-
wendung wasserdichter und wasserbeständiger schutz dar.
Baustoffe etc.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass
auch ein ausreichender Schutz gegen das Eindrin- Aber auch die kommunale Bauleitplanung kann
gen von Grundwasser und Rückstauwasser aus ihren Beitrag zum Hochwasserschutz leisten. Sie
dem Kanalnetz sowie die Sicherheit gegen Auf- ergänzt die überörtliche Planung und das wasser-
triebskräfte und Wasserdrücke vorhanden sein müs- rechtliche Instrumentarium.
sen. Zum Objektschutz gibt es zahlreiche Informa-
vgl. Veröffentlichungen,
tionsbroschüren von Bund, Ländern und Versiche-
Seite 39
rungen. Bindung der Bauleitplanung durch Ziele der
Raumordnung und förmlich festgesetzte Über-
Ein Gewässerausbau, dazu gehören auch Deich- schwemmungsgebiete
und Dammbauten, die den Hochwasserabfluss
beeinflussen, bedarf einer Planfeststellung bzw. Die Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung
Plangenehmigung nach Wasserrecht (§ 31 WHG, anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Solche Ziele sind
Art. 58 BayWG). Bei Hochwasserrückhaltebecken im Regionalplan ausgewiesene Vorranggebiete für
sind die Belange einer ökologischen Durchgängig- den Hochwasserschutz.
keit des Gewässers zu berücksichtigen.
Flächennutzungs- oder Bebauungspläne, die zu der
Mobile Hochwasserschutzeinrichtungen, wie z. B. Zielsetzung des Vorranggebiets in Widerspruch ste-
Dammbalkenwände, können nur dort in Betracht hen, sind mit § 1 Abs. 4 BauGB nicht vereinbar. Eine
gezogen werden, wo ausreichende Vorwarnzeiten Bauflächenausweisung kommt in solchen Gebie-
einen Aufbau ermöglichen. Dies ist bei kleineren ten grundsätzlich nicht in Frage.
Gewässern oft nicht der Fall.
Darüber hinaus enthält das am 1. April 2003 in Kraft
Ansprechpartner: Örtliches Wasserwirtschaftsamt getretene Landesentwicklungsprogramm folgen-
Landesamt für Wasserwirtschaft, des, für die gemeindliche Bauleitplanung binden-
Projektschwerpunkt Hochwasser des Ziel:
Hochwasserschutz – Maßnahmen der Gemeinden 21Sie können auch lesen