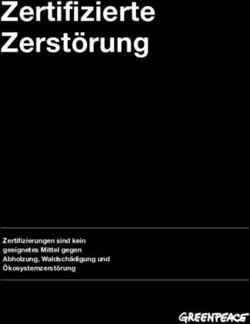Iga.Report 38 - Nudging im Unternehmen Den Weg für gesunde Entscheidungen bereiten - Initiative Gesundheit & Arbeit (iga)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
iga.Report 38
Nudging im Unternehmen
Die Initiative
Gesundheit und Arbeit
In der Initiative Gesundheit und
Arbeit (iga) arbeiten gesetzliche
Kranken- und Unfallversicherung
zusammen, um arbeitsbedingten
Den Weg für gesunde Entscheidungen bereiten Gesundheitsgefahren vorzubeugen.
Gemeinsam werden Präventions-
ansätze für die Arbeitswelt weiter-
Diana Eichhorn und Ida Ott entwickelt und vorhandene Methoden
oder Erkenntnisse für die Praxis
nutzbar gemacht.
iga ist eine Kooperation von
BKK Dachverband, der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV), dem AOK-Bundesverband
und dem Verband der
Ersatzkassen e. V. (vdek).
www.iga-info.deiga.Report 38 Nudging im Unternehmen Den Weg für gesunde Entscheidungen bereiten Diana Eichhorn und Ida Ott
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 7
2 Definition und theoretischer Hintergrund 8
2.1 Das Konzept des libertären Paternalismus 8
2.2 Stand der Forschung 11
2.3 Kritik an Nudges 12
3 Konzeptionelle Einordnung 13
3.1 Nudges als Instrument in der Prävention und der BGF 13
3.1.1 Prinzipien der Prävention und der BGF 13
3.1.2 Eingriffstiefe von Nudges 15
3.2 Legitimation von Nudges in der Prävention und der BGF 15
3.2.1 Auftrag der Sozialversicherungsträger 15
3.2.2 Wirksamkeit im Gesundheitskontext 16
4 Eine praktische Anleitung 18
4.1 Gestaltung von Nudges 18
4.1.1 Das MINDSPACE-Gestaltungsmodell 18
4.1.2 Weitere Gestaltungsmodelle 25
4.2 Nudging-Kriterien im Betrieb 27
4.3 Handlungsleitfaden zur Entwicklung eines Nudging-Konzepts 305 Eine Übersicht an Praxisbeispielen 36
5.1 Beispiele aus der Projektsteuerung 36
5.1.1 Interne Öffentlichkeitsarbeit des Steuerungsgremiums 36
5.1.2 Bewerbung von Gesundheitsaktionen für Beschäftigte 38
5.1.3 Analyse 39
5.2 Beispiele aus den Handlungsfeldern 40
5.2.1 Gesundheitsgerechte Verpflegung und Ernährung 40
5.2.2 Bewegungsförderliche Umgebung und bewegungsförderliches Arbeiten 41
5.2.3 Stressbewältigung und Ressourcenstärkung 43
5.2.4 Gesundheitsgerechte Führung 44
5.2.5 Gesundheitsförderliche Gestaltung der Arbeitsorganisation 45
5.2.6 Arbeitsschutz 47
6 Fazit 48
7 Literatur 50
8 Abbildungsverzeichnis 56
9 Tabellenverzeichnis 56Nudging im Unternehmen
1 Einleitung
Der Blick in die Fußgängerzonen, Parks und Wohngebiete der im Kontext von Public Health können Menschen bislang nur
Welt zeigte im Sommer 2016 viele Menschen mit gesenktem bedingt zu einem gesünderen Verhalten bewegen.
Blick auf das Smartphone. Sie alle waren auf der Jagd nach
kleinen virtuellen Monstern. Ein Spiel auf dem Smartphone Hinsichtlich der Frage, wer die Verantwortung für die Ge-
hat diese Menschen in Bewegung gebracht. Nicht nur von sundheit von Menschen trägt, befinden sich die Politik und
Computerspielen begeisterte Menschen, sondern unter- die Akteure im Gesundheitswesen in einem Zwiespalt. Einer-
schiedlichste Personenkreise waren den Sommer über auf seits wird die Verantwortung für die eigene Gesundheit dem
Monsterjagd in der realen Welt unterwegs. Dieses Massen- einzelnen Menschen zugeschrieben. Andererseits werden
phänomen war auch für die Wissenschaft von Interesse. Ein Voraussetzungen für eine Verantwortungsübernahme in ho-
Team der Universität Stanford untersuchte das Bewegungs- hem Maße von der Lebenswirklichkeit geprägt (Schmidt,
verhalten durch die Nutzung des Spieles. Dazu wurden die 2014). Anhand der steigenden lebensstilbedingten Erkran-
Daten von 32.000 Personen ausgewertet, die Fitnessarmbän- kungen wird deutlich, dass verhaltens- und verhältnisprä-
der trugen. Diese Personen erhöhten ihre Bewegungsaktivi- ventive Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Ge-
tät durchschnittlich um 1.473 Schritte täglich. Eine Steige- sundheit unzureichend sind.
rung um 25 Prozent ging damit einher (Althoff, White & Hor-
vitz, 2016; Howe et al., 2016). Für einen gewissen Zeitraum 2008 veröffentlichten Richard Thaler und Cass Sunstein das
hat das Spiel geschafft, was Aktivitäten und Appelle der Be- Buch „Nudge: improving decisions about health, wealth, and
wegungsförderung nur mühsam schaffen – Menschen (auch happiness“. Mit ihrem Ansatz des libertären Paternalismus
schwer erreichbare Zielgruppen wie junge Erwachsene) in versuchen die Autoren Erkenntnisse der Verhaltensökonomie
Bewegung zu bringen. Es stellt sich die Frage, welche Mecha- zu nutzen, damit Menschen „bessere“ Entscheidungen tref-
nismen dies bewirkt haben. fen. Das Wissen um die Entscheidungsarchitektur von Men-
schen wurde bis dato vorrangig in der Werbung eingesetzt,
Freie und rationale Entscheidungen zu treffen, diese Eigen- um Menschen in ihrem Konsumverhalten zu beeinflussen.
schaft wird dem Individuum zugeschrieben. Gleichzeitig Mit der Veröffentlichung des Ansatzes des libertären Pater-
zeigt sich in vielen Lebensbereichen, dass Menschen nicht nalismus stießen die beiden Forscher den Prozess an, Nudg-
nur irrational, sondern auch ihren eigenen Interessen zuwi- ing (dt. sanfte Stupser) als Instrument zur Beeinflussung von
derhandeln (Beck, 2014). Entscheidungen werden so häufig Verhalten in verschiedenen Feldern der Politik einzusetzen.
simplifiziert und vielmehr nach Faustregeln der Mühelosig- Das Thema Nudging durch staatliche Akteure wird von einer
keit und Funktionsfähigkeit getroffen. Der rein rational han- breiten und kontroversen Debatte in der Wissenschaft, der
delnde Homo oeconomicus existiert außerhalb der wirt- Politik und den Medien begleitet. Auch die deutsche Bundes-
schaftswissenschaftlichen Lehrbücher in der realen Welt regierung beschäftigt sich im Rahmen der Projektgruppe
selten (ebd.). Zur Verdeutlichung lassen sich viele alltägliche „wirksam regieren“ seit 2015 mit dem Thema Nudging. Bis-
Beispiele heranziehen – das Zeitungsabonnement, das ver- herige Anwendungsbereiche sind Verbraucher- und Umwelt-
gessen wurde zu kündigen und sich erneut um ein Jahr ver- politik.
längert, oder der Besuch beim Zahnarzt, der schon seit Mo-
naten herausgezögert wird. Besonders im Kontext der Die Gesundheitspolitik ist ebenfalls ein potenzielles Einsatz-
Gesundheit zeigt sich, dass das Verhalten von Menschen feld von Nudges. Eine theoretische Auseinandersetzung mit
nicht an gesichertem Wissen und darauf ausgerichtetem dem Nudge-Ansatz im Kontext von Prävention und Betriebli-
Handeln orientiert ist. Gesundheitsberichte über Bewegungs- cher Gesundheitsförderung (BGF) fand bislang nicht statt,
mangel, unausgewogene Ernährungsgewohnheiten und Ta- sodass der vorliegende Report eine explorative Übertragung
bakkonsum belegen die häufigen Entscheidungen zugunsten auf das Handlungsfeld leistet. Ziel ist es deshalb, die Defini-
eines schädigenden Verhaltens. Langfristig steigen Erkran- tion und den theoretischen Hintergrund von Nudges zu be-
kungen (z. B. Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck), die in Zu- leuchten und sich mit der Wirksamkeit sowie der Kritik am
sammenhang mit einem ungesunden Lebensstil stehen (Ro- Konstrukt auseinanderzusetzen (siehe Kapitel 2, S. 8). Im Ka-
bert Koch-Institut, 2015). Bisherige Präventionsmaßnahmen pitel 3 (siehe S. 13) findet eine konzeptionelle Einordnung
iga.Report 38 | 7Nudging im Unternehmen
von Nudges in die Prävention und die BGF statt. Dabei wer- ten im Betrieb. Anhand von realen Fallbeispielen werden im
den die Vereinbarkeit des Ansatzes mit den Prinzipien der Kapitel 5 (siehe S. 36) Möglichkeiten aufgezeigt, wie Betrie-
Prävention und der BGF sowie die Eingriffstiefe von Nudges be bereits Nudges einsetzen. Diese können als Anregungen
erörtert. Anschließend setzt sich der Report mit der Legitima- für die Auseinandersetzung mit und die Anwendung von
tion und der Zielgruppe von Nudges in diesem Kontext aus- Nudges im eigenen Unternehmen oder in der Beratungs-
einander. Das Kapitel 4 (siehe S. 18) bietet eine praktische praxis dienen.
Anleitung zur Gestaltung von Nudges und Nudging-Konzep-
2 Definition und theoretischer Hintergrund
Für ein einheitliches Verständnis sind in diesem Kapitel die diejenige, die Menschen auf der Grundlage vollständiger In-
Definition und eine theoretische Einordnung des Begriffs formation, vorausschauenden Denkens und dementspre-
Nudge dargelegt. chenden Handelns sowie bei ausreichender Selbstkontrolle
treffen. Nudges stoßen Menschen zu Entscheidungen an, die
sie im Alltag eher selten oder nicht treffen würden, denn
2.1 Das Konzept des libertären Menschen agieren häufig nicht rational und Nutzen maxi-
Paternalismus mierend (Beck, 2014).
Die Annahme, dass Menschen auf Grundlage vollständiger Definition: Nudge
Informationen rational und zu ihren Vorteilen handeln (Homo
oeconomicus), widerlegt seit einigen Jahrzehnten die experi- Veränderung des physischen, sozialen und psychischen
mentelle Verhaltensökonomie (Gilovich, Griffin & Kahneman, Entscheidungskontextes. Ein Nudge ist kein Gebot oder
2002). Das menschliche Verhalten wird vielmehr durch Irrati- Verbot und ist mit keinen finanziellen Anreizen1 oder
onalität, Inkonsistenz und von Umweltfaktoren beeinflusst mit Sanktionen belegt. Die autonome Entscheidung
(Beck, 2014). Diese Entscheidungsanomalien haben zur des Individuums bleibt unberührt.
Grundidee des libertären Paternalismus geführt und bilden
dessen Grundlage. Das Konstrukt des libertären Paternalis-
mus liegt dem Nudge-Ansatz zugrunde. Der Begriff Nudge Die normativen Annahmen des Konzepts beruhen auf zwei
wurde wesentlich durch Richard Thaler und Cass Sunstein Theorien der politischen Philosophie, zum einen auf dem
geprägt. Paternalismus: Demnach sind Eingriffe in Entscheidungssitu-
ationen gerechtfertigt, wenn diese das menschliche Wohler-
Nudges werden von den Autoren als Elemente einer Ent- gehen fördern (Buyx, 2010). Auch wird angenommen, dass
scheidungsarchitektur (Choice Architecture) gesehen, die die Institutionen dazu legitimiert sind, das Verhalten zum Wohl-
Freiheit des Einzelnen nicht einschränken oder Verhaltens- ergehen der Menschen zu beeinflussen (ebd.). Zum anderen
vorschriften aufstellen, sondern durch sanftes Anstupsen beruht das Konzept auf dem Libertarismus: Der libertäre An-
eine Entscheidung in einer vorhersehbaren Weise beeinflus- teil wird dadurch eingebracht, dass die individuelle Hand-
sen (Thaler & Sunstein, 2008). Um dies zu erreichen, wird der lungsfreiheit bei der Entscheidungsbeeinflussung nicht ein-
physische, psychische und soziale Entscheidungskontext ge-
zielt gestaltet. Auf diese Art soll eine Person im Moment der
Entscheidung in eine gewünschte Richtung beeinflusst wer- 1 In der Literatur finden sich zahlreiche Beispiele, in denen ein minimaler finanzieller
Anreiz genutzt wird, um die Entscheidungsarchitektur und somit das Verhalten von
den. Die Person soll eine „gute“ Entscheidung treffen. Thaler Personen aus einer bestimmten Zielgruppe zu verändern. Als Voraussetzung für die
Entscheidungsfreiheit gilt, dass keine unwiderstehlichen ökonomischen Anreize oder
und Sunstein (2008) definieren eine gute Entscheidung als Belohnungen damit verbunden sind.
8 | iga.Report 38Nudging im Unternehmen
geschränkt wird, d. h., es dürfen keine Vorschriften bzw. tems auf der Grundlage neurowissenschaftlicher Ergebnisse
Sanktionen erlassen oder Handlungsoptionen entfernt wer- verfeinert. Sie beschreiben das System 2 als zielgerichtetes
den. Das Konstrukt des libertären Paternalismus verbindet (Goal-directed) System. Das automatische System differen-
die konträren Theorien. Die Grundaussage lautet, dass Nudg- ziert sich in das Gewohnheitssystem (Habit System) und das
es Menschen zu besseren Entscheidungen verhelfen, ohne impulsive System (Impulsive System). Das Gewohnheitssys-
ihre Freiheit einzuschränken. tem beschreibt, dass Handlungen das Ergebnis von Reiz-Re-
aktions-Mechanismen sind, die sich über einen gewissen
Die Grundlagen des libertären Paternalismus beruhen auf Zeitraum verfestigt haben. Sowohl motorische als auch men-
Erkenntnissen der Verhaltensökonomie tale Gewohnheiten (den Urteilsheuristiken gleichzusetzen)
Nach Kahneman (2012) findet menschliches Denken in zwei haben sich eingeübt. Das impulsive System bezeichnet evo-
mentalen Systemen statt: dem automatischen (System 1) und lutionär bedingte Instinkte oder Emotionen (Angst, Ekel, Ver-
dem reflektierten (System 2). Entscheidungen im System 1 trauen etc.), die durch bestimmte Reize (Essen, andere sozia-
werden intuitiv, affektgesteuert und habituell zumeist in All- le Gruppen etc.) ausgelöst werden. Diese Stimuli aktivieren
tagssituationen getroffen. Das System 2 beinhaltet bewusste ein automatisches Verhalten, welches entweder der Ableh-
und rationale kognitive Vorgänge. Forschungsergebnisse zei- nung/Vermeidung oder Zuneigung/Annäherung zugeordnet
gen, dass menschliches Denken – auch in Entscheidungssitua- werden kann. Das impulsive System kann die Handlungen
tionen mit weitreichenden Konsequenzen – vom System 1 des zielgerichteten Systems verstärken oder unterdrücken.
bestimmt ist (ebd.). Urteilsheuristiken (automatisierte Denk- Abbildung 1 zeigt, wie das Zusammenspiel der beiden Syste-
weisen) prägen somit unsere Entscheidungen. Ivo Vlaev und me das menschliche Verhalten beeinflusst. Hier setzen die
Paul Dolan (2015) haben die Annahmen des dualen Denksys- Interventionen zur Verhaltensänderung an.
Zielgerichtetes System
Reflektiert, überlegend, planend
Impulsives System
Instinkt- und emotionsgesteuert
Verhalten
Techniken der
Verhaltensänderung
Gewohnheitssystem
Geprägt durch automatisierte
Denkweisen und Handlungen
Automatische Aktivierung durch Assoziationen
Abbildung 1: Selbstregulierungsprozesse (nach Vlaev, King, Dolan & Darzi, 2016, S. 553)
iga.Report 38 | 9Nudging im Unternehmen
Erkenntnisse zu menschlichen Verhaltenstendenzen Aufmerksamkeit oder auch Sichtbarkeit kann dazu führen,
Es gibt unterschiedliche Ansätze, menschliche Verhaltensten- dass Kosten- oder auch Nutzeneffekte nicht bedacht wer-
denzen zu systematisieren (Jones, Pykett & Whitehead, 2013). den.
Nachfolgend werden vier Verhaltenstendenzen nach Sunstein
(2011, 2013) erläutert, die empirisch gut belegt sind und eine 3. Soziale Einflüsse und Normen
hohe Relevanz für die Praxis haben. Das Verhalten eines Individuums ist durch andere Men-
schen stark beeinflussbar. Der Lebensstil sowie das Ge-
1. Trägheit und Prokrastination sundheits- und Risikoverhalten stehen in enger Verbin-
Menschen halten meist einen bestimmten Zustand (z. B. dung mit der jeweiligen relevanten sozialen Gruppe eines
ihr Verhalten) aufrecht (Status-quo-Effekt). Eine Änderung Individuums (Peergroup); auch deshalb, weil die Reputati-
wird auch dann nicht vollzogen, wenn die Kosten der Al- on jeder Person von der Konformität mit den Normen der
ternative geringer und der Nutzen größer sind. Auch nei- sozialen Gruppe abhängig ist. „Insbesondere die Ernäh-
gen Menschen dazu, Entscheidungen oder auch Verhal- rung wird von den Essgewohnheiten anderer beeinflusst.
tensänderungen aufzuschieben. So hat man herausgefunden, dass der Körperbau anderer
Menschen in der Bezugsgruppe einen Einfluss auf die Er-
Default-Regeln nutzen diese Verhaltenstendenz. Sie defi- nährungsgewohnheiten hat […]“ (Sunstein, 2013, S. 20).
nieren, was geschieht, wenn keine aktive Entscheidung Dabei fungieren Normen als Orientierung, was zu tun
getroffen wird. Beispiel: Ein Handyvertrag muss zum Ab- oder zu lassen ist bzw. was als wünschenswert gilt.
lauf der vertraglichen Laufzeit gekündigt werden, sonst
verlängert er sich um zwei Jahre. Es muss sich also aktiv 4. Fehleinschätzung von Wahrscheinlichkeiten
gegen die Verlängerung entschieden werden (Opt-out). Menschen sehen ihre eigene Person im Vergleich zu ihren
Andersherum können Default-Regeln dort genutzt wer- Mitmenschen tendenziell als weniger gefährdet an. Die
den, „[…] wo die Neigung zum Aufschieben signifikante Wahrscheinlichkeit, Schicksalsschläge wie schwere Krank-
Probleme verursacht, [dort] kann es hilfreich sein, eine heiten oder Unfälle zu erleiden, wird als gering einge-
automatische Teilnahme an den entsprechenden Pro- schätzt (Illusion: Mich trifft es nicht) (Kurzenhäuser & Epp,
grammen einzuführen“ (Sunstein, 2013, S. 16). Als Bei- 2009). Wenn jedoch ein Ereignis kognitiv verfügbar ist,
spiel wird häufig die automatische Aufnahme einer be- weil sich ein solches vor kurzer Zeit im direkten Umfeld
trieblichen Altersvorsorge beim Anstellungsbeginn in ereignet hat, wird die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts
einem Unternehmen angeführt. wiederum überschätzt. Auch spielen Emotionen in unserer
Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eine gewichtige Rolle.
2. Framing und Präsentation
Menschliches Verhalten wird dadurch beeinflusst, wie Das Wissen um menschliche Verhaltenstendenzen kann ge-
Entscheidungsoptionen dargeboten werden. Dabei spielt nutzt werden, um Nudges zu entwickeln und so Entscheidun-
einerseits das Framing eine Rolle. Wie erfolgt die inhaltli- gen in gewünschte Richtungen zu lenken. Dementsprechend
che Darstellung? Wird etwas als Gewinn (Gewinn-Frame) beruhen Gestaltungsmodelle für Nudges, die in Kapitel 4
oder Verlust (Verlust-Frame) verkauft? „Mit der Informati- (siehe S. 18 ff.) beschrieben sind, auf diesen Annahmen.
on, dass 90 Prozent der Patienten, die eine bestimmte
Operation hatten, fünf Jahre später noch leben, werden
sich Betroffene mit größerer Wahrscheinlichkeit für diesen
Eingriff entscheiden, als wenn man ihnen sagt, dass zehn
Prozent der Operierten fünf Jahre später tot sind“ (Sun-
stein, 2013, S. 17). Auf der anderen Seite geht es darum,
Informationen oder Angebote lebendig und auffällig zu
präsentieren. Informationen sollten nicht nur abstrakt
oder statistisch (z. B. in Form von schriftlichen Warnhin-
weisen), sondern auch grafisch ansprechend präsentiert
werden, um Aufmerksamkeit zu generieren. Begrenzte
10 | iga.Report 38Nudging im Unternehmen
2.2 Stand der Forschung (1) Staatliche Aufklärung > Kampagnen gegen das Rauchen,
Kampagnen für mehr Ernährungsbewusstsein, die z.B. vor
einer Kinovorstellung gezeigt werden
Einzelne Nudges beruhen auf Erkenntnissen aus Forschungs- (2) Informationsbereitstellung von der Nahrungsmittelindus-
arbeiten zu menschlichen Verhaltens- und Entscheidungs- trie > Die Regierung fordert von der Lebensmittelindustrie
weisen. Die empirische Basis einzelner Nudges und deren eine Kennzeichnung von Produkten, z.B. Lebensmittelam-
Wirkmechanismen wurde durch jahrelange Forschung trag- peln, Kalorientabellen.
fähiger. (3) Entscheidungsarchitektur > Die Regierung verpflichtet Su-
permarktketten, gesunde Lebensmittel auffälliger zu plat-
Die Effizienz und die langfristige Wirkung von Verhaltensän- zieren und süßigkeitenfreie Kassen bereitzustellen.
derungen sind jedoch noch nicht ausreichend belegt (Horton, (4) Eingriff in Handlungsoptionen > Einführung eines fleisch-
2011; Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke & Kelly, 2011). Daraus freien Tages in öffentlichen Kantinen. Im eigentlichen Sinne
resultiert ein Kritikpunkt an Nudges, welcher der empirischen handelt es sich dabei um keinen Nudge mehr, da die Hand-
Kritik zuzuordnen ist. Ebenso werden die Forschungsmetho- lungsoption genommen ist.
den der bisherigen Arbeiten kritisiert (Barton & Grüne-Yanoff, (5) Unterschwellige Botschaften > Der Einsatz von verdeckten
2015; Hallsworth, 2016). Da in bisherigen experimentellen Botschaften während Kinovorstellungen, um das Rauch-
Studien die Zielgruppen und die jeweiligen Entscheidungskon- und Essverhalten zu beeinflussen. Diese Maßnahme stellt
texte nicht ausreichend berücksichtigt werden, muss die Über- keinen Nudge dar, sondern ist der Manipulation zuzuord-
tragbarkeit der Ergebnisse in den Alltag bezweifelt werden. nen. Die Aufnahme dieses Typus erfolgte aufgrund der Ab-
grenzung zu anderen, transparenten Nudges (ebd.).
Für den praktischen Einsatz von Nudges in unterschiedlichen
Settings sind in den letzten Jahren Gestaltungsmodelle ent- Die Ergebnisse deuten auf eine positive Einstellung der euro-
standen, die eine Hilfestellung für die Umsetzung in der päischen Bevölkerung gegenüber „Gesundheits-Nudges“ hin.
Praxis bieten. Dazu zählen unter anderem Modelle wie Diese differenziert sich jedoch abhängig von Nudge-Typ, Land,
MINDSPACE und EAST. Jedoch fehlt auch in Bezug auf diese Alter und Geschlecht. In Deutschland lag die über alle Nudge-
Modelle die empirische Basis, wenn es um den Nachweis von Typen gemittelte Zustimmungsrate bei 68,7 Prozent (ebd.,
langfristigen Effekten der entwickelten Interventionen geht. S. 5). In Italien, Großbritannien und Frankreich lag diese bei
Somit lässt sich ein Forschungsbedarf an Evaluationsstudien etwa 74 Prozent. Die Bevölkerung in Ungarn (57,1 Prozent)
konstatieren. und Dänemark (51,4 Prozent) steht Nudges am kritischsten
gegenüber. Besonders hohe Zustimmungsraten (84,0 Prozent)
Die Akzeptanz der europäischen Bevölkerung gegenüber konnten in Deutschland für Nudges der Informationsbereit-
„Gesundheits-Nudges“ wurde 2016 von Reisch, Sunstein stellung, z.B. in Form von Lebensmittelampeln, verzeichnet
und Gwozdz untersucht. In sechs europäischen Ländern (Ita- werden (ebd., S. 6). Den Eingriff in Handlungsoptionen, wie die
lien, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Däne- Einführung eines fleischfreien Tages in Kantinen, befürworte-
mark) wurde mithilfe eines Onlinefragebogens ein repräsen- ten 54,9 Prozent (ebd., S. 7). Die geringste Zustimmung erfuh-
tativer Anteil der Bevölkerung nach seiner Zustimmung für ren die unterschwelligen Botschaften mit 42,2 Prozent (ebd.).
Nudges gefragt. Die Nudges wurden fünf Kategorien zuge- Dies bestätigte die Annahme des Forschungsteams, dass in-
ordnet. Die Eingriffstiefe wurde dabei immer weitreichender. transparente Nudges abgelehnt werden.
Die Eingriffstiefe (oder auch Interventionstiefe) bezeichnet
die Intensität des Eingriffs in die Entscheidungsautonomie
der handelnden Person (Nuffield Council on Bioethics, 2007).
Im Kontext von Konsumverhalten verdeutlichen Reisch et al.
(2016) dies an Beispielen und kategorisieren Nudges folgen-
dermaßen:
iga.Report 38 | 11Nudging im Unternehmen
2.3 Kritik an Nudges Der Anschein der Manipulation gehe auch damit einher, dass
Erkenntnisse der Psychologie und Verhaltensökonomie lange
Zeit hauptsächlich für Werbe- und Marketingmaßnahmen
Um das dargestellte Konzept wird eine Debatte in unterschied- eingesetzt worden seien (Fischer & Lotz, 2014). Eine solche
lichen Disziplinen wie Philosophie, Ökonomie oder Rechtswis- Methode als Politikinstrument zu verwenden, gehe mit For-
senschaften geführt (Bornemann & Smeddinck, 2016). An die- derungen nach strengen Regelungen einher (ebd.).
ser Stelle wird kein Anspruch erhoben, die Gesamtheit der
geführten Diskurse wiederzugeben. Jedoch ist es für die Ein- Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass der popu-
ordnung des Konzepts notwendig, einige Haupteinwände ge- lärwissenschaftliche Erfolg des Konzepts teilweise der Fülle
gen die Anwendung von Nudges aufzuzeigen. Dafür werden und Komplexität der zugrundeliegenden Wissenschaft nicht
nachfolgend konzeptionelle und normative Kritikpunkte the- gerecht wird. Dadurch bringt dieses Konzept Kritik insbeson-
matisiert. dere aus der Wissenschaft mit sich (Sugden, 2009; John,
Smith & Stoker, 2009). „Dennoch hat es auch für die Wissen-
Die konzeptionelle Kritik beinhaltet unter anderem folgen- schaft Vorteile, wenn komplexe Forschungsgebiete zuweilen
de Punkte: Das Konzept sei unklar definiert und weise keine auf simple, relativ grobe Begriffe wie Nudging reduziert wer-
klare Grenzziehung zu anderen Formen der Verhaltensbeein- den“ (Vogel, 2018, S. 52). Deshalb zeichnet sich Nudging als
flussung auf (Hausman & Welch, 2010). Die Popularität des ein praxisnahes Instrument aus, welches durch kreatives
Ansatzes führe dazu, dass jegliche Form der Verhaltensbeein- Ausprobieren immer wieder erprobt, modifiziert und stets
flussung als Nudge bezeichnet werde (Gigerenzer, 2015). mit praktischen Erfahrungen verbessert werden kann (test >
Dies führe dazu, dass Nudging-Interventionen in der Praxis learn > adapt).
nicht mehr klar von anderen Interventionen abgegrenzt wer-
den könnten. Hinzu komme, dass von den Befürwortern des
Nudgings eine Kombination unterschiedlicher Instrumente
zur Verhaltenssteuerung (ökonomische Anreize oder Hand-
lungsvorschriften) vorgeschlagen werde, um die Effektivität
von Interventionen zu steigern (Sunstein, 2014; Vlaev et al.,
2016). Dies führe dazu, dass die Grenzen zwischen den ver-
schiedenen Formen der Verhaltensbeeinflussung noch stär-
ker verschwimmen würden.
Die normative Kritik unterstellt dem Konzept, Menschen in
ihren Entscheidungen zu manipulieren. Entscheidungen wür-
den nicht aus der eigenen Bewertung der handelnden Person
getroffen. Stattdessen seien sie von den Entscheidungsarchi-
tekten, die einen Nudge kreieren, vorbestimmt. Damit wür-
den Präferenzen geschaffen, die nicht die eigenen seien und
somit die Willensfreiheit einschränkten (Schnellenbach,
2012). Beim Einsatz von Nudges in der Politikgestaltung be-
stimmten Vertreter der politischen Institutionen, welche die
zu bevorzugenden Handlungsoptionen bei Entscheidungen
seien, z. B. welche Option die „gesündere“, die „umwelt-
freundlichere“ oder die „nachhaltigere“ sei. Aber definieren
diese Personen wirklich Ziele, die auf das Wohl der Bevölke-
rung ausgerichtet sind? Nach Sunstein (2018) müssten Mani-
pulationen insbesondere von Politikgestaltenden ausge-
schlossen werden, indem Nudges transparent konzipiert
würden. Sowohl das Design als auch die Anwendung müss-
ten in der Öffentlichkeit sichtbar sein und debattiert werden.
12 | iga.Report 38Nudging im Unternehmen
3 Konzeptionelle Einordnung
In einigen Bereichen, wie z. B. der Verbraucher- und Umwelt- 3.1.1 Prinzipien der Prävention und der BGF
politik, werden Nudges bereits angewendet (Umweltbundes-
amt, 2017). Im Anwendungsgebiet von Prävention und BGF Der Nudge-Ansatz soll hier in Verbindung mit zentralen Fach-
fand bis dato kaum eine konzeptionelle Auseinandersetzung begriffen der Prävention und der BGF diskutiert werden.
mit dem Nudge-Ansatz statt. Deshalb bereitet der vorliegen-
de Report das Thema Nudging im Kontext von Sicherheit und Verhältnis- und Verhaltensprävention
Beschäftigtengesundheit explorativ auf. Der Logik der Prävention und BGF folgend geht es in den
Unternehmen darum, strukturelle Rahmenbedingungen am
Arbeitsplatz gesundheitsförderlich zu gestalten. Gesundheits-
3.1 Nudges als Instrument in der förderliche Strukturen betreffen z.B. Führungs- und Kommuni-
Prävention und der BGF kationskultur, eine bewegungsfreundliche Arbeitsumgebung,
gesundheitsgerechte Verpflegungsangebote sowie die ver-
hältnisbezogene Suchtprävention (GKV-Spitzenverband, 2018).
Das Anliegen von Prävention und BGF in Unternehmen ist es, Im Arbeitsschutz gilt ebenfalls der Vorrang von verhältnisbezo-
den Beschäftigten ein gesundes Arbeiten zu ermöglichen. genen Ansätzen. Maßnahmen sind zunächst auf der techni-
Der Arbeitsschutz trägt dazu bei, Unfälle bei der Arbeit zu schen und organisatorischen Ebene anzugehen. Können Risi-
vermeiden, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verrin- ken und Fehlbelastungen nicht durch technische oder
gern, Arbeit menschengerecht zu gestalten und somit Ar- organisatorische Maßnahmen behoben werden, müssen diese
beitsbedingungen für Beschäftigte zu verbessern. Die BGF durch personenbezogene Schutzmaßnahmen, wie z.B. das Tra-
setzt an der Verbesserung der gesundheitlichen Situation der gen einer persönlichen Schutzausrüstung, beseitigt werden.
Beschäftigten an. Ergänzend zum Arbeitsschutz werden Stra-
tegien verwendet, die sich auf die Gesundheitsressourcen Nudging als Konzept setzt an der Entscheidungsarchitektur
der Arbeitenden fokussieren und auf die Gestaltung einer an, d. h. an den physischen, sozialen und psychologischen
gesundheitsfördernden Umgebung zielen. Beide Ansätze in- Kontexten in einer Entscheidungssituation. Thaler und Sun-
tendieren ein gemeinsames Ziel: die Gesundheit der Beschäf- stein (2008) gehen von einer freien Entscheidung des Indivi-
tigten in der Arbeitswelt. Zur Zielerreichung werden unter- duums aus. Diese ist jedoch von den Umgebungsfaktoren
schiedliche Interventionsansätze verfolgt. bestimmt, die das (Gesundheits-)Verhalten beeinflussen. Der
Ansatzpunkt einer Verhaltensbeeinflussung ist somit die Ver-
Bei der Konzipierung von klassischen Angeboten, Maßnah- änderung der Verhältnisse. Eine Übereinstimmung mit den
men oder Kampagnen im Rahmen der Prävention und BGF Prinzipien der Verhältnis- und Verhaltensprävention liegt vor.
werden die menschlichen Denkfehler meist nur unzureichend
bedacht. Genau hier setzt das Nudging als Instrument an: am Empowerment
realen Entscheidungsverhalten. Dabei wird nicht von idealty- Ein weiteres Prinzip, welches der Prävention und der BGF zu-
pisch handelnden Arbeitenden ausgegangen. Der Mensch grunde liegt, ist die Befähigung des Individuums, Selbstbe-
wird vielmehr als ein nicht rein rational agierendes Wesen stimmung über die eigene Gesundheit zu gewinnen (WHO,
begriffen. Im täglichen Arbeitshandeln treffen Beschäftigte 1986). Folglich ist mit Empowerment gemeint, eigene Be-
Entscheidungen für oder gegen Sicherheit und Gesundheit. dürfnisse zu erkennen und Verantwortung zu übernehmen,
Ziel des Nudgings im Betrieb ist es, die sichere und gesunde und das ohne eine Fremdbestimmtheit. Auch im Arbeits-
Entscheidung zur einfachen Entscheidung zu machen. Mit schutz wird den Beschäftigten nicht nur eine objektbezogene
diesem Blickwinkel können Maßnahmen und deren Gestal- Rolle, sondern Eigenständigkeit und Eigenverantwortung
tung bedacht werden. Doch sind Nudges vereinbar mit den zugesprochen (Pieper, 2015).
Prinzipien von Prävention und BGF? Wie und wo können sie
im Rahmen der Prävention und der BGF Anwendung finden?
iga.Report 38 | 13Nudging im Unternehmen
Wahlmöglichkeiten eliminieren:
Regulierung, die Wahlmöglichkeiten komplett eliminiert
Regulative
Instrumente
Wahlmöglichkeiten begrenzen:
Regulierung, die Wahlmöglichkeiten begrenzt
Wahlmöglichkeiten durch negative Anreize steuern:
Finanzielle oder andere negative Anreize nutzen, damit
Menschen Aktivitäten unterlassen
Eingriffstiefe der Intervention
Ökonomische
Instrumente
Wahlmöglichkeiten durch positive Anreize steuern:
Finanzielle oder andere positive Anreize nutzen, damit
Menschen sich in einer bestimmten Weise verhalten
Wahlmöglichkeiten optimieren: Durch einladende Plakate oder Prozedurale
attraktive Apps Gesundheitsangebote ansprechend gestalten Instrumente
Entscheidungskontexte gestalten und Wahlmöglichkeiten
Unmittelbare Mittelbare
beeinflussen: Entscheidungen vereinfachen
Wirkung
Nudges Wirkung
und in eine Richtung „stupsen“
Informationen bereitstellen: Informationelle
Informieren und unterrichten Instrumente
Nichts tun oder einfach die aktuelle
Situation beobachten
Baseline
Abbildung 2: Einordnung von Nudges in Interventionsinstrumente unterschiedlicher Eingriffstiefe
(eigene Darstellung in Anlehnung an Umweltbundesamt, 2017, S. 49)
14 | iga.Report 38Nudging im Unternehmen
Nudging steht mit den genannten Ansprüchen in einem es werden keine Gebote oder Verbote ausgesprochen. Ver-
Spannungsverhältnis, denn es zielt vielmehr auf unbewusste bindliche Vorschriften im Arbeitsschutz werden von Nudges
Prozesse ab. Welches erwünschte Verhalten mit einem Nudge nicht tangiert, da sie keinen Ersatz bzw. keine Alternativen zu
angestrebt wird, ist nicht von den Beschäftigten selbst be- diesen darstellen. Es sind lediglich Ergänzungen zu beste-
stimmt, sondern von den Entscheidungsarchitekten gesetzt, henden Maßnahmen (Hartwig, 2017). Eine mittelbare Wir-
also von denjenigen, die den Nudge gestalten. Somit besteht kung üben Nudges in den Fällen aus, in denen sie „klassi-
die Gefahr, Beschäftigte lediglich in einer objektbezogenen sche“ Instrumente anreichern, beispielsweise, wenn bei der
Rolle zu verstehen und fremdbestimmte Ziele für diese zu Informationsaufbereitung visuelle Aspekte bei der Kommuni-
benennen. Bei dem Einsatz von Nudges in Betrieben muss kation genutzt werden.
dies bedacht werden. Diese Problematik kann durch eine
transparente Designphase und die Beteiligung der Zielgrup-
pe bei der Gestaltung abgemildert werden. Krisam, von Phi- 3.2 Legitimation von Nudges in der
lipsborn und Meder (2017) sehen sogar die Chance, durch Prävention und der BGF
die Aufklärung über psychologische Mechanismen, die beim
Nudging wirken, eine Kompetenzbildung zu ermöglichen, die
auch in anderen Lebensbereichen von Relevanz ist. Denn Der Einsatz von Nudges wird häufig mit den einschränken-
schließlich werden psychologische Mechanismen auch für den Fragen hinsichtlich der Legitimation und der Wirksam-
kommerzielle Interessen (Lebensmittel- oder Pharmaindus- keit verbunden. Die Legitimation der Sozialversicherung zur
trie) genutzt. Die Aufklärung über psychologische Mechanis- Beeinflussung von gesundheitsgerechtem Verhalten sowie
men im Rahmen des Nudgings kann laut Krisam et al. (2017) die empirische Evidenz von Nudges im Gesundheitsbereich
auch für solche Beeinflussungen sensibilisieren. Ein anderer werden nachfolgend thematisiert.
Ansatz sieht in Nudges die Chance, Menschen in ihren ange-
strebten Verhaltensweisen, die sie im Alltag jedoch nicht um- 3.2.1 Auftrag der Sozialversicherungsträger
setzen, zu unterstützen (z. B. regelmäßige Bewegung). Nudg-
ing macht in diesem Sinn die gesundheitsförderliche Option Was legitimiert die Sozialversicherungen zum Nudging im
leichter verfügbar und gibt Hilfestellung bei der Umsetzung Betrieb? Der Auftrag, mit dem die professionellen Gesund-
(z. B. Teilnahme am Rücken-fit-Kurs während der Arbeitszeit). heitsakteure der Krankenversicherung handeln, ist im Fünf-
Dabei gilt es, Bedürfnisse und Werte der Individuen nicht ten Sozialgesetzbuch (SGB V) formuliert. Aus diesem geht für
auszusparen (z. B. Freiwilligkeit der Teilnahme, keine Sanktio- die Prävention und die BGF hervor, dass strukturelle Rah-
nen bei Nichtbelegen des Kurses). Das Gleichgewicht an menbedingungen im Arbeitskontext gesundheitsförderlich
Selbstbestimmtheit und Fürsorge muss also gewahrt bleiben gestaltet werden sollen (§ 20b SGB V). Nudges können die-
(Schmidt, 2014). sen Auftrag unterstützen, denn die dahinterstehende norma-
tive Grundannahme des libertären Paternalismus ist kongru-
3.1.2 Eingriffstiefe von Nudges ent mit dem gesetzlichen Auftrag, Verhältnisse zu gestalten:
Sicherheits- und gesundheitsbezogene Regelungen in der Ar- „Da das Verhalten so stark von Umgebungsfaktoren be-
beitswelt liegen in unterschiedlichen Eingriffstiefen vor. Im einflusst ist, auf die der Einzelne wenig, private und öf-
Arbeitsschutz existieren regulative Instrumente wie Vor- fentliche/staatliche Institutionen jedoch viel Einfluss ha-
schriften, Regeln, Verordnungen oder Sanktionen. Diese sind ben, liegt die Verantwortung bei eben diesen Institutionen,
an bindenden Verhaltensanweisungen ausgerichtet, die Ein- zum Wohlergehen der Bürger beizutragen und die Verhält-
griffstiefe ist demnach hoch. Die BGF arbeitet hingegen mehr nisse so einzurichten, dass das erwünschte Verhalten mög-
mit informationellen und Befähigungsstrategien, welche auf lichst häufig eintritt. Thaler und Sunstein zufolge sind öffent-
einer freiwilligen Basis beruhen. Wird das Instrument Nudg- liche Institutionen dazu ermächtigt, in der beschriebenen,
ing auf einer Skala von regulativen bis informationellen Inst- libertär beschränkten Weise in das private Verhalten der Bür-
rumenten eingeordnet, so findet es sich in einem Bereich der ger einzugreifen und sie zu besserer Gesundheit zu ‚stupsen‘.
geringen Eingriffstiefe, wie der grafischen Darstellung in Ab- Gesundheitsplaner können also gerechtfertigt Modelle im-
bildung 2 zu entnehmen ist. Es wird unter anderem mit Ver- plementieren, die durch die bewusste Gestaltung von Ent-
einfachungen, Erinnerungen oder Feedback gearbeitet, aber scheidungsarchitektur und die gezielte Beeinflussung der
iga.Report 38 | 15Nudging im Unternehmen
Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens Menschen zu Anwendungsbereich nur wenige Übersichtsarbeiten, die sich
gesünderer Lebensweise animieren“ (Buyx, 2010, S. 228). mit der Wirksamkeit von Nudges beschäftigen (Vlaev et al.,
2016). Vlaev und Dolan (2015) übertragen in ihrem Artikel
Neben der Gestaltung der Rahmenbedingungen ist ein wei- Nudge-Ansätze explorativ auf den Bereich der Gesundheit.
terer Auftrag nach § 20 SGB V die Verminderung sozial be- Beide Autoren erheben dabei jedoch keinen Anspruch auf
dingter Ungleichheit von Gesundheitschancen. Bestimmte Vollständigkeit und stellen den Versuch zur Diskussion frei.
Arbeits- und Lebenssituationen erschweren die Entscheidung
für sichere und gesunde Optionen. Nudges können kompen- In dem Übersichtsartikel von Marteau et al. (2011) wird auf
satorisch wirken, indem sie gesundheitsförderliche Optionen die Frage „Can nudging improve population health?“ ein er-
verfügbar machen (Schmidt, 2014). Die Anwendung von nüchterndes Bild gezeichnet. Demnach wurden nur wenige
Nudges zum Erreichen benachteiligter Zielgruppen ist für Interventionen hinsichtlich ihrer Effektivität beurteilt. Insbe-
Schmidt eine Chance, gesundheitliche Ungleichheit zu redu- sondere der Nachweis einer nachhaltigen Wirkung steht
zieren. noch aus. So kam das Forschungsteam zu dem Schluss, dass
Nudging als alleiniges Instrument kaum eine Wirkung für
Für die Akteure der Unfallversicherung ist der Auftrag aus Veränderungen der Bevölkerungsgesundheit hat.
dem Siebten Sozialgesetzbuch (SGB VII) handlungsleitend.
Demnach gilt es, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und ar- Basierend auf bisherigen Forschungsarbeiten entwickelte die
beitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhüten. Regulative Forschungsgruppe um Hollands in ihrem konzeptionellen Ar-
Instrumente wie Vorschriften, Regeln oder Grundsätze wur- tikel von 2013 die Definition von Entscheidungsarchitektur
den zur Umsetzung dieses Auftrages erlassen. Wie bereits im Kontext von Public-Health-Interventionen weiter (Hol-
beschrieben, haben Nudges keine Auswirkungen auf diese lands et al., 2013). Für eine operationalisierbare und mess-
Regularien, denn sie sind als ergänzende Maßnahmen zu bare Definition betrachteten sie 440 Studien, die Interventio-
verstehen, die eine Veränderung des Verhaltens zwar be- nen auf Mikroumgebungen (z. B. Kantinen) untersuchten. In
günstigen, aber nicht dazu verpflichten. Eine Entscheidung diesen Umgebungen wurden entweder die Eigenschaft der
gegen eine durch Nudges dargebotene Option zieht keine Objekte/Stimuli, ihre Platzierung oder beides verändert. Das
Sanktionen nach sich. Den gesetzlichen Auftrag der Unfall- zugrunde liegende Ziel war die Beeinflussung des Gesund-
versicherung kann der Nudge-Ansatz dahingehend unter- heitsverhaltens. Es wurden Interventionen für die Bereiche
stützen, indem er in Kombination mit Vorschriften und Re- Ernährung, körperliche Aktivität, Alkohol- und Tabakkonsum
geln psychologische Mechanismen anspricht, die von systematisch erfasst und in einer Klassifikation berücksich-
Vorschriften allein nicht berührt sind. Erkenntnisse zu Com- tigt (siehe Tabelle 1). Für jeden dieser Bereiche werden die
pliance (Einhaltung von Regeln) im Arbeitsschutz (Hale & verfügbaren empirischen Studien aufgezeigt. Mit 70,2 Pro-
Borys, 2013) lassen vermuten, dass eine alleinige Verhaltens- zent aller identifizierten Arbeiten betrachten die meisten Stu-
steuerung von Beschäftigten durch explizite Regeln nicht dien das Ernährungsverhalten (Krisam et al., 2017; Hollands
ausreichend ist. Durch die Ergänzung anderer Formen der et al., 2013).
Verhaltenssteuerung erscheint ein regelgerechtes Verhalten
wahrscheinlicher (Elke, Gurt, Möltner & Externbrink, 2015). Damit kann für das Interventionsfeld „Ernährung“ auf eine
ausreichende Studienlage zurückgegriffen werden. Es exis-
3.2.2 Wirksamkeit im Gesundheitskontext tieren zwei aussagekräftige Metaanalysen, die die wirksams-
ten Nudges im Ernährungsbereich zusammenfassen. Diese
Es stellt sich die Frage, ob Nudging-Interventionen qualitäts- Studien belegen, dass Nudges (hier: Etikettierung, Priming,
gesichert sind. Die bisherige Forschungslage zur Wirksamkeit Dimensionierung) zu einer gesünderen Ernährungsweise
von einzelnen Nudges im Allgemeinen wurde im Kapitel 2.2 führen. Die Effektgröße liegt dabei im mittleren Bereich. Per-
(siehe S. 11) aufgearbeitet. In diesem Kapitel wird die Wirk- sonen, bei denen Nudges zum Einsatz kamen, haben sich um
samkeit von Nudges im Kontext der Gesundheit betrachtet. 15,3 Prozent häufiger für gesunde Lebensmittel oder eine
Da der Einsatz von Nudges am Arbeitsplatz noch keine aus- Reduzierung des Kalorienverbrauchs entschieden (Arno &
reichende wissenschaftliche Basis hat, muss dabei auf allge- Thomas, 2016). Eine weitere Metaanalyse (Broers, De Breu-
meine Erkenntnisse aus dem Kontext von Public Health zu- cker, Van den Broucke & Luminet, 2017) zeigt, dass Nudges
rückgegriffen werden. Jedoch existieren auch für diesen einen signifikanten Effekt (d = 0,3) auf die Entscheidung für
16 | iga.Report 38Nudging im Unternehmen
Obst und/oder Gemüse am Arbeitsplatz haben. Dies wird be- sächlich im Bereich der Ernährung vorhanden ist. Ein For-
sonders durch eine Veränderung der Platzierung in der Kan- schungsbedarf besteht somit weiterhin für die Anwendung
tine oder Küche (d = 0,39) umgesetzt. Auch die Wirksamkeit von Nudges in anderen Interventionsbereichen. Auch er-
von einer Kombination mehrerer Nudges (z. B. veränderte scheint eine kontinuierliche Evaluation von Interventionen
Platzierung und Verkleinerung der Portionsgröße) wird hier dahingehend relevant, inwiefern sie langfristige Verhaltens-
nachgewiesen (d = 0,28). änderungen bewirken oder auch unerwünschte Effekte ha-
ben (Krisam et al., 2017).
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine solide Evi-
denzbasis aus systematischen Übersichtsarbeiten haupt-
Tabelle 1: Typologie und Evidenzkartierung von Nudging-Interventionen nach Hollands et al., 2013,
entnommen aus Krisam et al., 2017, S. 120
Vorläufige Typologie von Interventionen in der Entscheidungs- Verfügbare Studien pro Interventionstyp
architektur auf Mikroebene nach Hollands et al. (2013) und Zielverhalten
Anzahl der Studienberichte
Interventionsklasse Interventionstyp
Ernährung Bewegung Alkohol Tabak
Ambiente: ästhetische oder atmosphärische
33 10 14 0
Aspekte einer Umgebung
Funktionelles Design: funktionelle Aspekte
27 11 5 0
einer Umgebung
Primäre Veränderung
Etikettierung: Kennzeichnung oder
der Eigenschaften
Darstellung von Informationen auf Produkten 78 0 7 10
von Objekten
oder am Entscheidungsort
und/oder Stimuli
Präsentation: sensorische Eigenschaften
21 0 0 2
oder visuelle Erscheinung eines Produkts
Dimensionierung: Größe oder Quantität
66 0 0 1
eines Produkts
Verfügbarkeit: Bereitstellung zusätzlicher
28 6 0 0
Primäre Veränderung Handlungsoptionen
der Platzierung
von Objekten
und/oder Stimuli Nähe: Veränderung des mit der Wahl von
21 1 0 0
Handlungsoptionen verbundenen Aufwands
Priming: Beeinflussung unbewusster
Veränderung sowohl
Handlungsentscheidungen durch subtile 9 1 5 1
von Eigenschaften
Umweltreize
als auch der
Platzierung von
Prompting: Bereitstellung allgemeiner
Produkten und/oder
Informationen, um die Bewusstmachung 26 55 1 1
Stimuli
von Handlungen zu fördern
Summe aller Interventionstypen 309 (70,2%) 84 (19,1%) 32 (7,3%) 15 (3,4%)
iga.Report 38 | 17Nudging im Unternehmen
4 Eine praktische Anleitung
In diesem Kapitel werden Modelle und Kriterien zur Gestal- Die Forschungsgruppe um Vlaev fasste 2016 die bisherige
tung von Nudges am Arbeitsplatz vorgestellt. Der Hand- Forschungslage im Kontext der Gesundheit zusammen und
lungsleitfaden beschreibt, welche Schritte bei der Gestaltung stellt anhand des MINDSPACE-Frameworks (Dolan et al.,
von Nudges und Nudging-Konzepten zu beachten sind. 2012) mögliche Ansätze zur Entwicklung von Nudges im
Kontext der Prävention und der BGF dar.
4.1 Gestaltung von Nudges Das MINDSPACE-Framework wurde im Rahmen der Arbeit
des BIT entwickelt (Dolan et al., 2010). Ziel des Frameworks
ist es, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit gut belegte Techniken
Gestaltungsmodelle im Rahmen von Nudging können als als eine Art Toolkit zusammenzufassen, die zur Verhaltensän-
Leitlinie für die Entwicklung von passgenauen Nudges gese- derung genutzt werden können. Diese basieren auf weitest-
hen werden. Sie beruhen auf zentralen verhaltenswissen- gehend automatischen neurobiologischen und psychologi-
schaftlichen Erkenntnissen und berücksichtigen Kontextfak- schen Prozessen (Dolan et al., 2012).
toren, die menschliche Entscheidungssituationen beeinflussen.
Gestaltungsmodelle liegen in unterschiedlichen Konzeptionen Im Folgenden werden auf der Basis der Arbeiten von Dolan et
vor. Handlungsempfehlungen gibt es unter anderem von der al. (2012) und Vlaev et al. (2016) die neun Techniken des
MINDSPACE-Checkliste (Dolan, Hallsworth, Halpern, King & MINDSPACE-Frameworks dargestellt und ihre Wirkmechanis-
Vlaev, 2010), der Weiterentwicklung des MINDSPACE-Ansatz- men erläutert (siehe Tabelle 2). Es wird betont, dass wir-
es in das EAST-Gestaltungsmodell (Behavioural Insights kungsvolle Nudging-Konzepte in der Praxis häufig eine Kom-
Team [BIT], 2014), dem CAN-Design (Wansink, 2015) sowie bination dieser Wirkmechanismen beinhalten (Vlaev et al.,
dem 4Ps-Framework (Chance, Gorlin & Dhar, 2014). Ziel die- 2016). Die Mechanismen werden als „aktive Zutaten“ be-
ses Kapitels ist es, eine Übersicht über fundierte Gestaltungs- schrieben, mithilfe derer ein komplexes „Gericht“ entstehen
modelle und Wirkmechanismen zu geben, die in der betrieb- kann. Die Wirkmechanismen weisen Ähnlichkeiten mit den
lichen Praxis genutzt werden können, um konkrete Nudges vier zentralen verhaltensökonomischen Erkenntnissen auf,
zu entwickeln. Besonders ausführlich wird die MINDSPACE- die im Kapitel 2 (siehe S. 10) dargestellt wurden.
Checkliste mit ihren empirischen Grundannahmen beschrie-
ben. Das EAST-Gestaltungsmodell und das 4Ps-Design finden
eine kurze Betrachtung.
4.1.1 Das MINDSPACE-Gestaltungsmodell
Wie bereits dargestellt wurde, beruhen wirksame Nudges
unter anderem auf Selbstregulationsprozessen (Vlaev et al.,
2016) und Erkenntnissen zu menschlichen Verhaltenstenden-
zen. Dementsprechend kann eine Vielzahl an Wirkmechanis-
men genutzt werden, um einzelne Nudges und Nudging-
Konzepte zu entwickeln. Eine Übersicht dazu gibt das
Behavioural Insights Team (BIT), eine Regierungsorganisa-
tion des Vereinigten Königreichs (Dolan et al., 2010, S. 80).
18 | iga.Report 38Nudging im Unternehmen
Tabelle 2: Das MINDSPACE-Gestaltungsmodell zur Verhaltensänderung (eigene Darstellung nach Vlaev et al., 2016)
MINDSPACE-Technik
(Wirkmechanismen) Verhaltensweise Beispiel
Messenger Wir werden von derjenigen Person Einbindung von angesehenen
(Absender) beeinflusst, die uns eine Information Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und/oder
übermittelt. Fachleuten
Incentives Unsere Antworten auf Anreize werden durch Anrechnung der Teilnahme an Aktionen als
(Anreize) vorhersehbare „mentale Abkürzungen“ Arbeitszeit
bestimmt, wie z. B. die Tendenz, Verluste zu
vermeiden oder Gewinne zu erzielen.
Norms Wir werden von dem beeinflusst, was Tragen der persönlichen Schutzausrüstung
(Normen) andere tun, z. B. durch soziale Normen und wird von Führungskräften vorgelebt und bei
Netzwerke. Nichteinhalten offen angesprochen
Defaults Wir „schwimmen mit dem Strom“ Automatische Anmeldung zu Aktionen
(Voreinstellungen, („go with the flow“) bei vorausgewählten mit der Option, sich wieder abzumelden
Standards) Handlungsoptionen.
Salience Unsere Aufmerksamkeit wird auf Neues Anbringung von Hinweisschildern mit ein-
(Salienz) und persönlich Relevantes gelenkt. gängigen Botschaften an Orten, die für das
Verhalten relevant sind
Priming Unsere Handlungen werden oft durch Auffällige Platzierung und attraktive
(Hervorhebung) unbewusste Reize und Auslöser beeinflusst. Gestaltung der gesünderen Mahlzeit
in der Kantine im Vergleich zur ungesunden
Variante
Affect Unsere Emotionen bestimmen unsere Gestaltung abschreckender Bilder
(Affekt) Handlungen. mit Konsequenzen des sicherheits- oder
gesundheitsgefährdenden Verhaltens
Commitments Wir streben innerlich nach Konsistenz: Öffentliches Commitment für das
(Selbstbindung) bei unseren öffentlichen Versprechen und Gehen von 10.000 Schritten am Tag durch
zwischenmenschlichen Handlungen. gemeinsame Teilnahme an einem
Wettbewerb
Ego Wir verhalten uns so, dass wir uns persönlich Individuellen Beitrag aller zu einer unterneh-
(Ichbezug) besser fühlen. mensweiten Gesundheitskampagne betonen
(„Mein Beitrag sorgt dafür, dass wir unser Ziel
erreichen.“)
iga.Report 38 | 19Nudging im Unternehmen
Messenger (Absender) An dritter Stelle kommt hinzu, dass Menschen Wahrschein-
Wie Menschen Informationen einschätzen und beurteilen, lichkeiten nicht realistisch einschätzen (Kahneman & Tversky,
hängt stark von ihren automatischen oder unbewussten Re- 1979, 1984). Unter anderem schätzen sie Risiken als bedroh-
aktionen auf die Person ab, von der sie die Botschaft erhalten licher ein, wenn sie in kleinen Zeiteinheiten angegeben wer-
haben (Dolan et al., 2012). Informationen, von Personen, zu den (z.B. „Jede Woche verletzen sich …“ vs. „Jedes Jahr ereig-
denen sie eine positive Einstellung haben, vertrauen sie mehr nen sich … Unfälle“) (Kahneman & Tversky, 2000). Daneben
und schätzen sie als glaubhafter ein als Informationen von wird das Risiko für das Eintreffen von Unglücken als höher
anderen Personen (Cialdini, 2007). Ebenso steigt die Wahr- eingeschätzt, wenn es gedanklich und emotional näher ist
scheinlichkeit für eine Verhaltensänderung, wenn sie Infor- (z. B. Überschätzung des Risikos für einen Flugzeugabsturz
mationen von Expertinnen bzw. Experten erhalten (Webb & durch regelmäßige Darstellung von Flugzeugunglücken in
Sheeran, 2006). Auch bewirken Informationen eher eine Ver- den Medien; Überschätzung des Risikos, schwer zu erkran-
haltensänderung, wenn sie von einer Person stammen, die in ken, wenn im Familien- oder Freundeskreis bereits eine
wichtigen Merkmalen mit der Zielgruppe übereinstimmt (Du- schwere Krankheit aufgetreten ist) (Kusev, van Schaik, Ayton,
rantini, Albarracín, Mitchell, Earl & Gillette, 2006). Dent & Chater, 2009).
Anregungen und Tipps für die Umsetzung: Anregungen und Tipps für die Umsetzung:
Bei der Bewerbung von Gesundheitsaktionen wird Es werden Gesundheitsangebote während der
darauf hingewiesen, dass diese Aktionen durch Arbeitszeit bereitgestellt.
Fachleute durchgeführt werden. Der Betrieb übernimmt einen Teil der Kosten für
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ein hohes individuelle Präventionsmaßnahmen.
Ansehen bei der Belegschaft genießen, werden bei der Relevante Studienbefunde:
Ankündigung und in die Durchführung von Aktionen Studien zeigen, dass Programme zur Gewichtsreduktion
eingebunden. effektiver sind, wenn die Teilnehmenden das Risiko
eingehen, Geld zu verlieren. Programme, bei denen
Incentives (Anreize) eine finanzielle Belohnung auf die Teilnehmenden
Menschen sind sensibel für Anreize und Kosten-Nutzen-Rela- wartete, sind hingegen weniger erfolgreich. Befunde
tionen (Kreps, 1990; Pearce, 1986). Insbesondere streben sie hierzu finden sich unter anderem bei Paul-Ebhohimhen
danach, mögliche Verluste zu vermeiden. So ist es ihnen & Avenell (2008) und Volpp et al. (2008).
wichtiger, das Risiko zu minimieren, einen bestimmten Be-
trag (z. B. an Geld) zu verlieren, als das Risiko einzugehen, Norms (Normen)
den gleichen Betrag zu gewinnen (Kahneman & Tversky, Wir werden in unserem Verhalten stark durch das beeinflusst,
1979). Diese Tendenz, die sich nicht nur auf finanzielle As- was andere tun. Aufgrund unseres Grundbedürfnisses nach
pekte bezieht, wird von den Autoren als Verlustaversion be- sozialer Eingebundenheit und Zugehörigkeit kann das Ver-
zeichnet. Die Gefahr, etwas zu verlieren, hat also einen grö- halten anderer auch das eigene Verhalten bestimmen (Axel-
ßeren Effekt auf das Verhalten als die Aussicht auf eine rod, 1986; Burke & Young, 2011). Menschen streben danach,
Belohnung. Geht es um positive Anreize, entscheiden sich die sozialen Normen des eigenen Umfelds zu erfüllen. Ziel
Menschen eher für Handlungsoptionen, die einen unmittel- einer Maßnahme wäre dementsprechend, soziale Normen zu
baren Erfolg oder Vorteil für die Gegenwart versprechen (z. B. etablieren und/oder zu beeinflussen. Für soziale Normen, de-
Geld direkt ausgeben vs. Geld als Altersvorsorge sparen) ren Verhalten erwünscht ist, kann es helfen, darzustellen,
(Kahneman & Tversky, 2000). was „normalerweise gemacht wird“ (informationeller sozia-
ler Einfluss) und was allgemein als „anerkannt“ gilt (norma-
Welchen Wert Menschen einer Sache oder einem Verhalten tiver sozialer Einfluss) (Deutsch & Gerard, 1955; Burger &
beimessen, hängt von zwei weiteren Faktoren ab: erstens, Shelton, 2011; Cialdini, 2003, 2007). Wenn es gelingt, ge-
welche Referenzpunkte herangezogen werden, und zwei- wünschte soziale Normen zu etablieren, kann sich dies posi-
tens, wie groß die Veränderung – von diesem Referenzpunkt tiv z. B. auf ein gesundes Essverhalten oder auf Bewegungs-
aus betrachtet – erscheint (ebd.). So können bereits kleine aktivitäten auswirken (Burger et al., 2010; Burger & Shelton,
finanzielle oder andere Anreize eine Verhaltensänderung be- 2011; Curtis, Danquah & Aunger, 2009; Perkins & Craig,
günstigen, wenn es vorher keinerlei Anreizsystem gab. 2006). Personen oder Gruppen, die sich bereits entsprechend
20 | iga.Report 38Sie können auch lesen