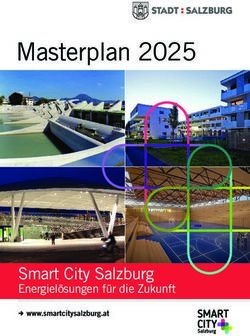IM ANGESICHT DES TODES - Sterbebegleitung - Maturitätsarbeit 2021 Sara Vetsch, C6b - palliative ch
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
IM ANGESICHT DES TODES
Sterbebegleitung
Maturitätsarbeit 2021
Sara Vetsch, C6b
KZO Wetzikon
Betreuende Lehrperson: Roman SpörriInhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis .................................................................................................................................... 1
1. Einführung ........................................................................................................................................... 2
1.1 Abstract ......................................................................................................................................... 2
1.2 Vorwort ......................................................................................................................................... 2
2. «Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht» ......................................................................................... 3
3. «Darin lese ich jeden Tag»................................................................................................................... 8
4. Theorie Hospiz St. Antonius .............................................................................................................. 13
4.1 St. Antonius Heim & Hospiz ......................................................................................................... 13
4.2 «Sie sterben nicht durch, sondern an unserer Hand» ................................................................ 15
4.3 «Ein Tattoo von den Toten Hosen» ............................................................................................. 22
5. Theorie Spiritual Care ........................................................................................................................ 26
6. «Der Glaube ist zu mir gekommen!»................................................................................................. 28
7. Theorie Palliative Care....................................................................................................................... 33
8. Fazit ................................................................................................................................................... 40
9. Dank ................................................................................................................................................... 41
10. Quellenverzeichnis .......................................................................................................................... 42
10.1 Internetquellen.......................................................................................................................... 42
10.2 Bücher ....................................................................................................................................... 43
10.3 Bilder ......................................................................................................................................... 43
11. Einführung
1.1 Abstract
Meine Maturitätsarbeit legt den Fokus auf Gespräche mit fünf Menschen, die täglich als Betroffene
oder Betreuende mit dem bevorstehenden Tod konfrontiert sind. Dabei stehen bei den Patien-
ten*innen Fragen über den Sinn des Lebens, über den Glauben, den Umgang mit der Angst vor Schmer-
zen und dem nahenden Tod im Zentrum. Bei den Betreuungspersonen liegt das Augenmerk auf der
Handhabung von gewollter Nähe und professioneller Distanz zu den Betroffenen, den notwendigen
beruflichen Anforderungen und ihrem Fundus an Erfahrungen. Auch ging ich der Frage nach: «Wo fin-
den Sie als Betreuende selbst seelischen Beistand, wo tanken Sie Ihre Kraft?» Der Theorieteil befasst
sich mit der Entstehung der Hospizbewegung und Entwicklung des Palliative Care Modelles. Mit dem
St. Antonius Heim & Hospiz habe ich mir näher befasst.
1.2 Vorwort
Menschen interessieren mich. Ich spiele mit dem Gedanken, nach dem Gymnasium Psychologie zu
studieren. Als ich mit meinen Eltern über die anstehende Maturaarbeit diskutierte, wurde mir bald
klar, dass Menschen dabei im Zentrum stehen sollen. In diesem Kontext sprachen wir über den Zyklus
des Lebens – von der Geburt bis zum Tod. Ich stellte dabei fest, dass die Geburt in unserer Gesellschaft
als freudiges Ereignis zelebriert und im Gegensatz dazu das Ableben tabuisiert wird. Dieser Gedanke
hat mich inspiriert und herausgefordert. Durch eine Internetrecherche über den Tod und seine Begleit-
umstände stiess ich auf Hospize und damit auf die Sterbebegleitung. Ich hatte schon davon gehört,
dass es solche Institutionen gibt, aber ich wusste im Prinzip wenig bis nichts darüber. Welche Men-
schen nehmen Sterbebegleitung in Anspruch? Eine Grundsatzfrage bleibt, ob eine Person Palliativ-
pflege in Anspruch nehmen darf oder nicht. Wie ist ein Hospiz strukturiert und organisiert? Meine
Neugier war geweckt! Ich erstellte ein Arbeitspapier mit entsprechendem Zeitplan. Zuerst kontaktierte
ich Hospizen und Spitäler mit Palliativabteilung. Bedingt durch die Coronapandemie sah ich mich plötz-
lich mit unerwartet hohen Hürden konfrontiert. Aus Angst vor Covid-19 haben viele Institutionen un-
erwartet schnell abgesagt. Erschwerend kam dazu, dass es generell in der Schweiz nur sehr wenige
Hospize gibt. Nicht bedacht hatte ich auch den Umstand, dass viele betroffene Menschen in der letzten
Phase krankheitsbedingt nicht mehr ansprechbar sind und deshalb nicht zur Verfügung stehen können.
Ich erweiterte deshalb meinen Blickwinkel und zog auch Betreuende von Sterbenskranken in meine
Arbeit mit ein. Dadurch konnte ich das Thema Palliative Care von verschiedenen Seiten beleuchten.
Ich freute mich auf die Begegnung mit mir unbekannten Menschen und auf ihre Lebensgeschichten.
22. «Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht»
Abbildung 1: Bruno Langmeier
Etwas unsicher betrete ich das Wohnzimmer eines Einfamilienhauses in Männedorf, die Maske griff-
bereit in der Hand. Von Karin Röthlisberger – sie ist gelernte Pflegefachfrau und Lebenspartnerin von
Bruno – werde ich ins Wohnzimmer der beiden geführt. Bruno sitzt auf einem Spitalbett im gleichen
Raum, von dem aus man den Fernseher gut bedienen kann. Er wirkt schmächtig, etwas abgemagert
und trägt eine Mütze und eine Faserpelzjacke. Ich nehme am Esstisch Platz und frage, ob ich für unser
Gespräch die Maske anziehen solle, was Bruno jedoch verneint.
Als ich bei Karin und Bruno anfragte, ob ich ein Interview machen dürfe, spürte ich im ersten Moment
eine gewisse Zurückhaltung und Vorsicht, vielleicht auch Angst, ob dies in dieser Coronazeit wohl über-
haupt möglich sei. Aber nach dem dreistündigen Besuch eröffneten mir die beiden, dass das Interview
ihnen gutgetan habe und sie Freude daran hätten, ihre Gedanken und Gefühle in einer Maturaarbeit
verewigt zu wissen.
Ich erkläre Bruno noch einmal das Ziel meiner Maturaarbeit und er hört sehr interessiert zu. Auf meine
Frage, wie es ihm heute gehe, antwortet er, er fühle sich etwas müde nach einer zweiwöchigen Grippe
mit Fieber und einem Abszess, weshalb er in letzter Zeit viel geschlafen habe. Er entschuldigt sich dafür,
unrasiert zum Interview zu erscheinen, aber seine Kräfte seien noch nicht vollumfänglich zurückge-
kehrt, so dass sogar eine Dusche jeweils ein Riesenprojekt sei.
3Name: Langmeier
Vorname: Bruno
Geburtsdatum: 19.07.1964
Zivilstand: Geschieden
Kinder: Eine Tochter
Konfession: Atheist
Hobbys: Musik hören, fernsehen (Dokus)
Beruf: KV Treuhand
Datum des Interviews: 29.08.2020
Abstürzen – wieder aufstehen
Mein Blick richtet sich auf die Hände von Bruno, die irgendetwas in eine metallene Schale bröseln. Er
bemerkt ihn und klärt mich auf: «Ich kiffe schon seit ich 14-/15-jährig bin. Die Ärzte haben es mir auch
jetzt nicht verboten, obwohl ich nur noch mit einer Lunge lebe und dies bereits seit sechseinhalb Jah-
ren. Für mich ist Kiffen wie ein Medikament schlucken, denn es ist schmerzlindernd und appetitanre-
gend und viel weniger schädlich als der andere Cocktail, den ich täglich einnehmen muss.»
Nachdem er Ende 2013 Blut gehustet und viele Abklärungen hatte über sich ergehen lassen müssen,
wurde bei ihm anfangs 2014 Lungenkrebs diagnostiziert. Nach einer schwierigen Operation und trotz
vielen Chemotherapien und Bestrahlungen empfindet er das Leben auch heute noch als sehr lebens-
wert. Er betont, wie glücklich er sei, dass bis jetzt noch keine Metastasen in seinem Körper gefunden
worden seien. Auch lobt er die fortschrittliche Medizin, denn eine regelmässige PET/CT (Positronen-
Emissions-Tomographie kombiniert mit einer Computertomographie (CT) in einem Gerät) ermögliche
bei ihm und natürlich bei allen anderen eine schnelle und genaue Lokalisierung und Beurteilung von
gesundem und krankem Gewebe. Mit der neuen Cyperknife Technik könne eine millimetergenaue Be-
strahlung eines Tumors vorgenommen werden (auch bei ihm in der Lunge). Dank dieser Methode sei
das Atmen während der Bestrahlung gut möglich, was früher nicht der Fall gewesen sei.
Bruno wuchs in Volketswil auf und blieb dort wohnhaft bis nach der Lehre, die er als Kaufmann auf
einem Treuhandbüro absolvierte. Er beschreibt seine Kindheit bis zur Oberstufe als sehr schön. Die
Oberstufe dann sei für ihn der pure Horror gewesen, so dass er das letzte Jahr in einem Internat zuge-
bracht habe. Nach der Lehre arbeitete er im Informatikbereich und war ein gefragter Mann des unte-
ren oder mittleren Kaders. Mit einem guten Lohn gründete er in Uster eine Familie. Der Teppich wurde
ihm unter dem Boden fortgezogen, als seine Frau ihm kurz nach der Geburt der einzigen Tochter mit-
teilte, dass sie eine Scheidung wolle. «Ich zog von einer traumhaften Wohnung in ein Loch», sagt er.
Plötzlich lief es auch im Geschäft nicht mehr optimal, denn Bruno wurde gemobbt. Er verlor seinen Job
und was darauffolgte, war die Geschichte von einem Kadermitarbeiter zum Tellerwäscher. Auf eine
lange Zeit als Arbeitsloser folgte eine Zeit mit zu viel Alkohol, wenig Geld, dann ein psychischer Zusam-
menbruch, ein Entzug. Erst als er 2002 seine jetzige Lebenspartnerin Karin kennenlernte, zeigte sich
das Leben wieder von der sonnigeren Seite. Auch beruflich rappelte er sich wieder auf und arbeitete
sich Stufe um Stufe empor bis zum Kundendienstleiter. Die Diagnose Lungenkrebs 2014 setzte aber
allen Plänen und Wünschen wieder ein Ende, denn seither ist Bruno arbeitsunfähig.
4Wichtig – unwichtig
«Was empfindest du rückblickend auf dein Leben als wichtig, was als unbedeutend? Würdest du deine
Prioritäten heute anders setzen?», frage ich ihn. Er seufzt und antwortet: «Das meiste im Leben ist
unwichtig. Ich habe so viele Fehlentscheidungen getroffen, meine Exfrau zum Beispiel. Sie hat mich bei
meiner Tochter immer schlecht gemacht, so dass mein Verhältnis zu ihr heute nicht gut ist. Wichtig ist
es auch, eine solide Ausbildung zu absolvieren, um einigermassen gut verdienen zu können. Man muss
nicht reich werden, aber zufrieden. 99% gehen Berufen nach, die ihnen nicht Berufung sind. Das macht
unzufrieden. Zufriedenheit mit dem, was man hat, ist das höchste Gut, das es zu erstreben gilt. Und
gesund müsste man sein. Ich habe meine Gesundheit aktiv selbst ruiniert, indem ich eineinhalb Päck-
chen Zigaretten pro Tag rauchte. Vielleicht hätte ich auch ohne zu rauchen irgendwann Lungenkrebs
gekriegt, aber das Risiko wäre 20 x kleiner gewesen.»
Abbildung 2: Brunos Krankenbett und Sauerstoffkonzentrator
Angst
Plötzlich entdeckt seine Lebenspartnerin eine Tablette auf dem Tisch und erschrickt. Es herrscht Un-
gewissheit darüber, ob Bruno diese wichtige Tablette beziehungsweise natürlich eine andere bereits
eingenommen hat. Das führt unser Gespräch auf die Medikamente, die Bruno täglich einnehmen muss,
es sind etwa 20 an der Zahl. Fein säuberlich aufgeräumt befinden sich diese in diversen Schubladen
eines Plastikgestells. Es sind dies Magenschoner, Magnesium (gegen Krämpfe und Verdauungsprob-
leme), Medikamente, damit der Schleim abgehustet werden kann und Pharmazeutika für die Blutbil-
dung, diverse Opioide und Morphintropfen, Cortison, Schmerz- und Schlafmittel. Dass Bruno gegen
viele Antibiotika bereits immun ist, macht seine Behandlung auch nicht einfacher.
5Regelmässiges Inhalieren, um die Lunge zu trainieren, gehört ebenso zum Tagesprogramm von Bruno,
wie das Herumgehen. Täglich muss er sechs kleine Mahlzeiten zu sich nehmen, wobei drei davon Ei-
weissdrinks sind, die einer Mangelernährung vorbeugen sollen.
Er ist stolz, wieder drei Kilo zugenommen zu haben und jetzt 51 Kilos auf die Waage zu bringen. Ich
schaue ihn an und frage unvermittelt: «Hast du Angst vor dem Tod?» Eine kurze Zeit ist es ruhig im
Wohnzimmer, dann antwortet er: «Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht. Ich glaube nicht an Gott,
beneide aber diejenigen, die das können. Ich bin ein Mensch der Wissenschaft und schaue mir viele
Dokus im Fernsehen an. Nein, eigentlich habe ich keine Angst, aber ich befasse mich auch nicht gross
mit diesem Gedanken. Da ich keine Metastasen habe, sehe ich mich im Moment keiner grossen Gefahr
ausgesetzt, ich bin sowieso gut darin, Dinge zu verdrängen. Ich habe nur Angst um Karin. Sie ist nicht
gerne allein. Ich weiss nicht, was mit ihr geschehen wird, wenn ich einmal nicht mehr sein werde. Auch
hat sie nachts Angst vor den Geräuschen in unserem Haus. Wir wohnen in einem Holzhaus, da knarren
manchmal die Dielen oder andere Holzkonstruktionen, verursacht zum Beispiel durch Temperaturun-
terschiede.»
Ratschlag an die junge Generation
Nachdem er von einem weiteren Joint auf dem Gartensitzplatz wieder ins Wohnzimmer tritt und sich
zu uns an den Tisch setzt, erkundige ich mich, ob er noch einmal jung sein möchte. Sofort bejaht er
meine Frage und sagt, er würde so gerne all die Reisen noch machen, die Karin und er einst geplant
hätten, Ski fahren und in den See springen. Es gebe so vieles, das ihm nicht mehr möglich sei, weil ihm
die Kraft dazu fehle. Aber etwas lasse er sich nicht nehmen. Regelmässig fahre er mit dem Auto – sein
transportables Sauerstoffgerät unter den Arm geklemmt – an den See in Männedorf. Als zusätzliche
Sicherheit trage er am Arm noch einen Notfallknopf, sollte irgendetwas Unvorhergesehenes gesche-
hen. Diese Ausflüge würden ihm ein Gefühl von Freiheit vermitteln.
Er erhebt sich von seinem Stuhl und holt beides, den grossen Sauerstoffapparat für zuhause und seinen
mobilen Sauerstoffspender. Er stellt die Geräte mitten ins Wohnzimmer, damit ich ein Foto machen
kann. Das Wohnzimmer ist eben auch ein Krankenzimmer.
Abbildung 3: Mobiler Sauerstoffspender
Langsam scheint Bruno wirklich müde zu sein. Das Interview mit mir hat ihn sichtlich erschöpft und
trotzdem bemerke ich, dass er zufrieden wirkt. Auf meine letzte Frage, ob er einen Lebenstipp für einen
6jungen Menschen wie mich habe, erwidert er: «Beginne nie zu rauchen, pass auf, mit welchen Leuten
du dich umgibst und erlerne etwas, das dir Spass macht!» Einer seiner Hustenanfälle schüttelt ihn er-
neut, dann doppelt er nach: «Du weisst hoffentlich, dass das Rauchen eine wirklich schlimme Sucht ist,
du bist beinahe so schnell süchtig wie bei Crystal Meth und davon loszukommen ist ebenso schwierig
wie bei der chemischen Droge.»
73. «Darin lese ich jeden Tag»
Abbildung 4: Karin Röthlisberger
Am Telefon sagt mir Karin, dass wir uns infolge der Coronapandemie besser auf dem Gartensitzplatz
bei ihr zuhause treffen sollten. Da das Wetter nicht besonders schön ist, entscheide ich mich eine di-
ckere Jacke mitzunehmen – frieren ist schliesslich unangenehm. Kaum angekommen, begrüssen wir
uns mit dem Ellbogen, was heute ja üblich ist. Darauf bittet sie mich dann doch ins Haus. Der trotz
schlechter Witterung heruntergelassene Sonnenstoren lässt das Wohnzimmer etwas dunkel erschei-
nen. Einige Minuten später steht eine Kanne mit feinem Tee und Gebäck auf dem Tisch. Meine Frage,
ob ich die Maske anziehen solle, verneint sie. Rückblickend kann ich sagen, dass je länger das Gespräch
dauerte, je kleiner schien die Angst vor einer Ansteckung zu sein.
Name: Röthlisberger
Vorname: Karin
Geburtsdatum: 19.08.67
Zivilstand: Ledig
Kinder: Keine
Konfession: Reformiert
Hobbys: Basteln, malen, zeichnen, fernsehen
Beruf: Pflegefachfrau
Datum des Interviews: 29.08.2020
8Das Helfen in den Adern
Ich frage Karin, wie es ihr gehe, worauf sie antwortet: «Ganz gut. Ich habe zwei anstrengende Wochen
mit Bruno hinter mir. Er hatte einen Abszess, der entfernt werden musste und immer wieder Fieber-
schübe mit gefährlich hoher Temperatur.» Sie hüstelt und erklärt, sie selbst sei ebenfalls Raucherin
(wie Bruno ihr Lebenspartner, der Lungenkrebs hat). Mittlerweile habe sie eine chronische Bronchitis.
Sie hält fest, eine Sucht sei eben auch eine Krankheit. Dummerweise habe sie mit 23 Jahren zwar erst,
aber eben doch, begonnen zu rauchen. Seit sie weiss, dass sowohl ihre Mutter als auch Bruno an Krebs
erkrankt sind, hat sie ihren täglichen Zigarettenkonsum noch erhöht.
Auf die Frage, wieso sie diesen Beruf erwählt habe, antwortet sie: «Seit ich mich erinnern kann, habe
ich den Menschen immer gerne geholfen. Für meine Eltern war dies gar nicht immer einfach. In meinen
Jugendjahren habe ich ohne zu überlegen wildfremde Personen mit nach Hause gebracht, einfach aus
dem Bedürfnis heraus, für die Menschen eine Hilfe sein zu wollen. Der Austausch mit vielen Leuten
war mir stets ein Anliegen. Ich hatte stets das Gefühl, dass ich jede Not auffangen musste. So lag der
Beruf der Krankenschwester auf der Hand. Da man damals diesen Beruf aber erst ab 18 Jahren erlernen
durfte, befand mein Vater, dass ich zuerst eine Ausbildung zur Kauffrau machen sollte, was ich schliess-
lich tat. Mein Wunsch diesen Beruf zu erlernen hat sich aber weiter gefestigt, so dass ich nach zwei
Jahren Berufserfahrung und allen nötigen Praktika die Ausbildung schliesslich doch begann.»
Ob sie ihre Berufung denn damals endlich gefunden habe, ist meine nächste Frage. Sie zögert kurz und
erklärt dann: «Jein. Durch mein Verlangen für andere Menschen da zu sein, habe ich mich erschöpft.
Zwei Jahre nach Beendigung meiner Ausbildung bin ich ausgebrannt gewesen. Ich habe die Menschen
jeweils auch nach dem Spitalaustritt weiter begleitet und versuchte, für ihre Anliegen da zu sein. Aber
es wurden immer mehr Menschen, denen ich mit Rat und Tat zur Seite stehen sollte, bis mir die An-
sprüche der anderen zu viel wurden. Ich musste in die Psychiatrie. Es fällt mir auch heute noch schwer
mich abzugrenzen. Ich war/bin mit all diesen Menschen unterwegs, fühle mich mit ihnen verbunden,
habe zu wenig Distanz. Diese Abgrenzung zu erlernen, wird für mich ein lebenslanger Lernprozess sein.
Anschliessend probierte ich noch in einem Pflegeheim zu arbeiten, hatte dort aber Mühe mit dem
Team. All diese Erfahrungen führten dazu, dass ich wieder in den kaufmännischen Bereich zurück-
kehrte.»
Eigenes Schicksal
Die Gedanken von Karin scheinen zurück in die Vergangenheit zu schweifen. Sie erzählt mir den Lei-
densweg von ihrer Mutter. Nach einer Hautkrebsdiagnose und -bekämpfung lebte ihre Mutter ohne
irgendwelche Beschwerden. Und ziemlich genau nach zehn Jahren – grundsätzlich sprechen Ärzte da-
von, dass nach 10 Jahren ein Krebs definitiv überwunden sei – erhielt ihre Mutter im November 2013
die Diagnose Brustkrebs. Dieser Krebs aber hatte bereits überall im Körper metastasiert. Karin wusste,
dass dies kam einem Todesurteil für ihre Mutter gleichkam. Sie kündigte kurzerhand ihren Job. Die
verbleibenden Monate wollte sie noch zusammen mit ihrer Mutter verbringen und sie pflegen. Die
gemeinsame, wertvolle Zeit sollte bis im März 2015 dauern, knappe eineinhalb Jahre.
Parallel dazu musste sie akzeptieren, dass ihre Kinderlosigkeit definitiv sein würde. Zehn Jahre blieb
ihr innigster Wunsch nach einem Kind unerfüllt. Heute denkt sie, dass es wohl seinen Sinn hatte, keine
Kinder erhalten zu haben – doch der Weg zur Annahme des Schicksals war schwierig.
Vorsichtig frage ich nach, ob ich wohl die Zusammenhänge richtig verstanden hätte. Bruno erzählte ja
ebenfalls davon, Ende 2013 Blut gehustet und die Krebsdiagnose Anfang 2014 erhalten zu haben. Karin
9nickt und sagt: «Es gab eine Zeit, da lag Bruno neben meiner Mutter im Spital, beiden floss die hoffent-
lich krebszerstörende Mixtur gleichzeitig in die Adern. Ich wusste manchmal nicht, wo mir der Kopf
stand. Immer wieder musste ich während der Betreuung neu entscheiden, wer mich wohl dringender
brauchte. Ich war manchmal so zerrissen!»
Abbildung 5: Erinnerungen an Verstorbene
In diese Zeit fielen auch ihre Bemühungen, die Bewilligung für eine freiberufliche Pflegefachfrau zu
erhalten. Ihr damaliges Krankenschwesterdiplom wurde umgewandelt und dem heutigen Standard an-
gepasst. Seit 2015 hat sie nun die Bewilligung als von allen Krankenkassen anerkannte selbständige
Pflegefachfrau zu arbeiten. «Und wenn wir schon gerade dabei sind, über administrative Angelegen-
heiten zu sprechen, möchte ich folgendes wirklich erwähnt wissen. Der Patient/die Patientin hat wäh-
rend der ersten zwei Jahre seiner/ihrer Arbeitsunfähigkeit zum Beispiel nach einer starken Chemothe-
rapie zwar noch 80% seines/ihres Einkommens durch die Arbeitslosenversicherung gedeckt. Danach
reduziert sich das Einkommen und gleichzeitig steigen die Kosten für die extrem teuren Medikamente.
Es können existenzielle Probleme entstehen. Selbst wenn der Patient/die Patientin nach der Behand-
lung noch arbeiten kann – vielleicht mit einem reduzierten Pensum zu Beginn – braucht er/sie Unter-
stützung in anderen Bereichen. Es ist in dieser Situation unglaublich schwierig, das Leben allein neu
aufzugleisen. Die Krankheit darf nie isoliert betrachtet werden, finanzielle, soziale, behördliche, admi-
nistrative, spirituelle und seelische Aspekte dürfen nie ausser Acht gelassen werden und müssen in die
Betreuung miteinfliessen. In diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob die Spitex künftig nicht auch
noch neue, zusätzliche Bereiche abdecken könnte.»
Leben mit Gott
Auf meine Frage, wie sich die Pflege ihrer Mutter von der Pflege Brunos unterscheide, beginnt Karin
über ihren Glauben an Gott zu sprechen, den sie nur mit ihrer Mutter, nicht aber mit Bruno teilen
konnte/kann. Sie erzählt, dass sie mit Jesus den ganzen Tag im Gespräch sei, dass sie ihn frage, was sie
als nächstes tun solle und müsse, dass sie ihn darum bitte, sie vor Schwierigkeiten zu bewahren und
ihr beim nächsten Vorhaben unter die Arme zu greifen. Sie schmunzelt, als sie über ihren Monolog
10spricht, der eigentlich ein Dialog mit Jesus sei. Sie staune immer wieder über die Kraft des Gebetes und
sei sehr dankbar für alle Leute, die im Gebet an sie dächten. Gott trage sie durch schwierige Situationen
hindurch, denn manchmal sei sie doch sehr traurig, müde und erschöpft. Die Pflege von Krebspatien-
ten*innen sei besonders anspruchsvoll, da man wenig bewirken könne, es sei ein Kampf, Vorhandenes
zu erhalten ohne Chance auf eine Verbesserung und in diesem Sinne ein ständiges Loslassen müssen.
Sie erzählt davon, dass es unglaublich schön gewesen sei, gemeinsam mit ihrer Mutter zu beten. Sie
erwähnt Texte und Andachten, die sie zusammen gelesen hätten, sie sprach davon, wie sie gemeinsam
im Bett gelegen und ERF Plus gehört hätten. Dieses Miteinander und diese Tiefe, die sie verband, gehe
weit über den Tod hinaus. Sie erwähnt, wie die Massagen, speziell die Fussmassagen, ihrer Mutter
gutgetan hätten und welche Bereicherung sie selbst dadurch erfahren habe, dass sie ihrer Mutter Er-
leichterung von den Schmerzen habe verschaffen können. Sie führt aus, dass die Menschen ihr magi-
sche Hände nachsagten. Sie liebe es, mit Berührung zu arbeiten und durch diese Interaktion und
Schmerzen lindern zu können. Ihre Mutter und sie hätten alle Unstimmigkeiten ausgeräumt, hätten
einander alles vergeben, alles in Ordnung gebracht, hätten sich gegenseitig ihre Liebe bekundet, hät-
ten einander für alles gedankt. In ihrer Beziehung sei nichts Oberflächliches gewesen, sie hätten das
Leben in seiner absoluten Tiefe verspürt, alles habe Substanz gehabt, sei wesentlich gewesen. Nach
dem Tod ihrer Mutter sei sie das erste Mal wirklich allein gewesen.
Abbildung 6: Andachtsbuch von Karin
Ihr tiefer Glaube veranlasst mich zu fragen: «Wie bist du denn zu deinem Glauben gekommen?» Sie
erzählt mir von ihrem gläubigen Elternhaus und dass ihr Vater Verwalter des Bibelheims Männedorf
gewesen sei. Dort sei sie dann auch in die Sonntagschule gegangen. An die 100 Kinder seien jeweils
gekommen und sie hätte den Sonntag jeweils mit grosser Vorfreude erwartet. Sie habe sich bereits mit
etwa acht Jahren bekehrt und habe auch in der Jugendgruppe und im Teenagerclub mitgewirkt.
Langsames Erlöschen des Lebenslichtes
«Was ist dir besonders wichtig im Umgang mit deinen Patienten*innen auf ihrem letzten Lebensab-
schnitt?», will ich wissen. Sie erklärt mir, wie wichtig es sei, die Bedürfnisse des Kranken zu erkennen
und ihn daran zu erinnern, nie zu vergessen sich am Moment zu erfreuen, getreu dem Motto „carpe
diem“ (nutze/pflücke den Tag, geniesse den Augenblick). Bedeutungsvoll sei es auch, eine angenehme
Atmosphäre zu schaffen. Sie arbeite zum Beispiel mit Kerzen, Lämpchen, Duftstoffen, Blumen und Mu-
11sik. Bei ihrem Lebenspartner Bruno habe sie gemeinsame Fotos von ihnen beiden an einer Wand am
Fusse des Bettes aufgehängt, das erinnere ihn an eine schöne, gesunde Vergangenheit und sei so im-
mer in seinem Blickfeld, wenn er sich ausruhe.
«Ist es dir möglich, den Sterbeprozess näher zu beschreiben?», erkundige ich mich. Sie fährt vorsichtig
mit der Hand über ihr zurückgekämmtes Haar und erzählt mir von einer mir noch fremden Welt: «Nor-
malerweise dauert der Sterbeprozess bei krebskranken Menschen Wochen. Langsam, aber stetig ver-
lieren sie immer mehr von ihren Fähigkeiten, sie müssen ihre Selbständigkeit abgeben. Die Abhängig-
keit von anderen Menschen nimmt zu. Das ist für beide Seiten nicht einfach zu akzeptieren. Je näher
der Tod kommt, je stärker werden die Schmerzen. Schmerzpflaster reichen irgendwann nicht mehr aus
und werden durch subkutane (unter die Haut applizierte) Spritzen abgelöst. Jetzt beginnt eine grosse
Herausforderung für die Ärzte und das Pflegepersonal – eine Gratwanderung. Die einen Menschen
wollen sich noch unbedingt von Personen in ihrem Umfeld verabschieden, klärende Gespräche führen
und nehmen deshalb starke Schmerzen in Kauf, andere entscheiden sich dafür, nicht mehr alles von
ihrer Umwelt wahrnehmen zu können, dafür die letzte Hürde schmerzfrei zu ‘überspringen’. In den
letzten Lebensstunden dann verklärt sich auch der Blick, es scheint, als ob der Patient bereits in einer
anderen Welt ist. Nun kommt der Moment, wo sich Seele und Geist vom Körper trennen müssen, dies
macht der Sterbende ganz bewusst. Ich glaube, dieser Prozess ist schlimm. In den letzten Stunden vor
dem Tod hat meine Mutter hörbar laut gestöhnt und ich hatte fürchterliche Angst, dass sie unerhörte
Schmerzen litt. Ich wurde aber aufgeklärt, dass dies nicht der Fall war und dies üblich sei, wenn der
Körper beginnt, nur noch die wichtigsten Organe mit Blut zu versorgen. In der End-End-Phase werden
nur noch Herz und Lunge mit frischem Blut versorgt, die Versorgung in die Peripherie ist nicht mehr
gewährleistet, wird eingestellt. Der Körper zentralisiert seine Versorgung auf die wichtigsten Organe,
zu mehr reicht ihm die Kraft nicht mehr. Das führt dazu, dass die Extremitäten violett werden können.
Etwa fünf Stunden vor dem Tod ist es häufig so, dass der Patient noch einmal stuhlen muss, vielleicht
möchte er noch etwas Letztes in Ordnung bringen, vielleicht erfolgt dies auch infolge der nachlassen-
den Muskulatur.» Sie führt weiter aus: «Weisst du, was erstaunlich ist? Die Wissenschaft hat heraus-
gefunden, dass sich in der Tränenflüssigkeit eine Substanz befindet, die dem Sterbenden hilft, seine
letzten Stunden erträglich zu machen. Die feuchten Augen des Patienten haben einen Sinn!»
Mein Weg, meine Zukunft
Die Frage, was bei Bruno im weiteren Verlauf beziehungsweise am Ende seines Lebens geschehen
könnte, beantwortet sie sehr fachmännisch und sachlich: «Durch ein Leberversagen könnte er ins
Koma fallen, auch eine Dekompensation des Herzens wäre möglich, wenn es überfordert wäre, oder
die Lungentumore könnten den Bronchus durchbrechen. Das wäre dann, wie wenn man mit einer Na-
del in einen Ballon sticht, die Lunge würde in sich zusammenfallen und Bruno würde ersticken.»
Sie erwähnt, dass sie schon Angst vor seinem Tod habe, sie könne nicht allein leben, eben auch nicht
in diesem Haus. Aber vor der Begleitung bis zum Tod habe sie keine Angst. Der Sterbende teile eigent-
lich immer mit, was er brauche. Bruno werde sie mitnehmen auf die letzte Wegstrecke.
Ich muss sagen, all diese Ausführungen haben mich tief berührt und die nächste Frage stelle ich erst
nach einem Schluck Tee: «Wie tankst du Kraft für deine Arbeit?» Sie steht auf, holt ein kleines Losungs-
büchlein und sagt: «Darin lese ich jeden Tag. Und an meinem freien Tag bin ich am liebsten Zuhause.
Mein Daheim ist meine Burg.»
124. Theorie Hospiz St. Antonius
4.1 St. Antonius Heim & Hospiz
Josef Anton Messmer, ein Priester, der selbst durch Krankheit invalid geworden war, wollte für behin-
derte Menschen eine Möglichkeit schaffen, friedlich zu leben. In Hurden, einer Halbinsel direkt am
Zürichsee, wurde er fündig und kaufte 1937 den Gasthof „Engel“. Bereits im Jahr 1938 zogen die ersten
behinderten Menschen in dieses neue Heim ein. Auch konnte Priester Messmer im Kloster Baldegg im
Luzerner Seetal Schwestern für seine Idee begeistern. Noch heute wirken Baldegger Schwestern im
Heim St. Antonius mit.
Im Jahre 1944 wurde die Stiftung St. Antonius Hochdorf-Baldegg durch das Kloster Baldegg gegründet.
Nur dank der Grosszügigkeit der Spender*innen an diese Stiftung konnte/kann die Zukunft des Heims
und des Hospizes gesichert werden. Über lange Zeit bewohnten mehrere Baldegger-Schwestern das
Heim. Jedoch hinsichtlich zunehmenden Alters beschlossen viele Schwestern wieder zurück in ihre Hei-
mat, in das Kloster zu ziehen. Die Folge davon war, dass es im Heim leerstehende Zimmer gab. Deshalb
gewann die Idee Raum, diese Zimmer anderweitig zu nutzen. Im Oktober 2011 wurde mithilfe der Stif-
tung und unter der Leitung von Schwester Jolenda Elsener das Hospiz St. Antonius eröffnet. Heute
bietet der Wohnort St. Antonius 37 Behinderten eine Heimat, und das Hospiz kann 4 Gäste aufnehmen.
Das Heim & Hospiz St. Antonius befindet sich an einem ruhigen, schönen Plätzchen in Hurden. In der
obersten Etage liegen vier Zimmer, welche immer für Gäste bereitstehen. Die todkranken Menschen
werden im Hospiz Gäste genannt. Mit direktem Seeblick, wunderschöner Natur und freundlichen Mit-
bewohnern*innen bietet das Hospiz den Gästen einen Ort an, um Ruhe zu finden auf ihrem letzten
Lebensabschnitt. Die Gäste werden herzlich aufgenommen und auf ihrem letzten Lebensabschnitt von
den Baldegger Schwestern begleitet. Insgesamt wohnen drei Schwestern in Hurden. Auch sie leben im
selben Haus, damit das Gefühl von Gemeinschaft vergrössert und das Zusammenleben verschönert
wird. Die Aussage von Schwester Jolenda: «Sie sterben nicht durch, sondern an unserer Hand» ist ein
wichtiger Grundsatz des Hospizes. Diese Aussage zeigt, dass allen Menschen im Hospiz die Möglichkeit
auf eine ganzheitliche Betreuung geboten werden soll. Die Baldegger Schwestern hören sich die Ängste
und Fragen der Gäste an und lassen sie spüren, dass sie auf ihrem „Sterbeweg“ nicht allein unterwegs
sind.
Ein Unterschied zu anderen Hospizen zeigt sich bei der Konfession. Die drei leitenden Personen gehö-
ren den Baldegger Schwestern an und haben somit einen christlichen Hintergrund. Der Alltag ist dem-
nach christlich geprägt. Jedoch ist der Glaube natürlich kein Aufnahmekriterium. Es spielt keine Rolle,
ob jemand Hinduist oder Atheist ist. Jede*r wird herzlich empfangen und begleitet. Schliesslich ist es
nicht das Ziel der Schwestern, die Gäste zu bekehren, sondern ihr Ableben so schön wie möglich zu
gestalten und ihnen zu helfen, den Weg zu ihrem Innersten zu finden. Der Sterbende/die Sterbende
soll ein familiäres Umfeld vorfinden, das es ihm/ihr ermöglicht, die verbleibende Zeit aktiv, den eige-
nen Möglichkeiten entsprechend, zu gestalten.
Die Philosophie des Hospiz besteht darin, den sterbenden Menschen eine kontinuierliche Anpassung
an ihren Zustand in Bezug auf die Verpflegung, den Tagesablauf und die pflegerischen Leistungen zu
bieten, denn bei diesen Gästen ist eine Behandlung, die auf Heilung ausgerichtet ist, nicht mehr mög-
lich.
13Die Hospizpatientinnen- und patienten erfahren eine sachgemässe Betreuung durch einen Facharzt
vor Ort oder durch den bisherigen Hausarzt/die bisherige Hausärztin und durch ausgebildetes Pflege-
personal. Auch Angehörige werden auf Wunsch der Betroffenen in die Betreuung miteinbezogen. Zu-
sätzlich helfen viele engagierte Mitarbeiter*innen mit, eine herzliche Atmosphäre zu schaffen.
Im Erdgeschoss befindet sich eine Cafeteria, die rege benutzt wird. Sie verfügt über einen gedeckten
Gartenplatz und steht auch der Bevölkerung von 13.30 bis 16.30 Uhr offen. Ein Treffpunkt für alle.1
144.2 «Sie sterben nicht durch, sondern an unserer Hand»
Abbildung 7: Schwester Jolenda
Um über Sterbebegleitung schreiben zu können, ist es essenziell, einen Besuch in einem Hospiz ma-
chen zu können. Ich kontaktierte verschiedene Einrichtungen, jedoch nur in Hurden, im Hospiz St. An-
tonius, stiess meine Anfrage auf offene Ohren. Zwar wurde ein Treffen infolge Corona auf unbe-
stimmte Zeit verschoben, aber ich erhielt die Zusage für eine Mitwirkung an meiner Maturaarbeit.
Name: Elsener
Vorname: Jolenda
Geburtsdatum: 23.11.1947
Zivilstand: Ordensschwester
Kinder: Keine
Konfession: Katholisch
Hobbys: Lesen, Auto fahren, beten
Beruf: Sozialpädagogin
Datum des Interviews: 27.07.2020
15Das Hospiz – die Pforte zum Paradies
Das Hospiz ist wunderschön gelegen. Es ist ein sonniger Tag im Juli 2020, als ich Schwester Jolenda, der
Leiterin des Hospiz St. Antonius in Hurden, einen Besuch abstatte. Zu einem späteren Zeitpunkt erfahre
ich, dass sich Patienten*innen dahingehend äussern würden, sie hätten schon das Gefühl im Paradies
zu sein. Schwester Jolenda begrüsst mich mit einem warmen Lachen und führt mich in ihr Büro. Jolenda
Elsener, wie sie mit bürgerlichem Namen heisst, ist eine Baldegger Schwester (sie gehört einem 1830
gegründeten franziskanischen Frauenorden an). Ihr Bildungsweg ist beeindruckend. Sie hat Theologie
studiert, ist Sozialpädagogin und hat eine katechetische Ausbildung. Mittlerweile wäre sie längst pen-
sioniert und kann auf eine 50-jährige Zeit zurückblicken, in der sie Kinder-, Jugend- und Altersheime
geleitet hat. Sie sagt, sie sei überzeugt, dass sie jetzt genau am richtigen Ort sei, denn zu ihr kämen
Personen, die dem Tod ins Auge sehen müssten und von ihrem Alter her gesehen sei sie dem Tod
ebenfalls näher als dem Leben.
Abbildung 8: Aussicht von der Hospizveranda
Schwester Jolenda arbeitet nun seit 20 Jahren in Hurden. Zuerst hat sie zwölf Jahre nur das Heim für
Schwerstbehinderte geführt und vor neun Jahren neu das Hospiz übernommen. Die Leitung des
Schwerstbehindertenheims hat sie dann aber einer anderen Fachkraft übergeben. Im Hospiz arbeiten
mit ihr noch vier Pflegefachfrauen, wovon zwei Ordensschwestern sind, und ein Arzt.
Das Hospiz kann seine Kosten trotz Zuschüssen von Gemeinde, Kanton und Krankenkassen nicht de-
cken, so dass das jährliche Defizit von der Stiftung übernommen wird. Diese Stiftung profitiert von
grosszügigen Spenden. Grundsätzlich ist es heute so, dass eine Tagespauschale von Fr. 140.- pro Tag
und Gast vom Hospiz erhoben wird. Dazu kommen Fr. 23.- für die Leistungen des Pflegedienstes, die
vom Kanton getragen werden. Das Hospiz nimmt aber auch Kranke auf, die sich einen Aufenthalt nicht
leisten könnten. Für Schwester Jolenda aber ist wichtig, dass der Patient/die Patientin eine friedliche
letzte Zeit hat und er/sie sich auf eine gute Art von der Welt verabschieden kann. Schliesslich soll auch
die Seele den richtigen Weg finden.
Nicht immer könne der Patient/die Patientin wählen, in welchem Hospiz er/sie die letzten Tage gerne
zubringen würde. Normalerweise werde man einfach dort hingebracht, wo es einen Platz frei habe. Sie
fährt fort mit ihren Erläuterungen. Schon oft sei es deshalb vorgekommen, dass Patienten und Patien-
16tinnen ohne Vorahnung ins St. Antonius Hospiz gekommen seien, ohne zu wissen, dass dieses von Or-
densschwestern geleitet werde. Sie wüssten einfach, dass dies die letzte Station in ihrem Leben sein
würde. Im ersten Moment sei der Schreck jeweils gross. Die Gäste hätten Angst, dass sie nun bekehrt
würden.
Abbildung 9: St. Antonius Heim & Hospiz
Schwester Jolenda sieht ihre Aufgabe aber in erster Linie darin, eine Beziehung zu den „Neuen“ im
Hospiz aufzubauen und sich um deren Angehörige und Gäste zu kümmern. Dem Tod ins Auge zu sehen,
sei für alle nicht leicht. Durchschnittlich bleiben die Patienten*innen drei Wochen im Hospiz, diese Zeit
kann von Mensch zu Mensch, zwischen einem Tag und drei Monaten variieren.
Von der Rebellin zur verständnisvollen Leiterin
Schwester Jolenda wuchs mit sieben Brüdern und drei Schwestern katholisch auf. Damals wurde der
Grundstein für ihre soziale Ader gelegt. Sie erzählt von einem strengen Vater und einer liebevollen
Mutter. Nicht nur die Liebe ihrer Mutter, sondern besonders auch die Strenge des Vaters hätten sie zu
dem gemacht, was aus ihr geworden sei. Sie sei bereits als Kind sehr gläubig gewesen und habe regel-
mässig die Kirche besucht. «Deshalb ist es mir schon immer so gut gegangen!», lacht sie. Als Kind sei
sie schwierig gewesen, weshalb sie auch immer viel Verständnis für Kinder gehabt hätte, die nicht ein-
fach gewesen seien. «Ich habe mich dann aber noch entwickelt», hält sie lachend fest. Grundsätzlich
ist sie davon überzeugt, dass Kinder aus einem guten Elternhaus früher oder später wieder Boden un-
ter den Füssen finden, auch wenn sie einmal eine Zeit lang quergeschlagen haben. Ihr Weg führte sie
denn auch in ein Kinderheim, wo sie neun Jahre als Gruppenleiterin und neun Jahre als Heimleiterin
tätig war. Es seien Kinder zu ihr ins Heim gekommen, deren Zuhause unerträglich gewesen sei und
Kinder, die sich in der Schule unmöglich benommen hätten. Sie habe sich aber prächtig mit diesen
Kindern verstanden, was man von den Erzieherinnen nicht habe sagen können. Oft seien die Kinder zu
ihr gekommen und hätten sich über die Erzieherinnen beklagt. «Ganz ehrlich, ich wäre ebenfalls nicht
folgsam gewesen und hätte einen Dreck auf diese Erzieherinnen gehört!», betont sie. Die Diskrepanz
zwischen den Ansichten der Erzieherinnen und ihrer eigenen habe denn auch dazu geführt, dass sie
17diese Arbeit an den Nagel gehängt habe. Gerne erinnere sie sich aber daran, dass sie während der
Skilager als Köchin fungiert habe und im Sommer Velo gefahren und mit den Kindern geschwommen
sei. Selbst Fussball spielen war ihr nicht fremd, sie gewann sogar mit ihren Heimkindern mehrere Tur-
niere. Später dann war sie als Katechetiklehrerin sehr beliebt, sie erreichte sogar die Herzen schwie-
rigster Kinder, zu ihr gingen sie gerne in den Unterricht.
Ich beginne zu ahnen, dass Schwester Jolenda die Gabe hat, mit den verschiedensten Menschen ins
Gespräch zu kommen, sie dort abzuholen, wo sie sich spirituell befinden. Schwester Jolenda hofft, dass
Gott diejenigen Menschen zu ihr ins Hospiz führt, die es nötig haben und die ihrer Hilfe bedürfen. Dabei
braucht sie nicht zu missionieren oder zu predigen, allein ihr Dasein, ihre Anwesenheit für jeden Ein-
zelnen lässt die Menschen innehalten und ermöglicht es ihnen, etwas von der göttlichen Liebe zu spü-
ren.
Natürlich werde sie auch gefragt, was es denn mit dem Tod auf sich habe und was nach dem Tod
geschehe. Dann erkläre sie den Leuten, sie sei auch noch nie auf der anderen Seite gewesen, aber diese
Frage sei eine des Glaubens. Sie selbst sei katholisch und lebe nach dem Evangelium mit der Überzeu-
gung, es folge nachher das Paradies. Jesus Christus sei für uns alle am Kreuz gestorben und wieder
auferstanden.
Die Kerze – Licht und Wärme
«Hatten Sie auch schon Kranke zu Gast, die durch Exit ihr Leben verkürzen wollten?», erkundige ich
mich. «Ja», erwidert sie, «drei Leute wollten Exit machen und mussten deshalb das Hospiz wieder ver-
lassen. Es tut mir sehr leid, dass diese Menschen nicht mehr warten können, bis der natürliche Tod
ihrem Leben ein Ende setzt, aber machen kann ich nichts dagegen. Dies ist jedes Mal ein trauriges
Erlebnis. Der Mensch will bis an sein Ende selber entscheiden, was gut für ihn ist. Er will sich nicht
pflegen lassen, vielleicht hat er auch sehr starke Schmerzen. Aber auch diese Menschen finden den
Weg ins Paradies. Der Weg über Exit ist einfach kurvenreicher. Sowieso glaube ich, dass alle Menschen
in den Himmel kommen, bei manchen dauert es einfach entsprechend länger. Weisst du, es ist sehr
wichtig, dass derjenige das Licht ablöscht, der es auch angezündet hat. Wenn wir auf die Welt kommen,
nehmen wir alle eine Kerze entgegen. Einige haben eine grosse, dicke Kerze, andere eine kleine be-
kommen. Aber wichtig ist es, dass wir mit dem Licht den uns vorbestimmten Weg gehen, sei er nun
kurz oder lang.»
«Was wissen Sie über das Sterben?», frage ich sie. «Sterben ist etwas Einmaliges und jedes Sterben ist
ein anderes. Ich empfinde es als Privileg, beim Sterben dabei sein zu dürfen. Sterben ist ein grosses
Geheimnis und es ist ein Wunder, wenn die Seele den kranken Körper verlässt und von den Engeln in
das göttliche Licht abgeholt werden kann.» Sie führt aus, auch wenn zum Beispiel mehrere Leute mit
einem Hirntumor ins Hospiz eingeliefert würden, könne der Krankheitsverlauf nie vorausgesagt wer-
den, denn jeder Mensch als Individuum reagiere unterschiedlich und habe wesenseigene Gedanken
im Kopf.
18Abbildung 10: Schwimmlift für Handicapierte in Hurden
In den vergangenen neun Jahren habe sie bereits weit über 300 Personen begleitet. «Sie sterben nicht
durch, sondern an unserer Hand. Es ist ein Kommen und Gehen», sagt sie. Diese Arbeit sei für das
Betreuungs- und Pflegepersonal sehr kräfteraubend und intensiv. Es würden deshalb nur Leute hier
arbeiten, die älter als 40 Jahre alt sind und schon viele Jahre Erfahrung mitbrächten. Es brauche eine
gewisse Reife für diese Tätigkeit. Für junge Leute wäre dies eine unzumutbare psychische Belastung,
wenn sie sähen, wie die Kranken immer wegstürben. Grundsätzlich sei es wohl etwas vom Schwierigs-
ten, nicht müde zu werden und immer wieder die Bereitschaft zu haben, sich auf neue Menschen zu
freuen und gleichzeitig dem Tod wieder in die Augen zu schauen.
Distanz und Nähe, Beruf und Berufung
«Können sie sich genügend abgrenzen?», frage ich sie. «Ja, das habe ich immer gut gekonnt», antwor-
tet sie, «Speziell bei den Kindern war dies besonders wichtig gewesen. Ich habe ihnen gezeigt, dass ich
sie gernhabe, aber ich liess sie nie so nah an mich herankommen, dass es sie verletzen würde, wenn
sie das Heim verliessen. Es ist sehr wichtig, das richtige Mass von Distanz und Nähe zu haben. Und 50
Jahre Erfahrung tragen natürlich dazu bei, diese Fähigkeit zu fördern. Es beelendet mich aber noch
heute, wenn Angehörige nach einem Todesfall sehr stark weinen müssen und die Trauer sehr gross ist.
Erleichterung empfinde ich hingegen, wenn ich mithelfen konnte, familieninterne Spannungen abzu-
bauen oder mithelfen durfte, zerrüttete Beziehungen wieder ins Lot zu bringen.»
Schwester Jolenda ist dabei, für das Hospiz eine gute Nachfolgelösung zu finden. Sie sucht geeignete
Frauen, die die Leitung des Hospizes übernehmen könnten. Da sie die Führung des Hospizes erst nach
ihrer Pensionierung übernommen hat, sieht sie die Zeit nun gekommen, zurück ins Kloster zu gehen.
Ihre Nachfolgerin wird keine Baldegger Schwester mehr sein, denn der Baldegger Orden hat keinen
Nachwuchs mehr. Sie ist nicht betrübt darüber, dass das Klosterleben auszusterben droht. Es ist nicht
ihre Art, traurige oder mürrische Gedanken an unabänderbare Tatsachen zu verschwenden. Sie selbst
19habe eine wunderbare Zeit im Kloster erlebt. Heutzutage müsste einem Kosterleben ein völlig neues
Konzept zugrunde gelegt und andere Möglichkeiten, Formen und Ansätze ausgearbeitet werden. «Um
sich für das Gute auf der Welt einzusetzen, muss man aber keineswegs eine Ordensschwester sein»,
so ihre Aussage.
Ich stelle ihr noch eine letzte Frage: «Möchten Sie noch einmal jung sein?» Sie antwortet ohne zu zö-
gern: «Nein, das möchte ich nicht. Ich sehe jetzt dem Ende meines Lebens entgegen und darf irgend-
wann abtreten und gehen. Ich hatte ein erfülltes, reiches Leben und habe von den Menschen viel zu-
rückerhalten durch meine dienende Arbeit. Ich konnte meine Berufung leben und habe mich einem
sozialen Leben verschrieben. Ich trage keine Bürde mit mir in einem Rucksack herum. Ich verspüre
auch keine Reue oder ein ungestilltes Verlangen; Nach Fehlern habe ich immer versucht, mit der je-
weiligen Person in Ordnung zu bringen, was zwischen uns stand. Ich bin leer auf die Welt gekommen
und verlasse diese wieder leer. Mein Lebenssinn bestand darin, für Gott und die Menschen zu leben,
mit ihnen unterwegs zu sein. Ich hätte auch eine Familie haben können, aber nur für einen Mann und
zwei/drei Kinder zu sorgen, war wohl nicht meine Bestimmung. Gott ganz nah zu sein, ist mir wichtig.
Ich hoffe, wenn ich sterbe, dass ich Gott erkennen werde, für ihn habe ich gelebt und geliebt – für ihn
hat es sich gelohnt zu leben und zu lieben.»
Geschichten aus Jolendas Leben
Sie erzählt:
«Ein jüngerer Mann wurde ins Hospiz gebracht. Er betonte seinen Atheismus. Wahrscheinlich wollte
er mir gerade von Anfang an klar machen, dass es sinnlos sein würde, ihm etwas über Gott zu erzählen.
Ich sagte zu ihm: „Das finde ich gar nicht so schlecht, dann machen wir nämlich dasselbe – zu glauben.
Sie glauben, es gibt keinen Gott, ich glaube, es gibt einen.“ Damit konnte ich den Bann zwischen mir
und dem Patienten brechen. Bis zu seinem Tod nach zehn Tagen haben wir viele gute Gespräche ge-
führt. Der Mann hat mich sogar einmal gefragt: „Wie habe ich das verdient, ein so schöner Ort und alle
sind so lieb zu mir. So etwas zu schenken ist wichtiger als jede Katechese!“ Dieser Mann konnte sein
Leben beruhigt loslassen und frei werden. Er hat zu sich selbst gefunden, indem er etwas von der gött-
lichen Liebe spüren durfte.
Einmal kam eine Frau zu uns ins Hospiz. Ich habe sie sehr bewundert. Sie war ungefähr sieben Wochen
hier. Obwohl sie erst 64 Jahre alt war, konnte sie ihre Krankheit gut annehmen. Die Frau hätte zwar
ihre Enkel*innen gerne heranwachsen sehen, doch da sie so sehr überzeugt war, dass nach dem Tod
etwas viel Schöneres auf sie warten würde, haderte sie nicht mit ihrem Schicksal.
Einmal kam ein älterer Herr, der von Einsiedeln stammte, um 14.30 Uhr zu uns ins Hospiz. Er hatte sich
bei Exit angemeldet, was speziell sein Sohn nicht akzeptieren konnte. Der Mann aber hatte seine Frau
acht Jahre lang gepflegt und es stand für ihn fest, dass er eine solche Pflegeintensität auf keinen Fall
über sich ergehen lassen wollte. Ich erklärte ihm: „Ihre Frau ist jetzt bei Gott und schon bereit Sie
abzuholen. Wenn Sie Ihr Leben aber vorzeitig beenden, stimmt der Zeitpunkt nicht mehr, denn Ihre
Frau kommt genau dann, wenn es für Sie vorherbestimmt ist, die Erde zu verlassen. Mit einem vorzei-
tigen Tod würde die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Frau zerstört.“ Am gleichen Abend ging es
diesem Mann gar nicht gut und er musste mit Morphium versorgt werden. Noch in der gleichen Nacht
um 5.30 Uhr verstarb er. Seine Kinder haben sich sehr bei mir bedankt. Genau dieses Gespräch hat ihm
geholfen, in Ruhe sterben zu können.
20Einmal kam eine Frau ins Hospiz. Sie war leicht depressiv und auch etwas böse. Sie hatte eine schwie-
rige Jugend gehabt. Als sie mit 17 mit einem unehelichen Kind schwanger war, wurde sie von ihrer
Familie verstossen. Sie zog nach Zürich und lernte dort ihren künftigen Mann kennen. Doch dieser war
ein Trinker und schlug sie. Von ihm hatte sie eine zweite Tochter. Den Glauben an Gott hatte sie ver-
loren, denn was ihre angeblich christlichen Eltern ihr angetan hatten, schien unverzeihlich.
Als ich sie besuchte, sagte ich ihr, dass sie wunderschöne Augen habe und ein bezauberndes Gesicht,
wenn sie nur etwas mehr lächeln würde. Ich sagte ihr auch, dass ich von ihrem verletzten Herz und von
ihren verletzten Gefühlen wisse, aber ihre Seele sei noch ganz rein, denn dort wohne Gott. Ich empfahl
ihr, alle schlechten Erinnerungen und Gedanken wegzulegen und mit einer reinen Seele zu sterben.
Darauf wurde die Frau sehr herzlich. Eine Tochter, die zu Besuch kam, bemerkte die Veränderung an
ihrer Mutter und ich erklärte ihr: „Deine Mutter ist jetzt auf dem richtigen Weg und dabei, alles Un-
wichtige loszulassen.“
Einmal kam ein 78-jähriger Mann zu uns. Er wusste, dass dieses Hospiz von Klosterfrauen geleitet wird
und betonte, er würde sich niemals bekehren lassen. Während der drei Wochen, die er hier war, hat
er mir immer wieder davon erzählt, wie er jeweils mit dem Hund im Wald spazieren gegangen sei und
wie er den pfeifenden Vögeln zugehört habe, wie schön hohe Tannenbäume seien und all die anderen
Pflanzen. Ich dachte bei mir, mit seiner positiven Einstellung und Fürsorge für die Natur ist er dem
Schöpfer immer näher gewesen, als er dies wahrscheinlich selbst vermuten würde. Eigentlich hat er
unbewusst ein christliches Leben geführt. Kurz vor seinem Tod hat der Mann seiner Frau dann erzählt,
was ich zu ihm gesagt hatte: „Gott kennt mich.“ Ein Mensch, der sagte, er glaube nichts und nach dem
Tod sei alles vorbei, darf auf dem Totenbett diese Erfahrung machen. Ein Wunder!»
214.3 «Ein Tattoo von den Toten Hosen»
Abbildung 11: Ein Foto, gemacht von Andrea Schmid
Total nervös sass ich etwa zehn Minuten vor dem Telefon, mich vorbereitend auf den ersten Anruf mit
einer Sterbenskranken. Schwester Jolenda hatte mir zwar versichert, Frau Schmid sei sehr zugänglich,
jedoch konnten meine Arme nicht aufhören zu zittern. Ich wählte ihre Nummer und nach dem dritten
Klingeln war die freundliche Stimme einer Frau zu hören. Das Telefonat verlief gut und deshalb liess
auch meine Anspannung schnell nach. Wir vereinbarten einen Termin auf Mitte Juli 2020 und meine
Vorfreude auf das Treffen war riesig.
Mit Bus und Zug fahre ich nun nach Hurden. Umgeben vom Zürichsee und fernab von Lärm kommt mir
die Gegend sehr friedlich und schön vor. Zusätzlich ist die Temperatur an diesem Tag angenehm warm
und das Sonnenlicht glitzert auf der Seeoberfläche – richtiges Ausflugswetter. Der Weg vom Bahnhof
bis ins Hospiz dauert zwar nur fünf Minuten, doch denke ich über vieles nach. Denn ausser ihrem Na-
men ist mir bis jetzt noch nichts über Andrea Schmid bekannt. Mit einer über Mund und Nase gezoge-
nen Maske schreite ich die letzten paar Stufen hinauf und öffne die grosse Eingangstür zum Hospiz. An
der Rezeption lächelt mir eine Frau zu und bittet mich freundlich zu ihr. Ich muss mich noch registrie-
ren, falls ein Contact Tracing zu einem späteren Zeitpunkt nötig sein würde, sowieso aber wäre es
denkbar ungünstig, wenn jemand einen Virus in ein Heim voller schwerstkranken Menschen bringen
würde. Nach der Administration beschreibt mir die Empfangsmitarbeiterin den Weg zu den Zimmern
der Palliativ-Abteilung. Im obersten Stock des Gebäudes, mit einer wundervollen Aussicht befinden
sich die Zimmer. Gemütlich schreite ich den Gang entlang und betrachte alles sehr genau. An den Wän-
den hängen farbige Bilder und durch ein Dachfenster dringt etwas Licht in den sonst recht düsteren
Gang. Die Atmosphäre verleiht mir das Gefühl zu Hause zu sein. In der hintersten Ecke des Flurs mache
22ich das Zimmer mit der gewünschten Nummer ausfindig. Ich nähere mich dem Raum, warte kurz und
klopfe dann dreimal kräftig an die Tür.
Name: Schmid
Vorname: Andrea
Geburtsdatum: 11.06.1976
Zivilstand: Ledig
Kinder: Keine
Konfession: Atheistin
Hobbys: Fotografieren
Beruf: Coiffeuse
Datum des Interviews: 14.07.2020
Beginn der Krankheit
Eine eher weit entfernt tönende Stimme antwortet mit: «Ja?», aber Frau Schmid öffnet schliesslich die
Tür, bevor ich antworten kann. Ihr Gesicht spiegelt die Überraschung, als sie mich erblickt und mich
fragt, wer ich sei. Sie hat nämlich komplett vergessen, einen Termin mit mir vereinbart zu haben. An-
statt einfach in ihrem Zimmer ein Interview durchzuführen, entscheiden wir uns, draussen auf der Ter-
rasse das anstehende Gespräch zu führen und dazu die Sonnenstrahlen zu geniessen. Dazu müssen wir
einen Raum durchqueren, in dem weitere Bilder zu sehen sind und in dessen Mitte sich ein runder
Tisch befindet. In der Ecke sticht mir eine kleine Küche ins Auge, aus der sicherlich Snacks und Getränke
stibitzt werden dürfen. Die Aussicht von der Terrasse ist unvergleichlich schön und es scheint hier der
perfekte Ort zu sein, um sich entspannen zu können. Wir setzen uns so weit auseinander, dass wir uns
ohne die störende Maske miteinander unterhalten können.
Ich erkundige mich, wie es ihr gehe, worauf sie entgegnet, es gehe ihr ok. Sicher, es gebe schlechtere
und bessere Tage, aber heute sei ein OK-Tag. Ihre Schmerzen seien erträglich, denn die Medikamente
wirkten gut und sie könne auch besser laufen als auch schon. In ihrem Zimmer habe ich zuvor einen
Blick auf einen Rollator werfen können, aber heute scheint sie nicht darauf angewiesen zu sein. Kurz
darauf entdeckt sie, dass ich nichts zu trinken habe, weshalb sie aufsteht und mir ein Glas Wasser aus
der kleinen Küche holt. Ein bisschen quält mich schon das schlechte Gewissen, als ich einer hinkenden
Frau zusehe, die mich bedient, obwohl ich das Getränk wirklich hätte selbst holen können.
Wir beginnen über die Kindheit und das Leben von Frau Schmid zu reden. Sie selbst beschreibt ihre
Kindheit als recht normal. Sie wuchs mit zwei Elternteilen und einer älteren Schwester in Meilen auf.
Ausserdem hatte die Familie Kätzchen und Wellensittiche als Haustiere. Ihr Elternhaus war nicht reli-
giös und auch sie konnte mit Religion nicht viel anfangen. Sie sagt, das habe sich bis heute nicht ver-
ändert. Sie beschreibt sich als konfessionslos. Nach ihrem Schulabschluss begann sie ein Praktikum zur
Kindererzieherin. Jedoch war es schwierig, eine Stelle in diesem Bereich zu bekommen, weshalb sie
dann ihre Berufsrichtung änderte und sich zu einer Coiffeurin ausbilden liess. Darauf zog sie von zu-
hause aus und lebte seither allein in einer gemütlichen Wohnung. Einige Jahre arbeitete Andrea
Schmid in ihrem erlernten Beruf, bis sie aufgrund der finanziellen Lage des Geschäftes nicht mehr wei-
terarbeiten durfte. Statt einer weiteren Stelle als Coiffeurin nahm Sie einen Job in der Migros an. So-
23Sie können auch lesen