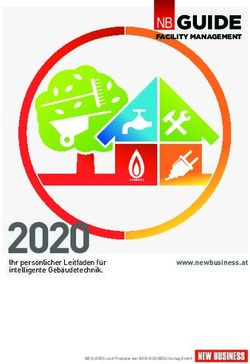Kommunale Suffizienzpolitik Strategische Perspektiven für Städte, Länder und Bund - Kurzstudie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 1
Kommunale Suffizienzpolitik
Strategische Perspektiven
für Städte, Länder und Bund
Kurzstudie des Wuppertal Instituts
für Klima, Umwelt, EnergieStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 2
Inhalt
Vorwort 3
Zusammenfassung 4
Einführung: Suffizienzbremsen für Kommunen 6
Wohnen 11
Mobilität 21
Wenn der Staat einkauft 33
Der politische Weg zur Suffizienz 36
Endnoten 38
Impressum
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND)
Friends of the Earth Germany · Am Köllnischen Park 1 · 10179 Berlin Förderhinweis
Tel.: (030) 275 86-40 · info@bund.net · www.bund.net
DIESES PROJEKT WURDE GEFÖRDERT VON:
Autor: Dr. Michael Kopatz,
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
Redaktion: Christine Wenzl · V.i.S.d.P.: Yvonne Weber
Gestaltung: N & U GmbH · Titelbild: Christian Lück/fotolia.de · Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Druck: Z.B.!, Köln, 2016 Veröffentlichung liegt bei den AutorInnen.Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 3
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wie bewahren wir unsere Lebensgrundlagen, wie stoppen wir den weltweiten Klimawandel und Artenschwund, damit auch unsere Enkel und
Urenkel noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden? Dafür brauchen wir eine dezentrale Energiewende, das Ende des Flächenfraßes, spürbar
weniger Materialverbrauch. Mehr Effizienz und technische Lösungen allein werden jedoch nicht reichen, um wirklich weniger zu konsumieren
und die Wachstumsspirale zu durchbrechen. Hier kommt als zentraler Baustein nachhaltiger Entwicklung die Suffizienz ins Spiel. Suffizienz,
abgeleitet vom lateinischen »sufficere« – ausreichen, genügen. Entscheidend dafür sind ein veränderter politischer Rahmen sowie Impulse und
Anreize für ein »ressourcenleichtes« Leben – der BUND engagiert sich daher für eine Suffizienzpolitik.
Vor Ort wird Suffizienzpolitik am ehesten Realität. Denn nicht nur ist der Beitrag der Städte von großer Relevanz für bundesweite umweltpoli-
tische Ziele – drei Viertel der deutschen Bevölkerung leben in der Stadt, 80 Prozent unserer CO2-Emissionen werden hier erzeugt. Auch sind
Veränderungen für die Menschen hier direkt erlebbar. Und: Zukunftsweisende Modelle lassen sich am ehesten in den Städten auf den Weg
bringen – nicht umsonst gelten sie als »Reallabore der Zukunft«. Zugleich sind wir in vielen Bereichen von einer nachhaltigen Entwicklung
weit entfernt. Eindrucksvoll zeigt sich am Beispiel des anhaltenden täglichen Flächenverbrauchs – vor Ort –, wo nach wie vor Fallstricke liegen
und insbesondere auch Bund und Länder gefordert sind, politische Rahmenbedingungen zu setzen.
Um diese Bedingungen näher zu beleuchten, hat der BUND das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie mit der vorliegenden Kurzstudie
beauftragt. Welche Potenziale hat Suffizienzpolitik vor Ort für ein zukunftsfähiges Wohnen, für nachhaltige Mobilität und öffentliche
Beschaffung? Wo liegen Restriktionen und ist die Landes- und Bundespolitik gefragt? Die Studie gibt inspirierende Einblicke, sie wirft Schlag-
lichter und formuliert neue Lösungswege.
Wir danken dem Autor Dr. Michael Kopatz für seinen wichtigen Beitrag zur Debatte und wünschen eine anregende Lektüre.
Prof. Dr. Hubert Weiger Christine Wenzl
3Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 4
Zusammenfassung
Es ist eine Alltagserfahrung, dass auch umsichtigen Bürgerinnen tehandel – ist grundsätzlich geeignet, den Wettbewerb zwischen
und Bürgern der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen Kommunen in zukunftsfähige Bahnen zu lenken.
schwerfällt. Schließlich wird allenthalben vom »Größer, Weiter,
Schneller, Schwerer und Stärker« geschwärmt. Doch nicht nur Indi- Mobilität
viduen, sondern auch Unternehmen und selbst Städte und Gemein- Die extreme Verschwendung von Öl ist selbstverständlicher Teil
den – die vieles bereits tun – stoßen an Grenzen, wenn es gilt, eine unserer Mobilitätskultur. Es ist erstaunlich, mit welcher Dynamik
Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit einzunehmen. Zu groß Deutschland das amerikanische Vorbild nachahmt. Die Neuzulas-
scheint das Risiko, die Nachbargemeinde werde die vermeintliche sungen von Kleinwagen verringerten sich zwischen 2009 und 2014
»Schwäche« für den eigenen Vorteil nutzen. Verschiedene Faktoren um fast 20 Prozent, während die Zahl der SUVs und Geländewagen
heizen den interkommunalen Wettbewerb an und behindern um 122 Prozent zunahm. Die Kommunen haben im Prinzip keine
zukunftsfähige Entwicklungsstrategien. Die Kommunen konkurrie- Möglichkeit, sich diesem Trend entgegenzustemmen. Hier sind
ren um Nachfrage, Einwohnerzahlen und Gewerbeansiedlungen. Bund und EU gefragt. Gleichwohl gibt es für Städte und Gemeinde
Zugleich stehen sie unter einem enormen Wachstumsdruck. Die zahlreiche Konzepte, um eine Verkehrswende einzuleiten.
Kurzstudie »Kommunale Suffizienzpolitik« sucht nach Strategien,
um solchen und anderen nicht-nachhaltigen Entwicklungen entge- Eine kommunale Politik für Verkehrssuffizienz sorgt für kurze Wege
genzusteuern. Sie betrachtet auch, inwiefern dafür geänderte Rah- zu Einkaufsmöglichkeiten für den alltäglichen Bedarf, sorgt für
menbedingungen von Ländern, Bund oder gar EU angebracht sind. eine exzellente Anbindung zum kostengünstigen Nahverkehr, ver-
längerte Wege zum Auto, schrittweise reduzierte Stellplätze und
Wohnen den Einsatz von besonders sparsamen Personenwagen. Tempo 30
Private Haushalte sind für gut ein Viertel des gesamten Endener- sollte die Regelgeschwindigkeiten in Städten und Gemeinden sein.
gieverbrauchs in Deutschland verantwortlich. Rund 85 Prozent Das halbiert den empfundenen Verkehrslärm, verringert Unfälle
davon werden für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt. und fördert den Radverkehr. Maß aller Dinge ist freilich eine
Das Gelingen der Energiewende hängt daher maßgeblich davon ab, Begrenzung der Straßenverkehrsflächen auf das gegenwärtige
ob wir es schaffen, den Aufwand für Heizenergie zu verringern, Niveau. Bei entsprechenden Rahmenbedingungen kann es gelin-
auch in Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen. gen, dass die Bürgerinnen und Bürger durch moderat suffizientes
Verhalten den Primärenergieverbrauch und die entsprechenden
Erforderlich ist dafür auf jeden Fall, dass im Neubau höchste Effi- Treibhausgasemissionen mehr als halbieren.
zienzstandards umgesetzt werden und Bestandsgebäude effizient
umgerüstet werden. Die breite Mehrheit der Bauherren und Eigen- Wenn der Staat einkauft
tümer hält sich nur an die gesetzlichen Vorgaben. Ein edles Bade- Jährlich werden in der Bundesrepublik Deutschland öffentliche
zimmer scheint den meisten wichtiger als eine effiziente solarge- Aufträge im Wert von mindestens 300 Milliarden Euro vergeben.
stützte Heizungsanlage. Da ist es gut, dass die Europäische Union Daran haben die deutschen Kommunen im Vergleich zu Bund und
die Standards immer weiter angehoben hat. Ab 2021 wird das Ländern den größten Anteil. Arbeitsbekleidung, Computer, Büroge-
Nullenergiehaus im Neubau zur Selbstverständlichkeit. räte, elektronische Bauteile und vielfältiges Zubehör werden heute
überwiegend in Entwicklungsländern hergestellt. Daraus resultiert,
Eine weitere Klimaschutzstrategie im Gestaltungsfeld »Wohnen« über die gesamte Prozesskette betrachtet, ein hoher Energie- und
wird von den zuständigen Akteuren jedoch fast vollständig igno- Materialverbrauch.
riert: die Begrenzung des Neubaus wie auch die suffizientere Nut- Die Kommunen können ihre Beschaffung deutlich konsequenter als
zung der Wohnflächen im Bestand. Allein wird sich eine Stadt oder bislang an sozial-ökologischen Kriterien ausrichten, um Suffizienz,
Gemeinde nicht dazu durchringen. Dazu bräuchte es ein Siedlungs- Effizienz und erneuerbare Energien und Materialen zu fördern, wie
limit oder Flächenmoratorium. Die absolute Begrenzung des Flä- auch eine sozial nachhaltige Herstellung. Grundsätzlich halten sich
chenverbrauchs – ob mit einem eigenen Moratoriumsgesetz oder die Behörden und die für die Beschaffung zuständigen Mitarbeiter
einem Paragraphen im Baurecht, ob mit oder ohne einen Zertifika- an die rechtlichen Vorgaben. Da hier nicht explizit öko-faire Stan-
4Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 5
dards vorgeben werden, obliegt es den Einzelpersonen, also den
Sachbearbeitern, Abteilungsleiterinnen, Bürgermeisterinnen u.a.,
sich darüber hinaus zu engagieren. Rechtlich betrachtet haben die
Kommunen inzwischen ausreichend Möglichkeiten an der Hand,
öko-faire Kriterien bei der Vergabe zu berücksichtigen. Die Poten-
ziale ließen sich systematisch heben, wenn die Länder – oder gar
der Bund – weitergehende, verbindliche Vorgaben machen.
Fazit
Appelle, Kampagnen und Bildungsinitiativen genügen nicht, um die
Realisierung von Suffizienzkonzepten ins Werk zu setzen. Seit
Jahrzehnten wird lebhaft über die Art und Intensität der politi-
schen Regulierung gestritten. Inzwischen ist die Liberalisierungs-
euphorie verflogen. Allerorts fordern Politiker und Aktivisten mehr
staatliche Regulierung. Und tatsächlich führt nichts an einer ver-
pflichtenden Nachhaltigkeit und damit auch an einer verbindlich
gemachten Suffizienz vorbei.
5Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 6
Einführung: Suffizienzbremsen für Kommunen
Es ist eine Alltagserfahrung, dass auch umsichtigen Bürgerinnen Wachstumsdruck: Als wäre das nicht schon kompliziert genug,
und Bürgern der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen stehen die Kommunen noch unter einem enormen Wachstums-
schwer fällt. Schließlich wird allenthalben vom »Größer, Weiter, druck. Maschinen, Roboter, Computer und die fortschreitende Digi-
Schneller, Schwerer und Stärker« geschwärmt. Doch nicht nur Indi- talisierung machen es möglich, dieselbe Produktionsmenge mit
viduen, sondern auch Unternehmen und selbst Städte und Gemein- weniger Arbeitskräften herzustellen. Schon allein deshalb sind die
den – die vieles bereits tun – stoßen an Grenzen, wenn es gilt, eine Entscheiderinnen und Entscheider vor Ort bemüht, neue Unterneh-
Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit einzunehmen. Zu groß men anzulocken, um die Arbeitsplatzverluste zu kompensieren.
scheint das Risiko, die Nachbargemeinde werde die vermeintliche Zugleich befeuert der forcierte Freihandel die Globalisierung der
»Schwäche« für den eigenen Vorteil nutzen. Verschiedene Faktoren Produktion. Selbst einfachste Produkte werden nur noch selten
heizen den interkommunalen Wettbewerb an und behindern regional hergestellt. Bäcker, Metzger und Tante-Emma-Läden
zukunftsfähige Entwicklungsstrategien. haben geschlossen. Inhabergeführte Einzelhändler schließen, weil
sie der Konkurrenz im Versandhandel nicht mehr gewachsen sind.
Konkurrenz um Nachfrage: Die Gemeinden tun sich schwer Die Konsumenten haben gelernt, dass Geiz klug ist.
damit, den motorisierten Individualverkehr (besonders zum Ein-
kauf) aus dem Umland in die Stadt zu begrenzen. Die Befürchtung Bundes- und Landesmittel für Straßenbau und Flughäfen: Die
ist groß, dass die Konsumenten dann in der Nachbarstadt einkau- Verkehrsexperten wissen, dass neue und erweiterte Straßen zumeist
fen und die Nachfrage abwandert. Das wäre schlecht für den weiteren Verkehr erzeugen. Doch Vermeidungsstrategien betreiben
Einzelhandel, schlecht für die Wirtschaftslage, schlecht für den die wenigsten Kommunen in Deutschland. Bund und Land haben
Arbeitsmarkt. hierauf einen maßgeblichen Einfluss: Sie stellen im Regelfall einen
beträchtlichen Teil der Finanzierung bereit, etwa für verkehrswich-
Werben um Einwohner: Mit der gleichen Begründung werden tige innerörtliche Straßen. Mit Blick auf die Kosten, die für Kommu-
weitere Grünflächen für Gewerbe und Einfamilienhäuser erschlos- nen anfallen, sind Bundesstraßen besonders attraktiv. Die Verlänge-
sen. Durch interessante Neubauprojekte im Wohnungs- und Häu- rung der A 100 in Berlin gäbe es wohl nicht ohne Bundesmittel.
sermarkt versuchen Kommunen zum Beispiel junge Familien in ihre Auch die neuen Provinzflughäfen wären ohne die Unterstützung
Stadt zu locken. Jeder zusätzliche Steuerzahler erhöht die Einnah- von Bund und Land und der EU kaum realisiert worden.
men der Stadt. Deswegen fällt es den Städten schwer, ihre Neu-
bautätigkeit zu beschränken: Sie fürchten, dass dann die Nachbar- Gibt es also keinen Ausweg? Oder welche Möglichkeiten gibt es für
stadt einen Vorteil daraus zieht. Ebenso lassen sich anspruchsvolle Kommunen, solchen und anderen nicht-nachhaltigen Entwicklun-
Energie- und Umweltstandards für Neubauten – wie Passivhäuser, gen entgegenzusteuern? Und an welchen Punkten benötigen sie
Dachbegrünung oder Solarenergie – in Regionen mit schwacher dafür geänderte Rahmenbedingungen von Ländern, Bund oder gar
Nachfrage nur schwer durchsetzen. EU? Vor allem für die letzten beiden Fragen werden in dieser Kurz-
studie Antworten diskutiert.
Werben um Gewerbe: Die Gewerbesteuer zählt zu den wichtigs-
ten Einnahmequellen der Kommunen. Sie leiden doppelt, wenn ein
Betrieb Pleite geht oder Teile der Produktion zurückfährt. Nicht nur Was ist Suffizienz?
die Steuereinnahmen fallen weg, zugleich steigen die Zahl der Über kaum etwas können Wissenschaftler so episch streiten wie
Arbeitslosen und die damit verbundenen Ausgaben. Im Gegenzug über die »richtige« Definition von Begriffen und Konzepten. In ihren
bemühen sich kommunale Wirtschaftsförderer um neue Betriebe Veröffentlichungen klären sie daher vorsichtshalber, was sie unter
und Arbeitsplätze – nicht zuletzt durch die Ausweisung von neuen einem Begriff verstehen. So verhält es sich selbstverständlich auch
Gewerbeflächen. Der Wettbewerb zwischen den Kommunen ver- mit Suffizienz und Effizienz.
stärkt diesen Effekt.
6Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 7
Definition und Diskurs sourcenbedarf kaum gesunken. Selbiges gilt seit 2008 für die Koh-
Suffizienz heißt die Frage zu stellen, ob es immer größer, weiter, lendioxidemissionen. Einen dritten Grund liefern Wertewandel
schneller, schwerer und stärker sein muss, oder ob es auch anders sowie Überdruss am Überfluss vor allem in jungen Generationen,
geht. Auch die Voraussetzungen und die Unterstützung, die Bürge- eine für viele attraktive Share-Economy und positive Erfahrungen
rinnen und Bürger, Unternehmen und die Kommunen selbst für mit suffizienten Lebensstilen.
dieses Anders benötigen, müssen bedacht und geschaffen werden.
Zudem ist klarzustellen, dass Suffizienz nicht mit Verzicht gleich- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
zusetzen ist. Das lateinische sufficere, gebildet aus sub und facere, Suffizienz ist damit eine Strategie vor allem für eine ökologisch
bedeutet so viel wie zu Gebote stehen, hinreichen, genug sein, nachhaltige Entwicklung. Gemeinsam mit Energie- und Ressour-
imstande sein, vermögen. Mit dem englischen sufficient, sufficien- ceneffizienz – weniger Input für den gleichen Nutzen – und immer
cy ist ebenso gemeint, was die Erwartungen erfüllt, was Befriedi- größeren Anteilen erneuerbarer Energie und Materialien kann sie
gung schafft oder ermöglicht, was genug und angemessen ist. Mit den Verbrauch und die Umweltauswirkungen gegenüber heute
keiner dieser Bedeutungen spricht Suffizienz von Verzicht oder absolut verringern. Inzwischen bezweifeln auch prominente Befür-
Mangel.1 worter von Effizienzstrategien nicht mehr, dass sich Klimaschutz
und Ressourcengerechtigkeit wesentlich leichter ins Werk setzen
Nach Linz geht es bei der Suffizienz um »Maßnahmen, Instrumente lassen, wenn wir zugleich Suffizienzkonzepte umsetzen.
und Strategien, mit denen Ressourcen eingespart werden können,
und zwar dadurch, dass Menschen ihr Verhalten verändern mit der Viele Handlungsansätze verbinden auch zwei oder alle drei Strate-
Absicht, Energie und Rohstoffe anders zu nutzen und von ihnen gien.
weniger zu verbrauchen als bisher.«2 Letztlich geht es also um den
achtsamen Umgang mit Ressourcen. Damit kann das individuelle Beispiel Busse und Bahnen: Sie sind einerseits effizienter als der
Verhalten, der gesellschaftliche Lebensstil, aber auch die allgemei- eigene PKW, aber bieten auch eine andere Art des Reisens, mit Vor-
ne Wirtschaftsweise gemeint sein. und Nachteilen. Der Umstieg ist also auch ein Akt der Suffizienz,
und es geht darum, die Vorteile zu stärken und die Nachteile zu
Rund ein Jahrzehnt wurde in der Wissenschaft nur wenig über Suf- verringern.
fizienz diskutiert. Im Jahr 1996 sorgte das Motto »Gut leben statt
viel haben« aus der Studie »Zukunftsfähiges Deutschland« noch Beispiel A+++ Kühlschrank: Es handelt sich um eine reine Effi-
für Schlagzeilen und regte intensive Diskussionen an.3 Doch in den zienztechnologie, betrachtet man nur den Energieverbrauch
2000er Jahren wurde der Suffizienzdiskurs nur noch von wenigen ansonsten identischer Geräte. Entscheidet sich der Haushalt aber
Institutionen vorangetrieben – zu unattraktiv schien eine Debatte, zudem dafür, statt eines Geräts mit 300 Litern Nutzinhalt nur eines
die mit Verzicht verbunden wurde. mit 200 Litern und ohne neues 0°C-Fach zu nehmen, weil das für
den Haushalt völlig ausreicht, ist das Suffizienz. Auch die Einstel-
Inzwischen hat eine Gemengelage aus verschiedenen Ereignissen lung auf 7°C statt 5°C bei der Nutzung des Geräts ist Suffizienz.
und Erkenntnissen zu einer Belebung des Suffizienzdiskurses Versteht man Suffizienz als absichtsvolles individuelles Verhalten,
geführt. Ein Auslöser ist das extreme Auf und Ab der Öl- und Res- das den Verbrauch von Energie und Material verringert, geht es um
sourcenpreise. Ein zweiter wichtiger Treiber: Es haben sich Zweifel Entscheidungen. Vertreter dieses Verständnisses sagen: Die Konsu-
breitgemacht, ob die für unsere Zukunft notwendigen Ziele von mentenentscheidung ist maßgeblich. Anders gesagt: Auch die
Energiewende und Klimaschutz mit »grünen Technologien« allein technische Effizienz wird erst durch die Kaufentscheidung für den
erreichbar sind. Zwar haben die Deutschen im Jahr 2013 ein Viertel A+++ Kühlschrank realisiert. Er ist deutlich teurer als die A-Varian-
des Stroms mit Sonne, Wind, Wasser und Biomasse erzeugt und te, deswegen erfordert der Kauf eine bewusste Entscheidung.
der Energiebedarf von Gerätschaften und Häusern hat sich relativ
gesehen deutlich verringert. Doch absolut betrachtet ist der Res-
7Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 8
Beispiel Verzicht auf mehr. Jemand kauft einen neuen Fernseher mehr tun, als der Gesetzgeber vorschreibt. Viele Maßnahmen sind
oder Kühlschrank, der nicht größer ist als der alte, obwohl Freund mit hohem Aufwand und einigen Kosten verbunden, die sich oft
und Nachbarn inzwischen viel größere Geräte haben und obwohl erst längerfristig amortisieren. Für anderweitigen Konsum steht
die Familie gewachsen ist. Das ist Suffizienz. Sie beginnt nicht erst, zumindest zeitweilig weniger Geld zur Verfügung. Und so kann die
wenn das Gerät kleiner wird, also tatsächlich jemand verzichtet. beste Technik ihre Wirkung im Regelfall erst durch achtsame Bür-
gerinnen und Bürger entfalten – und ein entsprechend energie-
Beispiel Gebäudesanierung: Der Einbau neuer Fenster, Isolierung, und ressourcensparendes Verhalten. Essenziell sind dafür Beratung
Lüftung etc. ist eine Investition in Effizienz, hat aber auch einen sowie Fordern und Fördern (auch finanziell) seitens der Politik von
Suffizienzaspekt. Im Kern geht es hier um effiziente Technik. Diese Kommunen, Ländern und Bund sowie der EU.
ist jedoch zunächst teuer, und meist sind es die Idealisten, die
CO2-Emissionen
14,5
14 in Tonnen pro Kopf und Jahr
12
Mittlerer Summenwert
der CO2-Emissionen
10 10
8
6 Beeinflussungsmöglichkeiten
durch selbstbestimmten
5 Lebensstil:
4
stark, aber indirekt
2 stark und direkt
mäßig bis gar nicht
0
Verschwenderischer Durchschnittlicher Effizienter
Lebensstil Lebensstil Lebensstil
Schon heute gibt es Bundesbürger, die nur fünf Tonnen CO2 emittieren. Bereiche wie »Ernährung« oder »Pkw-Verkehr« kann jeder Einzelne stark
beeinflussen.6
8Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 9
Weil Suffizienz mit Effizienz, erneuerbaren Energien und Naturver-
träglichkeit Hand in Hand gehen muss, wurden hier auch manche
wichtigen Handlungsansätze aus diesen Bereichen aufgenommen,
etwa in den Kapiteln über Bauen und Beschaffung. Zugleich sind
soziale Belange zu berücksichtigen, wie sich an einigen Stellen zei-
gen wird.
Suffizienzpotenzial
Der sozial-kulturelle Faktor ist u.a. beim Klimaschutz von immenser
Bedeutung. Das zeigt sich sehr deutlich, wenn man die Kohlen-
dioxidemissionen nicht nach den klassischen Sektoren der Energie-
statistik aufteilt, wonach zum Beispiel die Industrie verantwortlich
ist für die Emissionen bei Herstellung, Veredelung und Transport
von Gütern. Doch letztlich dient der überwiegende Teil der Wirt-
schaft direkt oder indirekt dem Konsum der privaten Haushalte. Um
das zu verdeutlichen ist es hilfreich, den CO2-Ausstoß Deutschlands
auf die Bundesbürger zu verteilen. Gegenwärtig liegen wir hierzu-
lande bei ca. neun Tonnen je Einwohner. Das ist ein international
sehr gut vergleichbarer Wert, der sich bis 2050 auf unter 1,5 Tonnen
verringern soll: um die Erderwärmung zu begrenzen und im Sinne
internationaler Gerechtigkeit alle Menschen mit ihren Pro-Kopf-
Emissionen gleich zu behandeln. Für Deutschland bedeutet dies, die
Treibhausgasemissionen im Inland um 65–80 Prozent bis 2030 und
um 95 Prozent bis 2050 zu verringern4.
Der persönliche Lebensstil entscheidet mit darüber, ob der persön-
liche CO2-Abdruck heute bei fünf Tonnen oder 15 Tonnen pro Jahr
liegt. Wer sich einmal die Mühe macht und mit Hilfe eines Online-
CO2-Rechners seinen persönlichen Ausstoß bilanziert, wird schnell
feststellen: Eine Reduktion auf 1,5 Tonnen ist bei den gegenwärtigen
Rahmenbedingungen kaum möglich. Beispielsweise wäre dieses ima-
ginäre »CO2-Budget« mit einem Mittelklassewagen bereits nach
10000 Kilometern verfahren.5 Doch auch wer kein eigenes Auto
besitzt, in einem sehr sparsamen Gebäude wohnt, nur alle fünf Jahre
einen Flug unternimmt, wenig Fleisch isst und überwiegend regionale
Produkte kauft, wird seine Bilanz nur in seltenen Fällen unter fünf
Tonnen drücken können. Das liegt auch an infrastrukturellen Voraus-
setzungen in Sektoren wie Wohnungsbau, Beheizung und Warmwas-
serbereitung – Bereiche, die besonders Mieterinnen und Mieter nur
geringfügig beeinflussen können – oder dem öffentlichen Konsum.
Dieser beinhaltet die gesamte öffentliche Infrastruktur, angefangen
von der Straßenbeleuchtung über Schulen, Krankenhäuser, Polizei.
9Studie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 10
© Nina Szebrowski/fotolia.de
10
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 11
Wohnen
Private Haushalte sind für gut ein Viertel des gesamten Endener- dass der haushaltsspezifische Verbrauch ca. 50 Prozent um den
gieverbrauchs in Deutschland verantwortlich. Rund 85 Prozent Mittelwert schwankte.13 Eine empirische Untersuchung des Heiz-
davon werden für Heizung und Warmwasserbereitung eingesetzt.7 verbrauches von 1600 Haushalten ergab ebenfalls bei vergleich-
Dabei wird in älteren Häusern zur Beheizung gut und gern zehnmal baren Gebäuden derselben Gegend Verbrauchsunterschiede im
so viel Energie benötigt wie in effizienten Neubauten.8 Das Gelin- Verhältnis 3:1.14 Wärmebedarfsmessungen bei 52 gleichartigen
gen der Energiewende hängt daher maßgeblich davon ab, ob wir Niedrigenergiehäusern in Skive/Dänemark haben einen mittleren
es schaffen, den Aufwand für Heizenergie zu verringern, auch in Heizenergiewert von 50 kWh/qm ergeben. Indes liegt der gemesse-
Gebäuden, die nicht dem Wohnen dienen. ne haushaltsspezifische Verbrauch zwischen 20 und 70 kWh/qm15.
Dementsprechend kam Epp schon vor 20 Jahren zu dem Schluss,
Erforderlich ist dafür auf jeden Fall, dass im Neubau höchste Effi- dass der Wärmebedarf je nach Verhalten um bis zu 50 Prozent vom
zienzstandards umgesetzt werden und Bestandsgebäude effizient Mittelwert abweichen kann. Und das sowohl bei Niedrigenergie-
umgerüstet werden. Dazu zählt, im Bestand die Wände und Dächer häusern als auch konventioneller Bauart. Die Abweichungen ent-
mit Dämmstoffen zu verkleiden und die Fenster zu erneuern. stünden durch Raumtemperaturniveau, Beheizungsumfang, Rege-
Zudem gilt es sparsame Heizungen zu installieren, gegebenenfalls lungsmechanismen, Lüftungsverhalten und Anwesenheitszeiten.
auf Basis von Holz. Ergänzend ist es von Vorteil, wenn ein Teil der
Wärme mit Sonnenkraft erzeugt wird und spezielle Lüfter die
Frischluftzufuhr übernehmen. Kommunen obliegt es neben Bund Neubau
und Ländern, die Bürger und Unternehmen beim Nutzen dieser Auch wenn wie gesehen in gleichen Gebäuden der Heizenergiever-
Potenziale zu beraten, zu fördern und zu fordern. brauch der Bewohnerinnen und Bewohner stark unterschiedlich ist:
Im Durchschnitt liegt er in sehr energieeffizienten Gebäuden deut-
Eine weitere Klimaschutzstrategie im Gestaltungsfeld »Wohnen« lich niedriger, so dass der restliche Bedarf durch Sonnenenergie,
wird von den zuständigen Akteuren jedoch fast völlig ignoriert: die Biomasse oder Erdwärme gedeckt werden kann. Schon seit Anfang
Begrenzung des Neubaus wie auch die suffizientere Nutzung der der 1990er Jahre gibt es »Null-Energiehäuser«, später kamen »Plus-
Wohnflächen im Bestand. Energiehäuser« hinzu: schöne Modellprojekte, die gezeigt haben,
was technisch möglich ist. Doch verbreitet haben sich die guten
Beispiele kaum. Zu teuer und unwirtschaftlich, begründen private
Potenziale Bauherren und Wohnungsunternehmen ihr dürftiges Engagement
Lässt sich die Bedeutung von Suffizienz bzw. Lebensstilverände- für den Klimaschutz. Selbst diejenigen, die persönlich davon über-
rungen für Energiewende und Klimaschutz quantifizieren? Den zeugt sind, dass der Verbrauch an fossilen Energien eines Hauses
Versuch hat beispielsweise eine Studie aus der Schweiz unternom- auf ein Minimum zu reduzieren ist, scheiterten in der Regel an
men. Sie kommt etwa zu dem Schluss, dass die Wohnfläche ein ihren Vorsätzen.
markanter Einflussfaktor für den individuellen Verbrauch ist. Mit Dabei wird häufig mehr Geld für schicke Bäder ausgegeben, als
einer Reduktion der Standardpersonenfläche9 um ein Drittel ließe für eine solare Warmwasserbereitung nötig gewesen wäre. Über
sich bei der Primärenergie und den Treibhausgasemissionen eine Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung denkt kaum jemand
Einsparung von rund 15 Prozent ermöglichen, dies gelte für Neu- ernsthaft nach. Während etwas mehr Komfort im Auto leicht mal
bauten genauso wie für Umbauten.10 einige Tausend Euro extra kosten darf, nehmen Bauherren warme
Wände und frische Luft nicht einmal als Komfortmerkmal wahr,
Solche Erkenntnisse sind übrigens nicht ganz neu. Liest man zum geschweige dass sie bereit wären, dafür Geld auszugeben. Ganz
Beispiel den Bericht vom Bärbel Epp über den »Einfluss des Verhal- offenbar sind Individuen, ja ganze Wohnungsgesellschaften mit
tens auf das Energiesparen von privaten Haushalten«12, kann das dem Nachhaltigkeitspostulat überfordert.
zu einem Déjà-vu führen. Bereits in den 1980er Jahren stellte die
Eidgenössische Materialprüfungsanstalt bei Ölverbrauchsmessun- Den Kommunen geht es dabei nicht viel anders. Nur wenige
gen von 60 Einfamilienhäusern mit gleicher Wohnstruktur fest, machen Vorgaben über die gesetzlichen Mindeststandards – die
11
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 12
Energieeinsparverordnung – hinaus. So etwas schien allenfalls in seit 2002 unter dem Namen »Energieeinsparverordnung«. Mit dem
gefragten Gegenden machbar, wie Frankfurt am Main oder Ham- Jahr 2009 gab es sogar Vorgaben für die Nutzung von Wärme aus
burg. Das hat sich bis heute nicht geändert. Im Gegenteil werden erneuerbaren Energien. Ab 2016 werden die Standards um weitere
die immer strengeren Vorgaben des Gesetzgebers zunehmend 25 Prozent angehoben, und mit dem Jahr 2019 müssen öffentliche
beklagt. Das Bauen werde dadurch zunehmend komplizierter und Gebäude (und alle übrigen Neubauten ab 2021) den Niedrigst-
teurer, und auch sozial orientierten Unternehmen falle es zuneh- Energiestandard erfüllen, also nahezu den Standard eines Null-
mend schwer, günstige Mietwohnungen zu bauen.16 energiehauses.17
Die Chancen für den Klimaschutz im Gestaltungsfeld »Wohnen« Jetzt liegt der Gedanke nahe, die Deutschen sind Vorreiter bei der
stünden also schlecht, wenn Bundesregierung und Europäische Gebäudeeffizienz. Doch diese Vorgabe gilt in der gesamten Euro-
Union das Problem nicht längst erkannt hätten. Sie schufen einen päischen Union. Das ist – ohne zu übertreiben – eine ganz vorzüg-
ordnungsrechtlichen Rahmen für anspruchsvolle Standards, den sie liche Entwicklung. Zwar ließe sich kritisieren, das man dies alles
Schritt für Schritt anhoben. Wichtige Wegbereiter für die jeweils schon viel früher hätte haben können, doch letztlich gilt, dass die
nächsten Schritte waren und sind Informationskampagnen, Förder- EU-Staaten überhaupt diesen Weg beschritten haben.
programme und Geldanreize wie Steuervorteile und Ähnliches mehr.
Das zeigt exemplarisch, wie sich kommunale Achtsamkeitspolitik
Schon seit 1976 gibt es gesetzliche Bestimmungen für effizientes mit europäischer und nationaler Rahmensetzung systematisch ins
Bauen. Die Anforderungen für Heizungsanlagen und Wärmebedarf Werk setzen lässt. Die hohen Effizienzstandards für die Bauwirt-
von Büros und Wohnhäusern haben sich schrittweise verschärft, schaft entlasten den einzelnen Bürger von der moralischen Abwä-
450 Wärmeschutzverordnung 1977
400
Wärmeschutzverordnung 1982
350
Jahresprimärenergiebedarf [KWh/(m2.a)]
300
250
Wärmeschutzverordnung 1995
200
EnEV 2007
150
EnEV 2009
EnEV 2014
100
50
0
1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018
Der ordnungsrechtliche Rahmen für Gebäudeeffizienz – die Anforderungen haben sich schrittweise verschärft. Maßgeblich ist derzeit die Ener-
gieeinsparverordnung von 2014. Neubausiedlungen müssen ab 2021 nahezu den Nullenergiehaus-Standard erfüllen. Die Verordnung überwin-
det dann – indem alle in die Pflicht genommen werden – das Wettbewerbsdilemma zwischen Kommunen.18
12
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 13
gung zwischen Klimaschutz und Küchendesign. Die Wärmeschutz- jedoch zunächst an der CSU-Regierung von Bayern gescheitert ist.
verglasung wird nun von Beginn an eingeplant, und der verbleibende Doch insgesamt hapert es bei der Verbindlichkeit.
finanzielle Spielraum bestimmt darüber, wie kostspielig die Bad-
keramik sein darf. Klimapolitisch ambitionierte Bürgermeister und Das ist freilich auch ein Problem für die Städte und Gemeinden in
Stadtplaner müssen fortan nicht darum bangen, dass das geplante Deutschland. Einige streben »100 % Klimaschutz« an.22 Der Bund
Neubaugebiet nicht angenommen wird, weil die energetischen fördert die Entwicklung der gleichnamigen Klimaschutzkonzepte
Anforderungen zu hoch sind. Denn auch die Baugebiete der Nach- mit dem Programm »Masterplan 100 % Klimaschutz«. Es richtet
bargemeinde sind nun zum Klimaschutz verpflichtet. sich an Kommunen, die sich eine Treibhausgas-Reduzierung von
95 Prozent und eine Senkung des Endenergiebedarfs bis 2050 um
Auch weiterhin wird es Kritiker geben, Skandalmeldungen zur 50 Prozent verordnet haben. Es entstehen beeindruckende Pläne,
»Volksverdämmung«, Brandgefahr, Schimmel etc. All das wird bald deren Umsetzung gerade im Gebäudebereich nur bedingt möglich
vergessen sein. Eigenheimbesitzerinnen werden bei den Hausfüh- ist. Denn den Kommunen stehen nur relativ sanfte Instrumente zur
rungen künftig mit einigem Stolz auf die technologischen Errun- Verfügung, um die Sanierung der Gebäude voranzutreiben. Sie sind
genschaften ihres Häuschens und den äußerst geringen Energiever- momentan angewiesen auf achtsame und umsichtige Eigentüme-
brauch hinweisen. rinnen und Investoren, die sich dem Klimaschutz verpflichtet füh-
len, und auf die Förderprogramme von Bund und Ländern für Bera-
tung und Investition.
Umbau: Sanierungsfahrplan
Ebenso wie beim Neubau lassen sich auch für den Bestand Zug um Kommunale Rahmenbedingungen für Suffizienz und Effizienz soll-
Zug die energetischen Standards anheben. Denn bei jedem Haus ten jedoch darauf abzielen, dass sich achtsame Einsparinvestition
steht nach 15 bis 40 Jahren ein Austausch der Heizung oder eine gleichsam verselbständigen. Im Idealfall bleibt beispielweise Ver-
Erneuerung der Fassade auf dem Plan. Das ist eigentlich der mietern dann gar nichts anderes übrig, als ihre Immobilien auch
Moment, um etwas für den Klimaschutz zu tun. Doch von allein energetisch verantwortungsvoll zu gestalten. Solches hat die Ener-
geschieht das selten. Eigenheimbewohner scheuen die hohen Kosten, gieeinsparverordnung nunmehr in zwei Bereichen realisiert. Erstens
und Vermieter müssen ohnehin nicht für die Heizkosten aufkommen. müssen Öl- und Gasheizkessel, die vor 1985 eingebaut wurden, seit
Nun hat die Bundesregierung für die Sanierung der Gebäude einen 2015 außer Betrieb genommen werden. Wurden die entsprechen-
Sanierungsfahrplan aufgelegt. So wie die Bahn die Ankunftszeit ihrer den Heizungsanlagen nach dem 1. Januar 1985 eingebaut, müssen
Züge festlegt, so plant die Regierung den Fortschritt der energeti- sie nach 30 Jahren ersetzt werden.
schen Sanierung. Demnach soll bis 2050 der Energiebedarf um 80
Prozent sinken.19 Der Gebäudebestand soll dann nahezu klimaneu- Zweitens sind Eigentümer nunmehr verpflichtet, die oberste
tral sein. Im Bestand müsste sich die derzeitige Sanierungsrate von Geschossdecke zu isolieren. Bis Ende 2015 soll die Nachrüstung
etwa einem Prozent der Häuser pro Jahr mindestens verdoppeln.20 abgeschlossen sein. Gemeint sind Decken beheizter Räume, die an
ein unbeheiztes Dachgeschoss angrenzen. Die Forderung gilt auch
Das hört sich zunächst einmal ambitioniert an. Der Haken: Ob die als erfüllt, wenn das Dach darüber gedämmt ist oder die Mindest-
Hauseigentümer sich an den Plan halten, ist ungewiss. Der Plan ist anforderungen an die Dämmung erfüllt.
unverbindlich, weil es keine gesetzliche Verankerung gibt. Man
beschränkt sich auf Informationen und Anreize: Kampagnen wie Solche Vorgaben setzen sich zwar nicht von selbst ins Werk und
»co2online-Klimaschutzkampagne« oder »Haus Sanieren – Profitie- werden womöglich ignoriert. Aber die lokalen Behörden vor Ort
ren«. 21Der Gebäudepass soll Vermieter und künftige Mieter für die haben nun einen Hebel, um nachträgliche Klimaschutzmaßnahmen
Energiekosten der Wohnung sensibilisieren. Die Kreditanstalt für an Gebäuden einzufordern und die ehrgeizigen Klimaschutzkon-
Wiederaufbau vergibt zinsgünstige Darlehen, gibt für besonders zepte umzusetzen. Manchmal genügt vielleicht schon ein freund-
weitgehende Sanierungsvorhaben einen Zuschuss, ebenso wie für licher Brief mit dem Hinweis auf die neue Gesetzeslage.
Energieberatungen. Geplant war auch ein Steuernachlass, der
13
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 14
Doch der Bund könnte deutlich mehr tun und beispielsweise dem verrückten Idee, ist aber sehr plausibel, gerade in schrumpfenden
Vorbild Baden-Württembergs folgen. Dort hat man quasi das EEG- Städten. Essen zum Beispiel hatte 1970 noch knapp 700 000 Ein-
Wärmegesetz des Bundes auf schon bestehende Häuser übertra- wohner, im Jahr 2000 595 000 und heute leben weniger als
gen. Seit Januar 2010 müssen bei einem Heizanlagenaustausch in 570 000 Menschen in der Zentralstadt des Ruhrgebiets.24 Vielen
bestehenden Wohngebäuden zehn Prozent der Wärme mit erneu- andern Städten im Osten und Westen erging es ähnlich. Mitunter
erbaren Energien erzeugt werden. Möchte der Eigentümer bei einer sind die Verluste moderater. Aber nur wenige Städte wachsen, wie
Öl- oder Gasheizung bleiben, kann eine thermische Solaranlage das die Ergebnisse des Zensus aus dem Jahr 2011 zeigen. Dutzende
Heizsystem ergänzen. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn die Städte, darunter auch Hamburg und Berlin, weigerten sich die
Kollektorfläche in einem bestimmten Verhältnis zur Wohnfläche Erhebung anzuerkennen.
steht.23 Für ein Haus mit 150 Quadratmetern reichen also sechs
Quadratmeter Sonnenkollektoren. Diese Kollektorgröße genügt Doch obwohl vielerorts die Zahl der registrierten Einwohner dra-
unabhängig davon, ob damit tatsächlich zehn Prozent des Wärme- matisch zurückgeht, entstehen dort Jahr für Jahr neue Siedlungen
bedarfs gedeckt werden. Solche klaren Vorgabe sind wegweisend: für Einfamilienhäuser und Gewerbe. Insgesamt steigt die beheizte
Leicht verständlich und praktisch gut umsetzbar. Fläche in Wohn- und Nichtwohngebäuden jährlich weiterhin um
ca. 0,6 Prozent.25 Es ist der Versuch, die weitere Schrumpfung und
Freilich ist nicht jede Dachfläche für die Erzeugung solarer Wärme damit den Wegfall von Einnahmen durch die Einkommens- und
geeignet. Daher gibt es noch andere Möglichkeiten die Verpflich- Gewerbesteuer zu stoppen oder gar umzukehren.
tung zu erfüllen, etwa mit Pelletkessel oder einer Scheitholzhei-
zung. Weitere Alternativen sind erstens Wärmeschutzmaßnahmen, Das hat Auswirkungen auf den Klimaschutz. Denn der beständige
um den gesamten Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren. Neubau hat jahrelang die Effekte der Gebäudesanierung und höhe-
Zweitens: Die neue Heizung erzeugt zugleich Strom – diese Tech- ren Standards kompensiert. Zwar ging der Energieverbrauch pro
nik heißt »Kraft-Wärme-Kopplung«. Drittens genügt es dem Gesetz, Quadratmeter zwischen 1995 und 2005 bundesweit um gut neun
wenn das Haus an ein Wärmenetz angeschlossen ist, das mit Kraft- Prozent zurück. Je Einwohner nahm der Raumwärmebedarf jedoch
Wärme-Kopplung oder mit erneuerbaren Energien arbeitet. Und zu und ist erst seit zehn Jahren rückläufig. In der Gesamtbilanz
falls viertens auf der Dachfläche bereits eine Photovoltaikanlage könnten noch rund zehn Jahre verstreichen, bis wir das Ver-
installiert ist, gilt die Zehn-Prozent-Anforderung auch als erfüllt. brauchsniveau der 1980er erreicht haben.
Inzwischen hat die Landesregierung den Pflichtanteil an erneuer- Im Wesentlichen sind zwei Entwicklungen für den zunehmenden
baren Energien von zehn auf 15 Prozent erhöht. Damit realisierte Wohnflächenbedarf verantwortlich: erstens der Trend zu kleineren
Baden-Württemberg letztlich einen Sanierungsfahrplan. Die Lobby Haushalten; zweitens der wachsende Wohnflächenkonsum älterer
der Hausbesitzer argumentiert, nun hätte erst recht keiner mehr ein- und zwei-Personen-Haushalte, bedingt durch den Verbleib der
Lust, die Heizung zu sanieren. Vermieter würden die Investition Eltern in der großen Familienwohnung nach Auszug der erwachse-
nun hinauszögern, bis die Heizung in ihre Einzelteile zerfällt. Das nen Kinder.26 Käme es hingegen zu einer Stagnation der Wohnflä-
stimmt möglicherweise. Doch bei 30 Jahren ist Schluss, per Gesetz chenentwicklung, wären die möglichen Einspareffekte beträchtlich.
(s.o.), und eine Kontrollfunktion erfüllen allein schon die regelmä- Hier setzt der Vorschlag eines »Flächenmoratoriums« an.
ßigen Schornsteinfegerbesuche. Vollends zerstreuen würden sich
die Bedenken der Zauderer wohl, wenn die Landesregierung ankün- Flächenmoratorium
digte, die Vorgabe im Jahr 2020 auf 20 Prozent zu erhöhen. Das Flächenmoratorium ist eine planungs- und ordnungsrechtliche
Vorgabe des Bundesgesetzgebers, die den Zubau neuer Wohnflä-
chen begrenzt. Gegebenenfalls enthält es eine Öffnung für zusätz-
Nichtbau liche Wohnflächen in Kommunen mit Bevölkerungszuwachs. Bei
Die größten Einsparpotenziale bleiben kommunalpolitisch weitge- stagnierender Bevölkerung gibt das Moratorium bis auf Weiteres
hend unbeachtet: den Neubau begrenzen. Das klingt nach einer vor, dass die Wohn- und Gewerbefläche in Deutschland nicht
14
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 15
zunimmt. Das würde Neubauten zwar nicht ausschließen, jedoch sonderten Studie zu untersuchen. Doch einige Vorüberlegungen
nur bei gleichzeitigem Abriss an selber oder anderer Stelle gestat- lassen sich auch ohne weitgehende Analyse anstellen.
ten. Der Staat setzt also einen Ordnungsrahmen, mit dem inner-
halb der Grenzen kreativ umgegangen werden kann. Der Flächen- Rechtliche Bewertung
bedarf wird gedeckelt. Das Baugesetzbuch hat einen enormen Einfluss auf Gestalt, Struk-
tur und Entwicklung der Städte und Gemeinden. Hier wäre der
Das ist zweifellos ein streitbares Postulat. Schlimmstenfalls wird richtige Ort, um das Moratorium zu verankern. So behandelt der
Wohneigentum so teuer, dass nur Wohlhabende die frei werdenden § 30 beispielsweise die »Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbe-
Immobilien erwerben können. Doch wäre das tatsächlich so? Wel- reich eines Bebauungsplans«, ein hier einzufügender vierter Absatz
che wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen sich aus einem könnte lauten: »Die Aufstellung von Bebauungsplänen ist aus-
Flächenmoratorium ergeben würden, wäre im Rahmen einer ge- schließlich in Abänderung bereits vorhandener Pläne unter Fortbe-
Raumwärmebedarf im Spannungsfeld von Wärmedämmung und Wohnflächennutzung
RRaumwärmebedarf ist verstanden als Endenergieverbrauch für Raumheizung ohne Wasserbereitung
Raumwärmebedarf Raumwärmebedarf W ohnfläche
Wohnfläche
in kWh pro Kopf und Jahr pro qm Wohnfläche in kWh/a
Wohnfläche pro Kopf in qm
8000 350 70
7000 Raumwärmebedarf 300 60
pro Kopf
6000
250 50
5000
Wohnfläche
pro Kopf 200 40
4000
150 30
3000
Raumwärme-
wärme-
100 20
Institut 2015
bedarf pro qm
2000 W ohnfläche
Wohnfläche
Ins
1000 „Ölschock“
„Ölsch
hock Wieder-
e r-
Wie
ede 50 10
© Wuppertal
Wuppertal
1973
19
973 vereinigung
verein
nigung Prognose
u
0 0 0
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Bis zum Jahr 2005 kompensierte der Zuwachs an Wohnfläche, die zusätzlich beheizt wird, die Effizienzgewinne der Gebäudedämmung.
Die gestrichelten Linien zeigen den zu erwartenden Effekt bei einer Begrenzung der Wohnfläche.
15
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 16
stand von deren räumlicher Abgrenzung zulässig«. Damit wäre kleinere Wohnung umzieht und die größere verkauft. Denkbar wäre
klargestellt, dass bestehende Bebauungspläne zwar geändert wer- auch ein Bonus für ältere Paare, die ihr Häuschen zum Wohle grö-
den dürfen, um den Lückenschluss in bebauten Gebieten sinnvoll ßerer Familien verkaufen. Zugleich könnte es hilfreich sein, wenn
zu planen, dass aber keine neuen Baugebiete hinzukommen. die Stadt attraktive Wohnformen fördert. Wenn zum Beispiel ältere
Menschen ihr Haus verlassen, suchen sie Wohnungen ohne Barrie-
Siedlungslimit in der Schweiz ren. Zugleich soll genug Platz für den Besuch der Kinder und Enkel
Die Schweiz möchte die Zersiedelung der Landschaft und den ver- sein. Beides scheint zunächst nicht kompatibel. Doch lässt sich die-
schwenderischen Umgang mit Bodenfläche stoppen. Mit dem ser sehr verbreitete Anspruch recht einfach durch Gästezimmer
beschlossenen Raumplanungsgesetz, dem die Bevölkerungsmehr- erfüllen. In Städten mit knappem Wohnraum gibt es schon heute
heit zugestimmt hat, sollen Bauzonen verkleinert und verdichtetes, vereinzelt solche Ansätze.
effizienteres Bauen gefördert werden. Die Novelle hat der Schwei-
zerische Bundesrat im Mai 2014 beschlossen. Sie beinhaltet ein Berlin – Staatlich finanzierte Umzugsprämien sollen alte Men-
Baustopp in schützenswerten Landschaftslagen, um den Erhalt von schen dazu bewegen, Platz für junge Familien zu machen. Das
Bodenfläche sowie von der Natur zu erreichen. Zukünftig soll nur hat der Chef der Gewerkschaft IG Bau, Robert Feiger, vorge-
noch in besiedelten Gebieten gebaut werden. Für die Kantone schlagen. Den Zuschuss von bis zu 5000 Euro sollen Senioren
ergeben sich daraus zahlreiche Vorgaben, welche sie in ihren erhalten, wenn sie ihre große Wohnung aufgeben und in eine
»Richtplänen« zu berücksichtigen haben. Sie müssen nachweisen, kleinere ziehen. Solche Prämien werden derzeit bereits
dass ihre Bauzonen dem voraussichtlichen Bedarf der nächsten erprobt.
fünfzehn Jahre entsprechen.
Mit dem Anreizsystem helfe man nicht nur Wohnungssuchen-
Die Kantone sind angehalten Bauzonen und Siedlungen möglichst den, sondern auch den alten Menschen selbst. »Zwingen wol-
kompakt zu entwickeln. Dörfer und Städte sollen nach innen weiter len und können wir natürlich niemanden. In der Realität sieht
entwickelt werden, beispielsweise durch verdichtetes Bauen, das es aber doch so aus, dass Senioren oftmals nicht mehr die
Schließen von Baulücken oder die Umnutzung von Brachen. Wohnung verlassen, weil sie die Treppen nicht steigen können.
Grundlage ist das Bestreben, den Verschleiß von Kulturland einzu- Sie würden gern in ein Haus mit Fahrstuhl umziehen«, sagte
dämmen und hohe Kosten für die Erschließung mit Straßen, Strom Feiger. Eine kleinere Wohnung sei da kein Hindernis. Für den
und Wasser zu vermeiden.27 Staat rentiere es sich, wenn zum Beispiel ein Rentner in eine
altersgerechte Wohnung statt in eine Einrichtung für betreu-
Das Raumplanungsgesetz der Schweiz geht in die Richtung eines tes Wohnen ziehe. Hier zahle der Staat deutlich mehr drauf,
Flächenmoratoriums, da es aufgrund der erläuterten Ziele und erklärte der IG-Bau-Vorsitzende. Nach seinen Vorstellungen
Ansätze einem Teilmoratorium gleicht. Deutlich wird, dass es bereits soll die Umzugsprämie vor allem für bedürftige alte Menschen
Ansätze gibt, die dem des Flächenmoratoriums nahe kommen. Mit sein. [...]
diesem kann man dem Anstieg der Pro-Kopf- Wohnfläche entgegen
wirken und bereits gebauten Wohnraum effizienter nutzen. Das Im vergangenen Jahr hatten die landeseigenen Wohnungsun-
Raumplanungsgesetz in der Schweiz zeigt, das auch in Deutschland ternehmen in Berlin und Brandenburg ein Prämienmodell ein-
ein Ansatz dieser Art durchaus durchsetzbar wäre, um auch hier die geführt. Damit der Umzug in eine kleinere Wohnung die
Zersiedelung und den verschwenderischen Umgang mit Bodenflä- Mieter nicht finanziell überfordert, zahlen die jeweiligen
che, wodurch immer mehr Wohnfläche gebaut wird, zu stoppen. Gesellschaften Umzugsprämien bis zu 2500 Euro. 2014 zähl-
ten sie bis September 105 Fälle, in denen Wohnungen
Anreize: Umzugsprämien u. a. getauscht wurden.
Jenseits solcher zentralen administrativen Ansätze, ist es möglich,
Anreize zu schaffen. Beispielsweise wäre es möglich, die Steuer Quelle: Mütze, Janina (2015): Platz für junge Familien,
beim Erwerb eines Grundstücks zu erlassen, wenn jemand in eine Süddeutsche Zeitung 6.2.2015, S. 21
16
KinderStudie_Kommunale Suffizienzpolitik_RZ_neu bio 20.04.16 11:06 Seite 17
Wogeno München 15 m2/Kopf weniger als in heutigen Neubauten. Für die Wohnun-
In München gibt es jetzt schon Anreize, mit Wohnraum verantwor- gen gibt es eine Mindestbelegung.
tungsvoll umzugehen. Die Wohnungsknappheit in der Region resul-
tiert ja nicht nur aus dem anhalten Zuzug, sondern auch aus dem Es gibt Familienwohnungen, kleinere Wohngemeinschaften und
zunehmenden Platzbedarf des Einzelnen. Dem begegnet die Woh- Gemeinschaftsräume für die Aktivitäten Kochen, Büroarbeiten,
nungsgenossenschaft Wogeno mit flexiblen Wohnungen. Diese sind Waschen, Werken u. a. Schon etwas exotisch klingt es, wenn von
an sich vergleichsweise klein, werden aber durch Gemeinschafts- Cluster-Gruppierung und Großhaushalten die Rede ist. »Cluster«
bereiche ergänzt. Im Keller gibt es ein Spielzimmer; Freunde, ausge- bestehen aus autonomen Kleinwohnungen mit Gemeinschaftsraum.
zogene Kinder oder Enkel können im hauseigenen Gästeappartement In Großhaushalten verbinden sich mehrere Individualwohnungen, in
übernachten und das Maleratelier lässt sich auch für Geburtstagsfei- denen sich jeweils ca. 50 Bewohner gemeinsam die Infrastruktur,
ern nutzen. Die Wogeno bietet zudem ein Tauschprogramm für also Küche, Ess- und Aufenthaltsraum und Ähnliches teilen. Die
Wohnungen an, etwa für die verwitwete Seniorin, für die sich der Bewohner verfügen über einen Raum für gemeinsame Feste, Turnie-
Umzug in eine kleinere Wohnung nicht lohnt; diese wäre mit einem re und Ähnliches. An den gemeinsamen Abendessen können zu
neuen Mietvertrag oft ähnlich teuer wie die große alte.28 einem günstigen Preis auch Gäste von Außerhalb teilnehmen.
Arbeiten und Wohnen in der Gemeinschaft: Nicht nur im Punkt Flächenbedarf ist die Kalkbreite vorbildlich.
Die Kalkbreite Zürich Regenerative Energieversorgung, ressourcenschonende Bauweise
Wer gerne in beliebten Städten wie München, Hamburg oder Göt- und ein nachhaltiges Mobilitätskonzept machen das Projekt
tingen und Heidelberg lebt, muss einen beträchtlichen Teil seines zukunftsfähig. Die Bewohner erhalten Hilfe beim Energiesparen
Gehalts für die Miete aufwenden. Es gibt viele Faktoren, die das und besitzen vertragsgemäß kein eigenes Auto. Entsprechend lie-
befördert haben. Einer davon sind die Stadtväter selbst: Attraktive ßen sich Kosten für den Bau von Parkplätzen einsparen. Die gute
Grundstücke verkaufen sie an den meistbietenden Investor. In Lage sorgt für eine optimale Anbindung an die öffentlichen Ver-
populären Städten kann man beobachten wie Luxusimmobilien für kehrsmittel. Selbstverständlich sind große Fahrradparkplätze und
Superreiche entstehen. Die Preise sprengen die Vorstellungskraft Velo-Verleihstationen vorhanden.
eines Normalverdieners. Das ist übrigens mitnichten ein Phänomen
allein in den urbanen Magnetpolen. In Städten wie Osnabrück oder Solche Projekte im Kleinen oder Großen nachzuahmen, obliegt den
Augsburg schlagen zwar nicht die Milliardäre aus China ihre Zelte Städten und Gemeinden. Es wird und soll keine zentrale Verord-
auf. Doch auch hier finden sich, entgegen allen städtebaulichen nung für einen gemeinwohlorientierten Städtebau oder ähnliches
Postulaten für mehr soziale Gerechtigkeit, Wegbereiter für die geben. Die Hoffnung ist, dass unsere kommunalen Mandatsträger
Spaltung der Gesellschaft in Arme und Reiche. Es ist die vornehme den blinden Wettbewerb um Einwohnerzahlen beenden und sich
Pflicht der Stadtväter, bei der Vermarktung von Grundstücken auch von stupiden und ästhetisch anspruchslosen Einfamilienhaussied-
Menschen mit kleinem Portemonnaie Chancen zu bieten. lungen verabschieden. Eine absolute Begrenzung des Flächenver-
brauchs für Wohnen und Gewerbe würde den kommunalen Trans-
Genossenschaftliche Wohnformen können das ermöglichen. Davon formationsprozess hin zur Nachhaltigkeit begünstigen.
profitieren die Wohnungssuchenden beispielsweise in Wien und
Zürich. In Zürich befindet sich jede fünfte Wohnung in Gemein- Umnutzung: Wohnen im Parkhaus
schaftsbesitz.29 So auch die Kalkbreite in Zürich. Auf einem mehr Parkhäuser sind die unwirtlichsten Orte der Innenstadt. Von innen
oder weniger brachliegenden Tramgelände an der Kalkbreitestraße betrachtet strahlen sie eine unheilvolle Atmosphäre aus. Von
entstand Raum für gemeinschaftliches Wohnen und Arbeiten außen erstickt die Kulisse jedweden Anflug urbanen Lebens.
sowie verschiedene Lebensmodelle. Eines der Ziele war, den Flä- Zugleich erinnern sie uns täglich an den Albtraum der autogerech-
chenverbrauch pro Person auf das Notwendigste zu verringern. Im ten Stadt. Mit dem eigenen Wagen bis ins Kaufhaus zu fahren, das
Ergebnis beanspruchen die Bewohner jeweils maximal 35 Quadrat- ist zwar praktisch, steht aber der Sehnsucht nach Ruhe, Vielfalt,
meter, inklusive gemeinschaftlich genutzter Fläche. Das sind 10 bis Flanieren und Ästhetik entgegen.
17
KinderSie können auch lesen