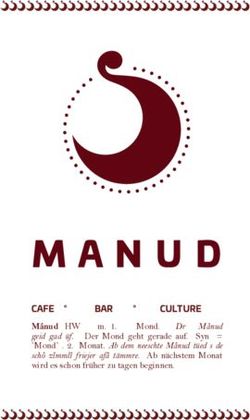MITTEILUNGEN DES VERBANDES DER DEUTSCHEN HÖHLEN- UND KARSTFORSCHER E.V - NR. 3 + 4/2019 - VDHK
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mitteilungen
des Verbandes
der deutschen Höhlen- und
Karstforscher e.V.
ISSN 0505-2211
H 20075 Nr. 3 + 4/2019 Jahrgang 65
3. + 4. QuartalMitteilungen Editorial
Der neue Solidaritätsfonds
Selbst bei maximaler Vorsicht passieren Höhlenunfälle. Grundle-
des Verbandes der deutschen gend wichtig ist stets die private Unfallversicherung – sie sollte zur
Höhlen- und Karstforscher e. V. üblichen Lebensvorsorge gehören. Doch alle heute bestehenden Ver-
sicherungen haben Lücken, was die Abdeckung der Bergungskosten
ISSN 0505-2211, Jahrgang 65, Nr. 3 + 4 betrifft. Der Verband hatte daher 1995 beschlossen, einen selbstver-
walteten Bergungskosten-Solidaritätsfonds zu gründen. 2017 wurde
er von der Hauptversammlung neu gestaltet. Unser Dank geht an
Inhalt Udo Kaiser und seine Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung der Richt-
linien.
Aus den Erfahrungen der letzten Jahre wurden Unfälle im Ausland
Editorial .................................................................................. 46 bekannt, bei denen der Rettungs- bzw. Bergungsaufwand sowie der
Transport ins Tal im Gegensatz zum deutschen Abrechnungssystem
Jenny Linde der Pauschalierung gemäß dem tatsächlich angefallenen Aufwand
Zur Bewertungsmöglichkeit menschlicher Einflüsse auf abgerechnet wurden. Bei einem Fall in Österreich werden Stunden-
Schauhöhlen-Ökosysteme ........................................................ 47 sätze von 300 Euro pro Einsatzkraft und Stunde ohne Zuschläge
eingefordert. Da Bergrettung und Höhlenrettung in Österreich zwei
Eckart Herrmann getrennt agierende Organisationen sind, können im Schadensfall
Pseudokarst in den Ufermoränen des Morteratsch-Gletschers, schnell hohe Forderungsbeträge im fünf- und sechsstelligen Bereich
Bernina, Schweiz ...................................................................... 54 entstehen. Vor diesem Hintergrund können wir allen Mitgliedern
nur dringend raten, ihre Absicherung zu überprüfen und anzupassen.
Helmut Steiner und Michael Laumanns Der alte Solifonds bleibt bestehen, es kann aber nicht weiter einge-
Höhlenprospektion in Nordost-China – zahlt werden. Mitglied im neuen Fonds wird man, wenn man die
Dongbei 2018/2019................................................................. 58 ausgefüllte Einverständniserklärung einsendet und ein Betrag von
mindestens 60 EUR auf dem Konto des Fonds eingegangen ist
Berichte ................................................................................... 68 (Volksbank Laichingen, IBAN: DE12630913000001492012, BIC:
GENODES1LAI). Weitere Details siehe www.vdhk.de.
Personalia.................................................................................. 76 Andreas Wolf, 2. Vorsitzender
Schriftenschau.......................................................................... 82
Redaktionsschlüsse der Mitteilungen – bitte beachten
Heft 1: 1. Januar, Heft 2: 1. April, Heft 3: 1. Juli, Heft 4: 1. Oktober.
Höhlentiere des Jahres.............................................................. 85
Lieferbare Veröffentlichungen.................................................. 87 Der Verband im Internet
www.vdhk.de
Speleotek.................................................................................. 88 Bitte lesen Sie regelmäßig die dort bekanntgegebenen Veranstal-
tungstermine.
Abo der Verbandsmitteilungen
Titelbild: Bärenschliff aus dem Hohlenstein-Stadel bei Asselfin-
gen (Alb-Donau-Kreis) im Lonetal. Aus dieser Höhle stammt der
Abonnements der Verbandsmitteilungen – auch als Geschenk! –
sog. Löwenkopfmensch, die älteste menschliche Plastik der Welt. für 20 Euro/Jahr (inkl. Porto/Verpackung) über: Leonhard
Eine ca. 30.000 Jahre alte Lebensspur des Ursus spelaeus, der Mährlein, Idealweg 11, 90530 Wendelstein, Tel. 09129/8428,
vor 20.000 Jahren aufgrund der Klimaveränderungen durch die schatzmeister@vdkh.de. Das Abonnement gilt jeweils für Heft
Würm-Eiszeit ausgestoben ist. Foto Hans-Martin Luz. 1 - 4 eines jeden Jahrgangs.
Copyright Der Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V. ist als gemein-
Verband der deutschen Höhlen- und Karstforscher e. V., München (VdHK) nützig anerkannt (Finanzamt für Körperschaften München, Steuernummer
143/223/30554 gem. Bescheid vom 24.1.2014).
Schriftleitung
Bankkonto (auch für Spenden)
Dr. Friedhart Knolle, Grummetwiese 16, 38640 Goslar, Volksbank Laichingen, IBAN: DE34 6309 1300 0001 4920 04,
Telefon 05321 / 20 281, fknolle@t-online.de BIC: GENODES1LAI (BLZ 630 913 00, Kto. 1 492 004)
Sven Bauer, Frankenhäuser Str. 28, 99706 Sondershausen, Nachdruck oder Veröffentlichung und Verbreitung in elektronischen Medien,
Telefon 0176 / 2426 6080, geocrax@web.de auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Schriftleitung.
Mathias Beck, Münchner Str. 4, 82229 Seefeld, Erscheinungsweise: 4 x jährlich
Telefon 0177 / 509 3734, MathiasHW.Beck@web.de
Bezugspreis: im Mitgliedsbeitrag inbegriffen; Abo: 20 Euro/Jahr
Dipl.-Biol. Hildegard Rupp, Zum Thingplatz 10, 29229 Celle,
Zugelassen zum Postzustellungsdienst für die Versendung als Streifbandzeitung
hilderupp@posteo.de (Vertriebskennzeichen H 20075 F).
Satz, Druck und Versand Die Redaktion behält sich Kürzung und Bearbeitung von Beiträgen vor. Durch
Oberharzer Druckerei, Fischer & Thielbar GmbH Einsendung von Fotografien und Grafiken stellen die Autoren den VdHK von
Alte Fuhrherrenstraße 5, 38678 Clausthal-Zellerfeld / Buntenbock Ansprüchen Dritter frei.
46 Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4)Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3 + 4) 47 - 53 München 2019
Zur Bewertungsmöglichkeit menschlicher Einflüsse auf Schauhöhlen-Ökosysteme
von
Jenny Linde
Kurzfassung
Im Zuge der touristischen Erschließung von Höhlen werden
hochfragile Ökosysteme durch Eingriffe des Menschen ver-
ändert und in Teilen irreparabel zerstört. Um anthropoge-
ne Beeinträchtigungen zu bewerten, gibt es in Deutschland
bisher nur das Bewertungsverfahren für den Lebensraumtyp
8310 („Nicht touristisch erschlossene Höhlen“) im Rahmen
der europäischen FFH-Richtlinie, das sich nur teilweise auf
Schauhöhlen übertragen lässt (Z aenker 2016). Daher wurde
ein neues Bewertungssystem auf Grundlage einer Punktever-
gabe für einzelne Managementindikatoren entwickelt, das den
Grad der Beeinträchtigung des Höhlenökosystems durch ei-
nen Schauhöhlenbetrieb bemisst und beurteilt.
Abstract
During the development of caves for tourism purposes, highly
fragile ecosystems are changed by human intervention and in
parts irrevocably destroyed. To assess this impact, to date in
Germany there has only been the assessment process for the Abb. 1: Beeinträchtigung des Höhlenökosystems durch menschliche
habitat type 8310 (caves not open to the public) as part of Aktivitäten; Grafik Jenny Linde
the European Habitats Directive guidelines, which can only
sungsgrads durch den Menschen bewerten zu können. Um
partly be transferred to show caves (Z aenker 2016). For this
die Methode auf Schauhöhlen anzuwenden, wurde eine neue
reason, a new assessment method was developed. It is based on
Leitfrage für das Bewertungssystem mit dazugehörigen Kate-
a scoring system for individual management indicators. This
gorien und Indikatoren entwickelt.
system measures and evaluates the degree of impact on the
Eine Übersicht der genutzten Indikatoren, mithilfe derer die
cave ecosystem caused by the operation of a show cave.
Beeinträchtigungen des Höhlenökosystems erfasst werden, ist
in Tab. 1 dargestellt. Die Hauptkategorien, die ausgewählt
Menschliche Einflüsse in Schauhöhlen wurden, decken Problematiken ab, die durch das Manage-
Die durch konstante Bedingungen geprägten Höhlenöko- ment selbst verursacht werden und nicht durch Gesellschaft
systeme werden durch einen Schauhöhlenbetrieb beeinflusst. und Wirtschaft im Umkreis. Dieser Ansatz wurde gewählt,
Menschen, die eine Höhle betreten, egal ob Forschende oder damit das Schauhöhlen-Management selbst in der Lage ist,
Touristen, haben stets einen Einfluss auf das Höhlenökosys- Beeinträchtigungen durch gezielte Maßnahmen zu beein-
tem. Eine Veränderung und Störung der Komponenten ist in flussen und zu verbessern. Diesen Hauptkategorien wurden
Höhlen besonders kritisch, da deren Ökosysteme eine äußerst einzelne Indikatoren zugewiesen, die relevant für das Höh-
geringe Resilienz aufweisen. Regenerationsprozesse dauern lenökosystem sowie mess- und bewertbar sind. Jedem Indika-
sehr lange oder sind gar nicht möglich. Aufgrund der starken tor wurde eine Punktzahl von 1 bis 3 gegeben, basierend auf
Habitatadaption der Höhlenbiota wirken sich schon geringe dem Grad der Beeinträchtigung des Höhlenökosystems durch
Umweltveränderungen auf das Verhalten und die Populatio- den Schauhöhlenbetrieb. Je größer die Zahl, desto größer die
nen der Fauna aus. Nicht nur das Höhlenbiotop wird dabei Beeinträchtigung. Als Grundannahme wurde davon ausge-
beeinflusst, sondern auch die abiotischen Eigenschaften und gangen, dass die Höhle per se eine Beeinträchtigung durch
die geologischen Prozesse werden verändert (Tremp & Rusdea den Besucherbetrieb erfährt, da sie sich durch die menschli-
1999, Gillieson 2011). che Einflussnahme nicht natürlich entwickeln kann. Gar kei-
Um Schauhöhlen objektiv und nachvollziehbar vergleichen zu ne Störung (0) ist daher ausgeschlossen. Die Punkte 1 bis 3
können, wurde für die Analyse ein Bewertungssystem entwi- wurden vergeben bei leichter Beeinträchtigung (1), mäßiger
ckelt, mittels dessen der Grad der Beeinträchtigung des Höh- Beeinträchtigung (2) und starker Beeinträchtigung (3). Ein
lenökosystems durch den Schauhöhlenbetrieb erfasst wird. In Indikator, der für die Höhle keine Relevanz hat, kann ggf. aus
Anlehnung an die Methodik von Van Beynen & Townsend dem Bewertungssystem herausgenommen werden, indem die
(2005) zum Karst Disturbance Index wurde dieser Bewer- Gesamtpunktzahl herabgesetzt wird. Eine Vergleichsmöglich-
tungsschlüssel für Schauhöhlen adaptiert und weiterentwi- keit mehrerer Höhlen besteht aber nur, wenn nicht zu viele
ckelt. Van Beynen & Townsend (2005) entwickelten einen Indikatoren ausgelassen werden.
ganzheitlichen Ansatz, um Karstlandschaften in ihrer Vielfalt Um den Beeinträchtigungsindex zu errechnen, wird die Sum-
mit Hilfe eines Punktesystems hinsichtlich ihres Beeinflus- me aller für die Indikatoren vergebenen Punkte für eine Schau-
Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4) 47Tab. 1: Ausgewählte Bewertungskategorien und -indikatoren für Schauhöhlen
Kategorie Indikator 3* 2* 1*
Normalbetrieb Baumaßnahmen maximal invasiv invasiv invasiv, mit Renaturie-
rungsmaßnahmen
Anteil der Wege am > 66 % 34 - 66 % 1 - 33 %
Höhlensystem
Führungsweg gleicher Weg hinein wie ein Teil des Weges wird kein Weg wird doppelt
hinaus doppelt begangen begangen
Beschaffenheit und Einbringung von Einbringung von Verwendung von
Pflege der Wege höhlenfremdem Material höhlenfremdem Material autochthonem
(versiegelte Flächen) (unversiegelte Flächen) Höhlenmaterial
Sonderbetrieb Events tägliche Licht- und/oder unregelmäßige Licht- und/ nur Führungen, keine
Musikshows oder Musikshows Events
Sonderveranstaltungen Sonderveranstaltungen Sonderveranstaltungen mit nur Führungen, keine
ohne Beschränkungen Beschränkungen Sonderveranstaltungen
Beleuchtung Leuchtmittel Einsatz von Glühbirnen Mix aus modernen Einsatz moderner
Leuchtmitteln und Leuchtmittel
Glühbirnen
Schaltsystem der Licht brennt permanent Licht brennt während Licht wird nur an
Beleuchtung ganzer Führung bestimmten Orten
angeschaltet
Lampenflora ausgeprägt, wachsend vorhanden, aber nicht nicht ausgeprägt
mehr wachsend
Fledermausschutz Winterquartiere von im Besucherbereich außerhalb des Höhle über Winter
Fledermäusen Besucherbereiches geschlossen
* (1) leichte Beeinträchtigung, (2) mäßige Beeinträchtigung, (3) starke Beeinträchtigung
höhle durch die höchstmögliche Punktzahl dividiert (bei zehn Temperatur geprägt. Die in Höhlen auftretenden Gesteinsforma-
Indikatoren ist die maximal erreichbare Punktzahl 30): tionen und mineralogischen Prozesse sind ebenfalls Bestandteil
der abiotischen Komponenten des Höhlenökosystems. Beein-
trächtigungen, die durch den Schauhöhlenbetrieb entstehen,
verändern lebensraumtypische Habitatstrukturen, zerstören das
Das Ergebnis ist ein Wert zwischen 0 und 1, woraus die Be- natürliche Erscheinungsbild der Höhle oder beeinflussen das le-
einträchtigung des Höhlenökosystems beurteilt wird. In Tab. bensraumtypische Arteninventar. Biotop und Geotop werden als
2 wird die Einteilung des Indexes in fünf Kategorien angege- gleichermaßen schützenswert angesehen. Nicht nur die lebenden
ben. Je näher der Wert der Zahl 1 ist, desto größer ist der Grad Komponenten des Höhlenökosystems sollen erhalten bleiben,
der Beeinträchtigung. Dieses Punktesystem ermöglicht es, die sondern auch die abiotische Dynamik des Gesteins. Höhlen-
Schauhöhlen bezüglich der Beeinflussung durch den Menschen schutz kann nicht punktuell betrieben werden, da die Komparti-
quantitativ zu bewerten und miteinander zu vergleichen. mente aufeinander abgestimmt sind.
Indikatoren des Bewertungssystems Baumaßnahmen
Berücksichtigung finden sowohl die abiotischen als auch die Baumaßnahmen, die in Folge anderweitiger Nutzung oder für
biotischen Komponenten, die zu einem Höhlenökosystem gehö- den Besucherbetrieb getätigt wurden, schädigen die biotischen
ren. Die Habitate der Höhlenbiota werden durch die abiotischen und abiotischen Komponenten des Höhlenökosystems. Dazu
Faktoren wie Licht, Wasser- und Stoffflüsse, Geräuschpegel und zählen Einbauten in der Höhle für eine bessere Wegeführung,
zum Beispiel durch Treppen und Stege oder das Einbringen
Tab. 2: Klassifikation des Beeinträchtigungsindexes (van Beynen & von Fremdmaterialien, wie das Betonieren des Bodens. Die Si-
Townsend 2005) cherheitsvorkehrungen sind immer Eingriffe in das natürliche
Höhlenökosystem und verändern das Erscheinungsbild und die
Morphologie der Höhle (Cigna 2016). Zur „Verschönerung“
angelegte künstliche Seen veränderten die natürliche Erschei-
nung, die Höhlenmorphologie und die Habitatstrukturen deut-
lich, ebenso wie Sprengarbeiten, um Räumlichkeiten zu vergrö-
ßern. Einbauten wie angelegte Wege und Treppen verändern
das Abflussverhalten von Tropfwasser und können dazu führen,
dass Höhlenformationen austrocknen (Gillieson 2011). Bei
Betonierungen und Wegearbeiten wird das Höhlensediment
verdichtet. Nach abgeschlossenen Baumaßnahmen ist es für das
Höhlenökosystem sehr wichtig, alle Rückstände der Bauarbei-
ten aus der Höhle zu entfernen. Metall- oder Kabelfragmente
infolge von Leitungsverlegungen können das Einbringen von
48 Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4)toxischen Stoffen zur Folge haben. Kupfer erzeugt Verbindun- gemanagt werden, wenn ein Teil des Höhlensystems mit den In-
gen, die giftig für Invertebraten sind, und galvanisierte Bauteile stallationen und Baumaßnahmen für einen Schauhöhlenbetrieb
setzen Metallionen frei, wie beispielsweise Cadmium, die eine nicht in Berührung kommt (Cigna 1993).
toxische Wirkung auf Mikrobiota, speziell die Süßwasserfauna,
haben. Auch verzinkte Eisen- oder Stahlkonstruktionen kön- Beschaffenheit und Pflege der Wege
nen toxisch wirkende Zinkionen an die Umgebung abgeben. Um das Befahren einer Schauhöhle möglichst einfach zu gestalten,
Kontaminieren diese Materialien das Höhlensediment oder werden gut begehbare Wege innerhalb der Höhle angelegt. Dabei
das Karstwasser, können deutliche Schäden verursacht werden wird das Höhlensediment verdichtet oder teilweise entfernt. Höh-
(Hamilton-Smith 2004, Gillieson 2011, Cigna 2016, ISCA lensediment stellt einen wichtigen Lebensraum für cavernicole
et al. 2015). Tierarten, besonders Invertebraten, dar. Durch Verdichtung und
Um diesen negativen Auswirkungen entgegen zu wirken und Entnahme der Höhlensedimente verlieren diese Teile ihres Habi-
vorhandene Schäden zu reparieren, sind Renaturierungsmaß- tats. Durch die Einbringung von Baumaterial zur Begradigung der
nahmen erforderlich. In Schauhöhlen ist aufgrund der langjäh- Wege werden Fremdstoffe in die Höhle eingetragen. Diese müssen
rigen Nutzung nur eine teilweise Wiederherstellung möglich. den natürlichen klimatischen Gegebenheiten in der Höhle stand-
Renaturierungsmaßnahmen umfassen beispielsweise die Ent- halten und sollten nicht bereits nach kurzer Zeit hohe Abnutzungs-
fernung von alten Baumaterialien, wie künstlich eingebrachte erscheinungen aufweisen. Die Materialien, die für den Gebrauch
Sedimente oder Kabelreste ehemaliger Beleuchtungsanlagen, unter solchen Bedingungen entwickelt wurden, sind langlebiger
die Reinigung der Wände von Lampenflora oder die Wieder- als in der Anfangszeit des Höhlentourismus. Heutzutage werden
herstellung von Lebensräumen (Werker & Hildreth-Werker außerdem Materialien bevorzugt, die auf lange Sicht keine Schad-
2004). stoffe freisetzen und nicht toxisch für die Höhlenbiota sind oder
die abiotische Umwelt verunreinigen – dazu zählen Edelstahl und
Kunststoff (Cigna 2016). Beton dagegen versiegelt den Boden,
verändert den Tropfwasserverlauf und zerstört Höhlensedimente
(Gillieson 2011). Mit der Einbringung höhlenfremder Baumate-
rialien verändert sich außerdem das natürliche Erscheinungsbild
der Höhle. Aber auch die über die Wege laufenden Besucher brin-
gen höhlenfremde organische und anorganische Sedimente in das
Höhlenökosystem ein – die Wege sind daher regelmäßig zu reini-
gen, wobei die eingetragenen Sedimente aus der Höhle entfernt
werden. In der hessischen Schauhöhle Herbstlabyrinth hat man
die Führungswege aus mehr oder weniger inertem GFK-Material
auf Stelzen und mit Gitterosten ausgebaut. Unter den Gittern hän-
gen Planen, die das eingebrachte organische Material auffangen, so
dass es regelmäßig entfernt werden kann.
Abb. 2: Minimalinvasiver Führungsweg aus GFK-Material in der
Schauhöhle Herbstlabyrinth bei Breitscheid, Hessen; Foto Siegfried
Wielert
Führungsweg
Der Führungsweg stellt den öffentlich begehbaren Bereich der
Höhle dar. Touristen dürfen sich während einer Führung nur auf
dem abgegrenzten Weg aufhalten. Sie werden für die Sicherheit der
Besuchenden ausgebaut, regelmäßig instand gehalten und über-
prüft. Um den Energieeintrag in die Höhle durch Besuchende zu
verringern, sollten Führungswege nicht doppelt begangen werden,
sondern unterschiedliche Ein- und Ausgänge verwendet werden
(Cigna 2016). Die Personenanzahl und die Verweilzeit in einem
Hohlraum haben einen entscheidenden Einfluss auf das Mikrokli-
ma der Höhle. Die doppelte Trittbelastung des Wegs beeinträch-
tigt ebenfalls die Höhlenbiota.
Abb. 3: Schutzplane unter dem Führungsweg im Herbstlabyrinth
Anteil der Wege am Höhlensystem bei Breitscheid, Hessen; Foto Ingo Dorsten
Um den Bestandteilen des Höhlenökosystems einen Rückzug-
sraum für eine ungestörte Entwicklung zu geben, sollte nicht die Events
gesamte Höhle als Schauhöhle genutzt werden. Um die aus der Mit einem Event während einer Höhlenführung ist eine bestimm-
Nutzung herausgenommenen Bereiche untereinander vergleichen te, wiederholbare Aktion gemeint, beispielsweise eine Licht- und/
zu können, wird der Führungsweg ins Verhältnis zur Gesamthöh- oder Musikshow, durch die sich Höhlenbetreiber eine Erlebnis-
lenlänge gesetzt. Analog zu van Beynen & Townsend (2005) wird steigerung für die Touristen versprechen. Solche Events werden
die Bewertung durch eine Einteilung in Drittel vorgenommen. Die auf jeder Führung durchgeführt und haben einen potentiell stö-
unzugänglichen Teile der Höhle sollen aus Naturschutzgründen renden Charakter. Durch einen zusätzlichen Geräuschpegel oder
so bleiben, wie sie die Natur geschaffen hat. Die Erhaltung der Lichtemissionen wird die Höhlenfauna beeinträchtigt. Beispiels-
natürlichen Fauna und ihrer Habitate in der Höhle kann besser weise sind für das Geotop über das normale Maß hinausgehende
Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4) 49Lärmpegel ebenfalls schädlich. Die erzeugten Schallwellen setzen tigt dementsprechend direkt das Mikroklima, so dass Habitate
Gesteinsformationen in Schwingungen und können Abbrüche zur durch die Veränderung der abiotischen Eigenschaften gestört wer-
Folge haben (Glückauf-Vermessung GmbH 2014). den.
Sonderveranstaltungen Schaltsystem der Beleuchtung
Sonderveranstaltungen werden außerhalb des regelmäßigen Füh- Das Einschalten der Beleuchtung für bestimmte Abschnitte des
rungsbetriebs angeboten. Konzerte, Theateraufführungen, Ge- Führungswegs ist einerseits kostensparend, da nicht unnötig Ener-
burtstage oder Hochzeiten können extra gebucht werden. Diese gie verbraucht wird für Abschnitte, in denen sich niemand befin-
werden teilweise außerhalb des Führungsbetriebs durchgeführt, det, und andererseits wird die Höhlenumwelt nicht durch einen
wodurch die Ruhezeiten in der Höhle verkürzt werden. Während künstlichen Tag-/Nacht-Rhythmus an die Oberfläche angepasst.
der Veranstaltungen nehmen die Lautstärke und die Lichtemissio- Die Höhlenlebewesen sind in ihrer Physiologie an ein Leben in
nen in der Höhle zu. Dunkelheit angepasst, so dass permanente Lichteinwirkung eine
Ein zusätzlicher Energieinput kann das Gleichgewicht des Ökosys- starke Beeinträchtigung des Lebensraums zur Folge hat.
tems „Höhle“ empfindlich verändern (Cigna 1993). Besuchende Für das Wachstum von Lampenflora sind die Lichtintensität und
und Beleuchtungsanlagen mit hohen Licht- und Wärmeemissio- die Dauer der Beleuchtung entscheidend. Durch eine kontinu-
nen tragen zu einer Erhöhung des Energieniveaus bei. Während ierliche Beleuchtung kann sich mehr Lampenflora entwickeln
Sonderveranstaltungen konzentrieren sich die Besuchergruppen als in Perioden mit kurzer Lichteinwirkung, auch wenn die glei-
auf einen Raum mit einer längeren Verweilzeit als üblich auf Füh- che Anzahl an Stunden pro Tag gegeben ist. Ursache dafür sind
rungen. Teilweise werden die Räume zusätzlich ausgestrahlt oder chemische und physiologische Stoffwechselprozesse der Pflanzen
bei Hochzeiten mit Kerzen erleuchtet. Die Gerüche und die Wär- zwischen den Licht- und Dunkelphasen, die Zeit und Energie er-
me, die dabei freigesetzt werden, beeinträchtigen das Mikroklima. fordern (A ley 2004). Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
Besonders Fledermäuse reagieren empfindlich auf eine Verände- mehrmals am Tag kann die Lampenflora reduzieren und damit
rung der lokalen Klimaverhältnisse (Furey & R acey 2016). das Gesteinssubstrat schützen (siehe folgender Abschnitt Lampen-
flora). Um einen zusätzlichen Energieeintrag in Form der Wärme-
Leuchtmittel abstrahlung von Lampen zu minimieren, sollte das Beleuchtungs-
Bei einem zusätzlichen Energieinput kann das Gleichgewicht ei- system in getrennte Abschnitte unterteilt werden. Somit wird die
ner Höhle empfindlich gestört werden (Cigna 1993). Moderne Anzahl der Lampen, die gleichzeitig brennen, reduziert und die
Leuchtmittel wie LEDs oder Kaltkathodenlampen (CCL) haben Wärmemenge an einem Standort gesenkt (Cigna 1993). An Tagen
zu den in der Vergangenheit genutzten Glühbirnen deutliche Vor- mit einem hohen Besucheraufkommen, wenn die Führungen in
teile. Der Energieverbrauch wird gesenkt, die thermale Wirkung kurzen Intervallen erfolgen, ist davon auszugehen, dass die Lam-
auf die Umgebung reduziert und damit zusammenhängend auch pen durchgängig brennen und das Höhlenökosystem durch erhöh-
die Ausbildung von Lampenflora verringert. Außerdem sind mo- te Lichtemissionen gestört wird.
derne Beleuchtungsanlagen deutlich effizienter, so dass die Be-
triebskosten für die Beleuchtung reduziert werden, haben eine sehr Lampenflora
lange Lebensdauer und müssen nicht häufig gewechselt werden Licht ist für autotrophe Pflanzen der limitierende Faktor in der
(Cigna 2016). Dunkelheit der Höhle, sie finden dort keine Wachstumsbedingun-
Für die Grotta di Castellana in Süditalien wurde nachgewiesen, gen vor. Durch den zusätzlichen Energieeintrag von Beleuchtungs-
dass eine 1 kW-Glühlampe, die sich 50 cm von der Gesteinswand anlagen in Schauhöhlen sind sie in der Lage, trotzdem zu wachsen.
entfernt befand, innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschal- Zur Gruppe der „Lampenflora“ gehören Algen, Cyanobakterien,
ten die Temperatur der Wand von 15 auf 25 °C erhöhte und die Moose, Moos-Protonema (asexuelle Mooskeime), Flechten und
Luftfeuchtigkeit von 95 - 100 auf 55 - 60 % fallen ließ (Cigna Farne. Sie können das natürliche Erscheinungsbild der Höhle ver-
1993). Die Wärmeemission von Beleuchtungsanlagen beeinträch- ändern und das Gesteinssubstrat beschädigen, da sie organische
Säuren produzieren, die die Gesteinsoberfläche korrodieren (A ley
2004).
Mit dem Besucherstrom, aber auch durch natürliche Prozesse
wie Wind-, Wasser- und Tiertransport werden in die Höhlen-
umwelt Sporen und Samen von Pflanzen eingetragen, die durch
die Energie und Lichtabgabe der Lampen in deren Nähe an den
Höhlenwänden zu keimen beginnen (Cigna 2016). Als Standorte
bevorzugen die Pflanzen feuchte und nasse Bedingungen. Wei-
che Oberflächen wie Höhlensedimente und Calcitablagerungen
(Mondmilch) können mehr Feuchtigkeit speichern und sind des-
halb anfälliger für das Wachstum als harte Oberflächen wie z.B.
die aktiven Ablagerungen von Speläothemen. In humiden Regio-
nen reicht die Feuchtigkeit auf harten Oberflächen jedoch eben-
falls aus, um Lampenflora entstehen zu lassen (A ley 2004). Das
Wachstum der Lampenflora wird durch die gesamte Lichtenergie
gesteuert, die sich aus der Lichtintensität und der Dauer der Be-
Abb. 4: Die in der Eisriesenwelt bei Werfen in Österreich zur Be- leuchtung zusammensetzt, außerdem sind Temperatur, Feuch-
leuchtung eingesetzten Magnesiumfackeln sind wenig vorbildlich tigkeit und Substrat ausschlaggebend (A ley 2004, Cigna 2011).
– sie produzieren erhebliche Feinstaubmengen und hinterlassen Ab- Eine Beleuchtungsstärke von 40 Lux ist ein grober Wert, bei dem
brandreste; Foto Matthias Kabel, Wikimedia Commons es unter kontinuierlicher Beleuchtung zu einer Entwicklung von
50 Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4)etwa 85 % der Lampenflora kommt. Lampen mit hoher Lichte- tate durch eine Veränderung der abiotischen Habitateigenschaften
mission fördern die Fotosynthese. Das Chlorophyll der Pflanzen angestellt werden. Beispielsweise beruhen die angegebenen maxi-
hat zwei Absorptionspeaks in den Bereichen 430 - 490 nm und malen Dezibelzahlen für die Lautstärke auf Erfahrungswerten und
640 - 690 nm. Lampen mit einem Emissionsspektrum außerhalb nicht auf wissenschaftlich abgesicherten Kenntnissen, die Beein-
dieser Bereiche können den Fotosyntheseprozess einschränken trächtigungen der abiotischen und biotischen Komponenten des
(Cigna 2011, 2016). Höhlenökosystems genauer beschreiben. Dazu ist Forschung zu
Winterquartiere von Fledermäusen innerhalb der Höhle den Auswirkungen unerlässlich.
Werden Fledermäuse während ihres Winterschlafs gestört, ver- Bei der Berechnung des Anteils der Besucherwege am Höh-
brauchen sie beim Aufwachen für die Temperatursteigerung ihres lensystem sagt ein hoher Anteil von unerschlossenen Bereichen
Körpers sehr viel Energie aus ihren Fettreserven, dem sog. „Brau- noch nichts über die Qualität der dort vorliegenden Habitate
nen Fettgewebe“ (Dietz et al. 2007). Bei häufigen Störungen für die Höhlenfauna aus. Eine Zerstückelung des ungestörten
können diese schrumpfen und die Fledermäuse bis zum Frühjahr Lebensraums in kurze Abschnitte oder eine Lage direkt an den
Besucherwegen wird durch die Zahlen nicht deutlich. Wenn kei-
ne störungsfreien Verbindungen zwischen den unerschlossenen
Teilen und der Außenwelt bestehen, müssen die Tiere durch die
touristisch erschlossenen Bereiche migrieren. An diese quantitative
Analyse des Indikators „Anteil der Wege am Höhlensystem“ muss
eine qualitative Untersuchung, beispielsweise durch ein Experten-
gutachten, anschließen.
Der Indikator „Baumaßnahmen“ kann teilweise nicht unmittelbar
vom jetzigen Schauhöhlenmanagement beeinflusst werden. Das
Management aller Schauhöhlen muss die Bewirtschaftung mit
dem aktuellen Zustand der Höhle abstimmen. In der Vergangen-
heit sind hauptsächlich aus touristischen Gründen viele Eingriffe
in die Höhlen vorgenommen worden, die das Höhlenökosystem
massiv beeinträchtigt haben. Daran lässt sich nur bedingt etwas
ändern. Der Betrieb kann jedoch zukünftig darauf achten, dass
bei diesem Indikator nicht noch mehr Schaden an der Höhle ange-
richtet wird bzw. kann er alte Einbauten zurückbauen.
Abb. 5: Lampenflora in der Teufelshöhle bei Steinau; Foto Rainer
Lippert Das entwickelte Bewertungssystem kann nur mit einer Leitfrage
angewendet werden. Es gibt ausschließlich Auskunft über den
nicht mehr mit der nötigen Energie versorgen. Liegen die Winter- Grad der Beeinträchtigung des Höhlenökosystems. Es wurden
quartiere an oder nahe der Besucherwege, können die Tiere täglich nur Indikatoren bemessen, bei denen festgestellt werden konn-
erwachen und durch Erschöpfung sterben (Furey & R acey 2016, te, dass durch das Management direkt auf das Höhlenökosys-
Thomas 1995). Um den Schutz der Tiere optimal zu gewährleis- tem Einfluss genommen wird. Es gibt noch andere einflussreiche
ten, sollten die Bereiche der Winterquartiere nicht begangen wer- Stellgrößen, die jedoch mit der Leitfrage nicht kompatibel waren
den. Für nicht touristisch erschlossene Höhlen ist ein gesetzlicher und nicht bewertet werden konnten. Jede Höhle hat eine andere
Schutz festgelegt. Das BNatSchG (2017) § 39 (6) schreibt vor:
„Es ist verboten, Höhlen, Stollen, Erdkeller oder ähnliche Räu-
me, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, in der Zeit
vom 1. Oktober bis zum 31. März aufzusuchen; dies gilt nicht zur
Durchführung unaufschiebbarer und nur geringfügig störender
Handlungen sowie für touristisch erschlossene oder stark genutzte
Bereiche.“ Schauhöhlen sind davon grundsätzlich nicht betroffen,
obwohl sie auch in Teilen wichtige Winterquartiere für Fleder-
mäuse, teilweise mit überregionaler Bedeutung, sind. Dennoch gilt
auch in Schauhöhlen natürlich der allgemeine Artenschutz, z.T.
sogar ein FFH-Schutzstatus.
Diskussion
Das Bewertungssystem hebt Aspekte hervor, die besonders durch
den Schauhöhlenbetrieb beeinträchtigt werden.
Bei einer ersten Anwendung des Bewertungssystems konnte fest-
gestellt werden, dass unzureichendes Datenmaterial große Schwie-
rigkeiten in der Bewertung mit sich bringt.
Beispielsweise liegen für die Indikatoren „Events“ und „Sonderver-
anstaltungen“ in Bezug auf Schauhöhlen oft nicht genügend Da-
ten vor, um diese objektiv beurteilen zu können. Eine direkte Be-
einträchtigung der Höhlenfauna kann durch Licht-, Wärme- und Abb. 6: Nicht mehr benötigte Einbauten sollten schnellstmöglich
Geräuschemissionen nicht bewiesen werden. Bisher sind kaum aus der Höhle entfernt werden – aus ästhetischen Gründen, aber
Forschungen bekannt, die diese Aspekte im Detail untersuchen. auch, weil von ihnen Schadstoffe freigesetzt werden könnten; Foto
Es können oft lediglich Vermutungen über die Störung der Habi- Segeberger Kalkberghöhle
Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4) 51Der Vergleich von Schauhöhlen zeigt die besten Management-
maßnahmen auf, die andere Betreiber übernehmen können, um
den Zustand des Höhlenökosystems zu verbessern. Es ist weltweit
nutzbar, da die Indikatoren essentielle Vorgehensweisen für einen
Schauhöhlenbetrieb abdecken.
Fehlende Forschung lässt teilweise nur Vermutungen oder Schät-
zungen zu. Validierte Aussagen lassen sich nur beschränkt treffen
und nicht verallgemeinern. Die quantitative Methodik bildet nicht
die Qualität der Beeinträchtigung ab. Ein anschließendes Exper-
tengutachten ist empfehlenswert. Während der Durchführung
wurden Schwachstellen aufgedeckt, die für weitere Einsätze an-
gepasst und verbessert werden können. Beispielsweise können die
Beschreibungen der Abstufungen der Indikatoren erweitert und
präzisiert werden, um eine subjektive Bewertung zu verringern
und bessere Auswahlmöglichkeiten zu geben.
Wird ausschließlich das Höhlenökosystem betrachtet, ist ein
Abb. 7: Auch von der Zahl der Besucher ist der touristische Einfluss Schauhöhlenbetrieb grundsätzlich nachteilig. Um ein funktionie-
auf das Höhlenökosystem abhängig; Foto ArGeKH rendes Konzept zwischen Naturschutz und Tourismus zu finden,
Ausgangssituation. Die Unterschiedlichkeiten in den natürlichen müssen die Veränderungen so minimal gehalten werden, dass der
Standortvoraussetzungen stellen verschiedene Anforderungen an Status quo erhalten werden kann. Um den Betrieb einer Schau-
das Management. Beispielsweise ist eine Vergleichbarkeit der Höh- höhle zu rechtfertigen, sollten nicht ausschließlich ökologische
len bezüglich der Fledermauspopulationen nicht möglich, da jede Aspekte Beachtung finden. Um eine ganzheitliche Qualitätsana-
Höhle unterschiedliche Habitatvoraussetzungen hat. Eine abstu- lyse für Schauhöhlen zu entwickeln, müssen die Indikatoren alle
fende Bewertung ist bei Tierarten nicht anwendbar, jedoch kann Bereiche der Nachhaltigkeit abdecken. Soziale und ökonomische
der Umgang durch das Management mit der Höhlenfauna mitei- Faktoren müssen ebenfalls Berücksichtigung finden. Auf diese He-
nander verglichen und bewertet werden. rangehensweise wurde hier verzichtet, da die Hauptursachen der
Um der Frage nach der Veränderung des Höhlenökosystems durch Beeinträchtigung des Höhlenökosystems im Fokus vorliegender
den Schauhöhlenbetrieb nachzugehen, bedarf es Forschung, die Arbeit standen.
schon vor der touristischen Erschließung ansetzt. Heutzutage Weiterhin offen ist die Frage der Einbeziehung der Besucherzah-
wird bei Neueröffnungen ein weitreichendes Monitoring etabliert len der jeweiligen Schauhöhle. Sie spielen eine große ökologische
und das Ökosystem inventarisiert (Cigna & Burri 2000). Nur und auch ökonomische Rolle, sind jedoch in ihrer Wirkung auch
so können Zusammenhänge von Besucherbetrieb und Schauhöh- abhängig von Größe und Form der Höhle und damit schwer be-
lenmanagement auf das Höhlenökosystem verifiziert werden. Bei wertbar. Natürlich macht es einen Unterschied, ob 200.000 oder
den Schauhöhlen, die in den vergangenen Jahrhunderten eröffnet nur 20.000 Besucher im Jahr eine Schauhöhle besichtigen, aber
wurden, fehlt diese Forschung. Das betrifft fast alle Schauhöhlen aus dem übertägigen Flächenschutz ist auch bekannt, dass viele
Deutschlands. Erst in den letzten Jahren wurden mehr und mehr Wanderer, die auf den vorgeschriebenen Wegen bleiben, oft gerin-
Umweltdaten gesammelt. gere Wirkungen auf Fauna und Flora haben als wenige Besucher,
Die Auswertungen eines ersten Bewertungsdurchgangs orientieren die das Wegesystem verlassen.
sich sehr stark an den Lebensbedingungen für Fledermäuse. Diese In diesem Sinne ist das entwickelte Bewertungssystem als ein An-
wurden als Indikatortiere gewählt, da sie gut erkennbar sind und satz anzusehen, der weiterentwickelt werden kann.
eine hohe Sensibilität für Veränderungen aufweisen. Andere Höh-
lenbiota sind aufgrund mangelnder Literaturdaten eher ungeeig- Dank
net. Besonders den Beeinträchtigungen durch Licht-, Wärme- und Das Bewertungssystem entstand im Rahmen einer Masterarbeit
Geräuschemissionen der Invertebraten beim Schauhöhlenbetrieb an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit dem The-
wurde bisher kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist ein gro- ma „Vergleich der Managementkonzepte deutscher Schauhöhlen
ßes Defizit, da in Höhlen die Wirbellosen einen Großteil der Le- in Sulfatkarstlandschaften“ (Linde 2017). Ich bedanke mich für
bensgemeinschaften darstellen (Zaenker et al. 2018). Daher ist die umfassende Betreuung bei den Gutachtern Prof. Dr. Manfred
es wichtig, dass untersucht wird, welche cavernicolen Arten über- Frühauf und Dr. Friedhart Knolle sowie für die inhaltliche und
haupt in der Höhle vorkommen. Auf eine endemische Art, wie z. motivierende Unterstützung von Dr. Anne Ipsen. Wertvolle Hin-
B. den Segeberger Höhlenkäfer, hat der Besucherverkehr sicherlich weise gab auch Stefan Zaenker.
eine andere Auswirkung als in einer fränkischen Schauhöhle auf
Nestkäferpopulationen, wenn die Tiere auch benachbarte Höhlen Literatur
ohne Besucherverkehr besiedeln. An diesem Punkt kann das FFH- A ley, T. (2004): Tourist caves: Algae and lampenflora. – In: Gunn, J.
Bewertungsschema von Zaenker (2016) mit dem hier vorgestell- (Hg.): Encyclopedia of caves and karst science. Fitzroy Dearborn,
ten System verknüpft werden – eine Aufgabe für die Zukunft. New York
BNatSchG (2017): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), online verfügbar unter ht-
Fazit und Ausblick
tps://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/BNatSchG.pdf
Die Beurteilung nach Indikatoren zeigt Schwachstellen im Höh- Cigna, A. (1993): Environmental management of tourist caves. – Envi-
lenmanagement auf, die einer Verbesserung bedürfen. Es ist ein ronmental Geology 21 (3): 173-180
Instrument, das zukünftig Anwendung bei Landesämtern oder Cigna, A. (2011): The Problem of Lampenflora in Show Caves. – In:
Naturschutzbehörden finden kann, die eine Schauhöhle bezüglich Bella, P. & Gažík, P. (Hg.): ISCA 6th Congress Proceedings, Lip-
ihres Erhaltungszustands und Schutzauftrages beurteilen müssen. tovský Mikuláš, Slovak Caves Administation: 201-205
52 Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4)Cigna, A. (2016): Tourism and show caves. – Z. Geomorphologie 60 (2): Thomas, D. (1995): Hibernating Bats Are Sensitive to Nontactile Hu-
217-233 man Disturbance. – J. Mammalogy 76 (3): 940-946
Cigna, A. & Burri, E. (2000): Development, management and economy Tremp, H. & Rusdea, E. (1999): Höhlen. – In: Konold, W. (Hg.): Hand-
of show caves. – Int. J. Speleol. 29B (1/4): 1-27 buch Naturschutz und Landschaftspflege. Kompendium zu Schutz
Dietz, C., Von Helversen, O. & Nill, D. (2007): Handbuch der Fle- und Entwicklung von Lebensräumen und Landschaften. Wiley
dermäuse Europas und Nordwestafrikas. Biologie, Kennzeichen, Ge- VCH, Weinheim
fährdung. – Kosmos, Stuttgart Van Beyen, P. & Townsend, K. (2005): A disturbance index for karst
Furey, N. & Racey, P. (2016): Conservation Ecology of Cave Bats. – In: environments. – Environmental Management 36 (1): 101-116
Voigt, C. & Kingston, T. (Hg.): Bats in the anthropocene. Conserva- Werker, J. & Hildreth-Werker, V. (2004): Restoration of Caves and
tion of bats in a changing world. Springer Open, Cham - New York Speleothem Repair. – In: Gunn, J. (Hg.): Encyclopedia of caves and
Gillieson, D. (2011): Management of Caves. – In: Van Beynen, P. (Hg.): karst science. Fitzroy Dearborn, New York
Karst Management. Springer Netherlands, Dordrecht Zaenker, S. (2016): Vorschlag für ein neues Bewertungsverfahren des
Glückauf-Vermessung GmbH (2014): Hauptbetriebsplan 2014 - 2018 Lebensraumtyps 8310 (Nicht touristisch erschlossene Höhlen) im
für den Betrieb der Barbarossahöhle nach § 52 Abs. 2 Nr. 2 BBergG Rahmen der europäischen FFH-Richtlinie. – Mitt. Verb. dt. Höh-
Hamilton-Smith, E. (2004): Tourist Caves. – In: Gunn, J. (Hg.): En- len- und Karstforscher 62 (3): 79-83
cyclopedia of caves and karst science. Fitzroy Dearborn, New York Zaenker, S., Hansbauer, G. & Steiner, H. (2018): Leben im Dunkel.
ISCA, IUCN & UIS (2015): Recommended International Guidelines for Höhlentiere in den Alpen. Ein Projekt zur Biodiversität unterirdi-
the Development and Management of Show Caves. – UIS-Bulletin scher Lebensräume im Rahmen des Ökoplan Alpen 2020. – Abh.
57 (1): 43-48 Karst- u. Höhlenkunde 37: 1-64
Linde, J. (2017): Vergleich der Managementkonzepte deutscher Schau-
höhlen in Sulfatkarstlandschaften“. – Masterarbeit Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Gutachter Prof. Dr. Manfred Frühauf Autorin: Jenny Linde M.Sc. International Area Studies,
und Dr. Friedhart Knolle Illertalstraße 21, 87448 Waltenhofen
Treffen des AK Nachhaltigkeit auf der Verbandstagung 2019 in Nesselwang
Am 17. August 2019 traf sich von 16 - 17 Uhr der AK Nachhaltigkeit.
Anwesend waren: Nathan Dornseif, Hildegard Rupp, Dr. Anne Ipsen,
Julia Hofmann, Peter Hofmann, Mathias Beck, Jean-Claude Thies,
Dominik Fröhlich, Seven Bauer und Dr. Jörg Dreybrodt, als Gast
Christian Lüthi (SGH).
Behandelte Themen
Einführung in den Arbeitskreis (AK), Ziele und Vorstellung des Posi-
tionspapiers (Jörg). Nächster Schritt ist die Verbreitung des Papiers auf
Deutsch und Englisch auf der VdHK-Webpage, in den Social Media,
bei den Naturschutz-NGOs einschließlich EEB, in Institutionen und
durch Veröffentlichungen.
Vorstellungsrunde mit Erwartungen und Anregungen: Kurzvorstel-
lung jedes Teilnehmers mit Erwartungen und Anregungen. Dadurch
entwickelte sich eine lebendige Diskussion. Folgende Punkte wurden
festgehalten:
Foto Renate Gindert
• Aktiv werden und ein eigenes Pilotprojekt starten, evtl. Förderung
bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) beantragen, besser Aktionspunkte
groß denken als klein und auf 2 - 3 Jahre (Anne) • Erstellung zweiseitiger Flyer aus dem Positionspapier mit QR-Link
• Ethikrichtlinien mit Bezug auf SDG verbessern und modernisieren (Jörg)
(Julia) • Einladung für Skype-Konferenz (Jörg)
• Finden eines griffigen Titels für den Auftritt des AK im Internet, • Beitrag in den Verbandsmitteilungen mit Abdruck des Positionspa-
Ideen sind willkommen (Dominik) piers (Jörg)
• Möglichkeiten, auch aktiv zu werden im AK Nachhaltigkeit des Eu- • Ideensammlung für Einbringung an die Organisation der Verbands-
ropean Environmental Bureau (EEB) (Jean-Claude) tagung 2020 (Julia)
• Nachhaltige Verbandstagung: Ideen entwickeln, um Verbandsta- • Verteilung Links und Positionspapier (Jörg)
gungen nachhaltiger zu machen und intern aufzuklären: Mitfahrge- • Vorsondierung bei der DBU betr. Fördermöglichkeiten (Anne)
legenheiten organisieren, Müllvermeidung, CO2-Kompensation u.a.; • Internetauftritt (Dominik)
Ideensammlung innerhalb der Jugend-Whatsapp-Gruppe als erster Dr. Jörg Dreybrodt, Sprecher AK Nachhaltigkeit
Anstoß (Julia) Skype: dreybrodt, WhatsApp +41767475015
Engagement auf der nächsten UN-ECE-Tagung in Genf (Fallbeispiel,
Stand) (Jörg). Internetlinks: sustainabledevelopment.un.org (Hauptseite der UN);
Folgende vier besprochene Themenkomplexe bündeln die Aktivitäten https://www.sdgwatcheurope.org (Berichte zu Aktivitäten); https://
des AK: eeb.org/sustainability-and-governance/sustainable-development
Arbeitskreis-Projekt; Nachhaltigkeit fördern bei Verbandstagungen (EEB); https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/
und interne Aufklärung; UN-Lobbyarbeit; Bekanntmachung des Po- agenda2030 (Bundesregierung); https://www.unece.org/rfsd2019
sitionspapiers (UN-Europa-Seite); https://www.dbu.de (DBU)
UN Europe and Central Asia (UN ECE) Sustainable development is formally defined by the World Commissi-
Teilnahme am Regional Forum for Sustainable Development (RFSD) on on Environment and Development (WECD) as “development that
in Genf (Link 2019: https://www.unece.org/rfsd2019.html), nächster meets the needs of the people today without compromising the ability
Termin: 18. - 19. März 2020. of future generations to meet their own needs”.
Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4) 53Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3 + 4) 54 - 57 München 2019
Pseudokarst in den Ufermoränen des Morteratsch-Gletschers, Bernina, Schweiz
von
Eckart Herrmann
Kurzfassung
Beschreibung konzentrierter unterirdischer Abflüsse von Flanken-
gerinnen durch Ufermoränen des Morteratsch-Gletschers, Berni-
na, Schweiz als Pseudokarstphänomen. Dank der Schweizer Lan-
deskarte ist dessen Werdegang seit seinen Anfängen ab der Kleinen
Eiszeit des 19. Jahrhunderts präzise dokumentiert.
Abstract
Description of concentrated subterranean waterways of some flank
brooks through lateral moraines of Morteratsch Glacier, Bernina,
Switzerland as pseudokarst phenomena. Luckily, official maps of
Switzerland precisely show the formation of this pseudokarst since
its beginnings after Little Ice Age maximum in 19th century.
Résumé Abb. 1: Der Talschluss des rückschmelzenden Morteratsch-Gletschers
Description des flux d’eau souterraine concentrés de canals de flanc mit dem Gipfelkamm zwischen Piz Palü (3900 m, links) und dem Piz
à travers les moraines latérales du Glacier Morteratsch, Bernina, Bernina (4049 m, rechts); im leeren Gletschertrog im Vordergrund die
Ova da Morteratsch und der Lehrpfad in dem sich taleinwärts ausdeh-
Suisse, en tant que phénomènes pseudokarstiques. Heureusement
nenden Bestand an Zirbelkiefern, rechts die im Zentrum der Betrach-
les Cartes de la Suisse précises offrent une représentation de leur de- tung stehende orografisch linke Ufermoräne der ehemaligen Gletscher-
venir depuis le maximum du petit âge de glace dans le 19ème siècle. zunge
Einführung brochen ist und keinen durchgehenden Talweg an ihrer gletscher-
In diesem Beitrag wird auf unterirdische Wasserwege durch Ufer- abgewandten Außenseite ausbilden konnte, formt die orographisch
moränen hingewiesen, auf die der Autor gelegentlich eines Auf- linke Ufermoräne einen durchgehenden, rund 20 m tiefen Graben
enthalts im Bernina-Massiv im Juni 2019 aufmerksam wurde. Die zum weniger schroffen Felshang unter der nur 300 m höher anset-
Darstellung beruht auf Geländebeobachtungen und Kartenanaly- zenden Hangschulter Pasculs da Boval. Der First dieser Moräne
sen. Weitergehende hydrologische oder hydrochemische Analysen fällt auf seiner Länge von rund 2,5 km von 2320 m im Süden auf
standen weit außerhalb der Möglichkeiten dieses Zufallsfunds. Die rund 2100 m im Norden ab. Die in den Gletschertrog gerichtete
Außergewöhnlichkeit und Prägnanz dieses bisher allgemein kaum Flanke ist oben bis zu 70° steil und damit einer raschen Erosion
beachteten Pseudokarstphänomens mögen jedoch die Publikation unterworfen, die mit dem Herausbrechen und Nachstürzen von
in der hier vorgelegten Form rechtfertigen. einzelnen Komponenten oder ganzen Bereichen verbunden ist
(Abb. 2). Aus diesem Grund musste der ursprünglich durchgehend
Der Morteratsch-Gletscher und seine zurückgelassenen Ufer- auf dem Moränenrücken verlaufende Weg zur Bovalhütte bereits
moränen über längere Abschnitte (ungünstig) in den Felshang neben der
Der vom Piz Bernina, 4049 m, nach Norden abfließende Morte- Moräne verlegt werden, und im Talboden wird ausdrücklich vom
ratsch-Gletscher (Vadret da Morteratsch; Abb. 1) zählt mit derzeit
noch mehr als 6 km Länge und bis über 2 km Breite als einer der
größten Gletscher der Ostalpen. Wie fast alle Alpengletscher ist
er seit dem 19. Jahrhundert einem starken, zuletzt beschleunigten
Abschmelzprozess unterworfen, so dass sich seine Länge seit 1850
um rund 3 km verringert hat (Kolly & R ittmeyer 2019). In sei-
nem Rückzugsgebiet blieb eine 1 km breite, von den Ufermoränen
flankierte Wanne zurück, in der ein instruktiver, jährlich zu ver-
längernder Gletscher- und Klima-Lehrpfad die dem Gletscher ent-
strömende Ova da Morteratsch flussaufwärts bis zum Gletschertor
begleitet.
Der Boden dieses Trogs wird von den kilometerweit geradlinig von
Süd nach Nord ziehenden Firsten der Ufermoränen um mehr als
200 m überragt. Während die orographisch rechte Ufermoräne Abb. 2: Blick vom First der orographisch linken Ufermoräne talauswärts
von einigen Felsrippen der nochmals um mehr als 1000 m steil in Richtung Morteratsch, rechts der Abbruchkante die bis zu 70° steile
darüber aufragenden Westflanke des Munt Pers (3207 m) unter- talseitige Flanke der Moräne
54 Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4)Verlassen des mittig angelegten Lehrpfades gewarnt. Tatsächlich
konnten am 19.6.2019 selbst bei trockenem Schönwetter einzelne
hinabstürzende und nach Aufprall weiterspringende Steine beob-
achtet werden. Mit dem Lockermaterial stürzen vereinzelt auch
Zirbelkiefern in die Tiefe, die neben spärlicher niederer Vegetation
auf der Moräne gedeihen und im letzten Jahrhundert einen der we-
nigen Waldstandorte über einer vorbeifließenden Gletscherzunge
der Alpen bildeten.
Die Moräne ist aus durchwegs nicht verkarstungsfähigen Gesteins-
komponenten (Gabbros, Diorite, Serpentinite) aufgebaut, die der
Morteratsch-Gletscher von den Hochgipfeln des Bernina-Massivs
herabtransportiert hat. Der Talhang über der Moräne, der zumin-
dest einzelne Komponenten zur Bildung des Moränenkörpers bei-
getragen hat, besteht daneben auch aus ebenfalls nicht verkarsten-
den Granodioriten, Alkaligraniten und Amphiboliten (Maisch et Abb. 3: Gesamtschau der orographisch linken Ufermoräne vom Gipfel
al. 1993; Höhlenportale am markierten Wanderweg zur Bovalhüt- des Munt Pers
te führen lediglich in Ausbruchs- oder Auswitterungsnischen). Der
Munt Pers über der orographisch rechten Ufermoräne besteht aus
Alkaligraniten, Granodioriten und Diavolezza-Rhyoliten (Maisch
et al. 1993). Dem Augenschein nach sind die Ufermoränen erwar-
tungsgemäß aus einem unregelmäßigen Gemenge unterschied-
lichster Komponenten von Schluffen bis zimmergroßen Felsblö-
cken aufgebaut. Eine Sortierung nach Komponentengrößen ist im
Aufschluss der erodierten Moränenflanken allenfalls ansatzweise
als Andeutung lokaler Schichtungen erkennbar.
Entsprechend dem im Vergleich zum spitz zulaufenden Steilhang
des Munt Pers an der orografisch rechten Talseite ist das Einzugs-
gebiet an der orografisch linken Seite des Gletschertrogs wesentlich
ausgedehnter, womit auch das seitlich auf die linke Ufermoräne
treffende Wasserdargebot wesentlich bedeutender ist. Als Zufluss-
bereich zur Ufermoräne können hier schätzungsweise 6 km² ange- Abb. 4: Episodischer Rückstau, mit dem am 19.6.2019 das erste (süd-
nommen werden, die teilweise vergletschert sind. liche) Flankengerinne in den Untergrund versinkt; 1876 - 1997 war an
dieser Stelle in der Schweizer Landeskarte ortsfest ein kleiner See ein-
Der abschnittsweise unterirdische Abfluss gezeichnet
Über den teils blanken und teils mit Hangschutt bedeckten Fels-
hang westlich über der linken Ufermoräne fließen in geringen
Abständen voneinander Sturzbäche herab, deren Schüttung bei
Schneeschmelze oder nach Niederschlägen hunderte Sekunden-
liter betragen kann. Nur im nördlichsten, unteren Abschnitt der
Moräne (östlich Puox Bass) ist es einem dieser Sturzbäche gelun-
gen, die am Felshang aufsitzende Moräne erosiv zu durchreißen
(Abb. 3). Die meisten Sturzbäche werden hingegen in lehrbuch-
mäßige Flankengerinne zwischen der Moräne und dem Felshang
abgelenkt, um schließlich als solche in Geländehohlformen zu ver-
sinken. Die südlichen Zubringer münden so in einen vermutlich
episodischen Rückstau, in dem am 19.6.2019 nach dem schnee-
reichen Winter 2018/19 noch Altschneekörper und von Lawinen
mitgerissene Vegetation trieben (Abb. 4). In dessen Bereich ist an
der Talflanke der Moräne 40 - 50 m unter dem First ein starker Abb. 5: Teilabschnitt der orographisch linken Seitenmoräne; deutlich
Wasseraustritt sichtbar, auf dessen Besuch aufgrund der oben zu sehen sind von der Trogschulter herabstürzende Zubringer des Flan-
dargestellten Verhältnisse verzichtet werden musste. Die Luftli- kengerinnes, der Rückstau (R) und der vermutete Wiederaustritt (eines
Teils) der Wassermenge (Q); mit strichlierter blauer Linie umgrenzt ist
nie zwischen Rückstau und Wasseraustritt beträgt ca. 80 m, der
das teilweise schuttbedeckte äußerste Ende der Gletscherzunge
Höhenunterschied ca. 20 - 30 m. Talauswärts dieser Quelle ist eine
Reihe schwacher Wasserausritte durch feuchte Schuttstreifen mar- und in einer Distanz von 200 m vom Ponor aus dem Talhang der
kiert, frei fließendes Wasser konnte in diesen Streifen jedoch nicht Moräne hervorbrechen. Die daraus gespeisten Zubringer der Ova
beobachtet werden (Abb. 5). Im Talweg unterhalb des Rückstaus da Morteratsch werden vom Fahrweg mit dem Lehrpfad im Talbo-
sammeln sich nach einem nur kurzen trockenen Abschnitt die wei- den mit kleinen Brücken überquert.
ter östlich herabstürzenden Wasserläufe in einem neuen Flanken- In der orographisch rechten Ufermoräne, deren Flankengraben
gerinne. Nach einem oberflächlichen Lauf von fast 500 m versinkt durch Felsrippen unterbrochen ist, sind im Abschnitt einer da-
der Bach im groben Blockwerk der Talfurche (Abb. 6). Als Wie- durch geschlossenen, rund 300 m langen Oberflächenhohlform
deraustritte kommen in diesem Bereich mehrere Quellen in Frage, zwei konzentrierte Wasseraustritte an der dem Gletscher zuge-
die wesentlich tiefer, minimal 100 m unter dem Moränenrücken wandten Seite der Moräne sichtbar (Abb. 7). Sie liegen mindestens
Mitt. Verb. dt. Höhlen- u. Karstforscher 65 (3+4) 55Sie können auch lesen