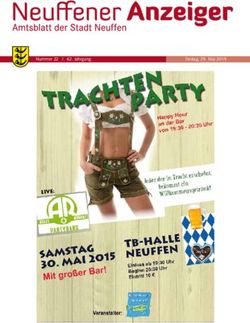"Nach Aufnahme arterielle Hypotonie": Personenkonzept und Kommunikationsformen in der Experten-Medizin* - Brill
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gesnerus 77/2 (2020) 411–437, DOI: 10.24894/Gesn-de.2020.77015
«Nach Aufnahme arterielle Hypotonie»:
Personenkonzept und Kommunikationsformen in der
Experten-Medizin*
Martina King
Summary
“Arterial hypotonia after admission”: concepts of personhood and types
of communication in clinical medicine
This article deals, from the perspective of textual and narrative theory, with
certain forms of communication in current clinical medicine. It will be ar-
gued that diagnostic and therapeutic procedures in highly specialized medi-
cal contexts tend to be fragmented and pluralistic and that this compromises
a distinct concept of personhood. Therefore, clinical experts should adopt an
integrative understanding of the patient as coherent entity. The phenomenon
of depersonalization in clinical medicine is, among others, reinforced by a
quasi ‘hegemonial’ expert genre that organizes almost all case-based com-
munication among specialists: the discharge report or epicrisis. However,
there is hardly any research about this genre. Against this background, a
brief overview will be given over the historical development of the medical
report in the 20th century and its epistemological function, using archival
sources. Certain narrative peculiarities such as deagentivization, reduction-
ism and fundamental linearity indicate that the medical report has the func-
tion of ordering past courses of events and of making causal connections ev-
ident – therefore it works anyway in a depersonalizing manner. In this con-
text, the Medical Humanities have a serious didactic task: they should raise
* Für kritische Lektüre und anregende Hinweise bedanke ich mich bei Felix Rietmann (Fri-
bourg) und Richard King (Bern).
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. habil. Martina King, Lehrstuhl für Medical Humanities, Uni-
versität Fribourg/SCIMED, Chemin du Musée 18, CH-1700 Fribourg
Gesnerus 77 (2020) 411
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accesscritical awareness of the relationship between talking, writing, thinking and
acting among future clinicians already during their academic education.
Clinical medicine, concept of personhood, depersonalization, medical re-
port, narrative theory, Medical Humanities
Zusammenfassung
Der Aufsatz setzt sich aus text- und erzähltheoretischer Perspektive mit den
Kommunikationsformen in der hochspezialisierten klinischen Medizin un-
serer Gegenwart auseinander. Es wird argumentiert, dass die Fragmentie-
rung und Pluralisierung von Diagnose- und Therapieprozessen zur Arrosion
eines distinkten Personenbegriffs führt und dass KlinikerInnen hier zum in-
tegrativen Denken aufgefordert sind, um ihre PatientInnen als personale Ge-
samtheit wahrzunehmen. Die Tendenz zur Depersonalisierung verdankt sich
u.a. jener Fachtextsorte, in der die gesamte fallbasierte Schriftkommunika-
tion unter ÄrztInnen zusammenläuft, die gleichwohl kaum erforscht ist –
dem Arztbrief. Anhand von Archivmaterialien wird ein kursorischer Ein-
blick in seine historische Entwicklung im 20. Jahrhundert gegeben und seine
epistemologische Funktion rekonstruiert. Narrative Eigentümlichkeiten wie
Deagentivierung, Verknappung und fundamentale Linearität weisen darauf
hin, dass der Arztbrief vergangene Abläufe ordnet, Kausalzusammenhänge
sichtbar macht – und dabei nolens volens depersonalisierend funktioniert.
Vor diesem Hintergrund wird für eine edukative Aufgabe der Medical Hu-
manities plädiert, die ein kritisches Bewusstsein für den Zusammenhang von
Sprache, Schrift, Denken und ärztlichem Handeln bei angehenden Medizi-
nerInnen bereits im Studium wecken können.
Klinische Medizin, Personenbegriff, Depersonalisierung, Arztbrief, Erzähl-
theorie, Medical Humanities
Wir sind heutzutage in der Lage, Cochlea-Roboter zu implantieren, chroni-
sche Leukämien zu heilen und kleinste funktionelle Hirnanteile kernspinto-
mographisch sichtbar zu machen. Wir können drei verschiedene Brustkrebs-
Gene identifi zieren, Patienten im Lungenversagen mit Sauerstoff versorgen
(ECMO) und wirksame Impfungen gegen neuartige Filoviren entwickeln.1
Dem biomedizinischen Fortschritt und seinen einzigartigen diagnostischen
1 Vgl. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2019/11/12/eu-zulassung-fuer-
ebola-impfstoff-ervebo, abgerufen zuletzt 20.12.2019.
412 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessund therapeutischen Entwicklungen ist es geschuldet, dass wir physisch so
gesund und so langlebig wie nie zuvor sind. Die technisch aufgerüstete Spe-
zialisten-Medizin, die in großen klinischen Zentren beheimatet ist, stellt ein
funktional maximal ausdifferenziertes und effizientes kulturelles Milieu dar,
dessen jüngere Geschichte noch nicht geschrieben ist;2 zu komplex seine
Strukturen, zu komplex seine Funktionsweisen, so dass Medizinhistoriker,
-soziologen und -anthropologen bislang nur einzelne Teilbereiche, Räume,
Praktiken und Akteursgruppen beobachten und analysieren. 3
So komplex und in seinen Gesamtzusammenhängen noch kaum verstan-
den das System ist, erfordert es von seinen vielen Mitspielern auch ganz neue
kommunikative und reflexive Kompetenzen. Unter anderem macht es für
Ärzte – so die These des vorliegenden Aufsatzes – distinkte Konzepte von
Personalität erforderlich und verlangt ein Bewusstsein darüber, dass episte-
mischer Pluralismus und Leidenserfahrungen des Patienten integriert werden
müssen. Obwohl immer wieder zu Recht auf die wachsende Informiertheit
und Autonomie des modernen Patienten und somit auf den fundamentalen,
emanzipatorischen Wandel dieser Rolle hingewiesen wird, sind Ärzte (sowie
Angehörige von Medizinalfachberufen) dennoch – so meine Argumenta-
tion – mit diesen Integrationsaufgaben konfrontiert. Es stellt sich die Frage,
wie die erforderlichen Kompetenzen entstehen und welche Prozesse der Be-
wusstmachung dafür erforderlich sind.
Der vorliegende Beitrag ist im Kontext der Debatte um Geisteswissen-
schaften in der Medizin angesiedelt und widmet sich dem Problemzusam-
menhang von Integration und Depersonalisierung aus dezidiert texttheore-
tischer und literaturwissenschaftlicher Sicht: Die Argumentation fußt auf
rhetorischen, semantischen und idiomatischen Analysen ausgewählter
mündlicher und schriftlicher Quellen und schließt medien- und gattungsge-
schichtliche Rekonstruktionen ein. Das ist insofern ein Novum, als Arbei-
ten zu Depersonalisierung und Reduktionismus versus embodiment und
embodied experience in der klinischen Medizin bislang mehrheitlich aus der
Medizinsoziologie und -ethnographie stammen und nicht hermeneutisch
2 Es existieren etliche Forschungsarbeiten zur Geschichte der medizinischen Spezialisierung
seit dem 19. Jahrhundert in Europa und Amerika; beispielsweise Rosen 1944, Stollberg/Tamm
2001, Huerkamp 1985, Stevens 1998, Weisz 2006. Allerdings verfolgen auch die neueren Ar-
beiten von Stevens und Weisz den Spezialisierungsprozess tendenziell nur bis in die 60er be-
ziehungsweise 50er Jahre, sind also konkret historiographisch-rekonstruktiv ausgerichtet.
3 Was das grammatikalische Geschlecht von Ärztinnen und Ärzten, Spezialistinnen und Spe-
zialisten, Patientinnen und Patienten sowie weiteren Akteuren in diesem Aufsatz betrifft,
beschränke ich mich im Folgenden aus Gründen der Ökonomie und Lesbarkeit auf die mas-
kuline Form; selbstverständlich ist die Diversität biologischen und kulturellen Geschlechts
dabei stets mitgemeint.
Gesnerus 77 (2020) 413
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accesssondern empirisch-quantifi zierend beziehungsweise als beobachtende Feld-
studien angelegt sind.4
Der Beitrag gliedert sich in vier Abschnitte. Damit die oben angesproche-
nen Integrationsaufgaben überhaupt deutlich werden, bedarf es zunächst ei-
nes kurzen Einblicks in den Ist-Zustand; diesen liefert der erste Abschnitt. Es
wird gezeigt, inwiefern das Verständnis und die Anwendung eines kohären-
ten Personenkonzepts für ärztliche Akteure unter den Bedingungen extre-
mer Spezialisierung und Technisierung eine Herausforderung darstellen.
Atomismus (der medizinischen Handlungsfelder) und Abstraktion (der me-
dizinischen Gegenstände) sind weit fortgeschritten, beherrschen den klini-
schen Alltag und werfen die Frage auf, wie man aus dem Dschungel der De-
tails herauskommen und in den Wahrnehmungshorizont des Patienten
eintreten kann. Im zweiten Abschnitt soll ein Modellfall deutlich machen,
dass das reduktive, tendenziell mechanistische Personenverständnis, das die
Hochspezialisierung hervorbringt, gegebenenfalls nicht nur die Sicht der
ärztlichen Spezialisten auf den Patienten, sondern ebenso – wenn auch unbe-
wusst – auf sich selbst mitprägt. Damit verbindet sich das Risiko einer gewis-
sen Rollen-Instabilität, die in kollektiven rhetorischen Eigentümlichkeiten
zum Ausdruck kommt und ihrerseits relevant für die Arzt-Patienten-Kom-
munikation sein dürfte. Im dritten Abschnitt wird gezeigt, dass diese kollek-
tiven rhetorischen Eigentümlichkeiten vor allem die hegemoniale, gleichwohl
völlig unerforschte Textsorte ‚Arztbrief‘ beherrschen, in der die gesamte fall-
bezogene Schriftkommunikation unter Ärzten stattfindet. Demnach sind
diese rhetorischen Eigentümlichkeiten epistemologisch wirksam; sie werden
lebenslang habitualisiert und unterstützen als kognitiver frame das deperso-
nalisierende Denken beziehungsweise bringen es mit hervor. Im vierten Ab-
schnitt wird für eine entsprechende edukative Aufgabe der Medical Huma-
nities plädiert: Ziel ist es, langfristige Reflexionsprozesse anzustoßen, die
idealerweise schon im Medizinstudium einsetzen, ein kritisches Bewusstsein
für die Zusammenhänge von Sprache, Schrift, Denken und ärztlichem Han-
deln wecken und in ein integratives Verständnis von Personalität münden.
4 Vgl. exemplarisch Gross 2012; hier auch zahlreiche Literaturhinweise aus Soziologie und
Ethnographie (1170f.) Die meisten dieser ethnographischen beziehungsweise soziologischen
Feldstudien gehen von Krebs als einem inhaltlichem Bezugspunkt aus (vgl. die Literaturü-
bersicht bei Kerr/Ross/Jacques/Cunningham-Burley 2018), während die vorliegende Arbeit
ideengeschichtlich, erzählgeschichtlich und texttheoretisch angelegt ist.
414 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free access1. ‚Person‘ und ‚Organismus‘ oder Abstraktion und Atomismus?
Denkformen in der Hochspezialisierung
Der oben in Schlaglichtern skizzierte, wissenschaftlich-technische Fort-
schritt birgt kommunikative Folgeprobleme, die insgesamt nahezu ebenso
komplex sind wie das System selbst und natürlich keiner einfachen Lösung
zugänglich; allerdings oder gerade deshalb geben sie in den Medical Huma-
nities immer wieder Anlass zu didaktischen Überlegungen. Schließlich birgt
die exzessive Differenzierung, die als emblematisch für die Gegenwartsme-
dizin gilt, 5 das Risiko, dass Fachärzte in hochspezialisierten Klinik-Milieus
kein umfassendes Konzept von ‚Person‘ oder auch ‚Organismus‘ für sich aus-
bilden beziehungsweise ihrer professionellen Tätigkeit zugrunde legen können
(was natürlich keineswegs bedeutet, dass sie in anderen Rollen, als privates In-
dividuum etwa, nicht über ein gefestigtes Personenverständnis verfügen).
Wenn hier von einem umfassenden, integrierten Personenkonzept in der
Medizin die Rede ist, dann soll damit natürlich nicht jener nostalgische Ruf
nach diffuser leibseelischer Einheit repetiert werden, der seit dem späten
19. Jahrhundert immer wieder als Echo großer technologisch-wissenschaftli-
cher Differenzierungsschübe ertönt und entsprechende, sich in schöner Re-
gelmäßigkeit wiederholende Dissidenzen begleitet. Waren das im 19. Jahrhun-
dert Homöopathie und Impfgegnerschaft, so folgten im Fin de Siècle
Naturheilkunde, Hydrotherapie und Lebensreform6 und im 20. Jahrhundert
anthroposophische Medizin, New Age, traditionelle chinesische Medizin, Os-
teopathie, Ayurveda, Schamanismus und viele weitere alternativmedizinische
Bewegungen, deren gemeinsamer Nenner ein diffuser, differenzierungsfeind-
licher Holismus ist. Mit diesem vor Augen ließe sich gegen die Stoßrichtung
des vorliegenden Aufsatzes einwenden, dass Ganzheitlichkeit ein Mythos der
antimodernen Moderne und immer schon von der Wirklichkeit überholter,
konservativer Traum ist. Er setzt vage Totalitäten gegen Differenzierungen
und allerlei Einheiten – der Natur, der Gesellschaft, des Leibes und der Seele,
der Evolution etc. – gegen die Vielheiten, Vermischtheiten und ‚Netze‘ der
postmodernen Realität; ein konservativer Traum also, der eine antimoderne
Weltanschauung gegen die Paradigmen der Moderne ins Feld führt. Eine sol-
che weltanschauliche Zurichtung, die nolens volens regressiv und reduktiv
ausfallen muss, kann den Komplexitäten des klinischen Expertentums natür-
lich nicht gerecht werden und ist hier auch keineswegs anvisiert.
5 Vgl. Weisz 2006, XI.
6 Vgl. King 2020.
Gesnerus 77 (2020) 415
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessWenn im Folgenden von einem ganzheitlichen Personenbegriff beziehungs-
weise von leibseelischer Identität die Rede ist, dann ist damit nicht naive Ganz-
heitssehnsucht in gut esoterischer Tradition gemeint,7 sondern eine relativ neue
Herausforderung der Gegenwartsmedizin: nämlich das Vermögen, eine Viel-
heit artifiziell generierter, abstrakter Daten auf eine Einheit – personeller oder
organischer Natur – zu beziehen beziehungsweise beide miteinander zu ver-
mitteln. Ein solches Desiderat steht im Kontext jener Krisenbefindlichkeit der
wissenschaftlichen Medizin, die ihrerseits seit 1920 in systeminternen Debat-
ten immer wieder zum Ausdruck kommt – die medizinische Wissenschaft
könne Krankheiten erforschen aber nicht den kranken Menschen, kritisiert
Sauerbruch 19268 – und auf die Volker Roelcke jüngst mit Nachdruck hinge-
wiesen hat. Roelcke plädiert in seinem Buch Vom Menschen in der Medizin
für eine kulturwissenschaftlich kompetente Medizin; ferner dafür, dass der
Blick auf den ganzen Menschen und seinen Lebenskontext nicht nur für den
Patienten sondern auch für den Arzt zu gelten habe.9 Dieses letztlich normati-
ven Anliegen fußt auf einem ganz ähnlichen Befund wie der vorliegende Auf-
satz: Eine «auf das theoretische und methodische Repertoire von Natur- und
Technikwissenschaften sowie von Informatik und Statistik» beschränkte Me-
dizin müsse sich, so Roelcke, den Vorwurf gefallen lassen, «kurzsichtig und re-
duktionistisch zu sein».10 Während nun Roelcke von diesem Befund aus den
kulturellen Bedingtheiten medizinischen Handelns und Erlebens nachgeht
und dabei ein Verständnis von «Patienten, Ärzte[n] und biomedizinische[n]
Wissenschaftlern als Menschen» voraussetzt,11 fragt der vorliegende Beitrag
danach, was dieses ‚Verständnis als Menschen‘ in der Expertenmedizin mög-
licherweise erschwert, auf welche Weise es zum Problem wird.
Dass es sich tatsächlich um ein Problem handelt, bestätigen weiterhin
Alltagsintuitionen, Impulse aus der sogenannten ‚narrativen Medizin‘ und
solche aus der Medizinethik. Unser Alltagshandeln zeigt, dass wir weder
dem liberalen noch dem postmodernen Personenideal immer und unter al-
len Umständen genügen: Wir sind nicht durchgehend autonome, entschei-
dungsgewaltige, unbedingt rationale und dabei funktional aufgesplitterte
Akteure, ebenso wenig sind wir alle Cyborgs, Hybride und gemischte Kong-
lomerate12 – sondern mit einem Bedürfnis nach Integration und Einheit aus-
gestattete Wesen. Insofern stellen uns abstrakte und inkohärente Daten-
7 Zu diesen Abgrenzungen von einem traditionellen Holismus, der zu den elementaren
Kennzeichen der Moderne gehört, hat mich ein anonymes Gutachten angeregt.
8 Sauerbruch 1926, 1083; vgl. auch Roelcke 2017, 12.
9 Roelcke 2017, 13–16.
10 Ebd., 15.
11 Ebd., 15.
12 Vgl. Latour 2008, 9f.
416 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessmengen vor ganz neue Anforderungen, und zwar auf beiden Seiten der
technischen Armada: als Ärzte und als Patienten. Dass die epistemologisch
unausweichliche Fragmentierung, Mathematisierung und bildliche Abstrak-
tion von organischen Krankheitsprozessen auf Patientenseite jenen Identi-
täts- und Kohärenzverlust befördert – die sogenannte ‚broken story‘ – den
schwere beziehungsweise chronische Erkrankungen ohnehin tendenziell mit
sich bringen, darauf machen besonders die Vertreter der narrativen Medi-
zin immer wieder aufmerksam; den Hochspezialisten würden in dieser
Situation neue integrative Kommunikationskompetenzen abverlangt.13 Ziel
des didaktischen Projekts ‚narrative Medizin‘ sind in diesem Zusammen-
hang erzählerische Kompetenzen für Kliniker, die es erlauben, die Patien-
tengeschichte als kohärente Gesamtheit aufzunehmen und zu verstehen.
Einhegung und Einheit anstelle von exzessiver Individualisierung und Zer-
splitterung scheint demnach ein ganz aktuelles, deontologisches Problem:
Christiane Woopen empfiehlt Klinikern, sich nicht in die Arroganz oder In-
differenz des reinen Spezialistentums zurückzuziehen, sondern «einen Bei-
trag zum Ganzen zu leisten». Man könne und müsse, so Woopen, «als Spezi-
alist nicht ganzheitlich, sehr wohl aber an das Ganze denken und seinen
Beitrag dazu leisten – wie der Geiger zur orchestralen Aufführung der Sinfo-
nie»; das ‚symphonische Ganze‘ definiert Woopen im Folgenden als «das
Wohl des Patienten».14 Nicht ‚ganzheitliches Denken‘ im Sinne der Moderni-
tätsverweigerung also, aber doch ‚das Ganze‘ im Blick haben: Diese Position
Woopens scheint die besondere Bedarfslage der hochspezialisierten Medizin
genau zu erfassen und sie macht deutlich, dass hier Reflexionsbedarf besteht.
Denn was ist dieses Ganze eigentlich, worauf sich der Spezialist in seinem
Handeln und ethischen Streben beziehen soll? Die ganz unterschiedlichen
Perspektiven von Roelcke (anthropologisch informierte Kontextualisierung
medizinischen Handelns), von Vertretern der narrativen Medizin (Verständ-
nis von Patientengeschichten als lebensgeschichtlichem Zusammenhang) und
von Woopen (Beitrag zum Ganzen als Spezialist leisten) laufen letztlich auf
ein gemeinsames Problem hinaus: Mit dem beschworenen ‚Ganzen‘ scheint
Personalität gemeint oder zumindest mitgemeint; anders gesagt ein distinktes
Verständnis der Akteure des klinischen Interaktionsspiels als ganze Perso-
13 Vgl. exemplarisch Fuks/Kreiswirth/Boudreau/Sparks 2011, Holmgren 2016, Kalitzkus/
Wilm 2017. Während allerdings die Zitierten sowie zahlreiche weitere Vertreter der narra-
tiven Medizin ‚Empathie‘ zur kognitiven und sozialen Schlüsselkompetenz küren, die auf
das Problem der Fragmentierung antwortet und die es in der medizinischen Ausbildung zu
vermitteln gilt, liegt der Fokus des vorliegenden Aufsatzes auf nicht-normativen Kompe-
tenzen wie reflexiver Distanz, Analysevermögen, Sprachbewusstsein und konzeptueller
Flexibilität.
14 Woopen 2009, 182, 186f.
Gesnerus 77 (2020) 417
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessnen, die über eine integrierte, kohärente Identität verfügen, in einen situati-
ven Lebenskontext eingebettet sind und aus diesem heraus interagieren.
Nimmt man Roelcke und Woopen zusammen, so wird deutlich, dass damit
beide Akteursgruppen – Ärzte und Patienten – angesprochen sind. An die-
sem Punkt knüpft der vorliegende Aufsatz an und untersucht in mehreren
Schritten, wo und inwiefern Depersonalisierungsphänomene im Denk- und
Sprachhaushalt der klinischen Expertenmedizin genau dieses angestrebte, in-
tegrierte ‚Verständnis als Mensch‘ erschweren.
Was würde es überhaupt bedeuten, den Patienten als Person zu verstehen?
Orientiert man sich an neueren Debatten in der Philosophie der Person, die
Personalität nicht nur vorrangig im moralischen Freiheitsgedanken sondern
auch im Prinzip der Verkörperung verankern, so würde es zunächst Folgendes
bedeuten: den Patienten als Entität zu sehen, der man physische Eigenschaften
und mentale Zustände zuschreiben kann; laut Peter Strawson ist ‚Person‘ als
Primitivbegriff dem Bewusstsein und dem Körper logisch vorgeordnet.15 Etwas
konkreter ausformuliert und mit Bezug auf die (gemäßigt naturalistische) Per-
sonalitätsphilosophie von Dieter Sturma, in der sich biologische und kulturelle
Determinanten verbinden,16 könnte man die Person des Patienten folgender-
maßen begreifen: als individuelles Lebewesen, das sich aus materialen Elemen-
ten (Organen, Leitungsbahnen, Zellverbänden), physiologischen Funktionen
(Metabolismus, Innervation, Zirkulation), individuellen kognitiven, emotiven
und moralischen Vermögen, einer individuellen Geschichte, einem kulturellen
Kontext und einem individuellen «Lebensplan» zusammensetzt.17 Freilich ließe
sich auch auf einer niedrigeren Stufe der Integration ansetzen, wo der Patient
lediglich als Organismus erscheint – also als ein relationales Gefüge von Orga-
nen, Zellverbänden und Funktionen, die alle vielfach aufeinander bezogen sind;
kurzgesagt als material-funktionaler Gesamtzusammenhang.18 Selbst da hätte
man immer noch eine bestimmte Form der Ganzheit im Blick und gewisserma-
ßen die Minimalbedingung, um kohärente Prozesse diagnostischer und thera-
peutischer Art in Gang zu setzen.
15 Vgl. Strawson 1959.
16 Vgl. Sturma 1997; zum gemäßigten Naturalismus vgl. 84f., 95. Vgl. auch Dieter Sturma:
«Der Begriff des Körpers hat die doppelte Bedeutung einer notwendigen Bedingung per-
sonalen Lebens und eines Ausdrucksmittels personaler Einstellungen. […] Während der
Begriff des Menschen die angeborene biologische Natur anspricht, bewegen sich die Be-
stimmungen des semantischen Felds von ‘Person’ im Bereich der kulturellen Lebensform»
(Sturma 2001, 35).
17 «Der Lebensplan ist die ‚Spur des Selbst‘ über die Zeit hinweg, in der sich Hierarchisierungen
von Einstellungen und Bewertungen manifestieren, mit denen Personen auf die kontingenten
Umstände und sich verändernde Gegebenheiten reagieren. Auf diese Weise gewinnt das Le-
ben einer Person gleichermaßen an Komplexität und Individualität» (Sturma 2005, 253).
18 Ontologisch gesehen handelt es sich bei ‚Person‘ und ‚Organismus‘ natürlich um Begriffe,
die ganz unterschiedlichen Kategorien angehören. Zwischen ihnen spannt sich ein Hiatus
418 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessGenau diese integrativen Konzepte scheinen aber im Denken der Hoch-
spezialisierung zu schwinden, da eine solche Medizin von den hochausgebil-
deten Klinikern nicht nur spezialisierte Kompetenzen sondern auch eine
hochselektiv gerichtete Wahrnehmung auf hochselektive Gegenstände ver-
langt. Experten beobachten, identifi zieren, klassifi zieren und therapieren
das, wofür sie Experten sind: das Geschwür im Magen oder die Innervation
des geschwürkranken Magens oder dessen endokrines System; die Klappen
des linken Ventrikels oder die Kernspin-Darstellung der Klappen des lin-
ken Ventrikels oder die Auswurffraktion des linken Ventrikels mit einem
Klappenfehler. Viele dieser Gegenstände werden von den Experten über-
haupt erst hergestellt, mittels aufwendiger Technologien, und man sieht da-
bei genau den Unterschied zwischen einem fehlenden Personen- und einem
fehlenden Organismus-Begriff: Für klinische Hochspezialisten besteht das
Risiko, dass sie ihre Aufmerksamkeit nicht nur nicht auf den magenkran-
ken Metzgermeister oder die herzkranke Seniorin richten, sondern ebenso
wenig auf einen ganzen Körper, der aufgrund einer komplexen Magener-
krankung mangelernährt ist und dessen Schmerzsymptomatik zur Wirbel-
säulendeformation geführt hat. Gegenstände wie das endokrine System des
Magens oder der linksventrikuläre Füllungsdruck kommen schließlich als
solche in der Natur nicht vor, sondern nur innerhalb des Gesamtorganismus;
oder wenn man so will: innerhalb einer Person. Derart isoliert und dekon-
textualisiert, stellen sie gewissermaßen Abstraktionen dar, die sich immer
weiter vom sinnlich gegebenen Konkretum des Körpers entfernen.
Diese systematische Dekontextualisierung von Einzelphänomenen aus ei-
nem lebendigen Gesamtzusammenhang ist freilich kein neues Phänomen und
wurde schon um 1900, im Zuge des kometenhaften Aufstiegs der experimen-
tellen Physiologie, Pathologie und Bakteriologie vehement beklagt; und zwar
keineswegs nur von Vertretern einer ganzheitlichen, modernitätsverweigern-
den Weltanschauung sondern besonders von den intellektuell Modernen.
Eine Medizin, die sich vom ganzen Menschen abwende und nur mehr im La-
bor und Seziersaal stattfinde, kritisierten wissenschaftlich ausgebildete Dich-
ter-Ärzte wie Gottfried Benn oder Arthur Schnitzler, nehme den Teil für das
Ganze, das einzelne Organ für den ganzen Menschen:19 «Hier diese Reihe
sind zerfallne Schöße und diese Reihe ist zerfallne Brust», so lautet eine be-
rühmte Gedichtzeile Benns, die sich auf seine Erfahrungen mit Krebskran-
auf, der erhebliche philosophische Überbrückungsarbeit erfordern würde. Gleichwohl wer-
den die beiden Begriffe im vorliegenden Aufsatz aus rein pragmatischen Gründen und im
Bewusstsein ihrer kategorialen Verschiedenheit in strukturell äquivalenten Positionen ver-
wendet, da die Stoßrichtung des Aufsatzes eine texttheoretische und gattungshistorische ist.
19 Beispielhaft ist etwa folgende Äußerung von Gottfried Benn: «In den ersten Jahrzehnten
noch guter Hoffnung, von der reinen Wissenschaft eine Kritik ihrer Grundbegriffe Krank-
Gesnerus 77 (2020) 419
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessken an der Charité bezieht.20 Sie bringt das Phänomen der sprachlichen ‚Me-
tonymie‘, also der Ersetzung des ganzen Menschen durch einen Körperteil in
der wissenschaftlichen Medizin auf den Punkt – weist allerdings auch darauf
hin, dass diese Autonomisierung von Körperteilen nicht nur ethisches Defi-
zit, sondern auch ungeahntes ästhetisches Potential bedeutete und dass sich
hier das bewusstseinskritische Projekt einer ganzen Epoche abzeichnet.21
Wurde die resultierende ‚Depersonalisation‘ also schon um 1900 zur Con-
ditio des modernen Menschen schlechthin erklärt,22 und zwar mit weitreichen-
den kulturgeschichtlichen Folgen,23 so hat das metonymische Denken in der
Medizin des 20. und 21. Jahrhunderts nochmals gewaltig an Fahrt aufgenom-
men. Derzeit scheint es in einen Atomismus zu münden, der die Frage auf-
wirft, wie in diesem hochausdifferenzierten System kommunikativer Transfer
zwischen Experten einerseits und zwischen Experten und Laien andererseits
noch möglich ist. So gilt der gegenwärtigen Spezialistenmedizin nicht mehr
ein Organ wie ‚Magen‘ als pars pro toto für einen Gesamtorganismus. Statt-
dessen gelten technologisch konstruierte, sinnlich unzugängliche Artefakte
im Kontext des Magens als pars pro toto für diesen selbst: Magenentleerung,
Magen-Gastrin, Gastrinrezeptoren auf Parietalzellverbänden im Magen-
Corpus; mit anderen Worten standardisierte Funktionen, Substanzen, mole-
kulare Strukturen. Für diese nicht natürlich gegebenen Objekte sind jeweils
Hochspezialisten zuständig, die sie technologisch zuallererst herstellen, um
sie dann zu beobachten und ggf. durch therapeutische Handlungen zu modi-
heit und Gesundheit, Leben und Tod zu erhalten, die sich heilwissenschaftlich verwenden
ließen, befand sie [die Heilwissenschaft, Anm. MK] sich nach dem Schwinden dieser Hoff-
nung bereits gedanklich zu stark verbunden mit den zellulären, mikroskopisch-ätiologi-
schen Tendenzen der Pathologie, um die Richtung einzuschlagen, im Kranken nicht die
analysierfähigen Organe sondern das psychische Faktum einer leidenden Individualität
prüfend zu umfassen» (Benn 1986 [1926], 157f.).
20 Mann und Frau gehen durch die Krebsbaracke (Benn 1986 [1912]).
21 Vgl. den instruktiven Beitrag von Hoffmann 2009.
22 Dazu nochmals Gottfried Benn: «Ich versuchte, mir darüber klar zu werden, woran ich litt.
[…] [I]ch vertiefte mich in die Schilderungen des Zustandes, der als Depersonalisation oder
als Entfremdung der Wahrnehmungswelt bezeichnet wird, ich begann das Ich zu erkennen
als ein Gebilde, das mit einer Gewalt, gegen die die Schwerkraft der Hauch einer Schnee-
flocke war, zu einem Zustande strebte, in dem […] alles, was die Zivilisation unter der Füh-
rung der Schulmedizin anrüchig gemacht hatte […] die tiefe, schrankenlose, mythenalte
Fremdheit zugab zwischen dem Menschen und der Welt» (Benn 1968 [1875], 252f.).
23 Die Kunst der Moderne kreist bekanntlich mit großem Enthusiasmus um Ideen von Ich-
Zerfall, Identitätsverlust, Dissoziation, vor allem die Literatur und bildende Kunst der
Avantgarden nach 1900. Hier sind es insbesondere Dichter-Ärzte wie Gottfried Benn und
Alfred Döblin, die die Vorstellung des dissoziierten Ichs ins Produktive wenden und dar-
aus innovative Poetologien und bewusstseinskritische, anthropologische Reflexionen ablei-
ten (vgl. Leistenschneider 2015, Kleinschmidt 1982). Diskursive Leitfunktion für diese neu-
artige Ästhetik der Depersonalisation hat neben Ernst Machs Empiriokritizismus eine an
Phänomenen der Ich-Dissoziation interessierte empirische Psychiatrie, vgl. als locus classi-
cus Dugas 1898.
420 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessfizieren: für das Magengastrin der gastroenterologische Endokrinologe, für
die Magenentleerungszeit der gastroenterologische MRT-Spezialist.
Man kann das beliebig weitertreiben bis in die kleinsten Verästelungen
des Spezialistentums und wird dabei immer wieder sehen, dass Abstraktion
(der Gegenstände) und Atomismus (der medikalen Prozesse) einander
wechselseitig bedingen. So liefern beispielsweise hochauflösende, organspe-
zifische Darstellungstechnologien wie Kontrast- oder Funktions-MRTs mit-
unter (Zufalls-)Befunde, die so feinkörnig sind, dass sie sich nicht in jedem
Fall auf ein morphologisches Korrelat im Zielorgan, geschweige denn auf
einen Gesamtorganismus beziehen lassen. Sie sind dann für die Experten,
die sie produzieren – trotz einer gesteigerten ‚Bildgläubigkeit‘ – schwer kon-
textualisierbar, so dass über ihre pathogene Relevanz oder physiologische
Normalität für das betroffene Individuum nicht immer zweifelsfrei entschie-
den werden kann.24 Gleichwohl gelten gerade computergesteuerte Schnitt-
bildverfahren, auch wenn sie das «Rauschen des Gemachten und der Unsi-
cherheit»25 mithören lassen, als Schlüsseltechnologie der Gegenwartsmedizin;
und der Experte im CT-Kabinett – vor einem Raster von Schnittbildern sit-
zend – avanciert zur ikonischen Figur, die bisherige icons wie den Arzt mit
Stethoskop oder mit Ohrenspiegel ersetzt. 26 Man mag diese Szene mit den
Worten des Anthropologen Barry Saunders als ‚Fetisch der postmodernen
Medizin‘ bezeichnen 27 oder sie lediglich als repräsentativ für medizinische
Erkenntnisformen ansehen, die auf der Herstellung von digitalen Artefak-
ten und auf Fragmentierung basieren; jedenfalls scheint mit dem unfrag-
mentierten Organismus jenes zentrale epistemologische Prinzip abhanden
zu kommen, das die wissenschaftliche Medizin im Moment ihrer Ausdiffe-
renzierung im 19. Jahrhundert wesentlich konstituiert hat: Normalität.28 Erst
ein empirisch oder experimentell gesichertes System von Durchschnittswer-
ten, Schwellenwerten und qualitativen Standards mit Bezug auf ein Ganzes
erlaubt es, den Einzelfall als ‚normal‘ oder ‚pathologisch‘ einzuordnen.29
24 Vgl. zur Bildgläubigkeit Chhem 2012, 14. Chhems Aufsatz widmet sich der extrem elaborier-
ten Herstellung von MRI- und PET-scan-Bildern, die sich vielen verschiedenen Konstruk-
tions-, Rekonstruktions- Korrektur- und digitalen Errechnungsschritten verdanken sowie
der problematischen Referentialität der Bilder. Der Verfasser formuliert die zentrale Frage
zur Differenzierungsproblematik von Artefakt und Repräsentation folgendermaßen:
«Does the image displayed on the monitor accurately represent reality, e.g. does this really
reflect the structures of the patient’s knee in the MRI room?» (12). Zur Semiotik und Epi-
stemologie moderner Bildgebungsverfahren vgl. auch folgende Beiträge im gleichen Band:
Brukamp 2012, Fangerau/Lindenberg 2012, 103–119.
25 Vgl. Fangerau 2017, 68.
26 Vgl. Saunders 2008, 3.
27 Ebd.
28 Vgl. Canguilhem 1989 [1942], 63–68; Link 2006, 109–116, 192–276.
29 Canguilhem 1989 [1942], 39–91, 115–233.
Gesnerus 77 (2020) 421
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessErst ein solches System erlaubt es, die gewünschte Gesundheit des betroffe-
nen Organismus zu bewerten und sinnvolle Handlungen zu begründen. Ge-
sund oder krank ist schließlich der Mensch, nicht der Gastrinrezeptor oder
das T2-gewichtete Thalamus-Signal. 30
Wie sehr sich das Problem zur zweiten Jahrtausendwende verschärft hat,
lässt sich wiederum der intellektuellen Wissenschaftskritik um 1900 able-
sen: Beklagte noch Gottfried Benn, dass seine Forscher-Kollegen «am Ge-
hirn gar nicht mehr der Sitz und das Ergehen der Seele» interessiere sondern
lediglich, «dass beim Stich in den vierten Ventrikel Zucker im Harn auf-
trat», 31 so richtet sich das heutige Interesse anstatt auf Gehirnventrikel und
Medulla oblongata auf die ‚diffusionsgewichtete Magnetresonanzdarstel-
lung‘ (DW-MRI)32 von Gehirnventrikeln und Medulla oblongata.
Insofern liegt das Problem wohl auch nicht oder nicht nur auf der ethischen
Ebene, sondern viel tiefer. Gleichwohl wird die bildliche, laboranalytische und
graphische Zersplitterung des kranken Menschen in Einzelelemente regel-
mäßig ethisiert, bevorzugt von Vertretern der anglophonen Medical Humani-
ties, die sie als kalt und inhuman beklagen und daraus diffuse Empfehlungen
zu Empathie-Schulung im Medizinstudium ableiten. Abgesehen davon, dass
niemand genau weiß, was Empathie eigentlich ist – eine kognitiv messbare
Größe, eine charakterliche Qualität, eine ethische Norm? – und insofern völ-
lig unklar bleibt, ob und wie man sie lehren kann, setzt diese Kritik am ein-
zelnen Akteur an; genauer gesagt an seiner charakterlichen Beschaffenheit.
Sie geht in eine falsche Richtung, da sie die individuelle Zuschreibbarkeit par-
tikularisierenden Denkens voraussetzt und ein selbstverantwortetes morali-
sches Fehlverhalten der Ärzte unterstellt, das vom Einzelnen steuer- und kor-
30 Canguilhem leitet zwar das Normalitätsparadigma aus dem phänomenologischen Kontinu-
itätsdenken der frühen Physiologen ab (und von Comte, der sich seinerseits auf den Unita-
rismus Broussais’ bezieht), vereint dann aber Normalisierung und Krankheits-Ontologie
für die Medizin des 20. Jahrhunderts durchaus miteinander. Gerade mit Blick auf diese
schlüssige Integration von quantitativer Normalität und qualitativer Ontologie wäre es in-
teressant, nach dem Verbleib von ontologischen Krankheitskonzepten in der gegenwärtigen
Hochspezialisierung zu fragen. Das ICD-Klassifi kationssystem, das fundamental ätiolo-
gisch organisiert ist und u.a. genetische, infektiöse, degenerative und neoplastische Krank-
heitsgruppen festlegt, erweckt auf den ersten Blick den Anschein, als halte sich unter Kli-
nikern die von Canguilhem mit Nachdruck angemahnte Krankheitsontologie. Mag das für
die Wissensordnung im Allgemeinen zutreffen, so gilt es jedoch weniger für die praktischen
Handlungsabläufe und Routinen in der Hochspezialisierung. Im Zuge der rasanten tech-
nologischen Entwicklungen um die zweite Jahrtausendwende scheint mit der Einheit der
Person, des Organismus und des Krankheitsprozesses auch die Einheit von Krankheit ab-
handen zu kommen und einer chaotischen Vielheit von Einzelphänomenen zu weichen, die
unabhängig voneinander beobachtet und manipuliert werden.
31 Benn 1987 [1911], 16. Gemeint ist der berühmte ‚Zuckerstich‘ Claude Bernards (1854) in
die Medulla oblongata, der über die Erregung sympathischer Zentren zur Nebennierensti-
mulation, zur Adrenalinausschüttung und Hyperglykämie führt (Bernard 1878).
32 Zu dieser funktionellen MRI-Technologie vgl. Jones 2011.
422 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessrigierbar wäre – wäre er denn nur ein besserer Mensch. Das Problem ist aber
offensichtlich in einem ganz anderen Bereich angesiedelt; nämlich auf der
Ebene der epistemologischen Gegenstandskonstitution und der Kategorien-
fehler: Organe gehören zu einer logisch anderen Kategorie wie Personen, Bil-
der zu einer logisch anderen Kategorie wie Organe.33 Daraus wiederum resul-
tieren Probleme für die Kommunikationspraxis des gesamten Medizinsystems.
Nicht zuletzt besteht das Risiko einer zunehmenden Dissoziation von
spezialisierten, diagnostischen und therapeutischen Aktivitäten, wenn
Ärzte unbewusst den ganzen Menschen durch Teile seines Gehirns und
schließlich durch den magnetischen Feldgradienten einer MRT-Sequenz von
diesen Gehirnteilen ersetzen. Aufgrund der Unverbundenheit, mit der viele
einzelne Akteure viele einzelne, hochabstrakte Gegenstände verfolgen und
aufgrund der wohl teilweise unvermeidbaren Kategorienfehler, die in den
Erkenntnisprozessen der Akteure eine Rolle spielen aber nicht explizit mit-
reflektiert werden, wächst die Kontingenz erheblich an: «For many resi-
dents, their fragmentation is systemic and isolates them not only from their
patients, but also from one another», so beschreibt die Anglistin und Medi-
zinpädagogin Lindsay Holmgren die Situation von Assistenzärzten in der
klinischen Weiterbildung. 34 Das Risiko, dass diagnostische und therapeuti-
sche Entscheidungsprozesse inkohärent und dissoziativ ablaufen, dürfte be-
sonders für komplexe, multifaktorielle Leiden (bspw. maligne, autoimmune
oder genetische Systemerkrankungen) gelten, die in die Zuständigkeit von
vielen und wechselnden Hochspezialisten fallen.
2. Ärztliche Rollenunsicherheit – ein Modellfall
Da wir indes die Spezialisierung und insofern die Abstraktion nicht abschaf-
fen können und uns als Gesellschaft wohl auch kaum geschlossen der tradi-
tionellen chinesischen Medizin zuwenden, scheint es geboten, beim Perso-
33 Bezüglich einer kritischen Diskussion und Bestimmung des Begriffs ‚Kategorienfehler‘, be-
sonders mit Blick auf medizinische Epistemologien, verweise ich auf Stier 2015. Stiers Auf-
satz setzt sich konkret mit den Kategorienfehlern einer biologisch-naturalistisch konzeptu-
alisierten Psychiatrie auseinander, die eine Parallele zu den von mir beschriebenen Phäno-
menen darstellen; mit dem Unterschied allerdings, dass es sich dabei um metaphorische
Austauschoperationen – beziehungsweise um Similaritätsbeziehungen in der Terminologie
Roman Jakobsons – handelt, wo jeweils physisch-materiale und psychische Entitäten, etwa
‚Gehirn‘ und ‚Geist‘ oder ‚intentionale Handlung‘ und ‚neuronales Ereignis‘, einander sub-
stituieren. Den von mir skizzierten Kategorienfehlern liegen hingegen metonymische Aus-
tauschoperationen – beziehungsweise Kontiguitätsbeziehungen – zugrunde, wo ein Teil das
Ganze substituiert.
34 Holmgren 2016, 100.
Gesnerus 77 (2020) 423
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessnenbegriff klinischer Spezialisten als Spezialisten anzusetzen und hier einen
anderen Bewusstseinsgrad zu schaffen. Besondere Brisanz gewinnt das da-
durch, dass die Hochspezialisierung einen distinkten Personenbegriff mög-
licherweise für beide Mitspieler des klinischen Dialogs verschattet: für die
Sicht des Arztes auf den Patienten wie auch auf sich selbst. Als Experte im
Milieu in einer fast grotesken technischen Systemdifferenzierung und gleich-
zeitig als ganze Person zu agieren scheint mitunter schwer vereinbar, ja fast
paradox. Diese Rollenproblematik zeigt sich exemplarisch, wenn Hochspe-
zialisten auf einen Patienten treffen, der selbst Experte ist und sich insofern
nicht an die Verhaltensregeln des klinischen Interaktionsspiels hält. Anhand
eines solchen ‚Joker‘-Patienten, der zwischen Arzt-Autorität und Leidense-
xistenz, mechanistischem und holistischen Selbstverständnis hin- und her-
schwankt, lässt sich die Depersonalisierungs- und Kommunikationsproble-
matik der Spezialistenmedizin modellhaft sichtbar machen.
Patient A., um dessen reale Erfahrungen es im Folgenden gehen wird, ist
selbst hochausgebildeter Kliniker und blickt auf eine jahrzehntelange Tätigkeit
als internistischer Oberarzt an Unikliniken zurück. Beunruhigend erkrankt mit
wochenlangem ‚fever of unknown origin‘, begibt er sich in die Obhut der orts-
ständigen Universitätsklinik, zu deren Dozentenkorpus er auch selbst gehört.
Und schon beginnen die Rollenprobleme; Obhutsanspruch und Autoritätsan-
spruch geraten immer wieder durcheinander. Herr A. weiß natürlich um die
Kontingenzen des rein phänomenologischen Labels ‚FUO‘ und nimmt kurzer-
hand seinen Diagnoseprozess selbst in die Hand. Er sucht den infektiologischen
und später den rheumatologischen Spezialisten auf, veranlasst zwischenzeitlich
seinen Hausarzt zur Abnahme einer hochspezialisierten Autoimmunserologie,
die der aber gar nicht interpretieren kann – und wünscht sich gleichzeitig, dass
ihm ein Kliniker mit Übersicht über den ganzen, in seiner Ganzheit aber noch
nicht evidenten pathophysiologischen Zusammenhang diesen abnimmt. Die
Kliniker hingegen tun genau das Gegenteil: Je komplexer das Geschehen wird,
desto mehr ziehen sie sich in die Kollegenrolle zurück, da viele unverbundene
Befunde auftauchen und jenen autonomen Dispersionsprozess in Gang setzen,
der dann die Rückführbarkeit auf ein Ganzes – einen Leib, einen Diagnosevor-
gang – immer schwieriger macht.
So finden sich antinukleäre Antikörper im Blut [lösliche Antikörper gegen
körpereigenes Bindegewebe, Anm. MK], die für eine rheumatologische Syste-
merkrankung sprechen, aber mit widersprüchlichen Fluoreszenzmustern, die
die Systemerkrankung wieder in Frage stellen. Es findet sich ein AV-Block im
EKG [elektrische Überleitungsstörung, Anm. MK], der eigentlich eine Myokar-
ditis anzeigt, aber kein Korrelat im Herzecho hat; es taucht eine erhöhte exhala-
tive Stickstoffkonzentration auf, die für eine Lungenfibrose spricht, aber von
424 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accesseinem normalen Lungen-CT begleitet wird. Diese Befunde sperren sich gegen
jede Integration; und da sie einen paradoxen Bezugspunkt haben, nämlich ei-
nen Experten-Patienten, überlässt man die Integration diesem Akteur. Er wird
zum Verwalter des eigenen Leibes und produziert dabei ein kommunikatives
Chaos, das den Zusammenhang zwischen Kategorienfehlern im ärztlichen
Denken und problematischer Rollenidentität deutlich macht.
So fragt etwa bei einem Kardio-MRT-Termin, der vom Rheumatologen
notfallmäßig anberaumt aber nicht spezifi ziert wurde, die Radiologin Herrn
A., was er denn untersucht haben wolle. «Ich mach ihnen, was sie möchten»,
so das freundliche Angebot,
«ein Struktur-MRT mit Gadolinium, ein Ischämie-MRT mit Adenosin, ein Ischämie-MRT
mit Dopamin, oder ein gemischtes Stress-MRT mit späten Mapping Sequenzen – was hät-
ten Sie denn gern? Die späten Mapping-Sequenzen kennen Sie doch sicher.»35
Herr A. kennt weder die Suchraster der verschiedenen MRT-Typen noch die
‚späten Mapping-Sequenzen‘ (eine hochinnovative Technologie in der Kar-
dio-Radiologie). Er weiß nur, dass die Suche einer fraglichen Herzmus-
kel-Beteiligung bei einer fraglichen Autoimmun-Erkrankung gilt und muss
sich für eines der bunten Angebote entscheiden. Aufgrund dieser erhebli-
chen Kontingenzfaktoren, der totalen Abstraktion und der Rolleninstabili-
tät auf beiden Seiten, misslingt die Kommunikation erwartungsgemäß und
grundlegend. Auf die Frage, ob sein Myokard krank sei, teilt die Kardio-Ra-
diologin Herrn A. nach Besichtigung der Bilder Folgendes mit:
«Herzgröße und Pumpleistung sind normal, die Ejektionsfraktion beträgt 68%, hier unten
infrahissär tritt ein diskretes late enhancement [Kontrastmittelanreicherung, Anm. MK]
auf; das ist möglicherweise eine Myokarditis, aber ob die abgelaufen ist oder akut, sagen die
Bilder nicht. Reden Sie doch mal mit ihrem Kardiologen».
Bedeutsam scheint hier nicht nur, dass der Abstraktionsgrad der Befunde eine
unzweideutige Rückführung auf das Organ ‚Herz‘, geschweige denn auf die
Person A. nicht erlaubt und Herrn A.’s Frage, ob sein Myokard krank sei, un-
beantwortet bleibt. Bedeutsam ist ebenso der Satzbau, der ganz ohne humane
Subjekte auskommt und stattdessen Körperteile und Maschinen zu Agenten
macht. An die Stelle des Patienten rücken Pumpleistung und Ejektionsfrak-
tion, an die Stelle der beobachtenden Ärztin rücken die späte Kontrastmitte-
lanreicherung, die auftritt, und die Bilder, die etwas sagen oder auch nicht.
Ähnliche rhetorische Eigentümlichkeiten kennzeichnen weiterhin Herrn A.’s
Gespräche mit anderen Spezialisten. «Die antinukleären Antikörper erreichen
35 Ich danke an dieser Stelle meinem anonymen Kollegen für die Überlassung seiner Arztbe-
richte sowie für detaillierte mündliche Informationen über seine Konsultationen mit Spe-
zialisten.
Gesnerus 77 (2020) 425
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessmanchmal Werte von 1:2500», erklärt der Rheumatologe, «bei Ihnen jedoch
nicht; solche ANAs sind unter Umständen ein prädiktiver Faktor, wobei diese
ssA-Ro-Antikörper eine Differenzierungstendenz zum systemischen Lupus ery-
thematodes [eine Autoimmunerkrankung, Anm. MK] anzeigen». Verdingli-
chung von Menschen und Personifizierung beziehungsweise Autorisierung von
Abstrakta – ein late enhancement, das auftritt, ein Antikörper, der etwas an-
zeigt – gehen hier Hand in Hand, so dass letztlich zwei verschiedene Sprach-Phä-
nomene die Arzt-Patientenkommunikation und ein stabiles Rollenverhalten er-
schweren. Erstens kommunizieren viele verschiedene Experten mit einem
Patienten-Experten, der sich selbst zum Gegenstand hat. Zweitens lassen sich die
Ärzte metonymisch durch denkende Maschinen beziehungsweise kluge Techno-
logien vertreten und dieses mechanistische, reduktive Selbstverständnis wird auf
den Patienten übertragen, der ja auch Experte ist. So spricht schließlich ein MRT
mit einer muskulären Pumpe, und ein serologisches Raster spricht mit einem
denkenden Antikörper, und Kardiologen und Rheumatologen sprechen selbst
kaum miteinander. Im Zuge solcher mehrfachen, unbewussten Kategorienfehler
tritt an die Stelle eines distinkten Personenkonzepts ein reines Funktionskon-
zept, und Funktionen sind bekanntlich in der Moderne differenziert, selbstrepro-
duktiv und voneinander unabhängig. Das Ergebnis ist – zumindest im Fall von
Herrn A. – eine gewisse Anomie, da nicht nur auf beiden Seiten des klinischen
Theaterspiels Teile für das Ganze stehen: für den ganzen kranken Menschen, für
den ganzen handelnden Arzt. Darüber hinaus ist es jeweils zu einer weitgehen-
den Autonomisierung der Teile gegenüber dem Ganzen gekommen.
Mag es sich nun beim Arzt-Patienten, der sein eigener Experte ist, um ei-
nen seltenen Sonderfall handeln, der im klinischen Alltag wohl kaum eine
Rolle spielt, so zeigt er gleichwohl modellhaft die Risiken eines reduktiven
Personenverständnisses in der Hochspezialisierung. 36
3. Depersonalisierung und medizinische Schriftkommunikation:
der Arztbrief
Außerdem spricht jenseits des Modellfalls eine ubiquitäre kommunikative
Praxis dafür, dass das medikale Denksystem tatsächlich mit einem fragmen-
tierten Personenverständnis operiert, mit metonymischen Ersetzungen und
personifi zierten Abstrakta: Das ist der Arztbrief – also jene epistolare Ge-
brauchstextsorte, die der umfassenden Vermittlung, Normalisierung und Ar-
36 Zu den hier skizzierten Phänomenen vgl. Ripke 2000, 237. Obwohl die Konstellation ‚Arzt
als Patient‘ laut Wolfgang Eckart «spannende Forschungsperspektiven im Grenzbereich
klinischer Medizin mit den Sozial- und Kulturwissenschaften und nicht zuletzt für die Me-
426 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accesschivierung aller klinischen Krankengeschichten dient. Es handelt sich dabei
um ein texttheoretisch und medizinhistorisch weitgehend unerforschtes Gen-
re, 37 das gleichwohl in der Gegenwartsmedizin die gesamte okkasionelle
Schriftkommunikation unter Ärzten trägt und dessen Entwicklung die
These vom Denksystem ohne distinktes Personenkonzept stützt. Scheint
doch der Arztbrief zwischen etwa 1960 und der Gegenwart – obgleich immer
noch narrativ organisiert – ein nahezu maximales Maß an Deagentivierung,
Ereignisverarmung und begrifflicher Abstraktion zu erreichen. Hier wieder-
holen sich genau die rhetorischen und idiomatischen Eigentümlichkeiten, die
oben anhand des Beispielfalls von Herrn A. beschrieben wurden.
Dazu einige vorläufige Bemerkungen zur Geschichte dieser unerforschten
Gattung. Gemäß eigener, unpublizierter Quellenstudien an ca. 500 chirurgi-
schen und pädiatrischen Krankenakten des Berner Insel-Archivs zwischen
1900 und 197038 tauchen Zusammenfassungen eines Krankheitsfalls in episto-
larer Form sporadisch in den Patientenakten der 40er Jahre auf. Zunächst sind
sie als persönliche, entschieden narrativ organisierte Briefe gestaltet und ant-
worten auf Nachfragen von Kranken- und Rentenversicherungen, Gerichten
und militärischen Institutionen; gelegentlich auch von weiterbehandelnden Spe-
zialisten, die eine ärztliche Einschätzung von unklaren Krankheitsprozessen
dizinische Ethik» verspricht (Eckart 2008, 37), existiert zu diesem Thema kaum For-
schungsliteratur.
37 Während die medizinische Forschung den Arztbrief als empirisches Objekt behandelt –
und zwar mit Blick auf Fragen der Digitalisierung und Datenoptimierung (Vgl. Bechmann
2017, 108) – beschäftigt sich die Fachtextlinguistik erst seit ganz kurzem mit dem Arztbrief.
Der Germanist Sascha Bechmann arbeitet gegenwärtig an einem Forschungsprojekt, das
u.a. die Entwicklung struktureller, funktionaler und pragmatischer Defi nitionskriterien für
diese Fachtextsorte zum Ziel hat. Bechmanns Ansatz ist gleichwohl normativ und interak-
tionsbasiert, da es ihm um die Entwicklung von sprachlichen und kommunikativen Stan-
dards für das Verfassen guter Arztbriefe und um die Verbesserung der interpersonellen
ärztlichen Kommunikation geht (vgl. Forschungsprojekt Sascha Bechmann unter https://
www.uni-duesseldorf.de/home/nc/app-rss/rss-n/news-detailansicht/article/arztbriefe-sind-
oft-unstrukturiert-und-fehlerhaft.html, sowie Manuskript von Bechmann 2019). Deskrip-
tive beziehungsweise historisch-rekonstruktive Arbeiten zur Geschichte, Epistemologie
und Narratologie des Arztbriefes hingegen fehlen meines Wissens nach bislang: Hier ist
eine auffällige Zurückhaltung von Literaturwissenschaftlern und Erzähltheoretikern aber
auch von Medizinhistorikern zu verzeichnen. Das mag zum einen an der Schwerverständ-
lichkeit der Fachsprache liegen, die im 20. Jahrhundert bereits weitgehend technolektal aus-
fällt; zum anderen aber auch in der Unzugänglichkeit der Quellen, die – als Bestandteil der
Patientenakte – in Klinikarchiven nur selten über längere Zeiträume aufbewahrt werden
beziehungsweise im Fall längerfristiger Archivierung meist mit Datenschutz bis weit ins
21. Jahrhundert belegt sind.
38 Vgl. Staatsarchiv Bern: Krankengeschichten der geburtshilflichen Klinik des Frauenspitals
Bern, Signaturen BB 2.4.362/363/369; Archiv des Inselspitals II: Krankengeschichten der
Chirurgischen Klinik Männer, Signaturen Insel II 388/389/390/423/425/457; Krankenge-
schichten des Jenner-Spitals für Kinder, Signaturen BB 05.10. 403/423/434/450; Archiv des
Kantonal-bernischen Säuglings- und Mütterheimes bzw. des Bernischen Säuglingsspitals El-
fenau: Krankengeschichten, Signaturen BB 05.10. 547-550/555-557/561/566/569/571/577/580.
Gesnerus 77 (2020) 427
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessanfordern.39 Erst ab den 1960er Jahren scheint der Arztbrief – und dies nur
avant la lettre, da für verbindliche, gattungsgeschichtliche Aussagen weitere
Korpora aus verschiedenen Fachdisziplinen, Kliniken und medikalen National-
kulturen zu untersuchen wären – seine aktuell gültige Form und Funktion zu
erreichen und damit den Status der definiten Gebrauchstextsorte. Als Schreib-
anlass gilt nun nicht mehr die okkasionelle Nachfrage einer außermedizini-
schen Institution oder eines Kollegen, sondern eine offensichtlich allgemein gül-
tige Regel, die die Verschriftlichung jedes stationär aufgenommenen Patienten
in standardisierter epistolarer oder protokollarischer Form (Epikrise) verlangt.
Dabei wird weitgehend das Schema des case reports eingehalten, bestehend aus
den Blöcken ‚Anamnese‘, ‚Untersuchungsbefund‘, ‚Therapie und Verlauf‘.
Gattungstheoretisch gesehen stellt die ausdifferenzierte Textsorte ‚Arztbrief‘
demnach ein eigentümliches Hybrid aus epistolaren und kasuistischen Schreib-
weisen dar und es ist sicher kein Zufall, dass sich eben diese Ausdifferenzierung
und Universalisierung zeitlich, mit den 60er Jahren, an den Aufstieg jener plu-
ralisierten, technokratischen Expertenmedizin knüpft, von der hier die Rede
ist. Schließlich ist die Akte selbst als ‚Archiv des Falls‘ zu diesem Zeitpunkt be-
reits zu einem Konglomerat aus Schriftstücken unterschiedlichster Materialität,
Größe, Anordnung, Semiotik und Referenz angewachsen. Sie enthält neben der
maschinengeschrieben, ärztlichen Verlaufsdokumentation auf dem inneren
Umschlagblatt und weiteren, losen Verlaufsblättern mittlerweile Röntgenbilder,
EKG-Streifen sowie zahlreiche unterschiedliche Vordrucke: hämatologische,
serumchemische und blutgruppenserologische Befundblätter, Lues-Serologie,
Liquor-Zytologie, bakteriologische Kulturergebnisse, faltbare Kurvenblätter
für Fieber-, Blutdruck-, und Pulsmessungen sowie für Urinchemie.40 Diese kom-
39 Vgl. Tom Kindt, Martina King: «No events, no actors? Narrating surgical procedures in his-
torical and contemporary medical reports», Tagungspaper (Manuskript), Internationaler
Workshop Doctors’ Stories Revisited: On the History, Structure and Epistemology of Me-
dical Narratives, organisiert von Martina King und Lea Bühlmann, Fribourg, 6.–7.5.2019
[https://www3.unifr.ch/med/de/info/conferences/doctors-stories-revisited/].
40 Vgl. die Krankenakten der 60er Jahre aus dem «Kantonal-bernischen Säuglings-und Mütter-
heim Elfenau» (1915–1983), einer 1915 gegründeten und im Untersuchungszeitraum ausgespro-
chen fortschrittlichen neonatologischen Klinik (Staatsarchiv Bern, Archiv des Kantonal-berni-
schen Säuglings- und Mütterheimes bzw. des Bernischen Säuglingsspitals Elfenau: Krankenge-
schichten, Signaturen BB 05.10. 561-580). Auch der Medientypus ‚Krankenakte‘ ist nicht
umfassend erforscht; zu nennen sind die Pionierarbeiten von Volker Hess, Andrew Mendelsohn
und Sophie Ledebur, die die schrittweise Entstehung dieses epistemologischen und administ-
rativen Registratursystems aus rubrifizierten, handschriftlich ausgefüllten Faltblättern im
19. Jahrhundert nachzeichnen (Hess/ Mendelsohn 2010, Hess 2010, Hess 2011, Hess/Ledebur
2011). Allerdings beschränken sich die Verfasser aus Quellen aus dem 18. und 19. Jahrhundert,
unter besonderer Bevorzugung eines psychiatrischen Akten-Korpus der Charité. Mit Blick auf
die noch ungeschriebene Geschichte der Akte in der disziplinär pluralisierten somatischen
Medizin des 20. Jahrhunderts steht man vor demselben Quellen-Problem wie im Falle des Arzt-
briefes: Nur wenig Material ist erhalten, dabei kaum systematisch archiviert und meist mit
Datenschutz belegt.
428 Gesnerus 77 (2020)
Downloaded from Brill.com12/18/2021 11:59:20PM
via free accessSie können auch lesen