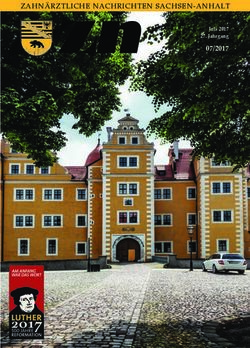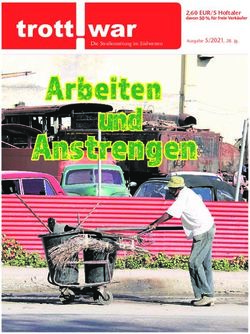Naturschutzarbeit in Sachsen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vom Aussterben bedroht: Wildkatze (Felis silvestris silvestris) Foto: Archiv Naturschutz LfULG, F. Richter
Inhaltsverzeichnis
Thomas Krönert
Erfahrungen aus 18 Jahren ehrenamtlicher NSG-Betreuung.................................................................... 4
Eckhard Jedicke, Heike Weidt, Jörg Döring
Landschaftspflege durch extensive Rinderbeweidung –
ein gemeinsames Projekt von Landwirtschaft und Naturschutz in Sachsen .................................16
Wolfgang Dietrich, Thomas Prantl
Puppenstuben für Sachsens Schmetterlinge –
Ergebnisse auf fünf Flächen im Mittleren Erzgebirge................................................................................32
Almut Gaisbauer
Projekt Rettungsnetz Wildkatze des BUND –
Rückkehr der Europäischen Wildkatze nach Nordsachsen ......................................................................46
Torsten Roch, Thomas Gröger, Sigmar Krause
Das Haus der Tausend Teiche –
zentraler Anlaufpunkt für Naturinteressierte in der Heide- und Teichlandschaft –
ein Verdienst von Peter Heyne und Dr. Astrid Mrosko .............................................................................62
Friedemann Klenke
Schutzgebiete in Sachsen 2016 ...........................................................................................................................70
|3„Naturschutzarbeit in Sachsen“, 59. Jahrgang 2017 Seite 4 – 15
Erfahrungen aus 18 Jahren
ehrenamtlicher NSG-Betreuung
Thomas Krönert
1 Einleitung
Die Betreuung von Schutzgebieten ist eine der Das 1.453 Hektar umfassende NSG weist als prä-
zentralen Aufgaben der Mitarbeiter im ehren- gende Elemente einen Flachland-Flussabschnitt
amtlichen Naturschutzdienst. Sie ist allerdings mit weitgehend natürlicher Flussdynamik, zahl-
nicht nur mit Annehmlichkeiten verbunden, reiche Altwasser, ausgedehnte Grünlandflächen,
wenn der Betreuer den Willen aufbringt, nicht Weidengebüsche und Reste der ehemaligen
nur als „Beobachter und Melder für die untere Hartholz-Auwälder auf. Eine Besonderheit ist der
Naturschutzbehörde“ (siehe § 43 SächsNatSchG) starke Einfluss der Flussdynamik, da Uferbefes-
zu handeln, sondern aktiv gegen Ordnungswid- tigungen nur noch in Rudimenten in Form von
rigkeiten vorgehen möchte. Hierbei muss er be- Steinschüttungen vorhanden sind. Hierdurch
reit und in der Lage sein, Diskussionen mit ord- sind ständige Veränderungen der Flussufer,
nungswidrig handelnden Bürgern und Flächen- der Ausdehnung und Lage von Kieshegern und
nutzern zu führen. Im Einzelfall können auch -inseln, Auflagerungen sowie die Entstehung bis
unterschiedliche Meinungen zur Bewertung von zu fünf Meter hoher Steilufer möglich. Das NSG
Verstößen mit der bestellenden unteren Natur- weist eine Nord-Südausdehnung von 14,5 km
schutzbehörde (UNB), aber auch anderen Behör- auf, die Länge des Flusslaufes beträgt aber durch
den auftreten. sein ausgeprägtes Mäandrieren über 27 km.
Im folgenden Beitrag werden Erfahrungswerte Wertgebende Tierarten sind unter anderem Elbe-
aus einer langjährigen ehrenamtlichen Betreu- Biber, Fischotter, Baumfalke, Fischadler, Bienen-
ung des heutigen NSG „Vereinigte Mulde Eilen- fresser, Eisvogel, Flussuferläufer, Mittelspecht,
burg-Bad Düben“ dargelegt. Rotmilan und Grüne Keiljungfer. Eine Besonder-
heit ist auch das Vorkommen der Ufer-Wolfs-
2 Das NSG „Vereinigte Mulde spinne (Arctosa cinerea) auf den Kieshegern.
Eilenburg-Bad Düben“ Diese Spinnenart ist in Deutschland streng ge-
Die Festsetzung des NSG „Vereinigte Mulde Ei- schützt. Sie besitzt im Binnenland Deutschlands
lenburg-Bad Düben“ erfolgte im Dezember 2001. nur noch wenige Vorkommen und ist, soweit
Vorher war etwa ein Drittel der Fläche des Ge- vorkommend, in den meisten Bundesländern
bietes zwei Jahre als NSG einstweilig sicherge- vom Aussterben bedroht.
stellt. Schon zu DDR-Zeiten war die Fläche des
heutigen NSG Bestandteil eines LSG. Es ist Be-
Abb. 1: Großflächiger Kiesheger am
standteil eines FFH- und eines SPA-Gebietes. „Südeingang“ des NSG bei Eilenburg
Foto: T. Krönert
4|Weitere Informationen zum NSG sind unter an- oder Teile davon, die unbefugt entnommen
derem dem Buch „Naturschutzgebiete in Sachsen“ wurden, sicherzustellen
(SMUL [Hrsg.] 2008, S. 88-93) oder dem Internet Im Rahmen der Schutzgebietskontrolle sollte der
auftritt des SMUL (https://www.umwelt.sachsen. Betreuer unbedingt weitere Rechtskenntnisse
de/umwelt/natur/24701.htm) entnehmbar. besitzen, um keine Fehlhandlungen zu begehen.
Hierzu ist an erster Stelle die Rechtsverordnung
3 Rechtsgrundlagen und darauf zum betreuten Gebiet zu nennen. Der Betreuer
aufbauende Handlungen sollte die Ge- und Verbote sowie die zulässigen
Das SächsNatSchG räumt im § 43 den Mitarbei- Handlungen gut kennen und bei Bedarf aus dem
tern des Naturschutzdienstes eine Reihe von Gedächtnis zitieren können. Die NSG-Verord-
Rechten ein. Diese unterscheiden sich für Natur- nung führe ich bei meinen Kontrollen grundsätz-
schutzhelfer und -beauftragte. Für die Betreu- lich mit, um auch diskussionsfreudige Bürger
ung von Schutzgebieten halte ich es grundsätz- („Wieso hat dein Vogel mehr Rechte als ich? “)
lich für angebracht, den Betreuer als Natur- möglichst überzeugen zu können.
schutzbeauftragten zu berufen, da dieser erwei- Vorteilhaft sind im weiteren Kenntnisse zu den
terte Rechte hat. Zumindest sollte diese Festsetzungen des BNatSchG zum Biotop- und
Funktionsübertragung erfolgen, wenn der Be- Artenschutz (§§ 39 u. 44) sowie zum Betreten
treuer Willens ist, mit bei Verstößen angetroffe- der freien Landschaft (incl. §§ 27 u. 28 Sächs-
nen Personen ein Gespräch zu führen. NatSchG), da in diesen Rechtsbereichen regel-
mäßig Verstöße festgestellt werden können.
Die Rechte der Naturschutzbeauftragten gemäß Wissen sollte man, dass die Rechte der Flächen-
§ 43 SächsNatSchG: bewirtschafter und -eigentümer gemäß BGB und
1. NSG und sonstige geschützte Flächen auch diverser Fachgesetze sehr umfangreich sind und
außerhalb von Wegen zu betreten gegebenenfalls auch Handlungen ermöglichen,
2. eine Person zur Feststellung ihrer Personalien welche den Puls des NSG-Betreuers „auf 180“
anzuhalten, wenn sie bei Rechtsverstößen bringen. Ein Landwirt darf beispielsweise in der
angetroffen wird oder solcher Verstöße ver- Brutzeit der Bodenbrüter über seine Grünland-
dächtig ist flächen fahren oder diese mähen. Hierzu ist
3. eine angehaltene Person zu einer Polizei- sachlich anzumerken, dass sonst Landwirtschaft
dienststelle zu bringen, wenn die Feststellung nicht sinnvoll möglich wäre.
der Personalien an Ort und Stelle nicht vor- Aus den vorstehenden Erläuterungen ergibt sich
genommen werden kann oder wenn der Ver- vermutlich ein wesentlicher Grund, warum nach
dacht besteht, dass ihre Angaben unrichtig meiner Kenntnis nur relativ wenige Mitarbeiter
sind (Diese Möglichkeit habe ich bisher nie des Naturschutzdienstes eine Schutzgebietsbe-
genutzt, da hierdurch die Situation eskalieren treuung ausüben möchten oder dazu von der
kann. Die Nennung dieser Möglichkeit in einer UNB berufen werden.
Diskussion ist allerdings ein starkes Argu-
ment.) 4 Beeinträchtigungen des Naturschutz-
4. eine Person vorübergehend von einem Ort zu gebietes und die Reaktionsmöglich
verweisen oder ihr vorübergehend das Betre- keiten des Betreuers
ten eines Ortes zu verbieten („Platzverweis“) Das genannte NSG ist erheblichen Beeinträchti-
5. besonders geschützte Tiere oder Pflanzen gungen ausgesetzt. Hierzu sind im Rahmen der
6|Abb. 2: Ackernutzung bis an die Abbruchkante eines Steilufers – eine erlaubte Handlung
Foto: T. Krönert
Betreuung vier rechtlich unterschiedlich zu behan- BNatSchG kann insbesondere die Landwirtschaft
delnde Kategorien zu unterscheiden. Diese sind: bei Einhaltung der „guten fachlichen Praxis“ und
1. die gesetzlich zugelassene Bewirtschaftung unter Berücksichtigung der schutzgebietsspezi-
durch die Land-, Forst- und Fischereiwirt- fischen Ge- und Verbote (hier § 5 Nr. 4 der NSG-
schaft VO) auch in diesem NSG weitgehend wie auf
2. bauliche Hochwasserschutzmaßnahmen, die Flächen außerhalb arbeiten. Dies hat unter an-
naturschutzfachlich ungünstige Zustände derem zur Folge, dass einzelne Landwirtschafts-
manifestieren und verstärken unternehmen jedes Jahr mit dem Faktor „Hoch-
3. die Missachtung der die Bewirtschaftung wassergefahr“ pokern und bis an die Steilufer
betreffenden Ge- und Verbote der NSG-Ver- der Mulde Ackerbau betreiben. Man geht ver-
ordnung mutlich davon aus, dass bei Hochwasserschäden
4. die Missachtung der den Normalbürger be- wie nach 2002 und 2013 mit Unterstützung des
treffenden Ge- und Verbote der NSG-Verord- Bauernverbandes nur in den Medien und gegen-
nung (zum Beispiel bei der Freizeitnutzung) über Politikern laut genug geklagt werden muss,
damit durch Steuergelder der Ernteausfall wieder
4.1 Beeinträchtigungen mit geringen ersetzt wird. Und die Direktzahlungen pro Hek-
Wirkungsmöglichkeiten des Betreuers tar Landwirtschaftsfläche bekommt man eh. Ich
Die Einflussmöglichkeiten des Betreuers auf die stelle mir hierzu die Frage, ob Ackerbau bis an
in den Punkten 1 und 2 genannten Handlungen das Flussufer in einem ausgewiesenen Über-
gehen gegen Null. Durch die Privilegierung der schwemmungsgebiet (vor dem Hochwasser-
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft im § 44 (4) deich) eine „standortgerechte Bewirtschaftung“
|7darstellt. Aus meiner Sicht ist in Überschwem- nahme durch den Betreuer. Diesen Fakt muss mungsgebieten nur Grünlandwirtschaft stand- man nüchtern zur Kenntnis nehmen, um nicht in ortgerecht, wie dies Landwirte Jahrtausende in seiner Funktion „über das Ziel hinauszuschießen“. Flussauen praktiziert haben. Folgewirkungen des Trotz dieser Tatsache sollte man erhebliche Be- Ackerbaus in der Überschwemmungsaue sind, einträchtigungen oder Schäden im NSG seiner neben den allgemeinen Beeinträchtigungen der UNB mitteilen. Auch für zugelassene Maßnah- Biodiversität, nach Niederschlägen Bodeneintrag men gibt es meist naturschutzrechtliche Aufla- in die Mulde, Agrochemikalieneintrag und die gen, die nicht in jedem Fall eingehalten werden. hierdurch bewirkte rasante Verlandung der Beispielsweise kann ich trotz „ökologischer Bau- Auen-Stillgewässer. begleitung“ über Wochen nicht beseitigte Be- Die im Punkt 2 aufgeführten Hochwasserschutz- triebsstoffrückstände im Boden, weggeworfene maßnahmen des Freistaates werden nach den Markierungssprayflaschen oder das Abstellen Jahrhunderthochwassern 2002 und 2013 von von Technik und Baucontainern innerhalb von den Bewohnern der Muldeaue dringend gefor- gesetzlich geschützten Biotopflächen im NSG dert. Das ist nachvollziehbar und unbestritten. zwischen Eilenburg und Gruna nennen. Sie sind rechtlich als Maßnahmen zu bewerten, bei denen „zwingende Gründe des überwiegen- 4.2 Beeinträchtigungen im Rahmen den öffentlichen Interesses“ (§ 45 BNatSchG) der Tourismus- und Freizeitnutzung vorliegen. Allerdings gibt es auch ein öffentliches In unserer zunehmend technisch geprägten Welt Interesse am Natur- und Artenschutz. Die hier zieht es auch in Sachsen zahlreiche Menschen erforderliche Einzelfallbetrachtung, zumal in in ihrer Freizeit in naturnahe und als schön emp- einem NSG, ist für mich bei den nach 2013 er- fundene Gebiete. Diese weisen einen hohen Er- folgten Deichinstandsetzungen und Ertüchti- holungswert auf, sind aber oft auch Schutz gungen in einigen Abschnitten nicht nachvoll- gebiete verschiedenster Art. Sofern sich Be ziehbar. Im NSG werden unter anderem Hoch- sucher an die „Spielregeln“ (Ge- und Verbote der wasserdeiche, die nur 15 oder 20 Meter vom Schutzgebietsverordnungen) in diesen Gebieten Muldeufer entfernt liegen, mit Spundwänden halten, ist dies eine auch für Naturschützer hin- verstärkt und erhöht. Dies ist Naturschutzzielen zunehmende Nutzung. Gleiches gilt beispiels- abträglich. „Wir müssen den Flüssen mehr Raum weise für das Angeln unter der Voraussetzung, geben“ wird nach dem nächsten Hochwasser dass sich die Angler an die im Prozess der wieder ein Satz sein, den viele Politiker aller Par- Schutzgebietsausweisung politisch ausgehan- teien unisono von sich geben. Den in der EU- delten Festsetzungen (Verfahren Träger öffent- Wasserrahmenrichtlinie geforderten naturnahen licher Belange) halten. Zustand der Flussauen wird man mit diesen Wo übliche Verhaltensregeln oder Festsetzungen Deicherhöhungen nicht erreichen. In Schutzge- zur Nutzungsregelung in Schutzgebieten miss- bieten sollten vorrangig Deichrückverlegungen achtet werden, sollten die zuständigen Ämter angestrebt werden. Dass diese erhebliche Pla- und/oder ehrenamtlichen Mitarbeiter des Natur- nungszeiträume beanspruchen und Konflikte schutzdienstes einschreiten. Hierbei erhalten sie beinhalten (Flächeneigentum), ist jedem Natur- im Regelfall von den Institutionen keine oder nur schützer bewusst. marginale Unterstützung. Die sich durch eine Die geschilderte Rechtslage unterbindet zu den erhöhte Freizeitnutzung ergebenden Probleme beiden vorgenannten Punkten eine Einfluss- sollen bitte „die Naturschützer“ lösen. 8|
Im NSG „Vereinigte Mulde Eilenburg-Bad Düben“ 5 Ausrüstung und mitgeführte Materialien
wurden in den vergangenen Jahren in der Summe Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine auf-
massive Störungen und Beeinträchtigungen gabenangepasste Ausrüstung in Diskussionen
durch Spaziergänger und Hundeführer mit frei mit heute oft sehr selbstsicher von ihren Rechten
laufenden Hunden abseits der Wege, Reiter, überzeugten Bürgern „die halbe Miete“ ist. Wich-
Cross- und Quadfahrer, Angler, durch Lagern, tig sind dabei neben rechtlichen Unterlagen zum
Zelten und Campieren (mit und ohne Lager- Schutzgebiet (Rechtsverordnung, Karte) auch
feuer), Musikbeschallung, Badenutzung, rechts- solche zur Umweltbildung und fachlichen Infor-
widrige Bootsnutzung und das Betreten und mation über das NSG. Ich führe bei meinen Kon-
Befahren von Kieshegern in der Fortpflanzungs- trollen folgende Materialien mit:
zeit geschützter Arten festgestellt. Hierzu ist ❚❚ Schutzgebietsverordnung (auch einzelne ko-
anzumerken, dass bei meinen Kontrollexkursio- pierte Exemplare zur Weitergabe an uninfor-
nen von im Regelfall einem Nachmittag an mierte Flächennutzer oder Bootsfahrer und
Wochenenden sicherlich nur „die Spitze des Naherholer)
Eisberges“ erkannt werden kann. ❚❚ Karte mit den NSG-Grenzen und den Stand-
Folge dieser Verstöße gegen die NSG-Verord- orten aller NSG-Schilder, der naturschutzbe-
nung ist unter anderem, dass auf den Kieshegern hördeninternen Nummerierung der Kiesheger
der Bruterfolg solcher wertgebender Arten wie und -inseln (wichtig für abgestimmte Orts-
Flussregenpfeifer und Flussuferläufer in den angaben) sowie der regionalen Bezeichnung
letzten Jahren gegen Null geht. aller Kleingewässer
Abb. 3: Bei längerzeitlichem Lagern auf Kieshegern haben Bruten von Flussregenpfeifer und Flußuferläufer keine
Chance.
Foto: T. Krönert
|9❚❚ Flyer des NABU-Landesverbandes über die den sind (beispielsweise abgestellte PKW im
Schutzwürdigkeit des NSG und einer Auswahl NSG, an Gehölzen mit durch Weidetiere ver-
der festgesetzten Verhaltensregeln (zur Wei- ursachte Schäden etc.); Inhalt: Hinweis auf
tergabe) das NSG, ausgewählten Ge- und Verbote,
❚❚ Beidseitig bedruckte A4-Seite mit Pressebei- Bitte um zukünftige Unterlassung der Hand-
trägen zum Thema „Schädigung von Boden- lung, eigener Name + Funktion, Telefonnum-
brütern und der Ufer-Wolfsspinne durch mer der UNB für Rückfragen
Betreten von Kieshegern“ (zur Weitergabe) ❚❚ Diktiergerät (Speicherung der Angaben zu
❚❚ Flyer des SMUL zum Thema „Wasserwandern Artnachweisen und Verstößen)
- Sport und Natur im Einklang“ mit Verhal- ❚❚ Stichpunktsammlung: erforderliche Angaben
tensregeln für Schutzgebiete (zur Weiter- zur Aufnahme von Ordnungswidrigkeiten (aus
gabe) F. Meltzer, UNB Kamenz (2003): „Feststellung
❚❚ Kopie der das NSG betreffenden Seiten des und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
aktuellen Wasserwanderatlas (mit Angabe der beim praktischen Flächen- und Artenschutz
Verhaltensregeln, Hinweis auf den gesperrten im Landkreis Kamenz“, aus: „Naturschutzar-
Zeitraum) beit in Sachsen“, 45. Jahrgang (2003), Mit-
❚❚ Bröschüre des aid (Informationsdienst des teilungen 2003, S. 13-14)
Vereins „Verbraucherschutz, Ernährung und ❚❚ Naturschutzdienst-Ausweis
Landwirtschaft e. V.“ Bonn) zum Thema ❚❚ Fotoapparat, Fernglas und die übliche Exkur-
„Richtig verhalten in Feld und Wald“ mit Ver- sionsausrüstung
haltensregeln in Schutzgebieten (zur Weiter-
gabe) 6 Inhalt der Schutzgebietskontrollen
❚❚ Materialsammlung für nicht rechtskonform ❚❚ Registrierung von Verstößen gegen die Ge-
handelnde Angler (zur Weitergabe): und Verbote der NSG-Verordnung, nach Mög-
1. Einem Auszug aus dem Sächsischen lichkeit einschreiten, gegebenenfalls Auf-
Fischereigesetz (§ 10, unter anderem nahme der erforderlichen Daten für ein Ord-
Angeln in Schutzgebieten) nungswidrigkeitsverfahren (entscheidet und
2. Kopie der aktuellen Gewässerordnung führt je nach Schwere die UNB)
und des Gewässerverzeichnisses mit ❚❚ Aufnahme der Daten für Artnachweise ge-
dem Ausschnitt für das NSG (hier sind schützter und von Rote Liste-Arten auf ein
die mit der UNB abgestimmten, für Ang- Diktiergerät (zur späteren Eingabe in den
ler zugelassenen Wege eingetragen) Datenpool „Multibase CS“); Ich hoffe, dass in
3. Auszug aus der NSG-Verordnung: Ge- Sachsen wie in anderen Bundesländern dem
und Verbote für Angler Naturschutzdienst zeitnah Erfassungsgeräte
4. A4-Seite mit Beiträgen aus „Fischer & zur Verfügung gestellt werden.
Angler“ (Verbandszeitschrift des Landes- ❚❚ Kontrolle des Zustandes der Beschilderung
verbandes sächsischer Angler) zum des NSG (Standorte aller Schilder wurden von
Thema „Angeln im Naturschutzgebiet“ der UNB übergeben)
❚❚ Vordruck in wetterfester Folie zur Hinterle- ❚❚ Aufnahme von naturschutzrelevanten Daten
gung/Befestigung vor Ort: Hinweise an nicht zum allgemeinen Zustand des NSG (neue
rechtskonform handelnde Bürger, welche Baumaßnahmen, Nutzungsänderung von Flä-
nicht am Ort des Verstoßes angetroffen wor- chen, Umweltschutzverstöße etc.)
10 |Abb. 4: Die Grundausrüstung für eine NSG-Kontrolle
Foto: T. Krönert
❚❚ Gesprächsführung mit ordnungswidrig han- ❚❚ Für die NSG-Kontrollen sollte man nicht nur
delnden Bürgern das erforderliche rechtliche und fachliche
❚❚ Gesprächsführung mit gesprächsbereiten Wissen zum Schutzgebiet haben, sondern
Flächennutzern; Einem großen Teil der im auch eine entsprechende charakterliche und
NSG wirtschaftenden Landwirte und den letztendlich auch körperliche Eignung auf-
meisten Schäfern bin ich bekannt. Die Schä- weisen. Wichtig ist hierzu, dass der Betreuer
fer und einige Landwirte fragen bei einem sich auch bei aggressiv, überheblich, dema-
Zusammentreffen aus eigener Initiative, ob gogisch oder anderweitig unkooperativ auf-
es Probleme auf ihren Flächen gibt oder stel- tretenden Personen nicht aus der Ruhe brin-
len Fragen zur Bewirtschaftung, zum Arten- gen lässt. Auch die Gefahr einer verbalen (in
schutz etc. meiner Praxis bisher viermal) oder gar kör-
perlichen Bedrohung ist nicht grundsätzlich
7 Erfahrungswerte aus der Praxis auszuschließen. Hierzu gibt mir eine langjäh-
❚❚ Meine NSG-Kontrollen führe ich mit dem rige militärische Ausbildung eine gewisse
Fahrrad durch. Hierdurch muss ich im Ver- Selbstsicherheit.
gleich mit einem PKW keine Rücksicht auf ❚❚ Letztendlich muss der Schutzgebietsbetreuer
schlecht befahrbare Wege nehmen und spare die Überwindung aufbringen, bei einem
mir sehr viel Bürokratie für die Beantragung Rechtsverstoß festgestellte Bürger anzuspre-
und Abrechnung von Fahr-km bei der UNB. chen. Bei den Kontrollen sollte man sich aber
| 11Abb. 5: Für die Kiesheger des NGSs ist ein Betretungsverbot festgesetzt. Foto: T. Krönert nicht selbst in Gefahr bringen. Möglich ist das es seit Jahrhunderten in der Muldeaue und zum Beispiel bei angetrunkenen Personen die geschützten Arten haben überlebt“ dis- oder größeren Personengruppen beispiels- kutiert werden. weise zum „Männertag“ oder Pfingsten. Hier- ❚❚ Für Schutzgebiete, die durch Tourismus- und bei habe ich innerlich immer den Konflikt mit Freizeitnutzung beeinträchtigt werden, ist es mir auszufechten, meiner Aufgabe nachzu- vorteilhaft, wenn Feiertagsperioden verreg- kommen oder hinzunehmen, dass wieder net sind. Ist das Wetter allerdings schön, einmal die Bruten des Flussregenpfeifers auf „brennt auch in meinem Betreuungs-NSG die einem Kiesheger zertreten oder aufgegeben Hütte“. Es gibt dann einen hohen Betreuungs- werden. Als Vorschlag für andere NSG möchte bedarf und zum Beispiel um die Gaststätte ich nennen, gegebenenfalls mit zwei Perso- „Fährhaus Gruna“ sowie durch die Zahl der nen zu handeln. Dies ist auch die übliche Boote auf der Mulde sind Ansätze von Mas- Verfahrensweise bei den sächsischen Fische- sentourismus feststellbar. reiaufsehern. ❚❚ Eine wertvolle Hilfe waren und sind für mich ❚❚ Regelmäßig sind Diskussionen mit den Schä- die Weiterbildungsveranstaltungen der Säch- fern zu führen. Einzelne missachten das Ver- sischen Landesstiftung Natur und Umwelt, bot, Uferbereiche zu schädigen und das unter anderem zum Thema „Gesprächsführung Gebot, dass Uferbereiche nicht durch Nutz- und Konfliktmanagement im Naturschutz“. tiere betreten werden dürfen. Hierzu gibt es Insbesondere die Veranstaltungen zur Rechts- zum Beispiel unterschiedliche Auffassungen schulung waren für mich in besonderer Weise zum Begriff der „Schädigung“. Und wieder- geeignet. Bei der Ansprache von Personen im holt muss zur Argumentation „Schäfer gibt NSG gehe ich deshalb immer vom Fall „alles 12 |
Abb. 6: Im NSG darf geangelt, aber die Kiesheger dürfen nicht betreten oder befahren werden!
Foto: T. Krönert
nicht gewusst“ aus und versuche, das Ge- Argumentation, die Abdeckung der Schilder
spräch diplomatisch zu führen. Am Schluss wurde danach aber sofort beendet.
sollte aber eine klare Ansage stehen, welche ❚❚ Seit 2017 hat sich in der Zusammenarbeit mit
Handlungsweise man von der Person in Zu- den Angelvereinen eine neue Stufe der Zu-
kunft erwartet. sammenarbeit entwickelt. Ich wurde zu den
❚❚ In den ersten 15 Jahren des NSG gab es zahl- Fischereiaufsehern eingeladen, habe diese
reiche Rechtsverstöße durch Angler. Nach zum Thema „Angeln im NSG“ informiert und
mehreren Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde Material hierzu übergeben. Bisher wurden
bekannt, dass im NSG Naturschutzkontrollen zwei gemeinsame Kontrollen im NSG durch-
durchgeführt werden. Ein wichtiges Beweis- geführt, für 2018 sind weitere geplant. Posi-
mittel waren hierzu die notierten und foto- tiv möchte ich an dieser Stelle auch mehrere
grafierten Kfz-Kennzeichen. Einzelne Angler Beiträge zum Thema „Angeln im NSG Verei-
zogen daraus nicht den Schluss, die rechts- nigte Mulde …“ des Präsidenten des Landes-
widrigen Handlungen einzustellen, sondern verbandes sächsischer Angler in der Ver-
die Kennzeichen im NSG abzudecken. Hierzu bandszeitschrift hervorheben. Diese Beiträge
fragte ich bei der UNB nach. Diese antwortete übergebe ich als Kopie den Anglern, die bei
mir, ich soll in solchen Fällen die Polizei rufen, Ordnungswidrigkeiten angetroffen werden.
da nicht auszuschließen ist, dass mit den ❚❚ Sehr ernüchternd war für mich ein Fachzeit-
Fahrzeugen kriminelle Handlungen begangen schriftenbeitrag aus der „Natur in NRW“
worden sind oder diese gestohlen sind. Dies 4/2015 (Naturschutzgebiete ohne Beschützer
teilte ich vor Ort den betroffenen Anglern – Rücksichtsloses Besucherverhalten – (k)ein
mit. Es folgte die übliche Pro und Kontra- Anlass zum Handeln?) In dem Beitrag ging es
| 13um ein Gerichtsverfahren gegen eine Person, Bootssaison, das ergänzende Schild nach zwei
die gegen die Verwendung von Fotos im Rah- Jahren angebracht. Die Erläuterungstafel ist sehr
men einer Naturschutzanzeige klagte. Das umfangreich (positiv), örtlich aber aufgrund von
Amtsgericht Bonn gab dem Beklagten Recht Hochwasserschutzforderungen so unglücklich
und wertete das Recht am eigenen Bild höher platziert, dass sie nur wenige Bootsfahrer lesen
als das Interesse der Allgemeinheit an der (eigene mehrmalige Feststellung).
Verfolgung von Naturschutzverstößen. Für Die Hoffnung auf weniger Verstöße hat sich nach
mich ein weiteres Beispiel, wie lebensfremd meinen Feststellungen nicht erfüllt. Konkret ist
Gerichte in Deutschland entscheiden können. die Zahl des Betretens, des Lagerns und des An-
❚❚ Sehr positiv hat sich auf meine Tätigkeit die legens von Lagerfeuern auf den Kieshegern nicht
Ausgabe der Bekleidungskennzeichen für den zurückgegangen, möglicherweise sogar gestie-
Naturschutzdienst vor etwa drei Jahren aus- gen. Dies sehe ich für ein Vogelschutzgebiet mit
gewirkt. Vor dieser Zeit hatte ich mehrfach einem von der EU vorgegebenen Verschlechte-
Nachfragen zu meiner Funktion und ihren rungsverbot als problematisch an.
Rechten. Dies war nach 2015 nicht mehr der Eine flächendeckende Übersicht, wer welche Flä-
Fall. che bewirtschaftet, habe ich nicht. Dies ist wohl
❚❚ Zu jeder Betreuungsexkursion sollte schrift- aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mög-
lich ein kurzer Nachweis mit den Verstößen, lich. Das erschwert und verzögert aber den Na-
Artnachweisen und Informationen zum NSG turschutzvollzug, da ich ansonsten auch „über
(fehlende Schilder etc.) angefertigt werden. den kurzen Dienstweg“ mit dem Landwirt spre-
Dieser ist unter anderem wichtig, um über das chen könnte. Nicht jeder Landwirt lehnt solche
NSG belehrte Wiederholungstäter feststellen Gespräche grundsätzlich ab. So muss ich Prob-
zu können. Diese Aufzeichnungen helfen leme der UNB melden, welche dadurch über die
auch, die Berichtspflicht gegenüber der UNB Vielzahl ihrer Pflichtaufgaben hinaus mit zusätz-
zu erfüllen. lichen Aufgaben belastet wird. Wenn die UNB
eine Reaktion als notwendig erachtet und ein
Bisher ungelöste Probleme Schreiben hierzu erarbeitet und sendet, vermu-
Im Jahr 2015 wurde am Südeingang des NSG ein ten dann die meisten Landwirte eine „Anzeige
Bootsanleger in Betrieb genommen. Hierdurch vom Krönert“. Das ist dem Aufbau einer langfris-
gelingt es nun auch relativ ungeübten Personen tigen guten Zusammenarbeit nicht förderlich.
und ganzen Familien, Boote gefahrlos in die Allerdings ist mir auch bewusst, dass ich keine
Mulde einzusetzen. Eine Steigerung des Boots- Vollzugsbehörde bin. Und bei einzelnen Landwir-
verkehrs auf der Mulde war nach Inbetriebnahme ten hilft nur ein Behördenschreiben, um ihre
dieses Bauwerks zu erwarten. Handlungsweise zu ändern.
Die Genehmigung der Naturschutzbehörde war Ich melde seit mehreren Jahren der UNB mit
mit der Hoffnung verbunden, dass durch eine konkreten Standortangaben, dass circa 90 Pro-
großformatige Erläuterungstafel und ein ergän- zent der ursprünglichen NSG-Schilder nicht mehr
zendes Schild mit Ge- und Verboten die Boots- vorhanden sind. Die meisten Personen, die ich
nutzer besser über die Prämissen der Befahrung aufgrund von Verstößen im NSG ansprechen
der Mulde im NSG informiert werden und sich muss, antworten mir, dass sie nicht wüssten, sich
somit die Zahl der Verstöße verringert. Die Erläu- in einem NSG zu befinden. Dieser Zustand ist
terungstafel wurde am letzten Tag (!) der ersten dem Naturschutzvollzug abträglich.
14 |§ 2 (2) BNatSchG fordert: „Die Behörden des Literatur
Bundes und der Länder haben im Rahmen ihrer
Zuständigkeit die Verwirklichung der Ziele des G asche , J. (1997): Handbuch für Schutzgebietsbetreuer.
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu Bundesverband Naturwacht e.V. (Hrsg.), Spreewiese.
unterstützen“. In „meinem“ betreuten NSG sind L ippert, A. (2000): Der Naturschutzhelfer. Deutscher
vorrangig Naturschutzverstöße im Rahmen der Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-
und Umweltschutzverbände (DNR) (Hrsg.), Bonn.
Tourismus- und Freizeitnutzung feststellbar. In
der Studie „Tourismusstrategie Sachsen 2020“
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt- Quellen und Rechtsgrundlagen
schaft, Arbeit und Verkehr (SMWA 2012) taucht
auf 54 Seiten das Wort „Naturschutz“ kein ein- BN at S ch G (2015): Gesetz über Naturschutz und
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der
ziges Mal auf. Ich kann daraus nur die Schluss- Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl.
folgerung ziehen, dass für das SMWA Natur- I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
schutz kein bei der Tourismusentwicklung zu Gesetzes vom 15. Sept. 2017 (BGBl. S. 3434), in der
aktuellen Fassung.
berücksichtigender Faktor ist. Dies ist bedauer-
lich. Im Werk „Nachhaltigkeit im Deutschland- H aupt, H. (2015): Naturschutzgebiete ohne Beschützer
– Rücksichtsloses Besucherverhalten – (k)ein Anlaß
tourismus-Anforderungen-Empfehlungen-Um- zum Handeln? Landesamt für Natur, Umwelt und
setzungshilfen“ des Deutschen Tourismusver- Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Natur in NRW
bandes (D eutscher Tourismusverband e . V. 2016) 4/2015, S. 37-41.
erscheint der Begriff Naturschutz 56 mal. S ächsN at S ch G (2015): Sächsisches Naturschutzgesetz
Durch eine ehrenamtliche NSG-Betreuung kann, vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), geändert durch
Artikel 25 des Gesetzes vom 29. April 2015 (SächsGVBl.
insbesondere auch in großflächigen Schutzge- S. 349), in der aktuellen Fassung.
bieten, nur die „Spitze des Eisberges“ der Zahl
SMWA – S ächsisches Staatsministerium für Wirtschaft,
und Schwere aller Rechtsverstöße festgestellt A rbeit und Verkehr (2012) (Hrsg): Tourismusstrategie
werden. Hierbei ist selbstverständlich, dass Ord- Sachsen 2020“, Dresden.
nungswidrigkeiten niemals vollständig verhin- D eutscher Tourismusverband e . V. (Hrsg.) (2016):
dert werden können. Sollte in Sachsen ein kon- Praxisleitfaden Nachhaltigkeit im Deutschlandtouris-
mus - Anforderungen-Empfehlungen-Umsetzungshil-
sequenter Naturschutzvollzug gewollt sein, ist
fen, Berlin.
es aus meiner Sicht erforderlich, in allen Land-
kreisen ohne Naturschutzwarte (§ 43 (5) Sächs-
NatSchG) zumindest eine Planstelle, besser zwei, Autor:
hierfür zu schaffen. Als Vorteil für die bereits in Thomas Krönert
der Praxis überlasteten unteren Naturschutzbe- An der Heide 9
hörden würde sich ergeben, dass sie bei der Be- 04838 Eilenburg,
arbeitung von Ordnungswidrigkeiten entlastet kroenert.leipzig@naturschutzinstitut.de.
werden könnten.
| 15„Naturschutzarbeit in Sachsen“, 59. Jahrgang 2017 Seite 16 – 31
Landschaftspflege durch extensive
Rinderbeweidung – ein gemeinsames Projekt
von Landwirtschaft und Naturschutz in Sachsen
Eckhard Jedicke, Heike Weidt, Jörg Döring
1 Einleitung
Früher landläufige Normalität im Landschafts- knüpft die Beweidung an eine lange Tradition
bild, fallen heute in Sachsen nur noch selten der Urlandschaft an.
grasende Rinder- und Schafherden ins Auge. ❚❚ Weidetiere bewirken einen „lebenden Biotop-
Direkt nach der politischen Wende sind die Be- verbund“, indem sie als „Taxi“ für die Ausbrei-
stände der Raufutterfresser drastisch zurückge- tung von Pflanzensamen und Tieren sorgen.
gangen. Noch stärker wirkt aber ein Wandel der Sie produzieren mit ihrem Dung, Trittwirkun-
modernen Tierhaltung: Aus betriebsökonomi- gen (insbesondere Viehpfaden) und selekti-
schen Gründen bleiben die Rinder heute über- vem Fraß Strukturvielfalt und Nahrung für
wiegend ganzjährig im Stall. In der sächsischen spezialisierte Pflanzen- und Tierarten.
Rinderhaltung zählen moderne Mastanlagen und ❚❚ Grünland leistet wirkungsvolle Beiträge zum
teils geschlossene klimatisierte Milchviehställe Erosionsschutz, fördert die Qualität von
bereits zum Standard. Dabei wird ein Großteil Oberflächen- und Grundwasser und speichert
der Nahrung für die Tiere als sogenanntes Feld- Kohlenstoff.
futter auf dem Acker und nicht mehr auf dem Für die Landwirtschaft selbst ist die intensive
Grünland erzeugt. Eine wichtige Rolle spielt der Produktionsweise teilweise kritisch zu sehen.
Mais in Form von Silomais. Grünland hat als Fut- Die Milchkrise und offenbar werdende Probleme
tergrundlage an Bedeutung verloren. Lediglich bei der Tiergesundheit können als sichtbare
Vielschnittsilagen in Gunstlagen können heute Symptome dafür gelten.
noch die Ansprüche der meisten tierhaltenden
Landwirtschaftsbetriebe an die Energiedichte
des Futters erfüllen.
Aus Sicht des Naturschutzes hat das gravierende
Folgen, indem grundlegende Funktionen der
Grünlandnutzung wegbrechen: Abb. 1: Beweidete Steinrücken-Landschaft im
Naturschutzgroßprojekt „Bergwiesen im Osterz
❚❚ Grünlandbiotope sind durch Beweidung und/ gebirge“, genutzt durch einen der Modellbetriebe
oder Mahd entstanden und erfordern zu ihrer Foto: Archiv Naturschutz LfULG, E. Jedicke
Erhaltung die Fortführung dieser Nutzungen.
Während reine Mähwiesen erst seit rund 200 Abb. 2: Teil einer Limousin-Herde
im elbnahen Grünland des Lehr- und
Jahren (kombinierte Mähweide-Typen seit Versuchguts Köllitsch
1400 Jahren) verbreitet sind (K apfer 2010), Foto: Archiv Naturschutz LfULG, E. Jedicke
16 || 17
Tab. 1: FFH-Arten der Grünland-Habitatkomplexe (nach Angaben von Hettwer et al. 2015)
FFH-Art FV U1 U2 XX Trend
Arnika (Arnica montana) U2 –
Abbiss-Scheckenfalter (Euphydryas aurinia) U2 –
Zauneidechse (Lacerta agilis) U1 +/–
Großer Feuerfalter (Lycaena dispar) FV +
Dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) U1 –
Heller Wiesenknopf Ameisenbläuling (Maculinea teleius) U2 –
Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) FV x
2 Die Situation des Grünlands in Sachsen Unter den sieben FFH-Arten der Grünland-Ha-
aus Sicht des Naturschutzes bitatkomplexe (Tab. 1) ist der Erhaltungszustand
Wie in vielen Regionen Europas und Deutsch- für zwei als „unzureichend“ (U1) und drei als
lands steht auch in Sachsen die Biodiversität in „schlecht“ (U2) bewertet, nur bei zwei Arten als
Agrarlandschaften unter besonders starkem „günstig“(FV) (Bewertung gemäß EEA (2015) in
Druck: Nahezu alle Indikatoren zeigen eine an- Hettwer et al. 2015, S. 13f). Für die im besonderen
haltend negative Entwicklung. So belegt die Fokus des Naturschutzes stehenden Lebens-
aktuelle Rote Liste gefährdeter Biotoptypen raumtypen (LRT) der FFH-Richtlinie sind deutli-
Deutschlands weitere (vor allem qualitative) che Verschlechterungen des Erhaltungszustands
Verschlechterungen der Situation für viele Grün- festzustellen. Für den Freistaat Sachsen weisen
landbiotope, die von einer extensiven landwirt- Hettwer et al. (2015, S. 15) explizit darauf hin,
schaftlichen Nutzung abhängen. dass die Verhältnisse im Grünland besonders
günstig (FV) 4
unzureichend, ungünstig (U1) 10
unzureichend, schlecht (U2) 3
sich verbessernd (+) 1
stabil (+/-) 4
negativ (-) 12
Abb. 3: Einschätzung des Erhaltungszustands (oben) und des Trends der Gesamtbewertung (unten) für die 18 FFH-
Grünland-Lebensraumtypen in Sachsen (Zahlen aus Hettwer et al. 2015).
18 |Tab. 2: Mäh- und/oder beweidbare FFH-LRT und ihr Erhaltungszustand in Sachsen
(zusammengestellt nach Angaben von Hettwer et al. 2015, LRT-Auswahl nach Ssymank et al.
in Bunzel-Drüke et al. 2015).
FFH-LRT FV U1 U2 XX Trend
2310 Binnendünen mit Sandheiden FV –
2330 Binnendünen mit offenen Grasflächen U1 –
4010 Feuchte Heiden U2 –
4030 Trockene Heiden U1 +/–
5130 Wacholder-Heiden FV +/–
6110* Basophile Pionierrasen U1 –
6130 Schwermetallrasen U1 –
6210 Kalktrockenrasen (* orchideenreiche Bestände) U1 –
6230* Artenreiche Borstgrasrasen U1 –
6240 Steppen-Trockenrasen U1 –
6410 Pfeifengraswiesen U1 –
6430 Feuchte Hochstaudenfluren XX x
6440 Brenndolden-Auenwiesen U1 +/–
6510 Flachland-Mähwiesen FV –
6520 Berg-Mähwiesen FV –
7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore U1 –
7210* Kalkreiche Sümpfe U2 +/–
7230 Kalkreiche Niedermoore U2 +/–
Legende für Tab. 1 und 2
Erhaltungszustand
FV günstig U1 unzureichend, ungünstig U2 Unzureichend, schlecht XX unbekannt
Trend Gesamtbewertung
+ sich verbessernd, +/- stabil, - negativ, x unbekannt, nicht einschätzbar
kritisch sind. Fasst man die dortigen Einstufun- negativen Trend auf, vier gelten als stabil und
gen für Grünland-LRT in weiterem Sinne (durch nur einer verbessert sich (Tab. 2, Abb. 3).
Mahd und/oder Beweidung nutzbar) im Jahr
2013 zusammen, so sind von 18 LRT lediglich vier 3 Das Forschungs- und Entwicklungs
in einem Erhaltungszustand, der als „günstig“ projekt „Landschaftspflege
bewertet wird, jedoch ist mit zehn die überwie- durch extensive Rinderbeweidung“
gende Zahl als „unzureichend, ungünstig“ und Eine an die natürlichen Standortbedingungen
drei als „unzureichend, schlecht“ (für einen un- angepasste Grünlandbeweidung ist ein unver-
bekannt) eingestuft. Zwölf LRT weisen einen zichtbares Instrument zur Erfüllung der Ziele des
| 19Naturschutzes in Agrarlandschaften und einer eine Projekt begleitende Arbeitsgruppe (PAG) aus nachhaltigen artgerechten Nutztierhaltung. Mitarbeitern der Abteilungen Naturschutz, Land- Daher haben die Abteilung Naturschutz, Land- schaftspflege (Abt. 6), Landwirtschaft (Abt. 7) schaftspflege und die Abteilung Landwirtschaft und Grundsatzangelegenheiten der Umwelt, im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Land- Landwirtschaft, Ländliche Entwicklung (Abt. 2) wirtschaft und Geologie (LfULG) gemeinsam ein des LfULG. In jährlich mindestens zwei Treffen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben initiiert. wird in der PAG über den Sachstand des Projek- Es soll ermitteln, wie eine naturschutz- und um- tes diskutiert sowie über die jeweils nächsten weltgerechte Rinderbeweidung betriebsökono- Meilensteine beraten. Durch ein ökonomisches misch nachhaltig erfolgreich praktiziert werden und naturschutzfachliches Monitoring sollen die kann. Um das Projekt so praxisnah wie möglich Fortschritte während der Laufzeit des Projektes zu gestalten, wurden für das Vorhaben in aus der beobachtet werden. Mit der Entwicklung zu- Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege kunftsweisender Beweidungsmodelle und öko- bedeutsamen Grünlandgebieten, über alle rele- nomisch erfolgreicher Vermarktungsstrategien vanten Regionen Sachsens verteilt, Rinder hal- ist die Hoffnung verbunden, dass künftig wieder tende Modellbetriebe gewonnen. mehr Rinderherden in sächsischen Grünland- Ein zentrales Anliegen des Projektes ist die Erpro- regionen zu sehen sein werden. bung extensiver Nutzungs- und Beweidungs- modelle in Sachsen zur Klärung folgender Fragen: 4 Struktur des Projektes ❚❚ Welchen Beitrag können diese Nutzungs- und und Vorgehensweise Beweidungsmodelle zur Erhaltung und natur- Das Vorhaben ist thematisch breit angelegt, denn schutzfachlichen Verbesserung zusammen- daran knüpfen Landwirtschaft und Naturschutz hängender Grünlandkomplexe leisten? verschiedene Erwartungen: ❚❚ Sind diese Nutzungs- und Beweidungsmo- Das Verständnis zwischen den Hauptakteuren in delle für Rinder haltende Betriebe praktikabel Landwirtschaft und Naturschutz soll gefördert, und ökonomisch tragfähig? der Wissens- und Erfahrungsaustausch erhöht, ❚❚ Wie müssen ggf. die Rahmenbedingungen die Grünlandnutzung stärker schutzwirksam und gestaltet werden, damit eine Verwertung der flexibler gestaltet, der wirtschaftliche Erfolg ver- aufgewachsenen Biomasse auf diesen Flä- bessert und so eine langfristige Aufrechterhal- chen mittels Raufutterfressern für die Land- tung einer naturschutzfachlich wie betriebsöko- wirtschaftsbetriebe attraktiv ist? nomisch optimierten Nutzung gewährleistet ❚❚ Können die aus der extensiven Rinderbewei- werden. dung erzeugten Produktmengen und -quali- Das entwickelte Modell der praxisnahen Weide- täten gewinnbringend vermarktet werden? konzepte – später zu integrieren in den „Be- ❚❚ Sind die Modelle und Ergebnisse zur Integra- triebsplan Natur“ (siehe S chneier 2014) – soll es tion von Naturschutzzielen in Betriebsabläufe den Betrieben ermöglichen, die fachlichen An- auf andere Betriebe übertragbar? forderungen des Naturschutzes adäquat zu Die Durchführung des Vorhabens erfolgt in vier Projektphasen und mit einer Gesamt-Laufzeit von 2013 bis 2021. Unterstützt wird der Auftrag- nehmer Prof. Jedicke in Kooperation mit dem Abb. 4: Hereford-Rinder in Klitten Landschaftspflegeverband Nordsachsen durch Foto: Archiv Naturschutz LfULG, J. Döring 20 |
| 21
Modellbetriebe im Überblick
5 1
8
3/2
9
7
6 4
10
Karte: Von U
http://www.
free.com, CC
https://comm
g/w/index.ph
Abb. 5: Lage der zehn ausgewählten Modellbetriebe in Sachsen. Kartengrundlage: von Ulamm – http://www.maps-
FuE‐Vorhaben „Landschaftspflege durch extensive Beweidung“| Erfahrungsaustausch der Modellbetriebe,
for-free.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3567818). Ziffern s. Tab. 3.
berücksichtigen und zugleich größtmögliche Frei- 4.1 Arbeit mit den Modellbetrieben
heiten bei der jährlich oft witterungsbedingt 2013 bis 2015 wurden zunächst für vier Betriebe
abzuwandelnden Umsetzung zu schaffen. Grund- in drei ausgewählten Grünlandgebieten Sachsens
bedingung ist, dass die Weideplanung so flexibel extensive Nutzungs- und Beweidungssysteme
ist, dass eine ganzjährige Futterverfügbarkeit (Weidekonzepte) mit Raufutterfressern entwi-
besteht, um vielfach bestehende starke jahrweise ckelt und etabliert. Je drei weitere Betriebe
Ertragsschwankungen abpuffern zu können. kamen 2016 und 2017 hinzu, sodass jetzt ein
Durch begleitende Öffentlichkeitsarbeit soll die Netz von zehn Modellbetrieben über ganz Sach-
Beweidung ein positives Image erhalten. sen verteilt besteht (Abb. 5).
Darüber hinaus sollen die in der Praxis gewon- Diese zehn ausgewählten Modellbetriebe bilden
nenen Erfahrungen dazu beitragen, künftig die einen Querschnitt der Rinder haltenden Haupt
Förderpolitik des Freistaats effektiver (und prak- erwerbsbetriebe in Sachsen. Alle Unternehmen
tikabler) auszugestalten. sind in unterschiedlichem Maße mit Aspekten
22 |des Natur- und Gewässerschutzes (Flächen in zum Einsatz (Tab. 3). Eine Besonderheit ist dabei
diversen Schutzgebieten) oder sehr spezifischen die Rasse Rotes Höhenvieh, eine gefährdete
Nutzungsbedingungen (zum Beispiel Grundwas- Nutztierrasse. Typische Landschaftspflegerassen
seranstieg) ihres Grünlandes konfrontiert. Allen (Galloway und Schottisches Hochlandrind) be-
gemein ist, dass sie ein besonderes Interesse an sitzt aktuell kein Betrieb.
Naturschutz und Landschaftspflege besitzen. Bei Die Spanne des Grünlandflächenanteils der be-
zwei Betrieben handelt es sich um Ökobetriebe, teiligten Betriebe liegt zwischen circa 140 und
ein Betrieb bewirtschaftet viele Flächen in einem 1.200 Hektar, wobei die Betriebe (noch) nicht
Naturschutzgroßprojekt, ein anderer in einem immer ihre gesamte Grünlandfläche in das Pro-
Gewässereinzugsgebiet mit den letzten sächsi- jekt eingebracht haben. Der maximale in das
schen Vorkommen der vom Aussterben bedroh- Vorhaben integrierte Grünlandflächenumfang
ten Flussperlmuschel. Zwei Betriebe nutzen eines Betriebes beträgt rund 430 Hektar. Durch
Flächen im Bereich des Biosphärenreservates die beteiligten Betriebe sind naturräumlich alle
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft und wichtigen Grünlandgebiete Sachsens im Projekt
arbeiten eng mit dessen Verwaltung zusammen. vertreten. Dazu zählen insbesondere die Auen
In den meisten Betrieben kommen die klassi- der großen Flüsse (Elbe, Mulde) und größere
schen Fleischrind- oder Zweinutzungsrassen Grünlandkomplexe des sächsischen Berglandes
Tab. 3: Charakterisierung der beratenen Betriebe, MK = Mutterkühe
Nr. Betrieb Grünland Rasse(n) Herden, Tierzahl
im Projekt
1 LVG Köllitsch, Arzberg 140 ha Limousin, Angus, Fleckvieh 3 Herden mit je ca. 30 MK
2 AG Klitten 340 ha Hereford 4 Herden mit ca. 100 MK, Herde
Jungbullen
3 Agrarproduktion & 155 ha Angus, Rotes Höhenvieh Höhenvieh 10 MK plus
Landschaftsgestaltung Mönau Nachzucht, Angus 24 MK inkl.
Uhyst e.G. Nachzucht plus 155 Mäster
4 Versuchsgut Börnchen GmbH 430 ha Fleckvieh 6 Herden mit insgesamt 250 MK
5 AG Hohenprießnitz e.G., 167 ha Fleckvieh-Limousin-Kreuzung, 30 MK, 30 Färsen
Zschepplin-Hohenprießnitz Färsen von Schwarzbunt-
Milchkühen
6 AG „Burgberg“ e.G., Frauenstein 130 ha Limousin, Charolais, Färsen 4 Herden mit 60 MK,
OT Burkersdorf Schwarzbunt 1 Herde mit 40 Färsen
7 Gutsverwaltung Schönfelder 290 ha Limousin in Kreuzungen 15 Herden mit 260 MK plus
Hochland – Weiderinder GmbH, Nachzucht
Dresden
8 Wassergut Canitz GmbH, 108 ha Charolais in Kreuzungen 2 Herden mit ca. 85 MK plus
Thallwitz Nachzucht
9 KÖG Kleinbardau 90 ha Fleckvieh, Limousin, Charolais 150 MK in 7 Herden
Landwirtschafts GmbH, Grimma
10 Hofgut Eichigt, Eichigt/ ca. 200 ha Holstein-Friesian, Charolais ca. 350 Färsen, 200 Jungrinder,
Vogtland 15 MK
| 23Mahd
Weide
Abb. 6: Beispiel einer Karte für den zweiten Auftrieb auf einer Nutzungseinheit aus dem Weidekonzept für das Lehr-
und Versuchsgut Köllitsch.
(Osterzgebirge). Ebenfalls im Projekt gut reprä- abgefragt und durch Begehungen vor Ort abge-
sentiert sind die wesentlichen, für Sachsen ty- glichen. Wo es Konflikte geben könnte, werden
pischen Grünlandbiotope (artenreiches Grünland Abstimmungsgespräche durchgeführt. Sowohl
frischer bis feuchter Standorte, unter anderem den Betrieben als auch der zuständigen unteren
Flachland-Mähwiesen und Bergwiesen, artenrei- Naturschutzbehörde und in der Projektbegleiten-
che Feuchtwiesen sowie Borstgrasrasen). den Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Landwirt-
schaft und Naturschutz werden die Entwürfe der
4.2 Die Weidekonzepte Weidekonzepte vorgelegt und Änderungswün-
Die betriebsspezifischen Weidekonzepte sind ein sche nach Möglichkeit berücksichtigt.
zentrales Element im Projekt. Sie beinhalten einen In den Folgejahren sind jährlich ein bis zwei Be-
kurz gefassten Text zu Grundlagen, betrieblichen triebsbesuche geplant, um die Passgenauigkeit
und naturschutzfachlichen Vorgaben, eine Ziel- und Umsetzung der Weidekonzepte zu überprü-
definition des Konzepts sowie Berechnungen für fen, mit Betriebsleitern und Herdenmanagern die
die Besatzstärke und Karten (Auszug Weideplan Erfahrungen zu diskutieren, ihnen bei Bedarf
Karte siehe Abb. 6) zur Weideführung. Dazu wer- Beratungen anzubieten und nötigenfalls die Kon-
den sowohl die betrieblichen Daten und Wünsche, zepte anzupassen. Hier werden auch möglicher-
als auch durch Kontakte zu den Behörden, die weise bestehende Konflikte gelöst. Die Weide-
naturschutzfachlichen Bedingungen und Ziele flächen werden begangen und mit den Herden-
24 |managern optisch festgestellte Erfolge und Weiterhin wurde im Entwurf eine Checkliste kon-
Defizite besprochen. Weiter werden Aspekte der zipiert, die Naturschutzbehörden und Verbänden
Vermarktungsförderung in die Beratung einge- helfen soll, mögliche Weideflächen hinsichtlich
bracht, vor allem unter Verweis auf die Natur- der Beweidbarkeit im konkreten Fall unter natur-
schutz-Wirksamkeit der Weideprojekte. schutzfachlichen Aspekten zu beurteilen und
Die entwickelte und erprobte Methode soll künf- Fragen im Dialog mit Dritten rasch und wirksam
tig in die Erarbeitung des „Betriebsplans Natur“ zu klären. Auch sie soll im Web zugänglich sein.
(S chneier 2014) integriert werden. Hierfür wird Anliegen und erste Ergebnisse des Projektes wur-
ein Vorschlag erarbeitet. den bei verschiedenen Veranstaltungen vorge-
stellt und diskutiert.
4.3 Monitoring In den kommenden Jahren sind weitere Termine
Nach gemeinsamer Aufstellung der Weidekon- geplant, um insbesondere Landwirtschaftsbe-
zepte in allen zehn Betrieben werden die darin triebe über aktuelle Erkenntnisse zu informieren,
vorgeschlagenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer aber auch um Anregungen aus der Praxis in das
Wirkung auf ökologische und landschaftspflege- Projekt aufzunehmen.
rische Ziele sowie in Hinblick auf betriebsstruk- Aus projektinternen Diskussionen und Erfahrun-
turelle Umsetzbarkeit und ökonomische Tragfä- gen aus der Praxis hat sich herauskristallisiert,
higkeit untersucht, die wichtig für ihre Akzeptanz dass es im Bereich der Tierhaltung zunehmend
in den Betrieben sind. Ein einfaches naturschutz- an praktischem Erfahrungswissen fehlt. Daher
fachliches und ein betriebswirtschaftliches Mo- sollen im Projekt gewonnene Informationen
nitoringkonzept wurden dazu entwickelt. Ersteres künftig im LfULG für die Aus- beziehungsweise
wird nach Vorauswahl geeigneter Untersu- Fortbildung von „Weidespezialisten“ in der Land-
chungsflächen ab 2017/18 umgesetzt. Seit 2016 wirtschaft genutzt werden, um Landwirte zu
werden in Zusammenarbeit mit dem LfULG (Be- qualifizieren.
triebs-, Umweltökonomie) ökonomische Daten in
den Modellbetrieben erhoben, um die Auswirkun- 5 Vorschläge zur Förderpolitik
gen auf die Betriebe zu analysieren und Empfeh- Die konkreten Erfahrungen aus den Modellbe-
lungen hieraus abzuleiten. trieben und weitere im Projekt gewonnenen
Ergebnisse dienen vor dem Hintergrund anste-
4.4 Öffentlichkeitsarbeit, hender Fortentwicklungen der Förderprogramme
Aus- und Fortbildung als eine wertvolle Informationsquelle, um Defi-
Als Hilfestellung für die Beratungen, insbeson- zite in (Teilen) der spezifischen Förderpolitik zu
dere zur späteren Verstetigung, wurde ein Leit- beschreiben und Vorschläge für die künftige
faden für Rinderhalter unter dem Titel „Land- Ausrichtung zu entwickeln. Erste Hinweise aus
schaftspflege mit Rindern“ entwickelt, mit den dem Projekt heraus wurden bereits vorgelegt und
Modellbetrieben abgestimmt und in der Bera- fließen in die fortlaufende Diskussion um die
tung erprobt. Er ist als fortschreibbares Doku- Programmentwicklung ein.
ment zusammen mit einer kurzgefassten Check-
liste auf den Internetseiten des LfULG veröffent- 6 Erste Ergebnisse
licht. (https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/ Anhand der zunächst vier Modellbetriebe konnte
download/Leitfaden_Landschaftspflege_mit_ gezeigt werden, dass eine gezielte Beratung und
Rindern.pdf) die kooperative Erarbeitung von Weideplänen
| 25sowohl naturschutzfachliche als auch gewisse führen. Die meisten Flächen befinden sich aus
wirtschaftliche Verbesserungen erreichen kann. naturschutzfachlicher Sicht nach persönlicher
Die Betriebsleiter und Herdenmanager zeigten Inaugenscheinnahme primär anhand des Vor-
sich in vielen direkten Kontakten und bei einem kommens von Pflanzenarten in einem guten
gemeinsamen Austausch der mittlerweile zehn Zustand, teilweise wird anhand des Vorkommens
Modellbetriebe im März 2017 sehr zufrieden mit seltener oder zumindest nicht ubiquitärer Kräu-
der besonders praxisorientierten Beratung und ter auch eine positive Entwicklung deutlich. Das
wünschen ausdrücklich die fortgesetzte Beglei- anlaufende Monitoring wird hierzu belastbare
tung. Es hat sich bewährt, keine zu stark detail- Ergebnisse bringen. Aufgrund der verzögerten
lierten Weidekonzepte zu formulieren, sondern Reaktion von Pflanzengesellschaften und Bio-
nur die wesentlichen Punkte komprimiert darzu- toptypen auf Veränderungen im Nutzungsregime
stellen. werden eindeutige Daten jedoch erst nach min-
Mit dem Blick von außen konnten den Betrieben destens fünf bis acht Jahren vorliegen. Unter
bereits ökonomisch wirksame Empfehlungen ge- Beachtung der relevanten Fachliteratur, so bei-
geben werden. Das betrifft beispielsweise die spielsweise der Zusammenführung zahlreicher
Vergrößerung von Weideeinheiten und die verrin- Details in dem Band „Naturnahe Beweidung und
gerte Zahl von Umtrieben, die zeitliche Ausdeh- Natura 2000“ (Bunzel-D rüke et al. 2015), sind
nung der Weideperiode (früherer Auftrieb im jedoch grundsätzlich der Erhalt des Status quo und
Frühjahr, zum Teil bei anschließender Nutzungs- deutliche positive Veränderungen zu erwarten.
pause zur Brutzeit der Wiesenbrüter), einen Ver- Ein Thema löste in vielen Fällen Diskussionen mit
zicht auf vorgesehene Düngung bei auch wirt- Vertretern des Naturschutzes aus: Die Einbezie-
schaftlich ausreichendem Nährstoffniveau sowie hung von Hecken, Steinriegeln, Gräben, Quellen
in einigen Fällen bei Unterbeweidung eine be- und kleinen Fließgewässern in die Beweidung auf
wusst erhöhte Weideintensität. Gemäß histori- größeren Weideeinheiten wird zum Teil kritisch
schen Vorbildern wird auf Teilflächen auch zur gesehen. In verschiedenen anderen Projekten hat
kombinierten Mähweidenutzung geraten. Be- sich jedoch gezeigt, dass die extensive Bewei-
standteil jedes Weidekonzepts sind sogenannte dung dieser Strukturen unter bestimmten Vor-
„Gummiflächen“, die je nach aktuellem Witte- aussetzungen naturschutzfachlich überaus po-
rungsverlauf flexibel genutzt werden können, um sitiv wirken kann – insbesondere, wenn die Flä-
Ertragsschwankungen ausgleichen zu können. chengröße zusammenhängend beweideter Par-
Mit den Modellbetrieben besteht eine ausnahms- zellen ausreichend groß und die Besatzstärke
los sehr gute und kooperative Zusammenarbeit. nicht zu hoch ist. Entgegen der nach wie vor
Von allen zehn Betrieben werden die Hinweise gängigen Lehrmeinung, dass ein Mehr an Hecken
aufgrund des jeweils aktuellen Flächenzustandes generell ein positives Ziel des Naturschutzes sei,
aufgenommen und erfolgreich umgesetzt. Ein zeigen Stooss et al. (2017) für den als typischen
wesentliches Anliegen des Projektes, die Opti- Heckenbrüter geltenden Neuntöter, dass das Zu-
mierung der Weideregime sowohl unter natur- rückdrängen von Gehölzen bei intensivierter
schutzfachlichem als auch betrieblichem Ge-
sichtspunkt, wird damit erreicht.
Im Projekt erfolgt eine beispielhafte Zusammen-
Abb. 7: Extensive Beweidung im Gebiet des
arbeit zwischen Naturschutz und Landwirt- Naturschutzgroßprojektes Osterzgebirge
schaft, die es gilt, weiter erfolgreich fortzu- Foto: Archiv Naturschutz LfULG, H. Menzer
26 |Sie können auch lesen