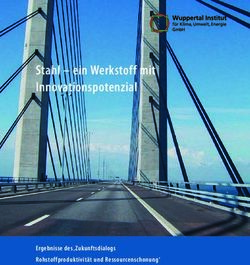Pflanzenbau im Klimawandel - Fachinformationen für die Landwirtschaft
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ausgabe 1 · Januar 2022
43969
Züchtung · Produktion · Verwertung
Fachinformationen für die Landwirtschaft
Pflanzenbau im
Klimawandel
➤ Nachhaltigkeit im Braugerstenanbau
➤ Hafer auch auf besten Böden anbauen
➤ Hybridroggen: auf besseren Böden eine Alternative
➤ Weizen: zuverlässig(e) Qualität erzeugen
optimale Saatstärke, angepasste Bestandesführung
➤ Dinkelvermarktung – Spelzen sind kein AbfallHaben Sie Anmerkungen zur praxisnah? 4
Dann rufen Sie uns gerne unter 0511-72 666-242 an, faxen Sie uns an
die 0511-72 666-300 oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@praxisnah.de
An unsere Leserinnen: Formulierungen in den Texten wie Landwirt/Betriebsleiter
etc. meinen auch immer Landwirtinnen und Betriebsleiterinnen. Zugunsten einer
besseren Lesbarkeit verzichten wir auf das Ausschreiben der Geschlechterformen
bzw. auf die Verwendung des Gender-*. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Kontakte Impressum
Bei inhaltlichen Fragen zu einzelnen
Artikeln wenden Sie sich bitte direkt an
Herausgeber und Verlag,
Druck und Vertrieb:
8 12
die Autorinnen und Autoren. PubliKom Z Verlagsgesellschaft für
Zielgruppen-Publizistik und
Dr. Anke Boenisch Kommunikation mbH
Redaktion praxisnah Frankfurter Straße 168, 34121 Kassel
Tel. 0511-72666242
Tel. 0561-60280-450, Fax: 0561-60280-499
info@publikom-z.de
Sven Böse
Fachberater Redaktion:
Tel. 0511-72666251
Verantwortlich: Dr. Anke Boenisch,
sven.boese@saaten-union.de
Eisenstr. 12, 30916 Isernhagen HB,
Tel. 0511-72 666-242
Felix Buchholz
Südwestdeutsche Saatzucht
Satz/Layout:
GmbH & Co. KG
Tel. 07222-770726
f.buchholz@suedwestsaat.de
www.alphaBITonline.de
14 16
Bezugspreis:
jährlich 9,60 €, Einzelheft 2,40 €,
Michael Dunker
zuzüglich Versandkosten
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Tel. 0581-8073162
Erscheinungsweise:
michael.dunker@lwk-niedersachsen.de
viermal jährlich: 34. Jahrgang;
ISSN: 2198-6525
Sébastien Frère
Produktmanager Braugetreide int. Alle Ausführungen nach bestem
Wissen unter Berücksichtigung von
19
SAATEN-UNION France
Tel. +33761-433669 Versuchsergebnissen und Beobach-
sebastien.frere@saaten-union.com tungen. Eine Gewähr oder Haftung
für das Zutreffen im Einzelfall kann
Steffen Hünnies nicht übernommen werden, weil die
Fachhochschule Südwestfalen
Tel. 02921-3783651
Wachstumsbedingungen erheblichen
Schwankungen unterliegen. Bei allen 17
huennies@fh-swf.de Anbauempfehlungen handelt es sich
um Beispiele, sie spiegeln nicht die
Daniel Husmann aktuelle Zulassungssituation der Pflan-
Produktmanager Hybridgetreide nat. zenschutzmittel wider und ersetzen
Tel. 0511-72666185
nicht die Einzelberatung vor Ort.
daniel.husmann@saaten-union.de
Copyright:
Dr. Stefan Kübler Alle Bilder und Texte in unserer
John Deere GmbH & Co. KG
Publikation unterliegen dem Urhe-
Tel. 0631-36191871
berrecht der angegebenen Bildquelle
kueblerstefan@johndeere.com
bzw. des Autors/der Autorin! Jede
Dr. Ulrich Lehrke
LWK Niedersachsen
Veröffentlichung oder Nutzung (z. B. in
Printmedien, auf Websites etc.) ohne 22 24
Tel. 0511-40052251 schriftliche Einwilligung und Lizenzie-
ulrich.lehrke@lwk-niedersachsen.de rung des Urhebers ist strikt untersagt!
Nachdruck, Vervielfältigung und/
Janneke Ogink oder Veröffentlichung bedürfen der
Getreidefonds Z-Saatgut e. V. ausdrücklichen Genehmigung durch
Tel. 0228-98581287 die Redaktion.
janneke.ogink@z-saatgut.de
Titelbild: agrarpress
Matthias Rapp
W. von Borries-Eckendorf
GmbH & Co. KG
Tel. 05208-912538
m.rapp@wvb-eckendorf.de
Stefan Ruhnke 26
Projektmanager Biokulturen
Mobil 0151-215 70 84
stefan.ruhnke@saaten-union.de
Jede Art der industriellen Produk-
Martin Rupnow tion erzeugt klimaschädliches CO2.
Fachberater für Mecklenburg- Wir gleichen das bei dem Druck der
Vorpommern praxisnah freigesetzte CO2 in einem
Mobil 0151-525524 83 Aufforstungsprojekt in den Alpen aus.
martin.rupnow@saaten-union.de Das Projekt neutralisiert in der Atmo-
sphäre befindliches CO2.
2 praxisnah 1 | 2022Inhalt
4 Pflanzenbau im Klimawandel
„Getreide führen heißt Getreide
verstehen.“ Dr. Anke Boenisch
(Redaktion)
8 Sommerhafer
Hafer auch auf besten Böden anbauen
10 Braugerste
Editorial
Mehr Nachhaltigkeit in der Bier-
produktion – das kann die Züchtung Neue Wege mit neuen Chancen –
beitragen nutzen wir sie!
12 Zuchtfortschritt Liebe Leserinnen und Leser,
Z-Saatgut sorgt für Perspektive wenn von „Erweiterung der Fruchtfolge“ gesprochen wird,
denken viele automatisch erst einmal an Kulturarten, die
im Getreideanbau für den Betrieb neu sind. Warum aber nicht mal darüber
nachdenken, etablierte Fruchtarten wie Hafer oder Roggen
14 Betriebsinterview nicht nur auf minder guten Standorten zu platzieren, son-
dern auf den besseren oder gar guten Böden? Auch dort
Zuverlässig(e) Weizenqualität erzeugen
können diese Kulturen konkurrenzfähig sein, wie wir in
dieser Ausgabe ausführen.
16 Dinkel/Spelzweizen
Werden hingegen Kulturarten erstmalig in die Fruchtfolge
„Wir denken lieber über das nach, aufgenommen, müssen oft auch neue Vermarktungswege
was geht.“ für z. B. Dinkel, Soja und Co. erschlossen werden, – dass
dies sehr gut in einer Betriebsgemeinschaft funktionieren
kann, zeigen wir in einem unserer Betriebsinterviews.
17 Dinkelspelzen sind kein Abfall
Doch auch bei Feldfrüchten, die seit Jahrzehnten auf dem
Betrieb angebaut werden, sollten laufend die Bestandes-
19 Winterweizen führung und die Sortenwahl angepasst und optimiert
Erfolgreicher Weizenanbau: werden – nicht nur wegen politischer Vorgaben, sondern
auch im eigenen Interesse, um allgemein die Ressourcen
optimale Aussaatstärke, angepasste effektiver zu nutzen oder Aufwendungen einzusparen.
Bestandesführung Beispielsweise stellen wir in dieser Ausgabe die Fragen:
„Geht Zwischenfruchtanbau auch ohne Glyphosat und
22 Winterroggen
ohne Düngung?“ oder „Wie führt man Getreide im Klima-
wandel?".
Wachstumsregler im Winterroggen: Züchter und Züchterinnen haben vermehrt Zuchtziele in
Was ist optimal? den Fokus genommen, die dem geänderten Umfeld Rech-
nung tragen: Ressourcen-Effizienz, Stresstoleranz und die
24 Hybridroggen Gesundheit der Sorten werden immer wichtiger. Neu zuge-
lassene Sorten tragen dazu bei, Ertragsleitung und Qualität
Auch für bessere Standorte zu sichern.
eine Alternative Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
26 Zwischenfrüchte
Es geht ohne Herbstdüngung
und ohne Glyphosat!
praxisnah 1 | 2022 3Artikelserie praxisnah
2020/2021/2022
Getreideanbau im Klimawandel
Pflanzenbau im Klimawandel 1. Ertragsbildung
2. Sortenwahl
3. Fruchtfolgen
„Getreide führen heißt 4. Kornqualität
5. Anbauverfahren
Getreide verstehen.“
Im letzten Teil dieser Artikelserie geht es um die Produktionstechnik
im Klimawandel. Mit welcher Anbauintensität fährt man am besten
und auf welche Maßnahmen kommt es jetzt an?
T
rotz häufigerer trockener und heißer Jahre mit
schwachen Ernten bleibt Mitteleuropa im internati-
onalen Vergleich ein Gunststandort. Die Bodennut- Die Direkt- und arbeitskostenfreie Leistung würde von gut
zungskosten, Betriebsmittel sowie Löhne haben sich jedoch 800 auf 600 €/ha sinken, was über einen Preisanstieg von
empfindlich verteuert. Hinzu kommt die GAP-Reform 2023 2,20 Euro/dt aufgefangen werden könnte.
mit weiteren Schritten zur Ökologisierung der Landwirt-
schaft. Dafür steigen die Chancen auf der Vermarktungs- Welche Anbauintensität lohnt sich jetzt?
seite. Nach jüngsten Erkenntnissen werden weltweit Mais, Bei Anpassungen der Intensität geht es heute weniger um
aber auch Reis und Soja ertraglich stärker unter dem be- Düngung und Pflanzenschutz, die verbleibenden Möglich-
schleunigten Klimawandel leiden als bisher angenommen. keiten liegen hier meist unter dem betriebswirtschaftli-
Diese Entwicklung könnte über steigende Risikoprämien chen Optimum. Die Fragen lauten vielmehr: Wie viel inves-
zu einer längerfristigen Preisfestigung beitragen. Was tiere ich in innovative Genetik, gelungene Zwischenfrüchte
bedeutet diese Gemengelage für den Pflanzenbau und oder präzisere Technik? Gehe ich täglich oder wöchentlich
dessen Anbauintensität? durch meine Bestände? Wie viel lasse ich mir anspruchs-
volle Beratung kosten?
Auf der Ertragsseite drohen ja nicht nur Ertragsdepressio-
nen durch den Klimawandel, auch der zunehmend limi- Sinkende Preise und Erträge sowie steigende Kosten emp-
tierte Einsatz von Düngung und Pflanzenschutz führt zu fehlen theoretisch eine geringere Intensität, gegenteilige
einer niedrigeren und flacheren Ertragskurve. Abb. 1 Entwicklungen eine höhere. Praxistypisch sind jedoch zu-
unterstellt einfachheitshalber, dass das Gesetz vom abneh- nehmende Schwankungen auf der Ertrags- und Erlösseite,
menden Ertragszuwachs auch für die Produktionskosten die sich erst nach der Ernte herausstellen. Betriebswirt-
insgesamt gilt, die im grünen Szenario trotz geringerer schaftlich gesehen empfehlen steigende Volatilitäten keine
Erträge aufgrund höher Umweltauflagen (Greening etc.) Änderung der Anbauintensität. Allerdings leidet die Effizi-
gleich hoch sind. Die optimale spezielle Intensität ist dann enz und damit auch der Gewinn: In guten Jahren wird
erreicht, wenn der zusätzliche Aufwand je Produktionsein- dessen Potenzial nicht ausgeschöpft, in schlechten Jahren
heit dem zusätzlichen Nutzen entspricht. Im Beispiel wäre Faktoraufwand verschwendet!
aktuell ein Aufwand von 1.250 €/ha zu vertreten, ohne Er-
tragsbremsen 1.300 €/ha. Am lohnendsten sind ertragssichernde bzw. -steigernde
Maßnahmen ohne Mehrkosten, angefangen bei der Saat-
zeit. Diese entscheidet maßgeblich über die Ertragsbil-
Abb.1: Die Ertragskurve bestimmt die optimale Anbauintensität dung der Pflanzen sowie deren Widerstandsfähigkeit ge-
Beispiele abhängig von Jahr, Standort und Sorte
genüber biotischem und abiotischem Stress! Es lohnt nicht
120 mehr, in Großbetrieben Teilflächen bewusst zu früh bzw. zu
ohne Klimawandel und Restriktionen
110 spät zu säen, um die Drilltechnik besser auszulasten. Die
Kornertrag dt/ha
100 damit verbundenen Terminkosten – resultierend aus den
90 höheren Anbaurisiken – steigen über die eingesparten
80 Maschinenkosten: Denn es gibt heute kaum noch Möglich-
70 keiten, überwachsene bzw. dünne Bestände über Pflanzen-
60 mit Klimawandel und Restriktionen schutz und Düngung gesund zu halten, zu bremsen oder
50 zu fördern.
0
0
0
00
50
00
50
00
50
00
50
00
50
85
95
90
1.1
1.3
1.1
1.4
1.0
1.2
1.2
1.3
1.4
1.0
Aufwand (Direkt- und Arbeitskosten €/ha)
4 praxisnah 1 | 2022Pflanzen führen heißt Pflanzen verstehen summe, gemessen in Gradtagen (°Cd). Eine neue Blatt-
In einem Kulturpflanzenbestand mit genetisch identischen bzw. Triebgeneration erfordert zwischen 60 und 100 °Cd, je
Hochleistungspflanzen mit gleichen Bedürfnissen zu je- nach Studie und Basistemperatur1. Hier werden die Werte
dem Zeitpunkt herrscht extremer Wettbewerb nach Raum, der N. U. Agrar herangezogen: 90 °Cd für die Keimung und
Licht, Wasser und Nährstoffen. Welche pflanzenbaulichen dann 70 °Cd für jede weitere Blattgeneration – ohne Basis-
Konsequenzen lassen sich daraus ableiten? temperatur, dafür werden nur Tage über 5 °C berücksichtigt.
In Abb. 2 zeigt die Jugendentwicklung einer Getreide- Ab dem dritten Blatt bilden die Triebe eigene Kronenwur-
pflanze ohne Konkurrenz und Mangel: Zeitgleich mit der zeln, wachsen also eigenständig und können Ähren bilden.
Entwicklung des 3. Blatts wird der erste Bestockungstrieb Jüngere Triebe werden bei Licht-, Wasser- und Nährstoff
angelegt, erscheinend zusammen mit dem vierten Blatt in stress schnell reduziert, die resorbierten Nährstoffe gehen
EC 21. Mit jedem weiteren Blatt des Haupttriebes erscheint zurück an die Muttertriebe. Kräftige, bereits bewurzelte
ein zusätzlicher primärer Bestockungstrieb, der seinerseits Nebentriebe werden dagegen nicht reduziert und überle-
ab dem 3. Blatt fortlaufend sekundäre Bestockungstriebe ben selbst bei Nährstoffmangel und Dürre bis zur Schoss-
bildet usw. Erst der Langtag stoppt diese exponentielle phase. Dann, bei maximaler Konkurrenz zwischen Trieben,
vegetative Entwicklung und leitet mit dem Schossen den Ährchen und Blütchen, stören sie sich gegenseitig in der
Übergang in die generative Phase ein. Die Triebentwick- Entwicklung und verschwenden noch als unterständige
lung bis dahin steht in linearer Beziehung zur Temperatur- Ähren Wasser und Nährstoffe.
Abb. 2: Die Jugendentwicklung des Getreides ist abhängig vom Ressourcenangebot und verläuft exponentiell
Bestockungspotenzial einer Getreidepflanze
Temp.summe in Gradtagen 90° 160° 230° 300° 370° 440° 510° 580° 650° 720° 790° 860° Anzahl
Triebe
BBCH 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29
19
16
13
Sekundäre
Bestockungstriebe 10
8
Primäre 6
Bestockungstriebe
4
3
2
Haupttrieb 1
Anzahl Blätter 1 2 3 5 8 12 18 26 36 49 63 80
Triebe > 3 Blätter 1 1 1 2 3 4 6 8 10 12
Triebe < 3 Blätter 1 2 2 3 4 4 5 6 7
1 z. B. T. Johnen, U. Boettcher, H. Kage 2018 / J. Burkhardt, T. Gaiser 2011
praxisnah 1 | 2022 5Entbehrung in der Jugend gehört dazu Wintergetreide eine Woche später drillen
Am effizientesten ist eine kräftige Jugendentwicklung bis Für die Herbstaussaat ist die phänologische Uhr hingegen
etwa BBCH 23, also dem dritten Bestockungstrieb. Weitere nicht brauchbar. Das Vegetationsende, – definiert als Blatt-
Triebgenerationen sollten in ihrer Ausbildung zurückblei- fall der Stieleiche, – hat sich im betrachteten Zeitraum um
ben bzw. möglichst früh abgestoßen werden. Eine „ver- einen Zehnteltag jährlich nach hinten verschoben. Dürre
ständnisvolle“ Bestandesführung kann diese Bestandesar- stress im Sommer oder Frühherbst beschleunigt jedoch die
chitektur unterstützen: mit ausreichend dicht stehenden, Alterung und damit auch den Beginn des phänologischen
gleichmäßig entwickelten Pflanzen bei nicht zu üppiger Winters. Hilfreicher als die Temperaturhistorie sind die Mit-
N-Versorgung. Dann haben spätere Triebgenerationen teltemperaturen. In Tab. 1 gehen in das Gebietsmittel alle
kaum Entwicklungschancen. Moderater Mangel bzw. Wetterstationen ein, auch Höhenlagen. In den typischen
etwas Stress in der Jugend sind also wichtig für die Ent- Ackerbaugebieten liegen die Werte um etwa 0,5 °C höher.
wicklung idealer Pflanzenbestände. Dazu gehören auch
„Kinderkrankheiten“ im Blattbereich, vor allem Schwäche- Der Oktober ist für die Herbstentwicklung entscheidend,
parasiten wie Typhula und Schneeschimmel. danach sind bei zunehmender Abkühlung steigende Tem-
peraturen unter der Wachstumsschwelle von 5 °C unerheb-
Sommerungen profitieren von früheren Saaten lich. In den letzten fünf Jahren waren die Oktober im Mittel
Bei den phänologischen Jahreszeiten des Deutschen Wet- um 1,3 °C wärmer als 1981 – 2010, die Temperatursumme
terdienstes beginnt der Frühling mit der Blüte von Forsy- stieg damit um 40 °Cd. Bei einer Aussaat am 1. Oktober
thie und Buschwindröschen. Im langjährigen Trend seit entspräche das – in Verbindung mit einigen wärmeren Ta-
1950 setzt diese Entwicklung alle fünf Jahre um einen Tag gen Anfang November – etwa einem BBCH-Stadium mehr
früher ein. Profitieren können davon vor allem Sommer Entwicklung. Konkrete Empfehlungen für die sehr unter-
getreide und heimische Leguminosen. Aufgrund der kür- schiedlichen Anbauräume Deutschlands sind daraus nicht
zeren Jugend ist deren Bestandesdichte und Einkörnung abzuleiten, übergreifende Trends schon:
labiler als die der Winterformen. Mit früherem Vegetations-
beginn können sie zeitiger bestellt werden, ohne Auflauf- ➤ Bei Weizen wäre aus dieser Entwicklungsbeschleuni-
und Entwicklungsprobleme zu riskieren. Mit der längeren gung eine Saatzeitverschiebung um etwa fünf Tage ge-
Vegetation im Kurztag verringern sich die Entwicklungs- genüber dem Vergleichszeitraum zu begründen, hinzu
nachteile gegenüber den Winterformen, die Erträge könn- kommt der um etwa drei Tage frühere Vegetationsbe-
ten sich zukünftig annähern! Auch Mais, Zuckerrüben und ginn. Dieser ist bei Weizen im Hinblick auf die längere
Soja werden heute zeitiger gesät, Wärmebedürftigkeit und Ährendifferenzierung und damit bessere Einkörnung
Frostrisiken erlauben jedoch keine weitere Verfrühung. Ge- voll anzurechnen. Zusammengenommen hätte sich
treide benötigt je nach Art zur Keimung hingegen nur ein damit in den letzten 30 Jahren das regionale Saatzeit
bis vier Grad Celsius. Das weitere Wachstum setzt bereits optimum um etwa 8 Tage nach hinten verschoben. In
bei drei bis fünf Grad ein, moderate Minustemperaturen milden Lagen mehr, in rauen Lagen weniger.
sind kein Problem.
➤ Anders als Weizen kann Roggen
Tab. 1: Durchschnittstemperaturen der Jahreszeiten nur zwei Körner je Ährchen bilden,
Mittelwerte Deutschland nach Daten des Deutschen Wetterdienstes in Grad Celsius Gerste nur eines. Zudem wachsen
Jahr Frühjahr Sommer Herbst Winter beide Arten im Frühjahr etwa zwei
September Oktober November
Wochen weniger im Kurztag. Eine
frühzeitige Ährendifferenzierung
1961–1990 8,6 7,7 16,3 13,3 9,0 4,1 0,3
ist deshalb entscheidend für die
1971–2000 9,0 8,1 16,6 13,3 8,8 4,0 0,8
Ertragssicherheit. Gerste generell,
1981–2010 9,3 8,5 17,1 13,5 9,2 4,4 0,9
Roggen auf Trockenstandorten
2011 10,0 10,1 16,8 15,2 9,4 4,6 -0,6
sollten deshalb eher BBCH 24 vor
2012 9,5 9,8 17,1 13,6 8,7 5,2 1,1 Winter erreichen. Gerste nutzt zu-
2013 9,1 6,7 17,7 13,3 10,6 4,6 0,3 sätzlich einige wärmere Septem-
2014 10,8 10,0 17,1 14,9 11,9 6,5 3,3 bertage, Roggen hat einen gerin-
2015 10,2 8,7 18,4 13,0 8,4 7,5 1,9 geren Energiebedarf. Daraus las-
2016 9,9 8,5 17,8 16,9 8,5 3,8 3,6 sen sich, bezogen auf die vergan-
2017 10,0 9,6 17,9 12,8 11,1 5,1 1,0 genen 30 Jahre, etwa sechs Tage
2018 10,7 10,2 19,3 15,1 10,7 5,2 1,5 späterere Saatzeitoptima folgern.
2019 10,7 9,1 19,3 14,1 10,8 5,2 2,8
2020 10,9 9,2 18,2 14,8 10,2 6,2 4,2
2021 7,2 17,9 15,2 9,6 4,1 1,8
Abweichungen zur Durchschnittstemperatur 1981–2010, blau = Abweichungen nach unten, rot = Abweichung nach oben
6 praxisnah 1 | 2022➤ In überwachsenen Wintergetreide-Beständen kann die
Triebreduktion beschleunigt werden, indem die Start-
gabe verschoben oder gleich mit der Anschlussgabe zu-
sammenfasst wird. Aufgeteilt folgt Letztere erst zum
Einknotenstadium. In schwächeren Beständen muss Nit-
rat früh und ausreichend für die Triebentwicklung be-
reitstehen. Die Anschlussdüngung fällt dann triebstabi-
lisierend Ende der Bestockung, mit Ammonium- bzw.
Harnstoff auch hier entsprechend früher.
➤ Die Abschlussdüngung sollte bei Trockenstress mit dem
Erscheinen des letzten Blattes ausgebracht sein. So wird
der Stickstoff effizient und damit umweltfreundlich ge-
nutzt und spätere Stickstoffschübe stimulieren nicht
Frühe und „dünne“ Saaten sind oft früh zusätzlich das vegetative Wachstum. Dies würde die
von Virusüberträgern befallen.
generative Entwicklung verzögern – und damit auch
die notwendigen Umlagerungsvorgänge im Verlauf der
➤ Von den späteren Saatterminen profitiert auch die Anbau- Kornfüllung.
sicherheit: Sie sind eine wirkungsvolle „Escape-Strategie“
gegenüber Viren, Pilzen und diversen Fraßschädlingen, ➤ Aus diesem Grund sind in Trockenlagen ab BBCH 39
auch Ungräser werden wirkungsvoll zurückgedrängt, die auch keine Fungizide mit Greeningeffekt mehr auszu-
Winterfestigkeit und Standfestigkeit gefördert. bringen (v. a. Triazole und Strobilurine). Diese hemmen
die Bildung des Abreifehormons Ethylen und verlängern
➤ Die Tendenz zu immer dünneren Saaten ist vorbei: Ei- auf diese Weise ebenfalls die weitere Entwicklung. Aus-
nerseits wegen der Abkehr von sehr frühen Bestelltermi- nahme ist die Fusariumbekämpfung im Winterweizen.
nen, andererseits für eine bessere Kontrolle der vegeta- Diese geht ja allerdings i. d. R. mit einem eher feuchten
tiven Entwicklung bei kürzerer Winterruhe. Denn mehr Juni einher, eventuelle Entwicklungsverzögerungen
Konkurrenz zwischen enger stehenden Pflanzen bremst sind dann weniger kritisch zu sehen.
die Entwicklung der später angelegten Bestockungs-
triebe. Zudem steigt mit höheren Saatstärken der Anteil ➤ Früh eingesetzt verstärkt der Wachstumsregler Ethe-
der ertragsstabileren Haupttriebe mit ihrer anfangs tie- phon als Ethylenbildner Trockenstress. In BBCH 49 aus-
fer reichenden Keimwurzel. Faustformel bei optimaler gebracht, unterstützt es hingegen die Umlagerungspro-
Bestellung: Weizen 45 %, Gerste 40 %, Roggen 35 % zesse zur Kornfüllung. Die übrigen Wachstumsregler ge-
keimfähige Körner/m² bezogen auf die angestrebte Be- hören zu den Gibberellinhemmern und stören deshalb
standesdichte. bei später Applikation die weitere Entwicklung. Für alle
Wachstumsregler gilt: Sie verschärfen die reduzierende
Düngung und Pflanzenschutz mit dem letzten Wirkung der bei Trockenstress von der Pflanze gebilde-
Blatt abschließen ten Stresshormone, eine Folge ist z. B. Spitzensterilität.
Düngung und Pflanzenschutz sollten das Anpassungsver-
mögen der Pflanze nicht unnötig stören. Bei Trockenheit Selbstregulation der Pflanze unterstützen
bremst das Stresshormon Abscisinsäure das oberirdische Die Produktionstechnik muss für den Klimawandel nicht
Wachstum, auch von den Wurzelspitzen kommen weniger neu erfunden werden, Kenntnisse um die Entwicklungs-
Wachstumssignale. Erst bei feuchtem Boden bilden diese physiologie der Pflanze werden jedoch wichtiger. Denn
wieder verstärkt das Wachstumshormon Cytokinin. Den „Verständnis“ für die Pflanze hilft, mit einer differenzier-
gleichen Effekt hat Nitrat! Menge, Termin und Form der ten Bestandesführung die natürliche Selbstregulation
N-Düngung haben damit erheblichen Einfluss auf ein der Pflanzen zu unterstützen: für effizientere Anbauver-
harmonisches Spross/Wurzel-Verhältnis. Das Gleiche gilt fahren mit wenig Ressourcenverbrauch und widerstands-
für Fungizide und Wachstumsregler im Hinblick auf eine fähigere Pflanzen. So bleiben die Stückkosten im Griff –
harmonische Abreife: trotz klimatischer und politischer Ertragsbremsen!
www.praxisnah.de/202211
➤ Vor allem die Winterungen Gerste und Roggen brau- Text: Sven Böse |
chen aufgrund ihres frühen Bedarfs i. d. R. auch zukünf- Fotos: Amazone, Sven Böse, Anke Boenisch
tig eine ausreichend bemessene, rechtzeitige N-Start-
gabe. Bei Sommergetreide wirkt ein frühzeitiges hohes
Nitratangebot entwicklungsbeschleunigend, auch hier
also startgabenbetont düngen.
praxisnah 1 | 2022 7Sommerhafer
Hafer auch auf besten
Böden anbauen
Die Erweiterung von Fruchtfolgen ist in der „Ackerbaustrategie 2035“ des
BMEL eine der wichtigsten Stellschrauben. Doch die Alternativen sind ins-
besondere dann rar, wenn ertragssichere und -starke Hauptkulturen hohe
Markterlöse garantieren bzw. wenn Standortfaktoren Alternativkulturen
benachteiligen. Günter Stemann1, Fachhochschule Südwestfalen, über Hafer
als Alternative auf guten Böden.
A
ckerbauliche Probleme lassen sich durch ein vielfäl- guten Durchwurzelungsleistung beruht. Selbst hohe Er-
tiges Anbauspektrum deutlich vermindern, auch träge von > 75 dt/ha können mit einem N-Aufwand von rd.
hinsichtlich der geforderten Verbesserung der Bio- 80 kg/ha erzeugt werden. Die so erreichten geringeren Ni
diversität sind Vorteile zu erwarten. Bei dem Vergleich mit tratreste in der herbstlichen Sickerwasserperiode sind be-
ertragssicheren und -starken Hauptkulturen bzw. durch sonders für ausgewiesene „Rote Gebiete“ ein zunehmend
Standortfaktoren benachteiligter Alternativkulturen muss wichtiger Aspekt. Letzterer zeigt sehr deutlich die Notwen-
der langfristige ackerbauliche Vorteil (Vorfruchtwert) den digkeit der betriebsindividuellen Bewertung solcher Eigen-
geringen Markterlös kompensieren. Darüber hinaus muss schaften: Was in Ackerbaubetrieben mit Mineraldünger
bei den „Extensivkulturen“ auch die Verringerung des zukauf positiv zu bewerten ist, kann im Viehhaltungs‑
Aufwandes für Produktionsmittel hinsichtlich der Umwelt- betrieb mit Nährstoffüberhang zusätzliche Kosten für den
wirkungen verstärkt bedacht werden. Export organischer Dünger verursachen.
Hafer – gut begründet! Anbauerfahrungen aus der Börde
Hafer kann ähnlich wie Blattfrüchte die Infektionszyklen Am Standort des Versuchsgutes Merklingsen der FH Süd-
von Schwarzbeinigkeit, Halmbruch und anderen Fußkrank- westfalen in der Niederungslage der Soester Börde ist der
heiten unterbrechen. Dies basiert auf spezifischen Wurzel- Hafer aus den skizzierten Gründen seit jeher Bestandteil
ausscheidungen, die über allelopathische Wirkungen auch des Ackerbaukonzeptes. Die langjährig erzielten Erträge
eine gewisse Unkrautunterdrückung bewirken können. Zu- liegen relativ stabil auf hohem Niveau (s. Abb. 1a). Dabei
sätzlich kann das Saatbett bis zum zeitigen Frühjahr acker- hielten sich die Erträge trotz der extremen Frühjahrs- und
baulich sehr gut vorbereitet werden, was Vorteile in Bezug Sommertrockenheit in den letzten Jahren, während insbe-
auf das Management von schwer bekämpfbaren oder gar sondere die der Ackerbohnen deutlicher absanken und die
resistenten Ungräsern hat. Dies muss aber auch das Ziel Erträge bei Raps deutlicher schwankten (Abb. 1b und c).
sein, da seit dem Wegfall von Lexus® keine Gräserherbizide
mehr im Hafer zugelassen sind. Demgegenüber können Wirtschaftlichkeit: Qualität wird gut bezahlt
breitblättrige Unkräuter (u. a. auch Disteln) sehr effizient Die Anbauentscheidung hängt nicht allein vom Ertrag,
und preisgünstig bekämpft werden. Die im Gegensatz zum sondern ebenso von der Vermarktung und Verwertung ab.
Wintergetreide meist gute, schüttfähige Struktur der Bo- Der Marktpreis des Hafers ist von der Verwertungsrichtung
denoberfläche ermöglicht im Bedarfsfall auch effiziente abhängig. Qualitätshafer für die Nahrungsmittelerzeugung
Einsätze des Unkrautstriegels. Ein gut etablierter Hafer in den Schälmühlen wird aufgrund des enormen Anstieges
bestand mit Saattiefe auf ca. 4 cm ist hier sehr robust. der Nachfrage sowie der eher geringen inländischen Er-
zeugung stark nachgefragt und wird derzeit zu rd. 60 %
Als „Gesundungsfrucht“, die selbst nur geringe produktions durch Importe gedeckt! Bei hoher Kornqualität kann der
technische Maßnahmen beansprucht, eignet sich Hafer gut Hafer über dem Weizenpreis gehandelt werden. Aber: Für
zur Auflockerung enger Fruchtfolgen mit Getreide, aber Futterhafer gibt es demgegenüber keine rege Nachfrage,
auch Raps und kann den hohen Aufwand zur Absicherung sodass dessen Preis noch unterhalb von dem der Gerste
der Erträge vermindern. Positiv in Betrieben mit Düngerzu- liegen kann. Der unbestrittene diätetische Wert des Hafers
kauf ist die hohe Nährstoffeffizienz, die u. a. auch aus einer in der Fütterung findet dabei leider keine besondere Wür-
1 Der Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Landw. Wochenblatt Westfalen erschienen. Der Arbeitgeber des inzwischen
8 praxisnah 1 | 2022
leider verstorbenen Autoren hat uns das Manuskript dankenswerterweise zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.digung. So kann also das betriebswirtschaftliche Ergebnis Abb. 1 a, b, c: Betriebserträge (dt/ha) von „Alternativkulturen“
stark schwanken, – dies zeigt das Kalkulationsergebnis der in der Niederungslage der Soester Börde am Standort Merklingsen
(1997 bis 2020) in einem 8-feldrigen Anbausystem
„Kostenbereinigten Marktleistung“ eindrücklich (s. Abb. 2).
Der Hafer erreichte auch als Futterhafer durchaus das Er- a: Entwicklung Hafererträge
gebnis des Rapses bzw. war mit Qualitätsbezahlung sogar 100
y = 0,13003x + 72,705
deutlich besser, während die Ackerbohnen weit abgeschla- 90
80
gen rangieren.
70
60
Hier darf jedoch nicht das „Verdrängungsprinzip“ greifen. 50
Alternativkulturen sollen ergänzen, das Anbausystem ver- 40
einfachen und den Ertrag der Folgekultur sichern! In unse- 30
rem Betrieb reagiert die Wintergerste nach Hafer mit sehr 20
10 2007: Totallager eines
hohen und sicheren Erträgen auf Weizenniveau. Zudem zu dichten Bestandes
0
verbieten sich zu hohe Rotationsanteile: Hafer wie auch
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Körnerleguminosen sollten eher weiter gestellt sein – alle
sechs Jahre wäre ein gutes Ziel.
b: Entwicklung Ackerbohnenerträge
80 y = -0,0791x + 56,957
Abb. 2: Kostenfreie Leistung der Kulturen, Erntejahr 2019
(Vermarktungserlös/ha abzüglich Kosten für Diesel, Saatgut, 70
Düngung, PSM, Erntekosten), Versuchsgut Merklingsen 60
50
1.400 40
1.200 30
1.000 20
Euro/ha
800 10
600 0
400
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
200
0
c: Entwicklung Rapserträge
ZR
WG
is
op W
fer
(Qu fer
ps
AB
(Bl W W
l
tte
)
l)
al.)
ma
at t
(St W
Ra
pe
Ha
Ha
y = 0,1133x + 40,797
Mi
Silo
60
Quelle: G. Stemann, Agrarwirtschaft Soest 50
40
30
Qualität und Vermarktung
20
Während an diesem Standort gute Erträge möglich sind, 10
liegt es mit den gewünschten Qualitäten im Argen. Als ein- 0
fach und schnell ermitteltes Preiskriterium örtlicher Han-
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
delspartner dient das Hektolitergewicht, das in aller Regel Quelle: G. Stemann, Agrarwirtschaft Soest, Versuchsgut Merklingsen
an der angelieferten Rohware gemessen wird. Meist wird
das gesetzte Limit von 52 kg/hl knapp verfehlt. Je nach
Einstellung des Mähdreschers kann die Analyse nach Aspi-
ration jedoch bereits um 1 bis 2 kg/hl höher liegen! tischen Aufwand des Lkw-Transportes zu rechtfertigen. Sehr
hilfreich wäre daher die Gründung von Erzeugergemein-
Vorrangig für die Herstellung der klassischen „Haferflocken“ schaften, verbunden mit einer guten Anbauberatung.
ist ein gut ausgebildetes gesundes Korn wichtig. Für die er-
weiterte Produktpalette wie Müsliprodukte, Kleie, Hafer- Fazit
milch etc. gilt das nicht unbedingt. Daher sind die Anforde- Kulturen zur Entlastung unserer nach wie vor engen An-
rungen der Schälmühlen weitaus differenzierter. So wer- bausysteme sind gefragt. Während derzeit vorrangig die
den u. a. auch Schälbarkeit, Spelz- bzw. Kernanteil und Körnerleguminosen favorisiert werden und deren Anbau
Korngrößenanteil (< 2 mm Schlitzlochsieb) bewertet, so- in Folge der Förderprogramme merklich angestiegen ist,
dass auch eine Ware mit rd. 50 kg/hl nicht mehr zwangs- blieb der Hafer bis in die jüngste Vergangenheit weitge-
www.praxisnah.de/202212
läufig im Futtertrog landen muss. Dies setzt erhöhte An- hend unbeachtet. Hafer trägt ebenso zur Unterbrechung
strengungen um eine entsprechende Vermarktung voraus: von Infektionszyklen in Getreide- und Rapsfruchtfolgen
Die Erntemenge muss repräsentativ bemustert und der bei, bietet darüber hinaus aber einen weiteren entschei-
Schälmühle zur Analyse zugeschickt werden, sodass eine denden Vorteil: Die N-Bilanzen können erheblich entlas-
vorübergehende Einlagerung unvermeidbar ist. Es kann da- tet werden und die „Gesundpflanze“ Hafer ermöglicht
rüber hinaus vorteilhaft sein, kleinere Partien mit ausrei- eine erfreulich extensive Produktion.
chender Qualität überbetrieblich zu bündeln, um den logis- Foto: Anke Boenisch
praxisnah 1 | 2022 9Braugerste
Mehr Nachhaltigkeit in der Bier
produktion – das kann die Züchtung
beitragen
Im Europäischen Green Deal und der Gemeinsamen Agrarpolitik 2023 spiegeln sich die gesellschaft-
lichen Bedenken hinsichtlich des Klimawandels und des Kohlenstoffmanagements wider. Wichtige
Akteure der Mälzerei- und Brauereibranche haben sich bereits zu einem klaren Ziel zur Senkung der
Treibhausgasemissionen verpflichtet, um das Pariser Abkommen1 zu erfüllen.
D
iese Entwicklung wird sich auf die gesamte Wertschöpf- Weltweite Initiative zur Senkung von Emissionen in
ungskette auswirken: Züchtung – Gerstenproduktion Unternehmen – auch Brauereien machen mit
– Malzproduktion – Bierherstellung. Die Initiative „Science Based Targets“2 (SBTi, deutsch: Wissen-
schaftlich fundierte Ziele) fördert ehrgeizige Klimaschutz-
Wie Abb. 1 zeigt, werden ca. 40 % der Treibhausgase in der maßnahmen in der Privatwirtschaft, indem sie Unterneh-
Nahrungskette im Bereich Landwirtschaft und Verarbei- men die Möglichkeit gibt, wissenschaftlich fundierte Emis-
tung produziert und können daher von der Züchtung und sionsreduktionsziele festzulegen. Um ihr Engagement zu
von den landwirtschaftlichen Produktionssystemen beein- formalisieren und zu validieren, verpflichten sich die Unter-
flusst werden. Denn Anbauverfahren in Zusammenhang nehmen der SBTi. Bis heute haben sich mehr als 10 Braue-
mit den genetisch bedingten Eigenschaften der Gersten- rei- und Brennereibetriebe angeschlossen.
sorten haben einen direkten Einfluss auf diese Emissionen.
Die Nachhaltigkeitsziele decken die gesamte Produktions-
Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft fängt bei der kette ab und sind in drei Kategorien unterteilt. Kategorie 1
Pflanzenzüchtung an entspricht den direkten Emissionen aus unternehmensei-
Führende Braugerstenzüchter wie die Unternehmen Acker- genen und kontrollierten Ressourcen. Indirekt wirkt sich
mann Saatzucht GmbH und Nordsaat Saatzucht GmbH bei der Herstellung, Verwendung und Entsorgung eines
haben daher mit Blick auf die Nachhaltigkeit bestimmte Produktes die Herstellung der benötigten zugekauften
Zuchtziele priorisiert, um der Praxis Sorten zur Verfügung Energie (Kategorie 2) aus. Ebenso wie alle Emissionen, die
zu stellen, die in der Wertschöpfungskette des berichtenden Unterneh-
➤…p roduktiv, aber ebenso tolerant gegen Witterungs mens entstehen, einschließlich vor- und nachgelagerter
extreme, Krankheiten und Schädlinge sind. Emissionen der benötigten eingekauften Materialien (Ka-
➤ … s owohl auf dem Feld trockentolerant sind, als auch tegorie 3). Wie in Tab. 1 zu sehen ist, wirken sich die von
während des Mälzungsprozesses weniger Wasser den Brauerei- und Mälzereiunternehmen verfolgten Ziele
benötigen. auf die landwirtschaftlichen Praktiken aus.
➤…w eniger Wasser, Zeit sowie Energie (Gas, Elektrik) wäh-
rend des Mälzungs- bzw. Brauprozesses benötigen.
Tab. 1: Emissions-Kategorien für Mälzereien und Brauereien
Das muss die Brauerei Das muss die Mälzerei Mögliche
dokumentieren dokumentieren Maßnahmen
Emissionen im Zusammenhang mit der Verbrennung Emissionen im Zusammenhang mit der Verbren- Biogas, thermische Solarenergie,
1
von Gas zur Erzeugung von Dampf im Sudhaus nung von Gas für die Trocknung des Malzes Verwertung anfallender Biomasse
Emissionen im Zusammenhang mit der
Emissionen im Zusammenhang mit der Windenergie
Verwendung von Energie für das Kontrollsystem,
2 Verwendung von Energie für das Kontrollsystem, Sonnenkollektoren
den Umgang mit der Ware, für Ventilatoren
Pumpen und Flaschenbefüllung, -reinigung etc. Blockheizkraftwerk (Biogas)
zum Einweichen, Keimen etc.
Emissionen im Zusammenhang mit Emissionen im Zusammenhang mit dem Transport Nachhaltiger Gerstenanbau
3
Malz- und Gerstenproduktion von Malz und Gerste und Gerstenproduktion Elektrische Fahrzeuge
1 DasPariser Abkommen ist ein internationales Abkommen mit dem Ziel, den Temperaturanstieg auf maximal 2 °C
10 praxisnah 1 | 2022 bzw. vorzugsweise 1,5 °C gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen.
2 https://sciencebasedtargets.orgAbb. 1: Vom Feld zum Bierglas – Anteile der freigesetzten
Treibhausgase der einzelnen Produktionsstufen
Landwirtschaft Industrielle Verarbeitung Abfüllung, Verpackung
Gerstenproduktion Malz- & Bierherstellung & Verteilung
~ 15 % ~ 25 % ~ 60 %
➤ Düngung ➤ Elektrizität
➤ Energie
➤ Maschineneinsatz ➤ Logistik
➤ Wasser
➤ Pflanzenschutzmittel ➤ Kühlung
Quelle: Sébastien Frère
„Grüne“ Energie verringert automatisch die Emissionen, biotischen und abiotischen Stress, Düngeeffizienz, Input
aber zusätzlich arbeitet die Industrie daran, über einen etc.) und Herstellungskriterien (Wassereffizienz, Energie-
geringeren Energie- und Wasserverbrauch direkt die Treib- effizienz etc.) zugrunde. Die derzeitige Sortenlandschaft ist
hausgasemissionen zu verringern. auf der Grundlage der Produktionsleistung stark differenziert.
Große Unterschiede bei der Nachhaltigkeit der zurzeit Fazit
verfügbaren Sorten Führende Braugerstenzüchter Deutschlands haben die
Spezifische genetische Sorteneigenschaften können eben- Bedeutung der Züchtung für die Verbesserung der Nach-
falls zu einer Reduzierung von Treibhausgasen in der Land- haltigkeit in der Produktion und Verarbeitung von Brau-
wirtschaft und der Produktion beitragen. Um nachhaltige gerste erkannt und ihre Zuchtziele auch darauf eingestellt.
Sorten für die Mälzerei- und Brauereikette besser bewerten Aber natürlich kann schon auf dem Feld damit begonnen
und auswählen zu können, hat die SAATEN-UNION die in werden, die Nachhaltigkeit in der (Brau)Gerstenproduk-
Abb. 2 dargestellte Nachhaltigkeitsmatrix entwickelt, die tion zu verbessern: Möglichst reduzierte Bodenbearbei-
Agronomie, Biodiversität und Prozessumwandlung kombi- tung, ganzjährige Bodenbedeckung, weniger nicht-orga-
niert. Der Bewertung liegen die wichtigsten agronomi- nische Düngung sind einige der möglichen Maßnahmen.
schen Kriterien (Produktivität, Widerstandsfähigkeit gegen
Text: Sébastien Frère
Abb. 2: Matrix zur Nachhaltigkeitsbewertung von Braugersten für den deutschen Markt
hoch
Wichtigste
agronomische
mittel
Sortenkriterien: Pflanzenproduktivität
Ertrag, und Biodiversität
Stresstoleranz,
Nährstoffeffizienz
niedrig
www.praxisnah.de/202213
niedrig mittel hoch
nachhaltige Sorte
nachhaltiger Prozess
nachhaltiges Wachstum Reduzierung des industriellen Emissions-Fußabdruckes
zugelassene Braugerstensorten,
vom Berliner Programm empfohlen
Sorten, deren Zulassung erwartet wird. Wichtigste Verarbeitungsmerkmale:
Wassernutzungseffizienz, Energieeffizienz
Quelle: SAATEN-UNION
praxisnah 1 | 2022 11Zuchtfortschritt
Z-Saatgut sorgt für Perspektive
im Getreideanbau
Wenn die Möglichkeiten im Getreidebau durch Klima und
Gesetze immer weiter eingeengt werden, gilt es, flexible Z-Saatgut wird mehrfach
amtlich geprüft, bevor es in
Strategien zu entwickeln. Der Sortenwahl und Sortenviel- einem streng kontrollierten
falt kommen dabei Schlüsselrollen zu. Hochqualitatives Verfahren aufbereitet wird.
Z-Saatgut mit mehrfach geprüfter Qualität sichert den
zukünftigen Zuchtfortschritt und bringt gleichzeitig den
Züchtungsfortschritt schnellstmöglich auf den Acker.
Janneke
F
Ogink
orschen für leistungsstarke gesunde Sorten
Um den sich immer schneller wandelnden Umwelt-
einflüssen Rechnung zu tragen, entwickelt die mo- auf dem Feld richtig ist. Neben einer abwechslungsreichen
derne Pflanzenzüchtung laufend neue, leistungsstarke Sor- Anbauplanung schwört Mauer auf den Nutzen hochwerti-
ten. Der Weg zu einer neuen Sorte ist dabei langwierig. Das gen Saatguts: „Bei uns kommen nur Z-Saatgut und Z-
Ziel ist aber klar: Gegenüber dem bisherigen Sortenniveau Pflanzgut in den Boden. So kann ich jedes Jahr zu 100 Pro-
muss ein Fortschritt erreicht werden. Dabei stehen aktuell zent den züchterischen Fortschritt mitnehmen. Wir brau-
durch die Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinschränkun- chen 60 bis 80 Tonnen Getreide-Saatgut im Jahr und ha-
gen Resistenzen gegenüber Krankheiten und eine erhöhte ben keine eigene Aufbereitung, da finde ich das nur
N-Nutzungseffizienz im besonderen Fokus. Der Züchtungs- folgerichtig.“
fortschritt trägt damit zu deutlichen Einsparungen bei der
Düngung, im Pflanzenschutz und somit zum Umwelt- Mehrfach geprüfte Spitzenqualität
schutz bei. Neue Sorten vereinen in sich verbesserte Er- Z-Saatgut wird in einem mehrstufigen und streng kontrol-
tragsleistungen, gezielte Resistenzen und hohe Qualitäts- lierten Verfahren produziert. Damit Saatgut als zertifizier-
sowie Verarbeitungseigenschaften. tes, also anerkanntes Saatgut gehandelt werden kann,
muss es von hoher Qualität sein. Die hohen Qualitätsstan-
Auch bei Landwirt Phillip Krainbring in Hohendodeleben dards sind im Saatgutverkehrsgesetz und in den verschie-
haben die klimatischen Veränderungen Auswirkungen auf denen Saat- bzw. Pflanzgutverordnungen geregelt.
seine betrieblichen Entscheidungen. Mittlerweile setzt er
auf Sorten, die widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten Die Qualität wird bereits durch die amtliche Besichtigung
und toleranter gegenüber Trockenheit sind. „Die bisherige der Vermehrungsfläche sichergestellt. Diese muss ord-
Sorte musste ich trotz extremer Trockenheit dreimal mit nungsgemäß bearbeitet sein und hohe Standards bei
Fungiziden spritzen, die neue haben wir nur einmal behan- Fremdbesatz und Gesundheitszustand erfüllen. Bei der
delt, wären aber auch wohl ohne ausgekommen“, sieht er Beschaffenheitsprüfung wird dann jede Saatgutpartie auf
seine Entscheidung gerechtfertigt. „Ertrag ist heute eben Keimfähigkeit, Fremdbesatz und Reinheit untersucht,
nicht mehr das alleinige Auswahlkriterium“, so Krainbring. bevor diese für den Verkauf zugelassen wird.
Sortenvielfalt Mithilfe von Saatgutaufbereitungsanlagen wird das Saat-
Heute stehen 512 amtlich geprüfte und zugelassene Sor- gut professionell aufbereitet und der gesamte Prozess
ten für Sortenvielfalt. Der Sortenwahl kommt aktuell eine durch Qualitätsmanagementsysteme laufend geprüft und
immer wichtigere Schlüsselrolle zu. Angesichts der vielen verbessert. Dabei geben die gesetzlich festgelegte Min-
Probleme wie Verunkrautung, Resistenzen, Erosion oder destkeimfähigkeit, der geringe Besatz und eine technische
Klimawandel, ist der junge Landwirt Alexander Mauer aus Mindestreinheit auch in schwierigen Phasen Sicherheit.
Pripsleben überzeugt, dass die Entscheidung für Vielfalt Der Landwirt kann sich auf ein zuverlässiges Produkt mit
12 praxisnah 1 | 2022geprüftem Tausendkorngewicht, Sortenreinheit sowie eine Ertragssteigerungen des Züchtungsfortschritts. Doch auch
professionelle Saatgutbehandlung verlassen. Die Saatgut- andere Qualitätseigenschaften von Z-Saatgut spielen für
verkehrskontrolle sowie die Ergebnisse, die vom Qualitäts- ihn eine Rolle: „Durch Z-Saatgut erhalte ich die geforderte
sicherungssystem für Z-Saatgutaufbereitungsanlagen Reinheit und Beizqualität.“ Diese habe sich in den letzten
(QSS) jährlich erhoben werden, bestätigen die sehr hohe Jahren immer weiter verbessert.
Saatgutqualität von Z-Saatgut.
Verbesserte Absatzmöglichkeit
Als Garant für genetisch fixierte Qualitätsmerkmale kommt
der Erhaltungszüchtung auch eine besondere Bedeutung
zu. Denn diese sorgt dafür, dass die Eigenschaften einer
Sorte stets beständig bleiben. Zusätzlich bieten sorten-
reine Partien bessere Vermarktungsmöglichkeiten, da spe- Dietrich Jänicke aus
zifische Verarbeitungseigenschaften auf die Abnehmer, Dargun geht auf Num-
wie Mühlen oder Mälzereien, abgestimmt sind. Weiterhin mer sicher und bestellt
sichert Transparenz entlang der gesamten Wertschöp- sein Z-Saatgut immer
rechtzeitig.
fungskette die Verlässlichkeit für Industrie und Verbraucher.
Wer Z-Saatgut kauft, kann außerdem auf ein kundenorien-
tiertes Reklamationsmanagement zurückgreifen, wenn
im Fall der Fälle doch mal etwas nicht stimmen sollte.
Für Krainbring noch ein weiterer Grund, der für Z-Saatgut
spricht: Mit Z-Saatgut habe er die Gewissheit, sauberes,
sortenreines Saatgut mit hoher Keimfähigkeit zu bekom-
men. Und sollte es doch einmal Probleme geben, was er Für Phillip Krainbring
bisher allerdings nicht erlebt hat, so „habe ich auch eine werden widerstands-
Möglichkeit zur Reklamation, eine Art Absicherung“. fähige und trocken-
tolerante Sorten
immer wichtiger.
Einsparung von Ressourcen
Mit der Verwendung von Z-Saatgut hat man in der arbeits-
intensiven Ernte- und Aussaatzeit weniger zusätzlichen
Aufwand und kann sich somit auf sein Kerngeschäft kon-
zentrieren. Gleichzeitig entfallen teure Lager- und Trans-
portkosten.
Auch Phillip Krainbring bleibt bei der Wahl des Saatguts
seiner Linie treu und setzt zu 100 Prozent auf zertifizierte
Qualität. Die Vermutung, dass er mit eigenem Nachbau ge-
genüber Z-Saatgut viel Geld sparen würde, ist für ihn nicht
Landwirt Alexander
richtig. „Wenn ich meinen Aufwand für Reinigung, Aufbe- Mauer aus Pripsleben
reitung und Beizung realistisch dagegenstelle, kann sich setzt auf Sortenvielfalt
der Nachbau kaum lohnen“, hat er für sich ermittelt. mit Z-Saatgut.
Besonders wichtig sind Krainbring die verschiedenen Opti-
onen der Saatgutbehandlung. So kann er seine Getreide-
sorten zum Beispiel auch mit Elektronenbeize bestellen.
„Und außerdem sichere ich mit dem Saatgutwechsel den
Zuchtfortschritt“, so der Ackerbauer des Jahres, der froh ist
über die „hohe Dichte der Züchterhäuser in Deutschland“. Züchtungsfortschritt hat nur dann einen praktischen
Wert, wenn er auf den Feldern ankommt. Z-Saatgut steht
www.praxisnah.de/202214
Rechtzeitige Bestellung bietet Sicherheit für standortangepasste Sorten in höchster Qualität: von
Für eine reibungslose Saatgutbeschaffung ist es wichtig, Profis für Profis erzeugt. Zugeschnitten auf den Bedarf
rechtzeitig zu bestellen, weiß auch Dietrich Jänicke aus der regionalen Landwirtschaft sorgt Z-Saatgut für
Dargun: „Wenn Sie drillen wollen, dann müssen Sie das Perspektive im Getreideanbau.
Saatgut auf dem Hof stehen haben.“
Jänicke schwört auf die Qualität von Z-Saatgut: Er habe Text: Janneke Ogink |
stets Zugang zu neuesten Sorten und profitiere von den Fotos: Getreidefonds Z-Saatgut e. V.
praxisnah 1 | 2022 13Betriebsinterview
Zuverlässig(e) Weizenqualität
erzeugen
Das ist das oberste Ziel von Arne Schwuchow, Produktionsleiter
Pflanzenproduktion der Agrar GmbH & Co. KG Wittow-Süd. Mit den
Vorgaben der neuen Düngeverordnung ist dies nicht unbedingt
einfacher geworden. Umso wichtiger wird es für ihn, bei der Sorten-
wahl auf eine hohe N-Effizienz zu achten.
S
ehr viel weiter nördlich geht es auf der Ostseeinsel Fruchtfolgen der Qualitätswinterweizen die Kultur, deren
Rügen nicht mehr: Auf den überwiegend arrondier- Vermarktung aufgrund der nahen Exporthäfen am lukra-
ten 1.750 Hektar der Agrar GmbH & Co. KG Wittow- tivsten ist.
Süd kann man die Ostsee schon riechen. Die Böden weisen
hier eine Bodenzahl zwischen 35 Hohe N-Effizienz als Basis für sichere Qualität
und 85 auf, sind aber meist auf Dabei hat Arne Schwuchow bei der Sortenwahl klare Vor-
den Schlag bezogen homogen. stellungen. „Ziel ist es, sicher qualitativ hochwertigen Qua-
Zwar ist die Ostseeinsel mit 500 litätsweizen zu produzieren. Mit Blick auf die Düngeverord-
bis 530 mm/Jahr nicht so reich nung müssen die Sorten folglich eine gute N-Effizienz auf-
mit Niederschlägen gesegnet wie weisen, also den Stickstoff sowohl in Ertrag als auch in
zum Beispiel die Ostseeküste in Protein effektiv umsetzen“, erklärt Schwuchow seine Priori
Schleswig-Holstein, aber mit dem tätensetzung bei der Sortenwahl. Allerdings kommt für ihn
reichlich anfallenden Tau kommt noch ein wichtiger Aspekt hinzu: „Ich sehe durchaus, dass
man ganz gut über das Jahr. Wo- wir von „außen“ aufgefordert sind, umweltverträglicher zu
Arne Schwuchow bei Arne Schwuchow sehr wohl wirtschaften und das sehe ich selbst auch so. Die Wahl von
festgestellt hat, dass selbst hier gesunden Sorten ist daher eine wichtige Stellschraube da-
die Vorsommertrockenheit in den letzten Jahren häufiger für, die Pflanzenschutzaufwendungen zu senken.“ Natür-
vorkam und für einige Kulturarten ertragliche Nachteile mit lich bleibt auch der Ertrag ein extrem wichtiges Kriterium,
sich brachte. auch weil die Düngerbedarfsermittlung auf dem Durch-
schnittskornertrag der letzten fünf Jahre basiert. Der Roh-
Winterweizen bleibt die Hauptkultur proteinertrag wird hier nicht berücksichtigt. Um hier keine
In der Agrar GmbH wurde bis vor wenigen Jahren die für Abwärtsspirale in Gang zu setzen, müssen die Sorten in der
diese Region typische, extrem wintergetreidelastigen Summe also auch ansprechende Erträge bringen.
Fruchtfolgen Winterraps/Winterweizen/Wintergerste oder
auch Winterraps/Winterweizen/Winterweizen/Wintergerste Den A-Weizen Lemmy hat der Landwirt jetzt im 3. Jahr im
gefahren. Anbau zzt. auf ca. 200 Hektar. Auf die Sorte aufmerksam
wurde er auch durch Demos bei dem in der Nähe liegen-
„Nicht nur wegen der politischen Vorgaben müssen wir den Betrieb der Nordsaat Saatzucht. Aus der anfänglichen
umdenken und die Fruchtfolgen mit Sommerungen erwei- Testsorte wurde dann eine der Stammsorten, denn bei Er-
tern, denn auch der Ackerfuchsschwanz wird zunehmend trägen vergleichbar denen der ebenfalls im Anbau befind-
zu einem schwer kontrollierbaren Problem“, erläutert der lichen Sorte LG Initial liefert Lemmy 1–2 % mehr Rohpro-
Landwirt. Da Mais aufgrund des – inselweit – mangelnden tein. „Nach Erbsen lieferte Lemmy 2020 105 dt/ha bei 14 %
Viehbesatzes aber kein Thema ist, wird mit Futtererbsen Rohprotein. Selbst als Stoppelweizen konnte er überzeu-
und Ackerbohnen sowie Sommergerste und im Flächen- gen. Seine ebenfalls sehr gute Backqualität wird leider sel-
tausch Kartoffeln gearbeitet. Allerdings wirkt sich auf die ten honoriert, weil die hier produzierten Qualitätsweizen
Leguminosen die Vorsommertrockenheit im Mai und Juni aufgrund der Nähe zu Exporthäfen und der Insellage fast
sehr ertragsreduzierend aus. 2021 wurde aufgrund seines ausnahmslos in den Export gehen“, bedauert er ebenso
geringeren Stickstoffbedarfes der Winterroggen auf den wie die Tatsache, dass die letzte regional ansässige Mühle
leichteren Standorten mit aufgenommen. Demnach ist aufgegeben hat und damit keine regionalen Vermark-
bei den jetzigen und auch den mittelfristig geplanten tungsmöglichkeiten mehr bestehen.
14 praxisnah 1 | 2022Darum brauchen wir Weizensorten mit
hoher N-Effizienz und Proteingehalt!
Höhere Proteingehalte im Qualitätsweizensegment wirken
sich zwar positiv auf die Backeigenschaften von Weizen aus.
Es gibt jedoch durchaus auch Sorten, die bei niedrigeren Pro-
teingehalten gute Backeigenschaften aufweisen. Da in der
Praxis jedoch Qualität auf Basis des Proteingehaltes honoriert
wird, werden diese Sortentypen zzt. unterbewertet.
Matthias Rapp,
Mit Blick auf die reformierte Düngemittelverordnung und die Weizenzüchter
steigenden Energie- und Düngemittelpreise ist in Zukunft ein W. von Borries-
verminderter Düngemitteleinsatz absehbar. Insgesamt wird Eckendorf
sich dies voraussichtlich in geringeren Kornerträgen und einem
deutlich geringeren Proteingehalt widerspiegeln.
N-effiziente Sorten, die möglichst den gesamten Stickstoff aufnehmen und in einen ho-
hen Proteingehalt umwandeln, könnten diese Entwicklung abfedern und werden somit
in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen.
Früh gesät, früh geerntet Vorteile von früh reifenden Weizensorten
Rügen gehört zu den Regionen im bundesweiten Ver- Für die Vermarktung hat sich die Frühreife von Lemmy als
gleich, die früh mit der Winterweizenaussaat beginnen. So sehr positiv erwiesen, denn ein Teil dieser Sorte kann dann
startet auch Arne Schwuchow schon am 10./12. September die Ex-Ernte-Kontrakte bedienen. Dies bringt aber noch ei-
und versucht, die Aussaat bis Mitte Oktober abgeschlossen nen weiteren Vorteil mit sich: „Lemmy wird hier so früh reif,
zu haben, denn danach wird es oft zu nass für eine ordnungs- dass wir einen Teil sogar vor Raps dreschen konnten! Das
gemäße Saat. Dabei bleibt er mit 260 bis 270 Körnern/m² hat den enormen Vorteil, dass man damit vor dem nachfol-
eher im unteren Bereich, damit die Bestände nicht zu üp- genden Raps für Bodenbearbeitung und Bestellung mehr
pig werden. Auch bei den Beizen wird versucht, Pflanzen- Zeit hat. Außerdem konnte der erntereife Rapsbestand im
schutzmittel einzusparen und so experimentiert man hier aktuellen Jahr etwas länger/besser abreifen als wenn er
mit Nährstoff- und Elektronenbeizen. Beim Herbizideinsatz gleich nach dem Gerstendrusch beerntet worden wäre.
sind aufgrund des Ackerfuchsschwanzaufkommens jedoch Zusätzlich ergibt sich durch solch frühreife Sorten die Mög-
volle Aufwandmengen angesagt. lichkeit, den Weizendrusch insgesamt auf einen längeren
Erntezeitraum auszudehnen.“
Die Stickstoffdüngung erfolgt in drei oder auch vier Gaben,
wobei die erste so früh wie möglich erfolgt. Denn das Meist wird der Qualitätsweizen in den betriebseigenen
Frühjahr ist hier meistens lange kühl und entsprechend Hallen sortenrein eingelagert, um die dann homogene
lange braucht der Nährstoff für den Weg in die Pflanzen. und bekannte Qualität der einzelnen Sorten zielorientier-
Die erste Gabe mit stabilisiertem Harnstoff macht etwa ein ter vermarkten zu können. Zudem ist aus rein logistischen
Drittel der Gesamtmenge aus. Für die qualitätssichernde Gründen ein vollständiger Abtransport des Erntegutes in
dritte und vierte Gabe wird ein N-Tester verwendet, der den Sommermonaten schwierig: Rügener Realität ist, dass
N-Sensor erwies sich aufgrund der Homogenität der Böden Hunderte von Touristenautos die Straßen schon morgens
als nicht notwendig. Bisher werden zwar auch Satelliten verstopfen. Und im Stau stehende Lkw will niemand be-
daten genutzt, um die Stickstoffgaben an die unterschied- zahlen müssen.
liche Bestandesentwicklung anzupassen. Aber mittelfristig
ist geplant, mithilfe standortspezifischer Streukarten und Fazit
modernster Applikationstechnik gezielter auf die Bestandes- Schlussendlich ist das oberste Ziel von Arne Schwuchow,
entwicklung reagieren zu können. sicher Qualitätsweizen mit guten Qualitäten und auch
ausreichend hohen Erträgen zu produzieren. Zudem will
Abb. 1: N-Effizienz der meistgeprüften A-Weizen der er möglichst Pflanzenschutzmittel einsparen. Damit ist
LSV 2019 und 2020, orthogonal bundesweit 98 Standorte klar, dass seine Wahl auf Sorten fällt, die eine sehr gute
12,0 N-Ausnutzung bei gleichzeitig guter Gesundheit mit-
Rohproteinertrag dt/ha
Lemmy Ø gesamtes Sortiment auf diesen
11,9 bringen. Auf Ertrag kann, will und muss er dabei nicht
www.praxisnah.de/202215
Standorten 11,1 dt/ha Rohproteinertrag
11,8
verzichten.
11,7
11,6 LG Initial
11,5 Text: Dr. Anke Boenisch, Martin Rupnow |
Apostel Asory
11,4 Fotos: praxisnah, Matthias Rapp
RGT Reform
11,3
98 99 100 101 102 103
Kornertrag relativ, 100 = Mittel der jeweiligen VR-Sorten
Quelle: nach Daten der Länderdienststellen
praxisnah 1 | 2022 15Sie können auch lesen