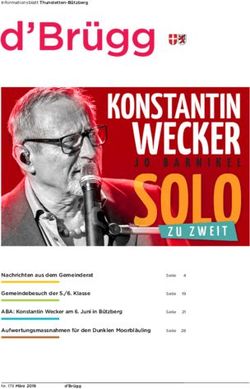Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln - BUW-Preisverleihung BundesUmweltWettbewerb 2006/2007 - Wettbewerb der Talente
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
BUW-Preisverleihung
BundesUmweltWettbewerb
2006/2007
Vom Wissen
zum nachhaltigen Handeln
Wettbewerb der Talente –
von Varroamilben über Knabenkraut
bis zu Biosensoren
1|
Inhalt Impressum
Inhalt
3 Grußwort
6 Preisverleihung 2006/2007
Zu Gast im Hahn-Meitner-Institut Berlin
11 Festvortrag:
„Die Zukunft von Solarzellen – Flexible, organische
und Mehrfachzellen“
Die Hauptpreisarbeiten
41 Silber und Bronze für BUWler in Istanbul
16 Schmetterlinge in Not – Erste Hilfe für bedrohte Arten!
45 Die Preisträgerinnen und Preisträger
20 Untersuchungen zur Biologie der Miniermotte Cameraria
ohridella und zum Befall der Rosskastanie im Stadtgebiet 49 BundesUmweltWettbewerb kompakt
von Sarstedt (Niedersachsen)
51 Förderer
24 Bienensterben – Bedeutung der Varroamilbe & Co.
.
27 Ökostrom – Klimaschutz aktiv. Ein einfacher Weg für
jeden Bürger seine CO2 -Bilanz zu verbessern
30 Tagfaltermonitoring als Grundlage für Maßnahmen zur
Steigerung der Biodiversität
34 Die Erhaltung des Hellgelben Knabenkrauts
(Dactylorhiza ochroleuca)
38 Entwicklung und Anwendung eines Biosensors auf Basis
der Sauerstoffproduktion von Algen
Impressum
Herausgeber: BUW (BundesUmweltWettbewerb) ● Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel (IPN) ●
Olshausenstraße 62 ● 24098 Kiel ● Telefon: 04 31/54 97 00 ● Fax: 04 31/880-31 42 ● E-Mail: buw-sekr@ipn.uni-kiel.de ● Internet:
www.buw-home.de ● Redaktion: Birgit Rademacher, Mark Müller-Geers
© 2007 BundesUmweltWettbewerb
Durch die Mitwirkung am BundesUmweltwettbewerb werden alle Urheberrechte an Bildern und Texten der Teilnehmer auf den Veranstalter übertragen.
3Grußwort
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der BUW- Zeitschrift.
l Im Jahr 2007 fand der BundesUmweltWettbewerb zum
17. Mal in Folge und zum zweiten Mal nach der erfolgreichen
Umstrukturierung des BUW in BUW I für die Altersstufe der
13- bis 16-jährigen und BUW II für die 17- bis 21-jährigen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt.
l Der Blick auf das BUW-Jahr 2007 und die vergangenen
Jahre zeigt uns: Der BundesUmweltwettbewerb ist eine Erfolgs-
geschichte. Der Wettbewerb mit dem Motto „Vom Wissen
zum nachhaltigen Handeln“ begeistert heute wie vor 17 Jah-
ren Jugendliche für die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt.
Immer wieder stellen sich Schülerinnen und Schüler mit viel
Engagement der spannenden Herausforderung eigenen um-
weltbezogenen Fragestellungen nachzugehen, nach Lösungen
zu suchen und diese Lösungen nachhaltig umzusetzen. Das l In Wettbewerbsjahr 2007 haben sich erneut einzelne
zeigt die positive Resonanz auf den BundesUmweltWettbe- Schülerinnen und Schüler, kleinere Schülergruppen sowie
werb, an dem sich im vergangenen Jahr 412 Mädchen und ganze Projektgruppen den Herausforderungen des BUW
Jungen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligten. gestellt. Sie haben eine Vielfalt an Ideen und Projekten ent-
wickelt und als Wettbewerbsbeitrag eingereicht. Die Band-
l Der BundesUmweltWettbewerb bietet durch den Umwelt- breite der eingereichten Arbeiten reicht von der Entwicklung
bezug mit seinen sozialen, wirtschaftlichen, politischen sowie eines neuartigen Kochsacks zur Verbesserung der Lebens-
naturwissenschaftlichen Anknüpfungspunkten besonderes umstände der Menschen in den Townships von Südafrika
Potenzial zur interdisziplinären Arbeit. Durch die Auseinan- über einen Biosensor auf Grundlage der Algensauerstoff-
dersetzung mit Umweltproblemen in ihrem lokalen Umfeld produktion zur Erkennung von Gewässerbelastungen bis
erwerben Schülerinnen und Schüler nicht nur umweltbezo- hin zu einer Bienenerfahrungskiste zur Vermittlung von
gene Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie lernen ver- Wissen im Unterricht. Weitere Wettbewerbsbeiträge des
netzt zu denken und werden angeregt, nach eigenen kreativen BUW befassen sich mit einer Untersuchung zum Erhalt des
Lösungen für Probleme unserer Welt zu suchen. Hellgelben Knabenkrauts, dem Problem des CO2-Ausstoßes
und mit der Herstellung von Energie und Dünger aus Mist.
l Dies ist eine zentrale Voraussetzung, die Zusammenhän- Die Vielfältigkeit der eingereichten Themen lässt vermuten,
ge unseres „Systems Erde“ besser zu verstehen und sich für dass es für die Jurys des BUW I und BUWII keine leichte Auf-
unsere Umwelt einzusetzen. Das Engagement der Schülerin- gabe war, aus den 98 eingereichten Arbeiten unterschiedlichs-
nen und Schüler, die sich neben den schulischen Verpflich- ter Art die Preisträger heraus zu kristallisieren. Doch schließ-
tungen innovativen Ideen unterschiedlichster Art widmen, ist lich stand die Entscheidung fest und insgesamt 42 Jugend-
nicht hoch genug zu bewerten. Dasselbe gilt für den Einsatz liche und junge Erwachsene wurden für ihre herausragenden
aller betreuenden Lehrerinnen und Lehrer und der Eltern, Leistungen ausgezeichnet. Ausschlaggebend für die Vergabe
welche die Jugendlichen in ihrem Engagement unterstützen. der Preise waren vor allem die Originalität und die Kreativität
bei der Lösungsfindung, die wissenschaftliche Genauigkeit
der angewandten Methoden, die praktische Umsetzbarkeit
Vom Wissen und die Nachhaltigkeit der Projekte. Für die Schülerinnen
nachhaltigen
zum
Handeln und Schüler stellen die Preise eine verdiente Anerkennung
ihrer außergewöhnlichen Leistung dar.
4ät
ativit
Originalität
& Kre
Näheres zu den Gewinnern und ihren spannenden Beiträgen Für das kommende BUW Jahr freuen wir uns wieder auf viele
sowie über die Preisverleihung finden Sie auf den nächsten spannende Wettbewerbsbeiträge. Gerne stehen wir Ihnen bei
Seiten. Fragen zum BUW zur Seite und unterstützen Sie mit Infor-
mationen und Anregungen.
l Neben den Informationen über die Wettbewerbsbeiträge
des BUW gibt es auch folgende personelle Änderungen: Zum l Viel Spaß bei der Lektüre und weiterhin ein anregendes,
Ende des Jahres 2007 hat Frau Dr. Mackensen-Friedrichs die interessantes und erfolgreiches Schuljahr, wünscht Ihnen
Geschäftsführung des BUW an Herrn Müller-Geers über-
geben. Neben der Geschäftsführung übernimmt Herr Müller- Ihr BUW Team
Geers die Koordination des BUW II. Frau Rademacher ist wie
bisher für die Koordination des BUW I zuständig. Frau
Rademacher und Herr Müller-Geers haben in ihren bishe-
rigen beruflichen Tätigkeiten als Biologin bzw. als Geoöko-
loge viel Erfahrung in der naturwissenschaftlichen Bildung
und der Umweltbildung mit Schülerinnen und Schülern
gesammelt und können diese nun für den BUW einsetzen.
Ein weiteres neues Gesicht im Team ist Frau Conradt, die als
Nachfolgerin von Frau Maaß seit Mitte 2007 als Sachbearbei-
terin im BUW-Sekretariat tätig ist. Frau Berthier, mit ihrer
langjährigen Erfahrung im BUW, bleibt weiterhin die maß-
gebliche Säule des BUW-Sekretariats. Das Team des BUW
möchte sich sowohl bei Frau Dr. Mackensen-Friedrichs als
auch bei Frau Maaß herzlichst bedanken und Ihnen alles
Gute und viel Erfolg für ihre weiteren Tätigkeiten wünschen.
spannende
Wettbewerbsbeiträge
5BUW-Preisverleihung
Zu Gast im Hahn-Meitner-Institut Berlin
Am 21. September 2007 wurden im Rahmen einer Festveranstaltung im Hahn-Meitner-Institut (HMI)
in Berlin Jugendliche und junge Erwachsene für ihre herausragenden Leistungen im BundesUmwelt-
Wettbewerb (BUW) 2006/2007 ausgezeichnet.
Ideen und Engagement
im Umweltschutz
l Im September 2007, genauer gesagt am 21. des Monats, l Und noch ein Unterschied zu Hollywood – alle Teilnehmer
erinnerte die Atmosphäre in den Räumen des Hahn-Meitner- des Wettbewerbs, die aus dem ganzen Bundesgebiet nach
Institutes in Berlin ein wenig an Preisverleihungen in Holly- Berlin eingeladen wurden, waren nicht nur nominiert, ihnen
wood. Doch statt Filmgrößen waren Jugendliche und junge war bereits ein Preis sicher. Nachdem sie sich mit einer Doku-
Erwachsene eingeladen, die durch ihre Ideen und durch ihr mentation ihrer Umweltprojekte am BUW 2006/2007 beteili-
Engagement im Umweltschutz auf sich aufmerksam gemacht gt hatten und ihre Arbeiten von den Jurys als besonders aus-
hatten. Statt Oscars warteten jedoch in den beiden Alterskate- zeichnungswürdig eingestuft wurden, war ihnen nun einer
gorien des BUW eine Fülle von Sach- und Geldpreisen auf der Sonder- oder vielleicht sogar einer der Hauptpreise sicher.
die Siegerinnen und Sieger des BUW 2006/2007. Welcher es werden würde, das war für alle noch ebenso ein
Geheimnis wie für die Teilnehmer einer Oscarverleihung die
Antwort auf die Frage, welche der Filmgrößen bei der Preis-
verleihung letztendlich das Rennen machen würde. Entspre-
chend groß war bereits lange vor der Ankunft in Berlin die
Nervosität bei den 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
sowie ihren Betreuern.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Preisverleihung
6Folk,
Pop, Rock
zukünftige
Energieversorgung
Prof. Rech Die Band „Feuertaufe“
l Jetzt, 10 Uhr morgens, hatte das Warten beinahe ein l Dann war es soweit – die Juryvorsitzenden Frau Professor
Ende, denn dies war der Zeitpunkt, an dem Dr. Ulrich Breuer, Dr. Susanne Bögeholz und Herr Professor Dr. Gerrit Schüür-
der kaufmännische Geschäftsführer des Hahn-Meitner-Insti- mann gaben noch einen Überblick über die Themenband-
tuts, die Veranstaltung eröffnete. In seiner Rede begrüßte er breite der Wettbewerbsbeiträge und die herausragenden
alle Anwesenden und hieß sie in den Räumen des Instituts Leistungen der Teilnehmer. Dann stand die Preisverleihung
herzlich willkommen. Im Anschluss dankte Frau Dr. Susanna auf dem Programm. Für jede der anwesenden Teilnehmerin-
Schmidt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung nen und Teilnehmer des BUW war bereits die Nominierung
(BMBF) den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr vor- und die damit verbundene Einladung in die Bundeshaupt-
bildliches Engagement im Umweltschutz. Sie beließ es aber stadt Berlin eine riesige Anerkennung für ihre Arbeit. Zwar
nicht nur bei Dankesworten. Wenig später sollte sie mit dem hatten die jungen Umweltschützer und -schützerinnen ihre
Überreichen der Preise ihrem Dank handfeste Taten folgen Projekte nicht gestartet, um dafür einen Preis zu bekommen,
lassen. Doch zuvor freute sich Dr. Benjamin Immanuel Hoff sondern weil sie aktiv etwas für unsere Umwelt tun wollten.
als Vertreter der Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Ver- Doch jetzt ging es auch um viele Sachpreise und um Geld-
braucherschutz der Stadt Berlin, Frau Katrin Lompscher, über preise bis zu 1.500 Euro und um mehrere Praktikumsplätze.
die große Zahl an Ideen und Projekten, mit welchen die Teil- Zwei der Preisträger erhielten sogar noch eine Einladung zur
nehmerinnen und Teilnehmer einen wichtigen Beitrag für internationalen Umweltolympiade nach Istanbul und damit
eine intakte Umwelt die Möglichkeit, das eigene Projekt vor einer Weltöffentlich-
geleistet hatten. keit zu präsentieren. So wunderte es nicht, dass die Anspan-
nung von Sekunde zu Sekunde anstieg, bis alle Preise verge-
l In dem sich daran anschließenden Festvortrag referierte ben und alle Laudatios für die Hauptpreisträger gehalten
Professor Rech vom Hahn-Meitner-Institut über die Zukunft worden waren.
von Solarzellen. Dieser Vortrag war für alle, die sich Gedanken
um die zukünftige Energieversorgung machen, eine Quelle
vieler neuer Informationen und Anregungen.
Die anschließende Pause wurde von der Band „Feuertaufe“
mit ihrem Programm aus Folk, Rock und Pop nicht einfach
nur gefüllt, die Berliner Schülerband war ein absolutes High-
light und ließ ein wenig die Nervosität vergessen, mit der alle
der eigentlichen Preisverleihung entgegen fieberten.
Frau Dr. Susanna Schmidt vom BMBF und
Frau Prof. Dr. Susanne Bögeholz bei der Preisübergabe
7l Im BUW I gingen die diesjährigen Hauptpreise an
Katharina Loevenich für die Arbeit „Schmetterlinge in Not –
Erste Hilfe für bedrohte Arten“ und an Phillip Grange,
Janette Bäte und Michaela Wolf für ihren Beitrag „Untersu-
chungen zur Biologie der Miniermotte Cameraria ohridella
und zum Befall der Rosskastanien im Stadtgebiet von Sarstedt
(Niedersachsen)“. Ein weiterer Hauptpreis ging an die
Gruppensprecherinnen Viktoria Pleyer und Lisa Staeck für
die Projektarbeit „Ökostrom – Klimaschutz aktiv. Ein ein-
facher Weg für jeden Bürger seine CO2-Bilanz zu verbessern“.
Auch Tabea Pocha und Janna Köbke-Kahl erhielten für ihre
Arbeit „Bienensterben – Bedeutung der Varroamilbe & Co.“
einen BUW-Hauptpreis.
l Für die Altersgruppe der 17- bis 21-Jährigen im BUW II
wurden in diesem Jahr drei Hauptpreise verliehen. Einen
Hauptpreis erhielt Carsten Reinhard für den Beitrag „Tagfal-
termonitoring als Grundlage für Maßnahmen zur Steigerung
der Biodiversität“, weitere Hauptpreise gingen an Justine Sturm
und Julia Schütze für ihr Projekt „Die Erhaltung des Hellgelben Experimente im Schülerlabor des
Hahn-Meitner-Instituts
Knabenkrauts (Dactylorhiza ochroleuca)“ sowie an Tobias
Hahn und Philomena Apitzsch für ihre Arbeit „Entwicklung
und Anwendung eines Biosensors auf Basis der Sauerstoff- l Bei einem Glas Sekt bot sich dann allen Beteiligten
produktion von Algen“. noch einmal die Gelegenheit, den Vormittag in Gedanken
und in Gesprächen Revue passieren zu lassen. Mit den
l Jetzt endlich hatten alle Wettbewerbsteilnehmer die ihnen sich anschließenden Führungen durch das Hahn-Meitner-
gebührenden Preise als Auszeichnung für ihre hervorragen- Institut und der Möglichkeit in den Schülerlaboren selbst
den Arbeiten erhalten und die ganze Anspannung hatte sich Experimente durchzuführen, fand die Preisverleihung einen
gelöst. gelungenen Abschluss.
l Diese Preisverleihung war ein Ereignis im Leben der
Preisträgerinnen und Preisträger, das sie wohl nie vergessen
werden. Es ist auch ein Ansporn, sich für unsere Umwelt
weiter aktiv einzusetzen.
l Für viele andere junge Umweltschützer ist es vielleicht
auch ein Ansporn, ihre eigenen Ideen zur Lösung von
Umweltproblemen in ihrem Umfeld in die Tat umzusetzen,
ihre Projekte mit großem Engagement durchzuführen und
als Beitrag zum BUW 2008 einzusenden.
Also bis dann,
bis zur Preisverleihung
2008.
8Festvortrag
Die Zukunft von Solarzellen
Energieverbrauch
Klimadebatte
Energie-Ressourcen der Erde
l Wozu überhaupt Solarstrom?
Nicht erst seit der Klimadebatte ist klar, dass unser jetziger Sonne, Wind, Erde & Co. bieten viel mehr Energie, als
Energieverbrauch nicht nachhaltig ist. Die fossilen Energie- wir Menschen brauchen. Zumindest aber genug, um
träger Kohle, Öl und Gas sind begrenzt, und das Potenzial den Energiebedarf der Menschheit zu decken. Bislang
politischer Probleme konnte beispielhaft am Konflikt zwi- wird nur ein Bruchteil dieser nahezu unendlichen Ener-
schen der Ukraine und Russland 2006 beobachtet werden. giequellen genutzt.
Dass bei der Verbrennung fossiler Energieträger ungesunde (Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft BSW)
Stoffe und Abgase entstehen, ist ein weiteres Problem, das
momentan gerne unter den Tisch gekehrt wird. Aber auch http://www.solarwirtschaft.de/medienvertreter/info-
Uran ist nur in begrenzten Mengen verfügbar, von der Gefahr grafiken.html
und ungelösten Entsorgungsproblematik des Atomstroms http://www.unendlich-viel-energie.de/index.php?id=113
völlig abgesehen. Wir brauchen für die Zukunft also Energie-
träger, die eine nachhaltige Energieversorgung garantieren
und gleichzeitig die Probleme der fossilen und atomaren
Träger umgehen. l Strom aus Halbleitern – wie geht das überhaupt?
Am einfachsten erklärt sich diese etwas komplizierte Materie
Die Sonne liefert weltweit ein Vielfaches der Energie, die ver- am Silizium, welches momentan den überwiegenden Anteil
braucht wird. Sie bietet sich daher als Energiequelle an, die der Photovoltaik-Module ausmacht. Wenn Licht auf das Halb-
langfristig angezapft werden kann. Um das Sonnenlicht in leiter-Material fällt, werden Elektronen angeregt. Durch diese
Strom umzuwandeln, benötigt es die Photovoltaik (im Gegen- Anregung steigt ihr Energieniveau, d.h. die Energie des Lichts
satz zur Solarthermie, bei der das Sonnenlicht in Wärme um- ist auf die Elektronen übergegangen. Um aber elektrische
gewandelt wird). Es gibt aber immer noch Einwände gegen Arbeit leisten zu können, müssen sich diese Elektronen von
diese emissionsfreie Technologie, die wir in diesem Text disku- „ihrem“ Atom lösen und durch einen Leiter zum Verbraucher
tieren werden. (z. B. einer Glühbirne) wandern. Dies geschieht beim Silizium
9dadurch, dass durch eine gezielte Verunreinigung mit ande-
ren Stoffen zwei Bereiche entstehen: eine Schicht mit einem
Elektronenüberschuss und eine mit einem Elektronenmangel.
Durch diese beiden Schichten entsteht ein elektrisches Feld,
welches die Elektronen in eine Richtung zieht. So können die
angeregten Elektronen sich aus „ihrem“ Atomverbund lösen
und zu einem elektrischen Leiter wandern. Jetzt endlich kön-
nen sie, z. B. an einer elektrischen Glühbirne, Arbeit verrich-
ten – die Birne leuchtet.
l Wo können Solarzellen eingesetzt werden, und
warum ist das noch so teuer?
Solarzellen können überall da eingesetzt werden, wo die Geplanter Einsatz für die Energieversorgung von Satelliten
Sonne scheint, also auch in Deutschland. Überall, wo Strom im Weltraum.2
benötigt wird und kein Stromnetz zur Verfügung steht, kann
Solarstrom diese Lücke füllen. Das kann im Weltraum an der
„International Space Station ISS“ sein, aber auch in Entwick- l Dicke und dünne Schichten zur Stromerzeugung
lungsländern, wo den meisten Einwohnern gar keine Elek- Das Silizium in Kristallform ist der Klassiker unter den photo-
trizität zur Verfügung steht. Entlegene Forschungsstationen voltaischen Materialien. Mit Silizium wurden die ersten Solar-
oder Bojen zur Messung des Seegangs werden mit Solarstrom zellen und -module gebaut, und momentan sind über 90 %
unabhängig von Batterien und Steckern betrieben. Ein ande- der am Markt erhältlichen Module aus Silizium. Silizium hat
res großes Anwendungsgebiet ist die netzgekoppelte Stromer- aber auch einige Nachteile. Es ist teuer, da es aufbereitet, mit
zeugung, bei der der gewonnene Strom ins Stromnetz einge- viel Energie eingeschmolzen, zugeschnitten und verschaltet
speist und entsprechend bezahlt wird. Momentan ist es noch werden muss. Außerdem muss ein so genannter Wafer relativ
so, dass Strom aus konventioneller Erzeugung deutlich billi- dick sein, 100–300 µm, also 0,1–0,3 mm. Die Forscher am
ger ist als Solarstrom. Das liegt zum einen daran, dass die ver- HMI arbeiten daher an einem neuen Ansatz, der Dünnschicht-
gleichsweise junge Photovoltaik-Technologie sich noch in der technologie. Hier sind die aktiven Schichten nur noch ein
Entwicklung befindet. Die produzierten Stückzahlen sind re- Bruchteil so dick, es wird also sehr viel weniger Material benö-
lativ klein, die Produktion teuer. Andererseits ist Strom aus tigt. So können zum Beispiel flexible Solarzellen entwickelt
fossilen und atomaren Trägern schlicht zu billig – die Rech- werden. Auch ist der Energieeinsatz in der Produktion deut-
nung zahlen unsere Umwelt und unsere Kinder. An der Sen- lich geringer. Durch die Verwendung vorhandener industri-
kung der Kosten arbeiten die Forscher am Hahn-Meitner- eller Technologien müssen zudem im Idealfall keine neuen
Institut, indem sie die Materialien zur Umwandlung von Maschinen entwickelt werden – all das senkt den Preis. Da
Licht in Strom weiter verbessern. das Silizium aber schon viel länger auf dem Markt ist und
auch durch den Einsatz in der Prozessor-Technologie gut
erforscht ist, sind Zellen und Module aus Silizium momentan
noch effizienter als Dünnschicht-Module – das heißt, sie
wandeln einen größeren Prozentsatz des einfallenden Lichts
in Strom um. Aber die dünnen Schichten holen auf, in Zukunft
werden neben den bläulich schimmernden Modulen immer
mehr Module im Nadelstreifenlook von den Dächern scheinen.
Silizium-vs.
Dünnschichttechnologie
Hier werden dünne
Schichten zur Strom-
erzeugung hergestellt.1
1 2
Quelle: HMI/SchurianTechnologielabor Quelle: HMI/Flexible Dünnschichtsolarzelle aus Kupfer,
am Hahn-Meitner-Institut Indium, Gallium und Selenid (CIGSe).
10Veränderungen des weltweiten Energiemixes bis 2100
l Eine neue Industrie entsteht, die Zukunft ist sonnig
Weltweit wächst die Solarzellenproduktion jährlich um über Solarstrom wird langfristig die wichtigste Primärenergie-
40 %, in Deutschland wuchs das Produktionsvolumen von quelle im weltweiten Energiemix sein, so die Prognose
2002 bis 2006 auf das über 30-fache an, Tendenz steigend. des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung
Aber immer noch ist die Industrie auf Förderung vom Staat Globale Umweltveränderungen (WBGU). Im Jahr 2050
angewiesen. Durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wird nach dieser Prognose Solarstrom bereits 24
erhalten Bürger, die Solarstrom aus ihrer eigenen Photovol- Prozent, bis zum Jahr 2100 63 Prozent zur weltweiten
taik-Anlage ins Stromnetz einspeisen, einen garantierten Energieerzeugung beitragen. Die konventionellen
Abnahmepreis, der vom Staat subventioniert wird. Hierbei Energieträger verlieren dagegen stark an Bedeutung.
darf man allerdings nicht vergessen, dass auch Kohle und (Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft BSW)
Atomstrom direkt oder indirekt subventioniert werden. Die
Forscher hoffen, im Jahr 2015 bis 2020 Solarstrom zu http://www.solarwirtschaft.de/medienvertreter/info-
konkurrenzfähigen Preisen anbieten zu können. Das könnte grafiken.html
sogar noch schneller gehen, wenn sich die Preise für Öl und http://www.unendlich-viel-energie.de/index.php?id=113
Gas weiterhin so rasant entwickeln. Deutschland hat hier gute
Chancen, weltweit weiter ganz vorne mitzumischen. Um die-
sen Vorsprung zu halten, müssen die Anstrengungen in For-
schung und Entwicklung weiter verstärkt werden, denn die
Konkurrenz schläft nicht. Die Wissenschaftler am HMI sind
hier an vorderster Front aktiv, damit wir einer sonnigen
Zukunft entgegensehen können.
sonnige Zukunft
dank
Solarenergieforschung
Photovoltaik
Öffentlichkeitsarbeit: Erik Zürn
Fon: 0 30/80 62-23 20 • Fax: 0 30/80 62-24 82
Email: erik.zuern@hmi.de
Festvortrag von Prof. Dr. Bernd Rech • Text: Erik Zürn
11Hauptpreise
BUW I
und
BUW II
12Betreuerin:
Barbara Knieps
Hauptpreis BUW I Preis für hervorragende Betreuung
Schmetterlinge in Not – Erste Hilfe für bedrohte Arten!
Die Faszination für die Natur, insbesondere für die Schmetterlinge mit ihrer Farbenpracht und
Artenvielfalt sowie die bedrohlichen Meldungen in den Medien über den Rückgang der Arten
waren der Ausgangspunkt für Katharina Loevenich (13 Jahre), sich näher mit den Schmetterlin-
gen in ihrer Region und ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Besonders interessierte sie,
ob die Falter ihrer Region auch vom Aussterben bedroht sind. Welche Gründe könnten mögli-
cherweise dafür verantwortlich sein? Und was kann man für ihren Schutz tun?
l Zur Klärung dieser Fragen war es notwendig, mehr über
die Schmetterlinge zu erfahren. Dazu gehörten ihre Ernäh-
rungs- und Lebensweise, ihre Entwicklung, aber auch die
ökologischen Zusammenhänge, wie beispielsweise der Ein-
fluss des Menschen auf die Natur. Aus diesem Grund beschäf-
tigte sich die Preisträgerin zunächst mit der Biologie der
Schmetterlinge, indem sie ihre Entwicklung von der Raupe
bis zum Schmetterling in einem selbst konstruierten Terrari-
um von etwa 38 cm Länge, 33 cm Breite und 32 cm Höhe
beobachtete. So erfuhr die Schülerin aus direkter Anschauung
viel über die Lebensgewohnheiten der Familie der Schmetter- Versuch zur Wahrnehmung von Farben bei Schmetterlingsraupen
linge (Lepidoptera) und ihre Haltungsbedingungen.
l Um Aufschluss darüber zu erhalten, wie Schmetterlinge
auf Umweltreize reagieren, führte Katharina in einer aufwän-
digen Versuchsreihe unterschiedliche Tests durch. Sie testete
die Reaktionen von Schwammspinnerraupen auf verschiede-
ne Sinneseindrücke, unter anderem auf den Geruchs- und/
oder Geschmackssinn. Hierzu wurden zunächst Blätter ver-
schiedener Pflanzen ausgepresst. Anschließend wurde der Saft
tropfenweise auf Glasplatten verteilt und das Verhalten der
Schmetterlinge beobachtet sowie protokolliert. In weiteren
Versuchen wurden den Schmetterlingen dunkle und helle
Bereiche angeboten. Um Rückschlüsse auf ihre Wahrneh-
mung von Licht zu ziehen, wurde der jeweils bevorzugte
Aufenthaltsort der Schmetterlinge ermittelt.
Schmetterlingsterrarium l Im Anschluss an den Erwerb dieser Kenntnisse infor-
mierte sich die Schülerin über den Schmetterlingsbestand in
Nordrhein-Westfalen, ihrem Heimatraum. Sie erfuhr, dass in
von der
Raupe zum diesem Bundesland 47% der Falterarten bedroht sind, wie
beispielsweise der Schwarzfleckige Feuerfalter (Glaucopsyche
Schmetterling arion) oder der Quendel-Ameisenbläuling. Daraufhin recher-
chierte sie mögliche Ursachen für diesen Rückgang, wie die
Eingrenzung ihres Nahrungs- und Lebensraumangebotes
durch den Menschen. So sind beispielsweise in Gärten mit
13„Englischem Rasen“, in denen nur wenige verschiedene Pflan-
zenarten vorhanden sind, nur bis zu drei Falterarten zu fin-
den, dagegen in Naturgärten bis zu 30 Schmetterlingsarten.
Ganz besonders wichtig ist das Nahrungsangebot für mono-
phage Arten wie den Beerentaubenkropf-Kapselspanner
(Perizoma lungdunaria). Wenn diese spezielle Fraßpflanze,
von der Raupe monophager Arten sich ausschließlich ernäh-
ren, nicht zur Verfügung steht, verhungert die junge Larve. Perizoma lungdunaria
Insgesamt bevorzugen Schmetterlinge heimische Pflanzen
und benötigen vielfach Futterpflanzen, die von den Menschen
Glaucopsyche
arion
als Unkraut angesehen werden. Mit exotischen Pflanzen, wie
sie vielfach angebaut werden, können heimische Arten nichts
anfangen. Durch die Vernichtung dieses „Unkrauts“ in Gärten
und in öffentlichen Parks sterben auch in Nordrhein-Westfalen l Ein weiterer Grund für das Artenschwinden der Schmet-
gehäuft Falterarten aus. terlinge in Katharinas Heimatraum ist, dass große Naturge-
biete durch die Versiegelung von Straßenbau, Gewerbegebie-
ten usw. aufgrund der wachsenden Bevölkerung bzw. des
immer größer werdenden Flächenbedarfs verloren gehen. So
wird der Lebensraum vieler Tierarten vom Menschen beschlag-
nahmt. Auch bedrohen Industrie- und sonstige Abgase die
Schmetterlingspopulation.
l Um die Artenvielfalt der wunderschönen Schmetter-
lingsfamilie zu erhalten, appellierte Katharina an alle Gemein-
den in ihrer lokalen Umgebung, die Flächennutzungspläne
stärker an den Tier- und Artenschutz anzupassen, damit der
Schmetterlingsbestand für folgende Generationen gesichert
Achatfalter
werden kann.
l In einem weiteren Schritt zog sie „schmetterlingsfreund-
liche“ Pflanzen vor und plante und gestaltete unter Beachtung
Achatfalter der Hinweise von Experten, wie der Biologin und Garten-
gestalterin Stefanie Martin, naturgerechte Gärten in ihrem
eigenen Umfeld.
l Getreu dem Motto „Man kann nur lieben und erhalten,
was man kennt“ führte Katharina Loevenich zur Aufklärung
und Sensibilisierung der Menschen in ihrer Umgebung einen
Projekttag durch, hielt Vorträge und organisierte Informa-
tionsstände. Die mit viel Freude durchgeführten und mit
Begeisterung aufgenommenen Aktionen ermunterten die
Schülerin zu einem Zeitungsartikel und zur Gestaltung einer
Homepage. Damit informierte sie zahlreiche Besucher über
die Lebensweise und Entwicklung, Artenvielfalt, Bedrohung
und die möglichen Hilfsmaßnahmen für Schmetterlinge, wie
zum Beispiel das Anpflanzen von beliebten Futterpflanzen.
Katharina bei der Gartengestaltung l Zusätzlich zu vielen positiven Rückmeldungen ergaben
sich aus diesen Aktivitäten weitere Anfragen für schmetterlings-
freundliche Gartengestaltungen.
14Betreuerin:
Verena Garve
Hauptpreis BUW I Preis für hervorragende Betreuung
Untersuchungen zur Biologie der Miniermotte Cameraria
ohridella und zum Befall der Rosskastanie im Stadtgebiet
von Sarstedt (Niedersachsen)
Begonnen hat alles mit dem Befall der Rosskastanie in ihrem Schulhof. Von ihrer Lehrerin darauf aufmerksam gemacht,
wuchs bei dem Schüler Phillip Grange (16 Jahre) und den Schülerinnen Janette Bäte (15 Jahre) und Michaela Wolf (16
Jahre) das Interesse, sich mit dieser Problematik intensiver auseinanderzusetzen. Sie begannen die einzelnen Entwick-
lungsstadien der Miniermotte und die Schädigung der Rosskastanienblätter zu erforschen und stießen schnell auf viele
unbeantwortete Fragen: Wie verläuft der Entwicklungszyklus der Miniermotte (Cameraria ohridella) im Jahr 2006? Wie
können Flugfähigkeit und Flugverlauf des Kleinschmetterlings erfasst werden? Warum ist der Schmetterling so schwer
zu entdecken? Welche Rosskastanien sind in Sarstedt von Cameraria ohridella befallen?
erobert die Miniermotte neue Gebiete. Für Deutschland ist
sie erstmals 1992 oder 1993 in Bayern gemeldet worden.
Im nächsten Schritt ihrer Untersuchungen kartierten Phillip,
Janette und Michaela alle Rosskastanien innerhalb eines aus-
gesuchten Stadtgebietes von Sarstedt. Das Ergebnis: Alle 103
weiß blühenden Rosskastanien Sarstedts waren von der
Miniermotte befallen. Im Gegensatz dazu konnte an den rot
blühenden Rosskastanien kein einziger Befall festgestellt wer-
den. Besonders beachtlich war der Fund einer Sarstedter Be-
sonderheit, nämlich einer Rosskastanie, die sowohl Äste mit
nur weißen Blüten als auch Äste mit nur roten Blüten auf-
weist. Nur die Blätter der weiß blühenden Äste dieses Baumes
wiesen Miniergänge auf.
Information der Öffentlichkeit
l Um der Fragestellung zur Befallssituation auf den Grund
l Zunächst informierten sich die Preisträger genau über zu gehen, wurden die einzelnen Entwicklungsstadien der
die Biologie der Miniermotte sowie über die konkrete Befalls- Rosskastanien-Miniermotte und Blätter der Rosskastanie im
situation in ihrer Region. Dazu beschafften sie sich Informa- Jahresverlauf untersucht sowie die Befallsintensität der Ross-
tionen über das Internet, über Bücher und Zeitschriftenartikel kastanien im Kartierungsgebiet erfasst. Mit Hilfe einer Phero-
und befragten Bürger von Sarstedt, einer Kleinstadt im Land- monfalle gelang es Ihnen, den Schmetterling anzulocken und
kreis Hildesheim sowie Experten von der Stadtverwaltung näher zu erforschen. Mit der Sexuallockstoff-Falle auf einem
Ludwigsburg nach Bekämpfungsmaßnahmen gegen Minier- 20 x 10 cm großen Klebeboden konnten bis zu 800 Exempla-
motten. So erfuhren sie, dass viele Universitäten, Institute re der 5mm kleinen Schmetterlinge gefangen werden. Im Ver-
und Forstämter an dem Problem des Befalls von Rosskastani- lauf Ihrer Arbeit konnte die Schülergruppe durch die Anzahl
en durch Miniermotten arbeiten. Eines der größten aktuellen der gefangenen Miniermotten drei Flughöhepunkte und
Forschungsprogramme ist ein EU-Projekt mit dem Namen damit drei Faltergenerationen nachweisen, die auch mit
CONTROCAM (Control of Cameraria). Ergebnissen einer Untersuchung der Berliner Senatsverwal-
tung aus dem Jahr 2006 zum Flugverlauf der Miniermotte
l Der Kleinschmetterling mit dem Namen Rosskastanien- korrelieren.
Miniermotte wurde erstmals 1984 in Mazedonien am Ohrid-
see entdeckt und hat sich bis heute in ganz Zentraleuropa aus- Cameraria
gebreitet. Mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km im Jahr
ohridella
15Pheromonfalle – der Fang eines Tages
Befallsuntersuchung an Rosskastanien
l Um den Schritt vom Wissen zum Handeln zu vollziehen,
haben die Schüler nicht nur ihre Eltern und Lehrkräfte ihrer
Puppe der Miniermotte Realschule, sondern auch die Öffentlichkeit über ihre Ergeb-
nisse informiert: Auf einer Homepage und in mehreren Pres-
l Als Nächstes wurden mit Ei, Larve und Puppe alle seartikeln wurden die Bürger in Sarstedt und Umgebung auf
weiteren Entwicklungsstadien der Miniermotte untersucht, den Befall der Rosskastanien aufmerksam gemacht und dazu
gezeichnet und fotografiert. Durch Laubpräparationen konn- aufgefordert, ihr Kastanienlaub zu entfernen. Experten wie
ten in den überwinternden Blättern zweier Winterjahreszeiten dem Umweltbeauftragten der Stadt Sarstedt und einem Sar-
neben Puppen auch Larven nachgewiesen werden, eine bis- stedter Mitglied des Kuratoriums „Baum des Jahres“ wurden
lang in der Literatur noch nicht beschriebene Beobachtung. die Ergebnisse der Untersuchungen mitgeteilt.
l Durch Recherchen und Untersuchungen stellte die Schü-
lergruppe fest, das zur Verringerung des Befalls der Rosskas-
tanien durch den Schmetterling nur eine Methode in Frage
kommt: Das Laub muss entfernt werden! Da die Miniermotte
im Laub als Puppe und Larve überwintert, kann durch die
Vernichtung des Laubes der Befall reduziert werden. Das kann
entweder durch tiefes Vergraben des Laubes oder durch Ver-
nichten des Laubes in einem Kompostierwerk unter großer
Hitzeeinwirkung geschehen.
Befallsuntersuchung
an
Rosskastanien
16Betreuer:
Ulf Neubacher
Hauptpreis BUW I Preis für hervorragende Betreuung
Bienensterben – Bedeutung der Varroamilbe & Co
In den letzten Jahren sind viele Bienenvölker in der nordwest-deutschen Tiefebene – und auch in anderen Regionen
Europas – eingegangen. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Ein Hauptfaktor liegt in dem Auftreten der Varroamilbe,
jedoch scheinen „das Zünglein an der Waage“ Sekundärerkrankungen zu sein. Diese Infektionen entstehen, nach-
dem Varroamilben ein Bienenvolk geschwächt haben und so der Weg für Sekundärinfektionen gebahnt wurde. Daher
beschäftigten sich Tabea Pocha (15 Jahre) und Janna Köpke-Kahl (15 Jahre) mit der Milbe und experimentell mit den
Pilz- und Bakterieninfektionen in einem Bienenstock nach Varroabefall.
l Sie stellten sich die Frage: Wie ist das Erscheinungsbild
der Milbe als hiesiger Bienenparasit und um welche Milben-
art handelt es sich? Inwiefern sind Bienen, Waben, Varroen
und Propolis Pilzträger und inwieweit sind sie Bakterienträger?
Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der Varroamilbe
l Mithilfe rasterelektronenmikroskopischer Aufnahmen
Tabea Pocha und Janna Köbke-Kahl konnten die Preisträgerinnen die Varroamilbe als Vertreter
der Spinnen mit den typischen Merkmalen einer Spinne mit
l Zur Beantwortung ihrer Frage führten sie zunächst eine vier Beinpaaren und Punktaugen identifizieren. Die Mund-
umfangreiche Recherche und Sachanalyse zu der Varroose werkzeuge der Milbe bestehen aus einem Paar Kieferntastern,
und den möglichen Bekämpfungsmethoden durch. Varroose das zusammen mit dem ersten Beinpaar als Antennen dient
ist vor allem eine Brutkrankheit, da die Milben mit den Bie- und aus einem Paar bezahnter Kiefer (Cheliceren), die als Beiß-
nen zur Brut gelangen, sich hier vermehren und die Hämo- und Stichinstrumente gebraucht werden. Auffällig ist auch,
lymphe der Larven aussaugen. Dies führt zur Schwächung dass der gesamte Körper behaart ist, also auch der Chitinpan-
der sich entwickelnden Jungbienen und auch zu Missbildun- zer und die Beine. Diese Behaarung begünstigt das Festsetzen
gen, sodass sie die Winterzeit nicht überstehen und sterben. von Pilzen und Bakterien auf der Oberfläche, die so mit der
Es gibt verschiedene Verfahren zur Eindämmung der Varroose Verletzung der Biene durch die Varroa umso leichter in ihren
während und nach der Trachtzeit der Bienen, die von den Im- Organismus gelangen können.
kern angewendet werden. Dazu zählen u.a. chemische Verfah-
ren wie beispielsweise der kurzfristige Einsatz von Ameisen- l Da Pilz- oder Bakterieninfektion zu einer weiteren Schwä-
säure, die Anwendung von ätherischen Ölen wie Thymol chung der Bienen führen und damit oft den entscheidenden
oder die Drohnenbrutentnahme mit jeweils wechselndem Punkt darstellen, der zum Sterben der Bienenvölker führt, wer-
Erfolg. den mehrere mikrobiologische Versuche durchgeführt, um
festzustellen, wo im Bienenstock der stärkste Befall nachzuwei-
sen ist.
Recherche
und
Sachanalyse zur
Varroose
17l Die Schülerinnen gingen bei beiden Versuchsreihen l Insgesamt konnten die Schülerinnen feststellen, dass bei
gleichermaßen vor. So wurde der Brutschrank jeweils vor den Bienen- und Varroaproben die höchste mikrobiologische
Beschickung mit Ethanol keimfrei gemacht, die Petrischalen Keimbesiedlung zu finden ist. Die bekannte antibiotische
mit Nährboden luftdicht mit Tesafilm verschlossen und nur Wirkung von Propolis ließ sich auch hier als Wachstumshem-
kurzzeitig geöffnet, um auf dem Nährboden Bienen, Varroen, mung nachweisen. Erstaunlich ist jedoch, dass Propolis mit
Waben und Propolis (alt und neu) an drei Impfstellen abzu- seinen vorher beschriebenen Pilz- und Bakterien hemmenden
drücken. Außerdem wurde immer ein Kontrollansatz durch- Eigenschaften einen mittleren Bewuchs zeigte, während die
geführt. Wabenproben im Bereich der Kontrollen lagen und damit das
geringste Wachstum aufwiesen. Im Wachs sind vermutlich
l Im ersten Teil Ihrer mikrobiologischen Versuche konnten nicht genügend Nährstoffe bzw. das Milieu auf den Waben ist
die Schülerinnen mit Hilfe eines pilzspezifischen Sabouraud- für Bakterien und Pilze nicht „lebensfreundlich“. Im Falle die-
Glukoseagar nachweisen, dass insbesondere Bienen und Varroa- ser Versuchsreihe ist von einer von den Waben ausgehenden
proben am stärksten, Propolisproben mittelgradig infiziert stärkeren antibiotischen Hemmung auszugehen als bei Pro-
sind und die Wabenproben auffallend wenig Pilzwachstum polis, so dass sich hier auch an der Oberfläche keine Krank-
zeigten. heitserreger halten, oder aber Wachs ist lediglich kein guter
Nährboden, so dass deshalb die Zahl an Erregern sehr gering
l Als zweiter Schritt zur Untersuchung der Bakterienver- ist.
teilung wurde bakterienspezifischer Nährboden (Brain-
Heart-Broth) für grampositive und gramnegative aerobisch
wachsende Bakterien und für Candida-Pilze verwendet.
Das Ergebnis der Untersuchung zur Pilzverteilung wiederhol-
te sich hier.
BakterienundCandida-Pilze
Mikrobiologische Versuche mit pilzspezifischem Nährboden
18Betreuer:
Wolfgang Potratz
Hauptpreis BUW I Preis für hervorragende Betreuung
Ökostrom – Klimaschutz aktiv
Ein einfacher Weg für jeden Bürger seine CO2-Bilanz zu verbessern
In Anbetracht der globalen Klimaveränderung und der dadurch geführten Diskussion fiel den Schülerinnen Tatjana
Dmitrienko, Linda Hinsken, Carolin Mietrup, Laura Niemann, Viktoria Pleyer, Liane Rezlaw, Alischa Sander und Lisa
Staeck auf, das es relativ wenig konkrete Ratschläge zur Senkung des CO2-Ausstoßes gibt. Dies nahm die Schüler-
gruppe des Gymnasiums Bad Essen zum Anlass, sich für den Schutz des Klimas einzusetzen, mit dem Ziel, bei der
breiten Bevölkerung Interesse und tatkräftige Bereitschaft für mögliche Maßnahmen zur CO2- Senkung zu wecken.
l Diese Gesamtausstoßmenge kann durch einen Wechsel
des Verbrauchers zu einem Ökostromlieferanten verringert
werden. Weil Ökostrom hauptsächlich aus Wasserkraft,
Windkraft, Solarstrom und Biogas gewonnen wird, setzt er
wenig CO2 frei, jedenfalls deutlich weniger als herkömmlicher
Strom.
l Deshalb verfolgten die Schülerinnen die Idee, möglichst
viele Leute zu überzeugen, Ökostrom zu beziehen. Um die
Menschen zu informieren, haben sie zunächst allgemeine In-
formationen zum Strom, insbesondere zum Ökostrom, zur
Verfügung gestellt und eine übersichtliche Liste von Öko-
Die Ökostrom-Schülergruppe aus Bad Essen stromanbietern erstellt.
l Um möglichst viele Bürger dazu zu bewegen, den Schritt
l Zum Schutz des Klimas kommt es darauf an, auf allen zu einem Ökostromanbieter zu gehen, haben die Schülerin-
Ebenen den CO2-Ausstoß zu verringern. Ein Bereich, in dem nen der Ökostrom-AG eine Reihe von Aktivitäten begonnen.
relativ viel CO2 erzeugt wird, ist die Stromproduktion. Bei der Sie ermittelten, dass es im Umkreis ihrer Schule im Altkreis
Stromerzeugung wird, je nach Energieträger, unterschiedlich Wittlage von Bad Essen über Bohmte bis Ostercappeln unge-
viel CO2 freigesetzt. In einem ersten Schritt sammelte die fähr 8000 Haushalte gibt. Sie stellten fest, dass ein Anzeigen-
Schülergruppe Informationen über die Ursachen und Folgen blatt einmal pro Woche an alle Haushalte im Altkreis Wittlage
der Klimaveränderungen. Als nächstes setzten sie sich theore- und angrenzende Gemeinden verteilt wird. Während die
tisch mit den verschiedenen Arten der Stromerzeugung aus- lokalen Ausgaben der Tageszeitungen (Wittlager Kreisblatt,
einander und recherchierten Daten und Fakten zum CO2- Neue Osnabrücker Zeitung) jeweils nur von etwa der Hälfte
Ausstoß. der Haushalte gelesen werden, konnten sie durch eine Artikel-
serie in diesem Anzeigenblatt alle Haushalte erreichen. In den
l Demnach gibt das Statistische Bundesamt (http://desta-
tis.de/) den Gesamtausstoß von CO2 für 2003 mit 859,95 Mil-
lionen Tonnen an und den Ausstoß aus der Stromerzeugung
mit 329 Millionen Tonnen. Das bedeutet, dass ca. 40% des
Kohlendioxids in Deutschland aus Kraftwerken kommen.
Auch im so genannten Strommix setzt eine Kilowattstunde
Strom im Durchschnitt etwas mehr als 500 g CO2 frei. Im
Versorgungsgebiet der Schülerinnen liegt diese Menge sogar
deutlich höher, da der Stromlieferant RWE hauptsächlich
Braun- und Steinkohlekraftwerke betreibt.
19jährlicher CO2-Ausstoß der Stromerzeugung in Deutschland:
329 000 000Tonnen
l Zu diesem Zeitpunkt haben die Preisträgerinnen pro-
zentual einen höheren Erfolg erreicht als die Stadtwerke
Osnabrück, die seit Jahren für ihren Ökostrom werben.
Deshalb haben sie ihre Zielmarke seit Abgabe ihres Wettbe-
werbsbeitrages auf eine jährliche Einsparung von mindestens
100 Tonnen im Einzugsgebiet ihrer Schule (ca. 8000 Haushal-
te) erhöht.
l Ihr Einsatz für die CO2-Senkung und damit für den
Schutz des Klimas ist aber noch nicht abgeschlossen. Durch
Ansprache von Energie AGs anderer Schulen wollen sie wei-
ter zur Nachahmung anregen, um damit die Menge des ein-
gesparten CO2 deutlich zu erhöhen. Die Ökostrom AG hat
also viel geschafft und dennoch in Zukunft noch eine Menge
Erstellung einer Homepage vor!
Artikeln informierten sie über verschiedene Stromeinspa-
rungsmöglichkeiten, motivierten die Leser über Verbesse-
rungsmöglichkeiten der eigenen CO2-Bilanz nachzudenken
und haben eine Reihe von Ökostromlieferanten (Lichtblick,
NaturPur, Greenpeace Energy, Elektrizitätswerke Schönau)
bekannt gemacht.
l Außerdem wurden, um möglichst viele Schüler, Lehrer
und Eltern und die allgemeine Öffentlichkeit über ihre Erkennt-
nisse zu informieren, ein Anschreiben in der Schule an Lehr-
kräfte und Mitschüler verteilt, eine Homepage erstellt und an
einem Infostand ein selbst erstellter Flyer verteilt und unzäh-
lige Gespräche geführt.
l Wie die Rückmeldungen auf ihre Zeitungsartikel zeigten, Information der Öffentlichkeit
konnten die Schülerinnen die Aufmerksamkeit und Sensibili-
tät der Menschen in ihrem Einzugsgebiet für das Thema um-
weltfreundlicher Umgang mit Energie erhöhen.
CO2-Einsparung
von
100 Tonnen pro Jahr
20Betreuerin:
Brigitte Grahn-Kramer
Hauptpreis BUW II Preis für hervorragende Betreuung
Tagfaltermonitoring als Grundlage für Maßnahmen
zur Steigerung der Biodiversität
Aus Interesse und Freude an der Naturbeobachtung im nahe gelegenen Park startete Carsten
Reinhard (19 Jahre) ein systematisches Monitoringprogramm von Tagfaltern. Wie können
die von ihm erfassten Daten genutzt werden, um den Bestand der beobachteten Falterarten
langfristig zu sichern? Gibt es Möglichkeiten, den Lebensraum der Falter artgerechter zu
gestalten, um deren Lebensbedingungen zu verbessern? Kann dabei auch die Artenvielfalt
im Park gesteigert werden?
l Schon seit längerer Zeit hat sich Carsten Reinhard aus
Bremerhaven sehr für die Natur in der nahen Umgebung sei-
nes Wohnortes interessiert. Die Beobachtung und das Foto-
grafieren der dort vorkommenden Tagfalter wurden zu einem
seiner größten Hobbies und sind die Grundlage für seinen
Wettbewerbsbeitrag für den BUW. Den Speckenbütteler Park
und die angrenzenden Bahngebiete in Bremerhaven hat er
hinsichtlich des Vorkommens von Tagfaltern genau unter die
Lupe genommen. Ursprünglich wollte er „nur“ untersuchen,
welche Tagfalter in diesen Gebieten vorkommen. Aus syste-
matischen Beobachtungen wurden im Verlauf der Arbeiten
handfeste Vorschläge zur Biotopumgestaltung, mit dem Ziel,
die Lebensbedingungen der Falter und anderer Tier- und
Pflanzenarten vor Ort nachhaltig zu verbessern. Darüberhin- Eine Feuchtwiese mit Weidenschloss
aus wurden von Carsten Reinhard vielfältige Aktionen gestar-
tet, um die Öffentlichkeit zu informieren und einzubeziehen.
l Um Tagfalter effizient schützen zu können, ist eine genaue
Kenntnis ihrer Biologie und ihrer ökologischen Ansprüche
erforderlich. Schmetterlinge haben einen vergleichsweise
kurzen Entwicklungszyklus. Viele Schmetterlingsarten sind
bezüglich ihres Lebensraumes in den frühen Entwicklungs-
stadien (z. B. als Larven oder Raupen) und auch später als
Imagines (also als geschlechtsreife Insekten), an das Vorkom-
men bestimmter Pflanzenarten gebunden. Nur dort, wo aus-
reichend Raupenfutterpflanzen einer Falterart wachsen, kann
diese Art dauerhaft überleben. Eingriffe in diesen Lebens-
raum wirken sich meist innerhalb kürzester Zeit negativ auf
die dort vorkommenden Falterpopulationen aus. Hauhechelbläuling
Naturbeobachtung und
Naturfotografie
21l Aufgrund weitreichender Veränderungen der Landschaft
durch den Menschen sind viele Falterarten heute gefährdet.
Menschliche Eingriffe wie das Trockenlegen von Wiesen und
ungünstige Mahdtermine, die Intensivierung der Landwirt-
schaft durch übermäßiges Düngen und durch Einsatz von
Insektiziden und Pestiziden, das Anlegen von Monokulturen,
veränderte Waldnutzungsformen sowie die zunehmende Ver-
siegelung der Landschaft haben in den letzten hundert Jahren
zu einem signifikanten Rückgang der Tagfalter geführt. Die
heutige Situation verlangt nach effizienten Schutzmaßnah-
men. Mit einem Monitoring können lokale Einflüsse von
Landnutzungsänderungen ermittelt werden. Folgen dann
gezielte Schutzmaßnahmen, so ist dies ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zur Arterhaltung der Tagfalter vor Ort.
l Zur Umsetzung seiner Naturschutzziele hat Carsten Rein-
hard eine Saison lang systematisch die Tagfalter im Specken-
bütteler Park in Bremerhaven und in den angrenzenden Lageplan der Beobachtungsgebiete
Bahngebieten beobachtet. Dabei ermittelte er von März bis
November wöchentlich für alle beobachteten Arten die l Schließlich hat Carsten Reinhard alle erhobenen und
Anzahl der Imagines, deren Verhalten, Verbreitungsgebiet recherchierten Daten mit dem Ziel ausgewertet, Veränderungs-
und Vorkommensdichte sowie ihre bevorzugten Nahrungs- möglichkeiten in den untersuchten Biotopen aufzuzeigen,
pflanzen. Zusätzlich wurden Wetterdaten notiert und Verän- mit denen eine Verbesserung der Lebensbedingungen für die
derungen in den Biotopen erfasst. Viele der Beobachtungen dort vorkommenden Tagfalter und Arten mit ähnlichen Stand-
wurden fotografisch dokumentiert. Die erfassten Daten, ortansprüchen erreicht werden können. Auch wurde überlegt,
wie zum Beispiel zur Populationsentwicklung der einzelnen inwieweit diese Maßnahmen zur Steigerung der Artenvielfalt
Arten, wurden zu Grafiken zusammengestellt. in den Untersuchungsgebieten beitragen könnten.
Hauhechelbläuling (Polyommatus icarus)
Artenvielfalt
im Park
22Kleiner Fuchs (Nymphalis urticae)
l Für den Speckenbütteler Park erarbeitete Carsten Rein- l Begleitend zu seinen umfangreichen Untersuchungen
hard eine Reihe von Vorschlägen zur Optimierung der Lebens- und Umgestaltungsempfehlungen hat Carsten Reinhard
bedingungen für Schmetterlinge. Für den Park waren ohne- viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um auch andere auf die
hin Umgestaltungsarbeiten geplant und Carsten Reinhard ist Schutzbedürftigkeit der Schmetterlinge aufmerksam zu
mit seinen Ideen beim Gartenbauamt Bremerhaven und dem machen. Er veranstaltete mehrere Führungen für den BUND
BUND-Regionalverband Unterweser auf offene Ohren gesto- und hat, zusammen mit seiner Betreuerin Frau Grahn-Kramer,
ßen. Eine ganze Reihe seiner Vorschläge konnten sofort um- Schautafeln erarbeitet. Zudem stellte er sein Projekt sowohl
gesetzt werden oder sind nun mittelfristig geplant. Dazu zählt in der Schule als auch in einer Radiosendung und in einer
die Optimierung von Mahdterminen, selteneres Mähen in Fernsehproduktion des ZDF vor.
Randbereichen der Wiesen, die Eingliederung von insekten-
freundlichen Gehölzen in Neuanpflanzungen und die Schaf-
fung öffentlichkeitswirksamer, blütenpflanzenreicher
Schmetterlingsbiotope. Auch eine Streuobstwiese wird im
Randbereich des Parks gepflanzt.
Schaffung
öffentlichkeitswirksamer
Schmetterlingsbiotope
23Betreuerin:
Cornelia Hinz
Hauptpreis BUW II Preis für hervorragende Betreuung
Die Erhaltung des Hellgelben Knabenkrauts
Was ist „Dactylorizha ochroleuca“, ist es der Titel einer spannenden Kriminal-
geschichte oder doch eher eine seltene Orchideenart? Die beiden BUW-Hauptpreis-
gewinnerinnen Justine Sturm (19 Jahre) und Julia Schütze (19 Jahre) zeigen mit
ihrem Wettbewerbsbeitrag das beides zutrifft. Mit viel Kreativität klären sie die
Öffentlichkeit über die Gefährdung des Hellgelben Knabenkrauts in der Uckermark
auf. Doch wie kann es gelingen, das Vorkommen des Hellgelben Knabenkrauts in
der Uckermark langfristig zu sichern?
l Orchideen sind eine der am meisten gefährdeten Pflan-
zengruppen, deren Arten vielfach vom Aussterben bedroht
sind oder zumindest einen starken Rückgang in der Popula-
tionsgröße zeigen. Auch in der Uckermark gibt es bedrohte
Orchideenarten, z. B. das Hellgelbe Knabenkraut (Dactylorhiza
ochroleuca). Die beiden BUW-Preisträgerinnen Justine Sturm
und Julia Schütze haben sich daher zum Ziel gesetzt, die
Bevölkerung in der Uckermark über die Gefährdung des
Hellgelben Knabenkrauts aufzuklären, sowie selbst tatkräftig
zur direkten Erhaltung dieser seltenen Orchideenart beizu-
tragen.
l Mit ihrer Arbeit möchten sie zum Einen helfen, geeignete
Lebensräume für das Hellgelbe Knabenkraut in der Region zu
erhalten, zum Anderen sollen (durch Anzucht im Labor und
Gewächshaus gewonnene) Jungpflanzen von Dactylorhiza
ochroleuca gezielt ins Freiland überführt werden, um letzte
verbliebene Populationen in der Uckermark zu stärken und
zu erhalten.
l Ausgangspunkt für den besonderen Einsatz von Justine
Sturm und Julia Schütze für die seltene Orchideenart war ihr
Biologieunterricht. Dort wurde ein Orchideenprojekt vorge-
stellt, das durch die Humboldt-Universität Berlin in Zusam-
menarbeit mit dem Naturpark „Uckermärkische Seen“ 2001
initiiert wurde. Justine Sturm und Julia Schütze übernahmen Dactylorizha ochroleuca – das Hellgelbe Knabenkraut
das Projekt von zwei Schülerinnen der 13. Klasse und arbeite-
ten von nun an mit Dr. Kurt Zoglauer und der Diplom Bio-
login Christina Lange von der Humboldt-Universität Berlin
zusammen.
Kriminalgeschichte
oder
Orchideenart
24
?Bei der Laborarbeit Samen nach der Keimung Jungpflanzen Im Moor
l Bald wurde Justine Sturm und Julia Schütze klar, dass das l Aus den Mooren in der Region wurde das „Knehdenmoor“
Problem der Erhaltung von Dactylorhiza ochroleuca in der ausgewählt, um hier erste Versuche zur Wiederansiedlung des
Uckermark komplexer ist, als auf den ersten Blick vermutet: Hellgelben Knabenkrauts zu beginnen. Erfolgsversprechende
Das Hellgelbe Knabenkraut ist, wie nahezu alle Orchideen- Versuchsflächen wurden, entsprechend der Standortansprüche
arten, hoch spezialisiert. Das heißt, es toleriert nur geringe der Orchidee, ausgewählt und vorbereitet. Gemeinsam mit
Abweichungen von den Optima der äußeren Umwelteinflüs- der HU Berlin starteten die beiden Preisträgerinnen dann erst-
se. Es gedeiht am besten an lichtreichen, feuchten, kalkhal- mals den Versuch, das Hellgelbe Knabenkraut direkt vom
tigen und insgesamt nährstoffarmen Standorten, wie sie in Labor in das Moor umzusetzen. Sie dokumentierten die
Mooren oder auf Feucht- und Nasswiesen gegeben sind. Auch Arbeiten und konnten zum Ende der Vegetationsperiode fest-
dürfen nicht zu viele andere Arten an diesen Standorten auf- halten, dass in den 4 Versuchsflächen 20 von 23 ausgebrach-
treten, weil das Hellgelbe Knabenkraut sehr konkurrenz- ten Individuen erfolgreich angewachsen waren.
schwach ist. Zudem bilden Orchideen sehr reduzierte Samen
aus, die nur unter Mitwirkung eines Mykorrhizapilzes kei- l Neue Wege sind Justine Sturm und Julia Schütze auch
men können. Das größte Problem bei der Erhaltung des in der Öffentlichkeitsarbeit zum Schutz von Dactylorhiza
Hellgelben Knabenkrauts in der Uckermark ist jedoch das ochroleuca gegangen. Neben Flyern, Internetseiten, Buttons
Schwinden der Lebensräume, die den Orchideen diese Wachs- und Vorträgen haben sie mit viel Kreativität eine Film-CD im
tumsbedingungen bieten. Viele Moore und Feuchtwiesen Stil einer Kriminalgeschichte über die Gefährdung des Hell-
wurden durch menschliche Eingriffe in die Landschaft trocken- gelben Knabenkrauts und des Lebensraumes Moor erstellt.
gelegt. Stoffeinträge, insbesondere von Stickstoff aus Dünge-
mitteln stiegen durch die intensive Landwirtschaft an. Um l In den kommenden Jahren soll auf Basis der Arbeiten
den Fortbestand von Dactylorhiza ochroleuca zu sichern, von Justine Sturm, Julia Schütze und der Wissenschaftler der
muss der Lebensraum „Moor“ langfristig erhalten werden. HU Berlin die Wiederansiedlung des Hellgelben Knaben-
krauts an erloschenen Standorten weiter durchgeführt und
l Also unterstützten Justine Sturm und Julia Schütze die beobachtet werden.
Wissenschaftler der Humboldt-Universität zu Berlin bei ihren
Forschungsarbeiten über das Hellgelbe Knabenkraut. Sie
vermehrten die Orchideen durch künstliche Bestäubung im
Freiland und aufwendige Anzucht im Labor erfolgreich vom
Samen bis zu den Jungpflanzen. Parallel arbeiteten sie mit
verschiedenen Akteuren des Naturparks „Uckermärkische
Seenplatte“ zusammen, um den Sukzessionsprozessen durch
regelmäßige Mahd und Entkusselung in mehreren Mooren
der Region entgegenzuwirken.
Erkundung des Knehden-Moores
25Sie können auch lesen