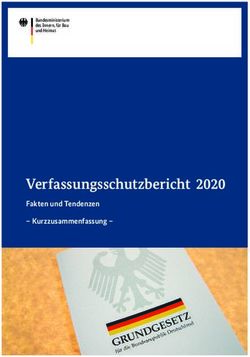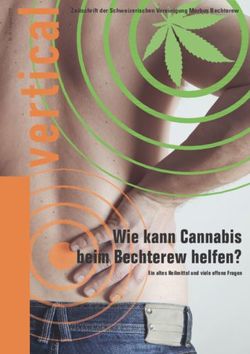Övs news - Dynamiken Krankenhaus im 2/2017 - ÖVS
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
övs news
Sponsoring Post-Nr. SP02Z030448 S
österreichische vereinigung für supervision und coaching 2/2017
Dynamiken
im
KrankenhausEditorial
Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Ich hoffe, dass alle einen erholsamen Som- Weitere Aktivitäten der Geschäftsstelle sind
mer – trotz der heftigen Hitze und Wetterka- auf den Seiten 18 und 19 zu finden. Dank
priolen – hatten und genügend Energie für gebührt auch Christiane Schnalzer führt die
Arbeit und Leben getankt haben. Koordination und Überwachung der Renovie-
Für einen Teil der internationalen Super- rung der ÖVS Geschäftsstelle.
visions Community endete die Urlaubszeit mit Das Protokoll der Generalversammlung
der ANSE Summer University 2017, die in 2017 ist sehr umfangreich ausgefallen. Auf-
Rotterdam unter dem Titel „Moved and Being grund der detailreichen und genauen Berichte
Moved“ stattfand. Über 120 KollegInnen aus aus den einzelnen Gremien wäre es im Druck
über 14 europäischen Staaten nutzten die Ge- eine eigene ÖVS News Nummer mit über 30
legenheit, sich – inspiriert durch Vorträge und Seiten. Aus diesem Grund haben wir entschie-
Workshops – über praktische, theoretische den, das Protokoll nur auf die Homepage zu
und politische Aspekte unseres Berufes aus- stellen. Wer es unbedingt in einer Printversion
zutauschen. Einen ausführlichen Bericht wird auch haben möchte, möge sich bitte in der
es in der NEWS 3/17 dazu geben. Für alle, Geschäftsstelle melden.
die auch einmal daran teilnehmen wollen und Viel Freude beim Lesen!
nicht weit fahren möchten, gibt es dafür im
August 2019 die Chance dazu. Dann findet die Mit kollegialen Grüßen
ANSE Summer University in Österreich statt. Wolfgang Knopf
Seit der Generalversammlung wird inten-
siv an der Gestaltung der neuen Homepage
und der Entwicklung der ÖVS interne Kom-
munikation gearbeitet. Viel Arbeit steckt im
Detail und Dank Rosie Moser‘s Übersicht und
Kenntnisse sind wir zuversichtlich, bald ein
gelungenes Resultat vorstellen zu können.
Inhalt 3 Dynamiken im Krankenhaus
Ursula Hermann/Wolgang Knopf
16 Lebenskraft statt Burnout
Helga Prähauser-Bartl
4 Die Konflikte im österreichischen 18 Öffentlichkeitsarbeit der ÖVS
Gesundheitswesen
Ernest Pichlbauer 18 Renovierung des ÖVS Büros
7 Effizienz von Supervision und Coaching 19 Supervision in der Ukraine – zwei Aufrufe!
im Krankenhaus
Verena Krassnitzer 20 Finanz & Co
Dr. Günther Fisslthaler
10 Wie viel Tod verträgt das Krankenhaus?
Ursula Hermann 20 Veranstaltungen
21 Aufgeblättert
24 Willkommen – Neue ÖVS-Mitglieder
Övs News Redaktion sucht Mitarbeiterinnen!
Die ÖVS News erscheint 3x im Jahr und wird durch das Redaktionsteam gestaltet.
Gestaltung heißt Themenschwerpunkte zu finden und diese zu betreuen. Betreuen
heißt, AutorInnen zu finden oder aber auch selbst etwas schreiben. Die notwendigen
COVERFOTO: FOTOLIA
Redaktionssitzungen werden in Zukunft auch über skype abgehalten werden. Also eine
große räumliche Distanz sollte kein Hindernis sein!
Über Interessierte freut sich die Redaktion und die Geschäftsstelle!
2 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
ÖSTERREICHISCHES GESUNDHEITSSYSTEM
Gesundheitsausgaben Lebenserwartung Zufriedenheit
pro Kopf in Euro bei guter Gesundheit mit dem Gesundheitssystem
in Jahren in Prozent
NÖ NÖ NÖ
3.884 66 79
OÖ Wien OÖ Wien OÖ Wien
3.738 4.400 66 65 75 76
Stmk. Stmk. Stmk.
3.834 65 78
Vbg. Tirol Sbg. Bgld. Vbg. Tirol Sbg. Bgld. Vbg. Tirol Sbg. Bgld.
4.020 3.870 4.105 3.508 69 71 70 63 79 82 81 79
Ktn. Ktn. Ktn.
4.004 67 80
Durchschnitt Österreich: 3.973 Durchschnitt Österreich: 66 Durchschnitt Österreich: 78
unter Durchschnitt über Durchschnitt im Schnitt
Dynamiken im Krankenhaus
Ursula Hermann/Wolgang Knopf
D
as österreichische Gesundheitswesen Grundlagen der Finanzierung des österreichi-
ist und bleibt ein Thema öffentlichen In- schen Gesundheitswesens: dabei verweist er
teresses. Am 22.08. präsentierte bei den auf unterschiedliche Modelle der Finanzierung,
Alpbacher Gesundheitsgesprächen die Gesund- wie der Kombination aus dem Beveridge und
heitsökonomin Maria Hofmarcher eine Studie, Bismarck Modell, die Österreich gemeinsam mit
die die eklatanten Unterschiede zwischen den Griechenland eine Sonderstellung in Europa gibt.
österreichischen Bundesländern zeigt (siehe Eine interne Sicht über den Einsatz von
Grafik) und am 25.08. stellte DER STANDARD Supervision und Coaching im Krankenhaus
das Gesundheitssystem auf den Prüfstand. gibt Rainhard Faber, strategischer Personal-
Immer ging es dabei um Grundsätzliches. entwickler im KAV, im Interview mit Isabella
Supervision ist im Krankenhaus angekom- Krassnitzer, Koordinatorin der ÖAGG-Pools. Sie
men. Die Träger der Krankenhäuser haben – machen sich Gedanken über die Effizienz von
wenn auch unterschiedlich – Supervision in Supervision und Coaching im Wiener Kran-
den Betrieb integriert, Coaching für Führungs- kenanstalten Verbund. Interessant ist die un-
kräfte beginnt ebenfalls Fuß zu fassen. terschiedliche Einschätzung der Wirkung von
Die Auftraggeber erwarten von den Super- Supervision und Coaching für die Organisation.
visorInnen und Coaches in den meisten Fällen Einen spezifischen Blick auf einen der zen-
dabei eine Feldkompetenz. Diese beschränkt tralen Dynamiken im Krankenhaus richtet Ur-
sich meist auf eine Beratungspraxis im System. sula Hermann in ihrem Beitrag. Krankenhaus
Um die Dynamiken im Krankenhaus zu er- verdient an der Krankheit nicht an der Ge-
fassen, gilt es die wesentliche ökonomischen sundheit! Zusammenfassung einer Forschung.
wie politischen Rahmenbedingungen zu ken- Das Spannungsverhältnis von Gesundheit und
nen und zu verstehen. Krankheit ist tabuisiert und wird besonders
Einen solchen ersten Schritt soll mit dieser deutlich am Umgang mit Tod und Sterben
FOTO: FOTOLIA
ÖVS NEWS Nummer unternommen werden. im Krankenhaus. Eine Forschung zu diesem
Der Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer Thema bietet der Beitrag: „Wieviel Tod verträgt
gibt einen Überblick über die ökonomischen das Krankenhaus?“
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 3fokussiert
Die Konflikte im österreichischen
Gesundheitswesen
Ein Gesundheitswesen ist immer in 3 Ebenen organisiert: Behandlungs-,
Versorgungs- und Systemebene. Von Ernest Pichlbauer
D
ie Behandlungsebene beschäftigt sich mit sourcen), die dazu eingesetzt werden (Logistik),
einzelnen Patienten, nämlich denen, die ein definiertes Ziel (Motivation) zu erreichen.
gerade behandelt werden. Auf dieser Ökonomie gibt es also überall, wo Menschen
Ebene findet sich nur ein Patient und ein Be- agieren. Deswegen ist der Vorwurf der Ökono-
handler. Die treffen nicht grundlos, zufällig und misierung in der Regel nur Polemik derer, die
irgendwo aufeinander, sondern in einem Um- Interessen vertreten.
feld, der Versorgungsebene. Diese beschäftigt Um das zu verstehen, muss man drei Mo-
sich dabei nicht mit einzelnen Patienten oder delle unterscheiden: (1) Gesundheitsökonomie,
Behndlern, sondern mit den Voraussetzungen, (2) „Neue politische Ökonomie“, (3) Mikroöko-
Dr. Ernest Pichlbauer die nötig sind, dass (möglichst) alle Patienten nomie (Betriebswirtschaft)
ist unabhängiger zur rechten Zeit beim richtigen Behandler eine Die Gesundheitsökonomie beschreibt „Kos-
Gesundheitsökonom, Behandlung bekommen können. Im einfachsten ten (Ressourcenverbrauch – nicht nur Geld,
gesundheitspolitischer Fall eben dadurch, dass ein Patient dort ist, wo sondern auch und vor allem Zeit) pro Patienten
Kolumnist der „Wiener er sein soll. Je nach Definition (nur Arzt, oder nutzen-Einheit“. Dem Patienten nützen wol-
Zeitung“ und Buchautor doch auch andere Gesundheitsberufe) treten len alle, aber wer darf das wie messen? Dazu
mindestens 200 Millionen Versorgungssituati- braucht es ein Werte- und Zielgerüst (und zwar
onen pro Jahr auf. Weil das gigantisch kom- ganz konkret), das durch einen öffentlichen
plex ist, schwebt darüber das System, das der Diskurs errichtet wurde – eine klassische Sys-
Versorgungsebene eine Orientierung geben soll, tem-Aufgabe. Womit wir bei der „Neuen politi-
was, mit welchen Mitteln erreicht werden soll. schen Ökonomie“ wären. Diese kennt andere
Behandler beschäftigen sich mit Patienten, Wertmaßstäbe; es geht um Einfluss (Stimmen)
Versorger mit Patientenströmen und Politiker -Verlust/Gewinn pro real durchgeführter Maß-
mit dem Ausgleich der Interessenslagen in der nahme. Ein Wertegerüst festzulegen, in dem
Versorgungsebene. Wenn letztere ihre Aufga- steht, dass ein Menschenleben soundso viel
ben schlecht wahrnehmen, wird die Versorgung wert ist, verspricht definitiv keinen Stimmenge-
von Interessenskonflikten durchsetzt – etwas, winn – denn, Gesundheit ist unendlich wertvoll;
das Behandler nicht selten als Folge der Öko- was aber heißt, dass das Gesundheitssystem
nomisierung deuten. Ökonomie ist aber nur unendlich viel kosten darf. Weil aber die Politik
das „Haushalten“ mit besessenen Mitteln (Res- keine unendlichen Ressourcen hat, findet man
bei uns praktisch nur Mikroökonomie. Diese
arbeitet mit Stückkosten. Um es einfach zu hal-
ten, definiert unser System als Stück gerne ein
Spital, ein Spitalsbett, eine Kassenordination
oder eine Tablette. Ziel sind möglichst viele,
möglichst billige „Stücke“. Und bei uns heißt
das eben – Aufrechterhaltung aller politisch
gewollten Strukturen, bei möglichst niedrigen
Kosten – der Nutzen des Patienten ist unerheb-
lich, auch wenn das anders kommuniziert wird.
Grundsätzlich ist der betriebswirtschaftliche
Ansatz nicht schlecht und führt v.a. bei akut und
schnell heilbaren Krankheiten zu guten Ergeb-
nissen. Schwieriger ist es, wenn es darum geht
Innovationen einzuführen. Denken wir an ein
neues Medikament, das doppelt so teuer ist, wie
das alte, aber auch doppelt so schnell wirkt –
wenn nur der Preis pro Tablette gültig ist, ist der
FOTO: FOTO WILKE
Patientennutzen „schneller gesund“ zu werden,
nicht Teil der Entscheidung.
Dieses Ökonomiemodell hat also Schwä-
4 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
chen. Richtig versagen muss es, wenn mehrere
„Zahler“ verantwortlich sind, also die Finanzie-
rung nicht aus einer Hand erfolgt. Und genau
das finden wir in Österreich.
Als eines von zwei Ländern in der EU wird das
öffentliche Gesundheitswesen nicht entweder
aus Steuern (Beveridge-Sstem) oder aus Sozi-
alversicherungsbeiträgen (Bismarck-System)
finanziert, sondern aus beiden. Diese duale
Finanzierung trägt ein gewaltiges Konfliktpo-
tential, wenn es darum geht, Patienten an der
richtigen Stelle zu versorgen. Vor allem, wenn
man betrachtet, welche „Hand“ für welche Sek-
toren zuständig ist.
Denn diese duale Finanzierung zerpflügt das
Gesundheitswesen förmlich in horizontale,
voneinander unabhängige Teilbereiche, ohne
inhaltliche Logik. So ist etwa die fachärztliche
ambulante Versorgung extramural Kassen-, int-
ramural Länder-Sache. Oder die Prävention, die
ist gleich mehrfach aufgeteilt, die (Tertiär)Pfle-
FOTO: FOTOLIA
geprävention überhaupt gleich ins Sozialsystem
verdrängt, das, anders als das Gesundheitssys-
tem, kein Sachleistungsprinzip kennt.
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 5fokussiert
Doch auch jeder horizontale Teilbereich ist in das dänische steuern, 214.000 Österreicher
sich (vertikal) fragmentiert. So sind etwa für hätten keine erheblichen Einschränkungen bei
die ambulante extramurale Kuration 35 bis 37 den Aktivitäten des täglichen Lebens – wären
(so genau weiß das niemand) Krankenkassen also keine „echten“ Pflegefälle, bei exakt glei-
oder -fürsorgeanstalten zuständig, während chen pro Kopf Gesundheitsausgaben.
die ambulante intramurale Versorgung von 53 Für Behandler, die direkt vor dem Patienten
Sptialsträgern definiert wird. Und weil über sitzen, hat dieses Chaos unmittelbare Folgen.
ihnen kein System steht, muss sich keiner ver- Denn, mangels eines einheitlichen Systems,
tikal oder wenigstens horizontal abstimmen. werden die Interessenskonflikte der Versor-
Alle folgen der inneren politischen Logik und gungsebene dem freien Spiel der (politisch)
Eigeninteressen. tätigen Interessensvertretungen (Gewerkschaf-
Der Rechnungshof hat dieses heillos frag- ten, Länder, Kammern, …) überlassen. Und so
mentierte System dargestellt. Die blauen Kreis- streiten etwa seit Jahrzehnten Apotheker und
segmente sind die Geldgeber, dann wird das Ärzte über Hausapotheken, und Kassen mit
Geld durch ein Labyrinth gejagt und kommt Ländern, wer für Kinderrehabilitation zustän-
irgendwann als Umsatz bei Ärzten und Spitä- dig ist. All diese Streitereien sind frustrierend.
lern an. Egal wie sehr sich Behandler bemühen, unter
den gegebenen Umständen verbrauchen wir
Und weil es keine Systemebene gibt, und damit enorme Ressourcen, erreichen aber keine ent-
die Versorgung unstrukturiert abläuft, ist der sprechend gesunde Bevölkerung – der Frust ist
Erfolg mäßig, genaugenommen schlecht. Mit verständlich. Und da Politik mit Gefühlen arbei-
450.000 amtlichen Pflegefällen (mehr als 65 tet, machen sich Politiker diesen Frust zu Nutze
Stunden Betreuung / Pflege pro Monat, andere und spielen Berufsgruppen gegeneinander aus.
werden nicht mitgezählt) gehören wir zu den Und genau das kann jeder jeden Tag in Ordi-
Ländern, die „Healthy Ageing“ nicht hinkrie- nationen, Spitälern oder Pflegeheimen täglich
gen. Zum Vergleich, würde unser System wie überprüfen.
6 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
Effizienz von Supervision und Coaching
im Krankenhaus
Interview von Verena Krassnitzer mit Herrn Reinhard Faber
Was bedeutet in Ihrem Kontext Effizienz
von Supervision und Coaching im KAV?
Zunächst ist ein so wirtschaftlicher Begriff
wie Effizienz in dem Zusammenhang immer
wieder ein Stück problematisch. Wenn ich die-
sen Begriff diskutiere, merke ich, dass gerade
im unserem Kontext wirtschaftliche Begriffe
wie Produktivität nicht so anerkannt und ge-
wünscht sind. Dennoch geht es um Effektivität,
um Wirkung von Interventionen.
Das hat ja mehrere Aspekte. Bei uns im KAV
sind ja viele ExpertInnen, die in der Kranken-
behandlung mit Problemstellungen der Patien-
tInnen sehr oft alleine auf sich gestellt sind. In
der Therapie, Diagnostik usw. muss man sehr
stark auf PatientInnen eingehen und entschei-
den, da kann man nicht sofort reflektieren.
Daher ist es als Organisation sehr wichtig, den
MitarbeiterInnen solche Instrumente anzubie-
ten, um zu signalisieren, dass der Arbeitgeber
um die Problematik weiß und einerseits Su-
pervision, aber auch Coaching für schwierige
Situationen anbietet.
Wie macht sich Effizienz bemerkbar?
Effizienz macht sich auf zwei Ebenen bemerk-
bar: in der qualitätsvollen Arbeit, aber auch in
der Stärkung der Reflexionsfähigkeit bzw. der
Personen selbst, so dass die MitarbeiterInnen,
Reinhard Faber
auch unter großer Belastung, weiterarbeiten
Bereichsleiter Strategische Personalentwicklung und Bildungsmanagement sowie
können. Eine Wirkung zeigt sich, wenn Mit- für Gesundheits-, Gender- und Diversitätsmanagement
arbeiterInnen sich subjektiv wohlfühlen. Das … seit über 30 Jahren im Personalmanagement der Krankenhäuser Wiens,
bedeutet aber auch für uns, dass wir gerade seit 1997 Aus- und Aufbau strategischer Personalentwicklung und
bei professionell im Krankenhaus arbeitenden seit 2003 Gestalter und Prozesseigner für Supervision im Wr.Krankenanstaltenverbund
Menschen immer Überzeugungsarbeit leisten
müssen. Wir verordnen das nicht, aber sorgen
dafür, dass das Angebot sichtbar ist.
drüber, weil es nicht aus einem eigenen Impuls
Würden Sie da einen Unterschied zwischen zu einer Unterstützung kommt, sondern auch
Supervision und Coaching machen, oder die gecoachte Führungskraft, als Verantwortli-
kann man in Bezug auf Ihre Antwort hier che für die Organisation, noch mal „eines drauf
beide Formate subsumieren? legt“. Doppelte Wirkung. Coaching kommt auch
Ja, in der mittelbaren Wirkung. Durch das Stär- deswegen eine besondere Bedeutung zu, weil
ken einer Führungskraft, die ja als Zielpunkt es hier die gezieltere Orientierung gibt, mehr
den Mitarbeitenden hat, haben wir auf die Pro- als in der Supervision.
fessionalisierung, auf das Wohlbefinden, Stabi-
lität der mit PatientInnen arbeitenden Mitar- Was soll Supervision und Coaching aus
beiterIn eine doppelte Wirkung. Beide Formate Ihrer Sicht für das Gesamtsystem KAV
FOTO: PRIVAT
sind sehr brauchbar, aber In der Effektivitäts- leisten? Welche Erwartungshaltung haben
frage stelle ich das Coaching noch ein wenig Sie hier als Personalentwickler?
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 7fokussiert
Wir haben dieses Thema ja von Grund auf ent- KAV auch eine Veränderung braucht. Also in
wickelt, unter anderem ja auch mit dem ÖAGG. Bewegung ist, und durch Coaching, durch die
Für uns bedeutet Supervision und Coaching einzelnen agierenden Führungskräfte model-
immer eine Intervention, die zwei Blickwinkel liert wird, und somit kann man sagen, ler-
verfolgt: das eine ist die Qualitätssicherung nende Organisation. Das ist das theoretische
der Arbeit, von Prozessen und Abläufen. Das Gebäude, und dort, wo uns Führungskräfte
andere ist die Gesundheitsförderung, die emo- beweisen, dass sie dies erkannt haben, funkti-
tionale Stabilisierung der einzelnen Personen, oniert es auch wunderbar. Da geht auch die Or-
was die mentale Stärkung des Einzelnen zum ganisationsentwicklung weiter. Ich komme aus
Zentrum hat. Das ist unverzichtbar. der Personalentwicklung und schaue natürlich
Der Beitrag von Supervision ist ja vielfältig darauf, dass sich die Personen entwickeln, aber
für die Organisation. Auch durch das profes- natürlich ist der Beitrag Coaching auch ein Bei-
sionelle Agieren der SupervisorInnen, um das trag zur Organisationsentwicklung.
Teamgefüge zu stärken und ein Ventil zu er-
möglichen, um bestimmte Belastungen auch Was erwarten Sie vom Coach, wann ist der
ausleben zu dürfen. Nicht nur: ich muss stark effizient?
sein, darf keine Schwäche zeigen: Dass Exper- Er/sie soll eloquent und sehr offen den Pro-
tenorganisationen hier Unterstützung für Ex- blemstellungen vom KH/Pflegewohnhaus oder
pertInnen liefern müssen, das ist der Punkt. einer Führungskraft gegenüberstehen, dem
D.h., der Beitrag von Supervision ist, die Stär- sehr gut begegnen. Nicht umsonst haben wir
kung und Stabilisierung des Staff des gesamten Kriterien in der Vertragspartnerschaft (mit
Leistungserbringers. Wir sind ein Dienstleis- dem ÖAGG) aufgenommen, dass der Coach/
tungsbetrieb, d.h. bei uns arbeiten Menschen, die Supervisorin eine mehrjährige Erfahrung
wir haben keine Maschinen, die wir abschalten im Krankenhauskontext haben muss. Um hier
können, außer auf der Intensivstation. Aber die viele Entwicklungen, Stolpersteine zu erken-
Hauptleistung bieten Menschen an. Und diese nen, um letztendlich aus dem KH-Kontext auch
sollen Unterstützung bekommen. den Blick hinauszumachen, auf eine neutrale
Und das Coaching ist natürlich auch eine Organisations-Sicht. Hemmnisse sollen etwas
Möglichkeit, sichtbar oder spürbar zu machen zurückgedrängt werden und andere Perspek-
(mit einigen Einschränkungen) , wie denn die tiven entwickelt werden. Nicht alles ist rea-
Grundhaltung der Organisation zum Thema lisierbar, dennoch braucht es auf Seiten des
Führen generell ist. Wenn ich eine Organisation Coaches einen Perspektivenwechsel. Und das
habe, die kein Coaching anbietet, zumindest so ist meiner Meinung nach das Hauptziel, wenn
systematisch wie wir, wird der Führungskraft wir mit Coaches arbeiten, dass der Perspekti-
signalisiert „Du musst funktionieren, und wenn venwechsel, die Vogelperspektive auf das Pro-
Du Hilfe brauchst, hol sie dir von außen.“ Und blem, die Organisation und auf die Menschen
wir signalisieren, und das ist der Beitrag zum gegeben werden. Es ist die Erwartung an Su-
Gesamterfolg als ein Arbeitsmittel, eine Un- pervisorinnen und Coaches, der FK die Chance
terstützung zur Verfügung gestellt bekommen, zu geben, selbst den Blick zu heben, und nicht
um sich mental auf schwierige Situationen und nur auf das Problem zu schauen. Viele unse-
Veränderungen einzustellen. rer Professionalisten, wenn ich an ÄrztInnen
denke, haben ja gelernt, genau auf das eine
Wenn man hier weiterdenkt, kann man Organ zu schauen, das Probleme macht. Dass
sagen, dass FK-Coaching einen Beitrag zur aber der Mensch als Ganzes viele Einflussfakto-
lernenden Organisation liefert? ren in sich trägt, die eine Ursache für eine Er-
Ja, absolut! Die Herausforderung, die wir im krankung sein können, das ist jetzt heute auch
KAV beim FK -Coaching haben ist, das der schon viel mehr verbreitet, dennoch schauen
Coachee direkt mit dem Vorgesetzten das Coa- einige noch immer ausschließlich auf das Sym-
ching- Ziel besprechen muss. Da gibt es schon ptom. Die Aufgabe des Coaches sehe ich darin,
noch eine Barriere, die vorhanden ist. Für sich den Blick aufs Ganze zu ermöglichen.
selbst als Coachee etwas zu holen, das ist ei-
nigermaßen anerkannt, aber die Wirkung des Weil Sie den Kontext Symptom erwähnt
Coachings für die Organisation zuzulassen, das haben, eigentlich die systemische Pers-
ist noch eine große Herausforderung. Nur we- pektive. Glauben Sie, dass ein Coach, eine
nige erkennen darin auch die Chance, dass sich SupervisorIn zumindest Grundkenntnisse
damit die Organisation auch verändert. Und aus dem systemischen Denken braucht?
das gehört weiter bearbeitet. Und wenn man Ich glaube, das ist unverzichtbar. Der Coach
so will, wäre es der Beitrag der Führungskraft, muss switchen können. Sich Einstellen auf die/
genau da zu erkennen, dass die Organisation den KundIn, die vielleicht den analogen Weg
8 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
gehen. Eine Außenperspektive, das ganze Sys- Arbeitszeiten, im Dienstplan, tatsächlich fixe
tem reinzuholen, das ist unverzichtbar. Reflexionsstunden für ein Team einzubauen.
Nicht draufzusetzen, nach dem Motto, wer Zeit
Das gleiche gilt für die Supervision aus hat, kommt halt auch, sondern genauso einzu-
Ihrer Sicht? planen, wie z.B. Dienstübergaben.
Ja, vielfach kann man mit unserem Modell der
Kurzzeitsupervision fokussiert auf Problembe- Wird damit die Freiwilligkeit in Frage
wältigung arbeiten, die SupervisorInnen sollten gestellt?
das jedenfalls im Repertoire mithaben. Ob sie Sie ist gefährdet, keine Frage. Das müssen wir
es dann anwenden können, ist die Frage, je in Kauf nehmen.
nachdem, was die Gruppe braucht.
Stichwort Effizienz und freiwillige Teil-
Können Sie die Effizienz von Supervision nahme: Wäre die Wahrscheinlichkeit
und Coaching an Zahlen festmachen? größer, wirkungsvoll zu sein, wenn diese
Da muss man differenzieren. Sie sprechen Angebote verpflichtend wären. Kann
mich als strategischen Personalentwickler an, man hier – aus Ihrer Sicht – eine kausale
meine Wahrnehmungen beziehen sich auf die Verbindung herstellen?
anonymen Feedbackbögen aus den Häusern, Das würde ich nicht automatisch mit ja oder
und teilweise auch auf die Resonanz der An- nein beantworten. Ich glaube, dass es da auch
sprechparnterinnen in den Häusern. Diese be- die Sicht des Supervisors braucht, mit dem Team
gleiten ja den Prozess aus einer administrati- abzugleichen. Da tu ich mir schwer, das absolut
ven, übergeordneten Sicht. Wir haben ja keine zu sehen. Bei der zeitlich begrenzten Supervision
Berichtspflicht, wir haben aber zwei systema- würde ich es so sehen, dass beim Einstieg die
tische Rückmeldungen, nämlich ob das Ziel Freiwilligkeit herrscht. Wenn man aber einmal
erreicht wurde oder nicht und ob Supervision dabei war, dann ist es Verpflichtung wieder zu
wieder in Anspruch genommen würde. kommen. Aber das ist keine einfache Entschei-
96 Prozent würden Supervision wieder in dung. Das hängt ganz von der Kultur, dem Be-
Anspruch nehmen (zeitlich begrenzt 2016), triebsklima ab, das sich gebildet hat, die geprägt
(84% 2015). Beim Coaching kann man nicht so wird von Führungskräften, es hängt aber auch
viel sagen, weil wenige Aufträge abgewickelt von den unterschiedlichen Disziplinen ab.
wurden. Da sind wir immer noch in den Anfän-
gen, da gibt es Nachholbedarf. Die Zufrieden- Wie wird aus Ihrer Sicht Supervision und
heit wird beim Coaching nicht abgefragt. Aber Coaching in Zukunft im KAV eingebettet
Effizienz kann schon daran gemessen werden, sein, welche Rolle wird diesen qualitätssi-
bzw. SV kann als Erfolg gewertet werden, wenn chernden Instrumenten zugewiesen?
es wieder in Anspruch genommen wird. Supervision ist auch ein Kostenfaktor. In Zeiten
wie diesen, muss nachgedacht werden, wel-
Welche Maßnahmen müssen aus Ihrer che Aufgaben können wir noch finanzieren?
Sicht gesetzt werden, um die Effizienz von Der Vorstand hat sich bis heute noch nicht
Supervision und Coaching zu steigern? positioniert, dass Supervision und Coaching
Wenn wir zunächst Coaching anschauen, sollte zu den unverzichtbaren Dingen gehören. Sie
dieser Beratungsprozess mehr im Sinne eines haben aber auch nicht gesagt, dass es gestri-
Lernprozesses fix eingebaut werden. Wir sind chen wird. D.h. wir sind ein wenig in einem
derzeit dabei, alle unsere Führungskräfte- Übergang, auf dem ich mich bewegen kann.
schulungen und Trainings neu auszurichten. Ich vermeide derzeit auch eine klarere Posi-
Wir integrieren in alle diese Lehrgänge Coa- tionierung. Wir haben eine ganz eindeutige,
chingsequenzen. D.h., wir wollen auch erwach- normierte Vorgangsweise, und an der halte
senbildnerisch mehr tun, als es bisher in man- ich fest. Wenn Sie mich also fragen, dann ist
chen Bereichen stattgefunden hat. Wir wollen die Linie im Change-Prozess ganz klar: Super-
jetzt ganz andere Wege gehen. Natürlich soll es vision und Coaching müssen den Change-Pro-
inhaltliche Impulse geben, aber, vor allem bei zess begleiten! Um die, die an diesem Prozess
Nachwuchsführungskräften, soll das kollegiale maßgeblich beteiligt sind, zu unterstützen.
Lernen gestärkt werden. Und das soll durch Koste es, was es wolle. Letztendlich muss die-
Einzelcoaching Angebote begleitet werden, ses Bewusstsein, dass es diese zwei Angebote
freiwillig zwar, aber deutlich aufgefordert, ein- gibt, immer deutlicher unterstrichen werden.
zelne Lernabschnitte für sich zu reflektieren. Auch die Erfolge müssen sichtbarer und viel
Ganz anders ist in diesem Zusammenhang mehr vermarktet werden.
die Supervision zu sehen. Wenn wir an die
Zukunft denken, ist es ganz wichtig, in den Herr Faber, vielen Dank für das Gespräch!
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 9fokussiert
Wie viel Tod verträgt das Krankenhaus? 1
Ein forschungssupervisorischer Blick auf Palliative Care in der Organisation Krankenhaus
von Ursula Hermann
K
rankenhäuser sind hochkomplexe Das Sterben wurde vom Alltag in einen ins-
Dienstleistungsbetriebe, die unter- titutionalen Rahmen „verlegt“ (vgl. Ariès 2002,
schiedliche gesellschaftliche Funktionen 729 ff.). Das ermöglicht uns eine „stillschwei-
erfüllen. Die Patient_innenversorgung ist dabei gende Aussonderung der Alternden und Ster-
eine ihrer Hauptaufgaben. Die Versorgung benden aus der Gemeinschaft der Lebenden“,
kranker Menschen geht oft mit Unsicherheiten wie Norbert Elias in „Über die Einsamkeit der
einher, denn Heilung ist keine Gewissheit. Me- Sterbenden“ (1990, 8) feststellt.
dizinische Behandlungen werden permanent Gesundheitsinstitutionen wird eine para-
verbessert, immer mehr wird möglich. Doch doxe Aufgabe überlassen: Sie sollen Gesund-
insbesondere der Tod setzt Grenzen und er- heit wiederherstellen, also den Tod besiegen,
zeugt im Krankenhaus die nachhaltigsten Er- gleichzeitig wird in ihnen gestorben. Mit dem
fahrungen des Scheiterns (Grossmann 1997, Sterben muss ein Umgang gefunden werden.
162). Der Kampf der Medizin und Pflege gegen So wird Sterben – etwas zutiefst Intimes und
Sterben und Tod gilt daher als identitätsstif- Persönliches – institutionalisiert und zur Rou-
tend und erweist sich in der Alltagspraxis tine.
des Krankenhauses als widersprüchlich (vgl. Ralph Grossmann skizziert die konstitutive
Grossmann 2000, 82). Denn Sterben und Tod Bedeutung, die das Verhältnis zu Sterben und
gehören zum Krankenhausalltag. Das zeigen Tod für die Organisation Krankenhaus hat:
die aktuellen Sterbezahlen von 2016 (Statistik „Am organisierten Umgang mit Schwerstkran-
Austria 2017): 67,6 Prozent der Verstorbenen ken und Sterbenden werden wie im Brennglas
starben in Krankenhäusern und Heimen, eine zentrale Organisationsprobleme des Kranken-
Zahl, die seit 2006 in etwa gleich geblieben ist. hauses deutlich.“ (Grossmann 2000, 80)
FOTO: FOTOLIA
10 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
Palliative2 Care – ein Paradigmenwechsel curative treatment. Control of pain, of other
Zentrale Organisationsprobleme zeigte Isabel symptoms, and of social, psychological and spi-
Menzies bereits in den 1950er-Jahren anhand ritual problems is paramount. Palliative care is
einer von ihr durchgeführten Studie in einem interdisciplinary in its approach and encom-
Londoner Ausbildungskrankenhaus auf (Men- passes the patient, the family and the commu-
zies 1960). Ihre Ergebnisse veranschaulichen, nity in its scope. In a sense, palliative care is
wie im System Krankenhaus Mechanismen der to offer the most basic concept of care – that of
Angstabwehr so wirkmächtig wurden, dass providing for the needs of the patient wherever
Schwesternschülerinnen reihenweise kündig- he or she is cared for, either at home or in the
ten oder gänzlich ihren Berufswunsch verwar- hospital. Palliative care affirms life and regards
fen (ebd., 108). Sie beschreibt, dass der Kontakt dying as a normal process; it neither hastens
zwischen Krankenschwester und Patient_in nor postpones death. It sets out to preserve the
durch eine völlige Aufsplitterung der einzelnen best possible quality of life until death.“ (EAPC Mag.a Dr.in Ursula
pflegerischen Tätigkeiten so reduziert wurde, European Association of Palliative Care 1989) Hermann MPOS,
dass sich kaum noch eine vertrauensvolle Palliative Care richtet den Blick auf die In- MSc: Supervisorin/
Coach (ÖVS), Trainerin,
Beziehung aufbauen ließ. Das Pflegepersonal dividualität schwer kranker und sterbender Pa-
Lehrbeauftragte an der
sollte auf diese Weise vor „zu viel“ Kontakt tient_innen, auf Schmerzbehandlung, Angstbe- Universität Bielefeld
geschützt werden, verlor damit jedoch den wältigung und Zuwendung. In diesem Sinn löst (Masterstudiengang
Bezug zu den Menschen, für deren umfassende Palliative Care einen Paradigmenwechsel im „Supervision und
Pflege es verantwortlich war. Um im persön- Gesundheitssystem aus (Pleschberger 2002). Beratung“) und der
lichen Kontakt möglichst wenig Beziehung zu Clark und Seymour (1999, 83) sehen neben FH St. Pölten (Depart-
Einzelnen herzustellen, wurden Patient_innen dem Konzept von „total pain“ Teamwork und ment Soziales); im
Redaktionsteam der
als Bettnummern, nach ihren Krankheiten Vertrauen als grundsätzlichen Elemente von
ÖVS News, Projektmit-
oder ihren erkrankten Organen benannt (ebd., Palliative Care. arbeit im abz*austria,
101 f.). Diese Verdrängung von Gefühlen war Auch der organisationale Kontext, in dem abz*gender & diversity.
für das Personal belastend, und für Sterbende das Sterben stattfindet, ist von fundamentaler bildungsberatung
hatte es drastische Folgen: Elisabeth Kübler- Bedeutung (vgl. Grossmann 2000, vgl. Heller österreich. www.ursu-
Ross, eine der Pionierinnen von Palliative Care, 2007). Katharina Heimerl (2008) hat dazu auf- lahermann.at
wird das Zitat zugeschrieben, im Krankenhaus gezeigt, wie sehr es sich bei der Integration
„den Tod aus den Toiletten geholt“ zu haben. von Palliative-Care-Angeboten um umfassende
Denn dorthin wurden Sterbende gebracht, als organisationale Aushandlungs- und Verände-
letzte Konsequenz einer Distanzierung. rungsprozesse handelt, die auch Hospiz und
Für Cicely Saunders, eine weitere Pionie- Palliative Care nachhaltig verändern (Heimerl
rin der Hospizbewegung3 und Palliative Care, 2008, 53).
gab dieser Umgang mit Sterben und Tod in den Seit den 1990er Jahren wurde mit der
Krankenhäusern der 1950er-Jahre in England Schaffung von Hospiz- und Palliativteams, Pal-
Anlass für die Entwicklung und Umsetzung liativstationen und Palliativdiensten4 Palliative
eines neuen Konzepts: Mit dem Versorgungs- Care in die Organisation Krankenhaus und in
und Sorgekonzept Palliative Care richtete sich Pflegeeinrichtungen geholt. Die nachhaltige
der Blick auf das Individuum (Saunders 1996). Integration dieser spezifischen Art der Sorge
Damit reagierte Sanders auf das rigide Kran- funktioniert nicht reibungslos, im Gegenteil. So
kenhaussystem mit einem interdisziplinären dauert es mitunter Jahre bis Jahrzehnte bis
Konzept und der Vorstellung, dass Schmerz als die Angebote hauseigener Palliativteams von
– „total pain“ – umfassend empfunden wird: einzelnen Stationen auch umfassend genützt
physisch, psychisch, sozial und spirituell. werden (vgl. Heimerl 2008, 23 f.)
Die Bezeichnung „Palliative Care“ wurde
erst 1975 vom kanadischen Arzt Balfour Mount Die Praxis im Fokus von Supervisions
geprägt und gilt als Versuch, einen Begriff zu forschung
entwickeln, der sowohl im Französischen wie Palliative Care ist im System Krankenhaus an-
auch im Englischen verständlich ist (Heller gekommen, die tatsächliche Integration passiert
2007, 197). Palliative Care ist der international aber nur zögerlich. Ausgehend von der Frage
verwendete Fachausdruck, im Deutschen wer- „Wie viel Tod verträgt das Krankenhaus?“ lässt
den auch Begriffe wie Palliativmedizin, Pallia- sich nun konkretisieren: Wie verträgt die Ge-
tivbetreuung oder Palliativversorgung verwen- sundheitsorganisation Krankenhaus Palliative
det (Steffen-Bürgi 2006, 31). Die European As- Care?
sociation of Palliative Care definiert Palliative Antworten, tiefe Einblicke in die Praxis, wie
Care wie folgt: auch valide Erkenntnisse geben Supervisions-
FOTO: PRIVAT
„Palliative care is the active, total care of prozesse mit Palliativteams. Diese können als
the patient whose disease is not responsive to Forschungsprozesse (Möller 2012, 89 f.) ange-
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 11fokussiert
wurden, reflektiert. In einem ersten Auswer-
tungsschritt wurden Themenfelder der Su-
pervisionsteams aus den Protokollen erhoben
und einer interdisziplinär zusammengesetzten
Fokusgruppe mit Felderfahrung in der Hos-
piz- und Palliativversorgung vorgestellt. Diese
Ergebnisse sind dann den beiden Supervisi-
onsteams in separaten Fokusgruppensettings
vorgestellt worden. Als Co-Forscherinnen – im
Sinne einer partizipativen Forschungsstrategie
(von Unger 2014) – bewerteten und kommen-
tierten die Supervisandinnen die Ergebnisse.
Ausgehend von den beiden Supervisions-
prozessen, den Inputs der drei Fokusgruppen
und unter Einbeziehung der forschungssuper-
visorischen Reflexionen habe ich relevante
Themen herausgearbeitet, mithilfe der doku-
mentarischen Methode habitualisierte Wis-
sensbestände rekonstruiert und schließlich
eine Typik der unterschiedlichen Erfahrungs-
dimensionen entwickelt.
Im Folgenden werde ich nun auf zwei Er-
gebnisse und eine Typologie meiner Untersu-
chung eingehen, die für die Institution Kran-
kenhaus und ihren Umgang mit Tod und Ster-
ben von besonderer Bedeutung sind.
Palliativ versus kurativ
Anhand der Zuweisungspraxis zu palliativen
Angeboten werden zentrale Widersprüche in-
sehen werden wie auch als „Erkenntnisform nerhalb der Gesundheitsorganisation Kranken-
innerhalb eines Feldes“ (Gröning 2013, 31). haus deutlich sichtbar. Patient_innen werden
Den Forschungscharakter von Supervision „gefiltert“, sie werden entweder als „palliativ“
habe ich mir zunutze gemacht und im Zuge oder als „kurativ“ geführt. Das kann auf den
meiner Dissertation das Erleben von Palliativ- ersten Blick eine überaus sinnvolle Strategie
und Hospizteams untersucht (Hermann 2017). sein, denn Patient_innen, die schwerkrank oder
Forschungsleitend war die Frage nach den sterbend sind, bekommen damit zusätzlich zu
Themen, die für Hospiz- und Palliativteams von oft noch weitergeführten kurativen Behand-
Bedeutung sind. Das Beratungsformat Supervi- lungen auch die Möglichkeit, von einem inter-
sion wurde als Forschungsinstrument im Feld disziplinären Palliativteam betreut zu werden.
der Hospiz- und Palliativversorgung mit For- Doch die Untersuchung zeigt, dass oftmals die
schungsstrategien ausgestattet, die einerseits Bezeichnung „palliativ“ dafür verwendet wird,
die soziale Wirklichkeit der Teams beschreib- eine Patient_in als „sterbend“ zu qualifizieren
bar machten und eine Partizipation der Super- und keine weitere Behandlung zu setzen, auch
visand_innen ermöglichten, und andererseits nicht das Hinzuziehen eines Palliativteams.
die Teilnahme der Forscherin als Supervisorin „Palliativ“ wird hier als vollständiger Behand-
und Beobachterin im Feld methodisch begrün- lungsrückzug verstanden, ganz so als ob im
deten. Selbstverständnis der Gesundheitsorganisa-
Über den Zeitraum eines Jahres wurden tion Krankenhaus nur Heilung, Lebensverlän-
die Supervisionssitzungen mit einem Palliativ- gerung oder Rehabilitation in Frage kommen,
dienst in einem Krankenhaus und einem mo- und Schmerzlinderung und Lebensqualität bis
bilen Hospizteam teilnehmend beobachtet. Die- zuletzt keinen Platz haben. Palliativ und kurativ
ser ethnografische Forschungszugang (Brei- werden als Kontrapunkte definiert, als ein sich
denstein et al. 2013) erfolgte in Anlehnung an ausschließendes Gegensatzpaar – eine Praxis,
die psychoanalytische Work Discussion (Datler, die sehr zum Nachteil der Palliativmedizin und
Datler 2014) in einem Dreischritt: Die Super- folglich auch für Betroffene ist (Gartner, Watzke
FOTO: FOTOLIA
visionen wurden beobachtet, protokolliert und 2006, 125).
im Anschluss in Forschungssupervisionen, die Die Klassifizierung in palliativ und kura-
auf Tonträger aufgezeichnet und transkribiert tiv kann als ein Versuch verstanden werden,
12 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
eine Ordnung, also Eindeutigkeit, herstellen Das Angebot der Trauerbegleitung wird zuge-
zu wollen.5 Es zeigt sich, dass auf diese Weise standen, doch nicht mit der Konsequenz, dass es
keine zufriedenstellende Zuweisung zum An- auch umgesetzt wird, da von dem organisatio-
gebot Palliative Care gelingt. Es bleibt immer nalen Selbstbild der Heil bringenden Organisa-
eine Ambivalenz, eine Unordnung, ein Nicht- tion abgerückt werden müsste (vgl. Grossmann
Zuordnen-Können. 2000, 83 f.). Bei Menzies’ Untersuchung erwei-
Damit wird deutlich, dass nicht der Begriff sen sich die unbewussten organisationalen Ab-
„palliativ“ so problematisch ist, der von den Co- wehrstrategien für viele Schwesternschülerin-
Forscher_innen mitunter für die Zuweisungs- nen als Ursache, die Ausbildung abzubrechen,
schwierigkeiten verantwortlich gemacht wurde weil sich die Abwehr von der Organisation auf
– weil er als zu uneindeutig und aber gleich- eine individuell-persönliche Ebene verlagerte
zeitig auch als zu bedrohlich wahrgenommen (Menzies 1960, 103). Bei dem Palliativteam der
wird – sondern der Anspruch, der mit dieser Untersuchung ist es das Angebot der Trauerbe-
Klassifizierung einhergeht: ordnen zu wollen, gleitung, also Hospiz und Palliative Care, das
wo eigentlich Ohnmacht empfunden wird über Anerkennung erfährt, jedoch in der Umsetzung
das „kurative Scheitern“. auf Distanz und Abwehr stößt. Einen Palliativ-
Diese widersprüchliche Praxis hat Auswir- dienst in einem Krankenhaus zu haben, heißt
kungen auf die Mitarbeitenden von Hospiz- und nicht, dass palliative Kultur praktiziert wird.
Palliativangeboten (vgl. Vachon 1995). Sie löst Katharina Heimerl (2008, 23) verweist hier auf
Spannungen und Irritationen aus, die so weit Eduardo Bruera (2004), der vier Stadien der
gehen, dass ein Moral Distress6 (Brazil et al. Entwicklung palliativer Kultur im Krankenhaus
2010) deutlich erkennbar wird. Im Rahmen der definiert: Ablehnung, Palliphobie, Pallialie und
Untersuchung manifestierte sich dieser an der Pallaktivität. Meine Untersuchung bestätigt,
Kontrollfunktion eines Palliativteams. Es entwi- dass die Stadien auch gleichzeitig erfolgen
ckelte von sich das Bild der „Palliativpolizei“. können. Das Angebot der Trauerbegleitung
Damit wird innerhalb des Krankenhauses Pal- aufzunehmen, es jedoch nicht publik zu ma-
liative Care von den Teams, die es anbieten als chen, entspricht bereits der dritten Stufe pallia-
Kampf um Versorgung und Schutz von vulnera- tiver Kultur (Bruera 2004, zitiert nach Heimerl
blen Menschen verstanden, die sonst im Versor- 2008, 23 f.): der Pallialie. Für dieses Stadium
gungssystem unterzugehen drohen (Hermann ist kennzeichnend, dass Monate bis Jahre nach
2017, 276 ff.). Gleichzeitig wird in der Institu- der Einführung von Palliative-Care-Program-
tion eine Organisationsdynamik sichtbar, die mit men nicht ausreichend Ressourcen zur Verfü-
einer vermeintlich deutlichen Klassifizierung für gung gestellt werden, obwohl in der Organisa-
eine unklare Zuweisung zum Angebot Palliative tion Palliative Care als wichtiges Thema erach-
Care sorgt (Hermann 2017, 248 ff.). tet wird. Für eine integrierte palliative Kultur
innerhalb der Organisation, der Pallaktivität,
Abwehr und Wertschätzung weist das Erleben einer Supervisandin hin, die
Wenn sich die Widersprüche der Organisation für Sterbebegleitungen durchwegs sehr hohe
anhand irritierenden Erlebens zeigen, erhöht
sich bei den Berufsgruppen von Palliative Care
der moralisch konflikthafte Stress deutlich
(vgl. Brazil et al. 2010). Aufseiten der Organi-
sation kann jedoch ein komplexes Verhalten
beschrieben werden, das Anknüpfungspunkte
an die den von Isabel Menzies (1960, 100 ff.)
formulierten „defensive techniques“ aufweist.
Ein Beispiel dafür ist der widersprüchliche
Umgang mit dem Angebot der Trauerbeglei-
tung, die das Palliativteam der Untersuchung
im Krankenhaus anbieten wollte. Die Kranken-
hausleitung genehmigte dem Palliativteam eine
Trauergruppe zu initiieren und fand dafür auch
anerkennende Worte, im Krankenhaus durfte
dafür aber nicht geworben werden. Ohne Be-
werbung kommt so ein Angebot allerdings
nicht zustande. Eine Supervisandin des Pallia-
FOTO: FOTOLIA
tivteams kommentierte diese Haltung mit den
Worten: „Eigentlich will man den Tod nicht im
Haus haben“ (Hermann 2017, 304).
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 13fokussiert
Wertschätzung von Seiten der Leitung wie auch die Widersprüchlichkeiten, die damit einher
von Kolleg_innen unterschiedlicher Stationen gehen, viel wirkmächtigere Belastungsfaktoren
erfährt (Hermann 2017, 306). als der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer.
Um am Ende noch einmal auf die Eingangs-
Bezug versus auf Distanz zum Angebot frage zurückzukommen: Die Institution Kran-
Palliative Care kenhaus verträgt das Sterben und Palliative
Dass Palliative Care als Haltung innerhalb Care durchaus, allerdings mit Widerstand. Und
einer Organisation alle vier Stadien gleichzei- dieser Widerstand, der mit dem Prozess der
tig durchlaufen kann, von Ablehnung bis zur Integration einhergeht, ist für Mitarbeitende
Praxis palliativer Kultur, belegt die Typologie, von Palliative Care-Angeboten mitunter schwer
die sich aus der Untersuchung in Bezug auf verdaulich. Damit bietet sich Supervision ge-
die Organisation Krankenhaus ableiten lässt: rade in diesem Feld als geschützter Rahmen
„Bezug versus auf Distanz zum Angebot Palli- und Ort der Reflexion und des Verstehens in
ative Care“ (Hermann 2017, 337). Diese Typo- besonderer Weise an.
logie wird getragen von der „Gleichzeitigkeit
des Ungleichzeitigen“ (Hausinger 2008), einem
Phänomen der heutigen Arbeitswelt. Was heißt
Referenzen:
das? Parallel zur Herausforderung des Feldes,
Ariès, P. (2002): Geschichte des Todes. 10. Auflage, München:
die gekennzeichnet ist durch ein bewusstes
Deutscher Taschenbuch Verlag
sich Einlassen auf Sterbende und ihre An- und
Zugehörigen, geht gleichzeitig für die Mitarbei- Bauman, Z. (2005): Moderne und Ambivalenz. Das Ende der
Eindeutigkeit. Hamburg: Hamburger Edition
tenden von Palliative-Care-Angeboten in Orga-
nisationen ein widersprüchliches Erleben ein- Brazil, K.; Kassalainen, S.; Ploeg, J.; Marshall, D. (2010):
Moral distress experienced by health care professionals who
her, das Palliative Care als Angebot innerhalb provide home-based palliative care. In: Social Science &
der Organisation Krankenhaus ablehnt, an- Medicine, 71: 1687-1691
FOTO: FOTOLIA
nimmt, abwehrt, bekämpft oder auch ignoriert.
Breidenstein, G.; Hirschauer, S.; Kalthoff, H.; Nieswand, B.
Beim untersuchten Palliativteam waren diese (2013): Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung. Konstanz,
organisationsdynamischen Auswirkungen und München: UVK
14 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhausfokussiert
Bruera, E. (2004): The Development of Palliative Care Cul- Menzies, I. (1960): A Case-Study in the Functioning of Social
ture. In: Journal of Palliative Care 20(4): 316-319 Systems as a Defence: Against Anxiety. A Report on a Study oft
he Nursing Service of a General Hospital. Human Relations
Clark, D.; Seymour, J. (1999): Reflections on palliative care. 13(2): 295-121
Buckingham, Philadelphia: Open University Press
Möller, H. (2012): Was ist gute Supervision? Grundlagen –
Datler, W.; Datler, M. (2014): Was ist „Work-Discussion“? Über Merkmale – Methoden. Kassel: Kassel University Press
die Arbeit mit Praxisprotokollen nach dem Tavistock-Konzept.
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:368997/ Müller, M.; Pfister, D. (Hrsg.) (2012): Wie viel Tod verträgt das
bdef:Content/get. Zugegriffen am 27.05.2015 Team? Belastungs- und Schutzfaktoren in Hospizarbeit und
Palliativmedizin. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Elias, N. (1990): Über die Einsamkeit der Sterbenden in unse-
ren Tagen. 4. Auflage, Frankfurt am Main: Suhrkamp Pleschberger, S. (2002): Palliative Care. Ein Paradigmen-
wechsel. Österreichische Pflegezeitschrift 12: 16-18
EAPC European Association of Palliative Care (1989): Defi-
nition of Palliative Care http://www.eapcnet.eu/Corporate/ Pleschberger, S. (2006): Die historische Entwicklung von
AbouttheEAPC/DefinitionandAims.aspx. Zugegriffen am Hospizarbeit und Palliative Care. In: Knipping, C. (Hrsg.):
3.2.2017 Lehrbuch Palliative Care. Bern: Huber, 24-29
Gartner, V.; Watzke, H. (2006): Palliativmedizin. Grundlagen Saunders, C. (1993): Foreword. In: Doyle, D.; Hanks, G. W. C.;
MacDonald, N. (Eds.): Oxford Textbook of Palliative Medicine.
und Symptomkontrolle. Wiener Klinische Wochenschrift
Oxford: Oxford University Press, v-viii.
Education 2: 123-134
Saunders, C. (1996): A personal therapeutic journey. In: Bri-
Gesundheit Österreich (2012): Prozesshandbuch Hospiz- und
tish Medical Journal 313:1599. http://www.bmj.com/con-
Palliativeinrichtungen. https://www.bmgf.gv.at/cms/home/
tent/313/7072/1599. Zugegriffen am 31.5.2017
attachments/3/6/7/CH1071/CMS1103710970340/prozess-
handbuch_hospiz-_und_palliativeinrichtungen_02-11-2012. Statistik Austria (2017): ergebnisse_im_ueberblick_gestor-
pdf Zugegriffen am 12.6.2016 bene.pdf https://www.statistik.at/web_de/statistiken/men-
schen_und_gesellschaft/bevoelkerung/gestorbene/index.
Gesundheit Österreich (2014): Abgestufte Hospiz- und Pal-
html. Zugegriffen am 31.5.2017
liativversorgung für Erwachsene. 2., aktualisierte Auflage.
http://www.hospiz.at/pdf_dl/broschuere_hospiz-_und_palli- Steffen-Bürgi, B. (2006): Reflexionen zu ausgewählten Defini-
ativversorgung_1_12_2014.pdf Zugegriffen am 6.6.2017 tionen der Palliative Care. In: Knipping, C. (Hrsg.): Lehrbuch
Palliative Care. Bern: Huber, 30-38
Gröning, K. (2013): Supervision. Traditionslinien und Praxis
einer reflexiven Institution. Gießen: Psychosozial-Verlag Vachon, M. L. (1995): Staff stress in hospice/palliative care: a
review. In: Palliative Medicine 9(2): 91-22
Grossmann, R. (1997): Besser Billiger Mehr – Zur Reform der
Expertenorganisationen Krankenhaus, Schule, Universität. von Unger, H. (2014): Partizipative Forschung. Einführung in
iff-Texte Bd. 2. Wien, New York: Springer die Forschungspraxis. Wiesbaden: Springer VS
Grossmann, R. (2000): Organisationsentwicklung im Kran-
kenhaus. In: Heller, A.; Heimerl, K.; Metz, C. (Hrsg.): Kultur
des Sterbens. Bedingungen für das Lebensende gestalten. 2.
Auflage, Freiburg im Breisgau: Lambertus, 80-105 1 Der Titel ist in Anlehnung an die Publikation von Müller,
Pfister (2012) gewählt.
Hausinger, B. (2008): Supervision: Organisation – Arbeit –
Ökonomisierung. Zur Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 2 Das Wort „palliativ“ geht auf das lateinische Verb „pal-
in der Arbeitswelt. Arbeit und Leben im Umbruch. München, liare“ zurück, das mit „umhüllen, fürsorglich beschützen“
Mering: Rainer Hampp (Heller, Pleschberger 2010, 16) übersetzt werden kann.
Heimerl, K. (2008): Orte zum Leben – Orte zum Sterben. 3 Mit der Eröffnung des „St. Christopher’s Hospice“ in
Palliative Care in Organisationen umsetzen. Freiburg im London im Jahr 1967 begründete Cicely Saunders die
Breisgau: Lambertus neue Hospizbewegung (Saunders 1993). „Hospiz“ wird
vom Lateinischen „hospitium“ hergeleitet und bedeutete
Heimerl, K.; Heller, A.; Pleschberger, S. (2006): Implementie- ursprünglich „Gastfreundschaft“ (Pleschberger 2006,
rung der Palliative Care im Überblick. In: Knipping, C. (Hrsg.): 25). Die ersten „modernen Hospize“, verstanden als Orte
Lehrbuch Palliative Care. Bern: Huber, 50-57 für Sterbende, entstanden bereits in der Mitte des 19.
Jahrhunderts in Australien und Frankreich.
Heller, A. (2007): Die Einmaligkeit von Menschen verstehen
und bis zuletzt bedienen. Palliative Versorgung und ihre Prin- 4 Die „Abgestufte Hospiz- und Palliativversorgung für
zipien. In: Heller, A.; Heimerl, K.; Husebø, S. (Hrsg.): Wenn Erwachsene“ (Gesundheit Österreich 2014) beschreibst die
nichts mehr zu machen ist, ist noch viel zu tun. Wie alte Men- gesamte Angebotspalette, das „Prozesshandbuch Hospiz-
schen würdig sterben können. 3., aktualisierte und erweiterte und Palliativeinrichtungen“ (Gesundheit Österreich 2012)
Auflage, Freiburg im Breisgau: Lambertus, 191-208 skizziert systematische Musterprozesse für jedes einzelne
spezialisierte Angebot, auch um für dieses noch junge
Heller, A.; Pleschberger, S. (2010): Hospizkultur und Palliativ Leistungsangebot erste Qualitätskriterien zu etablieren.
Care im Alter. In: Heller, A.; Kittelberger, F. (Hrsg.): Hospiz-
kompetenz und Palliative Care im Alter. Eine Einführung. 5 „Klassifizieren besteht aus den Handlungen des
Freiburg im Breisgau: Lambertus, 15-51 Einschließens und des Ausschließens“, konstatiert Zygmunt
Bauman (2005, 13) und verweist auf das Bestreben,
Hermann, U. (2017): „Je länger ich dabei bin, desto DURCH- Eindeutigkeiten zu konstruieren.
LÄSSIGER werde ich.“ Palliative Care im Fokus von Supervi-
sion: eine ethnografisch-partizipative Untersuchung von Pal- 6 Brazil et al. (2010, 1687) definieren das Erleben des
liativ- und Hospizteams. Dissertation, Universität Klagenfurt Moral Distress mit Bezug auf Jameton (1984) als „[...] the
feelings and experiences which result from a moral conflict
Jameton, A. (1984): Nursing practice: The ethnical issues. where one has a sense of the correct action to take but
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall constraints prevent implementation of the action.“
Themenschwerpunkt Dynamiken im Krankenhaus ÖVS news 2/2017 15informiert
Lebenskraft statt Burnout
Am 19. Mai 2017 fand in Linz eine Fortbil- und den Zugriff zu unbewusstem Erfahrungs-
dungsveranstaltung der ÖVS OÖ statt. Im Sinne wissen. Dies ist besonders für die Auseinander-
des Formates „brush up your tools“, wurden setzung mit Eigenmotivation und Bedürfnissen
vier Workshops angeboten, die sich allesamt sowie zur Bearbeitung komplexer Themen und
dem Thema „körperzentrierte Methoden“ der Suche nach kreativen Lösungen nützlich.
widmeten. Es referierten die Mitglieder der Danach konnten die TeilnehmerInnen der
Arbeitsgruppe „Lebenskraft“: Roswitha Hölzl, Fortbildung aus vier Workshops wählen, die
Gertraud Schlecht, Catherine Spöck, Helga sowohl im Freien, als auch im Seminarhaus
Prähauser-Bartl, Anita Putscher und Elisabeth durchgeführt wurden.
Peitl (von links nach rechts).
Diese Gruppe beschäftigt sich seit mehr als „Geh-Spräche“ und „Walk & Talk“ – geleitet
zwei Jahren, im Rahmen einer ARGE der ÖVS von Gertraud Schlecht und Roswitha Hölzl:
OÖ, intensiv mit dem Thema Burnout- Prä- Zahlreiche Studien belegen die positiven Aus-
vention. Aus der langjährigen Erfahrung als wirkungen von körperlicher Bewegung in der
Beraterinnen, gepaart mit den Erkenntnissen Natur, einem achtsamen Umgang mit sich
der Recherchen wurden Methoden vorgestellt, selbst und dem Erkennen und Einsetzen der
die SupervisandInnen dabei unterstützen, Ihre eigenen Stärken und Ressourcen in der Burn-
Selbstwahrnehmung und Selbstachtsamkeit zu out-Prävention und -Behandlung
sensibilisieren, sich zu stärken, zu entspannen Ziel dieses Workshops war, für die Teil-
und neue Kräfte zu sammeln – die personale nehmerInnen die positiven Auswirkungen von
und organisationale Resilienz zu stärken. Bewegung in der Natur spürbar zu machen,
Catherine Spöck gab in einem Einfüh- achtsam ihren Körper und die eigenen
rungsvortrag einen theoretischen Input zum Bedürfnisse und Gefühle wahrzunehmen und
Thema der Fortbildung „Körperzentrierte Bewusstheit darüber zu entwickeln, wie sie
Methoden in Supervision und Coaching“ und ihre persönlichen Stärken für ein gerade anste-
spannte den Bogen von sprach- und vernunft- hendes Thema nutzen können.
zu körperorientierten Vorgehen. Unsere kul- Mitten in einer Blumenwiese in einem Lin-
turgeschichtlich begründete, vernunftbetonte zer Park wurde mit einer Qigongübung gestar-
Arbeitsgruppe Prägung wird durch die emotionale Wende und tet. Anschließend haben die TeilnehmerInnen
„Lebenskraft“: ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse heraus- bei einem Spaziergang für ihre drei wichtigs-
Roswitha Hölzl, gefordert. Gefühle und Körperempfinden wer- ten Stärken Symbole aus der Natur gefunden
Gertraud Schlecht, den als maßgebliche Informationsquellen und und sich damit beschäftigt, wie sie diese Stär-
Catherine Spöck, Helga
Auslöser für Denk- und Handlungsprozesse ken für das aktuelle Thema einsetzen können.
Prähauser-Bartl, Anita
Putscher und Elisabeth entdeckt. Eine achtsame, körperzentrierte Im gegenseitigen Austausch konnten neue
Peitl (von links nach Arbeitsweise im Supervisionskontext ermög- Möglichkeiten angedacht und durch Feed-
rechts). licht den Wechsel auf eine zusätzliche Ebene back weitere Sichtweisen eröffnet werden.
Abschließend erfolgte eine weitere, angeleitete
Körperübung.
Rückmeldungen von den TeilnehmerInnen:
„Wieder in einer Blumenwiese gehen – das
sind Kindheitserinnerungen.“
„Ich wusste nicht, dass es in Linz solche
Plätze gibt, ich war seit Jahren das erst Mal
wieder spazieren.“ „Vor allem die Körperübun-
gen haben mir gut getan.“
„Aufrecht durch’s Leben“ geleitet von Elisa-
beth Peitl: Immer dann, wenn vorhandene, rou-
tinierte Strategien nicht mehr zum Erfolg füh-
ren, werden Veränderungsprozesse notwendig.
Es gilt, neue Denk- und Handlungsmuster zu
kreieren und dauerhaft abzuspeichern. Neuro-
FOTO: ERWIN PILS
wissenschaftliche Forschungsergebnisse stellen
ebenfalls Zusammenhänge zwischen körperli-
chem Empfinden, Emotionen und Denkmustern
16 ÖVS news 2/2017 Themenschwerpunkt Dynamiken im KrankenhausSie können auch lesen