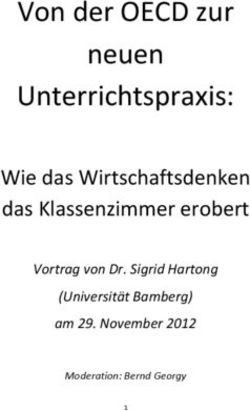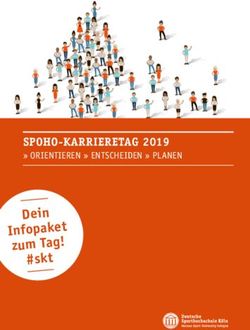WIE DIGITALISIERUNG GELINGT - Diffusion digitaler Technologien in der Beruflichen Bildung durch Lernortkooperation
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Diffusion digitaler Technologien
in der Beruflichen Bildung
durch Lernortkooperation
WIE DIGITALISIERUNG GELINGT
HANDLUNGSEMPFEHLUNGENVORWORT 3 BERUFSSCHULEN Schulorganisation und -leitung 5 Lehrende 8 Medienverantwortliche 10 AUSBILDENDE UNTERNEHMEN Organisationsentwicklung – Digitalisierungsstrategie, Implementierung und Lernkultur 13 Qualifizierung des Ausbildungspersonals 16 Digitale Lehr- und Lernprozesse 18 Netzwerke und digitale Lernortkooperation 20 DIGITALDIENSTLEISTER DER BERUFLICHEN BILDUNG Wegweiser 23 Akzeptanz und Offenheit 24 Produktvielfalt und Verbreitung 25 Nutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Ästhetik 26 Motivation zur Nutzung 29 Technische Ausstattung und Zugänglichkeit 30 Umgang mit Daten 33 Kommunikation und Kooperation 35 LITERATUR 36 KONTAKT 38
Vorwort
Die Digitalisierung der Arbeitswelt forciert einen Wandel von Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
etablierten Berufsbildern und geht mit neuen Kompetenzbe- (BMBF) geförderte Verbundprojekt Diffusion digitaler Tech-
darfen einher. Diese Entwicklung geht an der beruflichen Bil- nologien in der Beruflichen Bildung durch Lernortkooperation
dung nicht spurlos vorüber. Mit der Digitalisierung wandeln (DiBBLok) hat im Zeitraum von 2019 bis 2021 in einem For-
sich sowohl Ausbildungsinhalte als auch Ausbildungsme- schungsverbund von TU Dresden, Fraunhofer IMW Leipzig
thoden. Digitale Medien bieten enormes Potenzial für mehr und FH Dresden mit qualitativen und quantitativen Verfah-
Flexibilität und Leistungsfähigkeit in der beruflichen Bildung. ren die förderlichen und hemmenden Faktoren der Digitali-
Sie entkoppeln Ort und Zeit voneinander und ermöglichen sierung auf Ebene von organisationalen Strukturen und Pro-
neue Freiheitsgrade mit der Qualifizierungsangebote skaliert zessen an den Lernorten der dualen Ausbildung untersucht.
und schneller an neue Entwicklungen und Bedarfe aber auch Auf der Basis des im Projekt gemeinsam daraus entwickelten
neue methodische Zugänge angepasst werden können. Faktorensystem wurden Handlungsempfehlungen formu-
Durch die steigende Nutzung der Informations- und Kom- liert, die sich über die Bereiche Berufsschule, Unternehmen
munikationstechniken in bestehenden und neuen Berufen bis hin zu technologischen Aspekten erstrecken, und die für
ergeben sich Potenziale der Verschränkung und Vermittlung die vorliegende Veröffentlichung aus den unterschiedlichen
von beruflichen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Kenntnissen und Teilprojekten zusammengeführt wurden.
Verhaltensweisen. Es ist daher von besonderer Bedeu- Wir danken allen, die sich als Akteurinnen und Akteure von
tung, die Bedingungen des Gelingens der Digitalisierung in beruflichen Schulen und ausbildenden Unternehmen sowie
der beruflichen Bildung zu identifizieren und Handlungs- von Kammern und Technologiedienstleistern an den empi-
empfehlungen daraus abzuleiten, die es möglich machen, rischen Erhebungen im Projekt DiBBLok beteiligt haben und
passgenaue und auf die jeweiligen Akteure und Akteurinnen hoffen, dass die Empfehlungen der Projektgruppe zur Quali-
zugeschnittenen Angebote für eine zukunftsfähige Berufs- tät der beruflichen Bildungspraxis beitragen können.
bildung zu entwickeln.
3Berufsschulen Die Basis für die nachfolgend dargestellten Handlungsempfehlungen bilden qualitative und quantitative Erhebungen, wie sie im Forschungsprojekt DiBBLok im Zeitraum von 2019 bis 2021 vom Verbundpartner TU Dresden durchgeführt wurden. Um ein ganzheitliches Bild von Digitalisierungsprozessen zu erhalten, wurden dabei zunächst Strukturdaten des Online-Berichtshefts BLok analysiert und Interviews im Umfeld von ausbildenden Unternehmen und Berufsschulen geführt, um darauf aufbauend die Einrichtungen selbst auf der Makro-, Meso- und Mikroebene im Rahmen von Fallstudien sowie einer Online-Befragung zu beforschen. 4
SCHULORGANISATION
UND -LEITUNG
Digitalisierungsstrategie und
Budget für Digitalisierung
Ein wesentlicher Ankerpunkt bei der digitalen Transformation einer Organisation
sollte eine Digitalisierungsstrategie sein, in der klar definiert wird, welche Ziele mit
der Digitalisierung im Rahmen der beruflichen Ausbildung verbunden sind. Die
Verfügbarkeit eines Budgets für die Digitalisierung schafft zudem Handlungsspiel-
räume bei der Anschaffung und Erprobung von Technologien. Der übergreifen-
den Digitalisierungsstrategie wird eine höhere Bedeutung als dem Budget für die
Digitalisierung zugesprochen.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Digitalisierung sollte fest im Leitbild der Schule verankert werden, ver-
bunden mit einem Medienkonzept, in dem medienpädagogischen Ent-
wicklungsziele und der Fortbildungsbedarf hinterlegt sind. Des Weiteren
muss das Konzepte konkrete Umsetzungsmaßnahmen beinhalten.
Schulen sollten ihre Verwaltung zunehmend digitalisieren und per-
sonenbezogene Daten aktuell und sicher verwalten. Durch ein solches
Datenmanagement können Informationen leichter abgerufen und weiter-
verarbeitet werden.
Die Arbeit mit digitalen Medien sollte sich in der Außendarstellung
der Schule, z. B. auf der Website wiederfinden, um die Attraktivität der
eigenen Schule zu erhöhen. Aktuell stellen erst wenige Berufsschulen dar,
welche Rolle Digitalisierung im Berufsschulalltag spielt.
Um das Budget zu erhöhen, ist die Teilnahme an Ausschreibungen und
anderen staatlichen, sowie privat-wirtschaftlichen Förderungsmöglich-
keiten ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung. Dazu sollten Beratungs-
angebote gesammelt werden und die stetige Sichtung dieser unter den
Lehrenden aufgeteilt werden, damit die Arbeitsbelastung pro Person nicht
zu hoch wird. Besonders hilfreich ist das Abonnieren von Newslettern.
5Wissensmanagement Kommunikation und Austausch
Für die Digitalisierung ist ein gut implementiertes Wissens- Der Faktor Kommunikation/Austausch fokussiert die inner-
management von großer Bedeutung. Wissen sollte über- organisationale Kommunikation und Kooperation im Sinne
greifend nutzbar gemacht werden, damit Erfahrungswissen eines Austauschs (z. B. auch abteilungs-/standortübergrei-
nicht nur bei einzelnen Mitarbeitenden verbleibt und beim fend). Wie die Kommunikation und der Austausch in der
Ausscheiden dieser Person aus dem Unternehmen wichtige beruflichen Bildung ausgestaltet werden, hängt vom Engage-
Informationen verloren gehen. Ein gutes Wissensmanage- ment einzelner Ausbildender sowie der Organisationskultur
ment kann die Verbreitung der Nutzung von Technologien und den Strukturen der Berufsschulen und Ausbildungs-
für die betriebliche und schulische Ausbildung steigern. betriebe ab. Kommunikation und Kooperation innerhalb
der Schule nehmen eine essenzielle Rolle im Rahmen der
Digitalisierung ein. Ohne sie sind Wissensaustausch und
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN -management nicht möglich.
Die Einrichtung einer digitalen Stunde, in der HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Lehrende ihre erfolgreichsten Projekte vorstel-
len oder neuentdeckte digitale Werkzeuge sowie
Ressourcen miteinander teilen, verbessert das Um die didaktische Aufbereitung von Aufgaben
Wissensmanagement. mit Digitalisierung zu unterstützen, sollten diverse
Berufsschulen sollten Datenbanken zur Verfügung Austauschmöglichkeiten zwischen den Lehrenden
stellen, auf denen Lehrende ihre Unterrichtsmate- gefördert werden. Darüber hinaus könnten gemein-
rialien dem Kollegium zur Verfügung stellen können. same Vorbereitungsstunden angeboten werden.
Auf diese Weise können die Materialien kooperativ Lehrende sollten sich einmal monatlich zu einer
weiterentwickelt und bei Ausfällen leicht für Vertre- digitalen Stunde zusammenfinden. Hier können sie
tende zugänglich gemacht werden. digitale Werkzeuge vorstellen, neue medienpäda-
Administrative Informationen, wie der aktuelle gogische Konzepte diskutieren sowie Schulungen
Stunden- oder Vertretungsplan, sollten zentral auf zur Bedienung von neuen Geräten anbieten. Auf
der Website oder per E-Mail zur Verfügung gestellt diese Weise sollen das häufig schon vorhandene
werden. Push-Benachrichtigungen bei Änderungen, Potenzial und die individuellen Erfahrungswerte für
mit denen viele Personen ohne direkte Interaktion das gesamte Kollegium nutzbar gemacht werden.
erreicht werden können, sind ebenfalls hilfreich. Für die Kommunikationswege sollten nicht zu viele
redundante Tools verwendet werden.
6Implementierungsprozesse Lernortkooperation
Implementierung beschreibt den gesamten Prozess der Lernortkooperation beschreibt die Vernetzung und Zusam-
Einführung von Digitalisierung innerhalb einer Organisation. menarbeit verschiedener Organisationen: Im Rahmen der
Dazu gehören folgende Schritte: dualen Ausbildung sind hiermit vorwiegend die ausbilden-
1 | Vision und Initialisierung den Unternehmen und Berufsschulen gemeint. Durch den
2 | Bildungsdiagnose – Analyse des Ist- und Soll-Zustands Einsatz digitaler Technologien kann die (Lernort-)Koopera-
3 | Konzeption und Design tion orts- und zeitunabhängiger umgesetzt werden.
4 | Realisierung und Produktion
5 | Betriebliche Umsetzung
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Allgemein gilt es, digitale Informationsübermitt-
lung für die Lernortkooperation zu nutzen.
Bei der Implementierung sollte vor allem die Parti- Für die Auszubildenden sollten Informationen über
zipation der Teilnehmenden frühzeitig beginnen ihren jeweiligen Lernstand digital so dokumentiert
und ausreichend Raum erhalten. Dabei sollten werden, dass im Anschluss beide Dualpartner dar-
Workshops zur Bedarfsanalyse durchgeführt und auf zugreifen können.
Mitverantwortlichkeiten bei der Konzeption sowie Es empfiehlt sich, feste Kooperationsvereinbarun-
Realisierung vergeben werden. gen mit Betrieben zur Förderung der digitalen
Renovierungsphasen sollten genutzt werden, um Kompetenzen der Auszubildenden zu treffen und
Veränderungen voranzutreiben. Dazu muss die schriftlich festzuhalten.
Planung in Zusammenarbeit mit der Schulleitung Vertretende der Unternehmen sollten als Berate-
erfolgen, die darauf aufbauend gezielt Einfluss neh- rinnen bzw. Berater herangezogen werden. Dazu
men kann. eignet sich ein jährlich tagender Ausschuss. Es gilt
darauf zu achten, dass die Betriebe kontinuierlich
Auszubildende stellen und die zeitliche Belastung
nicht zu stark wird, damit eine aktive Zusammen-
arbeit erhalten bleibt.
7LEHRENDE
Didaktik
Digitales Lernen eröffnet eine große Bandbreite an Lernme-
thoden, die von interaktivem Austausch über Simulationen
bis hin zum digitalen Testing reichen. Auch die Formate kön-
nen von Präsenz mit digitalen Anreicherungen über hybride
Strukturen bis hin zu kompletten Online-Formaten reichen.
Im Zusammenhang mit der Didaktik ist daher sowohl eine
entsprechende Anpassung der Lernmethoden und -umge-
bungen als auch die der Lerninhalte von Bedeutung. Aus
diesem Grund ergeben sich Handlungsempfehlungen in
mehreren Teilbereichen.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
LERNUMGEBUNG SOZIALFORMEN
Eine praxisnahe Ausbildung kann mit Simulationen Gruppenarbeiten sollten mit gemeinsamer Cloud-
und digitalen Reparaturleitfäden sowie Erklär- Speicherung, dem leichten Verteilen von Doku-
videos unterstützt werden. Für die Prüfungsvorbe- menten und dem Austausch über verschiedene
reitung sollten digitale Self-Assessments angeboten Netzwerke wie E-Mail, WhatsApp, Skype, Discord,
werden. LernSax oder Zoom unterstützt werden.
MEDIENDIDAKTISCHE METHODEN UND FORMATE FEEDBACK
Damit digitale Medien ihren Mehrwert in Bezug auf Unmittelbares Feedback bei Self-Assessment-
die Unterrichtsgestaltung entfalten, ist es sinnvoll, Aufgaben unterstützt den Lernprozess und
die 45-Minuten-Taktung aufzubrechen und den motiviert dazu, eigenständig weitere Übungen zu
Auszubildenden zunehmend freie Arbeitszeiten bearbeiten.
anzubieten, in denen sie selbstgesteuert entschei- Zur Etablierung einer konstruktiven Fehlerkultur
den, welche Inhalte sie in welcher Intensität bearbei- muss diese durch die Lehrenden in Form von primär
ten möchten. formativen anstelle von summativ genutztem Feed-
Auszubildende sollten dazu angeleitet werden, ihre back aufgebaut und auch vonseiten der Schulleitung
Dokumentationen zu Lernzwecken zu nutzen, gelebt werden.
damit sie einen tatsächlichen Mehrwert aus der kon-
tinuierlichen und ausführlichen Berichtheftführung
ziehen können.
Bei physischen Unterlagen sollte ein Ordner mit
allen Materialen zum Einscannen angelegt werden.
8Qualifizierung und Weiterbildung
Durch Veränderungen der Arbeitswelt sind Einrichtungen HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
der beruflichen Bildung angehalten, die Kompetenzen und
Qualifikationen ihrer Mitarbeitenden und der Lehrenden
ständig den aktuellen Anforderungen anzupassen. Organi- Die Lehrenden müssen in Bezug auf die Digitalisie-
sationales und digitalisierungsbezogenes Wissen gewinnt rung auf unterschiedlichen Ebenen Kompetenzen
zunehmend an Bedeutung für Innovations- und Wettbe- erlangen. Neben der Bedienfähigkeit sollten auch
werbsfähigkeit von Unternehmen und Schulen. Die Bereit- Kompetenzen zu medienpädagogischen Gestal-
schaft zu Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten tungsprozessen vermittelt werden.
ist – neben der generellen Motivation und persönlichen Durch regelmäßige Schulungen der Lehrkräfte
Akzeptanz von Digitalisierungsprozessen – essenziell für können vorhandene technische Kompetenzen und
die Einführung neuer Prozesse und Strukturen in Bezug auf die Akzeptanz digitaler Technik weiter verbessert
Digitalisierung. werden.
Die Bedienkompetenzen sind bei den Ausbildenden
geringer ausgeprägt als bei den Auszubildenden,
was zu einer geringeren Nutzungshäufigkeit vom
Online-Berichtsheft Blok geführt hat. Für die erfolg-
reiche Diffusion digitaler Technologien sollte daher
die Bedienkompetenz der Ausbildenden erhöht
werden.
9MEDIENVERANTWORTLICHE
Organigramm und Technische Ausstattung
Verantwortlichkeiten
Die Verfügbarkeit von geeigneter Technik ist der Drehpunkt
aller Digitalisierungsprozesse in der dualen Ausbildung und
Das Organigramm als grafische Darstellung der Struktur wird als sehr relevant eingestuft. Neben der technischen
einer Organisation kann Abteilungen, Einheiten und kon- Ausstattung scheinen insbesondere die Nutzerfreundlichkeit
krete Personen beinhalten und ihr Verhältnis zueinander und Funktionalität der Tools relevant zu sein. Die Ästhe-
abbilden sowie klare Zuständigkeiten, Aufgabenverteilungen tik oder das Image der Anwendung ist dagegen weniger
sowie Arbeitsbereiche und Kommunikationswege auch in relevant.
Bezug auf die Digitalisierung fest- und offenlegen. Ohne
geregelte Verantwortlichkeiten innerhalb der Schulstruktur
können Veränderungsprozesse nicht ihr gesamtes Potenzial HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
entfalten.
WLAN sollte für alle im gesamten Schulgelände ver-
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN fügbar sein, einschließlich für die Auszubildenden.
Mit der Anschaffung von Groupware zum digitalen
Teilen von Informationen wird das Wissensmanage-
Schulen sollten Verantwortlichkeiten für Digitali- ment unterstützt. Im besten Fall werden konkrete
sierung transparent im Organigramm festhalten. Zeiträume für die Dokumentation eingeplant und
Dabei empfiehlt es sich, eine datenschutz- und von der Leitungsebene anerkannt und honoriert.
administrationsbeauftragte Person zu benennen. Bei Lernplattformen ist es sinnvoll, zunächst
Zusätzlich sollten Arbeitsgruppen zu einzelnen auf Open-Source-Varianten zurückzugreifen oder
Tools gefördert und in jedem Fachbereich eine ver- bundeslandspezifische Plattformen zu nutzen. Die
antwortliche Person für Technik benannt werden, tatsächliche Nutzung erhöht sich, wenn diese den
die den branchenspezifischen Anschaffungsbedarf Lehrenden offensiv nahegelegt und das Anlegen von
definiert. Kursen unterstützt wird.
Das Spannungsfeld zwischen freiem Zugang zur Die Entscheidung über die Anschaffung neuer
und Schutz der Technik ist zu beachten. Um Van- Geräte und Software sollte auf der Basis der bereits
dalismus und Diebstahl vorzubeugen, werden sonst vorhandenen Technik erfolgen. Damit können
offen zugängliche Räume häufig abgeschlossen. Redundanzen vermieden und Kompatibilität und die
Eine bessere Kontrolle kann aber z. B. auch dadurch Verfügbarkeit von Schnittstellen abgesichert werden.
erreicht werden, dass frei zugängliche Medienplätze Ist die technische Ausstattung für die branchenspe-
neben dem Lehrerzimmer eingerichtet werden. zifischen Fächer veraltet, kann sie unter Umständen
Freie Räume sollten für spezielle Nutzungsszenarien für die allgemeinbildenden Fächer trotzdem noch
gestaltet werden. Außerdem sollten mehr Lernflä- genutzt werden.
chen für Projektarbeiten und Selbstlernphasen Das Nutzungserlebnis für die Auszubildenden
vorgesehen werden. kann durch Apps im Verhältnis zu klassischen Web-
site-Interfaces deutlich gesteigert werden.
10Verwaltung und Digitale mediendidaktische Methoden,
Kommunikationsstrukturen digitalisieren Formate und Sozialformen nutzen, um den
Wissensmanagement durch Transfer auf reale Sachverhalte zu erleichtern
digitale Datenbanken anreichern Unmittelbares Feedback geben
Austausch zwischen Lehrenden ermöglichen Praxisnahe Ausbildung durch
Viel Raum und Zeit für Simulationen ermöglichen
Veränderungsprozesse einrichten Bereitschaft zur Qualifizierung und
Lernortkooperationen durch digitale Weiterbildung in den Bereichen
Informationsübermittlung erleichtern Bedienfähigkeit und digitale Technik zeigen
Schulleitung Lehrende
Medienverantwortliche
Verantwortlichkeiten für Digitalisierung transparent festhalten
Frei zugängliche Medienplätze anbieten
WLAN-Infrastruktur auch für Auszubildende einrichten
Neue Ausstattung auf die Kompatibilität mit der bisherigen Technik prüfen
11Ausbildende Unternehmen Die hier vorliegenden Handlungsempfehlungen stellen einen Auszug aus der seitens des Fraunhofer IMW veröffentlichten Broschüre Individuelle und organisationale Kompetenzen für eine digitale und vernetzte betriebliche Bildung – eine Handreichung für ausbildende Unternehmen (Preissler et al., 2021) dar. Die im Folgenden dargestellten Empfehlungen basieren auf den Ergebnissen von qualitativen Untersuchungen, die im Anschluss durch quantitative Erhebungen bestätigt wurden. 12
ORGANISATIONSENTWICKLUNG –
DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE,
IMPLEMENTIERUNG UND
LERNKULTUR
Digitalisierungsstrategie
Ein wesentlicher Ankerpunkt bei der digitalen Transforma- HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
tion einer Organisation sollte eine Digitalisierungsstrategie
sein, in der klare Ziele hinsichtlich der Digitalisierung im
Rahmen der beruflichen Ausbildung definiert werden. Diese Dem Veränderungsprozess zuträglich ist die proak-
Ziele variieren stark zwischen den Organisationen und hän- tive Entwicklung einer von allen Führungskräften
gen zudem vom digitalen Reifegrad der Unternehmen ab. und Mitarbeitenden getragenen Unternehmens-
Sie können (Ausbildungs-)Prozesse und (Ausbildungs-)Struk- kultur, die eine Innovationskultur befördert. Kultur-
turen, Produkte oder die Unternehmenskultur betreffen. Die wandel beginnt dabei in den Köpfen aller Mitarbei-
Digitalisierung der Ausbildungs- und Geschäftsprozesse ist tenden im Unternehmen. Eine Innovationskultur
eine wichtige Säule der Digitalisierung. Die Vereinfachung zeichnet sich unter anderem durch die Schaffung
und Automatisierung von Arbeitsprozessen durch Digitalisie- von Räumen für Interaktion und Kommunikation
rung haben das Potenzial Kosten zu reduzieren, die Aus- sowie durch das Reflektieren von traditionellen Hier-
bildungsqualität zu verbessern sowie die Zufriedenheit der archien und Rollen aus.
Mitarbeitenden zu steigern. Ein hohes Maß an Selbststeuerung, welches
Vor der Formulierung einer Digitalisierungsstrategie emp- sogenannte Innovatorinnen und Innovatoren sowie
fiehlt es sich daher, den digitalen Reifegrad und somit den „Early Adaptors“ als engagierte Vorreiter bzw. Vor-
Startpunkt der Transformation zu bestimmen. Das Change- reiterinnen wirken lässt, kann zudem helfen, die
management greift diese Strategie auf und unterstützt den Eigenverantwortung und Motivation aller Mit-
sich anschließenden, umfangreichen, organisationalen oder arbeitenden zu stärken.
unternehmerischen Veränderungsprozess. Dieser Verände- Die Einbindung digitaler Inhalte und Lernmedien
rungsprozess berührt Kultur, Strukturen und Strategien im sollte in der Ausbildung nicht lediglich auf operativer
Unternehmen und wird meist nicht schleichend, sondern in Ebene, sondern vor allem strategisch erfolgen.
einem zeitlich begrenzten Zeitrahmen durchgeführt.
13Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie Eine sich hier anschließende Möglichkeit der gezielten Plat-
für die Ausbildung zierung von Digitalisierungsthemen kann in der bewussten
Reformierung des betrieblichen Ausbildungsplanes liegen.
Die gestaltungsoffenen Formulierungen der Ausbildungsord-
nung können genutzt werden, um diese durch eigene, digi-
VERANTWORTLICHKEITEN REGELN tale Inhalte zu ergänzen, die für die Strategie des Unterneh-
Zunächst werden in einer ersten Akti- mens von Relevanz sind. Im betrieblichen Ausbildungsplan
vierungsphase Verantwortlichkeiten können demnach auf der Ebene der sachlichen Gliederung
bestimmt, was z. B. durch die Bildung einer Lernmethoden und digitale Formate, Medien sowie Themen
„Task-Force” realisiert werden kann, inner- und Inhalte platziert werden.
halb derer eine gemeinsame Vision sowie Leitfragen, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung
eine daran anknüpfende Mission sind (vgl. Funk/Weber, 2017):
der Organisation entwickelt wird. Welches Ziel möchten wir durch den Einsatz welcher
digitalen Technologie erreichen?
Woran erkennen wir, dass die Ziele erreicht wurden?
IST-ZUSTAND ANALYSIEREN Nach welchen Kriterien werden digitale Medien für das
Die dann stattfindende Analyse des Ist- Arbeiten und Lernen ausgewählt?
Zustandes erfasst den Status quo bezogen Wann wird was von wem eingesetzt?
auf den aktuellen Digitalisierungsgrad der
Organisation in ihren einzelnen, die Aus-
bildung betreffenden Ebenen.
Implementierungsprozess
POTENZIALE ERMITTELN
In der anschließenden Potenzialanalyse
können sodann Handlungsfelder identi- Die Entscheidung zu einer Adaption im Sinne der Einführung
fiziert und gezielt Innovationsimpulse einer neuen Technologie in der betrieblichen Ausbildung
gesetzt werden. (Welche Zukunftstrends wird im Rahmen eines Innovationsadaptionsprozesses
gibt es? Welche passen zu unserem Unter- getroffen. Mit der Implementierung dieser Technologie wird
nehmen? Wie können wir die Qualität der in diesem Zusammenhang der gesamte Prozess der Ein-
Ausbildung nachhaltig steigern?) führung in vorhandene Strukturen und Prozessabläufe des
ausbildenden Unternehmens in den Blick genommen.
Für einen erfolgreichen Implementierungsprozess müssen
DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE FESTHALTEN im allgemeinen fünf verschiedene Stufen bearbeitet werden
Beispielsweise können in Form einer Road- (vgl. Lehmann/Mandl, 2009):
map mit zeitlichen Markierungen künftige Vision und Initialisierung
Entwicklungsschritte festgehalten werden. Bildungsdiagnose – Analyse des Ist- und Soll-Zustands
Diese Roadmap der digitalen Transforma- Konzeption und Design
tionsstrategie berücksichtigt bestenfalls Realisierung
Technologien sowie Technologie-Kompe- Betriebliche Umsetzung.
tenz und einzelne Umsetzungsschritte
innerhalb der Handlungsfelder.
NÄCHSTE SCHRITTE KOMMUNIZIEREN
Transparenz wird schließlich über die Kom-
munikation der nächsten Schritte durch
die Verantwortlichen gewährleistet.
14Ein gelungener Implementierungsprozess digitaler Techno- Die Diffusion im Sinne einer kommunikativen Verbreitung
logien in der beruflichen Bildung setzt eine systematische von neuen Technologien ist stark vom Verhalten der Mit-
Vorbereitung vor der Einführung voraus, die nur den letzten arbeitenden und Führungskräfte abhängig und kann sich
Schritt eines umfangreichen Prozesses darstellt. Eine geteilte durchaus als ein Hindernis, als sogenannte Adaptionsbar-
Vision innerhalb der Organisation und strategische Über- riere, erweisen. Fehlendes Bewusstsein für die Vorteile der
legungen sind demnach essentiell. Die Erfahrungen der Technologie kann zu Adaptionswiderständen führen, mit der
Praxis zeigen, dass es im Rahmen der Adaption und Imple- Konsequenz, dass das Nutzenpotenzial der Innovation nicht
mentierung neuer digitaler Tools zielführend sein kann, zwar erkannt wird. Für die Förderung der Akzeptanz bei den Aus-
strategisch langfristig zu denken, jedoch operativ in kleinen bildungsbeteiligten ist es von Bedeutung, sowohl technisch/
Schritten vorzugehen: didaktisch als auch organisatorisch geeignete Maßnahmen
zu ergreifen.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Zunächst einzelne Prozesse zu digitalisieren und/ Es sollte regelmäßig erfasst werden, wie bedarfs-
oder durch Testings und Pilotierungen einzelne gerechte Unterstützungsmaßnahmen aussehen
Tools in abgegrenzten Unternehmenseinheiten und wo diese am wirksamsten sind. Zu Unterstüt-
zu erproben, kann hilfreich sein, um ressourcen- zungsmaßnahmen können Schulungen, Coachings,
sparend zu arbeiten und Mitarbeitende nicht zu externe Beratungsleistungen u. v. m. zählen. Wichtig
überfordern. ist, dass die einzelnen Akteure und Akteurinnen sich
Es kann zielführend sein, Neuheiten in den Rän- nicht allein gelassen fühlen, sondern bei Problemen
dern von Organisationen zu erproben, da in diesen unterstützende Strukturen vorfinden.
„Randbereichen“ im Sinne von einzelnen Abteilun- Bei der Einführung neuer Technologien oder neuer
gen mehr Freiheiten, aber auch mehr Kontakte zu (auch technischer) Infrastrukturen ist es zunächst
anderen Organisationen existieren als im stabilitäts- wichtig, die Akzeptanz aller Beteiligten zu erhalten.
erhaltenden Kern. Dafür sollten vor allem die Vorteile sichtbar gemacht
Im Sinne einer „Diffusion“ können sich diese Inno- werden. Jeder und jede Einzelne sollte erkennen
vationen und die Erkenntnisse, die mit deren Ein- können, welche Erleichterungen oder neuen Möglich-
führung einhergingen, im Unternehmen schrittweise keiten sich für die Organisation, aber auch für die
ausbreiten. einzelne Person ganz persönlich ergeben. So kann die
Mitwirkungsbereitschaft erhöht werden.
Für ein größtmögliches Commitment sollten Mitar-
beitende frühestmöglich in den Prozess einbezogen
werden. Transparenz kann über Wissensvermitt-
lung geschaffen werden, indem eine Aufklärung
über die Vorteile, die Komplexität, die Kompatibilität
sowie über Funktionsweisen erfolgt.
Es sollte geprüft werden, ob die einzuführende
Technologie kompatibel mit bisherigen Arbeits-
abläufen, Verhaltensweisen, Kompetenzen sowie
mit bisher eingesetzten Tools/Technologien und
vorhandenen technischen Standards ist. Ist die Kom-
patibilität nicht gewährleistet, müssen alle notwen-
digen Maßnahmen ergriffen werden, um eine gute
Basis für die Technologieeinführung zu schaffen.
15QUALIFIZIERUNG
DES AUSBILDUNGS-
PERSONALS
Die Erfahrungen der Praxis zeigen, wie wichtig es ist, die Aus- Durch Veränderungen der Arbeitswelt sind Unternehmen
wahl der Tools, Medien und Technologien an den Bedarfen der beruflichen Bildung angehalten, die Kompetenzen und
und Rahmenbedingungen des jeweiligen Ausbildungsberu- Qualifikationen ihrer Mitarbeitenden und der Ausbilden-
fes anzupassen. Hinsichtlich der Passung der Technologie den ständig den aktuellen Anforderungen anzupassen.
ergeben sich höchst individuelle Konstellationen je nach Organisationales und digitalisierungsbezogenes Wissen
Branche, Technologisierungsgrad, Mobilitätsgrad oder gewinnt zunehmend an Bedeutung für Innovations- und
Anforderungen. Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Neben den vier
So können Redundanzen der eingeführten Instrumente zur klassischen Kompetenzfeldern Fach-, Methoden-, Selbst- und
Folge haben, dass sich Funktionalitäten der einzelnen Tools Sozialkompetenz gewinnen neue, transversale Kompetenzen
überschneiden und Mitarbeitende eine Überforderung zunehmend an Bedeutung: Selbstorganisation, Flexibilität,
erleben. Bedeutsam ist, dass die digitalen Technologien, die kommunikative Fähigkeiten und Problemlösefähigkeiten.
als Lernunterstützung fungieren sollen und demnach als
didaktisches Werkzeug zu verstehen sind, in ein Lehrkonzept
eingebettet werden. Zwar können Bildungstechnologien oder
andere digitale Instrumente neue Möglichkeiten, beispiels-
weise eine individualisierte Förderung, bieten, jedoch erzeugt
ihr Einsatz nicht ohne Weiteres einen Mehrwert und erfor-
dern seitens der Nutzenden ein hohes Maß an Selbststeue-
rung. Eine ausgewogene Kombination neuer Technologien
und herkömmlicher Methoden ist daher empfehlenswert.
16HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
In kleineren Betrieben, in denen Strukturen für Wei- Zielführend kann es außerdem sein, zunächst im
terbildung fehlen bzw. wenig organisierte Planung Rahmen von Pilotprojekten neue Technologien in
hierfür stattfindet, können einzelne Mitarbeitende, einem kleinen Unternehmensbereich zu erproben
die an einer Fortbildung teilgenommen haben, als (unter Implementierungsprozess beschrieben) und
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen und/ entsprechend die Qualifizierungen in einem klei-
oder Lern-Promotoren und -Promotorinnen des nen Team durchzuführen. Erfahrung dieser ersten
erworbenen Wissens für ein Peer-to-Peer-Lernen Implementierung können dann in der Anpassung
eingesetzt werden. der Roadmap für die digitale Transformation
Erfolgreiche Organisationen sorgen u. a. durch und entsprechend in der strategischen Planung des
Ausbildung, betriebliche Weiterbildung sowie durch Kompetenzaufbaus münden. Schulungen, die im
in Arbeitsprozesse integriertes Lernen für einen Rahmen der Implementierung neuer Technologien
stetigen Lernprozess ihrer Mitarbeitenden. Insbe- durchgeführt werden, haben zudem den Vorteil des
sondere bei der Implementierung neuer Techno- in Arbeitsprozesse integrierten Lernens.
logien müssen neuartige Handlungsabläufe ein- Bei den geplanten Bildungsangeboten und Schu-
geübt werden. Insbesondere große Unternehmen lungen sollte auf eine Zielgruppenorientierung
präferieren die praxisorientierte Vermittlung von geachtet werden (z. B. nach Nutzungstypen oder
Wissen und einen in Arbeitsprozesse integrierten Altersgruppen). Mitarbeitende sollen dabei best-
Kompetenzaufbau. möglich in ihrer jeweiligen Lebenswelt „abgeholt“
Ein erfolgreicher Kompetenzaufbau im Rahmen und begleitet werden, damit der Kompetenzerwerb
der digitalen Transformation setzt eine konkrete und das Lernen nachhaltig funktionieren können.
Planung und Strategie voraus. Die Digitalisierungs- Die Ansprüche und Anwendungsszenarien gerade
strategie im Sinne einer Transformationsstrategie für den Erwerb digitaler Kompetenzen können
sollte dabei konkret erfassen, welche Kompetenzen äußerst heterogen sein, daher sind individuali-
notwendig sind (sowie dafür notwendige Ressour- sierte und passgenaue Schulungen vonnöten, um
cen und Zeit), um diese zur Umsetzung zu bringen. das Potenzial der getätigten Bildungsinvestitionen
Denn aus dem Einsatz neuer Technologien im Rah- bestmöglich zu nutzen.
men der Ausbildung folgen neue Anforderungen an Zudem kann es sinnvoll sein, für die Mitarbeitenden
Kompetenzen. (respektive in die Ausbildung involvierte Personen)
fest etablierte zeitliche Strukturen zu schaffen.
Die Erfahrungen aus der Bildungspraxis zeigen, wel-
chen Mehrwehrt die Einführung einer „digitalen
Stunde“ bietet, in der Peer-to-Peer-Schulungen zu
bestimmten Themen stattfinden oder die als Selbst-
lernphase intensiv genutzt werden kann.
17DIGITALE LEHR- UND LERNPROZESSE
Die Digitalisierung von Lehr- und Lernprozessen ist elemen-
tar für eine zeitgemäße Ausbildung, welche sich im digitalen Das Engagement der Auszubildenden sollte darüber
Wandel befindet. Denn Arbeit 4.0, Ausbildung 4.0 und Ler- hinaus durch eine integrierte Feedback-Kultur
nen 4.0 sind nicht getrennt voneinander zu denken. gestärkt werden. Die internen Rückmeldungen
können zusätzlich die Ausbildungsqualität steigern.
Diese besser ausgebildeten und motivierten Mitar-
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN beitenden sind für den Betrieb sehr wertvoll, daher
sollten durch digitale Tools Anreize geschaffen
werden.
Um die Akzeptanz dieser Veränderungen, die mit Die Ausbildenden sind ein wichtiger Faktor einer
dem digitalen Wandel einhergehen, zu fördern und positiven Lehr-/Lernatmosphäre. Daher sollte nicht
die Digitalisierung inklusiver zu gestalten, sollte primär eine reine und instruierte Wissensvermitt-
zunächst eine positive Lernkultur im Unterneh- lung verfolgt werden. Vielmehr sollten sie zuneh-
men gefördert werden. Diese positive Lernkultur mend als Prozessbegleitende durch die Auszubil-
kann durch Fehlerakzeptanz, Zusammenhalt, eine denden wahrgenommen werden.
positive Feedbackkultur und Wertschätzung begüns- Der Übergang zwischen einem „Lehrenden“ und
tigt werden. Die individuelle Unterstützung von einer agilen Lernbegleiterin bzw. einem agilem
Auszubildenden durch digitale Lösungen ist darüber Lernbegleiter sollte vom Unternehmen und zudem
hinaus förderlich für die Gestaltung einer positiven durch digitale Lösungen unterstützt werden. Durch
Lernatmosphäre. diese Lehrmethode können sich Auszubildende
Bei einer offenen, positiven Lernkultur, welche die besser integriert fühlen und eine bessere Unterstüt-
Selbststeuerung der Auszubildenden fördert, steigt zung erfahren, welche besonders für die jüngeren
die Wahrscheinlichkeit, dass sich die angehenden Auszubildenden eine große Stütze sein kann.
Fachkräfte aus Eigeninitiative mehr einbringen. Bei mehreren Ausbildenden in einem Betrieb sollte
Diese Impulse der Auszubildenden sollten einbe- dieses Kollektiv genutzt werden, um Lösungen,
zogen werden, um sie am Fortschritt zu beteiligen Methoden und Tools gemeinsam zu entwickeln
und die Digitalisierung der Prozesse individuell pas- und zu nutzen. Der Zusammenschluss der Aus-
send auf die Ausbildung zuzuschneiden. Denn die bildenden sollte das Lehren effektiver und ressour-
neu etablierten Lerninhalte, Methoden und Formate censparender machen, indem zeitliche Ressourcen
können die Motivation bei den Auszubildenden in die partizipative Entwicklung von Methoden und
fördern, was wiederum zu einer erhöhten Lernbe- Lösungen investiert werden. Gleichzeitig kann dies
reitschaft und damit qualitativ besseren Ausbildung im Sinne eines „Peer-to-Peer-Lernens“ zum Kompe-
führt. tenzzuwachs beitragen.
18Blended-Learning-Ansätze sollten genutzt werden, Die digitale Qualifizierung der Auszubildenden ist
um E-Learning-Lösungen mit vorhanden Präsenz- relevant, um Digitalisierung erfolgreich und lang-
Lernmethoden zu verbinden. Die digitalen Lern- fristig im Unternehmen zu verankern und zukünftige
methoden ermöglichen mehr Flexibilität für Ausbil- digital affine Mitarbeitende auszubilden. Durch die
dende und Auszubildende. Förderung der digitalen Grundkompetenzen sind
Die E-Learning-Lösungen können außerdem große die angehenden Fachkräfte gleichzeitig für digitale
Abwechslung in der Wissensvermittlung bieten. Ins- Trends der Zukunft gerüstet.
besondere video-gestütztes Lernen ist eine beson- Zudem können spezifisch angelegte Qualifizie-
ders auszubildendenzentrierte Methode der Wis- rungsmaßnahmen auch im Sinne von Zusatzquali-
sensvermittlung und wird meist gut angenommen. fikationen als ein mögliches Flexibilisierungs-
Hierbei können Auszubildende auch von externem instrument eingesetzt werden, um die Qualität der
Wissen und Experten und Expertinnen profitieren. Ausbildung zu steigern und das Ausbildungsunter-
Eine der individualisiertesten E-Learning Lösungen nehmen zusätzlich für angehende Auszubildende
für eine zukunftsfähige Trainingskultur ist das Ler- attraktiver zu machen. So kann es zielführend sein,
nen am „Digital Twin“. Hierbei werden Aufgaben branchenbezogene Schulungen für Auszubildende
oder komplette Betriebsabläufe digital simuliert, anzubieten, um ihnen neben der Berufsausbildung
die von den Auszubildenden bearbeitet werden eine zusätzliche Profilierung zu ermöglichen.
können. Dieses Lernen erlaubt es Auszubildenden,
selbstständiger Dinge auszuprobieren und Fehler
zu machen, ohne schwerwiegende Konsequenzen
befürchten zu müssen. Durch diese digitale „Hands-
on Methode“ können Auszubildende sich Eigenstän-
digkeit und die Fähigkeit, Probleme selbstständig zu
lösen, aneignen.
19NETZWERKE UND
DIGITALE LERNORTKOOPERATION
Ein zentrales Ziel im Hinblick auf die Kooperationen der an der beruflichen Bildung
beteiligten Lernorten sollte sein, die methodisch-didaktische Zusammenarbeit zu
intensivieren, indem in den Lernorten gemeinsame handlungs- und prozessorien-
tierte Lernprozesse initiiert werden. Hier werden konkrete Maßnahmen benötigt,
um die Lernortkooperation zu befördern und ihr Potenzial, theoretisches und
praktisches Lernen miteinander zu verbinden, zu erhöhen.
Die Digitalisierung kann auch hier als wichtiger Treiber fungieren, da sie zahlreiche
Gelegenheiten bietet, Akteure bzw. Akteurinnen und Lernorte digital zu vernetzen
und kooperative Lerngelegenheiten zu schaffen.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die zunehmende digitale Kollaboration in der Arbeitswelt innerhalb
einer Organisation, beispielsweise durch die Nutzung von Cloud-Anwen-
dungen, sollte demnach auch für die Lernortkooperation zunehmend eine
Selbstverständlichkeit werden. Digitale Kooperationen und Netzwerke
können die Wissensbildung über neue Technologien, den Austausch und
gegenseitige Unterstützung fördern.
Die Nutzung von digitalen Lösungen vermag dabei die Lernortkoopera-
tion mit unterschiedlichsten Partnerinnen und Partnern zu vereinfachen,
indem Distanzen überbrückt werden können. Hier können neben Online-
Berichtsheften wie beispielsweise BLok, welche Lernorte digital vernetzen,
auch andere Kommunikations- und Kollaborationstechnologien wie elek-
tronische Lerntagebücher, Blogs oder Wikis Anwendung finden. Weitere
Möglichkeiten sind digitalisierte Ausbildungspläne und digital gestützte
Kompetenzfeststellungen, die lernortübergreifend zum Einsatz kommen.
Erfolgreiche Lernortkooperationen ermöglicht den Auszubildenden in
höherem Maße, die theoretischen und praktischen Lerninhalte zu ver-
knüpfen, beispielsweise durch gemeinsam durchgeführte, fächerüber-
greifende und handlungsorientierte Projekte. Eine digital gestützte
Netzwerkpflege trägt also zu einer „Lernortkooperation in den Köpfen“
der Auszubildenden bei, indem die Reflexion von Theorie und Praxis ange-
regt wird. Dies wiederum ist einer Qualitätssteigerung der Ausbildung
zuträglich.
20Die Interaktion der Kooperierenden sollte durch Überbetriebliche Ausbildungsangebote haben
feste Termine und Verbindlichkeiten gefördert eine besondere Funktion bei der Wissenserweite-
werden, sodass gemeinsam an Projekten oder auch rung in der Berufsausbildung. Als nunmehr dritter
Herausforderungen wie zu Fragen der Digitalisie- Lernort im Rahmen der „dualen Ausbildung“ können
rung gearbeitet werden kann. Überbetriebliche Ausbildungsstätten jene Lern-
Um Erfahrungen zu teilen oder Entwicklungstrends inhalte in praxisnahen Schulungen vermitteln, die
zu identifizieren, kann im Rahmen der Kooperation kleine und mittelständische Betriebe aufgrund ihrer
mit anderen Unternehmen beispielsweise ein Spezialisierung nicht oder nicht vollständig abde-
Austausch über eingesetzte digitale Instrumente cken können.
im Ausbildungsbetrieb oder andere Digitalisierungs- Zudem können die Überbetrieblichen Bildungsstät-
maßnahmen stattfinden. Zusätzlich können kleinere ten als Multiplikatoren fungieren; insbesondere, was
Unternehmen ihre Auszubildenden zu externen fachspezifische digitale Kompetenzen durch den
Experten und Expertinnen in andere Betriebe ent- Einsatz neuer Technologien sowie digitaler Lernar-
senden, wenn sie aufgrund ihrer Betriebsgröße rangements anbelangt. Idealerweise findet ein Tech-
und Spezialisierung bestimmte Kompetenzen nicht nologietransfer von den Überbetrieblichen Bildungs-
abbilden können. stätten nach den Betrieben statt, indem Wissen über
Über diese Ausbildungsverbünde (Realisierung neueste Trends und Technologien vermittelt wird,
möglich als Kooperationsverbünde; Leit- und Part- welches anschließend durch die Auszubildenden in
nerbetrieb; Ausbildungsverein; Auftragsausbildung) die Betriebe gelangt.
können zudem Ausbildungsabschnitte oder auch Eine weitere Möglichkeit ein Ausbildungsnetzwerk
Verwaltungsaufgaben abgetreten bzw. aufgeteilt zu schaffen oder ein bestehendes zu bereichern ist
werden (Berufsbildungsgesetz (BBiG §10 Vertrag ). die Durchführung von kooperativen Projekten
Kammern und Innungen wirken hier unterstützend mit nationalen und internationalen Kooperations-
durch Beratung und können bei Fragen behilflich partnern. Zusätzlich können diese Projekte im
sein sowie mit entsprechenden Kontakten zur Seite eigenen Betrieb neue Impulse durch erfolgreiche
stehen. Praxisbeispiele aus anderen Ausbildungsbetrieben
schaffen. Die Integration neuester Entwicklungen in
die Berufsausbildung macht Ausbildungsbetriebe
darüber hinaus im Rahmen der Fachkräftesicherung
attraktiv für zukünftige Auszubildende.
21Digitaldienstleister der beruflichen Bildung Die in den folgenden Kapiteln dargestellten Empfehlungen basieren auf der Auswertung von neun leitfadengestützten Interviews mit elf Akteuren (drei Auszubildende, zwei Berufsschullehrende, drei Ausbildungsleitende, zwei Ausbildende und eine Schulleitung) und werden durch die Ergebnisse der im Rahmen des Verbundprojektes durchgeführten quantitativen Befragung des CODIP gestützt. 22
WEGWEISER
Hier dargestellt sind Einflussfaktoren von Digitaldienstleistern und deren Einfluss
auf andere Faktoren der Digitalisierung in der beruflichen Bildung. In den folgen-
den Kapiteln werden zu den einzelnen Bereichen zugehörige Handlungsemp-
fehlungen beschrieben. Mit Digitaldienstleistern sind insbesondere Anbieter von
Software aber auch andere Dienstleister gemeint, die technische Lösungen für die
berufliche Bildung bereitstellen.
Technische Ausstattung Umgang mit Daten Transparenz/Kontrolle
Zugänglichkeit Schnittstellen/Verknüpfung Digitales Feedback
Administration Motivation
... Qualifizierung/Weiterbildung
Akzeptanz &
Offenheit
Beratung/lnformation ...
Image/Attraktivität Kommunikation/Austausch Nutzerfreundlichkeit
Produkt Kooperation/Netzwerke Funktionalität
(-vielfaIt/-entscheidung)
Ästhetik
Nutzungsintensität/
Verbreitung
23AKZEPTANZ UND OFFENHEIT
Der Schlüsselpunkt für die erfolgreiche Digitalisierung der beruflichen Bildung
sind die Akzeptanz und Offenheit der einzelnen Agierenden. Der Faktor lässt sich
durch verschiedene Einflüsse stärken und unterstützen bzw. ermöglicht wiede-
rum andere Digitalisierungsprozesse. Digitaldienstleistende können nicht auf
alle notwendigen Faktoren zur Stärkung der Akzeptanz und Offenheit Einfluss
nehmen, aber einen großen Teil dazu beitragen. Auch äußere Einflüsse wie die
Covid-19-Pandemie können Veränderungen des Faktors hervorrufen. Es wurde
beobachtet, dass die Pandemie neben dem technisch-materiellen Aufschwung
auch für ein bleibendes digitales Umdenken und eine höhere Akzeptanzschwelle
sowie Offenheit gesorgt hat. Die folgenden Handlungsempfehlungen zielen darauf
ab, die individuellen Akzeptanz- und Kompetenzniveaus durch Beratung und Schu-
lung weiter zu erhöhen.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Da insbesondere in kleineren Organisationen oft die Zeit zum aktiven Aus-
probieren vieler verschiedener Tools fehlt, sollten Digitaldienstleistende
Schulungs- und Beratungsleistungen über digitale Hilfsmittel anbieten,
hierbei zunächst den Bedarf verdeutlichen und dann ggf. eigene Produkte
aktiv bewerben bzw. über diese informieren.
Das Angebot von Schulungen und Workshops zur Stärkung von digitalen
Kompetenzen ist ebenfalls empfehlenswert, um den persönlichen Nutzen
für die Akteure und Akteurinnen hervorzuheben und ihre generelle Akzep-
tanz zu erhöhen. Hierbei sollte ein Bezug zu bereits bekannten digitalen
Systemen hergestellt werden, um den Einstieg zu erleichtern.
Lehrenden wird i. d. R. weniger Medienkompetenz und digitale Akzeptanz
zugeschrieben, da sie sich in ihrer Arbeitszeit häufig wegen Zeitmangels
nur begrenzt mit neuen Technologien auseinandersetzen können. Des-
halb sollten diese verstärkt über insbesondere zeitliche und organisatori-
sche Vorteile digitaler Hilfsmittel aufgeklärt und geschult werden.
Interne Schulungen sollten durch die Bereitstellung von Infomaterial
unterstützt werden. Beliebte Formate sind hierbei PowerPoint-Präsenta-
tionen und Video-Tutorials.
24PRODUKTVIELFALT UND
VERBREITUNG
Lernortübergreifende Systeme profitieren von einer höhe- HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
ren Verbreitung, da die Akzeptanz und der Austausch durch
diese gestärkt werden. Bei vielen Akteuren und Akteurinnen
der beruflichen Bildung besteht jedoch mittlerweile eine Damit sich Digitaldienstleistende bei der Vielzahl von
Überforderung durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten behaupten können, sollte ihr Produkt ein
Systemen. Dies bezieht sich sowohl auf die Vielzahl an Ange- Alleinstellungsmerkmal aufweisen und dieses als
boten bei der Entscheidung für ein Produkt als auch auf die Marktvorteil klar kommuniziert werden.
Vielzahl der vorhandenen Systeme mit teils überschneiden- Um die Akzeptanz, Sichtbarkeit und Verbreitung
den Funktionsweisen. zu erhöhen, sollten Digitaldienstleistende im Kontext
der beruflichen Bildung insbesondere versuchen mit
bildungspolitischen Organen wie Kammern zusam-
menzuarbeiten. Hierbei können diese ggf. an der
Entwicklung beteiligt werden oder die Zielgruppen
über die digitalen Produkte informieren bzw. diese
bewerben.
Imagebildende Maßnahmen wie die Kooperation
mit bildungspolitischen Organen, dem Angebot von
Schulungen, einem zeitgemäßen visuellen Erschei-
nungsbild und Onlineauftritt (u. a. Website und
Social Media) sind sehr empfehlenswert, da diese
das Vertrauen in ein Produkt erhöhen, womit die
Akzeptanz steigt.
Zudem sollten Digitaldienstleistende engagierte
Einzelakteure und -akteurinnen identifizieren,
unterstützen und ihnen Material zur Überzeugung
anderer Agierender an die Hand geben sowie Mög-
lichkeiten der Kooperation anbieten, da diese den
Einsatz digitaler Tools oft anstoßen und verbreiten.
25NUTZERFREUNDLICHKEIT,
FUNKTIONALITÄT UND ÄSTHETIK
Generelle Softwareanforderungen
Da die meisten Agierenden der beruflichen Bildung zu wenig Zeit haben, sich mit
neuen technologischen Lösungen auseinanderzusetzen, sind Übersichtlichkeit
sowie eine intuitive Bedienung und Funktionalität oft Grundvoraussetzung für die
zukünftige Nutzung eines Produkts. Ein modernes, freundliches und minimalis-
tisches Design mit Anpassungsmöglichkeiten wird als erstrebenswert befunden.
Im Gegensatz zur Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit spielt Ästhetik bei
Produktentscheidungen im beruflichen Bildungskontext eher eine untergeord-
nete Rolle. Wichtig für die Ästhetik einer Anwendung bleibt dennoch, die anfangs
genannten Grundsätze nicht negativ zu beeinflussen. Es ergeben sich folgende
Maßnahmen:
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Um sicherzustellen, dass eine Softwarelösung von allen Zielgruppen als
benutzerfreundlich und funktionstüchtig wahrgenommen wird, ist es
entscheidend, nutzerzentriert zu arbeiten und Vertreterinnen und Ver-
treter von allen Zielgruppen durchgängig an der Entwicklung zu beteiligen
(User-Centered Design). Hierbei ist es förderlich, die Anforderungen
jedes Akteurs und jeder Akteurin durch eine Analyse von bisher verwen-
deten Werkzeugen und Arbeitsabläufen zu verstehen, um gesammelte
Vorerfahrungen anzusprechen. Darauf basierend können neue Lösungen
entwickelt, iterativ überprüft und verbessert werden.
Ästhetische Innovationen sind i. d. R. nicht notwendig. Bei der Gestaltung
kann demnach pragmatisch vorgegangen und State-of-the-art-Lösungen
zum Vergleich genutzt werden.
26Vorerfahrungen und
Hilfestellungen
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Um die technologische Akzeptanz zu begünstigen ist Nutzende sollten schnellen Zugriff auf verschie-
es hilfreich, die benötigte Einarbeitungszeit durch dene Hilfestellungen haben, damit sie sich voll-
die Nutzung von Vorerfahrungen zu minimieren umfänglich informieren bzw. Probleme einfach und
und das digitale Hilfsmittel möglichst intuitiv nutzbar selbstständig lösen können. Hierbei sollten verschie-
zu machen. dene Arten und Detailgrade der Informationsauf-
Wenn sich Software auch an Akteure und Akteurin- bereitung angeboten werden (z. B. Video-Tutorials,
nen aus technisch wenig versierten Fachbereichen Schnellhilfeseiten für häufig gestellte Fragen und
richtet, muss von einer geringeren Medien- und ausführliche Wikis).
Bedienkompetenz sowie Akzeptanz ausgegangen
werden als bei technischeren Branchen. Deshalb
sollten hier mehr Überzeugungsarbeit zur Nut-
zung geleistet (z. B. durch differenzierte Werbung)
und Funktionsweisen stärker sichtbar gemacht
werden (siehe auch Abschnitt Funktionsweisen Funktionsweisen
sichtbar machen).
Etablierte bzw. von anderen Anwendungen sichtbar machen
bekannte Benutzungsabläufe sollten weitestgehend
implementiert werden, da ihr Fehlen das Benut-
zungserlebnis oft negativ beeinflusst. Hierzu zählen HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
z. B. Funktionen wie Copy & Paste, Drag & Drop
u. v. m.
Auszubildende verfügen i. d. R. über eine hohe Es ist entscheidend, Benutzern und Benutzerinnen
Bedienkompetenz im Bereich mobiler Apps und auch softwareseitig über Funktionen und deren
Unterhaltungsmedien. Entsprechend hoch sind die Vorteile aufzuklären. Erst wenn diese erkannt bzw.
Erwartungen an Bedienkomfort, was bei der Gestal- anerkannt wurden, können sie einen persönlichen
tung von (insbesondere mobilen) Applikationen Mehrwert bieten. Anwendende sollten insbeson-
berücksichtigt werden sollte. dere auch über Verbesserungen und Neuerungen
Auszubildende verfügen i. d. R. selten über Erfah- informiert werden, da diese ausschlaggebend für die
rungen mit Anwendungen zur elektronischen weitere Nutzung bzw. eine höhere Nutzungshäufig-
Datenverarbeitung und entsprechenden Unter- keit sein könnten. Umgesetzt werden kann dies u. a.
nehmensprozessen. Dementsprechend müssen über E-Mail-Benachrichtigungen und Hinweise
Nutzende softwareseitig in diese Prozesse und beim Start einer Anwendung.
Anwendungsabläufe eingeführt werden (siehe auch Um Nutzende nicht mit zu vielen Reizen bzw.
Abschnitt Funktionsweisen sichtbar machen). Erklärungen zu überladen, kann es hilfreich sein, sie
Software für Ausbildende und Lehrende sollte im Onboarding-Prozess explorativ an das System
von einer niedrigeren Bedienkompetenz ausgehen, heranzuführen. Hierbei gilt es, Funktionen je nach
wodurch Bedienelemente und -abläufe verstärkt Erfahrungsgrad freizuschalten und sie im Moment
erklärt werden müssen. der ersten Nutzung zu erklären.
27Übergreifende Funktion und
Navigation
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Wenn eine Anwendung für verschiedene End-
geräte bestimmt ist, sollte darauf geachtet werden,
dass sie auf diesen in gleicher Art und Weise
nutzbar ist, damit die Bedienung nicht neu erlernt
werden muss und flexibel gearbeitet werden kann.
Um zu verhindern, dass Informationen verloren
gehen bzw. deren Existenz vergessen wird, sollten
Nutzende innerhalb einer Anwendung mit mög-
lichst wenigen Schritten zum gewünschten Ziel
kommen. Hierzu ist es förderlich, bereits auf dem
Startbildschirm die wichtigsten Funktionen erreich-
bar zu machen.
Sollte die Anzahl der Funktionen zu hoch sein, um Indikatoren und
sie beim Start der Anwendung gänzlich anzuzeigen,
können verschachtelte Menüs genutzt werden. Benachrichtigungen
Dies lässt sich auch auf Unterseiten übertragen, um
die Anzahl von nötigen Schritten zu minimieren und
alle möglichen Funktionen aufzuzeigen. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Auf besonders relevante Informationen sollten Nut-
zende mit visuellen (ggf. auch auditiven) Indika-
toren hingewiesen werden. Diese Hinweise können
z. B. farblich hervorgehobene Felder mit Zahlen sein,
welche die Anzahl von neuen Benachrichtigungen
widerspiegeln. Auf mobilen Geräten, aber auch PCs,
kann man mit diesen Symbolindikatoren schon vor
dem aktiven Öffnen der Applikation auf neue Infor-
mationen hinweisen.
Pop-up bzw. Browser-Benachrichtigungen
haben den Vorteil, dass ohne Start der Applikation
prägnante Informationen auf dem Bildschirm der
Nutzenden angezeigt werden. Diese können Erinne-
rungen, Nachrichten, Neuerungen u. v. m. beinhal-
ten und neben der Informationsweitergabe auch die
Nutzungshäufigkeit steigern.
Wenn keine sofortige Reaktion angestrebt wird,
können Benachrichtigungen auch gebündelt und
als regelmäßige Updates (z. B. täglich) per Pop-up
oder E-Mail übermittelt werden.
28Sie können auch lesen