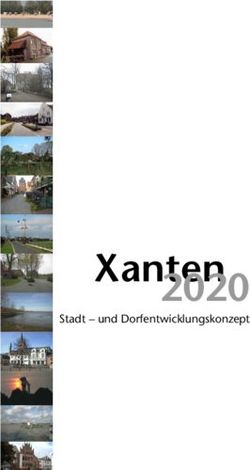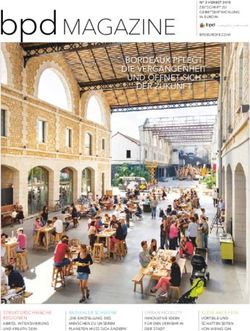Wohnen im Viererfeld fürs ganze Leben!
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wohnen
im
Viererfeld
▬
fürs
ganze Voraussetzungen einer sozial-
räumlichen Arealentwicklung für
alle Generationen
Leben! Bericht mit Empfehlungen und
Angeboten an die Stadt Bern und die
zukünftigen Bauträgerschaften
Ilja Fanghänel
Markus Leser
Anna Hostettler
Im Auftrag der
Interessengemeinschaft:
▬ Förderverein Generationen-
wohnen Bern-Solothurn
▬ Burgerspittel im Viererfeld
▬ CURAVIVA Schweiz
Bern, Februar 2019
1Impressum
AutorInnen:
Ilja Fanghänel Sozial-Raum-Planung Bern, ilja@fanghaenel.ch / www.fanghaenel.ch
Markus Leser Leiter Fachbereich Menschen im Alter CURAVIVA Schweiz (Kontakt siehe unten)
Anna Hostettler Praktikantin CURAVIVA Schweiz, B.Sc. Psychologie, anna.hostettler@students.unibe.ch
Mitarbeit Studierende:
Die Studierenden der Berner Fachhochschule - Soziale Arbeit arbeiteten bei den Erhebungen der sozialräumlichen
Quartieranalyse im Rahmen des Moduls «Sozialräumliche Quartier- und Stadtteilarbeit» mit.
Alina Brühlmann, Rahel Hänni, Nina Landolt, Tim Stauffer, Rahel Walser
Auftraggeber (Steuergruppe der IG):
Christoph Graf Präsident Förderverein Generationenwohnen Bern-Solothurn
christoph.graf@innovage.ch / www.generationenwohnen-beso.ch
Eduard Haeni Direktor Burgerspittel
eduard.haeni@burgerspittel.ch / www.burgerspittel.ch
Markus Leser Leiter Fachbereich Menschen im Alter CURAVIVA Schweiz
m.leser@curaviva.ch / www.curaviva.ch
Inhaltliche Verantwortung
Der Bericht gibt die Auffassung der AutorInnen wieder, die nicht notwendigerweise mit derjenigen der Auftraggeber oder
der ExpertInnen übereinstimmen muss. Die Angebote an die Stadt und die zukünftigen BauträgerInnen (jeweils am Ende
jeder Empfehlung in Kapitel 3) sind hierbei jedoch mit den Auftraggebern abgesprochen. Markus Leser ist sowohl Autor
wie auch Mitglied der Steuergruppe.
Zitiervorschlag:
Fanghänel, Ilja; Leser, Markus; Hostettler, Anna (2019). Wohnen im Viererfeld - fürs ganze Leben! Voraussetzungen einer
sozialräumlichen Arealentwicklung für alle Generationen. Bern.
2Inhaltsverzeichnis
Summary ......................................................................................................................................... 4
1. Ziele und Vorgehen .................................................................................................................. 6
1.1. Einleitung ........................................................................................................................ 6
1.2. Ziele und AdressatInnen .................................................................................................. 6
1.3. Vorgehen und Methode ................................................................................................... 7
1.4. Sozialräumlicher Ansatz .................................................................................................. 7
1.5. Begriffsklärungen ............................................................................................................. 8
2. Hintergründe und Entwicklungen .......................................................................................... 10
2.1. Generationenwohnen ..................................................................................................... 10
2.2. Der Stadtteil II Länggasse-Felsenau .............................................................................. 10
2.3. Die Arealentwicklung Viererfeld ..................................................................................... 13
2.4. Der Burgerspittel im Viererfeld ....................................................................................... 15
2.5. Das CURAVIVA Wohn- und Pflegemodell 2030 (WOPM) ............................................... 17
2.6. Folgeprojekte des WOPM 2030 ..................................................................................... 20
3. Empfehlungen und Angebote ................................................................................................ 22
Sozialräumliche Arealentwicklung ........................................................................................... 24
Enge Kooperation unter den Bauträgerschaften ...................................................................... 26
Aufbau von nachbarschaftlichen Netzwerken .......................................................................... 28
Eine Drehscheibe für alle(s) .................................................................................................... 30
Innovative und integrative Wohnformen ................................................................................... 32
Bezahlbare Wohnungen, Betreuung & Pflege .......................................................................... 34
Technologie- und Kommunikationskonzept .............................................................................. 36
Etappierung und laufende Evaluation ...................................................................................... 38
4. Bezug zum städtebaulichen Siegerprojekt «VIF_2» ............................................................. 40
5. ExpertInnen ............................................................................................................................ 44
6. Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................... 45
7. Literaturverzeichnis ............................................................................................................... 46
3Summary
Ausgangslage im Viererfeld Länggasse-Felsenau angestrebt. Der Projekttitel
Im Areal Viererfeld/Mittelfeld in Bern entstehen in «Wohnen im Viererfeld - fürs ganze Leben!» soll
den nächsten Jahren rund 1200 Wohnungen für verdeutlichen, dass dabei eine lebendige Nachbar-
ca. 3000 Personen. Bei der Arealentwicklung sind schaft für alle Generationen, Lebensphasen und
die Grundlagen für die Entstehung von qualitativ Lebensstile entwickelt werden soll.
gutem Wohn-, Arbeits- und Lebensraum für unter- Der Bericht richtet sich einerseits an die Stadt Bern
schiedlichste Personengruppen vorhanden. Die und andererseits an die zukünftigen BauträgerIn-
Stadt Bern erarbeitete mit der 2018 erschienen nen und BetreiberInnen im Viererfeld sowie an alle
Wohnstrategie eine sorgfältige und sozialpolitisch Interessierten einer nachhaltigen Stadtentwick-
beachtenswerte Basis für die Berner Stadtentwick- lung. Der IG, wie auch den AutorInnen, ist es dabei
lung und das kürzlich jurierte Siegerprojekt ein Anliegen zu betonen, dass sie die Arealent-
«VIF_2» von Amman Albers StadtWerke GmbH wicklung nicht in eine neue Richtung lenken wollen,
und Team ergänzt die städtische Strategie mit ei- sondern vielmehr Hand für eine Zusammenarbeit
nem überzeugenden städtebaulichen Projekt im at- mit Stadt, zukünftigen Bauträgerschaften und
traktiv gelegenen Viererfeld/Mittelfeld (nachfolgend QuartiersakteurInnen bieten wollen.
jeweils unter «Viererfeld» zusammengefasst). Entsprechend der frühen Planungsphase (bei Ab-
gabe des Berichts im Februar 2019 startet die Mas-
Die Interessengemeinschaft (IG) terplanphase für die Arealentwicklung) sind die
Unmittelbar an das Viererfeld angrenzend liegt das Empfehlungen wie auch die Angebote der IG für
Alters- und Pflegeheim «Burgerspittel im Vierer- eine Zusammenarbeit als Diskussionsgrundlage
feld» mit 70 altersgerechten Wohnungen mit einem auf einer relativ hohen Flughöhe gedacht und be-
breiten Betreuungs- und Dienstleistungsangebot dürfen der gemeinsamen Konkretisierung in späte-
sowie 125 Pflegeplätzen (26 davon für demente ren Phasen.
Menschen). Der Burgerspittel will seine Wohn-,
Pflege- und Dienstleistungsangebote für weitere Die acht Empfehlungen mit Angeboten
Personengruppen öffnen und in Kooperation mit Auf Basis von Recherchen, einer sozialräumlichen
anderen AkteurInnen im Viererfeld ergänzen. Quartieranalyse (unter Mitarbeit von Studierenden
Der Förderverein Generationenwohnen Bern-Solo- der BFH - Soziale Arbeit), ExpertInnen-Gesprä-
thurn unterstützt Entwicklungen für generationen- chen und Workshops wurden die Grundlagen für
übergreifendes Wohnen im Raum Bern und Solo- den Bericht im Dialog entwickelt. Die drei AutorIn-
thurn und CURAVIVA Schweiz ist die Entwicklerin nen formulieren auf dieser Basis acht Hauptemp-
des neuen Wohn- und Pflegemodells 2030 fehlungen (Kapitel 3), welche jeweils mit einer ta-
(WOPM), welches eine zentrale konzeptionelle bellarischen Übersicht zusammengefasst werden.
Grundlage für den vorliegenden Bericht darstellt. Die Tabellen geben dabei auch Auskunft darüber,
Das WOPM hat zum Ziel, den Sozial- und Wohn- welcher Betrachtungsperimeter (Stadtteil, Areal,
raum von Menschen aller Generationen - mit einem Parzellen-Cluster oder Parzelle) für die jeweilige
Schwerpunkt bei Menschen mit Pflege- und Be- Massnahme sinnvoll erscheint und wer den Lead
treuungsbedarf - bedarfsgerecht zu gestalten, so übernehmen könnte.
dass ein Verbleib im Sozialraum auch im (hohen) Ergänzt wird jede Hauptempfehlung mit konkreten
Alter möglich ist. Die drei Organisationen schlos- Angeboten der IG für eine Zusammenarbeit sowie
sen sich für die gemeinsame Umsetzung obiger einer Sammlung von Referenzen, Links und Litera-
Ziele im Viererfeld in einer Interessengemeinschaft tur zum weiteren «Stöbern» im Internet.
(IG) zusammen.
Empfehlung 1 betont die Wichtigkeit einer sozial-
Ziele des Berichts räumlichen Herangehensweise, also einer integra-
Die IG hat den vorliegenden Bericht in Auftrag ge- len, kooperativen und prozessorientierten Areal-
geben, um eine Grundlage für die modellhafte Um- entwicklung im Viererfeld. Dabei sollen auch die
setzung des Wohn- und Pflegemodells 2030 inkl. umliegenden Quartiere des Stadtteils II in die Ent-
Generationenwohnen zu schaffen. Hierbei wird wicklung miteinbezogen werden, so dass das Vie-
eine sozialräumliche, integrale und kooperative rerfeld eine sozialräumliche und städtebauliche
Arealentwicklung mit allen AkteurInnen und mit Verbindung zwischen der Länggasse im Süden
starker Verankerung im bestehenden Stadtteil II und der Engehalbinsel im Norden bilden kann.
4Dass für die Umsetzung des Wohn- und Pflegemo- Beim Thema Betreuung anknüpfend, wird in Emp-
dells 2030 eine enge Kooperation aller Bauträger- fehlung 7 die frühzeitige Erarbeitung eines Tech-
schaften Voraussetzung ist, wird in Empfehlung 2 nologiekonzeptes fürs Viererfeld vorgeschlagen.
ausgeführt. So werden Überlegungen zu verschie- So werden zwar unzählige Technologien für die
denen Formen der Zusammenarbeit gemacht und Unterstützung in Betreuung und Pflege entwickelt,
die Gründung einer Dachorganisation aller Bauträ- längst nicht alle stellen dabei aber den Menschen
gerInnen sowie von Untereinheiten (sog. Bauträ- ins Zentrum - zudem sind sie selten untereinander
ger-Cluster) vorgeschlagen. kompatibel. Ergänzt werden kann das Technolo-
giekonzept mit einem Kommunikationskonzept, in
In Empfehlung 3 werden verschiedene Anregun- welchem die Kommunikation der Bauträger, der
gen dazu gemacht, wie der Aufbau von nachbar- Bewohnenden und weiterer AkteurInnen aufeinan-
schaftlichen Netzwerken mit partizipativen Metho- der abgestimmt wird und neue (partizipative) Kom-
den und moderierten Prozessen, sowohl in der Pla- munikations-Tools erprobt werden können (Stich-
nung als auch später im Betrieb, gefördert werden wort Smart-City).
kann. Funktionierende soziale Netzwerke bilden
die Basis für soziale Integration in allen Lebens- Abgerundet werden die Empfehlungen mit Überle-
phasen, speziell auch im (hohen) Alter. gungen zum Entwicklungsprozess. So wird in
Empfehlung 8 eine laufende Dokumentation und
Für die Bewohnenden des Viererfelds soll eine Evaluation der Arealentwicklung vorgeschlagen.
Drehscheibe in der Nähe des Burgerspittels entwi- Ebenso werden Anregungen zu einer sinnvollen
ckelt werden, mit einer Pilotphase möglichst schon Bau-Etappierung aus Sicht des Wohn- und Pflege-
in der Zwischennutzung bzw. in der Planungs- modells gemacht. So könnten in einer ersten
phase (Empfehlung 4). Die Drehscheibe ist An- Etappe die Kernelemente des WOPM in räumlicher
laufstelle und «Reisebüro» für alle Arealbewoh- Nähe des Burgerspittels und in Zusammenarbeit
nenden (Informationen, Beratung, Triage, Raum- mit diesem aufgebaut werden. In weiteren Etappen
miete usw.) und wird im Idealfall in Kooperation von könnte die kompakte Siedlungsentwicklung von
bereits im Quartier aktiven soziokulturellen Träger- Süden nach Norden erfolgen und schlussendlich
schaften betrieben und von allen Bauträgerschaf- die Länggasse mit der Engehalbinsel städtebaulich
ten im Viererfeld mitfinanziert. verbinden.
Empfehlung 5 macht Aussagen zu einem Woh- Bezug zum städtebaulichen Siegerprojekt
nungsmix, welcher die Basis dafür bietet, dass Im vierten Kapitel werden schliesslich die acht
Menschen theoretisch alle Lebensphasen im Vier- Empfehlungen nochmals kurz anhand des städte-
erfeld verbringen können und eben «fürs ganze Le- baulichen Siegerprojekts «VIF_2» diskutiert und
ben» inkl. Pflegebedürftigkeit im Viererfeld und da- konkretisiert. So werden u.a. Vorschläge für die
mit im bekannten Sozialraum verbleiben können. räumliche Anordnung einer Drehscheibe, für mög-
Dabei ist eine Vielfalt von Wohnungstypen und ein liche Grössen von Parzellen- bzw. Bauträger-Clus-
Zusammenspiel der Bauträgerschaften inkl. Bur- tern oder eben für die oben erwähnte Etappierung
gerspittel zielführend, so dass ein breites Angebot gemacht.
von konventionellen Klein- und Familienwohnun-
gen über integrative Wohnformen bis hin zu inno- Fazit und Dank
vativen/experimentellen Wohnformen entstehen Die Arealentwicklung im Viererfeld bietet mit der
kann. eingangs erwähnten Ausgangslage somit ideale
Voraussetzungen dafür, das neue Wohn- und Pfle-
Neu bauen ist bekanntlich nicht günstig und auch gemodell 2030 von CURAVIVA Schweiz mit be-
Betreuung und Pflege ist zeit- und kostenintensiv. darfsgerechten Wohnformen für alle Generationen
In Empfehlung 6 werden deshalb Überlegungen in der Praxis zu erproben und kann dabei Antwor-
dazu gemacht, wie sich auch einkommensschwa- ten auf aktuelle gesellschaftliche Fragen liefern.
che Haushalte ein Leben und Älterwerden im Vier- Die Autorenschaft dankt allen GesprächspartnerIn-
erfeld leisten können. So braucht es beispielsweise nen für ihr engagiertes Mitdenken und freut sich auf
planerische Vorgaben für die Erstellung von be- eine spannende weitere Entwicklung im Viererfeld.
zahlbarem Wohnraum (Design to cost) oder neue
Finanzierungsmodelle bei der Betreuung von EL-
BezügerInnen, welche zurzeit nicht über die Ergän-
zungsleistungen finanziert werden.
51. Ziele und Vorgehen
1.1. Einleitung 1.2. Ziele und AdressatInnen
„Früher wurden Menschen in Gemeinschaf- Ziele
ten geboren und mussten ihre Individualität Der vorliegende Bericht hat zum Ziel, die Grundla-
finden. Heute werden Menschen als Indivi- gen für eine modellhafte Umsetzung des Wohn-
duen geboren und müssen ihre Gemein- und Pflegemodells 2030 von CURAVIVA Schweiz
schaft finden.“ inklusive generationenübergreifenden Wohnfor-
New Yorker Trend-Agentur K-Hole men im Viererfeld zu liefern. Hierbei wird eine sozi-
alräumliche, integrale und kooperative Arealent-
wicklung mit allen AkteurInnen, insbesondere auch
Soziale Kohäsion
mit dem Burgerspittel, und mit starker Verankerung
Vor dem Hintergrund zunehmender Individualisie-
im bestehenden Stadtteil II Länggasse-Felsenau
rung, der Pluralisierung der Lebensstile und der de-
angestrebt. So dass sich das neue Areal Viererfeld
mografischen Entwicklung entstanden in den letz-
zu einer lebendigen Nachbarschaft mit Wohn- und
ten Jahren Initiativen und Bewegungen in der
Freizeitangeboten für alle Generationen, Lebens-
Schweiz, wie auch in anderen Teilen der westli-
phasen und Lebensstilen entwickelt. Der Projektti-
chen Welt, welche die Stärkung der sozialen Kohä-
tel «Wohnen im Viererfeld - fürs ganze Leben!» soll
sion der Gesellschaft wieder stärker in den Vorder-
dieses Anliegen verdeutlichen.
grund rücken wollen. Dazu zählen auch die drei
Der Bericht legt Schwerpunkte bei der sozialen und
auftraggebenden Organisationen des vorliegenden
teilweise bei der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit -
Berichts, der Förderverein Generationenwohnen
die ökologische Nachhaltigkeit wird weitgehend
Bern-Solothurn, das Alters- und Pflegeheim Bur-
ausgeklammert, ist aber selbstverständlich gleich-
gerspittel im Viererfeld sowie CURAVIVA Schweiz,
wertig mitgedacht. Die Flughöhe ist entsprechend
Verband der Heime und Institutionen. Der Interes-
der frühen Entwicklungsphase noch relativ hoch -
sensgemeinschaft ist es ein Anliegen, dass sich in
viele der in Kapitel 3 gemachten Empfehlungen be-
bestehenden und neuen Siedlungen Nachbar-
dürfen somit der Konkretisierung in der Masterpla-
schaften herausbilden, bei welchen Inklusion und
nung und später bei der Realisierung.
ein solidarisches Zusammenleben aller Gesell-
schaftsschichten und Generationen, inkl. Men-
AdressatInnen
schen mit Betreuungs- und Pflegebedarf, bewusst
Die AdressatInnen des Berichts sind einerseits die
gelebt wird.
Stadt Bern (Politik und Planungsbehörden) und an-
dererseits die zukünftigen BauträgerInnen und Be-
Einmalige Chance im Viererfeld/Mittelfeld
treiberInnen im Viererfeld. Selbstverständlich rich-
Die Arealentwicklung im Viererfeld und Mittelfeld in
tet sich der Bericht auch an weitere Stakeholder
Bern (nachfolgend jeweils unter «Viererfeld» zu-
aus dem Stadtteil sowie an alle Interessierten einer
sammengefasst) bietet die einmalige Chance in
nachhaltigen Stadtentwicklung.
der Schweiz, ein solches nachbarschaftliches
Netzwerk bereits vor Bezug der neuen Überbau-
Angebote zur Zusammenarbeit
ung mit rund 1300 Wohnungen gezielt aufzubauen
Die Auftraggeber beabsichtigen, die Resultate des
und in ein Zusammenspiel mit dem bereits in direk-
Berichts im Frühling 2019 in die Masterplanung
ter Nachbarschaft ansässigen Burgerspittel sowie
Viererfeld einzuspeisen. Im Hinblick auf die Areal-
anderen Quartierorganisationen zu bringen. Diese
strategie Viererfeld (Stadt Bern 2017) sowie die
Ausgangslage veranlasste die Interessengemein-
kürzlich erschienene Wohnstrategie des Gemein-
schaft, den vorliegenden Bericht an Ilja Fanghänel,
derates (Stadt Bern 2018) decken sich viele der in
Sozial-Raum-Planer und Co-Projektleiter Genos-
diesem Bericht vorgeschlagenen Empfehlungen
senschaft Warmbächli und Hauptstadt-Genossen-
erfreulicherweise mit den Strategien der Stadt
schaft, Markus Leser, Leiter Fachbereich Alter bei
Bern. Der Bericht hat also nicht zum Ziel, die Ent-
CURAVIVA Schweiz und Mitglied der Steuer-
wicklung in eine neue Richtung zu lenken, vielmehr
gruppe der IG sowie Anna Hostettler, Praktikantin
wollen die auftraggebenden Organisationen Hand
bei CURAVIVA Schweiz, in Auftrag zu geben.
bieten für eine gemeinsame Entwicklung im Vierer-
feld. Die genaue Ausgestaltung einer allfälligen Zu-
sammenarbeit (konkrete Angebote siehe jeweils
6am Ende jeder Empfehlung in Kapitel 3) ist dabei integrierenden und zusammenführenden Charak-
zwischen der Interessengemeinschaft auf der ei- ter hatte. Das St. Galler Modell zur Gestaltung des
nen und der Stadt und ggf. den zukünftigen Bau- Sozialraumes (Reutlinger und Wigger 2010) betont
trägerInnen auf der andere Seite im Detail inkl. Fi- drei Praktiken der Raumbildung, die zwingend zu-
nanzierung auszuhandeln. Parallele Prozesse sol- sammengehören:
len dabei um jeden Preis verhindert werden. - die professionelle Gestaltung der Steue-
rung und der Organisation
1.3. Vorgehen und Methode - die professionelle Gestaltung der Arbeit
mit Menschen
Desk-Recherchen - die professionelle Gestaltung der phy-
Nebst Recherchen zu Referenzprojekten erfolgten sisch-materiellen Welt
Literaturstudium und Analysen zum Wohn- und
Pflegemodell 2030, zum Generationenwohnen und
zu sozialräumlicher Quartierentwicklung durch das
Autorenteam, wobei die Autoren bereits früher zu
oben genannten Themen arbeiteten und publizier-
ten bzw. das Wohn- und Pflegemodell selbst mit-
entwickelt haben (Markus Leser).
Sozialräumliche Quartieranalyse
Mit der Analyse von statistischen Daten, Begehun-
gen sowie Gesprächen mit VertreterInnen von
Quartierinstitutionen und Mitarbeitenden der Stadt-
verwaltung wurde eine sozialräumliche Quartier- Abbildung 1: Sozialraum nach Reutlinger&Wigger (2010)
analyse sowie eine Stakeholder-Landkarte erstellt
(siehe Kap. 2.2 sowie Abbildung 3). Es geht also darum, die Organisation des Raumes
mit den menschlichen Bedürfnissen und den Anfor-
ExpertInnen-Interviews und Workshops derungen der damit zusammenhängenden Infra-
In zwei Workshops sowie in Interviews mit Einzel- struktur in einen Einklang zu bringen. Eine sozial-
personen oder kleinen Gruppen konnte zudem die räumliche Denkweise berücksichtigt immer alle
Sicht von Fachpersonen, QuartiervertreterInnen drei Ebenen. Wer einfach nur Gebäude nach städ-
und Verwaltungsmitarbeitenden eingeholt sowie tebaulichen Vorgaben baut, denkt nicht in sozial-
Zwischenerkenntnisse gespiegelt werden (Über- räumlichen Mustern.
sicht ExpertInnen siehe Kap. 5).
Sozialraumverständnis CURAVIVA Schweiz
Interviews durch Studierende der BFH CURAVIVA Schweiz hat sein Verständnis von So-
Im Rahmen des Moduls «Sozialräumliche Quar- zialraumorientierung in einem fachübergreifenden
tier- und Stadtteilarbeit» konnten Studierende der Sinne definiert (siehe Link bei Empfehlung 1). Da-
Berner Fachhochschule - Soziale Arbeit fünf Be- bei sind drei Aspekte zentral:
wohnende des Burgerspittels, eine Pflegefachper-
son sowie zwei Fachpersonen im Bereich Alter aus Nachfrageorientierung anstatt Angebotsorientie-
dem Quartier befragen. Die Erkenntnisse sind rung: hierbei passen sich die Unterstützungsleis-
ebenfalls in den Bericht eingeflossen (siehe Kap. tungen den Bedürfnissen der Menschen an. Dies
2.2). im Gegensatz zur Vorstellung, die Menschen hät-
ten sich den bestehenden Angeboten anzupassen.
1.4. Sozialräumlicher Ansatz Dabei geht es aber immer auch darum, sämtliche
Angebote multifaktoriell auszugestalten, d.h. in
Sozialraum nach Reutlinger&Wigger Kombination von Begleitung, Betreuung und
Der Begriff des Sozialraums geht auf die 1970er Pflege.
Jahre (Lefebvre 1974) und in unserem Zusammen-
hang auf die 1990er Jahre zurück und wurde hier Es erfolgt immer eine konsequente Ausrichtung an
als Gegenstück zu separierenden Angeboten vor den individuellen Ressourcen der im Sozialraum
allem für Menschen mit unterschiedlichstem Hilfe- wohnenden Menschen. Ergänzt hierzu werden die
und Unterstützungsbedarf entworfen. Immer ging räumlichen sowie auch die personellen Ressour-
es darum, einen Ansatz zu entwickeln, der einen cen. Zwingend ist dabei, dass die professionelle
7Arbeit immer in einem interprofessionellen Ver- 1.5. Begriffsklärungen
ständnis erfolgt, das nicht ab - sondern eingrenzt.
Hinzu kommt die koordinierte Orchestrierung aller Die nachfolgenden Definitionen gelten nur für den
Akteure des Sozialraumes. Diese Grundhaltung vorliegenden Bericht. Die Begriffe mögen in ande-
bezieht alle dort lebenden und arbeitenden Men- ren Kontexten eine andere Bedeutung haben. So
schen mit ein, d.h. das professionelle System wie gibt es z.B. keine einheitliche Definition, was Woh-
auch das informelle (Angehörige, Nachbarschaf- nen mit Dienstleistungen oder Service-Wohnen ge-
ten, Freiwillige). nau beinhaltet. Damit keine begriffliche Verwirrung
im Viererfeld entsteht, werden nachstehend die
Sämtliche Institutionen und Organisationen, die Definitionen vom Burgerspittel übernommen. Als
sich im Sozialraum mit ihren Angeboten und Ergänzung finden sich jeweils die entsprechenden
Dienstleistungen bewegen, sind offen gestaltet und vier Kategorien D-A beim Betreuten Wohnen von
fördern die «Teilhabe» wie auch die «Teilgabe» CURAVIVA Schweiz (vgl. Tabelle 1 in Kap. 2.6):
aller Menschen am sozialen Leben des Sozialrau-
mes. Damit wird auch der Aspekt des «normalen» Wohnen mit Pflege
Alltaglebens gefördert. Gerade für ältere Men-
➔ Entspricht Kat. A von CURAVIVA
schen gilt, dass sie einen möglichst starken Bezug
Schweiz
zu ihrer Alltagsnormalität haben müssen. Alter ist
weder eine Krankheit noch ein Sonderfall, es ist Wohnen mit Pflege beinhaltet Pflege in einem 1-
eine normale Lebensphase. Bett-Zimmer (ebenso auf der Demenzstation),
Nachsorge nach Spitalaufenthalt, Rehabilitation
Caring community sowie Kurz- und Ferienangebote. Dieses Angebot
Auch in der Alterspolitik im Kanton Bern setzt man ist sowohl für SelbstzahlerInnen als auch für EL-
sich mit dem Konzept der "Caring Communities" BezügerInnen im Burgerspittel vorhanden (Finan-
(eine sich sorgende Gemeinde) auseinander, vgl. zierung der Pflegeleistungen über Krankenkasse,
Bericht zur Alterspolitik im Kanton Bern (Gesund- öffentliche Hand und BewohnerIn).
heits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
2016). Ihrem Bericht zufolge bedeutet der Begriff Wohnen mit Dienstleistungen / Betreutes Woh-
"Caring Community", dass man füreinander Ver- nen
antwortung übernimmt und ein gegenseitiges Ver- ➔ Entspricht Kat. B und C von CURAVIVA
trauen entwickelt. Das Umfeld muss so gestaltet Schweiz
werden, dass auch für Menschen, die sich in einem
Beim Wohnen mit Dienstleistungen (auch «Betreu-
fragileren und verletzlicheren Zustand befinden,
tes Wohnen») in 1 bis 3-Zi.-Wohnungen ist im mo-
die Möglichkeit besteht, ein gutes Leben zu führen.
natlichen Pensionspreis folgendes enthalten: 24h
Um dies zu ermöglichen, braucht es Teilhabe am
Präsenz von Pflegepersonal (innert wenigen Minu-
gesellschaftlichen Leben, (Infra-)Strukturen, wel-
ten vor Ort), Mittagessen, Reinigung sowie Veran-
che Mobilität trotz Einschränkungen erlauben und
staltungen. Im Burgerspittel ist dieses Angebot für
soziale Kontakte. Die «Teilhabe» am Leben wird
SelbstzahlerInnen vorhanden, ein entsprechendes
ergänzt durch die «Teilgabe», was bedeutet, dass
Angebot für EL-BezügerInnen wird aktuell durch
es auch Menschen jeglichen Alters in einer Ge-
die Stadt Bern im Rahmen der Wohnstrategie des
meinschaft gibt, die bereit sind ihre Ressourcen
Gemeinderats vom Oktober 2018 noch entwickelt
und Kompetenzen mit anderen zu teilen und sich
(benötigt neue Finanzierungsmodelle, vgl. hierzu
entsprechend einbringen (geben). Eine Teilhabe
Empfehlung 6).
ist ohne eine Teilgabe nicht möglich.
Thomas Klie beschreibt Caring community folgen-
Wohnen mit Services / Service-Wohnen
dermassen: "Community Care ist ein international
verwendeter Begriff aus der Gerontologie, der aus- ➔ Entspricht Kat. C (und ev. D) von
sagt, dass Care, die Sorge um andere Menschen, CURAVIVA Schweiz
in die Community, in die Gemeinschaft gehört.
Beim Wohnen mit Services oder Service-Wohnen
Care ist demnach die Aufgabe einer ganzen Ge-
in eher kleineren 1 bis 3-Zi-Wohnungen ist keine
meinschaft. Die Alterung der Bevölkerung und der
Betreuung oder Pflegebereitschaft enthalten. Die
steigende Anteil alter Menschen in der Gesell-
Pflegedienstleistungen werden nach Vereinbarung
schaft erfordert aus gerontologischer Sicht eine
durch die Spitex (entweder Inhouse oder externe
neue Kultur des Sich-Sorgens." (Gesundheits- und
Spitex) erbracht. Weitere Dienstleistungen wie
Fürsorgedirektion des Kantons Bern 2016, S. 13)
8Pflegebereitschaft, Essen, Reinigung, Wäsche Unterscheidung Stadtteil, Quartier, Areal
usw. können modular zugekauft werden. Dieses Nachfolgend wird zudem kurz der Unterschied zwi-
Angebot ist im Burgerspittel noch nicht vorhanden. schen Stadtteil, Quartier und Areal für diesen Be-
Bei einer Entwicklung im Viererfeld wäre die EL-Fi- richt definiert:
nanzierungstauglichkeit unbedingt zu entwickeln.
(Design to cost). Stadtteil
Die Stadt Bern ist in sechs Stadtteile unterteilt. Das
Generationenwohnen Areal Viererfeld befindet sich im Stadtteil II Läng-
Auch für den Begriff «Generationenwohnen» gibt gasse-Felsenau.
es keine einheitliche Definition, der Bericht stützt
sich auf die zwei untenstehenden und sich ergän- Quartier / Gebräuchliche Quartiere (GQU)
zenden Formulierungen. Der Förderverein Gene- Das Quartier ist keine trennscharfe Einheit. Im vor-
rationenwohnen Bern-Solothurn charakterisiert liegenden Bericht wird der Begriff als Bezeichnung
Generationenwohnen mit zehn Kriterien: für die umliegenden Siedlungen vom Areal Vierer-
feld verwendet. Die Stadt Bern hat zudem die
▬ gesteuerte altersmässige und soziale Durch-
Stadteile in sog. «Gebräuchliche Quartiere» (GQU)
mischung
unterteilt und gewisse statistische Daten sind ent-
▬ verbindliche, organisierte Nachbarschaftshilfe
sprechend aufgeschlüsselt, vgl. hierzu Monitoring
innerhalb und zwischen Generationen
Sozialräumliche Stadtentwicklung (Statistik Stadt
▬ Aufbau eines sozialen Netzwerkes
Bern 2018) sowie Kap. 2.2.
▬ Autonomie und Partizipation der Bewohnen-
den
Areal
▬ Wohnformen, die Begegnungen fördern aber
Mit dem Areal ist in diesem Bericht das Viererfeld
auch Rückzugsmöglichkeiten bieten
wie auch das Mittelfeld gemeint. In der Literatur
▬ Gemeinschaftsräume für unterschiedliche Be-
(z.B. in Dokumenten der Stadt Bern) wird sowohl
dürfnisse
der Begriff «Areal» wie auch der Begriff «Quartier»
▬ Hindernisfreie Ausgestaltung der Wohnungen
oder «Quartierteil» für die Entwicklung Viererfeld
und der Umgebung
verwendet. Nachfolgend wird für das zu entwi-
▬ Preisgünstige Wohnungen
ckelnde Gebiet Viererfeld/Mittelfeld immer der Be-
▬ Einbindung ins Quartier und guter Anschluss
griff Areal verwendet (in Abgrenzung zum umlie-
an öffentlichen Verkehr
genden Quartier; siehe oben). Der Übersichtlich-
▬ Vernetzung mit Unterstützungs- und Pflege-
keit zuliebe wird zudem nur vom Viererfeld gespro-
angeboten in der Nachbarschaft
chen, das Mittelfeld ist aber immer mitgemeint (so-
Und die Genossenschaft GenerationenWohnen fern nicht ausdrücklich anders erwähnt).
definiert den Begriff wie folgt:
«Zusammenleben mehrerer Generationen in ei-
nem Wohnmodell. Durch das gemeinsam gebil-
dete soziale Netz werden Mitbewohnende im
Haus, in der Siedlung oder im Quartier, unter Nut-
zung der vorhandenen Ressourcen, freiwillig unter-
stützt. Die informellen Hilfestellungen der Nachbar-
schaftshilfe können durch formelle, professionelle
Hilfsangebote ergänzt werden. Das Wohnprojekt
fördert durch die altersmässige Durchmischung
den Austausch zwischen den Generationen und er-
möglicht auch besondere Wohnformen.»
www.generationenwohnen.ch
92. Hintergründe und Entwicklungen
2.1. Generationenwohnen Wohnungen) zu realisieren. Mit rund dreissig ge-
meinnützigen BauträgerInnen aus Bern und Re-
Der Förderverein Generationenwohnen Bern- gion im Rücken, kann sie den zukünftigen Bewoh-
Solothurn nenden ein professionelles Gefäss für partizipati-
Der 2016 in Bern gegründete Förderverein setzt ves, gemeinschaftliches und generationenüber-
sich zum Ziel, gemeinschaftliche und generatio- greifendes Wohnen anbieten. Die Hauptstadt-Ge-
nenübergreifende Wohnprojekte im Raum Bern nossenschaft bündelt dabei die Kräfte des gemein-
und Solothurn zu fördern. Der Förderverein defi- nützigen Wohnungsbaus in Bern und bietet sich
niert «verbindliches Generationenwohnen» auf sei- somit als Partnerin für die Entwicklung des Vierer-
ner Homepage mit zehn Kriterien (vgl. auch Be- felds im Sinne des Wohn- und Pflegemodells 2030
griffsklärungen in Kap. 1.5). sowie des Generationenwohnens an.
Nebst Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit oder der
Erarbeitung von Grundlagen wie dem vorliegenden www.hauptstadt-genossenschaft.ch
Bericht, unterstützt der Förderverein Bauträger-
schaften beim Realisieren von generationenüber- Referenzprojekte ausserhalb von Bern
greifenden Projekten im Raum Bern-Solothurn, ei- Selbstverständlich wurde «Generationenwohnen»
nes davon ist die unten beschriebene Siedlung nicht (nur) in Bern erfunden. V.a. im Raum Zürich,
Holliger. aber auch in anderen Städten und vereinzelt in
ländlichen Gebieten, entwickelten sich in den letz-
www.generationenwohnen-beso.ch ten Jahren entsprechende Initiativen und Projekte,
mit welchen der Förderverein wie auch Berner Ge-
Die Siedlung Holliger (Areal Warmbächliweg) nossenschaften im Austausch stehen. Unten eine
Im Areal der ehemaligen Kehrichtverbrennungsan- Auswahl von Projekten aus Winterthur, Zürich und
lage am Warmbächliweg entsteht die neue Sied- Basel – letzteres noch in Planung. Hierbei «bran-
lung Holliger. Sechs gemeinnützige Bauträger aus den» sich nicht alle Projekte explizit als «Generati-
Bern haben sich zur Infrastrukturgenossenschaft onenwohnen», beinhalten aber viele der in Kap.
Holliger ISGH zusammengeschlossen und entwi- 1.5 genannten Kriterien des Fördervereins.
ckeln gemeinsam das Areal, welches etappiert zwi-
schen 2021-23 bezogen wird. Als erstes baut die www.giesserei-gesewo.ch
speziell hierfür gegründete Mitgliedergenossen- www.mehralswohnen.ch
schaft Warmbächli das alte Lagerhaus von Scho- www.kalkbreite.net
ggi Tobler um. Die Entwicklung im Holliger wird www.kraftwerk1.ch
über eine Projektdauer von drei Jahren von der www.zwicky-sued.ch
Age-Stiftung und vom Förderverein Generationen- https://lena.coop
wohnen unterstützt und von der Berner Fachhoch-
schule mit Fokus auf das Thema Generationen-
wohnen dokumentiert und evaluiert. Bereits jetzt 2.2. Der Stadtteil II Länggasse-
können erste wertvolle Erfahrungen aus dem Holli- Felsenau
ger für die Arealentwicklung Viererfeld mitgenom-
men werden. Sozialräumliche Erhebungen
Mithilfe von Begehungen, Studium von Literatur
www.holliger-bern.ch und Presseberichten, Analyse von statistischen
www.warmbaechli.ch Daten sowie einer grossen Anzahl Gesprächen
und Interviews mit Fachpersonen aus dem Quartier
Die Hauptstadt-Genossenschaft – eine neue ge- und der Stadtverwaltung, kann ein ganzheitliches
meinnütziger Trägerschaft fürs Viererfeld Bild vom bestehenden Quartier mit aktuellen
Im Sommer 2018 wurde die Hauptstadt-Genossen- Trends gezeichnet werden. Unterstützend waren
schaft auf Initiative des Regionalverbands Bern- auch die Recherchearbeiten von Studierenden der
Solothurn von Wohnbaugenossenschaften BFH - Soziale Arbeit (siehe 1.3). Bei ihrer Befra-
Schweiz mit dem Ziel gegründet, die erste gemein- gung von fünf Bewohnenden und einer Pflegefach-
nützige Etappe auf dem Viererfeld (ca. 150-200 person des Burgerspittels sowie von zwei Fachper-
10sonen im Bereich Alter im Quartier, konnten Berei- Verbindung Länggasse und Engehalbinsel
che aufgezeigt werden, bei welchen sich Synergien Geographisch betrachtet bildet die geplante Über-
zwischen bereits bestehenden Angeboten des Bur- bauung im Viererfeld die städtebauliche Verbin-
gerspittels und noch zu entwickelnden Dienstleis- dung im Stadtteil II vom Länggassquartier im Sü-
tungen und Wohnangeboten im neuen Areal aus den zu den Quartieren der Engehalbinsel im Nor-
Sicht der befragten Personen anbieten (Gesund- den. Hierbei ist anzumerken, dass die sog. «Ge-
heitsdienstleistungen à la carte, 24h Notfallknopf, bräuchlichen Quartiere» GQU der Engehalbinsel
Öffnung der Infrastruktur des Burgerspittels, Tan- Tiefenau (Nr. 201), Aaregg (Nr. 202), Rossfeld (Nr.
dems alt-jung, Quartierzentrum/Drehscheibe 203), Felsenau (Nr. 204), Hintere Engehalde (Nr.
usw.). An dieser Stelle sei auch auf die aktuellen 205) und Vordere Engehalde (Nr. 206) schon allein
und für diesen Bericht äusserst hilfreichen Doku- aufgrund der topographischen Höhenunter-
mente der Stadt Bern verwiesen: schiede, teilweise aber auch aufgrund der Bewoh-
▬ Stadt Bern (2017): Arealentwicklung Vierer- nerInnen-Zusammensetzung nicht als Einheit zu
feld/Mittelfeld. Areal- und Wohnstrategie. Ein verstehen sind (Einteilung in nummerierte «Ge-
lebendiges neues Stadtquartier bräuchliche Quartiere» gemäss Monitoring Sozial-
▬ Stadt Bern (2018): Wohnstrategie mit Mass- räumliche Stadtentwicklung der Stadt Bern, vgl.
nahmen. Wohnstadt der Vielfalt Abbildung 2).
▬ Statistik Stadt Bern (2018): Monitoring Sozial-
räumliche Stadtentwicklung 2017 Synthesekarte Gebräuchliche Quartiere GQU
▬ Immobilien Stadt Bern (Hg.) (2018): Arealent- Auf der Synthesekarte aus dem Monitoring Sozial-
wicklung Viererfeld/Mittelfeld. Partizipations- räumliche Stadtentwicklung (vgl. Abbildung 2) wer-
konzept. Walter Schenkel, synergo GmbH den verschiedene Variablen rangiert (Einkommen,
Anteil sesshafter Personen, Sozialhilfequote, Er-
Stakeholder-Landkarte gänzungsleistungsquote, mittlere Zimmerbelegung
Ein Resultat der Erhebungen ist die Stakeholder- pro Wohnung, ausländische Personen aus nicht-
Landkarte, auf welcher die zentralen Anspruchs- deutschsprachigen Nationen) und in fünf Quintile
gruppen bei der Entwicklung Viererfeld abgebildet eingeteilt, welche die fünf Synthesewerte (–2, –1,
sind (siehe Abbildung 3). Bei den zentralen Akteu- 0, 1, 2) darstellen. Ein negativer Synthesewert (rot
rInnen erfolgte zudem eine Analyse, welche An- eingefärbt) steht somit für eine höhere soziale Be-
sprüche sie geltend machen (könnten) und inwie- lastung des Quartiers und ein positiver Wert (grau
fern man sie in die weitere Entwicklung im Sinne eingefärbt) steht für ein sozial eher begünstigtes
dieses Berichtes einbinden könnte. Die Analyse GQU. Insgesamt zeigt sich somit ein soziokulturel-
wird aus Platzgründen nicht im Detail nachgezeich- les und sozioökonomisches Gefälle zwischen der
net, die Schlussfolgerungen daraus finden sich attraktiven und gut erschlossenen Länggasse
aber in den Empfehlungen in Kapitel 3 wieder. (grau/rosa eingefärbt) und der, auch in Bezug auf
Infrastruktur wie Läden, ÖV, Treffpunkten usw., et-
Die Arealentwicklung unter Beobachtung was abgehängten Engehalbinsel (v.a. grau einge-
In den Erhebungen zeigte sich, dass die Überbau- färbt). Hier kann die neue Überbauung Viererfeld
ung Viererfeld von verschiedensten Anspruchs- (Nr. 210, momentan noch weiss eingefärbt da
gruppen mit grossen Erwartungen verbunden ist. keine Bewohnende) auf verschiedenen Ebenen für
Für die Stadt ist es ein Prestigeprojekt, gemeinnüt- eine Verbindung und einen Ausgleich sorgen
zige wie auch gewinnorientierte BauträgerInnen in- (siehe Empfehlung 1, 3 und 4 sowie Bezug zum
teressieren sich als Investoren für ein Baufeld, Be- städtebaulichen Siegerprojekt in Kap. 4).
wohnerInnen aus verschiedenen Quartieren von
Bern sehen das Viererfeld als möglichen zukünfti-
gen Wohnort und die Öffentlichkeit und die Anwoh-
nenden verfolgen die Entwicklung mit grossem In-
teresse (und teilweise auch Skepsis).
Auch Quartierinstitutionen und das lokale Gewerbe
schauen gespannt auf die Entwicklung im Vierer-
feld und machen sich Gedanken dazu, welchen
Einfluss die Entwicklung auf ihre Organisation ha-
ben könnte.
11GQU Viererfeld (Nr. 210)
Abbildung 2: Synthesekarte nach gebräuchlichen Quartieren GQU (Statistik Stadt Bern 2018)
Abbildung 3: Stakeholder-Landkarte Viererfeld
122.3. Die Arealentwicklung Teams ihre Lösungsvorschläge aufeinander ab
Viererfeld und entwickeln diese in einer zweiten Phase mit
den zukünftigen Bauträgerschaften für die erste
Entwicklungsziele Bebauungsetappe weiter.
Auf der Homepage der Stadt Bern wird das neue
«Stadtquartier» im Viererfeld und Mittelfeld u.a. fol- Zwischennutzung, Bau und Bezug
gendermassen beschrieben: Im besten Fall kann 2023 mit den Bauarbeiten ge-
startet werden, womit eine erste Etappe ab 2025
«Menschen aus allen gesellschaftlichen
bezugsbereit wäre – das Siegerprojekt geht hier
Gruppen und in jeder Lebensphase sollen
von drei Etappen mit einer Gesamtentwicklungs-
im neuen Stadtquartier Viererfeld/Mittelfeld
zeit von mind. zehn Jahren aus. Ab Frühling 2019
ein Zuhause finden können.»
bis Baubeginn ist eine Zwischennutzung auf einem
Das Areal, attraktiv in der Nähe des Bahnhofs und Teil des zukünftigen Stadtteilparks geplant.
des Länggassquartiers gelegen, soll mit rund 1200 Die Stadt legt, ganz im Sinne des Legislaturmottos
neuen Wohnungen im Verlauf der nächsten zehn «Stadt der Beteiligung» sowie der Wohnstrategie
Jahre Platz für rund 3000 Menschen bieten. Rund des Gemeinderates (Stadt Bern 2018), bei der gan-
die Hälfte des Viererfelds und ein Drittel des Mittel- zen Entwicklung grossen Wert auf Partizipation
felds bleiben dabei unbebaut und werden als Stadt- und stellt dafür unterschiedliche Mitwirkungsge-
teilpark, als Familiengärten sowie als Spiel- und fässe zur Verfügung (vgl. auch Immobilien Stadt
Sportflächen einen öffentlich zugänglichen städti- Bern (Hg.) (2018): Arealentwicklung Viererfeld/Mit-
schen Freiraum bilden. telfeld. Partizipationskonzept. Walter Schenkel, sy-
Die Baufelder werden im Baurecht an InvestorIn- nergo GmbH).
nen abgegeben, davon mindestens 50% an ge-
meinnützige Wohnbauträgerschaften. Gemäss An- Webseite Arealentwicklung Viererfeld (Stadt Bern)
gaben auf der Homepage, will die Stadt auch selbst
im Viererfeld Wohnungen realisieren (ob als Betei-
ligte einer Wohnbaugenossenschaft oder in eige-
ner Regie, lässt sie hierbei noch offen).
Sechs Teilprojekte und städtebaulicher Wett-
bewerb
Die Entwicklung erfolgt in den sechs Teilprojekten
Areal und Wohnstrategie, Planung und Städtebau,
Freiraum und Grünraum, Verkehr und Umwelt, Inf-
rastruktur und Energie sowie Schul- und Sportan-
lagen. Auf Basis der partizipativ erarbeiteten
Wohn- und Arealstrategie Viererfeld/Mittelfeld
(Stadt Bern 2017) wurde Anfang 2018 der städte-
bauliche Wettbewerb lanciert, an welchem 26 inter-
disziplinäre Planungsteam teilnahmen. Ende 2018
wurde der Wettbewerb juriert und im Januar 2019
das erstprämierte Team «Städtebau» und «Stadt-
teilpark» (VIF_2 von Ammann Albers StadtWerke
GmbH, Zürich) sowie insgesamt sieben prämierte
Teams «Projektteil Wohnen» vorgestellt (Analyse
des städtebaulichen Siegerprojekts siehe Kapitel
4).
Masterplanung
Unmittelbar an den Wettbewerb anschliessend be-
gann Anfang 2019 die komplexe Masterplanungs-
phase, welche bis Ende 2019 abgeschlossen sein
soll. In der Masterplanung stimmen die rangierten
13Abbildung 4: Planungsperimeter Viererfeld (oben) und Mittelfeld (links) (Foto Stadt Bern)
142.4. Der Burgerspittel im Viererfeld rektor des Burgerspittels und Mitglied der Steuer-
gruppe der IG, sich auch mit VertreterInnen der
Die Burgergemeinde Bern betreibt mit dem Burger- Burgergemeinde und der Burgerspittel-Kommis-
spittel eine Altersinstitution mit zwei Standorten: Ei- sion austauschen. Hierbei wurde die Offenheit für
nen im Berner Generationenhaus am Bahnhofs- eine sozialräumliche und kooperative Arealent-
platz mit drei Hausgemeinschaften sowie einen di- wicklung in Zusammenarbeit mit dem Burgerspittel
rekt ans Viererfeld und Mittelfeld angrenzend mehrfach betont.
(siehe Abbildung 5). Wenn nachfolgend von «Bur-
gerspittel» gesprochen wird, ist immer der Standort www.burgerspittel.ch
im Viererfeld gemeint (sofern nicht ausdrücklich
anders erwähnt).
Im Burgerspittel stehen, nebst einem Restaurant
und vielfältigen Angeboten im Bereich Gesundheit
und Freizeit, 1½, 2½- oder 3½-Zimmer-Wohnun-
gen mit oder ohne Pflege oder Betreuung (Wohnen
mit Dienstleistungen) sowie eine Pflegeabteilun-
gen und eine Demenzabteilung zur Verfügung. Der
Burgerspittel verfügt heute über 70 altersgerechte
Wohnungen mit einem breiten Betreuungs- und
Dienstleistungsangebot. Die Pflegeleistungen wer-
den durch das betriebseigene Pflegepersonal er-
bracht, inkl. Inhouse-Spitexleistungen 365
Tage/24h. Ein vielfältiges Aktivitätenangebot steht
ebenfalls zur Verfügung. Zudem verfügt der Bur-
gerspittel über 125 Pflegeplätze (26 davon spezia-
lisiert für die Betreuung von dementen Menschen),
die teilweise (40% des Angebotes) auch für Bezü-
gerInnen von Ergänzungsleistungen verfügbar
sind. Das Burgerspittel ist offen für alle Personen,
nicht nur für BernburgerInnen.
Ganz im Sinne des Wohn- und Pflegemodells 2030
von CURAVIVA Schweiz will sich der Burgerspittel
in Zukunft sozialräumlich auf die neue Überbauung
Viererfeld ausrichten und dabei neue Kooperatio-
nen eingehen und ggf. auch selbst als Investor und
Betreiber auftreten (naheliegend wäre hierbei die
im städtebaulichen Siegerprojekt VIF_2 mit einem
Verbindungsgang ans Burgerspittel angedockte
sog. «Spitalerweiterung»). In Abbildung 6 ist die Vi-
sion des Burgerspittels, welche auch von den an-
deren IG Mitgliedern mitgetragen wird, als Grafik
abgebildet (hier noch auf Basis einer mittlerweile
veralteten städtebaulichen Testplanung). In der Vi-
sion wird deutlich, dass sich der Burgerspittel öff-
nen und weiterentwickeln will und hierbei auch be-
reit ist für neue Kooperationen in unterschiedlichen
Bereichen.
Beim Verfassen dieses Berichts konnten die Auto-
rInnen, nebst Gesprächen mit Eduard Haeni, Di-
15Abbildung 5: Viererfeld (oben), Mittelfeld (links), Burgerspittel (mitte) (Foto Stadt Bern)
Abbildung 6: Vision der IG (Burgerspittel, Förderverein Generationenwohnen, CURAVIVA Schweiz)
162.5. Das CURAVIVA Wohn- und dass wir die gesamten Lebensübergänge der Men-
Pflegemodell 2030 (WOPM) schen zu gestalten haben, was eine Separierung in
verschiedene Angebotskategorien wie ambulant
Wohnmodelle orientieren sich künftig immer am oder stationär ausschliesst. Beim WOPM 2030
«Normalitätsprinzip». Weder das Alter noch an- geht es immer um die beziehungsmässige und be-
dere Lebensphasen sind ein «Sonderfall», sondern darfsorientierte Angebotsgestaltung der unter-
zeit- und altersspezifische Phasen im Lebensver- schiedlichen Lebensphasen, in denen sich die Be-
lauf eines Menschen. Es macht wenig Sinn diese wohnerinnen und Bewohner eines Sozialraumes
Phasen zu trennen, sondern das Gegenteil sollte befinden (für die Version I des WOMP vgl. Abbil-
der Fall sein. Es geht immer darum die unter- dung 7).
schiedlichen Lebensphasen miteinander zu verbin-
den. Altersfreundlich heisst immer auch familien- Das WOPM 2030 – Version II
freundlich oder singlefreundlich und umgekehrt. Das WOPM 2030 hat sich in den letzten drei Jah-
Eine aktive Gestaltung dieses Wohn- und Sozial- ren weiterentwickelt und wird im Laufe des Jahres
raumes ist stets auch eine Prävention gegen die 2019 ein Update zur Version II erfahren. Inzwi-
Vereinsamung. schen sind auch die unter Kap. 2.6. beschriebenen
Folgeprojekte abgeschlossen. Ein Grossteil der
Da ein lebensphasenübergreifendes Wohnkonzept dazu erarbeiteten Basisdokumente stehen auf der
immer ganz unterschiedliche Altersgruppen an- Website von CURAVIVA Schweiz zur Verfügung.
sprechen muss, führen solche Nachbarschaften In der revidierten und ergänzten Version II (vgl. Ab-
automatisch und zwangsläufig zu generationen- bildung 8) gehen wir davon aus, dass der Sozial-
übergreifenden Nachbarschaften. In der heutigen raum immer moderiert werden muss, damit im
individualisierten und auf eigene Bedürfnisse fo- Sinne des unter Kap. 1.4 genannten St. Galler Mo-
kussierten Zeit, braucht es ein moderierendes Ge- dells des Sozialraumes die professionelle Gestal-
genstück, damit generationenübergreifende Wohn- tung und Steuerung bedarfsgerecht und zum
modelle funktionieren können. Der Hilfe- und Un- Wohle des im Zentrum stehenden Menschen erfol-
terstützungsbedarf hingegen ist individuell von der gen kann. Dies kann im Sinne eines Netzwerkes
jeweiligen Person abhängig und wird im Sinne der oder eines entsprechenden Dienstleistungszent-
in Kap. 1.4 skizzierten «caring community» be- rums (DLZ) geschehen.
darfsgerecht und adressatengerecht organisiert.
Dabei kommt das professionelle oder das infor- Die Erfahrungen aus dem Folgeprojekt «Gesund-
melle Hilfesystem zum Tragen, oder auch entspre- heitszentrum» zeigen, dass im Falle eines Dienst-
chende Mischformen. leistungszentrums dies idealerweise unter einer
einheitlichen Leitung erfolgt (vgl. auch Empfehlung
Das WOPM 2030 – Version I 4). Interprofessionelles Zusammenarbeiten benö-
Das Wohn- und Pflegemodell 2030 wurde 2016 der tigt ein entsprechendes Commitment von allen Mit-
Öffentlichkeit vorgestellt (CURAVIVA Schweiz arbeitenden und hierzu braucht es die Bereitschaft
2016). Es wurde auf dem ebenfalls in Kap. 1.4 kurz für eine Kultur der Zusammenarbeit. Diese Kultur
skizzierten Ansatz des Sozialraumes erarbeitet zu moderieren und herzustellen ist eine der wich-
und berücksichtigt auch die Kriterien einer «caring tigsten strategischen und operativen Führungsauf-
community». Der Grundgedanke geht davon aus, gaben. Das Dienstleistungszentrum geht weit über
dass wir bei der Gestaltung von Wohnangeboten den Bereich der Gesundheit hinaus und verbindet
für ältere Menschen nicht einfach nur grosse, spi- soziale (Beziehungen), gesundheitliche (ganzheit-
talähnliche Gebäude brauchen, sondern ein En- lich) und kulturelle (Freizeit) Aspekte. Das DLZ hat
semble von verschiedenen, individuellen Wohnin- die folgenden Aufgaben:
seln, die so angeordnet sind, dass sie auch die Be- - Entwickeln bedarfsgerechter Angebote im So-
ziehung unter den dort wohnenden Menschen ge- zialraum.
stalten können. Wohnraumgestaltung ist demnach - Kombinieren der Bereiche Gesundheit, Bezie-
immer auch Beziehungsgestaltung. hungsmoderation, Alltags- und Lebensgestal-
Auf einem Areal wie dem Viererfeld, bei welchem tung, Freizeit.
es um «das ganze Leben» der Menschen geht, be- - Orchestrierung der verschiedenen Gruppierun-
nötigt es deshalb zwingend eine flexible Gestaltung gen vor Ort: Personal, Freiwillige, Nachbar-
über die gesamte Lebensdauer der dort lebenden schaften, Angehörige. Hier geht es kurzum um
Menschen. Auch das WOPM 2030 geht davon aus,
17die Gestaltung der im St. Galler Modell er- Eine sozialräumliche Gestaltungsweise bringt im-
wähnten professionellen Gestaltung der Zu- mer die Menschen zusammen, die im Sozialraum
sammenarbeit unter Menschen. leben und/oder wirken: die NachbarInnen, die An-
gehörigen, die Freiwilligen und das Personal.
Die bereits erwähnte physisch-materielle Welt wird
ebenfalls vom Dienstleistungszentrum moderiert www.curaviva.ch/wopm
und gestaltet. Sie beinhaltet das Angebot an mög-
lichst vielen, flexiblen Wohninseln, welche ein le-
benslanges Verbleiben im Sozialraum des Vierer-
feldes ermöglichen. Dabei ist es selbstverständ-
lich, dass diese Wohninseln nicht nur eine be-
stimmte Lebensphase abdecken dürfen, sondern
alle umfassen müssen. Damit sind sie automatisch
auch generationenübergreifend. Im Sozialraum
muss es «normal» sein, dass dort unterschiedliche
Generationen miteinander leben. Lebensphasen-
übergreifend heisst immer auch generationenüber-
greifend. Damit dieses «Miteinander leben» nicht
zu einem nebeneinander wird, benötigt es die oben
erwähnte Moderation durch das Dienstleistungs-
zentrum. Generationenübergreifend hat stets auch
eine lebenslange Beziehungsgestaltung zur Folge.
Die revidierte Version des WOPM II geht immer
vom Bedarf der Menschen aus, die im Zentrum des
Modells stehen. Die Bedarfe beziehen sich dabei
auf die Bereiche Wohnen, Dienstleistungen,
Pflege/Betreuung und Alltagsgestaltung. Diese Be-
reiche müssen von den Leistungserbringern ge-
staltet und bedarfsgerecht aufbereitet werden. Da-
bei können die Leistungserbringer organisatorisch
als ein Zentrum (Dienstleistungszentrum), welches
alles aus einer Hand anbietet (all inclusive) oder als
Netzwerk ausgestaltet werden.
Eine sozialräumliche Gestaltung bedeutet aber
auch das aktive Gestalten von Nachbarschaften,
das schlussendlich zu einem Miteinander und nicht
zu einem Nebeneinander führt. Ein schönes Bei-
spiel hierfür ist das im Programm Socius lancierte
Projekt «Nachbarschaft Bern» der Stadt Bern (un-
terstützt von der Age-Stiftung). Seit Herbst 2016
wird im Stadtteil III Mattenhof-Weissenbühl ein Pi-
lotprojekt zur aktiven Gestaltung der Nachbar-
schaftshilfe durchgeführt. Entstanden ist ein Modell
der gegenseitigen Unterstützung, welches mit pro-
fessionellen Hilfsangeboten wie z.B. Spitex, Kirch-
gemeinden oder dem SRK kombiniert wird. Aus un-
serer Sicht ist es angezeigt die dort gemachten Er-
fahrungen sowie die Idee auf das Viererfeld zu
übertragen, was von Seiten Stadt Bern ja auch ge-
plant ist (siehe hierzu auch Empfehlung 3).
18Abbildung 7: Das CURAVIVA Wohn- und Pflegmodell 2030, Version 1
Abbildung 8: Das CURAVIVA Wohn- und Pflegmodell 2030, Version 2 (in Entwicklung)
192.6. Folgeprojekte des WOPM 2030 das Wohn- und Pflegemodell 2030 zu integrieren,
wird letztlich im Folgeprojekt ein Kommunikations-
A: Das Gesundheitszentrum (Modell und Busi- konzept vorgestellt, welches ermöglicht, Akteure
nessplan) und Dienstleistungen im Quartier einfacher zu ver-
binden. Das Ziel ist eine umfassende, personali-
Projektbeschrieb sierte und technikunterstützte Versorgung und Ein-
In diesem Folgeprojekt hat sich eine interdiszipli- bindung der BewohnerInnen im Quartier.
näre Arbeitsgruppe (bestehend aus GeriaterInnen,
Chef- und HeimärztInnen, ApothekerInnen, Heim- Kernaussage
und Spitalleitungen, Spitex Schweiz sowie Es lässt sich festhalten, dass die Gestaltung und
CURAVIVA Schweiz) mit der Thematik rund um die der Weg zur Realisierung der technologischen Zu-
interprofessionelle Zusammenarbeit im Gesund- kunft im Wohn- und Pflegemodell 2030 schrittweise
heitszentrum auseinandergesetzt (CURAVIVA erfolgen muss. Wichtig ist, dass die sich mit der
Schweiz 2017). Zur Visualisierung und zum Ver- Zeit verändernden Umgebungsbedingungen stets
ständnis wurde zum einen das "Modell Interprofes- berücksichtigt werden müssen. Als Grundlage für
sionelle Zusammenarbeit im Gesundheitszentrum" diesen Weg kann das Kommunikationskonzept
erarbeitet. Zum anderen wurde ein "Projekt- und dienen, welches zum einen relevante Akteure im
Businessplan" erstellt, welcher die Realisierung ei- Sinne des Wohn- und Pflegemodells 2030 vernetzt
nes Gesundheitszentrums greifbarer machen soll. und zum anderen den bedarfsorientierten Techno-
CURAVIVA Schweiz bietet dazu eine fachliche logieeinsatz ermöglicht. Folglich bildet das Tech-
Auslegeordnung und fasst die Resultate dieses nologiekonzept eine Basis für die Empfehlung 7
Folgeprojektes im Faktenblatt "Interprofessionelle «Technologie- und Kommunikationskonzept».
Zusammenarbeit im Gesundheitszentrum" zusam-
men. C: Kostenmodell
Kernaussage Projektbeschrieb
Im Wohn- und Pflegemodell 2030 von CURAVIVA Im Wohn- und Pflegemodell 2030 stellt der Pflege-
Schweiz wird aus der klassischen Pflegeinstitution bedarf der Kunden das zentrale Instrument für die
ein «Gesundheitszentrum». Dieses bietet älteren Zuteilung zu einer Pflegeform dar und nicht mehr
Menschen in ihrem angestammten Sozial- und Le- die Fehlanreize, welche durch die unterschiedliche
bensraum Dienstleistungen und Serviceangebote Finanzierung ambulanter und stationärer Langzeit-
aus einer Hand. Für die BewohnerInnen im Quar- versorgung zustande kommen. CURAVIVA
tier bedeutet dies, dass sie mit ihren individuellen Schweiz hat deshalb Polynomics AG beauftragt,
Bedürfnissen im Zentrum stehen und die Dienst- die Kostenwirkungen des Wohn- und Pflegemo-
leistungen aus der Sicht des Menschen für sie or- dells 2030 gegenüber der heutigen Versorgungs-
ganisiert werden. Aufbauend auf dem Folgeprojekt struktur zu untersuchen (Polynomics 2018).
des Gesundheitszentrums lässt sich die Empfeh-
lung 4 «Eine Drehscheibe für alle(s)» ableiten und Die Studie verfolgt dabei folgende drei Ziele:
ausformulieren. 1. Einordnung des WOMP in den nationalen und
internationalen Kontext
B: Technologiekonzept 2. Systematisierung der zentralen Elemente ei-
nes durchgehenden Pflegeprozesses
Projektbeschrieb 3. Berechnung der Kostenwirkungen des WOPM
Das Forschungszentrum Informatik FZI wurde von im Vergleich zur heutigen Versorgungsstruktur
CURAVIVA Schweiz beauftragt, ein Technologie-
konzept zu entwickeln, welches die im Wohn- und Kernaussage
Pflegemodell 2030 verankerte Wohn- und Versor- Die Ergebnisse der Studie bestätigen, dass mit
gungssituation technologisch vernetzen und erwei- dem Pflegemodell 2030 ein erhebliches Kostenein-
tern soll (FZI Forschungszentrum Informatik 2017). sparungspotenzial besteht. Fallen die Fehlanreize
Im Rahmen dieses Folgeprojektes wurde eine der heutigen Finanzierungsformen weg und wird
Übersicht zur verfügbaren Technologie und der Be- die Pflege vermehrt durch das betreute Wohnen
darf an diese aus der Sicht der Branche erarbeitet. bereitgestellt, kann im Pflegemodell bis zu 6.8 Pro-
Zudem wurde auch der Aspekt von visionären zent der heutigen Pflegekosten eingespart werden.
Technologien im Quartier der Zukunft erfasst. Um
die Vorstellungen des Technologiekonzeptes in
20Sie können auch lesen