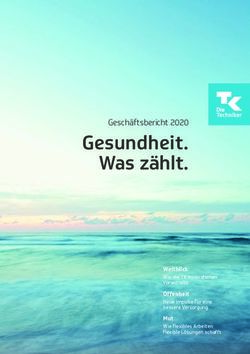Der Hafen als Labor +++ Ein GUIDE zum Erfolg - Uni-DUE
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Newsletter Vol.19/Nr.04 Dezember 2020
s to ff e + + + H a u c h dünn, biegsam
ziert Schad
+++ LeanDeR redu o d e n fü r L i-I o n e n -Batterien +++
ssere An
und robust +++ Be r + + + E in G U ID E zum Erfolg +++
Labo
+++ Der Hafen alsALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Inhalt Liebe Alumni,
.
Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1924, also vor knapp 100 Jahren, legte
Auf dem Titel … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 die in Hannover geborene Ilse ter Meer als
Fakultät erste Maschinenbauingenieurin Deutsch-
Public-Private-Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lands an der Technischen Hochschule
München ihr Examen ab. Anschließend
LeanDeR reduziert Schadstoffe . . . . . . . . . . . . . 4 Prof. Dr. Dieter Schramm
machte sie sich mit einem eigenen Ingenieur
Online-Süchte besser verstehen . . . . . . . . . . . . . 6 büro selbständig und engagierte sich ab men. Besonders schön daran ist, dass sie
Optische Chips realisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1925 als erste Frau im VDI auch berufspo- selbst Absolventin unserer Fakultät ist.
Call for Papers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 litisch stark für Frauen im Ingenieurwesen. Die Covid-19-Pandemie hat die Welt
Ilse ter Meer sollte für lange Zeit eine Aus- weiter fest im Griff. Wir erleben ein wei-
Serie Fachgebiete: Institut für Schiffstechnik, .
Meerestechnik und Transportsysteme . . . . . . . . . 8 nahmeerscheinung bleiben. teres Semester mit stark eingeschränkter
Erst im letzten Jahrzehnt hat sich der Präsenz. Dass dies unvermeidbar ist, ver-
Strom, Wärme, Klimaschutz . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anteil von Studentinnen in den MINT- deutlichen die saisonal bedingt hohen Er-
Effizientere UV-LEDs für die Desinfektion . . . . . 10 Fächern deutlich erhöht. Im vergangenen krankungszahlen: Die Intensivstation der
Neue Unterstützung für MARIE . . . . . . . . . . . . 11 Jahr nahmen knapp 120.000 Frauen ein Uniklinik Essen war Ende Oktober zeitweise
Sicherheitslücken schließen . . . . . . . . . . . . . . . . 12 entsprechendes Studium auf – doppelt so komplett belegt. Ein erster Hoffnungs-
viel wie im Jahr 2008. Gleichzeitig ist die schimmer zeigt sich derzeit durch die be-
Roboter als Inklusionsbeschleuniger . . . . . . . . . 13
Zahl männlicher Studienanfänger rück vorstehende Zulassung erster Impfstoffe.
Förderverein
läufig. Der Trend macht zweierlei deut- Doch bis eine ausreichende Immunität .
Förderverein wählt Gremien neu . . . . . . . . . . . 14 lich: Die langjährigen Bemühungen, in der Gesamtbevölkerung erreicht ist,
Universitätswochen werden digital . . . . . . . . . . 15 schon im schulischen Bereich Nachwuchs werden selbst bei optimalem Verlauf noch
Hochschule für unser Berufsfeld zu interessieren, Monate vergehen.
machen sich allmählich bezahlt. Und: Uns allen steht nun das erste Weih-
Bessere Anoden für Li-Ionen-Batterien . . . . . . . 16
Frauen sind für den Ingenieurberuf nicht nachtsfest unter Pandemiebedingungen
Hauchdünn, biegsam und robust . . . . . . . . . . . 16 weniger geeignet als Männer. bevor. Wir alle müssen versuchen, das
Rohstoffe aus Abfall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Auch in der Lehre zeigt sich langsam Beste daraus zu machen. Ich wünsche
Der Hafen als Labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ein entsprechender Anstieg. Immerhin 16 Ihnen allen und Ihren Angehörigen trotz
Energy For Future im Schülerlabor . . . . . . . . . . 19 der etwas mehr als 90 Professuren an unse- der Herausforderungen dieser Zeit schöne
rer Fakultät sind inzwischen weiblich be- Feiertage, Erholung, Gesundheit und viel
Ausbildungsplatz Hochschule . . . . . . . . . . . . . . 20
setzt. Das sind gut 17 Prozent – und da ist Kraft für das kommende Jahr.
Knotenpunkt der Neuen Seidenstraße . . . . . . . 21 noch viel Luft nach oben. Mit Franziska
Personalien Muckel hat jüngst die erste Professorin in
Herzlichst Ihr
Ein GUIDE zum Erfolg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 der Elektrotechnik ihre Arbeit aufgenom-
Virtuelle AbsolventInnenfeier . . . . . . . . . . . . . . 22
Photodetektoren und Lichtemitter . . . . . . . . . . . 23
Verstärkung für das SSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Auf dem Titel …
Best Paper Award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 … zeigen wir die Untersuchung von
Sloshing in einem teilgefüllten Tank für
Auszeichnung für Jan Mischke . . . . . . . . . . . . . 23
Flüssiggas. Unter Sloshing versteht man
Studierende das Bewegungsverhalten von Flüssig
Ziele statt Vorbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 keiten in einem anderen Objekt, das
Neuland – auch für Digital Natives . . . . . . . . . 24 sich typischerweise ebenfalls bewegt,
Abschlussarbeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 also zum Beispiel Flüssiggas in einem
Finite Elemente Tankschiff. Das Bild entstand am Institut
für Schiffstechnik, Meerestechnik und
Termine, Vorschau, Impressum . . . . . . . . . . . . . 27
Transportsysteme, das wir in dieser Aus-
Neulich im Tannenwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
gabe auf Seite 8 vorstellen.
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04F a k u lt ä t
Public-Private-Partnership
Lehrstuhl für Strömungsmaschinen kooperiert mit Siemens
von Nina Pawlik
Mit dem Center of Rotating Equipment CoRE richtet die Universität gemeinsam mit Siemens Energy ein weltweit einzig-
artiges Forschungs-, Ausbildungs- und Trainingscenter für Strömungsmaschinen in Duisburg ein. Im Mittelpunkt von
CoRE stehen die Zusammenarbeit und der Wissensaustausch zwischen Universität und Industrie.
Dafür wurde auf dem Duisburger
etriebsgelände von Siemens Energy
B
eine Halle neu hergerichtet. Ebenso wird
das Labor des Lehrstuhls für Strömungs-
maschinen mit der neuesten Leittechnik
ausgestattet. Durch die Forschungsmög-
lichkeiten vor Ort sollen die Flexibilität
und Effizienz von Strömungsmaschinen,
vor allem vor dem Hintergrund der
Energiewende, vorangetrieben und die
Erkenntnisse an die Industrie weitergege-
ben werden.
Durch die Zusammenarbeit der Uni- Detlev Weniger und Prof. Dr. Dieter Brillert vom Lehrstuhl für Strömungsmaschinen
versität und der Siemens Energy entstehen freuen sich auf die Kooperation mit Siemens
folglich zahlreiche Synergieeffekte auf
beiden Seiten. n aher Zukunft praxis- und industrienahe wird damit ein einzigartiger Masterkurs
So werden die von der Fakultät zur Praktika oder „Hands-on-Vorlesungen“ für Strömungsmaschinen eingerichtet und
Forschung errichteten Prüfstände einschließ- angeboten werden können. Sie be Siemens kann sich weiterhin als innovativer
lich der neuesten Leittechnik von Siemens kommen also die Gelegenheit, industrie- Marktführer auf diesem Gebiet behaupten.
zu Trainingszwecken genutzt. Ziel ist es, nahe Praxiserfahrungen zu sammeln und CoRE steigert folglich das Ausmaß an
Angestellte und Kunden auf dem Universi- ihr theoretisches Wissen mit der Praxis . Transfer und Austausch zwischen Theorie,
tätsgelände effizient zu schulen und so zu verknüpfen. Praxis und Industrie auf dem Gebiet der
Kundenbeziehungen zu stärken. Gleich- Zudem wird ein internationaler Master- Strömungsmaschinen, in dem Deutschland
zeitig wird durch die Nutzung der An studiengang im Maschinenbau mit der Ver- weltweit bereits Alleinstellungsmerkmale
lagen durch Siemens Energy und ihre tiefung Strömungsmaschinen angeboten. besitzt. Durch den Bau des Trainingscenters
Kunden auch die Sichtbarkeit der Univer- Für Letzteren nutzt die Industrie ihr welt- werden Lehre, Forschung und Innovation
sität weltweit erhöht. weites Netzwerk und wählt mit der UDE auf der einen Seite, aber auch die Schaf-
Im Gegenzug werden Studierende im zusammen exzellente internationale Stu- fung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
Betrieb, der Wartung sowie der Montage dierende aus, um sie mit einem Stipendium und Exzellenzen auf der anderen Seite
von Strömungsmaschinen praktisch ge- für den Studiengang auszustatten und mit vorangetrieben. Dadurch wird nicht zu-
schult. Mit der Errichtung des Trainings weiteren Studierenden vor Ort zu ver- letzt auch die Wirtschaft der Region nach-
centers bei Siemens werden ihnen in knüpfen. An der Universität Duisburg-Essen haltig gestärkt und gefördert.
Ausgabe verpasst? Bestimmter Artikel gesucht? Oder wollen Sie einfach
nochmal stöbern in fast 20 Jahren Alumni-Newsletter-Geschichte?
Registrierte Mitglieder im Netzwerk Alumni haben in unserer Online-
ALUMNI Datenbank Zugang zu allen bisher erschienenen Heften als PDF-Download.
Einfach einloggen unter http://www.alumni-iw.uni-duisburg-essen.de/
Ingenieurwissenschaften
und dann den Button „Newsletter-Archiv“ anklicken.
Universität Duisburg-Essen
2
3ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
LeanDeR reduziert
Schadstoffe
Projekt erprobte
Flüssiggaseinsatz im Hafen
von Patrick Driesch
Das im Mai abgeschlossene Forschungsprojekt „LeanDeR“
umfasste den Aufbau und Betrieb einer multimodal nutz-
baren LNG-Infrastruktur (Liquefied Natural Gas) als Leucht-
turm-Projekt am Duisburger Hafen und sollte den Weg für
eine Infrastruktur für Flüssigerdgas ebnen. Partner des
Verbundvorhabens waren die Duisburger Hafen AG und
RWE Supply & Trading sowie der Lehrstuhl für Mechatro-
nik und das Institut für Baubetrieb & Baumanagement der
Universität Duisburg-Essen. Das Projekt wurde mit Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
gefördert.
Bild: Duisport/Frank Reinhold
Betrieb eines Reachstackers am Duisburger Hafen
Im Rahmen von LeanDeR wurde der auf einen Diesel/LNG-Dual-Fuel-Betrieb ausschließliche Dieselbetrieb gewählt.
Betrieb von Hafenumschlaggeräten mit umgerüstet. Dadurch kann das Fahrzeug Damit ein Vergleichsmaßstab zu dem erd-
dem alternativen Kraftstoff Erdgas erprobt sowohl ausschließlich mit Dieselkraftstoff als gasbetriebenen Terminaltraktor vorliegt,
und dem konventionellen Betrieb mit Diesel- auch mit einer Kombination beider Kraft- wurden zusätzlich Messungen an einem
kraftstoff gegenübergestellt. Aufgrund stoffe betrieben werden. Zudem wurde dieselbetriebenen Fahrzeug dieses Typs
seiner erhöhten Energiedichte wurden die ein mit Erdgas betriebener Terminaltraktor aus der bestehenden Flotte vollzogen.
Hafenumschlaggeräte mit Erdgas in ver- in die bestehende Fahrzeugflotte am Hafen Die Untersuchungsergebnisse zeigen,
flüssigter Form als LNG (Liquefied Natural integriert. dass ein Erdgasbetrieb besonders den lo-
Gas) betankt. Als Versuchsobjekt wurde Um eine Einschätzung über Unter- kalen spezifischen Emissionsausstoß des
ein zuvor dieselbetriebener Reachstacker schiede zwischen Erdgas- und Dieselbe- Terminaltraktors gegenüber einem Diesel-
trieb der Fahrzeuge hinsichtlich des betrieb reduzieren kann. So konnte ein
Kraftstoffverbrauchs und des Emissions- Einsparpotenzial von ca. 10,2 % trotz ei-
ausstoßes zu erhalten, wurden Messungen nes Austretens von nicht verbranntem Me-
durch Datenloggersysteme und Abgas- than für den spezifischen CO2-Ausstoß
analysegeräte an den Fahrzeugen vollzo- ausgemacht werden. Bei den spezifischen
gen. Als Vergleichsmaßstab zum Dual- Emissionen der Luftschadstoffe CO und
Fuel-Betrieb des Reachstackers wurde der NOx ergaben sich Einsparpotenziale von
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04F a k u lt ä t
Datenloggersystem
Messsonde
Zugriff auf den
CAN-Bus Abgasendrohr
Eingesetzte Messtechnik beim Terminaltraktor
mehr als 50 %. Ebenfalls folgte aus der genzug die spezifischen CO- und CH4- künftig durch technische Anpassungen
Schwärzung von Feinstaubfiltern, dass im Emissionen an. Aufgrund der erhöhten verbessert werden.
Erdgasbetrieb im Gegensatz zum Diesel- Klimawirksamkeit von Methan kann dies Das Forschungsprojekt hat gezeigt, dass
betrieb nahezu kein Feinstaub ausgesto- in einer gesamten Klimabilanz zu einer Erdgas eine praktikable und alltagstaugliche
ßen wurde. Dabei wies das erdgasbetrie- Egalisierung der geringeren spezifischen Antriebsalternative zum konventionellen
bene Fahrzeug einen etwa 8,1 % höheren CO2-Emissionen führen. Der Anstieg der Diesel für Hafenumschlaggeräte darstellt.
spezifischen Kraftstoffverbrauch als die spezifischen CO- und CH4-Emissionen . Die positiven Rückmeldungen der Mitarbei-
dieselbetriebene Variante auf. Für den bei ansteigender Substitutionsrate von ter am Duisburger Hafen unterstrichen, dass
Fahrzeugtyp Reachstacker konnten zwar Erdgas kann zum Beispiel auf eine unvoll- sowohl der Betrieb als auch die Betankung
im Dual-Fuel-Betrieb mit ansteigender ständige Verbrennung hindeuten. Sie der erdgasbetriebenen Fahrzeuge praktika-
Substitutionsrate von Erdgas die spezifi- kann dadurch bedingt sein, dass das Mo- bel ist. Dabei kann, besonders im Einstoff-
schen CO2- und NOx-Emissionen gegen- torsteuergerät und die Abgasnachbe- betrieb, durch den Einsatz von Erdgas der
über einem Dieselbetrieb des Fahrzeugs handlung auf einen Dieselbetrieb des lokale spezifische Emissionsausstoß der
gesenkt werden, jedoch stiegen im Ge- Fahrzeugs optimiert sind. Dies könnte zu- Fahrzeuge gesenkt werden.
Bild: Duisport
Diesel- und erdgasbetriebener Terminaltraktor am Duisburger Hafen
Universität Duisburg-Essen
4
5ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Online-Süchte besser verstehen
Matthias Brand koordiniert transregionale Forschungsgruppe
von Cathrin Becker
Was haben Computerspiele, Shoppen, Pornos und die sozialen Medien gemeinsam? Suchtpotenzial – und das zunehmend
online. Was dabei in den Köpfen der Nutzer vor sich geht und wie sich ihr Verhalten möglicherweise ändern lässt, unter-
sucht Prof. Matthias Brand vom Fachgebiet Allgemeine Psychologie: Kognition in einer von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) bewilligten transregionalen Forschungsgruppe. Rund 3,2 Millionen Euro stehen für sieben Teilprojekte
plus Koordinationsprojekt in den nächsten drei Jahren zur Verfügung. Fachliche Unterstützung gibt es von Kollegen der
Universitäten Bochum, Bamberg, Gießen, Mainz, Lübeck, Siegen, Ulm und der Medizinischen Hochschule Hannover.
Bild: Tim Reckmann/pixelio.de
Online spielen, Pornographie nutzen, in Netzwerken chatten oder exzessiv einkaufen: Das Internet bietet Raum für viele Süchte
Gaming Disorder, das suchtartige cognitive mechanisms of specific Internet- sert werden“, so Brand, der auch Sprecher
Computerspielen, hat die Weltgesundheits- use disorders (ACSID) (FOR 2974)”. der Forschungsgruppe ist.
organisation bereits als eigenständige Er- Basierend auf einem von Brand und Der Psychologe und seine Kollegen
krankung anerkannt. Sich unkontrolliert Kollegen vorgeschlagenen theoretischen wollen erstmalig eine große Anzahl von
seiner Sucht hinzugeben, passiert Nutzern Modell wollen die Forschenden die (bio-) über 1.300 Probanden mit diversen Frage-
online aber nicht nur beim Daddeln: Auch psychologischen Prozesse untersuchen, bögen und Tests untersuchen, was in dieser
hemmungslose Pornographienutzung, ex- die zur Online-Sucht führen, insbesondere Form nur in einer transregionalen Forschungs-
zessives Online-Shopping und die ständig die affektiven und kognitiven Mechanis- gruppe geschehen kann. Auch werden
lockenden sozialen Netzwerke können zum men. Wie werden die Nutzer gereizt? Hirnscans zum Einsatz kommen. „Wir ma-
ernsthaften Problem werden. Was diesen Gelingt es ihnen, ihre Impulse und Süchte chen einen Querschnittsvergleich zusammen
bekannten Internetnutzungsstörungen an zu unterdrücken? Warum verhalten und mit einer Folgebefragung von Personen mit
psychologischen und neurobiologischen entscheiden sie sich so? „Nur, wenn wir unproblematischem, riskantem und patho-
Prozessen zugrunde liegt, wollen Prof. Brand die Mechanismen der Entstehung und logischem Verhalten. So können wir die
und seine Kollegin Dr. Elisa Wegmann her- Aufrechterhaltung des süchtigen Verhaltens verschiedenen Stadien des Suchtprozesses
ausfinden. Brand koordiniert die neue trans- verstehen, können auch Prävention und aufzeigen.“ Mit ersten Ergebnissen ist in
regionale Forschungsgruppe „Affective and Therapie dieser neuen Störungen verbes- rund zweieinhalb Jahren zu rechnen.
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04F a k u lt ä t
Optische Chips realisieren
UDE koordiniert internationales Doktorandennetzwerk
von Birte Vierjahn
Sie können Licht erzeugen, detektieren, modulieren und speichern, um hochfrequente Terahertzstrahlung zu empfangen
und zu verarbeiten – theoretisch. Noch sind lediglich einzelne Bestandteile optischer Chips entwickelt. Bis zu vollständigen
Schaltkreisen auf Photonen-Basis sind noch einige Herausforderungen zu meistern. Diesen stellt sich nun das internationale
Doktorandennetzwerk TERAOPTICS, das von Ingenieuren der UDE koordiniert wird. Die EU fördert das Projekt bis 2024
mit vier Millionen Euro.
Licht lässt sich durch spezielle Technik in Übertragung höchster Datenraten per
hochfrequente Terahertzstrahlung zwischen Funk. „Bisher entwickelte optische Syste-
0,3 und 10 THz umwandeln. „Diese Tech- me sind aber in der Regel zu komplex und
nologie ist vielversprechend, zum Beispiel letztlich auch zu teuer“, fasst Stöhr die
für künftige Mobilfunknetze, Sicherheits- Ausgangslage zusammen.
technik oder für die Raumfahrt“, erklärt Eine der größten Herausforderungen ist
Prof. Dr. Andreas Stöhr vom Zentrum für der Aufbau aus verschiedenen Material-
Halbleitertechnik und Optoelektronik systemen, denn im Gegensatz zu komplett
(ZHO), der das Netzwerk koordiniert. Silizium-basierten elektronischen Chips
Doktoranden von Universitäten und For- brauchen die Bestandteile der optischen
schungseinrichtungen weltweit sowie von Technologie verschiedene Trägermateria-
mehreren europäischen Industrieunterneh- lien – und müssen dennoch in einem inte-
men erforschen in 15 Teilprojekten unter- grierten System funktionieren. Forschungs- Photonisch integrierter Schaltkreis (PIC)
schiedliche Aspekte der Technologie. bedarf besteht daher auch beim Design der für die Terahertz-Strahlsteuerung
Ziel ist es, optisch integrierte Halbleiter Chips, ihrer Mikrostrukturierung sowie bei
chips zu entwickeln, also Schaltkreise, die der Aufbau- und Verbindungstechnik. raumorganisation ESA, der Europäische
anstelle von Elektronen mit Photonen ar- TERAOPTICS ist das erste von der UDE Verband der Photonischen Industrie, aber
beiten. Dadurch ließen sich THz-Signale koordinierte europäische Doktorandennetz- auch viele Start-ups und kleine Unterneh-
effizienter erzeugen und präziser verarbei- werk. Wie groß das Interesse am Thema men. Die EU fördert das Netzwerk im
ten – ein fundamentaler Vorteil beispiels- ist, zeigt die große Anzahl assoziierter Marie-Skłodowska-Curie-Programm inner-
weise für die Materialanalyse oder die Partner, darunter die Europäische Welt- halb von Horizon 2020.
Call for Papers
Wissenschaftsforum Mobilität
Seit 2008 bietet das Wissenschaftsforum Mobilität an der Universität Duisburg-Essen jährlich eine Gelegenheit zur intensiven
Diskussion von Forschungsarbeiten zur Mobilität, einem Gebiet mit großer thematischer Breite und sehr dynamischer
Entwicklung. Ausgerichtet wird das Forum vom Lehrstuhl Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Internationales
Automobilmanagement.
Angesichts der Covid-19-Pandemie Hygienebedingungen im Fraunhofer-in- Urban Mobility und Accelerating Mobility
plant der Lehrstuhl für das nächste Forum Haus-Zentrum vortragen und diskutieren, Transformation sind sehr willkommen. Ab-
im Juni derzeit eine hybride Veranstaltung während die weiteren Teilnehmer digital stracts müssen bis zum 31. Januar auf der
mit vier Tracks, drei Sessions und jeweils zugeschaltet werden. Webseite des Wissenschaftsforums hoch-
drei Papers. Sofern es die Situation zu- Originäre Beiträge zu den vier Tracks geladen werden.
lässt, werden die Speaker auf dem Wis- Transforming Mobility Management, Trans- Nähere Informationen finden Sie unter
senschaftsforum unter den erforderlichen forming Mobility Engineering, Transforming https://www.uni-due.de/iam/
Universität Duisburg-Essen
6
7ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Serie
Forschung in Schiffs- und Offshoretechnik
Fach- Institut für Schiffstechnik, Meerestechnik und Transportsysteme
te
gebie Die Schiffs- und Meerestechnik hat in Duisburg eine langjährige Tradition, deren Ursprünge bis in das Jahr 1954
zurückreichen. Bedingt durch den größten europäischen Binnenhafen ist in Duisburg die Nähe zu Schiffen und
dem Maschinenbau im maritimen Kontext gegeben. In Nordrhein-Westfalen wird der größte Umsatz im Wind-
Offshore-Bereich generiert. Ein Alleinstellungsmerkmal der Schiffstechnik in Duisburg ist das automatisierte Fahren
von Schiffen. Hier wurden in der letzten Zeit große Forschungsprojekte mit der Mechatronik und dem UDE-An-Institut
DST akquiriert.
Das Institut für Schiffstechnik, Meeres- ab. Aktuelle Fragestellungen der maritimen werden numerische und experimentelle
technik und Transportsysteme deckt über Industrie (See- und Binnenschiffe, Offshore- Methoden entwickelt und angewendet.
seine Aktivitäten in der Grundlagen- und der Strukturen und angrenzende Gebiete) Die Arbeitsgruppe hat sich auf Mehr-
angewandten Forschung verschiedene werden im Rahmen von zahlreichen For- phasenströmungen, Fluid-Struktur-Wech-
Bereiche der Schiffs- und Offshoretechnik schungsvorhaben aufgegriffen. Hierzu selwirkung und automatisiertes Fahren
Bild: ISMT
Untersuchung von Sloshing in einem teilgefüllten Tank für Flüssiggas
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04F a k u lt ä t
Bild: ISMT
von Schiffen spezialisiert. In den instituts Die Lehre umfasst Maschinenanlagen,
eigenen Laboren werden experimentelle Hydrodynamik, Strukturdynamik, Entwurf
Untersuchungen von Sloshing, Slamming, und Konstruktion von Schiffen und
Kavitation etc. durchgeführt. Weiterhin Offshore-Bauwerken. Als Bestandteil des
werden numerische Verfahren entwickelt internationalen englischsprachigen Studi-
und angewendet. Das Institut arbeitet eng engangs „International Studies in Engi-
mit verschiedenen Unternehmen im In- und neering“ (ISE) baut das Profil „Ship and
Ausland zusammen. Offshore Technology“ auf den fundierten
In der Lehre bietet das Institut den Stu- Grundlagen des Maschinenbaus auf und
dierenden eine fundierte Ausbildung im erweitert diese um branchenspezifische
Bereich Schiffs- und Offshoretechnik in Kenntnisse im Bereich der Schiffs- und
deutscher und englischer Sprache. Das Offshoretechnik. Es werden die im ma-
Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt schinenbaulichen Kontext erforderlichen
„Schiffs- und Offshoretechnik“ besteht . Kenntnisse zur Lösung schiffs- und
aus akkreditierten Bachelor-of-Science- offshoretechnischer Fragestellungen ver-
und Master-of-Science-Studiengängen. mittelt. Offshore-Windkraftanlage im Seegang
Bild: Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e. V.
Lehre
Hydrodynamik
Strukturfestigkeit von Schiffen und Offshore-Anlagen
Entwurf von Schiffen und Offshore-Anlagen
Konstruktion von Schiffen und Offshore-Anlagen
Sicherheit und Risikoanalyse von Schiffen und .
Offshore-Anlagen
Forschung
Numerische und experimentelle .
Untersuchungen von Mehrphasenströmungen
(Sloshing, Slamming, Kavitation)
Fluid-Struktur-Interaktion
Welleninduzierte Lasten und Bewegungen .
von Schiffen und Wind-Offshore-Anlagen
Automatisiertes Fahren von Schiffen
Anwendung
Maritime Industrie (Schiffe, Wind-Offshore)
ko n ta k t
Prof. Dr.-Ing. Bettar Ould el Moctar
Dr.-Ing. Jens Neugebauer
Universität Duisburg-Essen .
Institut für Schiffstechnik, Meerestechnik .
und Transportsysteme
Bismarckstr. 69 .
47057 Duisburg
www.uni-due.de/ismt
@ ismt@uni-due.de
+49 (0) 2 03 / 379 - 11 73 oder - 45 96
Fahrstand im DST-Versuchs- und -Leitungszentrum für autonome Binnenschiffe
Universität Duisburg-Essen
8
9ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Strom, Wärme, Klimaschutz
17. Duisburger KWK-Symposium als Online-Konferenz
Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gilt als umweltfreundliche Technik, denn mit ihr kann man gleichzeitig Strom und
Wärme erzeugen. Um ihre Rolle bei der Energiewende, um technische Entwicklungen und gesetzliche Änderungen ging
es bei der ersten digitalen Version des Symposiums am 22. und 23. Oktober. Eingeladen hatten der Lehrstuhl Energie-
technik und der KWK-Bundesverband (B.KWK).
Viele Kommunen und Teile der Industrie
betreiben KWK-Anlagen bzw. planen, in
welche zu investieren. Dies könnte teilweise
unrentabel werden, wenn der nationale
CO2-Handel und die aktuelle Novelle des
EEG wie erwartet kommen.
Darüber und über wirtschaftliche und
rechtliche Fragen diskutierten Wissen-
schaftler, Anlagenbetreiber und Vertreter
von Verbänden via Zoom beim Sym
posium. Unter anderem wurden erfolg
reiche Beispiele einer Industrie-KWK-
Anlage sowie einer KWK-Lösung mit
einem kommunalen Wärmenetz vorgestellt.
Andere Vorträge drehten sich um die
Zukunft der Kraft-Wärme-Kopplung. Diese
muss natürlich zu einem stabilen Strom-
netz beitragen und sollte zunehmend mit
erneuerbaren Energien betrieben werden.
Hier wird Biogas – und stärker noch
Brennstoffzellen-KWK-Anlage des ZBT Wasserstoff – eine Rolle spielen.
Effizientere UV-LEDs für die Desinfektion
BMBF genehmigt wissenschaftliches Vorprojekt
Als große und globale Herausforderungen unserer Zeit wurden unter anderem die Trinkwasserversorgung für Mensch
und Tier, unsere medizinische Versorgung sowie die Luftreinhaltung identifiziert. Hierfür werden Lösungen gesucht, die
mobil und energieeffizient sind. Ein gerade sehr wichtiges Thema ist die effiziente und flächendeckende Desinfektion
durch ultraviolettes Licht.
Aktuell werden hierfür quecksilber bereichen Wasser- und Luftreinigung, desministeriums für Bildung und Forschung
haltige und somit umweltschädliche und aber auch für das Gas-Monitoring oder BMBF wurde am Fachgebiet Werkstoffe
energiefressende Lichtquellen eingesetzt. die Phototherapie. Verhindert wird ihr Ein- der Elektrotechnik unter Leitung von Prof.
Man erwartet, dass UV-Leuchtdioden . satz bislang durch die schlechte Effizienz Gerd Bacher nun ein wissenschaftliches
auf Basis von Aluminium-Gallium-Nitrid- aktueller Bauelemente, insbesondere derer, Vorprojekt genehmigt. Ziel des Projektes
Heterostrukturen die quecksilberhaltigen die Licht im unteren UV-C-/UV-B-Bereich ist die Steigerung der Effizienz dieser
Lichtquellen in naher Zukunft ersetzen. . emittieren. Leuchtdioden mithilfe direkt gewachsener,
Sie gelten als ökologisch und ökonomisch Im Rahmen des Förderprogramms atomar dünner Kohlenstoffschichten, so-
attraktive Alternative in den Anwendungs- Photonik Forschung Deutschland des Bun- genanntem Graphen.
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04F a k u lt ä t
Neue Unterstützung für MARIE
DFG fördert Sonderforschungsbereich für vier weitere Jahre
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) wird den Sonderforschungsbereich Mobile Material Characterization and
Localization by Electromagnetic Sensing“ (MARIE) für weitere vier Jahre mit 13,7 Millionen Euro fördern. Bei MARIE
arbeiten Forscher der UDE und der Ruhr-Universität Bochum gemeinsam an den Grundlagen für einen mobilen hoch
sensiblen Mini-Detektor.
MARIE soll einmal ferngesteuert die detaillierte Untersuchung von kritischen Bereichen ermöglichen
Das Gerät wird einmal die Material Dafür muss der Detektor sehr hohe Fre- Lehrstuhls für Hochfrequenzsysteme.
eigenschaften nahezu beliebiger Objekte quenzen bis in den Terahertzbereich ab- eteiligt sind zudem die Universität
B
bestimmen können, selbst wenn diese hin- decken. Wuppertal, die TU Darmstadt und die
ter einer Wand verborgen liegen. So kön- Geleitet wird MARIE von Prof. Dr. Fraunhofer-Institute für Mikroelektronische
nen auch Menschen in kontaminierten Thomas Kaiser, dem Leiter des UDE-Fach- Schaltungen und Systeme (IMS/Duisburg)
Räumen oder schmorende Kabel inner- gebiets für Digitale Signalverarbeitung, sowie für Hochfrequenzphysik und Radar-
halb von Wänden aufgespürt werden. und Prof. Dr. Ilona Rolfes, Leiterin des RUB- technik (FHR/Wachtberg).
10
11ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Sicherheitslücken schließen
BMBF-Projekt CYWARN startet mit Beteiligung der Fakultät
von Cathrin Becker
Der Bundestag, Krankenhäuser, aber auch Unis: Sie alle wurden schon Opfer von Hackern. Denn mit zunehmender
Digitalisierung steigt die Gefahr von Cyberangriffen. Wie ist die Lage aktuell? Wie lassen sich IT-Sicherheitsfachleute
und Behörden unterstützen? Das will ein interdisziplinäres Forschungsteam untersuchen. Mit dabei: Prof. Stefan Stieglitz
vom Fachgebiet Professionelle Kommunikation in elektronischen Medien/Social Media. Gefördert wird das 2-Millionen-
Euro-Projekt CYWARN* vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Bild: SpaceX-Imagery/Pixabay
Mit zunehmender Digitalisierung steigt die Gefahr von Cyberangriffen
Könnten Frühwarnsysteme helfen? Oder Maßnahmen bei IT-Sicherheitsvorfällen Dashboards für und mit Behörden. So sollen
ist die unmittelbare Reaktion auf immer geht. Entstehen soll ein Demonstrator, der die sie schneller IT-Sicherheitslücken identifizie-
komplexere Cyberangriffe entscheidend? automatisierte Sammlung öffentlicher und ren und schließen können. 500.000 Euro
Die Wissenschaftler wollen in den nächsten geschlossener Datenquellen zulässt. Die stehen dafür zur Verfügung.
drei Jahren unter Leitung von Prof. Dr. Daten sollen auf ihre Glaubwürdigkeit ge- „Mit den im CYWARN-Projekt ent
Christian Reuter von der TU Darmstadt prüft werden und eine Einordnung und Ge- stehenden Ergebnissen können in Zukunft
herausfinden, wie sie Computer Emergency wichtung der Informationen ermöglichen. sehr viel besser IT-Sicherheitslücken
Response Teams (CERTs) mit neuen Strate- In seinem Teilprojekt sammelt Prof. Stefan geschlossen und Hackerangriffe abge-
gien und Technologien bei der Analyse und Stieglitz mit seinem Team elektronische wehrt werden“, so Stieglitz. Die Gesell-
Kommunikation des deutschlandweiten Cy- Daten, zum Beispiel aus den sozialen schaft profitiere durch eine bessere
ber-Lagebilds unterstützen können. CERTs Netzwerken, wertet sie aus und erarbeitet Sicherheitslage und weniger Risiken, etwa
sind die zentrale Anlaufstelle, wenn es um ein Kommunikationskonzept inklusive eines Datenverluste.
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04F a k u lt ä t
Roboter als Inklusionsbeschleuniger
Wie Technologie mehr Teilhabe ermöglicht
von Thomas Wittek
Der Einsatz neuester Robotertechnologie ermöglicht Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe am Arbeitsleben: Das ist
das Ziel eines gemeinsamen Projekts des Sozialdienstleisters wertkreis Gütersloh, der Rethink Robotics GmbH und der
UDE. Zum Projektstart übergab Rethink Robotics zwei spezielle Roboter an den Berufsbildungsbereich des wertkreis
und den Lehrstuhl Fertigungstechnik.
Gemeinsam für mehr Teilhabe durch Innovation: Daniel Bunse von Rethink Robotics, Anja Große-Coosmann sowie Carolin Reckmeyer
vom wertkreis Gütersloh und Dr. Holger Dander vom Lehrstuhl Fertigungstechnik
Die beiden Roboter, sogenannte Co- und entlastet ihn“, erklärt Daniel Bunse, zeichnet. „Dass Werkstätten für Menschen
bots, können mit Menschen interagieren. CEO von Rethink Robotics. mit Behinderung als Inkubatoren für neue
Sie sind der Grundstein für die Zusammen- Michael Buschsieweke, Geschäftsführer Systeme genutzt werden, ist ein Ansatz,
arbeit im Bereich „Inklusion 4.0 mit kolla- des wertkreis Gütersloh, sieht in solch digi- mit dem wir schon in der Vergangenheit
borierenden Systemen“. Mit neuartigen talen Assistenzformen ein Zukunftsmodell für gute Erfahrungen gemacht haben“, sagt
Applikationen und angepassten Arbeitspro- Menschen mit Handicap: „Im Idealfall wer- Projektleiter Dr. Holger Dander. „In dieser
zessen sollen Menschen mit Behinderungen den sie irgendwann einmal so selbstver- Umgebung muss der Mensch im Mittel-
oder ohne sprachliches Ausdrucksvermö- ständlich sein wie Seh- und Gehhilfen.“ punkt stehen, damit die Interaktion von
gen bessere Chancen auf Bildung und Der Lehrstuhl für Fertigungstechnik arbei- Mensch und Maschine funktioniert. Lösun-
Teilhabe bekommen. „Cobots können im tet schon seit mehreren Jahren an der Frage, gen, die sich hier bewährt haben, lassen
Betrieb unterstützende Tätigkeiten über- wie sich kollaborierende Robotik in Arbeits sich dann sehr einfach und schnell auch
nehmen, die sich sehr oft wiederholen. prozesse integrieren lässt, und wurde dafür auf andere Bereiche der Arbeitswelt über-
Somit assistiert der Cobot dem Menschen 2018 mit dem NRW-Inklusionspreis ausge- tragen.“
12
13ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Förderverein wählt Gremien neu
Mitgliederversammlung mit Mundschutz und Abstand
von Klaus G. Fischer
Die Mitglieder des Fördervereins Ingenieurwissenschaften haben sich zu ihrer diesjährigen Versammlung getroffen.
Auf der Tagesordnung standen der Rechenschaftsbericht des Vorstands, die anstehenden Aktivitäten und deren finanzielle
Absicherung. Zudem waren Vorstand, Kuratorium und Rechnungsprüfer für eine neue Amtszeit von zwei Jahren zu wählen.
Vor dem Hintergrund der vorliegen- Ein sehr uneinheitliches Bild bieten der- meister des Fördervereins Giovanni Mala-
den Berichte und der zwischenzeitlich er- zeit die vom Förderverein unterstützten ponti kündigte auch die Ausschreibung
neuten Einschränkungen durch die Corona- Ingenieur-Akademien. Alle drei Partner – der Innovationspreise Ingenieurwissen-
Pandemie wird der Vorstand mit einer Schulen, Hochschule und Unternehmen schaften 2020 an.
Task Force konkrete Projekte zur Unterstüt- – wollen das Projekt fortsetzen, müssen Der Vorsitzende des Fördervereins,
zung der Fakultät entwickeln. Ein Schwer- aber neue Strukturen finden, die den der- Dr.-Ing. Wolf-Eberhard Reiff, verabschie-
punkt muss die Gewinnung neuer und die zeitigen einschränkenden Randbedingun- dete den stellvertretenden Vorsitzenden
Pflege bestehender Kontakte zu Unter- gen Rechnung tragen. Ein ebenfalls neu Prof. Holger Vogt mit Dank für seine lang-
nehmen sein. Dazu wird auch das von itq zu eroberndes Terrain sind die Fachschaf- jährige ehrenamtliche Tätigkeit für den
und crossrelations brandworks entwickelte ten, deren Unterstützung einfach an den Förderverein. Bei den Wahlen zum Vor-
Format „TecTalk“ nützlich sein, das sich fehlenden Ansprechpartnern scheitert – stand wurde Prof. Holger Hirsch vom Fach-
nach der Veranstaltung über „Corona- und wahrscheinlich auch an der nicht an- gebiet Energietransport und -speicherung
Pandemie, Digitalisierung und Nachhaltig- wesenden Klientel. als neuer stellvertretender Vorsitzender
keit“ vom 29. September als Nächstes Gewohnt zuverlässig ist die Koopera gewählt (siehe Kasten).
dem Thema „Mobilität, Smart City“ widmen tion mit der Sparkasse am Niederrhein, Neu ins Kuratorium gewählt wurde
wird. Eine gute Chance bieten auch neue die nicht nur die Online-Version der . Dr.-Ing. Jens Reichel, thyssenkrupp Steel
Aktivitäten in der Schiffstechnik und der 33. Universitätswochen zum Thema Europe. Die Rechnungsprüfer Dr. Wolf-
Hafenlogistik, die Dekan Prof. Dieter „Mobilität in der Zukunft“ mit dem Vor- gang Mertin und Michael Gerarts von
Schramm in seinem turnusmäßigen Bericht trag von Prof. Ellen Enkel bei YouTube der Sparkasse am Niederrhein wurden
aus der Fakultät herausstellte. bereitstellt. Der Vorsitzende und Schatz- mit Dank in ihren Ämtern bestätigt.
Holger Hirsch studierte Elektrotechnik an der Univer
sität Dortmund und promovierte 1991 am dortigen
Lehrstuhl für Hochspannungstechnik und elektrische An
lagen auf dem Gebiet der faseroptischen Stromsensorik.
1995 übernahm er die Laborleitung der neu gegründeten
EMC Test NRW in Dortmund, bevor er 1998 den Ruf für
die Professur „Theorie der EMV“ an der Universität
Dortmund annahm. 2003 wechselte er als Leiter des
Lehrstuhls „Energietransport und -speicherung“ an die
Universität Duisburg-Essen. Seine Forschungsgebiete sind
die Hochspannungstechnik, die Elektromagnetische Ver-
träglichkeit und die Nutzung von Informationstechnik .
in Energiesystemen. Daneben engagiert er sich in der
nationalen (DKE) und internationalen (CENELEC, IEC)
Normung im Bereich der EMV.
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04förderverein
Universitätswochen werden digital
Ellen Enkel referiert über Mobilität der Zukunft
Die Universitätswochen der Sparkasse am Niederrhein und der UDE stehen in diesem Jahr vor besonderen Herausforde-
rungen. Eine Präsenzveranstaltung, wie sie bisher mit Vortrag und Diskussion im Foyer der Sparkasse am Niederrhein
stattgefunden hat, ist zurzeit leider wegen Covid-19 nicht möglich. Um aber die Verbundenheit der Universität Duisburg-
Essen mit der Region am Niederrhein auch in diesen Zeiten zu betonen, haben wir gemeinsam beschlossen, dieses Mal
die Universitätswochen als Online-Veranstaltung zu organisieren, mit einem spannenden Vortrag zur neuen Mobilität.
Die Welt der Mobilität befindet sich in
einem Umbruch. Neue Technologien wie
das E-Bike, Hybrid- und Elektro-Autos ste-
hen bereit, andere wie das autonome
Fahrzeug sind in der Entwicklung. Neue
Geschäftsmodelle entstehen: Kaufe ich mir
ein Fahrzeug, leihe ich es, teile ich es mit
anderen? Muss es überhaupt ein Auto
sein? Neue Anbieter erscheinen auf der
Bildfläche. Firmen wie Google, eher be-
kannt für die Suchmaschine und Big Data,
beschäftigen sich auf einmal mit der Mo-
bilität. Die deutsche Autoindustrie, bisher
weltweit ein Treiber der persönlichen
Mobilität und ein wesentlicher Bestandteil
unserer Industrienation, steckt in einer
Krise. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
geraten in die Diskussion, alternative Kon-
zepte entstehen erst langsam. Die Universitätswochen als Online-Veranstaltung: Prof. Dr. Ellen Enkel
Klar ist aber sicherlich, dass wir weiter-
hin mobil sein wollen, komfortabel, kosten- Inhaberin des Lehrstuhls für Allgemeine des Nutzerverhaltens. Dabei tun sich viele
günstig, aber auch nachhaltig für unsere BWL & Mobilität an der Universität spannende Themen auf, spannend für die
Umwelt. Wie können wir diese Mobilität Duisburg-Essen, spannt in ihrem Vortrag Industrie, für die Forschung und für uns als
von morgen erreichen? Welche Chancen den Bogen von den Anforderungen an Nutzer.
und Herausforderungen gibt es für die Unternehmen, die in der agilen Welt der Hier finden Sie den Vortrag online:
Unternehmen, die Gesellschaft und den Mobilität bestehen wollen, über neue tech- https://www.youtube.com/
einzelnen Nutzer? Prof. Dr. Ellen Enkel, nische Möglichkeiten bis hin zum Einfluss watch?v=PNAR-K7egf4
Noch nicht Alumni-Mitglied?
Sofort gratis in der Alumni-Datenbank anmelden
ALUMNI unter http://www.alumni-iw.uni-due.de/
Ingenieurwissenschaften und kostenlos alle Vorteile nutzen!
Universität Duisburg-Essen
14
15ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Bessere Anoden für Li-Ionen-Batterien
Bund fördert Projekt von UDE und Evonik
Spätestens im Jahr 2023 soll es marktreif sein: Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien, das zu leistungsfähigeren-
Energiespeichern führt. Das Material ist in den Laboren des Center for Nanointegration (CENIDE) bereits erprobt worden.
Seit dem 1. September fördert das Bundeswirtschaftsministerium die UDE mit fast 1,7 Millionen Euro, um den Herstellungs-
prozess in einem gemeinsamen Projekt mit Evonik weiterzuentwickeln und auf den Industriemaßstab zu übertragen.
Bisher wird in Lithium-Ionen-Batterien theseanlagen des NanoEnergieTechnik- und Form auf Basis von Modellsimula
Graphit als Anodenmaterial eingesetzt, Zentrums (NETZ) in Duisburg hergestellt: tionen. Ebenfalls genau unter die Lupe
doch dessen Kapazität und Fähigkeit . Das Komposit aus Kohlenstoff und Silizium genommen wird der nächste Schritt, in
zum schnellen Laden sind weitestgehend hat eine viel höhere Kapazität bei gleichem dem die hergestellten Partikel zu Pasten
ausgereizt. Eine vielversprechende Alter- Volumen, zudem ist es langzeitstabil und verarbeitet und als Anodenmaterial auf
native haben UDE und Evonik in den Syn- schnell zu laden. „Kein Projektpartner kennt Kupferfolie gedruckt werden.
etwas Vergleichbares“, so Prof. Dr. Hartmut Evonik nutzt die Strömungsmodelle so-
Bild: ICAN/Dr. Hans Orthner
Wiggers vom Institut für Verbrennung und wie die Experimente der UDE-Experten für
Gasdynamik IVG. Die von der Fachwelt die eigene Pilotanlage im Industriemaß-
geforderte Kapazität von 1,5 Ah/g er- stab. „Unser erstes Ziel ist, die richtige
reicht es problemlos. Zusammensetzung und Form der Partikel
Nun müssen die im Labor bereits etab- auch im industriellen Maßstab zu gewähr-
lierten Herstellungs- und Verarbeitungs- leisten. So können wir unseren Kunden dann
prozesse auf die erheblich größeren maßgeschneiderte Lösungen anbieten“,
Dimensionen der industriellen Fertigung erklärt Dr. Julia Lyubina, die zuständige
übertragen werden. Neben der Arbeits- Projektmanagerin bei Evonik.
gruppe Wiggers arbeiten daran auch die Das Bundesministerium für Wirtschaft
Forscher um Prof. Doris Segets (IVG) und und Energie fördert das Verbundprojekt
Prof. Andreas Kempf vom Lehrstuhl für „HOSALIB – Hochleistungs-Silizium-
Amorphe Silizium/Kohlenstoff- F luiddynamik: Es geht um optimale Prozess- Kohlenstoff-Komposit als Anodenmaterial
Partikel (Aufnahme aus einem technik, Partikelcharakterisierung und den für Lithium-Ionen-Batterien“ für drei Jahre
Transmissions-Elektronenmikroskop) Bau von Anlagen in der richtigen Größe mit insgesamt 2,3 Millionen Euro.
Hauchdünn, biegsam und robust
CENIDE entwickelt flexible Leuchtelemente
Würde man 80.000 von ihnen übereinanderlegen, wäre der Stapel nur so hoch wie ein flachliegendes Blatt Papier:
Wissenschaftler vom Center for Nanointegration (CENIDE) haben gemeinsam mit Kooperationspartnern eine nur drei Atom-
lagen dünne Schicht aus Wolframdisulfid entwickelt. Sie leuchtet, ist flexibel und zudem stabil gegenüber äußeren Ein-
flüssen. Mehrere Quadratzentimeter große Flächen davon wurden bereits in Bauelemente eingebettet, der Herstellungs-
prozess ist aber darüber hinaus skalierbar. Das Fachmagazin Advanced Optical Materials hat darüber berichtet.
Die hauchdünne Leuchtschicht wächst Aachen und der Firma AIXTRON ganze Unter Leitung von Prof. Gerd Bacher
auf einer Unterlage aus Saphir, wird an- Bauelemente aus dem zweidimensionalen entstanden so Leuchtelemente, die die
schließend behutsam mithilfe eines Lackes Material entwickelt haben. Die Methode Vorteile verschiedener Bauelementkonzep-
abgehoben, auf die Trägerfolie übertragen lässt sich mit dem gleichen Material und te verbinden: Die anorganische Wolfram-
und der Lack aufgelöst. In groben Zügen derselben Architektur auf weitaus größere disulfidschicht ist wenig anfällig gegen-
ist das der Herstellungsprozess, über den Flächen skalieren – das macht sie industriell über schädlichen Umgebungseinflüssen
die Projektpartner der UDE, der RWTH interessant. wie Sauerstoff oder Feuchtigkeit und zudem
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04langzeitstabil. Durch die flexible Bauwei-
se passt sich die Struktur jeder Form an.
Doch die Flexibilität birgt noch einen weite-
ren Vorteil: Biegt man die Folie, verzerrt
sich das Kristallgitter der leuchtenden
Schicht, und die Wellenlänge des ausge-
sandten Lichts, und damit die Lichtfarbe,
verändert sich. Diese Änderung ist zwar
mit dem bloßen Auge nicht sichtbar, aber
mit Messgeräten leicht zu erfassen.
„Das macht die Elemente zum Beispiel
auch interessant als Sensoren“, erklärt Dr. Folie mit 1 cm Kantenlänge und vier Lichtemittern; das Bild im Bild zeigt einen
Tilmar Kümmell aus der Arbeitsgruppe von ihnen in Betrieb. Der weiße Balken entspricht 2 mm.
Bacher. „Etwas weiter gesponnen könnten
wir uns etwa vorstellen, dass sie eingesetzt gungen zu erkennen.“ Auf der anderen der Folie auch eine bestimmte Wellenlänge
werden, um Verformungen oder Verbie- Seite ließe sich durch die präzise Biegung für das ausgestrahlte Licht einstellen.
Rohstoffe aus Abfall
Anlage reinigt Metallspäne aus Produktionsprozessen
von Alexandra Nießen
Rohstoffe aus verunreinigten Metallspänen zurückgewinnen und damit wertvolle Materialien wiederverwenden: Diese
nachhaltige Ressourceneffizienz verspricht die Entölungsanlage, die von der UDE und regionalen Projektpartnern ent-
wickelt und in Herne in Betrieb genommen wurde. Bis zu 40 Prozent weniger Energie im Vergleich zu anderen Methoden
braucht das Verfahren, dessen Umsetzung vom Bundesforschungsministerium gefördert wurde.
Wer Metalle bearbeitet, nutzt dazu Herausgekommen ist ein Entölungs
Kühlschmierstoffe und Öle. Damit lässt sich prozess, in dem die Späne mit einem Ge-
die Reibung zwischen Werkstück und misch aus Wasser und Tensiden in einem
Werkzeug verringern, zugleich werden mehrstufigen Prozess gewaschen und im
die entstehende Wärme sowie die Späne, Kreislauf anschließend getrocknet werden.
die bei der Bearbeitung anfallen, abge- Auch das Wasser wird gereinigt und wie-
führt. „Die Späne enthalten dieselben Me- derverwendet. Im Vergleich zu bisher ge-
talle wie das Fertigprodukt“, sagt Professor nutzten Verfahren sinken so der Energie-
Rüdiger Deike vom Institut für Technologien einsatz um rund 40 Prozent und die
der Metalle (ITM) und erklärt: „Allerdings CO2-Emissionen um gut zwei Drittel.
werden sie durch die Schmierstoffe und Schwieriger fällt die Entölung beim
Öle verunreinigt, dadurch verlieren sie deut- Abfall aus, der beim Schleifen von Metall
lich an Wert. Dabei sind die Legierungs- entsteht. „Die Partikel sind wegen ihrer
elemente häufig teure wirtschaftsstrategi- kleineren Korngröße schlechter vom Öl
sche Rohstoffe.“ zu trennen“, so Deike. Doch auch hierfür
Fünf Jahre hat das Team um Deike ge- haben die Wissenschaftler bereits ein
meinsam mit dem Institut für Energie- und Verfahren im Technikumsmaßstab ent
Umwelttechnik (IUTA) und mehreren Indus- wickelt, mit dem Mengen von 100 kg pro Hochlegierte Stahlspäne nach der Reinigung,
triepartnern untersucht, wie die Späne Stunde entölt werden können. Das Projekt bereit für die Wiederverwendung im Betrieb
ökonomisch in den Wertstoffkreislauf zu- KOMPASS – Kontinuierliche Öl- und
rückgeführt werden können – im industri- Metallrückgewinnungs-Prozessanlage für forschungsministerium mit 1,7 Millionen
ellen Maßstab. Schlämme und Späne“ wurde vom Bundes- Euro gefördert.
16
17ALUMNI
Ingenieurwissenschaften
Der Hafen als Labor
NRW fördert neues Versuchszentrum mit 1,5 Millionen Euro
von Ulrike Bohnsack
Deutschland ist Logistikweltmeister, und NRW spielt dabei eine führende Rolle. Eine wichtige Drehscheibe ist Duisburg
mit dem weltweit größten Binnenhafen. Damit dies so bleibt, fördert das nordrhein-westfälische Verkehrsministerium ein
neues Versuchszentrum für innovative Hafen- und Umschlagtechnologien: HaFoLa. Es wird von der UDE und dem Ent-
wicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) aufgebaut. Das Land finanziert das Labor, das Ende
kommenden Jahres seine Arbeit aufnehmen soll, mit 1,5 Millionen Euro. Verkehrsminister Hendrik Wüst übergab den
Förderbescheid jetzt persönlich.
NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (Mitte) übergibt auf dem künftigen Gelände des Hafenlabors den Förderbescheid
des Landes. Prof. Dieter Bathen (Vorstandsvorsitzender der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft),
Dr. Rupert Henn und Prof. Dr. Bettar Ould el Moctar vom DST sowie Dekan Prof. Dr. Dieter Schramm
vom Lehrstuhl für Mechatronik freuen sich über den Zuschuss von 1,5 Millionen Euro.
„Die Mobilität der Zukunft ist digital, Leiter Cyril Alias, der auch die Idee dazu es ein Experimentierlabor geben, in dem
vernetzt und automatisiert. Wir wollen, dass hatte. wir untersuchen werden, wie sich die
die Mobilität 4.0 nicht nur in Nordrhein- Alias verantwortet den Bereich Logis- Hafen- und Schifftechnologien weiter digi-
Westfalen erforscht, entwickelt und getes- tik & Verkehr am DST: „Mit dem neuen talisieren lassen“, so Alias.
tet, sondern auch hier produziert und Versuchszentrum werden wir anwendungs- Denn wollen die deutschen Häfen wett-
frühzeitig angewendet wird“, so Wüst. orientierte Forschung zu Binnenschifffahrt bewerbsfähig bleiben, geht kein Weg an
„Deshalb schaffen wir in Duisburg opti- und Hafenlogistik betreiben, um Lösungen der schrittweisen Automatisierung vorbei.
male Bedingungen für die Entwicklung der und Prototypen bis zur technischen Mach- Um maschinelles Lernen, cyberphysische
autonomen Binnenschifffahrt und fördern barkeit zu entwickeln und in das Real Systeme und Industrie-4.0-Anwendungen
das Projekt Hafenforschungslabor.“ umfeld überführen zu können. Das geht zu erproben, arbeitet das DST eng mit
Die Uni und ihr An-Institut stärken mit vom Anlegen und Festmachen des Schiffs dem Lehrstuhl für Mechatronik zusammen.
dem neuen Versuchszentrum an der über den Güterumschlag und den Kran- Eine bewährte Kooperation, setzen die
Oststraße in Duisburg ihre ohnehin schon betrieb bis hin zum Management von beiden Partner doch schon andere Erfolgs-
herausragende Forschung zum vollauto- Hafenressourcen.“ projekte gemeinsam um. Ebenfalls vom
matisierten Schiffsbetrieb und zur Hafen- HaFoLa wird aus einer Halle beste- NRW-Verkehrsministerium gefördert wurde
logistik. Viele Bundes- und Landesmittel hen, in der die Topografie eines Hafens das Versuchs- und Leitungszentrum für die
sind bereits in innovative Testumgebungen abgebildet ist – samt Hafenbecken, Autonome Binnenschifffahrt VeLABi, über
und Projekte geflossen. Dass HaFoLa reali- Kaimauer, Schiffsmodellen, Containern das wir bereits in der letzten Ausgabe be-
siert werden kann, freut vor allem dessen und Umschlaggeräten. „Außerdem wird richtet haben.
Newsletter ALUMNI Ingenieurwissenschaften Vol.19/Nr.04Hochschule
Energy For Future im Schülerlabor
Neues EFRE-zdi-Projekt kann starten
Schülerlabore können für eine bessere MINT-Bildung und mehr Nachwuchs in Naturwissenschaften und Technik eine
Rolle spielen, die über einen reinen Wissenschaftstransfer deutlich hinausgeht. Als außerschulischer Lernort können sie
neue wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in den außerschulischen und schulischen Unterricht transportieren. Vor diesem
Hintergrund wird das Angebot des zdi-Schülerlabors durch das Projekt „Energy For Future“ erweitert, um noch mehr
junge Menschen für die Studiengänge Physik und Ingenieurwissenschaften, speziell NanoEngineering und Energy Science,
und die MINT-Ausbildungsberufe begeistern zu können.
Viele Schülerinnen und Schüler enga-
gieren sich derzeit in der Bewegung „Fridays
For Future“ und gehen auf die Straße, um
dem Klimawandel entgegenzuwirken .
und die 100 % erneuerbare Energiever-
sorgung bis 2035 einzufordern. „Dieses
Engagement kann man nutzen, um die
Teenager für MINT-Berufe zu begeistern,
in denen sie dann selbst aktiv am Klima-
schutz mitarbeiten können“, sagt Dr. Kirsten
Dunkhorst, Leiterin des zdi-Schülerlabors
an der Universität Duisburg-Essen, die das
Projekt eingeworben hat.
Daher werden in dem Projekt neue Kurse
zum Thema „Intelligente Materialien für
Energie und Umwelt“ entwickelt, die neben
den experimentellen Angeboten in Form
von MINT-Boxen auch Partner aus der
Universitätslandschaft und kleine und mitt-
lere Wirtschaftsunternehmen aus der Das zdi-Schülerlabor an der UDE weckt seit Jahren das Interesse junger Menschen an MINT-Fächern
Region einbinden. Das zdi-Schülerlabor
ist in der glücklichen Lage, von der Klimaschutz eine wichtige Rolle. Stadt Die digitale Erweiterung der MINT-
Schwerpunktausrichtung „Nanowissen- direktor Martin Murrack freut sich . Boxen kann zum Beispiel für das Home
schaften“ der UDE zu profitieren. Vertreten über die Zusammenarbeit: „Das Projekt Schooling oder den digitalen Unterricht
wird dies vom Center for Nanointegration zeigt einmal mehr, wie sich die enormen eingesetzt werden, vor allem in Zeiten, in
CENIDE mit seinem interdisziplinären Potenziale der Universität Duisburg-Essen denen ein direkter Besuch des Schülerlabors
Netzwerk aus 70 Wissenschaftlerinnen für beide Seiten gewinnbringend nutzen nicht möglich ist. Sollte die Corona-Krise
und Wissenschaftlern. lassen.“ weiter andauern, können auch die Boxen
Mit Unterstützung der Stadt Duisburg „Durch die aktuelle Lage der Corona- selber flexibel an die Physik- bzw. Chemie-
konnten außerdem die Stadtwerke Duis- Pandemie ist es enorm wichtig, dass kurse ausgeliehen werden, und der Besuch im
burg als Kooperationspartner für dieses MINT-Angebote auch flexibel und digital Schülerlabor kann später nachgeholt werden.
Projekt gewonnen werden. Für einen genutzt werden können, damit man Für das neue Projekt stellt das NRW-
Energiedienstleister, der auch zahlreiche kurzfristig auf extreme Situationen reagie- Wirtschaftsministerium im Rahmen der
eigene Erzeugungsanlagen betreibt, ist ren kann“, sagt Kirsten Dunkhorst. „Daher Landesinitiative zdi Fördermittel in Höhe
die Weiterentwicklung der Erzeugungs- bauen wir zusätzlich eine E-Learning-Platt- von knapp 48.000 Euro aus dem Euro
technologien in der Zukunft von großer form auf, die Hintergrundinformationen, päischen Fonds für Regionale Entwick-
Bedeutung. Neben der Wirtschaftlichkeit Erläuterungen zum Umgang mit den lung (EFRE) zur Verfügung. Kofinanziert
der Erzeugungsprozesse spielen hier auch Boxen, didaktisch aufbereitetes Material wird das Projekt aus Mitteln des Schüler-
Faktoren wie Ressourcenschonung oder und weiterführende Links enthält.“ labors „Einsichten in die Nanowelt“.
18
19Sie können auch lesen