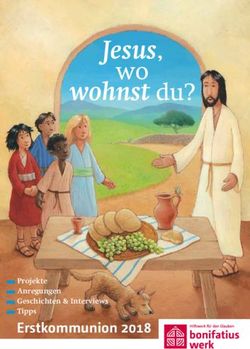Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst! - Matthias Bauer (Mainz)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Matthias Bauer (Mainz)
Liebe Deinen Replikanten wie Dich selbst!
Das Melodram der Mensch-Maschine-Interaktion
in Blade Runner und Solaris.
Das filmische Melodram wird in der Regel als eine Erzählung von schick-
salhafter Begegnung und Verstrickung bestimmt. Seine Wirkung besteht
vor allem darin, seitens der Zuschauer starke Affekte zu erregen, diese
anhand der Figurenkonstellation und ihrer konfliktreichen Dynamik auf die
komplementären Pole von Sympathie und Antipathie zu verteilen, die
Sympathie zur Identifikation zu steigern und dergestalt eine Anteilnahme
am Schicksal der Figuren zu erzeugen, die man als Mitleid im emphati-
schen Sinn des Wortes bezeichnen kann. In dieser Hinsicht knüpft das Me-
lodram einerseits an die Wirkungsästhetik der antiken griechischen Tragö-
die an, von der Aristoteles in seiner POETIK behauptet hat, sie sei auf die
katharsis von eleos und phobos angelegt. Andererseits haftet dem Begriff
des Melodramas insofern etwas Pejoratives an, als die Erregung und Ab-
fuhr dieser Affekte im Unterschied zur antiken Tragödie nicht mehr an das
Schicksal wahrhaft heroischer Gestalten gekoppelt ist, die den Durch-
schnittsmenschen an Mut und Moral übertreffen.1 Vielmehr handelt das
Melodrama gerade von Menschen, denen wir jederzeit im Alltag oder beim
Blick in den Spiegel begegnen könnten, also von unseresgleichen. Daher
ringen die Protagonisten des Melodramas, so sehr sie auch mit ihrem
Schicksal hadern, nicht mehr mit Göttern oder mythischen Gewalten, son-
dern eben mit ihresgleichen respektive mit Dämonen, die eher psychoso-
ziologisch als metaphysisch zu deuten sind. Das Melodrama ist ein säkula-
res Derivat der antiken Tragödie – und diese Genealogie erklärt, warum es
zuweilen als triviale Schwundstufe, als bloß sentimentales Rührstück be-
griffen wird.
1
Vgl. Aristoteles Hinweis: „[...] die Komödie sucht schlechtere, die Tragödie bessere Menschen nachzuahmen,
als sie in der Wirklichkeit vorkommen.“ In: Aristoteles: Poetik. Griechisch / Deutsch. Übersetzt und herausgege-
ben von Manfred Fuhrmann. Stuttgart 1991, S. 9. Dass manche Melodramen – etwa Königin Christina – nicht in
bürgerlichen Kreisen spielen, ist nur scheinbar ein Einwand gegen die These, das Melodram würde von unseres-
gleichen handeln. Denn die Regeln, nach denen auch die Adligen im Melodrama soziopsychologisch wie drama-
turgisch behandelt werden, lassen sich eben aus dem Bürgerlichen Trauerspiel bzw. den Postulaten der Empfind-
samkeit ableiten, die darin übereinstimmen, dass sie ein einheitliches, schichtenübergreifendes Menschenbild
voraussetzen, das sich über die Ständeklausel hinwegsetzt.
1Angesichts dieser Genealogie verwundert es nicht, dass Hermann Kappel-
hoff in seiner Habilitationsschrift MATRIX DER GEFÜHLE (2004) ausführlich auf
das bürgerliche Trauerspiel und den empfindsamen Briefroman eingeht,
die – vom Kino aus betrachtet – zu den literarischen Vorläufern des filmi-
schen Melodrams gehören. Und es ist wohl auch kein Zufall, dass Kappel-
hoff seine Abhandlung ausgerechnet mit einem Verweis auf Steven Spiel-
bergs A.I. – Artificial Intelligence (2001) beginnt. Dessen Hauptfigur, der
kleine David, gespielt von Haley Joel Osment, ist ein künstlicher Mensch,
der beim Zuschauer intensive Gefühle des Mitleids und der Vorsorge
weckt. Kappelhoff macht in diesem Zusammenhang auf drei Gesichts-
punkte aufmerksam, an die ich anknüpfen möchte. Er betont erstens, dass
Spielberg am Beispiel des kleinen, künstlichen David die Geschichte der
Menschwerdung einer Maschine erzählt. Zweitens hebt er den Umstand
hervor, dass die Emotionen, die diese Geschichte beim Zuschauer auslö-
sen, eine komplexe psycho-semiotische Aktivität der Einfühlung erfordern,
die offenbar nicht dadurch beeinträchtigt wird, dass der Bezugsgegens-
tand dieser Aktivität eine Illusion ist. 2 Drittens schließlich kann man aus
Kappelhoffs Darstellung folgern, dass es einen Zusammenhang zwischen
dem Thema der Menschwerdung einer Maschine und der Struktur jenes
Prozesses gibt, in dem der kleine David zu einem ‚inneren Objekt‘ des Zu-
schauers wird.
Kappelhoff meint nämlich, dass die paradigmatische Bedeutung des filmi-
schen Melodrams darauf beruht, dass es die Inszenierung des kinema-
tografischen Bilds selbst zu einem Objekt macht, „das seiner Funktion
nach dem kleinen David aus Spielbergs A.I. gleicht“. 3 So wie diese Figur
muss der Film insgesamt zu einem ‚inneren Objekt‘ des Zuschauers wer-
den, damit sich dieser als empfindsames Subjekt wahrnehmen und begrei-
fen kann. Anders formuliert: Der Gegenstand des filmischen Melodrams
lässt sich nicht auf die dargestellte Handlung reduzieren, die – semiotisch
gesprochen – nur das unmittelbare Objekt der Wahrnehmung ist. Das dy-
namische Objekt der psycho-semiotischen Aktivität, als die man die suk-
zessive Wahrnehmung und Deutung eines Films begreifen muss, ergibt
sich erst aus der reflexiven Einstellung auf die Handlung sowie auf die Art
und Weise ihrer Vermittlung. Dabei aber werden dem Zuschauer seine ei-
2
Hermann Kappelhoff: Matrix der Gefühle. Das Kino, das Melodrama und das Theater der Empfindsamkeit.
Berlin 2004, S. 11f.
3
Kappelhoff, S. 19.
2genen Gefühlsreaktionen auf die dargestellten Figuren und Aktionen zum
Gegenstand der Interpretation.
Mit der begrifflichen Unterscheidung zwischen dem unmittelbaren und
dem dynamischen Objekt der Wahrnehmung und Deutung habe ich eine
Terminologie von Charles Sanders Peirce (1839-1914) verwendet, die
Kappelhoff selbst nicht benutzt, die jedoch hilft, rascher als es ein um-
ständliches Referat seiner Ausführungen erlauben würde, zu ihrem Kern
vorzudringen. Dieser Kern lässt sich mit drei Zitaten einkreisen, die ich
jeweils zurückbinden werde an das Thema der Menschwerdung der Ma-
schine.
Erstes Zitat: „Die melodramatische Darstellung strukturiert den Prozeß
des Zuschauens als Entfaltung einer artifiziellen Innerlichkeit.“ 4 Zugleich
ist diese Entfaltung einer artifiziellen Innerlichkeit aber auch der Prozess,
den im Science Fiction-Genre Maschinen wie Data in der Star Trek-Serie
durchlaufen müssen, um über die äußerliche Ähnlichkeit hinaus als Eben-
bilder des Menschen eingestuft werden zu können.
Zweites Zitat: „Das sympathetische Nachempfinden der Gefühlslage der
Figur ist lediglich das Movens eines Selbstempfindens, das dem Zuschauer
den Raum seiner eigenen Innerlichkeit eröffnet.“ 5 Diese Bemerkung be-
zieht sich auf Lessings Konzept des Mitleids, das sowohl für das Theater
der Empfindsamkeit als auch für das filmische Melodram wegweisend war,
weil es das Moment der Reflexivität in den Prozess des emphatischen
Nachvollzugs der inneren Geschichte einer Figur einbaut, die der Schau-
spieler in Mimus, Gestik, Proxemik und Dialog auszudrücken versucht.
Entscheidend ist, dass dieses Reflexivwerden der Empathie an eine dezi-
diert visuelle Szene gekoppelt ist, nämlich an die Beobachtung dessen,
was sich vor allem im Antlitz, aber auch in den Bewegungen einer drama-
tischen Person zu spiegeln scheint. Es ist dabei gar nicht so leicht und
kaum eindeutig zu sagen, womit dieser Prozess eigentlich beginnt: Mit der
Wahrnehmung der eigenen Affekte, die in die Darstellung projiziert wer-
den, oder mit der Wahrnehmung der Emotionen, die der Darsteller der
Szene vorgibt, und die dann vom Zuschauer introjiziert werden? Mit einem
von Hans J. Wulff klug gewählten Begriff kann man den Bereich, in dem
sich dieses Wechselspiel von Projektion und Introjektion, Fremd- und
4
Kappelhoff, S. 29.
5
Kappelhoff, S. 81.
3Selbstwahrnehmung, Affiziert-Sein und Reflexiv-Werden abspielt, als ein
„empathisches Feld“ begreifen, das gemäß der sich dynamisch entwi-
ckelnden Figurenkonstellation und Konfliktlage zwischen den beiden Polen
der Sympathie und Antipathie aufgespannt wird. 6 Dieses empathische Feld
ist, wie ich hinzufügen möchte, stets ein intermediäres Feld, weil es nur
insofern und solange existiert, als die symbolische bzw. imaginäre Inter-
aktion zwischen dem Geschehen auf der Leinwand und dem Bewusstsein
des Zuschauers stattfindet (was nicht bedeutet, dass seine Halbwertzeit
auf die Spieldauer des Films beschränkt ist): Ausschlaggebend ist, dass
dieses empathische, intermediäre Feld zumindest in der Science Fiction-
Welt auch in der Mensch-Maschine-Interaktion entsteht, wenn zwei emp-
findsame Beobachter aufeinandertreffen: der homo sapiens und sein Re-
plikant.
Drittes Zitat: Als Kappelhoff auf Jean-Jacques Rousseaus Musikalische
Skizze PYGMALION (1762) und Johann Gottfried Herders Essay über die
PLASTIK (1778) zu sprechen kommt, der sich auf Pygmalions menschen-
bildnerischen Traum bezieht, bemerkt er, dass in diesen Texten „die Ge-
burt der melodramatischen Heroine als Galionsfigur der Liebe in Szene
[gesetzt wird]: Ihre Verwandlung markiert die Pole der zeitlichen Achse,
welche die Heroine im Prozeß des Melodramas Mal um Mal durchläuft: Be-
ginnend als Objekt eines begehrlichen Blicks und endend im Bewußtsein
einer sich als Weiblichkeit gewahr werdenden Sensibilität.“ 7 Die Urszene
der melodramatischen Liebe, die zugleich die Urszene des filmischen Me-
lodrams darstellt, lässt also die Heroine einen Prozess der Selbstwahr-
nehmung durchlaufen, an dessen Ende das Bewusstsein für die Entfaltung
genau jener artifiziellen Innerlichkeit steht, auf die auch die Wahrneh-
mung und Deutung dieses Prozesses durch die Zuschauer hinauslaufen.
*
Der Prozess, bei dem die Frau zunächst unmittelbar als Objekt der Begier-
de erscheint und sich dann unter den Augen des Zuschauers in ein emp-
findsames Subjekt verwandelt – was ja bedeutet, dass sie zu einem dy-
namischen Objekt der Selbsterfahrung des Zuschauers als empfindendes
Subjekt wird – bestimmt auch die Schlüsselszene in Ridley Scotts The Bla-
6
Vgl. Hans J. Wulff: Das empathische Feld. In: Film und Psychologie – nach der kognitiven Phase? Hrsg. v. Jan
Sellner und Hans J. Wulff. Marburg 2002, S. 109-122, insbesondere S. 110 und S. 119ff.
7
Kappelhoff, S. 179.
4de Runner (1982, Director’s Cut 1991). Dort folgt Rachael Rosen, ein
Replikant, Rick Deckard, dem Rachael soeben das Leben gerettet hat, in
die Wohnung. Sie will nicht nur wissen, ob er sie trotzdem verfolgen und
auftragsgemäß auslöschen wird. Sie möchte auch erfahren, ob er selbst
sich schon einmal dem Test unterzogen hat, der echte Menschen von ih-
ren maschinellen Imitationen (Replikanten) unterscheidet. Deckard bleibt
ihr die Antwort schuldig. Erschöpft liegt er auf einem Sofa, während sich
Rachael an ein Klavier setzt und eine Melodie anstimmt, die ihr spontan in
den Sinn zu kommen scheint. Anschließend löst sie ihr streng frisiertes
Haar, so dass es ihr in fülligen Locken auf die Schulten fällt. Deckard, der
sich inzwischen zu ihr gesetzt hat, beugt sich zu Rachael herüber und
küsst sie auf die Wange. Als Rachael daraufhin, kopfscheu geworden, De-
ckards Wohnung zu verlassen sucht, versperrt er ihr den Ausgang, stößt
sie zurück und nötigt ihr einen Kuss ab. Er verlangt, dass sie nach ihm
verlangt und die Zärtlichkeiten erwidert. Zögernd, ja erschrocken, dann
aber doch hingerissen und stürmisch wirft sich Rachael Rick an den Hals.
Bedenkt man, dass die von Sean Young gespielte Frau im Rahmen der fil-
mischen Fiktion ein Replikant, ein weiblich gestylter Roboter ist, werden
die Zuschauer in dieser Szene Zeugen einer Menschwerdung durch den
Akt der Liebe, wobei das Überwältigtwerden durch die stürmischen Gefüh-
le, die Rachael und Rick für einander empfinden, voraussetzt, dass sie sich
selbst als empfindsame Subjekte verstehen und fühlen. Eben deswegen
können wir ihnen als Zuschauer weder unsere Sympathie noch unsere
Fürsorge verweigern. Wir nehmen Anteil an ihrem Schicksal, sind also
vom melodramatischen Gang der Handlung in einer zutiefst emotionalen
Weise betroffen.
Das aber ist vor allem ein Effekt der Art und Weise, in der Ridley Scott in
Rachaels Fall die Verwandlung, die Menschwerdung der Maschine insze-
niert hat: „Von Einstellung zu Einstellung“, so hat es Thomas Koebner
formuliert, „verschwindet der puppen- und maskenhafte glatte Schimmer
ihres unbewegten Gesichts und weicht einem natürlich wirkenden Teint.“ 8
Dem komplexen Zusammenwirken von Mienenspiel und Beleuchtung,
Farbdramaturgie und Gesichtsausdruck, Frisurenwechsel und Makeup
können die Zuschauer entnehmen, wie Sehnsucht und Angst, Selbstbe-
wusstsein und Unsicherheit, Verlangen und Fluchtimpulse entstehen. Ra-
8
Thomas Koebner: Wovon träumen die Geschöpfe des Prometheus. Künstliche Menschen im Film. In: Dersel-
be: Halbnah. Schriften zum Film. Zweite Folge. St. Augustin 1999, S. 58-74; Zitat S. 70.
5chael weiß, dass ihr die Erinnerungen einer fremden Person implantiert
worden sind, doch nun, bei der Erfahrung, Klavier spielen zu können, ent-
deckt sie ihre Fähigkeit, unter Verwendung dieser Reminiszenzen echte
Gefühle zum Ausdruck bringen und wecken zu können. Was in diesem Au-
genblick, da Rachael aus dem Bannkreis ihrer Programmierung heraus
tritt, mit Deckard geschieht, hat Fabienne Liptay in einer luziden Bespre-
chung des Films als Wendepunkt der Geschichte markiert. Deckard, so
schreibt sie, „erkennt, dass alles so wahr ist, wie man es empfindet.
Schließlich ist es dann auch unbedeutend, ob Rach[a]els Kindheitserinne-
rungen an Klavierstunden ihre eigenen sind oder die einer anderen Per-
son.“ 9
Worauf es ankommt, ist nun zum einen die Erfahrung, dass die Affekten-
lehre des Kinos nicht nur eine kognitive und ethische Bedeutung, sondern
in den Filmen, um die es hier geht, auch eine anthropologische Pointe hat.
Zum anderen gilt es, die spezifische Funktion herauszuarbeiten, die dem
Melodrama in seiner Rolle als sub plot zukommt.
*
Dass zahlreiche Filme, die man einem anderen Genre zurechnet – etwa
dem Western oder dem film noir – melodramatische Züge aufweisen, ist
gewiss keine neue Erkenntnis. Man muss nur an Raoul Walsh Pursued von
1947 oder Roman Polanskys Chinatown von 1974 denken, um zu erken-
nen, wie gerne das Melodram als sub plot genutzt wird, um die Figuren
und Konflikte, die auf der Ebene des action-reichen main plots nicht ver-
tieft werden können, zu profilieren. Die schicksalhafte, vom Scheitern be-
drohte Liebe erscheint dabei vor allem als ein Medium der Figuren- und
Konfliktentwicklung, damit aber auch der Themenentfaltung. Die spezifi-
sche Leistung des filmischen Melodrams – ob nun als sub plot oder main
plot – besteht somit, abstrakt formuliert, darin, Kognition und Emotion in
ein Verhältnis der Ko-Evolution zu versetzen. Konkret zeigt sich das an der
allmählichen Bildung dessen, was man Problembewusstsein nennt. Ohne
die emotionale Teilnahme am Schicksal der Figuren würde man als Zu-
schauer nicht so leicht eine analytische Einstellung zu den Konflikten ent-
wickeln, in die sie verstrickt sind. Ohne diese analytische Einstellung wie-
derum, bei der es immer auch um die Antizipation oder Reflexion kontin-
9
Fabienne Liptay: Der Blade Runner. In: Filmgenres Science Fiction, hrsg. v. Thomas Koebner. Stuttgart 2003,
S. 376-387; Zitat S. 384.
6genter Konfliktverläufe geht, würde der kognitive Mehrwert der Inszenie-
rung erheblich geschmälert. Man muss daher das filmische Melodram als
Medium der Erkenntnisvermittlung im Modus der Gefühlserregung verste-
hen, hat damit aber noch nicht sein Spezifikum erfasst. Denn um Erkennt-
nisvermittlung im Modus der Gefühlserregung geht es ja fast immer im
Kino und überhaupt in allen dramatisch erzählten Geschichten (was wie-
derum erklärt, warum das filmische Melodram als Paradigma für die Wir-
kungsästhetik des Kinos gilt).
Um nun der spezifischen Pointe der Themenentfaltung in The Blade Run-
ner auf die Spur zu kommen und zu begreifen, wie der Vorgang der
Menschwerdung einer Maschine mit der psycho-semiotischen Aktivität des
Zuschauers und der Inszenierung einer artifiziellen Innerlichkeit zusam-
menhängt, empfiehlt es sich, Scotts Film mit seiner Textvorlage zu ver-
gleichen:
In seinem 1968 unter dem Titel DO ANDROIDS DREAM OF ELECTRIC SHEEP?
erstmals veröffentlichten Roman stellt Philip K. Dick (1928-1982) zwar das
auch für Ridley Scott entscheidende Problem der Un-Unterscheidbarkeit
von Mensch und Maschine, von homo sapiens und Replikant heraus, nutzt
aber nur in sehr begrenztem Maße die Möglichkeiten des Melodrams, um
dieses Problem zu veranschaulichen. Insbesondere die Figur der Rachael
Rosen erfüllt im Roman eine ganz andere Funktion als im Film. Bei Dick
setzt sie ihre erotische Verführungskraft ebenso zielstrebig wie kalt-
schnäuzig lediglich dazu ein, Replikantenjäger wie Rick Deckard in ihrer
beruflichen Identität zu verunsichern. Das mag auch damit zusammen-
hängen, dass Deckard bei Dick mit Iran verheiratet ist, die ihn gleich zu
Beginn der Geschichte als „Mörder“ apostrophiert, 10 weil er keinerlei Mit-
leid mit den Androiden empfindet, die sie liebevoll als „Andys“ bezeichnet.
Der Erzähler kommentiert diese Gefühllosigkeit einige Seiten später mit
den Worten:
„Für Rick Deckard war ein entsprungener Androide, der seinen Herrn getö-
tet hatte, der über eine größere Intelligenz als viele menschliche Wesen
verfügte, der keine Tierliebe zeigte, der nicht die Fähigkeit besaß, empa-
10
Vgl. Philip K. Dick: Blade Runner. Roman. Überarbeitete Neuausgabe. Deutsche Übersetzung von Norbert
Wölfl, durchgesehen und ergänzt von Jacqueline Dougoud 2. Auflage. München 2002, S. 9.
7thische Freude für das Glück einer anderen Lebensform oder Trauer bei
deren Unglück zu empfinden, die Verkörperung des Mörders.“ 11
Zunächst scheint die Sache also eindeutig klar und Deckard in seiner Rolle
als eiskalter Roboter-Terminator moralisch absolut gerechtfertigt zu sein.
Verunsichert in seiner Selbstgerechtigkeit wird Deckard unter anderem im
Gespräch mit Luba Luft, die er verdächtigt, ein Android zu sein. Als sie
sein Misstrauen mit dem Angebot zur Mitarbeit zu zerstreuen sucht –
„Würde ich Ihnen meine Hilfe anbieten, wenn ich selbst ein Androide wä-
re?“ – kontert Deckard: „Einem Androiden ist es gleichgültig, was mit ei-
nem anderen Androiden geschieht.“ Woraufhin Luba Luft sofort bemerkt:
„Dann müssen Sie ein Androide sein.“ Dass diese Bemerkung Deckard
12
„wie ein Faustschlag“ trifft, hebt seine Verunsicherung und die der Leser
keineswegs auf. Im Gegenteil. Die entscheidende Frage, die der Roman
fortan ventiliert, die Frage nämlich, ob womöglich auch Androiden eine
Seele haben, droht mit Deckards Selbstgewissheit auch die anthropologi-
sche Differenz von Mensch und Maschine aufzuheben. Einerseits gilt:
Wenn die Replikanten Empfindungen hegen, muss man auch Mitleid mit
ihnen haben und sie wie Menschen behandeln. In diesem Fall verbietet es
sich, sie erbarmungslos abzuschlachten. Andererseits gilt dann aber auch:
Dass ich selbst Gefühle habe, bedeutet keineswegs, dass ich kein Roboter
oder Automat bin. Dieses Dilemma wird in der für Deckard schicksalhaften
Begegnung mit Rachael Rosen verschärft. Im Roman liest sich diese Szene
– anders als im Film – so:
„Wie mag es wohl sein, einen Androiden zu küssen? fragte er sich. Er
beugte sich ein wenig vor und küßte ihre trockenen Lippen. Es folgte keine
Reaktion. Rachael blieb gleichgültig, als berühre sie ein Kuß gar nicht. An-
13
ders bei ihm. Doch vielleicht war das bloß Wunschdenken.“
In Dicks Version nimmt das Dilemma der Un-Unterscheidbarkeit also fol-
gende Form an: Entweder empfinden Maschinen im Unterschied zu Men-
schen keine echten Gefühle oder aber das, was Menschen für echte Ge-
fühle halten, sind lediglich Simulationen, wie sie auch jede entsprechend
programmierte Maschine erzeugen kann. Wenn also in der Liebe der eine
Mensch für den anderen zur Projektionsfläche wird und das erotische
11
Dick, S. 41.
12
Vgl. Dick, S. 116.
13
Dick, S. 208. Im Film erscheint Rachael von Deckards Zärtlichkeiten zunächst überfordert zu sein und zeigt
daher eine Fluchtreaktion. Sie ist dort also keineswegs gleichgültig.
8Feedback nichts anderes als die Umkehr der Projektionsrichtung ist, ver-
liert selbst das urromantische Erlebnis der wechselseitigen interpersonel-
len Rührung seine intrapersonelle Funktion als Beglaubigung der eigenen
Authentizität. Im Roman wird dieser grundlegende Zweifel anhand der
Gegenüberstellung zwischen Buster Freundlich, einem Medienstar, und
Wilbur Mercer, dem Propheten der Empathie, dargestellt. Buster ist selbst
ein Androide, der den Mercerismus im Fernsehen als Schwindel und
Selbstbetrug entlarvt. Dann aber taucht Mercer im entscheidenden Mo-
ment der Geschichte wider Erwarten auf, um Deckard vor dem gefähr-
lichsten aller Androiden zu warnen. Dieser Androide ist nicht, wie im Film,
Roy Batty, sondern Pris Stratton, weil sie Rachael Rosen zum Verwechseln
ähnlich sieht. Tatsächlich stammen beide Andreiden aus der gleichen Bau-
reihe und wurden ursprünglich als Kampfroboter entwickelt. Als Nebenef-
fekt ihrer Umprogrammierung zu Domestiken der Weltraum-Kolonisation
ist ihre Disposition zur Entwicklung von Gefühlen entstanden. Damit diese
emergente Eigenschaft nicht außer Kontrolle gerät, hat man die Lebens-
dauer der Replikanten auf vier Jahre terminiert.
Deckard gelingt es, Pris auszuschalten, nachdem sie sich in einen Kampf-
roboter zurückverwandelt hat. Rachael wiederum rächt sich im Roman an
Rick Deckard, der sie zwar nicht erschossen, aber auch nicht als gleichbe-
rechtigt akzeptiert hat, indem sie das Kostbarste, was er und seine Frau
besitzen, ein Haustier, tötet. Die Eifersucht des Androiden auf das Tier re-
spektive auf das, was es für Deckard und seine Frau bedeutet, sowie die
Gefühllosigkeit, mit der das Tier exekutiert wird, unterstreichen bei Dick
die Demarkationslinie, die zwischen dem Blade Runner auf der einen Seite
und Mensch-Maschinen wie Pris Stratton oder Rachael Rosen auf der an-
deren Seite wohl nicht geradlinig, aber doch noch immer kenntlich ver-
läuft. Zwar haben auch die Androiden Empfindungen und Wünsche, Ängs-
te und Träume, sie handeln jedoch ohne Rücksicht auf die Gefühle ande-
rer, während sich wahres Menschsein an der Reflexivität zeigt, dank der
nicht nur die eigenen, sondern auch die Empfindungen der anderen das
Handlungskalkül bestimmen. Vielleicht – diese Perspektive eröffnet der
Roman – ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Androiden auch zu
dieser Reflexivität in der Lage sind; einstweilen gilt jedoch, dass sie mit
dem christlichen Gebot, ‚Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst‘, rational
und emotional nichts anzufangen wissen. Um es mit Blick auf Kappelhoffs
Konzept des Melodramas zu sagen: Ihre artifizielle Innerlichkeit wird nicht
9bis zu dem Punkt entfaltet, an dem sie im Sinne einer ethischen Maxime
das eigene, soziale Handeln steuert.
Der Film The Blade Runner geht in dieser Hinsicht erheblich weiter. Das
wird vor allem deutlich, wenn man sich das Melodrama der Liebe ansieht,
in das Rick und Rachael hier verstrickt sind. Voraussetzung dafür ist zum
einen, dass Deckard im Film nicht verheiratet ist, sowie zum anderen,
dass Rachael den Blade Runner keineswegs – wie im Roman – nur deswe-
gen verführt, weil sie seinen Killerinstinkt lahmlegen möchte. Eher schon
wird sie in der erwähnten Szene auch im erotischen Sinne gejagt und in
die Enge getrieben, bevor sie sich schließlich ergibt und hingibt. Es ist also
das interaktive, zum melodramatischen Klischee verfestigte Schema der
Eroberung der Frau durch einen Mann, der, von ihren Reizen überwältigt,
initiativ, ja aggressiv und handgreiflich wird, über das in der Schlüsselsze-
ne des Films eine von Reflexivität und Solidarität bestimmte Beziehung
angebahnt wird, die schließlich dadurch stabilisiert wird, dass Deckard zu
dem Schluss gelangt, selbst ein Androide zu sein.
Wenn Deckard daher am Ende der Maxime, ‚Liebe Deinen Nächsten wie
Dich selbst‘, folgt, so bedeutet dies nicht nur, wie im Roman, dass er Ra-
chael im biblischen Sinn als das erkennt, was sie ist, indem er mit ihr
schläft, sondern dass er durch einen Akt der Selbsterkenntnis dahin ge-
langt ist, die Wahrhaftigkeit ihrer und seiner eigenen Empfindungen zu
ratifizieren, indem er ihre Art der Existenz vollumfänglich teilt. Obwohl
selbst ein Replikant, ist es ihm nicht mehr egal, was mit einem anderen
Androiden geschieht. Das aber heißt: Deckard, der vermutlich selbst
schon auf der Abschussliste steht, transzendiert seine Programmierung
und bildet mit Rachael eine Schicksalsgemeinschaft; gemeinsam mit sei-
ner Geliebten wird er entweder überleben oder untergehen. Und genau
darin, dass er seine Liebe über den eigenen Tod stellt, erweist sich De-
ckard in Ridley Scotts Director‘s Cut als durch und durch melodramati-
scher – sprich: humaner – Held. So wie in der Schlusssequenz des Films
aus dem ehemaligen Kampfroboter Roy Batty eine Christus-Figur wird, die
Mitleid vor Recht ergehen lässt, Deckards Leben schont und die Frie-
denstaube in die Freiheit entlässt – auch darin unterscheidet sich der Film
nachhaltig von Dicks Roman –, führt der melodramatische sub plot Ra-
chael und Rick an den Punkt, an dem die Zuschauer den beiden Replikan-
ten unmöglich ihre Empathie verweigern können. Obwohl dem alle Zei-
chen entgegenstehen, hoffen die Zuschauer, dass diese beiden liebens-
10werten Personen dem Schicksal der anderen, weniger sympathischen „An-
dys“ entgehen möchten. 14
Auffällig ist zudem, wie The Blade Runner den melodramatischen sub plot
mit dem politischen Szenario des main plot verbindet. Wenn sich Rachael
in Deckards Wohnung an das Klavier setzt und einige Töne anschlägt, wird
das Haupt-Drama der Replikantenjagd so offensichtlich vom Melos unter-
brochen, dass man darin beinahe schon eine reflexive Bezugnahme auf
das Genre sehen darf. Ähnlich zart wie die Töne auf dem Klavier, die deut-
lich der Härte der Auseinandersetzungen kontrastieren, in die Deckard von
Berufs wegen verwickelt ist, bahnt sich ein Moment der nicht nur eroti-
schen Ekstase an. Tatsächlich treten Rick und Rachael, indem sie sich in-
einander verlieben – also noch bevor Deckard die Entdeckung macht,
selbst ein Replikant zu sein – aus dem moralischen und politischen Zu-
sammenhang der Gesellschaft heraus, die Androiden das Recht verwehrt,
zu lieben und geliebt zu werden. Entscheidend ist, dass dabei anders als
im Roman keine der beiden Film-Figuren berechnend oder kaltblütig er-
scheint. Eher werden sie selbst von der Intensität der Gefühle überwältigt,
als dass man ihnen als Zuschauer (im Rahmen der Fiktion) unterstellen
könnte, Empfindungen zu simulieren.
Das ist umso bemerkenswerter, als die allgegenwärtige Mediensimulation
fest in die Szenografie der Mega-City eingebaut ist, die der Film in düste-
ren Bildern vor Augen führt. Das offene Ende der Geschichte, bei der die
äußere Bedrohung der Protagonisten aufrecht erhalten bleibt, delegiert die
Frage nach dem Unterschied von Mensch und Maschine dank der melo-
dramatischen Grundierung der Figuren- und Konfliktentwicklung wesent-
lich nachhaltiger an das Publikum als dies in der Romanvorlage geschieht.
14
Wobei man sagen muss, dass die beiden Kontrast- und Komplementärfiguren Pris Stratton und Roy Batty, die
ebenfalls ein Liebespaar bilden, keine unsympathischen Figuren sind. Eher schon antizipiert ihr Schicksal das
von Rachael und Rick. Die Art und Weise, in der die beiden Figurenpaare aufeinander bezogen werden, ist zu-
dem typisch für eine melodramatische Inszenierung und verweist auf das Moment der Kontingenz: Was diesen
passiert, könnte auch jenen zugestoßen sein; jedes Schicksal steht im Melodram vor dem Hintergrund kontingen-
ter Entwicklungsmöglichkeiten. Gerade das Bewusstsein für diese Kontingenz aber verstärkt die Affektivität der
Rezeption und damit den Eindruck, anders als in der Tragödie, keinem Schicksal beizuwohnen, das von vornher-
ein unabänderlich wäre. Insofern erscheint dass Melodramatische als ein eminent senti-mentaler Modus der
Darstellung: Er setzt mentalitätsgeschichtlich das moderne Wissen um die Möglichkeit voraus, das eigene
Schicksal gestalten zu können, vermittelt jedoch das deutliche Gefühl, dass diese Möglichkeit ausgeschlagen
werden oder nicht genutzt werden kann, weil dies entweder die sozialen und politischen Verhältnisse oder aber
die psychische Verfassung der beteiligten Personen nicht erlauben. Als Grund der Ausweglosigkeit erscheint im
Melodrama, so gesehen, nicht, wie in der (antiken) Schicksalstragödie, das von den Göttern beschlossene Ver-
hängnis, sondern die von den Menschen selbst verschuldete Unvereinbarkeit zwischen der Unbedingtheit des
(eigenen) Gefühls und den Lebensumständen, die scheinbar vernünftig geordnet sind und doch – im Einzelfall –
nicht das Glück, sondern das Unglück befördern.
11Das wird noch deutlicher, wenn man The Blade Runner auf die Tradition
der Darstellung künstlicher Menschen im Film und in der Literatur bezieht.
Nicht nur in Fritz Langs Metropolis (1927), auch in den unzähligen Versio-
nen des Frankenstein-Mythos, aber auch in dem zu Unrecht häufig igno-
rierten Roman DIE EVA DER ZUKUNFT (1886) von Jean-Marie Villiers de l’Isle
Adam wird die Andreide entweder, wie bei Mary Shelley, gar nicht erst
zum Leben erweckt oder so bald als möglich vernichtet, weil der prome-
thische Mann in ihr nur eine gefährliche Infragestellung seiner schöpferi-
schen Potenz und Autonomie sehen kann. Echte Gefühle zu haben, wird
der künstlichen Frau ebenso verwehrt wie das Anrecht darauf, als Mensch
behandelt zu werden. In James Whales The Bride of Frankenstein (1935)
etwa kann das arme Geschöpf im Gegensatz zum männlichen Monster,
das über einen vergleichsweise elaborierten Code verfügt, lediglich spitze,
grelle Schreckensschreie ausstoßen, bevor es, kaum das es existiert, auch
schon wieder annihiliert wird.
*
Gerade im Vergleich mit den Geschichten von künstlichen Menschen, die
im Kino vor The Blade Runner erzählt worden sind, aber auch im Vergleich
mit der Romanvorlage, zeigt sich somit, dass Ridley Scott über die Variati-
on des Themas hinaus zu einer innovativen Sicht der Dinge gelangt ist.
Hervorzuheben ist dabei zum einen, dass er zum ersten Mal in der Litera-
tur- und Filmgeschichte weibliche künstliche Menschen präsentiert, die
überleben und deren Kampf um Anerkennung nicht diskreditiert wird. Zum
anderen scheint der eigentliche Clou von Scotts Romanverfilmung gerade
darin zu bestehen, dass ein Replikant, der sich wie Roy Batty, Rachael Ro-
sen oder Rick Deckard verhält, ziemlich genau dem Bild entspricht, das
Albert Camus vom „Mensch in der Revolte“ gezeichnet hat:
„Was ist der Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der nein sagt. [...] Er
schritt unter der Peitsche des Herrn. Nun bietet er ihm die Stirn“, 15 heißt
es bei Camus. Zwei wichtige Bemerkungen ergänzen dieses Bild vom Men-
schen in der Revolte. Erstens verweist Camus auf die deontische bzw. e-
thische Dimension der Revolte: „Scheinbar negativ, da sie nichts erschafft,
15
Albert Camus: Der Mensch in der Revolte. Essays. Reinbek bei Hamburg 1988 [Französische Erstausgabe
1951], S. 14. Wenn Roy Batty im Film seinem ‚Vater‘, dem Roboterhersteller Tyrell, die Stirn bietet und ver-
langt, die Termination seiner Existenz aufzuheben, und diesem dann, nachdem er sich von der technischen Un-
möglichkeit überzeugen musste, dass dieser Wunsch erfüllt werden könnte, die Augen eindrückt, reagiert er
ähnlich wie Frankensteins Monster, nachdem ihm sein Schöpfer das Recht auf ein Mit-Geschöpf verwehrt hat.
12ist die Revolte dennoch zutiefst positiv, da sie offenbart, was im Menschen
allezeit zu verteidigen ist.“ 16 Dass es in The Blade Runner Replikanten
sind, an deren Revolte sich diese Dimension offenbart, spricht ein deutli-
ches Urteil über die Humanität der Gesellschaft, die sie zu lebenslängli-
chen Knechten bestimmt hat. Zweitens erklärt Camus: „daß die Revolte
nicht allein und notwendigerweise im Unterdrückten ausbricht, sondern
daß sie beim bloßen Anblick der Unterdrückung eines anderen ausbrechen
kann. In diesem Fall kommt es also zur Identifikation mit dem anderen.“ 17
Es ist nun aber genau diese Identifikation, die Rachael erst mit Deckard
und Rick dann seinerseits mit ihr vollzieht, und die sich auch in der sym-
bolischen bzw. imaginären Interaktion zwischen dem melodramatischen
Geschehen auf der Leinwand und dem Bewusstsein des Zuschauers – also
dank der psycho-semiotischen Aktivität im empathischen Feld des Kinos –
ereignet. Dass es bei dieser Art der Identifikation in einem sehr spezifi-
schen Sinne tatsächlich um die Herstellung eines ‚inneren Objekts‘ geht,
kann man sogar neurobiologisch begründen, wenn man sich auf die so
genannten ‚Spiegelneuronen‘ bezieht, die Ende des letzten Jahrhunderts
von Giacomo Rizzolatti und seinem Team am Physiologischen Institut der
Universität Parma entdeckt wurden. Es handelt sich dabei um Nervenzel-
len bzw. Zellverbände, die nicht nur aktiv werden, wenn es im motori-
schen und prämotorischen Cortex darum geht, Handlungen des eigenen
Körpers oder Sprechakte einzuleiten. Vielmehr feuern die ‚Spiegelneuro-
nen‘ auch dann, wenn die Bewegungen und – das ist hier entscheidend –
die Gefühlsregungen anderer Menschen beobachtet werden. Kurzum: „Wir
erleben, was andere fühlen, in Form einer spontanen inneren Simulati-
on“, 18 die als Resonanzmuster der neuronalen Erregung aufgefasst wer-
den kann. Interessant ist nun folgendes:
„Das Resonanzmuster, das Nahestehende in uns hervorrufen, wird inner-
halb kurzer Zeit zu einer festen Installation. Es entsteht eine dynamische
innere Abbildung dieses Menschen“, 19 also das, was Kappelhoff als ‚inne-
res Objekt‘ bezeichnet hat. „Über eine solche innere Repräsentation einer
nahe stehenden Person zu verfügen heißt, so etwas wie einen weiteren
16
Camus, S. 19.
17
Camus, S. 16f.
18
Joachim Bauer: Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneu-
rone. 8. Auflage, Hamburg 2006, S. 145.
19
Bauer, S. 86.
13Menschen in sich zu haben.“ 20 Das aber bedeutet nicht nur, dass das Ge-
hirn zur Wahrnehmung und inneren Abbildung anderer Menschen diesel-
ben Programme einsetzt, mit denen es auch ein Bild von sich selbst mo-
delliert. 21 Es bedeutet darüber hinaus, dass die Wahrnehmung und Reprä-
sentation einer menschlichen Gestalt auf der Leinwand tatsächlich insofern
der Herstellung eines Replikanten gleicht, als es dabei um die Identifikati-
on mit dem dynamischen Objekt geht, das im empathischen Feld entsteht.
Die spontanen Simulationen der Gefühlsregungen, die ein Schauspieler auf
der Leinwand ausdrückt, werden im Rahmen der psycho-semiotischen Ak-
tivität, die mit der Aktivität der Spiegelneuronen beginnt, zu einer ver-
gleichsweise stabilen Repräsentation entwickelt, in der sich zwei Bilder
von Personen ineinander spiegeln: das der eigenen Person und das einer
Bezugsperson. In diesem Sinne ist der Replikant eine Allegorie der neuro-
nalen Replikationen, die Menschen im Prozess der Identifikation mit einem
signifikanten Anderen – sei es nun in der Realität oder in der Fiktion – er-
zeugen. Dabei ist die Simulation klar und deutlich von der Verhaltensimi-
tation zu unterscheiden: Die ‚Spiegelneuronen‘ feuern, doch die eigene
Bewegung wird inhibitiert. Gleichwohl findet in der Imagination offenbar
statt, was George Herbert Mead auf die Formel „to take the role of the o-
ther“ gebracht hat. 22 Der sentimentale Vorgang der Identifikation einer
Zuschauerin oder eines Zuschauers mit Figuren wie Rachael Rosen oder
Rick Deckard ist also kein Indiz von Naivität, sondern genau das, was man
als die basale Interaktion bzw. als den immer wieder von neuem erforder-
lichen Akt der Konstitution einer humanen Gesellschaft bezeichnen könn-
te. Indem die Schlüsselszene von The Blade Runner diesen Vorgang mo-
delliert und an das Bild vom Menschen in der Revolte koppelt, erhält der
Film eine ethische Dimension, die über das empathische Feld hinausweist,
das sich in seiner Wahrnehmung und Deutung bildet. Daher kann man mit
Thomas Koebner über Scotts Film sagen:
„Er definiert Menschlichkeit nicht traditionalistisch, etwa durch biologische
Er[b]folge, Stammbaum, Familie – dies scheinen nur veraltete Vehikel
bürgerlicher Selbstfindung aus verflossenen Tagen zu sein. Er definiert sie
20
Bauer, S. 86.
21
Vgl. Bauer, S. 165f.
22
Vgl. George Herbert Mead: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Aus dem
Amerikanischen von Ulf Pacher. Frankfurt am Main 1993. Dort heißt es auf S. 300 über die soziale Person:
„Indem sie diese Rolle der anderen übernimmt, kann sie sich auf sich selbst besinnen und so ihren eigenen
Kommunikationsprozeß lenken. Diese Übernahme der Rolle anderer [...] ist nicht nur zeitweilig von Bedeutung
[...], sondern für die Entwicklung der kooperativen Gesellschaft wichtig.“ Siehe auch den Abschnitt ‚Über das
Wesen des Mitgefühls‘, S. 346-350.
14vielmehr durch Abweichung vom vorgegebenen Handlungsauftrag, durch
Innehalten im Schmerz, durch das Ablegen des starren Schutzpanzers,
das Weichwerden, durch Widerstand gegen Fremdbestimmung, Wider-
stand, der allmählich oder spontan aus fürsorglichen Gefühlen entsteht,
auch durch den Verrat an der Pflicht aus Liebe, den Rach[a]el und De-
ckard begehen, indem sie sich gegenseitig beschirmen vor anderen Rep-
likanten und sich gegen die angeblichen Gebote vergehen, einander mit
Gewalt zu begegnen und sich auszulöschen.“ 23
Dass die Revolte von Pris und Roy im Film scheitert, und es wahrscheinlich
auch Rick und Rachael nicht gelingen wird, dem Schicksal der Replikanten
zu entkommen, ist die eine Seite der Geschichte: „Menschlichkeit – das
scheint das Resümé des Films zu sein – vereinzelt, gefährdet das Subjekt
und bestimmt es offenbar zu frühem Untergang. So schließt die vom Re-
gisseur bevorzugte Version (der sog. Director’s Cut) mit einem offenen
Ende, das nichts Gutes verheißt.“ 24
Die andere Seite kommt in den Blick, wenn man sich noch einmal vor Au-
gen führt, dass der Replikant bei Ridley Scott die Rolle des signifikanten
Anderen übernimmt, wie sie George Herbert Mead in seiner Theorie des
Symbolischen Interaktionismus beschrieben hat: die Rolle einer Bezugs-
person, an deren Autonomie sich reflexiv nicht nur das eigene Ich-
Bewusstsein, sondern auch dessen soziale bzw. ethische Dimension aus-
bildet. In der primitiven Fassung lautet die Lektion, die sich aus der Be-
gegnung mit dem signifikanten Anderen ergibt: Was Du nicht willst, das
man Dir tut, das füg‘ auch keinem andern zu. In dem empathischen Feld
der symbolischen, melodramatisch inszenierten Interaktion von Film und
Zuschauer wird daraus die Maxime: Liebe Deinen Replikanten wie Dich
selbst.
*
Man kann diese emphatische Steigerung mühelos an die Tradition der
neuzeitlichen Philosophie zurück binden. Anknüpfungspunkt ist dabei die
Sinnverschiebung, die das Hauptmotiv der Handlung, die Detektion der
Replikanten, im Verlauf der Geschichte erfährt: Zu Beginn geht es für De-
ckard einfach nur darum, die Replikanten als die ganz Anderen des Men-
23
Koebner, Wovon träumen die Geschöpfe des Prometheus, S. 72.
24
Koebner, Wovon träumen die Geschöpfe des Prometheus, S. 72.
15schen zu identifizieren und ‚abzuschalten‘; am Ende geht es für ihn und
die Zuschauer darum, sich mit den vermeintlich Anderen zu identifizieren
und gemeinsam der Vernichtung zu entkommen. Wenn Deckard im Direc-
tor’s Cut beim Anblick des Origamo-Einhorns vor seiner Wohnung reali-
siert, dass man seine Träume kennt und ihn daher wie jeden anderen
Replikanten, der nur über implantierte Erinnerungen verfügt, behandeln
wird, hat der Zuschauer mit ihm in der Vorstellung, also psycho-
semiotisch, die Schwelle überschritten, die den Menschen von der Maschi-
ne trennt. Indem der Film die Anthropologie, derzufolge nur Menschen,
aber keine Maschinen Empathie empfinden, dekonstruiert, als Ideologie
entlarvt und invertiert, gewinnt er dem melodramatischen Geschehen so-
mit eine philosophische Pointe ab. Dass dies im Rahmen einer Science Fic-
tion geschieht, ist kein Einwand, zumal wenn man bedenkt, dass auch die
Begründung dieser Anthropologie nur im Rahmen eines Gedankenexperi-
ments gelang, das deutlich fiktionale Züge trägt.
Nachzulesen ist dieses Gedankenexperiment bei René Descartes (1596-
1650), in den MEDITATIONEN ÜBER DIE GRUNDLAGEN DER PHILOSOPHIE aus dem
Jahre 1629. In seinem 1637 erstmals veröffentlichten DISCOURS DE LA
MÉTHODE rekapituliert Descartes das Gedankenexperiment aus den MEDITA-
TIONEN noch einmal und schreibt rückblickend: „Endlich erwog ich, daß uns
genau die gleichen Vorstellungen, die wir im Wachen haben, auch im
Schlafe kommen können, ohne daß in diesem Fall eine davon wahr wäre,
und entschloß mich daher zu der Fiktion (Kursivierung MB), daß nichts,
was mir jemals in den Kopf gekommen, wahrer wäre als die Trugbilder
meiner Träume.“ 25 Nur innerhalb dieses Verständnisrahmens kann Des-
cartes an seine Behauptung aus den MEDITATIONEN anknüpfen: „Körper,
Gestalt, Ausdehnung, Bewegung und Ort sind nichts als Chimären“. 26 Und
allein unter dieser offenbar kontrafaktischen Voraussetzung gelingt es
ihm, sein Gedankenexperiment auf das berühmte „cogito ergo sum“ zuzu-
spitzen: „Alsbald aber fiel mir auf, daß, während ich auf diese Weise zu
denken versuchte, alles sei falsch, doch notwendig ich, der es dachte, et-
was sei. Und indem ich erkannte, daß diese Wahrheit: ‚ich denke, also bin
ich‘ so fest und sicher ist, daß die ausgefallensten Unterstellungen der
Skeptiker sie nicht zu erschüttern vermöchten, so entschied ich (Kursivie-
rung MB), daß ich sie ohne Bedenken als ersten Grundsatz der Philoso-
25
René Descartes, Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. In:
René Descartes: Philosophische Schriften in einem Band. Hamburg 1996, S. 53.
26
René Descartes: Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. In: Descartes, Philosophische Schriften,
S. 43.
16phie, die ich suchte, ansetzen könne.“ 27 Wohlgemerkt: Was Descartes
vorträgt ist kein Beweis, sondern ein Entschluss, der sich aus dem expe-
rimentum crucis ergibt. Folglich muss man das ‚cogito ergo sum‘ stets auf
die Versuchsanordnung der heuristischen Fiktion relativieren, in der es
entwickelt worden ist.
Unbedingt erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang eine weitere
Bemerkung, die Descartes macht, um seinen Gedankengang zu illustrie-
ren. Er verfällt dabei zunächst auf das vergleichsweise harmlose Beispiel
vom Wachs und schreibt, es sei falsch, aus dem Geruch oder Gefühl von
Wachs zu schließen, dass die Sinne des Menschen die entscheidende Rolle
bei der Erkenntnis von Gegenständen oder beim Urteil über ihren Reali-
tätsgehalt spielen würden. Schuld an diesem nahe liegenden Fehlschluss
sei der Sprachgebrauch, indem er den Eindruck erwecke, dass man Wachs
unmittelbar als das erkenne, was es sei. Tatsächlich sei es jedoch allein
der Verstand, der zu dem Urteil gelange, dass es sich bei einem Gegen-
stand wirklich um dieses oder jenes handele. In diesem Augenblick unter-
bricht Descartes seine Reflexion gleichsam so, als habe ihn eine Sensation
vom Weiterschreiben abgelenkt, um dann fortzufahren:
„Doch da sehe ich zufällig vorm Fenster Menschen auf der Straße vorü-
bergehen, von denen ich ebenfalls, genau wie vom Wachse, gewohnt bin
zu sagen: ich sehe sie, und doch sehe ich nichts als Hüte und Kleider, un-
ter denen sich ja Automaten verbergen können! Ich urteile aber, dass es
Menschen sind. Und so erkenne ich das, was ich mit meinen Augen zu se-
hen vermeinte, einzig und allein durch die meinem Denken innewohnende
Kraft zu urteilen.“ 28
Die reziproke Schlüsselszene in The Blade Runner ließe sich etwa so pa-
raphrasieren: Hier sehen die Zuschauer gemeinsam mit Rick Deckard ei-
nen Automaten oder Replikanten, in dem ein Mensch stecken könnte. Es
ist aber nicht primär der Verstand, der zu diesem Urteil kommt, sondern
die melodramatisch stimulierte Empfindung, die zu dieser Detektion bzw.
Identifikation führt: Das Objekt der Beobachtung durchläuft also einen
Prozess, in dem es in dem Maße seine (weibliche) Sensibiliät und Identität
entdeckt, indem es in der Imagination des Beobachters zu einem dynami-
schen Objekt wird, in dessen Entwicklung sich die eigene Subjektgenese
27
Descartes, Von der Methode, S. 53.
28
Descartes. Meditationen, S. 57.
17spiegelt. Dass damit zugleich die anthropologische Differenz von Mensch
und Maschine aufgehoben wird, macht den Clou dieser Schlüsselszene
aus.
Der Umstand, dass Rick Deckards Name, frankophon prononciert, an René
Descartes erinnert, hat also eine tiefere Bedeutung. The Blade Runner ist
eine Revision des traditionellen Menschenbilds, und es ist daher auch kein
Zufall, dass der Replikantenjäger, als er Pris Stratton aufspürt, in ein Ka-
binett von Automaten gerät, das Exponate umfasst., die an E.T.A. Hoff-
manns Olympia-Puppe aus DER SANDMANN und ähnliche Figuren erinnern.
Dass ausgerechnet Pris im Film Descartes’ „cogito ergo sum“ rezitiert, ge-
hört in den gleichen Zusammenhang. Ebenso offensichtlich knüpft der Film
allerdings an eine weitere Genealogie des modernen Menschen an, die
vom Prothesengott zum Cyborg führt:
Schon 1930 hatte Sigmund Freud in seinem Essay DAS UNBEHAGEN IN DER
KULTUR darauf hingewiesen, dass der Mensch mit all den technischen Hilfs-
organen, die er sich geschaffen hat, ein „Prothesengott“ geworden sei. 29
Auf der gleichen Linie liegt Marschall McLuhans These, dass die Medien
Ausdehnungen des menschlichen Körpers, seiner Sinne und seiner Extre-
mitäten seien. Und nur drei Jahre nach dem Kinostart von The Blade Run-
ner, nämlich 1985, bemerkte Donna Haraway in EIN MANIFEST FÜR CYBORGS:
„Im späten 20. Jahrhundert, in unserer Zeit, einer mythischen Zeit, haben
wir uns alle in Chimären, theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Ma-
schine und Organismus verwandelt, kurz, wir sind Cyborgs.“ 30
Vor diesem Hintergrund gewinnt eine Beobachtung von Thomas Koebner
Relevanz, die er in seiner lesenswerten, bereits mehrfach zitierten Inter-
pretation von The Blade Runner im Hinblick auf das Recycling kultureller
Muster mitteilt, das Ridley Scott, seine Bühnenbildner und Ausstatter be-
trieben haben:
„Das Zitathafte der geschichtlichen Verweise und Dokumente korrespon-
diert dem Zitathaften der Erinnerungen im Gedächtnis der Replikanten. Da
29
Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur. In: Das Unbehagen in der Kultur und andere kulturtheoretische
Schriften. Einleitung von Alfred Lorenzer und Bernhard Görlich. Frankfurt am Main 1994, S. 57.
30
Donna Haraway: Ein Manifest für Cyborgs. Feminismus im Streit mit den Technowissenschaften. Überset-
zung. Fritz Wolf. In: Dieselbe: Die Neuerfindung der Natur. Primaten, Cyborgs und Frauen, herausgegeben und
eingeleitet von Carmen Hammer und Immanuel Stieß. Frankfurt New York 1995, S. 33-72, Zitat S. 34.
18wie dort handelt es sich um die systematische Ausstattung eines Gehirns
mit Leitmotiven aus einer vergangenen Epoche, um den zusammengesetz-
ten ‚Individuen‘ lebensgeschichtliche Tiefe zu verleihen, eine Art Vorge-
schichte, die sie als vermutlich künstliche Wesen sonst entbehren müß-
ten.“ 31
Die Frage muss erlaubt sein, was uns Mediensubjekte, die wir tagtäglich
einer vom Recycling lebenden Bewusstseinsindustrie unterworfen – also
sub-jectum – sind, eigentlich noch vom Gemütszustand der Replikanten
mit ihren Gehirnimplantaten unterscheidet? Man kann diese Frage als
Hinweis auf einen weit verbreiteten Irrtum verstehen – den Irrtum näm-
lich, dass die Bedeutung von Empfindungen davon abhängt, dass sie eine
authentische Genese haben. Offenbar ist dies nicht der Fall. Zumindest im
Kino ist die Inauthentizität dessen, was der Zuschauer wahrnimmt, die
Bedingung der Möglichkeit, wahrhaftig etwas zu empfinden und dieser
Empfindung einen Wert zuzuschreiben, der bloß deswegen, weil er fiktio-
nal oder imaginär entworfen und entfaltet wird, keineswegs illusorisch ist.
In diesem Sinne ist der Film, ist vor allem das filmische Melodram, das
Simulakrum einer Interaktion zwischen dem Subjekt, das sich imaginär
konstituiert, und dem signifikanten Anderen, der seine Rolle nur spielen
kann, indem er von einem unmittelbaren Objekt der Wahrnehmung in das
dynamische Objekt einer Deutung verwandelt wird, die sich das beständi-
ge Hin und Her zwischen Projektion und Introjektion, Fremdreferenz und
Selbstreferenz zunutze macht, das der szenografische Diskurs anstößt. So
gesehen, ist das Melodram nicht einfach nur ein Genre, sondern eine Im-
plikatur, die sich im Verlauf der psycho-semiotischen Aktivität des Zu-
schauers entfaltet. Im Unterschied zu einer Implikation, deren Auflösung
eine logische und semantische Kompetenz erfordert, stellt die Implikatur
ein pragmatisches Phänomen dar, das performativ entfaltet wird durch die
Art und Weise, wie sich ein Subjekt zu Bezugsobjekten verhält, die im
empathischen Feld mit zum Teil sehr hohen Affektbeträgen ausgestattet
werden. Und eben darin, in der performativen Entfaltung, ist sowohl die
soziale als auch die ethische Dimension des Melodramas angelegt.
*
31
Thomas Koebner: Herr und Knecht. Über künstliche Menschen im Film. In: Derselbe: Halbnah. Schriften zum
Film. Zweite Folge. St. Augustin 1999, S. 75-91, Zitat S. 85.
19Eine wiederum fiktionale Bestätigung erfährt diese Sicht der Dinge in dem
Roman SOLARIS, den Stanislaw Lem 1968 erstmals publiziert hat. Er han-
delt nicht von Maschinen-Menschen, die man als Replikanten bezeichnen
könnte, sondern von Replikationen der menschlichen Psyche, die sich in
somatischer Form materialisieren. Kris Kelvin, der Ich-Erzähler des Ro-
mans, berichtet, wie er auf eine Raumstation geschickt wurde, die den
rätselhaften Solaris-Ozean umkreist. Rätselhaft ist vor allem die starke
Wechselwirkung, die zwischen der Materie dieses Ozeans und dem Ge-
dächtnis der Astronauten entstanden ist. Nachdem man Solaris mit Rönt-
genstrahlen beschossen und zu einer Reaktion provoziert hat, werden die
Astronauten auf ihrer Raumstation von seltsamen ‚Gästen‘ heimgesucht,
die sich als Neutrino-Inkarnationen ihrer Wunsch- und Alpträume erweisen
und sich genau so schnell, aber auch genau so hartnäckig zu regenerieren
vermögen, wie es fixe Idee tun, die man gerade dadurch ständig wieder
ins Bewusstsein holt, dass man sie vorsätzlich loswerden möchte.
Folgerichtig wird der Solaris-Ozean im Roman als „protoplasmatisches
Hirn-Meer“ bezeichnet. 32 Die starke Wechselwirkung dieser Materie mit
dem menschlichen Gedächtnis wirkt, als habe Lem die Philosophie von
Henri Bergson mit den erzählerischen Mitteln der Science Fiction veran-
schaulichen wollen. Auch Kelvin wird alsbald von den Erinnerungen an sei-
ne Frau Harey heimgesucht, an deren Selbstmord er sich schuldig fühlt.
Als er das erste Mal auf der Raumstation erwacht, sitzt sie vor ihm. „Wie
gut, daß das ein Traum ist, bei dem man weiß, daß man träumt“, 33 denkt
Kris zunächst, muss dann aber erkennen, dass Harey auch im Wachzu-
stand an seiner Seite bleibt. Es kommt sogar zur körperlichen Vereinigung
zwischen den beiden, zur Wiedergeburt ihrer Liebe.
Dennoch oder gerade deshalb gerät der Aufenthalt auf der Raumstation
für Kelvin zu einer Zeit der Trauerarbeit, ohne dass es ihm abschließend
gelingt, sein Wunschdenken mit dem Realitätssinn zu vermitteln. Kelvin
weiß sehr wohl, dass seine Hoffnung auf eine Rückkehr der echten Gelieb-
ten illusorisch ist, aber er kann auch nicht mehr ohne ihr Phantasma le-
ben: Ecce homo. Zudem entwickeln die ‚Gäste‘ ihrerseits ein mehr oder
weniger eigenständiges Gefühlsleben. So leidet Harey daran, nicht au-
thentisch und autonom zu sein. Da sie nur eine Materialisation von Kris‘
32
Vgl. Stanislaw Lem: Solaris. Roman. Deutsch von Irmtraud Zimmermann-Göllheim. München 12. Auflage
1997, S. 27.
33
Lem, S. 62.
20Erinnerungen an seine verstorbene Frau darstellt, ist sie sich seiner Zu-
neigung niemals sicher. Gilt diese Zuneigung ihr, dem Abbild, oder eigent-
lich nur dem Vorbild? 34 Hareys Re-Inkarnation folgt der Regel von der
Wiederkehr des Verdrängten, die unbewusst geschieht und sich willentlich
nicht kontrollieren lässt, nur dass es nicht ihr eigenes Unbewusstes, son-
dern das von Kelvin ist, dem sie ihre fragwürdige Existenz verdankt.
Ihre letzten gemeinsamen Tage an Bord der Raumstation verbringen Kris
und Harey in dem Wissen, dass es für sie unmöglich ist, auf Dauer oder
gar auf der Erde zusammen zu leben. Harey kann sich nur in dem Feld der
Wechselwirkung bewegen, das zwischen Kelvins Bewusstseinsstrom und
dem elektroenzephallografischen Ozean von Solaris aufgespannt ist – ein
intermediärer Bereich, in dem sie nur insofern und solange existiert wie
eine Film-Figur im empathischen Feld ihrer Wahrnehmung und Deutung.
Um Kelvin die Rückkehr in die menschliche Zivilisation zu ermöglichen,
bringt Harey schließlich dessen Kollegen Snaut dazu, ihre Neutrino-Matrix
ein für alle Mal zu vernichten. 35 Kris hinterlässt sie einen Abschiedsbrief.
Der Name Harey, mit dem sie diesen Brief unterschrieben hat, ist ver-
schmiert. So wird die Signatur zum grafischen Reflex ihrer paradoxen,
nicht-authentischen, nicht-autonomen Existenz. 36 Kris jedoch beschließt,
in der Nähe von Solaris zu bleiben, weil er glaubt, im Menschengewimmel
der Erde zu ertrinken. Einmal fliegt er zu einer Insel im Ozean, vermutlich
in dem Bestreben, sich selbst zu vergessen. 37 Gelingen kann das schon
deshalb nicht, weil er nach wie vor die Erwartung auf eine Rückkehr der
Geliebten hegt. Statt mit einem Akt der Entsagung schließt die Ich-
Erzählung mit einer philosophischen Reflexion auf die Un-Möglichkeit, oh-
ne Illusion zu existieren:
34
Angesichts der großen Rolle, die das Projektionsverfahren der Übertragung in der Liebe spielt, ist dies, neben-
bei bemerkt, eine nur allzu menschliche und stets virulente Frage.
35
Psychologisch betrachtet, entspricht dies der Notwendigkeit, das Trauma, das der Selbstmord ihres Vorbilds
bei Kelvin hinterlassen hat, noch einmal imaginär durchzuspielen, um es überwinden zu können. Nur dass Kel-
vin diese Überwindung nicht restlos gelingt. Es wäre vorschnell, darin einen Einspruch Lems gegen die Psycho-
therapie oder gar deren Widerlegung zu sehen, haben Freud und seine Nachfolger doch stets betont, dass es bei
der Redekur nicht darum geht, die Erinnerung an schmerzvolle Erfahrungen zu ‚löschen‘, sondern lediglich
darum, die Lebens-Blockade, als die sie der Patient erfährt, aufzulösen, indem die Erinnerungen uminterpretiert
werden.
36
Wer dabei an das berühmte Gedankenexperiment von Schrödingers Katze denkt, die weder to noch lebendig,
sondern eben 'verschmiert' ist, befindet sich durchaus auf dem richtigen Weg – nur das Lems literarisches Ge-
dankenexperiment nicht der Veranschaulichung eines physikalischen, sondern eines philosophischen Paradoxons
dient.
37
Vgl. Lem, S. 236.
21Sie können auch lesen