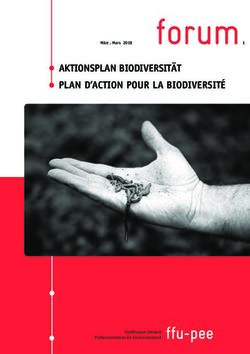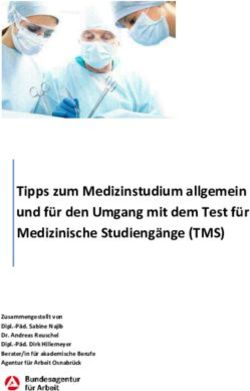NFP 51 Integration und Ausschluss - Bulletin Nr. 3, Mai 2006 - SNF
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
NFP 51 Integration und Ausschluss
Bulletin Nr. 3, Mai 2006
www.nfp51.ch
Schwerpunkt
Editorial
Fragen an die Geschichte sind für das NFP 51
Die strukturelle Prägung der
von besonderer Bedeutung. Im Dialog mit den Sozialpolitik durch die Geschichte
anderen Sozial- und Humanwissenschaften
tragen Historikerinnen und Historiker wesent- Prof. Dr. Brigitte Studer, Bern
lich zu fundierterem und differenzierterem
Wissen über moderne Gesellschaften und ihre
Dynamik bei. Nationale Forschungsprogramme sind von ihren Themen-
und Problemstellungen her gegenwartsbezogen und von
Dies ist nicht nur für die Wissenschaft selbst,
ihren Erkenntnisinteressen her weitgehend anwendungs-
sondern auch für Gesellschaft und Politik von
orientiert. Was können da historische Projekte beitragen?
Nutzen. Drei Gründe seien hier genannt:
Erstens sind sozialpoliti-
Das NFP 51 «Integration und Ausschluss» war von Anfang
sche Interventionen ihrer
an stark historisch ausgerichtet. Seine Entstehungs-
Natur nach langfristig
geschichte ist verwoben mit der Forderung, die Aktion
angelegt. Sozialstaaten
«Kinder der Landstrasse» aufzuarbeiten, mit der die Stiftung
sind schwere Tanker, die
Pro Juventute zwischen 1926 und 1973 versucht hatte, die
ihre Richtung nur lang-
Schweizer Jenischen sesshaft zu machen. Die 1996 vom
sam und kaum merklich
Bundesamt für Kultur (BAK) in Auftrag gegebene Vorstudie
ändern. Ökonomen und
der Historiker Walter Leimgruber, Thomas Meier und Roger
Politikwissenschaftler
Sablonier hat erstmals das Ausmass, die Dauer und die
sprechen deshalb von
Methoden der systematischen Kindswegnahmen gezeigt
«Pfadabhängigkeit» – vom Schwergewicht
(Leimgruber et al. 1998). Um jedoch die gesellschaftliche
etablierter Institutionen und der Zählebigkeit
und institutionelle Verankerung dieser Praxis offenzulegen,
früherer Weichenstellungen. Wer den Födera-
aber auch um die Schicksale der Betroffenen zu rekonstru-
lismus modernisieren, die Altersversorgung
ieren, schien ein Forschungsprogramm notwendig. Ein sol-
reformieren oder die Bürokratie verschlanken
ches wurde auch seitens der Betroffenen gefordert. Es kam
will, weiss, wovon die Rede ist.
schliesslich im Jahr 2000 dank des Engagements von
Zweitens hat unbewältigte Geschichte – um- Bundesrätin Ruth Dreifuss zustande und wurde im Jahr
gangssprachlich häufig als «Leiche(n) im Keller» 2002 ausgeschrieben.
bezeichnet – die Eigenschaft, von Zeit zu Zeit
zurückzukehren. Mit Hilfe historischer Analysen Die besondere Rolle der historischen Forschung im NFP 51
kann das komplexe Zusammenwirken von Ver- ist nicht nur durch die Genese, sondern auch durch die
drängung und Mythenbildung, individueller Thematik des Forschungsprogramms begründet. Bei der
Erfahrung und Erinnerungen sowie t Frage nach Integration und/oder Ausschluss von Einzelnen
oder Gruppen geht es letztlich um die Grundlagen der
Demokratie und des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Die Art und Weise und der Grad der sozialen Eingliederung
der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger wie auch der Aus-
länderinnen und Ausländer – die zwar nie ganz ausgeschlos-
sen, aber stets auch nur bedingt integriert waren – werden
von historisch gewachsenen Denkmustern, PerzeptionenGegenwart gezogen werden. Die Historie befasst sich mit
t gesellschaftlicher Bewusstwerdung der Hypo-
dem konkreten Einzelfall. Ihre Aussagekraft bezieht sie aus
theken der Vergangenheit besser verstanden
der historisch genauen Kontextualisierung. Dieselben Aus-
werden. Als Archäologen, Kritiker und Aufklärer
gangsbedingungen können in einer anderen Situation
auch der «Rückseite des Sozialstaats» (Brigitte
andere Effekte zeitigen. Das hindert freilich nicht, struktu-
Studer) sind die Geschichtswissenschaften
relle Kontinuitäten in den Denk- und Handlungsmustern
gefragt wie nie.
herauszuarbeiten. Die historische Rekonstruktion kann
«Historische Wissenschaft ist nicht Politikbera- zudem dank der empirischen und konzeptuellen Multi-
tung», unterstreicht Jakob Tanner in seinem perspektivität Muster und Folgen sozialer Interaktionen
Beitrag. Aber ebenso wie er betonen alle Autorin- aufzeigen, die den Zeitgenossen verdeckt geblieben sind
nen und Autoren dieses Bulletins den Wert oder zumindest nicht in ihrem realen Ausmass bewusst
historischen Wissens für heutige Entscheidungs- waren. Im Fall der Aktion «Kinder der Landstrasse» handelt
prozesse. Und dies ist der dritte Grund, denn es sich um die Tragik der individuellen Schicksale: bei den
die Geschichte gibt Einblick in ein gesellschaft- Kindern um die Fremdplatzierung und die Schutzlosigkeit
liches Laboratorium, in dem politische Leitbilder, gegenüber physischer, psychischer und sexueller Gewalt,
soziale Trends und individuelle Biographien bei den Eltern um den Verlust der Kinder und die Recht-
von ihrem Ende her betrachtet werden können. losigkeit gegenüber den behördlich-institutionellen Mass-
Sinn für langfristige Entwicklungen, Achtung nahmen.
vor menschlichen Schicksalen und ein Bewusst-
sein der Komplexität gesellschaftlicher Verhält- Die normativen Grundlagen der sozialen Fürsorge
nisse: das kann man aus Geschichte lernen – Hinter dem Handeln der Stiftung Pro Juventute standen
wenn man will. Normen wie die Sesshaftigkeit und die so genannte bürger-
liche Familienordnung – Normen, die aus der zeitlichen
Prof. Dr. Christoph Conrad,
Distanz fragwürdig erscheinen, die aber damals sozial breit
Mitglied der Leitungsgruppe des NFP 51
abgestützt gewesen sein dürften. Nun beruht jede Inter-
vention von Behörden, von Stiftungen oder auch von priva-
ten Organisationen im sozialen Bereich auf normativen
Vorstellungen und Erwartungen, die stets sowohl integrativ
als auch ausschliessend sind. Ausschliessend sind sie für
diejenigen, die ihnen nicht oder vermeintlich nicht ent-
sprechen können oder nicht entsprechen sollen, wie es im
20. Jahrhundert bei den angeblich zu wenig assimilierten
Ausländern der Fall war. Es ist zwar keineswegs sicher, ob
das Wissen um diesen Effekt in der Vergangenheit die
Verantwortlichen vor zukünftigen Fehlern bewahren kann,
eine Sensibilisierung für die möglichen Konsequenzen
und Stereotypen, Handlungsmodellen und politischen ihres Handelns ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung
Praxen bestimmt. Es ist daher auch für politische Entschei- dafür.
dungsträger wichtig, sich der Logik eingespielter Prozesse
bewusst zu werden. Nicht immer stand am Ende eines Ent- Die Geschichte zeigt, dass die Praktiken der Sozialpolitik
scheidungsprozesses die beste Lösung, sei es, weil das poli- aufgrund ihres Normierungsanspruchs, d. h. ihre Ziel-
tische Handeln bekanntlich nie ganz frei von Interferenzen setzung als Norm zu definieren, in vielen Fällen stigmati-
durch Partikularinteressen ist, sei es, weil politische Be- sierten, diskriminierten und sogar kriminalisierten. Dieser
schlüsse stets im Kontext zeittypischer Paradigmen und Aspekt der Geschichte des Sozialstaates – sozusagen seine
ihrer jeweiligen blinden Flecken zustande kommen. Histo- Rückseite – ist für die Schweiz noch ungenügend erforscht.
risches Wissen kann sich unter Umständen als nützlich Mehrere Projekte des NFP 51 leisten dazu nun einen wich-
erweisen, um die Wiederholung von Fehlern zu vermeiden, tigen Beitrag. Historische Studien zur sozialen Fürsorge
um Verantwortlichkeiten zu bestimmen oder um zumindest sind in der Schweiz auch deshalb noch selten, weil die
die jeweiligen Optionen zu kennen. Fürsorge vorwiegend in die Zuständigkeit der Gemeinden,
manchmal auch der Kantone fiel und daher in eine Vielzahl
Es soll allerdings darauf hingewiesen werden, dass hier unterschiedlichster Politiken und Rationalitäten, Verwal-
nicht gemeint ist, es könnten aus der Vergangenheit mittels tungsinstanzen und Agenturen zerfällt. Da zudem trotz
der Geschichtsschreibung ohne weiteres Lehren für die föderaler Strukturen im Lauf des 20. Jahrhunderts zwischen
2 NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006den diversen Fachgebieten immer dichtere institutionelle unterstellten Arbeitnehmer zuständig und versicherte bis
Vernetzungen und kommunikative Verflechtungen auf re- in die 1980er Jahre nur etwa die Hälfte der Arbeiter. Für
gionaler, eidgenössischer und internationaler Ebene ent- alle anderen waren private Versicherer oder kantonale
standen sind, erhöht sich die Komplexität des Gegenstands Einrichtungen zuständig (vgl. Lengwiler 2002).
noch zusätzlich. Eine weitere Besonderheit der Schweiz,
die die historische Forschung auf diesem Gebiet erschwert, Das Schweizer Sozialversicherungsmodell weist auch hin-
stellt der hohe Anteil privater Organisationen in der sichtlich seiner Finanzierung Besonderheiten auf, die his-
Sozialpolitik dar. Ein Beispiel dafür ist die Stiftung Pro torisch entstanden sind. So beruht es nur zu vergleichsweise
Juventute, die 1912 von der Schweizerischen Gemeinnützi- kleinen Teilen auf sozialen Umverteilungsmechanismen.
gen Gesellschaft gegründet wurde und noch heute eine Dies ist besonders deutlich bei der Krankenversicherung
regional diversifizierte, beeindruckende Angebotspalette mit den Pro-Kopf-Prämien wie bei den nach dem Kapital-
aufweist, die von der sozialpädagogischen Familienbeglei- deckungsverfahren funktionierenden Pensionskassen.
tung über die Organisation von Ferienlagern und Waisen- Auch bei Finanzierungsmodellen über Lohnprozente müs-
unterstützung bis zur Stipendienvergabe reicht. sen die Versicherten in der Schweiz im Vergleich zu ande-
ren Ländern einen höheren Anteil tragen, wohingegen der
Die historischen Besonderheiten der Schweizer Anteil der Arbeitgeber eher niedrig ist (Zahlen siehe Flora
Sozialversicherungen et al. 1983; Guex und Studer 2002).
Der Public-Private-Mix der Finanzierung und der Aufga-
benverteilung charakterisiert auch die zweite Dimension Schliesslich tragen fiskalische Einnahmen des Staates in
des Schweizer Sozialstaats, die Sozialversicherung, in der der Schweiz nur in geringem Mass zur Finanzierung der
die Beiträge (Prämien) der Versicherten – handle es sich Sozialversicherungen bei. Auch Ende der 1990er Jahre
nun um die gesamte Bevölkerung (Obligatorium) oder um machen Steuern immer noch weniger als die Hälfte der
die Gruppe der zu einem bestimmten Versicherungszweig Einnahmen (resp. des gesamten Finanzvolumens) aus (kri-
Zugelassenen – und ihr Leistungsanspruch nach einem tisch zu diesen Finanzierungsmodi: Flückiger und Suarez
bestimmten Schlüssel in ein Verhältnis gesetzt werden. 1996). In diesem Zusammenhang stellt sich im Übrigen die
von der Geschichtswissenschaft noch kaum behandelte
Dass die Schweizer Sozialausgaben ab den 1970er Jahren Frage der Wohlfahrtsleistungen über Steuervergünstigun-
angestiegen sind und nun im europäischen Vergleich im gen.
oberen Drittel liegen, wird von der Forschung nicht unbe-
dingt der Entwicklung des Sozialversicherungswesens Die Zuordnung des Schweizer Sozialstaats zu einem
zugeschrieben. Mathieu Leimgruber (2005) sieht den Grund Typus des «Wohlfahrtsregimes»
viel eher in der Integration in die Soziale Wohlfahrt von Von allen zum internationalen Vergleich entwickelten
Kranken- und Pensionskassen, die von privaten Anbietern Ansätzen ist der wohl einflussreichste derjenige von Gøsta
dominiert sind und die über die Äufnung von Fonds und Esping-Andersen (1990). Er unterscheidet
einen hohen direkten Kostenanteil der Versicherten statt – das Bismarcksche oder konservative Modell, das auf die
über steuerliche Umverteilungen und Risikoausgleich Erwerbstätigkeit zentriert und wenig redistributiv ist: die
finanziert sind. Die grosse Rolle von Privatversicherungs- Pensionsrenten wie die Arbeitslosengelder sind auf der
anstalten in der Altersvorsorge hat in der Schweiz Tradition Basis der früheren Löhne berechnet;
und setzte schon Ende des 19. Jahrhunderts ein. Ihre – das universalistische oder sozialdemokratische Modell,
Funktion ging von Anfang an über das Angebot von Lebens- das stark umverteilend wirkt: das fundamentale Prinzip
versicherungen oder kollektiven Altersvorsorgeeinrich- bildet nicht die Sozialversicherung, sondern die Offerte
tungen für die Privatwirtschaft hinaus. Kleine Gemeinden, von universellen Dienstleistungen nach Mittelschicht-
die oft nicht in der Lage waren, eine eigene Pensionskasse standard (Schweden, Dänemark, Norwegen gelten hier als
zu führen, übertrugen diese Aufgabe in vielen Fällen einer repräsentativ);
Privatversicherung. So spielen die privaten Anbieter auch – das Markt- oder liberale Modell, dessen Logik auf Markt-
in den Vorsorgeeinrichtungen der öffentlichen Verwaltung mechanismen gründet; der Staat interveniert nur subsi-
eine gewisse Rolle. diär, wenn die Marktmechanismen wie auch die familiären
Solidaritäten nicht greifen.
Die Rolle der privaten Anbieter hat auch in der Unfallver-
sicherung Tradition. Lange vor Einführung der Schweizeri- Die Schweiz wird dem Markt- oder liberalen Modell zuge-
schen Unfallversicherungsanstalt (suva) waren private rechnet. Diese Zuordnung trifft jedoch offensichtlich nicht
Unfallversicherer im Geschäft und blieben es auch danach. ganz zu, denn ebenso lassen sich Elemente des universalis-
Denn die suva war anfänglich nur für die dem Fabrikgesetz tischen und des konservativen Modells ausmachen. Das
NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006 3erklärt sich m.E. aus der langen Entstehungszeit des 1941 betrug die weibliche Sicherungsquote im Vergleich zu
Schweizer Sozialstaats (von einem Wohlfahrtsstaat lässt derjenigen der Männer in den Pensionskassen im öffent-
sich erst seit dem Aufholschub der letzten Jahrzehnte spre- lichen Bereich 58 % und in der Privatwirtschaft 49 %. 1970
chen), die im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann lagen die entsprechenden Prozentsätze bei 56 und 37.
und bis zur Einführung einer Mutterschaftsversicherung
2004 reicht, sowie den zahlreichen beteiligten Akteuren mit Wissensdefizite und Forschungsdesiderata
ihren je eigenen Interessen und Konzepten. Es gibt noch viele Lücken in der Geschichte des Schweizer
Sozialstaats. Wissensdefizite bestehen zum Beispiel im
Einen vierten Typus von Wohlfahrtsregime hat kürzlich Hinblick auf die Stellung der Ausländerinnen und Aus-
Michael Opielka vorgestellt. Für diesen Typus, den er länder. Das 1934 in Kraft getretene Bundesgesetz über Auf-
«Garantismus» nennt, sei die Schweizer Sozialpolitik gera- enthalt und Niederlassung der Ausländer führte einen
dezu paradigmatisch. Aus historischer Perspektive erscheint Schutz des nationalen Arbeitsmarktes ein und bedeutete de
diese Zuordnung allerdings fragwürdig. Gerade was die von facto einen Teil-Ausschluss von gewissen Versicherungen
Opielka angeführte Krankenversicherung angeht, hat sich (wie etwa von der Arbeitslosenversicherung, die an konti-
die Schweiz bereits 1911 für eine «Volksversicherung» und nuierliche Erwerbsarbeitsverhältnisse gebunden war).
gegen eine reine Erwerbstätigenversicherung entschieden Eine sozialrechtliche Gleichstellung ausländischer Arbeits-
(allerdings ohne Obligatorium, was erst 1996 mit dem KVG kräfte mit Schweizer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nachgeholt wurde). Auch wenn es zweifellos stimmt, dass nehmern erfolgte erst nach 1977.
es aus der Integrationsperspektive eine Rolle spielt, ob die
gesamte erwachsene Bevölkerung Teilhaberechte an einer Die gesamte Sozialstaatskonfiguration der Schweiz ist noch
Versicherung hat oder nicht, ist doch die Frage, auf welchen wenig erforscht. Was weiter oben für den Bereich der sozi-
finanzierungspolitischen Grundlagen dies geschieht, nicht alen Fürsorge konstatiert wurde, gilt auch für die Sozial-
ohne Bedeutung. Grundsätzlich mutet eine Zuordnung zu versicherungen: Das System war schon immer organisato-
einem Wohlfahrtsregime, die sich nur auf die sozialpoliti- risch und konzeptuell fragmentiert oder, anders formuliert,
schen Felder Alterssicherung und Gesundheit stützt, pro- charakterisiert durch hohe funktionale Ausdifferenzierung
blematisch an. Die Geschichtsforschung hat hingegen und institutionelle Delegation. Die Versicherungen, Vor-
schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Schweiz eine sorgeeinrichtungen, Hilfskassen usw. teilen sich nicht nur
Mischung aus liberalem, sozialdemokratischem und in staatliche, nichtstaatliche und private Einrichtungen, sie
konservativem Wohlfahrtsregime darstellt (Studer 1998; sind überdies auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen
Magnin 2002). (Bund, Kantone, Gemeinden) angesiedelt und basieren auf
diversen Rechtsformen. Daneben traten stets auch Gewerk-
Dies zeigt sich deutlich aus der Geschlechterperspektive. schaften, Arbeitgeber, professionelle Gruppierungen usw.
Konservativ geprägt ist jedenfalls die den Sozialversiche- als Versicherungsträger auf. Noch wenig ist in der dualen
rungen zugrunde liegende Geschlechterordnung (trotz eini- Struktur des Wohlfahrtsstaates (Sozialversicherung –
ger Korrekturen in den letzten Jahren), wenn man den Grad öffentliche/private Fürsorge) über die Rolle und die Ver-
der weiblichen Abhängigkeit vom Familienernährer oder flechtung von intermediären Instanzen und Fürsorge-
umgekehrt den Grad der «Individualisierung» bzw. der institutionen wie gemeinnützige Vereine, Hilfswerke,
eigenständigen sozialen Sicherung von Frauen als Krite- Verbände, Städte etc. bekannt. Last but not least stehen der
rium nimmt (Lewis 1993). Die meisten Sozialversicherungs- internationale Vergleich des Sozialmodells Schweiz und die
zweige der Schweiz sind auf das Ernährermodell zu- Erforschung seiner transkulturellen Interdependenzen
geschnitten. Daraus ergibt sich ein «gender gap» in der noch weitgehend aus.
Versicherungsdeckung. Frauen sind in verschiedenen
Sozialversicherungen weniger gut abgesichert. Historisch Wenn man davon ausgeht, dass es eine Kovariaton von
trifft das etwa für die Arbeitslosenversicherung (Studer Wissen und Sozialstruktur gibt, so ist es nicht unerheblich,
2004), für die AHV (Luchsinger 1995) und für die Zweite die früheren Denk- und Begriffskategorien, die Wahrneh-
Säule zu. Wie Matthieu Leimgruber (2005) belegt, sind mungsschemata und Lösungsmuster, die sich im Schweizer
Frauen hinsichtlich der Alterssicherung aber nicht nur in Sozialstaat verstetigt haben, wie auch die gescheiterten
der Privatwirtschaft, sondern gleichfalls, wenn auch weni- Optionen zu rekonstruieren, um dieses komplexe Gebilde
ger prononciert, im staatlichen Arbeitssektor benachteiligt. besser zu verstehen. Und bewusst und begründet handeln
zu können.
4 NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006Literatur
Esping-Andersen G. The three worlds of welfare capitalism. Cambridge,
1990
Flora P et al. State, economy and society in Western Europe 1815–1975.
A data handbook in two volumes. Frankfurt/M., London, Chicago, 1983
Flückiger Y, Suarez S. Propositions de réforme du financement de la
sécurité sociale en Suisse. In: Greber PY (Hg). La sécurité sociale en
Europe à l’aube du XXe siècle. Basel, 1996; 145–192
Guex S, Studer B. L’Etat social en Suisse aux XIXe et XXe siècles. Notes
sur quelques pistes de recherche. In: Gilomen HJ, Guex S, Studer B (Hg).
Von der Barmherzigkeit zur Sozialversicherung. Umbrüche und
Kontinuitäten vom Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Zürich, 2002;
201–211 Brigitte Studer
Leimgruber M. Achieving social progress without state intervention?
A political economy of the Swiss three-pillar pension system (1890–1972).
Thèse de doctorat, Université de Lausanne, 2005 (unpubl. Ms.)
Leimgruber W, Meier T, Sablonier R. Das Hilfswerk für die Kinder der Prof. Dr. Brigitte Studer, geboren 1955, Studium
Landstrasse. Historische Studie aufgrund der Akten der Stiftung Pro der Geschichte, Anglistik und Pädagogik an den
Juventute im Schweizerischen Bundesarchiv, erstellt durch die Beratungs- Universitäten Freiburg und Lausanne und an der
stelle für Landesgeschichte (BLG) im Auftrag des Eidgenössischen
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Departements des Inneren (EDI), hg. vom Schweizerischen Bundesarchiv.
in Paris. 1995 – 1997 Lehrbeauftragte an den
Bern, 1998 (Bundesarchiv Dossier 9)
Universitäten Zürich und Genf, 1995 ein
Lengwiler M. Kalkulierte Solidarität. Risikoforschung im Sozialstaat
(1870–1970). Habil.-Schr., Universität Zürich, 2002 (unpubl. Ms.)
Semester Visiting Professor an der Washington
University, St. Louis (USA), WS 2001/2002 –
Lewis J (Hg). Women and social policies in Europe. Work, family and the
state. Aldershot, 1993 WS 2003/2004 Visiting Professor an der
Luchsinger C. Solidarität, Selbständigkeit, Bedürftigkeit: Der schwierige
Strathclyde University, Glasgow (GB). Seit 1997
Weg zu einer Gleichberechtigung der Geschlechter in der AHV, 1939–1980. Ordinaria für Schweizer und Neueste Allgemeine
Zürich, 1995 Geschichte an der Universität Bern.
Magnin C. Der Alleinernährer. Eine Rekonstruktion der Ordnung der Sie leitet im Rahmen des NFP 51 mit Dr. Gérald
Geschlechter im Kontext der sozialpolitischen Diskussion von 1945 bis Arlettaz, Bundesarchiv Bern, ein Forschungs-
1960 in der Schweiz. In: Gilomen HJ, Guex S, Studer B (Hg). Von der projekt zur Geschichte der Einbürgerung und
Barmherzigkeit zur Sozialversicherung. Umbrüche und Kontinuitäten vom
Ausbürgerung in der Schweiz: «Die Staatsbürger-
Spätmittelalter bis zum 20. Jahrhundert. Zürich, 2002; 387–400
schaft zwischen Konzepten des Nationalen und
Opielka M. Der «weiche Garantismus» der Schweiz. Teilhaberechte in der
Ordnung des Sozialen: Aufnahme- und Aus-
Sozialpolitik. In: Bulletin NFP 51, Nr. 2, Dezember 2005; S. 1–6
schlusskriterien des ‹Schweizerbürgerrechts›
Studer B. Soziale Sicherheit für alle? Das Projekt Sozialstaat. In: Studer B
(Hg). Etappen des Bundestaates. Die Staats- und Nationsbildung in der
von 1874 bis zur Gegenwart».
Schweiz, 1848–1998. Zürich, 1998; 159–186
Studer B. Social policy as gender technology. The construction of the
category of the unemployed in Switzerland in the 1930s. Paper presented Kontakt
at the Fifth ESSHC in Berlin, March 2004 (unpubl. Ms.) Prof. Dr. Brigitte Studer
Universität Bern
Historisches Institut
Länggassstrasse 49
CH-3000 Bern 9
Tel. +41 (0)31 631 39 45 (Sekretariat)
Fax +41 (0)31 631 44 10
brigitte.studer@hist.unibe.ch
NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006 5Berichte aus den Forschungsprojekten
Von Akten und Menschen – und
dem Umgang mit dem Anderssein
Als Beispiel dafür, welche Rolle Akten bei Diskriminierung
und Ausgrenzung spielen können, wählten wir das von der
Stiftung Pro Juventute getragene «Hilfswerk für die Kinder
der Landstrasse», das zum Ziel hatte, die so genannte
«Vagantität» auszutilgen. Mit Behördenhilfe wurden zwi-
schen 1926 und 1973 über 600 jenische Kinder ihren Eltern Roger Sablonier,
weggenommen, unter Vormundschaft gestellt und in Pflege- Projektleiter
familien, Heimen, Kliniken, Anstalten oder an Arbeitsstellen
untergebracht.
Analysiert werden die vom «Hilfswerk» angelegten umfang-
reichen Akten. Wir interessieren uns nicht nur für die darin
enthaltenen Stigmatisierungen, sondern auch dafür, wie die
Betroffenen mit Stigmatisierungen und Diskriminierungen Gesellschaftspolitische Bedeutung
umgingen (Stigma-Management). Dazu werden vorhande- Die gesellschaftspolitische Bedeutung des Projekts liegt auf
ne biografische Aufzeichnungen sowie die Berichte von acht mehreren Ebenen. So besteht ein Anspruch auf eine Auf-
Betroffenen, die zu ihrer Lebensgeschichte interviewt wur- arbeitung der Kampagne und ihrer Umstände seitens der
den, in die Untersuchung einbezogen. Betroffenen wie seitens einer Gesellschaft, die sich ihrer
Verantwortung als demokratisches und soziales Gemein-
Wir verfolgen ferner Forschungsinteressen, die allgemei- wesen stellt. Bei der Aktion «Kinder der Landstrasse» han-
ner Natur sind und auf eine Erweiterung der historischen delt es sich um einen einzigartigen, in mancherlei Hinsicht
Interpretationsmöglichkeiten abzielen, indem danach ge- aber eben auch exemplarischen Fall schweizerischer Für-
fragt wird, was mit einem Schriftstück nach dessen Erstel- sorge- und Minderheitenpolitik. Die Einmaligkeit besteht
lung geschieht, d.h. wie es aufbewahrt und vor allem wie, in der systematischen Verfolgung einer Minderheit, das
wann, von wem, unter welchen Umständen, zu welchem Beispielhafte in den dabei angewandten Mitteln. Genauere
Zweck usw. es genutzt wird. Dieses «Schrifthandeln» ist im Kenntnisse sind deshalb gerade auch im Hinblick auf die
Falle der Akten, mit denen wir es beim «Hilfswerk für die Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme von grosser
Kinder der Landstrasse» vorwiegend zu tun haben, ausge- Bedeutung.
prägt und exzessiv.
Aktenführung – in jeder Verwaltung omnipräsent – ist inte-
Mit unserem Projekt verfolgen wir also zwei Forschungs- ressanterweise kaum erforscht. Dabei werden in staat-
ziele: Indem wir die Aktenführung bzw. den Zusammenhang lichen Behörden, in Personalabteilungen von Unterneh-
zwischen Aktenführung und Stigmatisierung untersuchen, men, in Kliniken, Fürsorge- und anderen Institutionen lau-
möchten wir einen wissenschaftlichen Beitrag zur Aufklä- fend Informationen zu Personen gesammelt und ausge-
rung institutioneller Ausschlussprozesse und allgemein zur tauscht. Solche Akten enthalten häufig Wertungen, die mit
Bürokratieforschung leisten. Zum andern verstehen wir konkreten Auswirkungen für die betreffende Person ver-
unser Projekt auch als Beitrag zu einer wissenschaftlichen bunden sein können. Indem solche Zusammenhänge auf-
Aufarbeitung «eines der dunkelsten Kapitel in der jünge- gezeigt werden, soll auch für die Problematik der
ren Schweizer Geschichte» (Ruth Dreifuss), die immer wie- Aktenführung sensibilisiert werden.
der gefordert und von der Politik in Aussicht gestellt wor-
den ist. Resultate
Die Analyse des Aktenmaterials erlaubt erstmals quantita-
tive Aussagen zum «Hilfswerk». Entgegen der immer wie-
der genannten Zahl von 619 «Kindern der Landstrasse» ist
von insgesamt rund 900 auszugehen. Auffallend ist die star-
ke Vertretung einiger weniger jenischer Familien aus den
Kantonen Graubünden, St. Gallen und Tessin, ein Umstand,
6 NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006Thomas Meier, Sara Galle,
Projektleiter wissenschaftliche Mitarbeiterin
der sich vor allem durch die Akquisitionspolitik des «Hilfs- Das Arsenal von negativ konnotierten Qualifizierungen
werks» erklärt. Unter den «Kindern der Landstrasse» fin- bezieht sich auf physische wie psychische Merkmale oder
den sich aber auch solche nichtjenischer Herkunft. Störungen, ja deckt sämtliche Facetten einer Person ab. Die
Qualifizierungen betreffen die körperliche Erscheinung,
Ferner wissen wir mehr über Umfang, Art und Struktur des den Gesundheitszustand, die Körperfunktionen, die Sexua-
Aktenmaterials sowie über die interne Verwaltung und lität, das Genussverhalten, die Intelligenz, die schulische
Funktionsweise des «Hilfswerks». Überraschenderweise oder Arbeitsleistung sowie den Geistes- und psychischen
veränderte sich etwa die Aktenführung über den langen Zustand.
Zeitraum nur geringfügig.
Eine breite Palette von diskreditierenden Zuschreibungen
Der Vergleich mit Akten der Zürcher Amtsvormundschaft bezieht sich auf die Persönlichkeitsmerkmale oder den so
zeigt, zumindest hinsichtlich der formalen Behandlung der genannten Charakter sowie das entsprechende (soziale)
«Fälle» signifikante Unterschiede. Was die reine Akten- Verhalten.
mässigkeit der Tätigkeit der beiden Institutionen betrifft,
sind hingegen nur erstaunlich geringe Differenzen auszu- In den Akten finden sich sodann Etikettierungen als
machen. Ganz anders präsentieren sich die Verhältnisse in Angehörige einer bestimmten Familie, sozialen Gruppe oder
einzelnen Heimen sowie in den aus Laien zusammenge- Minderheit. Sehr häufig sind schliesslich Kumulationen von
setzten Vormundschaftsbehörden kleinerer Gemeinden. Stigmatisierungen, die in Pauschalurteile bzw. Kategori-
sierungen münden.
Eine Besonderheit in ihrer Quantität und Intentionalität
stellen die vom «Hilfswerk» angelegten Dossiers über Oft bleibt es nicht bei aktenmässigen Stigmatisierungen
ganze Familien dar. Sie sind für die Vorgeschichte der ein- von Mündeln. Es kommt darüber hinaus zu Diskriminie-
zelnen «Fälle» bedeutsam und belegen, dass das «Hilfs- rungen, ja selbst zu eigentlichen Pathologisierungen sowie
werk» eine eigentliche Akquisitionspolitik betrieb, also Kriminalisierungen mit weit reichenden Folgen für die
nicht einfach nur Hilfe leistete, sondern gezielt bestimmte Betroffenen.
Menschen als «Fälle» definierte und aktiv einer Betreuung
zuführte. Folgerungen
Die Analyse des historischen Aktenmaterials und die viel-
Stigmatisierungen finden sich nicht nur in Dokumenten fältigen Einblicke in aktuelle, höchst unterschiedliche
des «Hilfswerks», sondern auch in jenen beteiligter Institu- Praktiken im Umgang mit Akten machen deutlich, dass es
tionen, namentlich in Behördenkorrespondenz, Heimbe- für öffentliche und im Auftrag der Öffentlichkeit handeln-
richten, Gerichtsakten, psychologischen und medizinischen de Institutionen unbedingt verbindlicher Regelungen im
Gutachten sowie Krankengeschichten.
NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006 7Umgang mit Personenakten bedarf, und zwar über den
Datenschutz im engeren Sinn hinaus. Zu regeln sind die
Zwischen Integration und
Anlage und Führung von Personenakten, ferner die Stigmatisierung: Der Umgang der
Einsichtnahme bzw. der Zugang zu solchen Akten und – im
Interesse der Betroffenen wie der Forschung – die Aufbe-
Fürsorge mit gesellschaftlicher
wahrungsfristen. Die Festlegung entsprechender Normen Marginalität im 20. Jahrhundert
und eine institutionalisierte Aufsicht sind dringende politi-
sche Desiderate. Das System des Wohlfahrtsstaates, das nach 1945 auch in
der Schweiz schrittweise eingeführt wurde, versucht, einen
Teil der Armutsrisiken durch ein Netz von Sozialversiche-
Forschungsprojekt im NFP-51-Modul «Konstruktionen von rungen abzufedern und auf diese Weise eine Stigma-
Identität und Differenz»: Aktenführung und tisierung von Menschen in Not zu vermeiden. Seit dem Ende
Stigmatisierung. Institutionelle Ausschlussprozesse am der Hochkonjunktur ist dieses System jedoch mit wachsen-
Beispiel der Aktion «Kinder der Landstrasse» 1926–1973 den Problemen konfrontiert. Während Politiker das Ende
Laufzeit: 01.07. 2003–31.12.2006 des Ausbaus des Sozialstaates proklamieren, entstehen an
den Rändern der reichen Industriegesellschaften soziale
Projektverantwortliche Problemzonen, mit denen sich unter anderem die öffentli-
Prof. Dr. Roger Sablonier che Fürsorge auseinander setzen muss. Immer wieder wer-
Historisches Seminar der Universität Zürich den Stimmen laut, die ein hartes Durchgreifen gegen
Karl-Schmid-Strasse 4 Personen fordern, welche des Missbrauchs sozialstaatlicher
CH-8006 Zürich Leistungen verdächtigt werden. Die Behörden, namentlich
Tel. +41 (0)44 634 38 56 die Fürsorgestellen, sind dadurch mit widersprüchlichen
sablon@hist.unizh.ch Anforderungen konfrontiert: Einerseits wird von ihnen
eine effiziente, kostengünstige und missbrauchsresistente
Dr. Thomas Meier Verwaltung der sozialen Probleme verlangt, andererseits
Historisches Seminar der Universität Zürich müssen sie ihre Interventionen und deren Folgen vermehrt
Culmannstrasse 1 auch ethisch rechtfertigen können.
CH-8006 Zürich
Tel. +41 (0)44 634 28 50 Hier setzt unser Forschungsprojekt an. Es untersucht die
meiertho@hist.unizh.ch Veränderungen der Rolle von Fürsorge und professioneller
und Sozialarbeit, den Wandel ihrer Leitbilder und ihrer Prakti-
BLG Beratungsstelle für Landesgeschichte AG ken und fragt nach Selbstdefinitionen und Handlungs-
Im Rank 146 perspektiven der Betroffenen. Während das eine Teilprojekt
CH-6300 Zug die Debatten und die Selbstreflexion der sich professiona-
Tel.+41 (0)41 710 70 88 lisierenden Fürsorge in der Schweiz von der Jahrhundert-
www.landesgeschichte.ch wende bis in die 1950er Jahre in den Blick nimmt, befasst
sich das zweite Teilprojekt anhand von Akten der öffent-
lichen Fürsorge der Stadt Bern mit der Praxis und, soweit
Literatur die Akten darüber Aufschluss geben, mit der Problemsicht
Meier T. Die Verfolgung der Jenischen in der Schweiz durch das «Hilfswerk
und den Strategien der Betroffenen im Zeitraum zwischen
für die Kinder der Landstrasse» (1926–1973). In: Sedlaczek D, Lutz T,
1920 und 1960. Zusätzlich werden die sich wandelnden
Puvogel U, Tomkowiak I (Hg). «minderwertig» und «asozial». Stationen der
Verfolgung gesellschaftlicher Außenseiter. Zürich, 2005; 157–178 institutionellen Rahmenbedingungen der Fürsorge in der
Galle S, Meier T. Stigmatisieren, Diskriminieren, Kriminalisieren.
Stadt Bern untersucht. Die parallele Analyse von Theorie-
Zur Assimilation der jenischen Minderheit in der modernen Schweiz. bildung, Praxis und institutioneller Politik erlaubt interes-
In: Opitz C, Studer B, Tanner J (Hg). Kriminalisieren – Entkriminalisieren – sante Einblicke in das Zusammenspiel und die Wechsel-
Normalisieren. Zürich, 2006 [im Druck] wirkungen zwischen den drei Ebenen.
Meier T. Zigeunerpolitik und Zigeunerdiskurs in der Schweiz 1850–1970.
In: Herbert U, Zimmermann M (Hg). Zwischen Erziehung und Vernichtung. Die in unserem Projekt aufgeworfenen Fragen sind für die
Zigeunerforschung und Zigeunerpolitik im Europa des 20. Jahrhunderts.
Schweiz noch kaum bearbeitet. Historische Untersuchun-
Stuttgart, 2006 [im Druck]
gen über die professionelle Sozialarbeit und ihre theoreti-
schen Konzepte fehlen fast vollständig, und auch die Praxis
der Sozialfürsorge wurde historisch erst punktuell aufgear-
beitet.
8 NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006Unsere bisherige Arbeit hat gezeigt, dass es sich hier um tinnen und verwiesen auf die soziale Mütterlichkeit, kraft
ein sehr lohnendes Feld historischer Forschung handelt, bei derer sie über eine genuine Eignung für die soziale Arbeit
dem wir nicht nur auf aufschlussreiche Veränderungen von zu verfügen beanspruchten. Die Expertinnen und Experten
Leitbildern, Problemsichten und Deutungsmustern, von debattierten – durchaus in Konkurrenz miteinander – sozi-
Praktiken, Strategien und Politiken stossen, sondern auch alarbeiterisches und fürsorgerisches Handeln, verhandel-
auf erstaunliche Persistenzen. Namentlich das Spannungs- ten Problemdiagnosen, entwickelten Handlungsstrategien
feld zwischen Integration und Ausschluss erweist sich als und definierten Politiken.
durchgehendes Element in der theoretischen Reflexion
Brigitte Schnegg Gaby Sutter Sonja Matter
und in der Praxis von Fürsorge und Sozialarbeit. Auch der Die Forderung, die «Armengenössigen» in die Gesellschaft
Widerstand der Betroffenen gegen Stigmatisierung durch zu integrieren, spielte in diesen Debatten eine wichtige
die Fürsorgeabhängigkeit durchzieht die Akten wie ein Rolle. Durch neue Formen der Unterstützung, die nicht
roter Faden. mehr den Charakter von Almosen hatten, sollte eine kollek-
tive Stigmatisierung vermieden werden. Eine detaillierte
Die Erkenntnis, dass der Staat sich um die soziale Integra- Überprüfung jedes Einzelfalls sollte der individuellen
tion seiner marginalisierten BürgerInnen bemühen muss, Problemlage gerecht werden und die Unterstützung sollte
löste um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert nach und aus der Not helfen. Nach dem Ersten Weltkrieg etablierte
nach alte Vorstellungen ab, denen zufolge die Obrigkeit sich die «rationelle Einzelfallhilfe» als Methode in der
lediglich für die Linderung der Not der Armen verantwort- Sozialhilfe. Praktiziert wurde sie, indem über jede zu unter-
lich war. Die traditionellen Formen der Armutsbekämpfung stützende Person weitläufige Informationen beschafft und
galten zunehmend als ungenügend. Die Kritik an den her- umfangreiche Dossiers anlegt wurden. Die Folgen davon
kömmlichen Praktiken verband sich mit Forderungen nach waren indes zwiespältig: Da man Vermieter, Nachbarn oder
mehr Professionalität und verdichtete sich gegen Ende des Arbeitgeber über die Klientinnen und Klienten befragte,
19. Jahrhunderts zu einem eigentlichen Expertendiskurs. wurde deren Notlage nicht nur publik, sondern auch
Die jungen Wissenschaften Ökonomie und Soziologie Gegenstand von Klatsch und Gerüchten. Die daraus resul-
begannen, sich mit den verarmten und verelendeten tierende Stigmatisierung wurde noch dadurch verstärkt,
Gruppen und Individuen der Gesellschaft zu befassen, und dass nicht Bargeld gegeben, sondern Einkaufsgutscheine
lieferten damit nicht zuletzt den politischen Behörden das ausgestellt oder Mietzuschüsse direkt an die Vermieter
Expertenwissen, auf das sie bei der Lösung der brennen- gezahlt wurden. Immer wieder kämpften die Betroffenen
den «sozialen Frage» angewiesen waren. deshalb für Barauszahlungen, um der Demütigung im
Quartierladen oder gegenüber ihren Vermietern zu entge-
Auf dem neuen Feld dieses Expertenwissens bewegten sich hen.
verschiedene Gruppen. Neben den Wissenschaften positio-
nierten sich auch die Vertreter der öffentlichen Armen- Eine Sensibilisierung für die negativen Implikationen der
pflege als Experten. Die in der Wohltätigkeit ehrenamtlich auf Kontrolle und Überwachung basierenden Fürsorge ent-
engagierten Frauen aus dem Bürgertum schufen Frauen- wickelte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war die
schulen für Soziale Arbeit. Auch sie sahen sich als Exper- UNO, die dabei eine entscheidende Rolle spielte. Im Zuge
NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006 9ihres Engagements für die Menschenrechte forderte die Forschungsprojekt im NFP-51-Modul «Soziale Arbeit und
neu gegründete Weltorganisation einen menschenrechts- Sozialpolitik»: Staatliche Fürsorge und gesellschaftliche
konformen Umgang mit den sozialen Rand- und Problem- Marginalität. Geschlechterordnung, Leitbilder und
gruppen. Die Methode des «Social Case Work», die sich an Interventionspraktiken der Sozialarbeit in der Stadt Bern des
der Interaktion von Arzt und Patient orientiert und auf eine ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts
gemeinsame Erarbeitung von partnerschaftlich-konsen- Laufzeit: 01.09.2003 – 31.10.2006
suellen Lösungen für die Betroffenen setzt, schien diesen
Ansprüchen zu entsprechen. Sie wurde in den 1950er Projektteam
Jahren als «demokratische Sozialarbeit» breit propagiert. Projektverantwortliche
Fachleute aus Europa erhielten an Weiterbildungskursen, Dr. Brigitte Schnegg
die auch von zahllosen Sozialarbeiterinnen aus der Schweiz Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und
in den USA besucht wurden, Gelegenheit, sich damit ver- Geschlechterforschung der Universität Bern
traut zu machen. Der Siegeszug des «Social Case Work» in Hallerstrasse 12
den schweizerischen Expertenkreisen ist eindrucksvoll. Im CH-3012 Bern
Laufe weniger Jahre entwickelte sich ein Konsens über Tel. +41 (0)31 631 40 25
Sinn und Notwendigkeit der neuen Methode. Wie diese brigitte.schnegg@izfg.unibe.ch
Einigkeit im Detail zustande kam, warum das Interesse und
die Akzeptanz so gross waren und wie die Methode Teilprojekt Fallakten
schliesslich in die Praxis umgesetzt wurde, soll in den ver- Dr. Gaby Sutter
bleibenden Monaten untersucht werden. Dammerkirchstrasse 47
CH-4056 Basel
Angesichts der aktuellen gesellschaftlichen und wirtschaft- Tel. +41 (0)61 321 58 85
lichen Transformationsprozesse, die mit der Marginalisie- gaby.sutter@izfg.unibe.ch
rung breiter gesellschaftlicher Gruppen einhergeht, und
angesichts der Debatten über einen Umbau des Sozial- Teilprojekt Diskurse
staates scheint uns die Forderung nach einer demokrati- Sonja Matter, lic. phil.
schen, auf Respekt und Anerkennung basierenden Form Interdisziplinäres Zentrum für Frauen- und
der Sozialfürsorge von besonderem Interesse. Die Einsicht Geschlechterforschung der Universität Bern
in die Notwendigkeit, Ausgrenzung und Demütigung der Hallerstrasse 12
sozial und wirtschaftlich Schwachen zu vermeiden, um eine CH-3012 Bern
stabile Demokratie zu gewährleisten, ist nicht zuletzt vor Tel. +41 (0)31 631 52 68
dem Hintergrund der Katastrophe des Nationalsozialismus sonja.matter@izfg.unibe.ch
gereift. Sie scheint uns für die Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen genauso bedeutsam wie die histori- Publikation aus dem Projekt
schen Erfahrungen, die mit einem auf Kontrolle und Über- Matter Sonja. Wissenstransfer und Geschlecht. Die
wachung basierenden Umgang mit Fürsorgeabhängigen Rezeption «amerikanischer» Methoden in der Schweizer
gemacht worden sind. Sozialarbeit der 1950er Jahre. In: Ariadne. Forum für
Frauen- und Geschlechtergeschichte. Heft 49: Women in
Welfare – Soziale Arbeit in internationaler Perspektive.
Kassel, 2006 (im Druck)
Ausgewählte Literatur
Fraser N. Widerspenstige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht. Frankfurt
a. M., 1994
Gilomen HJ, Guex S, Studer B (Hg). Von der Barmherzigkeit zur Sozial-
versicherung. Umbrüche und Kontinuitäten bis zum 20. Jahrhundert.
Zürich. 2002
Ramsauer N. «Verwahrlost». Kindswegnahme und die Entstehung der
Jugendfürsorge im schweizerischen Sozialstaat 1900–1945. Zürich, 2000
Rudloff W. Die Wohlfahrtsstadt. Kommunale Ernährungs-, Fürsorge- und
Wohnungspolitik am Beispiel Münchens 1919–1933. Göttingen, 1998
10 NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006Zwangmassnahmen und
psychiatrische Ordnung
1979 publizierte der französische Sozialwissenschaftler
Robert Castel eine einflussreiche Studie mit dem Titel «Die
psychiatrische Ordnung», in der er auf die Wechselwir-
kungen zwischen Ausgrenzungs- und Integrationsmecha-
nismen hinwies. Ordnung lässt sich nur stabilisieren, wenn
sich Konformität nach innen und Abgrenzung nach aussen
ergänzen; der Ordnungsgedanke fusst auf einer mentalen
Disposition, in der sich Sicherheitsbedürfnisse und Gefühle
der Bedrohung wechselseitig bedingen. Stellten kritische
psychiatriegeschichtliche Untersuchungen zunächst die
Jakob Tanner und Marietta Meier
mit dem Aufkommen psychiatrischer Anstalten in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich verstärkende Exklu-
sion durch Internierung ins Zentrum, so betont Castel dage-
gen die integrierenden Aspekte und analysiert die
Verwobenheit der modernen Psychiatrie mit der Organi- chiatriepatienten einschliesst, oder aber eine umfassend
sation gesellschaftlicher und politischer Macht. Norm und normalisierte «Disziplinargesellschaft», für deren Funk-
Normalisierung erweisen sich damit als zentrale Analyse- tionslogik das Anstaltsmodell paradigmatisch ist.
kategorien. In einer «psychiatrisablen Gesellschaft» wird,
so Castels These, der Wahnsinn in ein Verwaltungsobjekt Eine differenzierte Sichtweise, wie sie unser Projekt
transformiert und zum Gegenstand therapeutischer anstrebt, wird möglich, wenn die «Ordnung des Selbst» –
Eingriffe gemacht, die auf Heilung, d.h. auf Reintegration Subjektivierungsformen, Ichbildung, Persönlichkeitsent-
ausgerichtet sind. In diesem Vorgang verschränken sich wicklung – auf die «gesellschaftliche Ordnung» bezogen
Inklusions- und Exklusionstendenzen. wird. Die «psychiatrische Ordnung» lässt sich dann als
intermediäres Phänomen begreifen: Sie ist mit Menschen
Unser Projekt «Internieren und Integrieren. Zwang in der befasst, bei denen eine Selbststörung, d. h. eine Geistes-
Psychiatrie: Der Fall Zürich, 1870 –1970», das von Marietta krankheit, diagnostiziert wurde und die mittels therapeuti-
Meier und mir geleitet wird und an dem Brigitta Bernet, scher Massnahmen wieder in die gesellschaftliche Ordnung
Roswitha Dubach und – in der Schlussphase – Urs zurückgeführt werden sollen. Dabei entfaltet die psychia-
Germann mitarbeiten bzw. mitgearbeitet haben, greift sol- trische Ordnung, der diese Aufgabe zufällt, ihre eigenen,
che Fragestellungen auf und fokussiert vor allem den organisationsspezifischen Zwänge; Gründe dafür sind etwa
Aspekt des Zwangs. Anders als in der älteren Psychiatrie- in der chronischen Überfüllung von Anstalten und im
geschichte, die davon ausging, im Zuge der Verwissen- Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal zu sehen. Die
schaftlichung der Geisteskrankheiten seien die «Irren» Zwangsproblematik erfährt in der Psychiatrie gewisse Zu-
endlich «von den Ketten befreit» worden, wird hier Zwang spitzungen, was sich an einer immer wieder aufflammen-
als ein umfassenderes Phänomen betrachtet. Zwang ist in den Kritik ablesen lässt: Von der No-restraint-Bewegung
einer rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft, die die der 1860er Jahre über die bürgerliche Psychiatriekritik um
Menschenrechte achtet, negativ konnotiert; gleichzeitig ist 1900 bis zur Antipsychiatrie der 1960er Jahre spannt sich
die Einsicht vorhanden, dass Recht, wenn es sich nicht auf ein grosser Bogen (selbst-)kritischer Thematisierung.
einen wirksamen «Erzwingungsstab» (Max Weber) stützen
kann, macht- und hilflos wird. Darüber hinaus würden Dass sich die historische Entwicklung der Psychiatrie nicht
moderne, arbeitsteilig organisierte, komplex strukturierte ohne eine Geschichte der kritischen Auseinandersetzung
Gesellschaften ohne einen umfassenden «Zwang zum mit ihr darstellen lässt, ist eines der evidenten, wenn auch
Selbstzwang» (Norbert Elias) nicht funktionieren. Zwang in der Öffentlichkeit immer noch nicht generell akzeptier-
weist somit eine fundamentale Ambivalenz auf: Er wird – ten Resultate des Forschungsprojekts.
unter freiheitlichen Gesichtspunkten – abgelehnt, tritt aber
– in funktionaler Hinsicht – massenhaft auf. Die Verabsolu- Das Projekt knüpfte an eine von der Gesundheitsdirektion
tierung des einen oder des andern Aspekts führt zu einan- des Kantons Zürich finanzierte und Ende 2002 publizierte
der ausschliessenden Beschreibungsformen: Man sieht Pilotstudie zum Thema an, an der ausser den bereits Ge-
entweder eine «freiheitliche Gesellschaft», die auch Psy- nannten noch Gisela Hürlimann mitgewirkt hat. Neuartig
NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006 11an unserem Projekt ist auch der Zugang zu den Quellen. Forschungsprojekt im NFP-51-Modul «Konstruktionen von
Dank einer Bewilligung der «Eidgenössischen Experten- Identität und Differenz»: Internieren und Integrieren.
kommission für das Berufsgeheimnis in der medizinischen Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich, 1870 –1970
Forschung», welche umgekehrt das Forschungsteam zur Laufzeit: 01.09.2003–31.01.2006
Einhaltung strenger Datenschutzbestimmungen verpflich-
tet, konnte erstmals der grosse Fundus der Kranken- Projektverantwortliche
geschichten über den ganzen Untersuchungszeitraum hin- Prof. Jakob Tanner
weg benutzt werden. Universität Zürich
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
Die Resultate des Projekts werden im Herbst 2006 veröf- Rämistrasse 64
fentlicht werden. Die geplante Studie wirft zunächst einen CH-8001 Zürich
Blick auf die Entwicklung der psychiatrischen Kliniken im Tel. +41 (0)1 634 36 41
Kanton Zürich; neben der 1870 gegründeten Psychiatri- jtanner@hist.unizh.ch
schen Universitätsklinik Burghölzli kommen die 1867 ein-
gerichtete Pflegeanstalt Rheinau und die 1913 eröffnete Dr. Marietta Meier
psychiatrische Poliklinik zur Sprache. Die empirische Aus- Universität Zürich
wertung einer repräsentativen Stichprobe von Patienten- Sozial- und Wirtschaftsgeschichte
dossiers zeigt den Form- und Funktionswandel von Rämistrasse 64
Zwangsmassnahmen in den Zürcher Kliniken auf. Aufgrund CH-8001 Zürich
des langen Untersuchungszeitraums ist es möglich, den Tel. +41 (0)1 634 36 43
Paradigmenwechsel von der Internierung, die von den marmeier@hist.unizh.ch
1870er Jahren bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg
dominierte, zu einem allgemeinen Interventionismus im
Zeichen von Prävention, Prophylaxe und Rehabilitation Literatur
nachzuzeichnen. Dabei wird auch das Aufkommen der Tanner J. Auguste Forel als Ikone der Wissenschaft. Ein Plädoyer für
historische Forschung. In: Leist A (Hg). Auguste Forel – Eugenik und
Psychopharmaka thematisiert, die einschneidende Auswir-
Erinnerungskultur. Zürich: vdf Hochschulverlag, 2006; 81–106
kungen auf die psychiatrische Praxis hatten. Weitere
Tanner J. Der «fremde Blick». Möglichkeiten und Grenzen der historischen
Kapitel widmen sich der «Irrenrechtsfrage» um 1900, den Beschreibung einer psychiatrischen Anstalt. In: Rössler W, Hoff P (Hg).
Sterilisationen in den 1930er Jahren, den gehirnchirurgi- Psychiatrie zwischen Autonomie und Zwang. Heidelberg: Springer,
schen Eingriffen (Leukotomien) nach dem Zweiten Welt- 2005; 46–66
krieg sowie der Arbeits- und Beschäftigungstherapie, die Tanner J. Schlusswort zur Studie: Zwangsmassnahmen in der Zürcher
dem Leitgedanken einer «sozialen Heilung» verpflichtet Psychiatrie 1870 – 1970. Bericht im Auftrag der Gesundheitsdirektion
war. des Kantons Zürich, verfasst von Marietta Meier, Brigitta Bernet, Gisela
Hürlimann. Zürich, 2003; 203–211
Historische Wissenschaft ist nicht Politikberatung; gleich- Tanner J. «Keimgifte» und «Rassendegeneration». Zum Drogendiskurs und
den gesellschaftlichen Ordnungsvorstellungen der Eugenik. In: Itinera
wohl können die Ergebnisse des Projekts den politischen
(hg. von der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz)
Meinungsbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess im 1999; 21: 249–258
Bereich der Sozial-, Gesundheits- und Wissenschaftspolitik
in wichtigen Punkten unterstützen. Über eine allgemeine
Sensibilisierung für Fragen der Integration und Ausgren-
zung und die Zwangsprobleme in der Psychiatrie hinaus
werden auch erstmals zuverlässige Informationen zur Rolle
von Psychiatern und medizinischen Institutionen bei inva-
siven und irreversiblen Eingriffen wie der Sterilisation und
Kastration von Frauen und Männern geboten. Die «Frei-
willigkeit» dieser Eingriffe wurde vielfach erzwungen.
Nicht zuletzt deshalb hat diese Praxis in den vergangenen
Jahren immer wieder Anlass zu politischen Diskussionen
gegeben.
12 NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006bundenen Ausschlussprozesse zu analysieren, aber auch die
Historische Forschung schafft sehr unterschiedlichen Formen der Dynamik von Aus-
politisches Orientierungswissen schluss- und Integrationsprozessen im Zusammenhang mit
anderen gesellschaftlichen Entwicklungen zu erforschen.
Es gibt kaum eine politische Analyse, kaum eine bundesrät-
liche Botschaft oder eine nationalrätliche Debatte, in der Dabei war es zentral, dass die historische Forschung hier
nicht zuerst die historische Entwicklung mehr oder weni- nicht nur als die Erforschung einer «Vorgeschichte» aufge-
ger ausführlich dargestellt wird. Dennoch ist historische fasst wurde, die alles, was nicht unmittelbar zur aktuellen
Forschung in den Nationalen Forschungsprogrammen, politischen oder gesellschaftlichen Lage beizutragen
deren Ziel die Untersuchung gesellschaftspolitischer Zu- scheint, ausblendet. Vielmehr wurde es durch die Forschung
sammenhänge ist, durchaus nicht die Regel, insbesondere ermöglicht, historische Entwicklungen auch in ihrer Eigen-
dann nicht, wenn sie mehr als die «Vorgeschichte» einer logik zu erfassen, Differenzen und Parallelen herauszuar-
Entwicklung darstellt. Beim NFP 51 war das anders. Hier beiten und gerade damit zur Analyse und Interpretation
wurde die Frage nach der historischen Entwicklung expli- von gegenwärtigen Entwicklungen beizutragen.
zit zum Ausgangspunkt des Forschungsprogramms.
Bedeutung der Schweizer Forschung für die internationale
Desiderat: Erforschung der Eugenik Debatte
Am Anfang der konzeptionellen Arbeit für das NFP «Inte- In den internationalen wissenschaftstheoretischen Debat-
gration und Ausschluss» Ende der 1990er Jahre stand die ten zeichnet sich eine neue Bewertung der historischen
Forderung, die Entwicklung der Eugenik in der Schweiz Eugenik ab. Die Eugenik, die bisher überwiegend als Teil
und in engem Zusammenhang damit auch die Geschichte nationalsozialistischer deutscher Politik analysiert wurde,
und Kultur der Fahrenden in der Schweiz zu erforschen. wird nun vermehrt als Bestandteil der Entwicklung der
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Wunsch nach bürgerlichen Moderne bewertet, mit welchem die demokra-
Perfektionierung der Menschheit in der Eugenik eine wis- tischen Staaten in Europa und den USA um 1900 die
senschaftliche Grundlage gefunden. Wissenschaftler, Bevölkerung an den sozialen und nationalen Rändern zu
Politiker und Ärzte beanspruchten zu entscheiden, was kontrollieren suchten. Die Radikalisierung der Eugenik im
«lebenswertes» oder «lebensunwertes» Leben und «gutes» Nationalsozialismus stellt dabei eher eine Ausnahme dar.
oder «schlechtes» Erbgut war. Eugenik, eigentlich «Lehre Die Erforschung «eugenischer Netzwerke» in demokrati-
vom guten Erbe», wollte Theorien und Ergebnisse der schen Staaten erscheint besser geeignet, das «normale»
Biologie dazu nutzen, das genetische Material sozialer Zusammenwirken von Wissenschaft, Politik und Verwal-
Gruppen und ganzer Nationen zu «optimieren». In der tung bei der Etablierung und Umsetzung eugenischer
Schweiz erfolgten die ersten eugenisch begründeten Konzepte und Massnahmen zu belegen. Für diese Neu-
Kastrationen um 1890, die ersten Sterilisationen um 1900, bewertung sind Schweizer Forschungsergebnisse von gros-
meist aufgrund unscharfer Diagnosen wie «Psychopathie» ser Bedeutung. Die der Eugenik zugrunde liegende biologi-
oder «Schwachsinn». Neben psychiatrischen Krankheiten sche Deutung gesellschaftlicher Verhältnisse sowie die dar-
wie Epilepsie oder Schizophrenie wurde auch uner- aus abgeleiteten Lösungsansätze zur Bewältigung sozialer
wünschtes soziales Verhalten – wie «Trunksucht», «Halt- Probleme schlugen sich in der Schweiz seit Beginn des 20.
losigkeit», «sexuelle Zügellosigkeit», «Liederlichkeit» oder Jahrhunderts vor allem in behördlichen Verfahren, kanto-
«Verschwendungssucht» – als Ausdruck einer erblichen nalen Gesetzen, Richtlinien und institutionellen Praktiken
Belastung verstanden. nieder, fanden aber nur teilweise Eingang in die nationale
Politik und Gesetzgebung. In diesem Zusammenhang ist
Zwar war aus der historischen Forschung bekannt, dass die Situation im Kanton Basel-Stadt von besonderem In-
auch in der Schweiz eugenisches Gedankengut sehr schnell teresse, weil es hier eine starke Ausprägung erbpsychiatri-
Verbreitung gefunden hatte; die Finanzierung einer detail- scher und eugenischer Forschung gab und mit der Eugenik
lierten Analyse der Entwicklung in verschiedenen Regio- Ende der 1930er Jahre spezifische Gesetze und Richtlinien
nen der Deutschschweiz blieb allerdings lange ein Problem, legitimiert wurden. Ein Netzwerk verschiedener Institutio-
auch dann noch, als das Bekanntwerden des Ausmasses nen und Behörden sorgte für deren Durchsetzung.
eugenischer Massnahmen in den skandinavischen Ländern
das öffentliche Interesse auch in der Schweiz erhöhte. Erst
durch die Einrichtung des NFP 51 wurde es möglich, diese
Entwicklung fundiert zu untersuchen und die damit ver-
NFP 51 Bulletin Nr. 3 | Mai 2006 13Sie können auch lesen