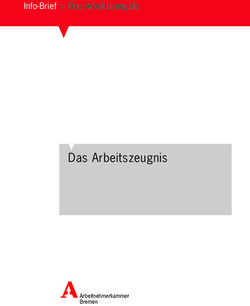PARTIZIPATIVE TECHNIK-FOLGENABSCHÄTZUNG EINES ZUKÜNFTIGEN ENERGIEMARKTDESIGNS - Autor*innen: Steffi Ober, Verena van Zyl-Bulitta, Marian Wuntke ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Autor*innen: Steffi Ober, Verena van Zyl-Bulitta, Marian Wuntke, Marcel Reichmuth PARTIZIPATIVE TECHNIK- FOLGENABSCHÄTZUNG EINES ZUKÜNFTIGEN ENERGIEMARKTDESIGNS
1
TABLE OF CONTENTS
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis ........................................................................ 2
Abkürzungen ................................................................................................................................ 3
Executive Summary ................................................................................................................. 5
1. Einleitung ................................................................................................................................. 6
2. Zwei Rollen Energiesystem im Wandel ................................................................ 9
2.1 Die Rolle des Endkunden vom einfachen Verbraucher zum
Prosumer ........................................................................................................................ 10
2.2 Utility 4.0: Der Wandel der Energiedienstleister in der
Digitalisierung des Energiesystems ........................................................... 12
3. Methodische Herangehensweise ........................................................................... 14
3.1 Grundlagen und Schritte der partizipativen TA (pTA) .................... 15
3.2 Partizipative Herangehensweise ................................................................... 16
Stakeholder .................................................................................................................................................... 16
Workshop Format und Phasen .......................................................................................................... 17
Parameter zur Thesenentwicklung ................................................................................................ 17
4. Inhalt ......................................................................................................................................... 19
4.1 Akteur*innen, Rollen, Parameter ................................................................. 20
4.2 Parameter ..................................................................................................................... 22
4.3 Gestaltungsoptionen und Feldbeschreibung ...................................... 24
4.4 Thesen ............................................................................................................................. 25
4.4.1 Fokusthese 1 ..................................................................................................................................... 27
4.4.2 Fokusthese 2 ................................................................................................................................... 28
5. Ergebnisse zu Spannungsfeldern und Nebenwirkungen..................... 29
5.1 Konfliktfelder, Ziel- & Interessenskonflikte
in den neuen Möglichkeiten ............................................................................ 30
5.1.1 Konfliktfelder und Herausforderungen (Zielkonflikte ersten Grades) .......... 30
5.1.2 Konfliktfelder und Herausforderungen (Zielkonflikte zweiten Grades) ....... 32
5.1.3 Konfliktfelder und Herausforderungen (Regulatorik) ............................................. 34
5.1.4 Konfliktfelder und Herausforderungen (Technologieebene) .............................. 34
5.1.5 Konfliktfelder und Herausforderungen
(Datenzugang/Datenverarbeitung) ................................................................................... 35
5.1.6 Konfliktfelder und Herausforderungen (Sozio-ökonomische Ebene) ........... 36
5.1.7 Konfliktfelder und Herausforderungen auf mehreren Ebenen ......................... 37
6. Lösungsoptionen .............................................................................................................. 40
6.1 Lösungsvorschlag zu Zielkonflikten ersten Grades ......................... 41
6.2 Lösungsoptionen für ZKs zweiten Grades .............................................. 42
7. Diskussion und Offene Fragen ............................................................................... 47
7.1 Flexibilitäten mit mehr oder weniger Autonomie ............................ 48
7.2 Geschäftsmodelle, Kundenbedürfnisse und Kooperationen ..... 48
7.3 Digitalisierung und Daten von einer
gesellschaftlichen Perspektive ...................................................................... 49
7.4 Automatisierung und Aktivierung
von Verhaltensänderungen für Flexibilisierung ............................... 49
7.5 Zusammenfassung .................................................................................................. 49
8. Fazit und Ausblick ........................................................................................................... 50
Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 522
TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1
Entwicklung der Stromindustrie entlang der Transformation
vom Versorgungswerk zum digitalen Energiedienstleister ............................................................. 13
Abbildung 2
Akteurs-Landschaft .................................................................................................................................................... 21
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 ..................................................................................................................................................................... 23
Tabelle 2
Beschreibung der Thesen zur Fokusthese 1: Prosumer und eEDU
beeinträchtigen die Rolle des Netzbetreibers ........................................................................................... 27
Tabelle 3
Beschreibung der Thesen zur Fokusthese 2: Das klassische
Versorgungsunternehmen wird trotz Digitalisierungs-Wandel (eEDU)
Schwierigkeiten bekommen, ein rentables Geschäftsmodell zu finden .................................. 28
Tabelle 4
Zielkonflikte zweiten Grades ................................................................................................................................. 333 ABKÜRZUNGEN ARegV Anreizregulierungsverordnung BKV Bilanzkreisverantwortliche(r) BnetzA Bundesnetzagentur eEDU digitalisiertes Energiedienstleistungsunternehmen EVU Energieversorgungsunternehmen IKT Informations- und Kommunikationstechnologie IT Informationstechnologie NB Netzbetreiber P2P Peer-to-Peer P2X Peer-to-X pTA partizipative Technikfolgenabschätzung SOC state of charge (Ladezustand der Batterie) TA Technikfolgenabschätzung ÜNB Übertragungsnetzbetreiber VNB Verteilnetzbetreiber
5
EXECUTIVE SUMMARY
Der deutsche Energiemarkt befindet sich seit Mitte der 1990er Jahre in einem umfangrei-
chen Veränderungsprozess mit dem Ziel, die Integration der erneuerbaren Energien zu
fördern. Im SynErgie-Projekt, eines von vier Kopernikus Projekten, werden die zukün-
ftigen Systemcharakteristika im Hinblick auf die Flexibilisierung der Nachfrage unter-
sucht. Für eine Umsetzung von Flexibilisierungsmaßnahmen sind verschiedene Lösungen
auf technischer, infrastruktureller sowie sozio-ökonomischer Verhaltensebene nötig. Um
mögliche Auswirkungen auf die Gesellschaft zu antizipieren, wurden in einer partizipati-
ven Technikfolgenabschätzung (pTA) Thesen aufgeworfen und in einem Expert*innen-Work-
shop bearbeitet. Die pTA erfolgte zu digitalisierten Stromsystemen mit dem Ziel, mögli-
che Risiken, Fehlentwicklungen, Lock-in-Effekte (langfristige irreversible Festlegung von
Investitions- und Infrastrukturentscheidungen) und Pfadabhängigkeiten frühzeitig zu
erkennen, zu analysieren und somit besser steuern zu können.
Mit der sozioökonomischen pTA wurden Chancen und Risiken des Ausbaus von Flexi-
bilitäten unter der Annahme vermehrter Technologieoptionen und Digitalisierung im
Stromsystem anhand von zwei Schwerpunktthemen systematisch analysiert und mögli-
che Gestaltungsoptionen geprüft. Im Mittelpunkt dieses partizipativen Ansatzes stand
ein thesenbasierter Workshop mit diversen Stakeholdern aus Wissenschaft, Zivilgesell-
schaft und Praxis. In diesem wurden Zielkonflikte durch die möglichen Veränderungen in
der Akteur*innenlandschaft identifiziert und zusätzlich erste Lösungsoptionen diskutiert.
Die Zielkonflikte und Lösungsoptionen spiegeln den Stand der Diskussion im Expert*in-
nen-Workshop wieder und geben Indikationen zu möglichen Entwicklungen und deren
Risiken und Nebenwirkungen. Für welche Akteur*innen welche Ausgestaltungen im
System wünschenswert sein könnten, wurde zudem erörtert. Auf Grundlage der identi-
fizierten Zielkonflikte und Lösungsoptionen können nun im nächsten Schritt für die Heraus-
forderungen der Energiewende durch die Dezentralisierung und Digitalisierung Lösungs-
optionen gemeinsam mit den Akteur*innen erweitert und ausgestaltet werden.6
1. EINLEITUNG –
EINE VERÄNDERTE
ENERGIEWIRTSCHAFT
Die vier Kopernikus-Projekte des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung (BMBF) untersuchen Rah-
menbedingungen, Umsetzungen und Technologien
für ein nachhaltiges Energiesystem der Zukunft mit
vermehrter erneuerbarer Erzeugung. Im SynErgie-
Projekt werden Flexibilitätsoptionen für ein erneu-
erbares Energiesystem mit den Möglichkeiten des
Netzausbaus, der Speicher, der Sektorenkopplung
und nachfrageseitige Flexibilität entwickelt (Reinhart
et al., 2020). Die energieintensive Industrie nimmt hier
eine Schlüsselrolle ein. Für die Umsetzung der Flexi-
bilität gibt es technische wie gesellschaftliche Heraus-
forderungen.
Im Rahmen des SynErgie-Projekts beschäftigt sich die-
ses Papier mit den sozioökonomischen Technikfolgen,
die durch die benötigten Flexibilitäten und unter der
Annahme vermehrter Technologieoptionen und Digi-
talisierung im Stromsystem entstehen. Insbesondere
wurden hierbei die neuen Rollen der Endkunden und
Energiedienstleister und deren Auswirkungen in der
Wertschöpfungskette betrachtet. Hierfür wurde eine
partizipative Technikfolgenabschätzung (pTA) mit ei-
nem Expert*innen Workshop zum Thema „Sozio-öko-
nomische Technikfolgen der energieflexiblen Indust-
rie in der Energielandschaft von Morgen“ durchge-
führt. Das Ziel dieser Technikfolgenabschätzung be-
steht darin, Konfliktfelder in den verschiedenen Gestal-
tungsoptionen für flexibilisierte Energiesysteme zu
identifizieren sowie Interessenkonflikte und Blickwin-7 kel der betroffenen Akteure zu beschreiben. Bewusst wurde ein partizipativer und transdisziplinärer Ansatz gewählt. Trans- disziplinäre Formate sind geeignet, um in gesellschaftlicher Interaktion die Optionenvielfalt einzuschränken, zu beurtei- len und somit zu gesellschaftlich tragbaren und sozial-robus- ten Lösungen zu gelangen (Böschen et al., 2021). Die Veränderungen im Energieversorgungssystem hin zu mehr Dezentralität und Partizipation bedeuten zwangsweise einen Paradigmenwechsel, in welchem neue Rollen entstehen und bestehende Akteur*innen ein neues Rollenverständnis einnehmen können. Gleichermaßen sind die Möglichkeiten der Zusammensetzung, Koordination, Betrieb und Orchest- rierung der Technologien und Infrastruktur erweitert oder verändert. Technik und Gesellschaft sind kein Dualismus, sondern ein eng verwobenes Netzwerk, in dem mal das eine, mal das andere Objekt oder Subjekt ist (vgl. Rammert 2016, 46).
8 Dieses Zusammenspiel innerhalb des Netzwerkes und hier- aus möglicher entstehender Konflikte werden im Laufe der Studie genauer betrachtet. Im Rahmen des SynErgie-Projektes werden die nötigen Tech- nologien für ein flexibleres Energiesystem untersucht. Tech- nologie ist aber nie nur aus technischen Komponenten zu- sammengesetzt, sondern beinhaltet in einem Wechselspiel von Technik und Gesellschaft immer auch politische, soziale, und ökonomische oder sogar kulturelle Aspekte (Manski & Bauwens, 2020). In einer großen technologischen Infrastruk- tur wie dem Stromsystem (Giotitsas et al., 2020) interagie- ren Lock-in Effekte in verschiedenen Kontexten mit wechseln- den bzw. interagierenden Machtoptionen durch Technik und gesellschaftliche Präferenzen. Gegenstand der Technikfol- genabschätzung sind Zielkonflikte und nicht intendierte Fol- gen von Entwicklungen in dieser Wechselwirkung zwischen Technik und Gesellschaft. Mit Infrastrukturentscheidungen geht oft das Eröffnen und Verschließen von Optionen einher. Speziell im Bereich der Energiewirtschaft sind diese Lock-in Effekte vor allem bei kapitalintensiven Anlagen entscheidend, so dass Änderungen oftmals mit Gewinnen, Verlusten und Interessenkonflikten einhergehen. Um die neuen Rollen, Märkte und Technologiekompositio- nen mit sinnvollen regulatorischen Rahmenwerken zu ver- sehen, besteht die Notwendigkeit, die bilanzielle Abrech- nungs- und Handelsgeschehensseite mit der Verantwort- lichkeit für physische Lastflüsse und die Instandhaltung des Stromnetzes zu koordinieren. Die Blickwinkel, die in dieser Studie schwerpunktmäßig gewählt wurden, sind die Auswir- kungen der veränderten Rolle des Endkunden hin zum Pro- sumer und die des Energiedienstleisters im Rahmen der Digitalisierung der Versorgung (Utility 4.0). Im Fokus stehen die betroffenen Akteur*innen und die Digitalisierungspoten- tiale in verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten sowie der daraus resultierende Nutzen.
9
2. ZWEI ROLLEN
ENERGIESYSTEM
IM WANDEL
Der deutsche Energiemarkt befindet sich seit Mitte der
1990er Jahre in einem umfangreichen Veränderungs-
prozess mit dem Ziel, die Integration der erneuerbaren
Energien zu fördern. Dieser Veränderungsprozess
umfasst Vorgaben und Maßnahmen zur Liberalisie-
rung, welche zu neuen und veränderten Rollenver-
ständnissen der Akteure führt. Im ersten Abschnitt
dieser Studie werden die Veränderungen zweier Rol-
len, die des Endkunden und die des Energiedienstleis-
ters im Energiesystem, beschrieben, um den Schwer-
punkt für die Technikfolgenabschätzung zu erläutern.10
2.1 DIE ROLLE DES END-
KUNDEN VOM EINFACHEN
VERBRAUCHER ZUM
PROSUMER
Die Energiewende als komplexe gesell- Der Begriff erweiterte sich später auf die In der „Prosumer-Ära“ (Sovacool, 2016)
schaftliche Aufgabe betrifft verschiedens- Erwartungshaltung und Fähigkeiten des wollen, können und sollen immer mehr
te Akteur*innen auf unterschiedlichen Prosumers als eine Art Endverbraucher, Konsumenten eine Prosumer-Rolle ein-
Ebenen, die passive oder aktive Rollen der professionalisiert und interessiert an nehmen, besonders wenn marktliche
einnehmen können. Mit der Liberalisie- der Bereitstellung von Flexibilität und sowie technische und sozio-technische
rung, Deregulierung sowie den Effekten Teilnahme an neuen Geschäftsmodellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Inte-
vermehrter Dezentralisierung gibt es ist (Sioshansi, 2019). Welchen Effekt die- gration von Prosumern im Energiesys-
für immer mehr Akteur*innen neue Mö- ser Rollenwandel auf verschiedene Sy- tem existieren. Durch das erweiterte Rol-
glichkeiten, sich im Energiesystem aktiv stemlevels hat, hängt stark von Regula- lenverständnis, die neuen Möglichkeiten
zu beteiligen. Insbesondere vermischen rien und Anreizen ab. Diese erweiterten in der dezentralen Energiewende sowie
sich mehrere Funktionen in neuen Rol- Möglichkeiten können auch nachhaltige durch Entwicklungen hin zu Rekommu-
len wie zum Beispiel die des Prosumer Wirkungen haben. Jedoch ist die genaue nalisierung, können sich „Flickenteppi-
oder Prosumenten, eine Kombination Auswirkung stark abhängig von der je- che von Eigentumsverhältnissen (owner-
aus Produzent und Konsument. Die ur- weiligen Akteur*innen-Perspektive und ship patchwork)“ (Moss et al., 2015) bil-
sprüngliche Herkunft des Begriffs geht deren Bewertungsmaßstäben (Gonella, den. Diese variieren entlang der lokalen
auf den historischen Strukturwandel, 2019). Ziel der Studie ist es, diese Auswir- politischen, (infra-) strukturellen, insti-
wie Güter produziert und konsumiert kung genauer zu beleuchten. tutionellen und sozio-ökonomischen Kon-
werden, zurück (Toffler, 1980). texte sowie den damit in Zusammenhang
stehenden Machtverhältnissen (Moss et
al., 2015).11
Das Geschäftsmodell des letzten Jahr- grund von intrinsischer Motivation netz-
hunderts ermöglichte kaum oder wenig dienlich verhalten und somit System-
Entscheidungsfreiheit für die Verbrau- dienstleistungen erbringen. Große Indu-
cher*innen. Mit der Transformation des striekund*innen, die Versorgung und
klassischen Endverbrauchers hin zum Verbrauch gleichermaßen betreiben,
Prosumer ergeben sich neue Möglichkei- bekleiden ebenfalls die Rolle eines Pro-
ten für eine Bottom-Up Teilhabe. Ausge- sumer und spielen im SynErgie Projekt
hend von der derzeitigen Top-Down eine entscheidende Rolle in der For-
Perspektive entsteht mehr Komplexität, schung. Wie sich die Rollen und Wirkwei-
da nun auf unteren Netzebenen Aktivi- sen der anderen Akteur*innen in der
täten stattfinden, die vorher nicht mö- Wertschöpfungskette durch diese Ver-
glich waren. Ein Prosumer mit eigenem änderung der Endkonsument*in ändern,
Speicher kann sich bei angemessenen wurde mit der Technikfolgenabschät-
externen Anreizsystemen oder auch auf- zung untersucht.
Um das komplexe Feld der Energieland-
schaft weiter aufzuspannen, wird zudem
die Rolle der Energiedienstleister und
dessen Veränderung analysiert.12
2.2 UTILITY 4.0:
DER WANDEL DER
ENERGIEDIENSTLEISTER
IN DER DIGITALISIERUNG
DES ENERGIESYSTEMS
Durch die Deregulierung und Liberalisie- tragung mit Liberalisierung, Wettbewerb
rung des Energiemarktes ergeben sich und Differenzierung und einer Versor-
neue Möglichkeiten und Grenzen zwischen gungslandschaft, die von mündigen Kund*
Verteilung und Vertrieb. Gleichzeitig lö- innen mitgestaltet wird. In der Transfor-
sen sich durch das Aufkommen von Ak- mation der Utility 3.0 standen Dienstleis-
teur*innen wie Prosumern sowie durch tungen im Vordergrund, mit erweiterten
die Digitalisierung in der Versorgungsinf- Produktangeboten des Energiedienstleis-
rastruktur bestehende Grenzen auf. Diese tungsunternehmens und der aufkommen-
Grenzverschiebung betrifft insbesonde- den Rolle des aktiven Prosumers. Im Rah-
re die Energiedienstleister (EDU), die sich men der TA wird unter Utility 4.0 der Wan-
vom einfachen Energieversorgungsunter- del der Energiedienstleistungsunterneh-
nehmen (EVU) hin zum digitalen Energie- men hin zum digitalen Energiedienstleis-
dienstleister (eEDU) wandeln. tungsunternehmen verstanden (vom EDU
zu eEDU). Dieser Wandel der Energiever-
Die Bezeichnung Utility 4.0 (Doleski, 2016, sorgungsunternehmen hin zum digitalen
2020a, 2020b; Schallmo et al. 2017) be- Energiedienstleistern ist in Abbildung 1
schreibt die Transformation der Rolle von schematisch dargestellt. Durch den der-
Versorgern (Sioshansi, 2016), die sich zeit stattfindenden letzten Schritt der
durch die Digitalisierung der Energiever- Utility 4.0 sollen insbesondere der bidi-
sorgung und die digitale Transformation rektionale Informationsaustausch und
der Wertschöpfungskette ergeben. Der Plattformaktivitäten an Bedeutung ge-
Zusatz 4.0 bezieht sich auf ähnliche Ent- winnen. Hieraus ergeben sich wiederum
wicklungen wie zum Bespiel in der Indu- Herausforderungen, Ziel- und Interessen-
strie 4.0. Für den Bereich Strom bedeute- konflikte, die ebenfalls betrachtet werden
te Utility 1.0 Versorgungswerke, Elektri- müssen.
fizierung und Verteilung aus einer Hand.
Utility 2.0 bezeichnet die Entwicklung
der Trennung von Erzeugung und Über-13
ABBILDUNG 1
Entwicklung der Stromindustrie entlang der
Transformation vom Versorgungswerk zum
digitalen Energiedienstleister
(Quelle: Doleski, 2016, S. 13).
Doleski (2017) beschreibt die Herausfor- von Flexibilisierungsmaßnahmen im Rah-
derungen und Gratwanderungen in der men dieser Rollen der eEDUs gibt es ver-
Rollenidentität und Definition von eEDUs schiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten
hin zu technologieaffinen Innovator*innen, der damit in Zusammenhang stehenden
kundenorientierten Serviceanbieter*in- Dienstleistungen. Insbesondere in den
nen, regionalen Wertschöpfungspartner*- Interaktionen mit den aufkommenden
innen, virtuosen Social-Media-Anwender*- Prosumern gibt es Fragen zur Verteilung
innen und verantwortlich handelnden Tei- der Verantwortung und der Notwendig-
len der Gesellschaft. Für die Umsetzung keit von Datenaustausch sowie Teilhabe.14
3. METHODISCHE
HERANGEHENSWEISE
Die Wahl der Schwerpunkte, Prosumer und der eEDU
Prozess der Utility 4.0 wurde getroffen, weil durch diese
Akteur*innen die Effekte von Dezentralisierung, Eigen-
verbrauch, Anbindung ans Netz, (lokale) Märkte und
Digitalisierung breit dargestellt werden können. Die
Effekte durch den Wandel dieser Rollen auf die derzei-
tige und zukünftige Energieversorgung wurden in die-
ser Technikfolgenabschätzung anhand eines partizipati-
ven Ansatzes untersucht.15 3.1 GRUNDLAGEN UND SCHRITTE DER TECHNIK- FOLGENABSCHÄTZUNG (TA) Um ein Verständnis für die Strukturen im und zu evaluieren, war es zentral, einen Allgemein hilft eine systemische Betrach- Stromsystem und die institutionellen und Rahmen für die Erschließung der mög- tung im Rahmen einer TA bei der Ein- rechtlichen Rahmenbedingungen zu ge- lichen Zukünfte für die Entwicklung der schätzung, inwiefern Änderungen und winnen, wurde die Akteur*innenlandschaft Systemlandschaft abzustecken. Je nach- Anpassungen auf Seiten der Rollen, Funk- entlang der Rollen, Interessen, Ziele und dem wie sich die Funktionen innerhalb tionen und Regulatorik gesellschaftlich Geschäftsmodelle beschrieben. Ausgehend der neuen und alten Akteur*innenrollen wünschenswert sind. Durch den systemi- von einem systemischen Ansatz sollen die unter den neuen technologischen Mög- schen Ansatz wird transparenter, welche derzeitigen und zukünftigen Möglichkeits- lichkeiten verändern, ergeben sich be- Interessen und Machtungleichgewichte für räume der Akteur*innen an sich und die stimmte Konflikt- und Spannungsfelder. die Verteilung von Ursachen und Wirkun- Interaktionen zwischen den Akteur*innen Diese Zielkonflikte sind insbesondere für gen ausschlaggebend sind. Darauf basie- herausgearbeitet werden. Mit dieser Feld- die Übergangszeiträume, in denen der rend können gesellschaftliche Aushand- beschreibung wurden zur Bewertung und regulatorische Rahmen noch nicht hin- lungsprozesse für die Ausgestaltung der Wahl der Schwerpunkte sozioökonomi- reichend auf die Entwicklungen und Mög- Wandlungsprozesse informiert werden. sche Parameter identifiziert. Um Zielkon- lichkeiten angepasst ist, genauer zu be- flikte zwischen Akteur*innen zu erkennen achten.
16
3.2 PARTIZIPATIVE 3.2.1 STAKEHOLDER DER
HERANGEHENSWEISE EXPERT*INNENRUNDE
Für die Expert*innenrunde
Um die erarbeiteten Schwerpunkte beim wurden folgende Ziele definiert: Die Stakeholder wurden zu einem ge-
digitalen Wandel der Energiewirtschaft meinsamen Termin im Format eines
möglichst umfassend, zielführend und › Erlangen eines breiteren Blickwinkels Thesen-Workshops als Expert*innen-
mit aussagekräftigen Resultaten im Rah- zu den konkreten Themenschwerpunk- runde eingeladen. Die Teilnehmenden
men der TA zu beleuchten, ist die Einbin- ten durch die Zusammenarbeit der kamen aus verschiedenen Institutionen
dung diverser Expert*innen aus den Fel- Expert*innen und verteilten sich auf die Sektoren
dern der Forschung und Energieindustrie Wissenschaft (7), Zivilgesellschaft (1),
von zentraler Bedeutung. Dazu wurden › Unterschiedliche Positionierungen Industrie (2).
vorab Sondierungsgespräche geführt, sichtbar zu machen und zu verstehen
um die Schwerpunktthemen Prosumer
und Utility 4.0 zu schärfen. Wesentlich › Im Rahmen der Positionen die jeweili-
für eine partizipative TA ist jedoch, nicht gen Zielkonflikte zu identifizieren und
nur die Einzelbetrachtungen der Exper- herauszuarbeiten
tisen zu erhalten, sondern die konstruk-
tive Interaktion untereinander zu einem › Eine übergeordnete Validierung der
konkreten Thema zu ermöglichen. Dazu Schwerpunktthemen hinsichtlich deren
wurde auf das Format der Expert*innen- Relevanz und Bedeutung zu erheben
runde zurückgegriffen und zu einem ge-
meinsamen Termin eingeladen. › Ableitend davon die weiterführenden
Fragestellungen, Thesen und Handlungs-
optionen zu den Konflikten zu identifi-
zieren17
3.2.2 WORKSHOP FORMAT
UND ABLAUF
Aufgrund der aktuellen Pandemie wurde
ein virtuelles Workshop-Format entwickelt,
um die gemeinsame Arbeit möglichst effi-
zient und gewinnbringend für alle Beteilig-
ten zu nutzen. Das Gesamtkonzept des
Workshops war in vier konsekutive Phasen
aufgeteilt:
Phase 1:
gemeinsames Verständnis der Aus-
gangslage etablieren mit Bezug auf
die Rahmendaten des Szenarios,
relevanten Akteur*innen sowie der
thematischen Schwerpunkte
Phase 2:
eigenständiges Erarbeiten der persön-
lichen Themen zum jeweiligen Schwer-
punkt
Phase 3:
Austausch in der Kleingruppe über die
einzelnen Themen sowie gemeinsame
Auswahl und Bearbeitung anhand rele-
vanter Thesen
Phase 4:
übergreifender Austausch der Ergeb-
nisse aus den Kleingruppen im Plenum
mit anschließender Feedbackrunde18
Phase I:
Vor dem Hintergrund, dass Expert*innen
aus verschiedensten Fachbereichen zu-
sammenkommen und dadurch unter-
schiedliche Wissensstände bestehen, war
es von zentraler Bedeutung, in Phase 1
sämtliche Teilnehmer*innen schrittweise Phase 2:
auf ein gemeinsames Verständnis zu
bringen. Dazu wurden die wichtigsten Die Teilnehmer*innen wurden basierend fliktpotentiale konnten die Expert*innen
Kennzahlen des derzeitigen und zukünf- auf ihrer persönlichen Vita passend auf eine kollektive Wertung erstellen. Darauf-
tigen Feldes vorgestellt und erklärt.1 jeweils ein Schwerpunktthema einer Klein- folgend wurden die selektierten Thesen
Insbesondere wurde auf die Rahmen- gruppe zugeordnet. Dies erfolgte, damit nacheinander in der Kleingruppe bearbei-
daten der Energielandschaft und dessen die jeweilige Thematik für alle Teilneh- tet und diskutiert. Aufgrund der Dichte
Veränderung vom derzeitigen Stand mer*innen relevant ist und sie sich pro- an Informationen wurde jede Gruppe von
hin zur zukünftigen Landschaft einge- aktiv einbringen können. Nach einer Vor- zwei Facilitator*innen begleitet, um die
gangen. Diese Kennzahlen und Rah- stellungsrunde in der jeweiligen Klein- Inhalte und Ergebnisse übergreifend
mendaten beinhalten folgende Parame- gruppe wurden zuerst die einzelnen Wis- festzuhalten.
ter: (1) Stromverbrauch, (2) Treibhaus- sensstände und Perspektiven zu den The-
gasminderung, (3) Anteil Erneuerbarer menschwerpunkten abgefragt, bevor Phase 4:
Energien, (4) Elektrifizierung der Sekto- diese mit dem Rest der Gruppe abgegli-
ren, (5) Grad der Dezentralisierung der chen und bewertet wurden. Die anschließende Vorstellungsrunde der
Netze, (6) Anlagengröße zur Einspeisung Ergebnisse der Diskussionsrunde ermög-
der Energiequellen sowie die entspre- Phase 3: lichte zum einen Einblicke in Ergebnisse
chend (7) relevanten technischen Verän- der anderen Gruppe. Zum anderen bot
derungen. Die identifizierten relevanten Im nächsten Schritt wurden vorab zu den sich die Möglichkeit, Feedback der ande-
Akteure mit ihren Rollen und Zielen wur- Schwerpunktthemen Thesen formuliert, ren Teilnehmer*innen zu erhalten und ei-
den für das gemeinsame Verständnis um deren Kernaussagen provokativ zu- gene Einsichten zu teilen. Damit konnten
ebenfalls vorgestellt und beschrieben. zuspitzen und damit zugänglicher für die die Gruppenarbeiten abschließend über-
Fragen dazu konnten anschließend im folgende, gemeinsame Bearbeitung auf- greifend betrachtet werden. Zum gemein-
Plenum geklärt werden. So wurde eine bereitet zu haben. Hierdurch konnte der samen Abschluss gab es für alle Teilneh-
gemeinsame Basis geschaffen, um die Rollenwandel der im Fokus in den beiden mer*innen eine gemeinsame Feedback-
beiden Themenschwerpunkte „Utility Schwerpunktthemen war mit einer reich- runde, in welcher inhaltliche wie auch me-
4.0“ und „Prosumer“ zugänglich zu ma- haltigen Auswahl an weiteren Thesen er- thodische Anmerkungen sowie persönliche
chen und für die nächste Arbeitsphase weitert werden. Durch die anschließende Eindrücke festgehalten wurden.
genauer zu beschreiben. gemeinsame Auswahl der Thesen hinsich-
tlich deren Relevanz und möglichen Kon-
1
Kennzahlen aus dem Kopernikus Schwesterprojektes ENSURE-Storyline D („dezentral“)19
4. INHALT
Das Ziel der pTA besteht darin, Konfliktfelder zu identi-
fizieren sowie Interessen und Blickwinkel der betroffe-
nen Akteure zu beschreiben. Damit die Interaktionen
und Interessen der Akteure*innen im Feld aber nach-
vollzogen werden können, muss im ersten Schritt die
Akteur*innenlandschaft und das Feld, in welchem sich
die Akteur*innen bewegen, betrachtet werden.20
4.1 AKTEUR*INNEN &
ROLLEN
Um die Akteur*innenlandschaft zu ana- der Akteur*innen zusammengefasst und Service zur Verfügung zu stellen. Zusätz-
lysieren, wurden die derzeitigen Funktio- vereinfacht dargestellt. So lässt sich die lich bieten sie weitere Services wie zum
nen, Rollen, Geschäftsmodelle, Ziele der Rolle der Energieerzeuger auf den Auf- Beispiel Smart Home Lösungen an. In die-
Akteure beschrieben, so dass der Kontext und Ausbau von (erneuerbarer) Energie- sem Kontext wurden Akteure, die als Ser-
und auseinanderdriftende Konflikte sicht- erzeugungsanlagen, der Erzeugung von viceprovider und Energielieferanten gleich-
bar werden. Diese stark vereinfachte Land- (erneuerbarer) Energie und der damit ver- zeitig auftreten, als Energiedienstleister
schaft besteht aus folgenden Systemak- bundenen Grundversorgung sowie Bereit- bezeichnet. Decken sie zusätzlich auch
teur*innen: stellung von Regel-, Primär-, Sekundär- noch die Energieerzeugung ab, wurden
leistung mit den entsprechenden Reser- sie in diesem Rahmen als Energieversor-
› Energieerzeuger & Kraftwerksbetreiber ven reduzieren. Im vereinfachten Kontext gungsunternehmen benannt. In der Netz-
› Energielieferanten zielen die Energieerzeuger auf die Ver- hemisphäre dieser Akteur*innenland-
› Messung- und Servicedienstleister marktung und Verkauf von Energie, um schaft wurden die Verteil- und Übertra-
› Kunden den Shareholder Value zu steigern. In gungsnetzbetreiber als Netzbetreiber
(Industrie, Gewerbe und Haushalte) dieser Landschaft beschränkt sich die zusammengefasst, deren Rolle es ist,
› Netzbetreiber Rolle des Energielieferanten auf den Ein- die bedarfsgerechte Instandhaltung und
(Übertragung- & Verteilnetzbetreiber) kauf von Energie und der anschließen- Dimensionierung des Stromnetzausbaus
den Stromlieferung und Abrechnung an zu betreuen. Sie gewährleisten einen dis-
Um die Komplexität zu reduzieren, wur- (Groß-)Kunden / Endverbraucher. Damit kriminierungsfreien Netzzugang und
de bei der Akteur*innenlandschaft be- reduziert sich ihr Ziel auf Kundenbin- Netzanschluss, um die Netznutzung zu
wusst auf Akteur*innen aus dem Ener- dung und Kundenausbau, um den Profit ermöglichen. Diese Akeur*innenland-
giehandel, den Bilanzkreisverantwort- zu steigern. Selbiges Ziel haben auch die schaft ist schematisch in Abbildung 2
lichen und Kommunen verzichtet. Damit Messung- und Servicediensleister, deren dargestellt.
die Teilnehmenden der Expert*innenrun- Rolle es in dieser Landschaft ist, Mess-
de einen schnellen Zugang zu der Land- systeme bereitzustellen, zu betreuen und
schaft erlangen konnten, wurden die oft durch Ablesung und Datenübermittlung
komplexen Ziele und Geschäftsmodelle den mit den Messungen verbundenen21 ABBILDUNG 2
22 4.2 PARAMETER Um im weiteren Verlauf der TA die Ziel- und Interessenkonflikte besser beschrei- ben und ordnen zu können, wurden 40 Parameter in sieben Kategorien bestimmt. Diese sind Tabelle 1 zu entnehmen. Der Zweck der Parameter war eine einheit- liche Beschreibung von möglichen Änder- ungen in der Zukunft und Trends, die sich bereits in der Gegenwart zeigen, um mögliche Zielkonflikte sichtbarer zu ma- chen. Deswegen wurden bei manchen Parametern die Extrempunkte der Spek- tren in einem Bereich benannt. Fragen dazu, welche veränderten Rollen durch Technik und Teilhabe aus Entwicklung- en in Bottom-Up und Top-Down Prozes- sen entstehen und dann Effekte und Wechselwirkungen haben könnten, wur- den in diesem Ansatz kritisch diskutiert.
23
TABELLE 1
KATEGORIE PARAMETER
Normativer Rahmen Legalität, Legitimität, (Ethische) Akzeptabilität, Akzeptanz
Kommunikationshäufigkeit, IT-Kompetenz,
Technisch
Infrastruktur- & Netzausbau / -kosten
Komfort(-einbußen), Energiearmut, Energiegerechtigkeit / -fairness,
Sozial
Flexibilitätsgerechtigkeit, Förderung des sozialen Zusammenhalts
Energie- und klimapolitische Effizienz, Kosteneffizienz / Gesamtkosten, Resilienz, Effektivität
Zielsetzungen
Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt, Wirtschaftliche Planungssicherheit,
Optimierungs-Bezugsrahmen / Referenzsystem, Standortsicherung,
Strukturwandel durch Outsourcing, Verteilung von Flexibilitätskapital,
Ökonomisch
Unsicherheiten, Geschäftsmodellinnovationen, Diversität der Geschäftsmodelle,
Digitaler Zwilling, Wertschöpfungsverschiebung, Individualisierung von
Produkten und Marketingmaßnahmen, Ökonomische Dezentralisierung
Umwelt- und Ressourcenschonung, Schutz der menschlichen Gesundheit,
Ökologisch Ökologie Effekte / Klimaschutz, Unsicherheiten, sektorübergreifende Effekte,
Ressourcen- & Energieverbrauch durch zusätzliche Technik / Messtechnik
Datenallmende versus Privateigentum, Datenoffenheit – Zugang zu Techno-
logien / Daten, Datenkontrolle / -hoheit, -souveränität, -solidarität, Daten-
verwertung; Integration / Zugang verschaffen für Technologien, Passivität /
Inaktivität versus Agency, Rollenpluralität / Diversität versus Rolleneindeu-
Teilhabe / Agency
tigkeit, Administrative Unterstützung für Teilhabe / Partizipation, Datenzu-
gang für lernende Algorithmen, Mitgestaltung lernende Systeme, Level an
Fernsteuerung, Demokratische Teilhabe / Mitbestimmung / Partizipation /
Anreize24
4.3 GESTALTUNGS-
OPTIONEN UND
FELDBESCHREIBUNG
Gestaltungsoptionen für die Energiesys- Die Themen, die spezifisch zu den Schwer- Neben Sektorenkopplung und Power-to-
temlandschaft von Morgen mit neuen punkten anhand von Thesen untersucht X (P2X) wurden verschiedene Modelle für
Rollen, Graden an (De-)Zentralisierung wurden, spannen eine breite Landschaft Peer-to-Peer (P2P)-Systeme und Handel,
und Automatisierung sowie Speicher- zu technischen, sozialen und ökonomi- im Detail erörtert.
möglichkeiten und Marktdesign müssen schen Fragestellungen, sowie Fragen zu
sowohl technische als auch soziale und Koordinationsmechanismen auf. Im Be- Im Folgenden werden die Thesen, die die
ökonomische Aspekte berücksichtigen. reich der Technik wurden insbesondere Gestaltungsoptionen und Feldbeschrei-
An welchen Stellen welche(r) Akteur*- Betriebsweise, Größe und den Eigentums- bung für den Workshop strukturierten,
in(nen) dazu notwendige Koordinations- verhältnissen der Speicheroptionen disku- vorgestellt.
aufgaben übernehmen sowie Datenana- tiert. Im Spektrum der ökonomischen
lysen und Prognosen durchführten und und sozialen Seite der Versorgungsinfra-
bereitstellten, hängt stark von den Regu- strukturen wurde die Verantwortung für
larien und technischen Gegebenheiten Versorgungsengpässen erörtert. Des Wei-
ab. Immer mehr Möglichkeiten werden teren spielen die erforderlichen Lösungen
durch Digitalisierung und Dezentralisie- in der größen- und räumlichen Differen-
rung eröffnet, was Auswirkungen auf zierung für Verbraucher*innen oder Pro-
den Betrieb, Handel und das Umfeld hat, sumer(-Kollektiven) im lokalen Kontext
in dem eine Akteur*in eingebettet ist. (wie Stadt/Land) eine Rolle.
Um die Möglichkeitsräume für verschie- Unter den rechtlichen Aspekten wurden
dene Zukünfte zu erörtern, wurden zu- Finanzierungs- und Profitabilität der Rol-
nächst die technisch, sozial und ökono- len und Funktionen sowie das Aufkom-
misch denkbaren Optionen beschrieben. men neuer Geschäftsmodelle themati-
Basierend darauf konnten akteur*innen- siert. In Bereichen, in denen zukünftig
spezifische Interessen, die in Zukunft zu eigenständig entschieden werden kann,
Zielkonflikten führen können oder gegen- eine Verbindung zum Stromnetz auf-
wärtig schon präsent sind, diskutiert recht zu erhalten oder nicht, sind tech-
werden. nische Möglichkeiten, finanzielle Anreize
und soziale Themen wie Solidarität oder
Entsolidarisierung höchst relevant.25 4.4 THESEN ALS BASIS FÜR DIE EXPERT*INNENRUNDE Als Ausgangspunkt der pTA wurden die Schwerpunkte Prosumer und Utility 4.0 vorgestellt. Um den Rollenwandel der Endverbraucher*innen und EDU hin zu Prosumer und eEDU und die damit ver- bundenen sozioökonomischen Folgen zu bearbeiten, wurden auf Grundlage der möglichen Veränderungen Thesen gebil- det. Hierfür wurden mehrere kontrover- se Thesen in acht Themengebieten der Digitalisierung und Dezentralisierung des Energiemarktes vorab formuliert. Zu folgenden Themengebieten wurden The- sen gebildet: 1. Netz und physikalische Infrastruktur 2. Speicher 3. Automatisierung 4. Digitalisierung 5. Sektorenkopplung 6. Rollentransformation 7. (De)zentralisierung 8. Marktdesign Anschließend wurden zwei übergeordne- te Fokusthesen gewählt, welche der Expert*innenrunde als Grundlage ihrer Diskussion dienten. Die beiden Fokus- thesen wurden in der Expert*innenrunde zusammen mit ihren Unterthesen, die der ausführlicheren Erläuterung dienten, vorgestellt.
26
FOKUSTHESE 1: FOKUSTHESE 2:
Prosumer und eEDU Das klassische Versorgungs-
beeinträchtigen die Rolle unternehmen wird trotz
des Netzbetreibers des Digitalisierungs-Wandels
(eEDU) Schwierigkeiten
Unterthese 1: bekommen, ein rentables
Geschäftsmodell zu finden
Der liberalisierte Strommarkt hat
die Akteure (Erzeuger, Netzbetreiber,
Unterthese 1:
Versorger, Kunde) voneinander
entfremdet.
Die Umsetzung von Effizienz- und
Suffizienzmaßnahmen (weniger Ver-
Unterthese 2:
brauch) führt zu weniger Einkom-
men für Versorgungsunternehmen.
Wenn keine Anreize für Prosumer da
sind, wird es auch keine Prosumer
Unterthese 2:
geben. Anreize müssen über die Regu-
lierung für Marktdesign & Geschäfts-
Prosumer-Kollektive stehen im Wett-
modelle geschaffen werden, ohne zu
bewerb mit eEDU.
Lasten der Solidargemeinschaft zu
fallen.
Unterthese 3:
Unterthese 3:
Die digitale Transformation des Energie-
sektors könnte die Rolle eines Energie-
Wenn Ausgleich- und Netzstabilisierung
versorgungsunternehmens (EVU) zum
als Dienstleistung im Vordergrund steh-
Anbieter von Reservestrom schrumpfen
en, kann Verschwendung (Mehrverbraucht
lassen.
statt Einschränkungen) entsprechend
der lokalen und zeitlichen Gegebenhei-
ten für das Gesamtsystem einen Nutzen
(technisch, ökologisch) beinhalten.
Unterthese 4:
Der Prosumer profitiert von der öffentli-
chen Netzinfrastruktur und hat keine
Anreize, um in Fallback-Optionen wie
große Speicher zu investieren.
Die jeweilige Fokusthese beschreibt das
generelle Konfliktfeld einer möglichen
Zukunft, während die Unterthesen den
Teilnehmenden einen Kontext der
Fokusthese lieferten. Die zwei Fokusthe-
sen mit ihren Unterthesen werden im
Folgenden genauer erläutert.27
4.4.1 FOKUSTHESE 1:
PROSUMER UND EEDU Konflikten, die auch in die Netzhemi- TABELLE 2
BEEINTRÄCHTIGEN DIE sphäre der Akteur*innenlandschaft
ROLLE DES NETZBE- treten. Die Fokusthese soll darstellen, BESCHREIBUNG DER THESEN ZUR
TREIBERS dass es Überschneidungen und darin FOKUSTHESE 1: PROSUMER UND
mögliche Konfliktfelder zwischen den EEDU BEEINTRÄCHTIGEN DIE ROLLE
In beiden Schwerpunkten findet ein neuen Rollen der Prosumer und eEDU DES NETZBETREIBERS
Rollenwandel von Akteur*innen statt. und der etablierten Rollen und Funk-
Dieser Wandel führt zwangsweise zu tionen der Netzbetreiber gibt.
UNTERTHESE BESCHREIBUNG
Der liberalisierte Strommarkt hat Die Liberalisierung des Energiemarkts und damit intentionale Trennung von
die Akteur*innen (Erzeuger*innen, Erzeugung und Verbrauch führte dazu, dass die Wertschöpfungskette nicht
Netzbetreiber, Versorger, Kund*in- mehr in einem Unternehmen vereint sein kann. Dies führt zu Kommunikati-
nen) entfremdet. ons- und Verantwortungskonflikten.
Wenn Ausgleich- und Netzstabilisie- Derzeit fehlen Anreize für netzdienliches Verhalten und Rahmenbedingun-
rung als Dienstleistung im Vorder- gen für einen Mehrverbrauch (zum Beispiel durch Probleme bei den Kunden-
grund stehen, kann Verschwendung größen / Kategorien, mit denen der Netzbetreiber interagiert, und der Da-
(Mehrverbrauch statt Einschränkun- tengrundlage für eine netzdienliche Steuerung).
gen) entsprechend der lokalen und
zeitlichen Gegebenheiten für das Ge-
samtsystem einen Nutzen (technisch,
ökologisch) beinhalten.
Endverbraucher beschäftigen sich wenig mit der Thematik „Strom“. Es müs-
Wenn keine Anreize für Prosumer sen Anreize über die Regulierung für Marktdesign & Geschäftsmodelle ge-
da sind, wird es auch keine Prosu- schaffen werden, ohne zu Lasten der Solidargemeinschaft zu fallen, damit
mer geben. der Rollenwandel des Endverbrauchers überhaupt im gewünschten Maße
stattfindet.
Der Prosumer profitiert von der öf- Ähnlich wie in Unterthese 2 thematisiert sollten Prosumer ihre Speicher-
fentlichen Netzinfrastruktur und möglichkeiten dem öffentlichen Netz zur Verfügung stellen, um sich netz-
hat keine Anreize, um in Fallback- dienlicher und damit als gesamtgesellschaftliche*r Akteur*in zu verhalten.
Optionen wie große Speicher zu
investieren.28
4.4.2 FOKUSTHESE 2: Die Unterthesen zur zweiten Fokusthese TABELLE 3
DAS KLASSISCHE VERSOR- und deren Beschreibungen sind der Ta-
GUNGSUNTERNEHMEN belle 3 zu entnehmen. Die zweite Fokus- BESCHREIBUNG DER THESEN ZUR
these konzentriert sich verstärkt auf den FOKUSTHESE 2:. DAS KLASSISCHE
WIRD TROTZ DIGITALISIE-
Wandel der EDUs und deren zukünftigen VERSORGUNGSUNTERNEHMEN WIRD
RUNGS-WANDEL (EEDU) Geschäftsmodellen. Da derzeitige EDUs TROTZ DIGITALISIERUNGS-WANDEL
SCHWIERIGKEITEN BEKOM- sehr langsam auf Innovationen reagieren, (EEDU) SCHWIERIGKEITEN BEKOMMEN,
MEN, EIN RENTABLES könnten sie in Zukunft Schwierigkeiten EIN RENTABLES GESCHÄFTSMODELL
GESCHÄFTSMODELL ZU haben, sich am wandelnden Markt zu be- ZU FINDEN
FINDEN. haupten. Neue Akteure drängen auf den
Markt, die sehr viel schneller auf die neu-
en Bedingungen, die durch die Digitalisie-
rung entstehen, reagieren können und
verdrängen so die etablierten Akteure der
Energiedienstleistung.
THESEN BESCHREIBUNG
Durch regulatorische (z. B. ökonomische) Anreize Energie einzusparen,
Die Umsetzung von Effizienz- und
können Versorger bei derzeitigen Geschäftsmodellen und Abrechnungs-
Suffizienzmaßnahmen (weniger
systemen Einkommenseinbußen haben. Sie werden deshalb gegen
Verbrauch) führt zu weniger Ein-
Effizienz und Suffizienz-Regelungen agieren und den gewünschten Wandel
kommen für Versorgungsunter-
nicht unterstützen. Das kann sich indirekt auch auf weitere Flexibilisie-
nehmen.
rung der Nachfrage auswirken.
Die digitale Transformation des Als kontroverses Szenario, in welchem sich Eigenverbrauch und dezentrale
Energiesektors könnte die Rolle Märkte und Speicheroptionen verbreiten würden, könnte sich die Rolle des
eines Energieversorgungsunter- Energieversorgungsunternehmen zum reinen Backup degradieren.
nehmens (EVU) zum Anbieter von
Reservestrom schrumpfen lassen.
Die Geschäftsmodelle des möglichen eEDU werden von Prosumern oder
Prosumer-Kollektive stehen im
Prosumer-Kollektiven unterwandert, so dass dieser Akteur als klassischer
Wettbewerb mit eEDU.
EDU überflüssig wird.29 5. ERGEBNISSE ZU SPANNUNGSFELDERN Anhand der Thesen konnten die beiden Themen- schwerpunkte Prosumer und Utility 4.0. und deren Auswirkungen im Format eines Thesenworkshops diskutiert werden.
30
5.1 KONFLIKTFELDER, ZIEL-
& INTERESSENKONFLIKTE
DER NEUEN MÖGLICHKEI-
TEN
Durch die verschiedenen Hintergründe
der Expert*innen konnten die Ziel- und
Interessenkonflikte zwischen den ver-
schiedenen Akteur*innen erfasst werden.
Diese Zielkonflikte werden im Folgenden
dargestellt.
5.1.1 KONFLIKTFELDER UND dere Zielkonflikte direkt oder indirekt ab- bar anpasst. Deswegen sollen die gesell-
HERAUSFORDERUNGEN hängen. Zielkonflikte ersten Grades haben schaftliche Bewertung und Aushandlung
somit eine höhere Gestaltungsmacht als in Interaktion mit Betroffenen stattfinden.
(ZIELKONFLIKTE ERSTEN
Zielkonflikte zweiten Grades, die sich gege-
GRADES) benenfalls ergeben, wenn vorgelagerte In diesem Abschnitt werden grundlegen-
Zielkonflikt nicht gelöst sind. de Konflikte aus Vorarbeiten und Liter-
Um die Zielkonflikte (ZK) besser einord- atur beschrieben, um danach die erarbei-
nen und die Komplexität des Feldes be- Eine bessere Bezeichnung für ZK ersten teten Konflikte (zweiten Grades), die sich
schreiben zu können, werden diese ei- Grades wäre Konfliktfelder, da dies aus- in der Diskussion ergeben haben, zu er-
nerseits in thematische Kategorien und drückt, dass komplexe (technische, öko- örtern.
andererseits in Grade (ersten oder zwei- nomische, soziale) Sachverhalte aufei-
ten Grades) eingeteilt. Die Einteilung nandertreffen. Gerade durch eine tech-
der Zielkonfliktgrade erfolgt so, dass er- nologisch verursachte Erweiterung der
sten Grades diejenigen Gesichtspunkte Möglichkeitsräume von Akteur*innen
und Faktoren sind, die das System mehr ist es vorprogrammiert, dass sich z. B.
bestimmen als andere und von denen an- der rechtliche Rahmen nicht unmittel-31
Übergeordnetes Konfliktfeld Die Analyse der Zielkonflikte zu zukünfti-
der rechtlichen Rahmenbedin- gen Rollen, Interaktionen und Konstella-
gungen tionen zwischen den Akteur*innen helfen,
die möglichen Teilhabechancen der ver-
Da ökonomische und oder rechtliche Rah- schiedenen Akteur*innen zu bewerten.
menbedingungen die Ausgestaltungsmög- Inwiefern neue Akteur*innen entstehen
lichkeiten für Investitionen und Betrieb und sich etablieren sowie mögliche Rol-
diktieren, schränken diese Regelwerke die len, die bestehenden Akteur*innen ein-
Handlungsspielräume und Freiheitsgra- nehmen können (z.B. eEDU, Prosumer,
de der Entscheidungen der Akteur*innen Prosumer-Kollektive, Vereine oder Genos-
in großem Maße ein. Dies betrifft kleinere senschaften), hängt stark von der Gesetz-
und größere Akteur*innen, da der klas- gebung ab. Diese gibt die Anreize, um
sische Konsument keine große Gestal- Entscheidungen für nachhaltige Energie-
tungsmacht in der Politik hat. Auch die system-Investitionen zu tätigen oder
energieintensive Industrie ist an recht- Flexibilisierungsmaßnahmen zu planen
liche Rahmenbedingungen gebunden und umzusetzen. Kazhamiaka et al. (2017)
und abhängig von der Aufrechterhaltung bekräftigen in ihren Untersuchungen zur
etwaiger Ausnahmeregelungen. Ein- Profitabilität von kleinen Prosumern mit
schränkungen und Hürden durch Regu- Solar PV und Speichern, dass Entscheidun-
larien können zu inkohärenten Zielset- gen zur Energieversorgung zum Großteil
zungen und Koordinationsmechanismen nicht von technischen sondern ökonomi-
führen. schen Betrachtungen abhängen, die wie-
derum von Regularien wie Einspeisetari-
fen zu großen Teilen beeinflusst sind.32
5.1.2 RESULTIERENDE
KONFLIKTFELDER UND
HERAUSFORDERUNGEN
(ZIELKONFLIKTE ZWEITEN
GRADES)
Die im Expert*innen Thesenworkshop
herausgearbeiteten ZK zweiten Gerades
sind in Tabelle vier Kategorien zugeordnet.
Neben den direkten Zielkonflikten zwi-
schen Akteur*innen traten auch komple-
xere Konfliktfelder auf. Diese werden an-
schließend im Detail beschrieben.33
TABELLE 4
ZIELKONFLIKTE ZWEITEN GRADES
KATEGORIE/EBENE KONFLIKT
Netzstabilität vs. Flexibilisierung
Regulatorik zum Die Verteilung der Verantwortung für Netzstabilität sowie das Engpassmanage-
Engpassmanagement und ment und Vorhalten von Reserven ist unter zunehmender Flexibilisierung durch
Netzstabilität den Wandel der Akteur*innen und neuen Geschäftsmodellen, wie Complex
Service Solutions, unklar.
Versorgungssicherheit vs. Resilienz
Die Resilienz des Stromsystems ist mit zunehmender Automatisierung
anfälliger für Versorgungslücken.
Technologieebene
Eigenoptimierung vs. Gesamtsystemoptimierung
Geschäftsmodelle etablierter und neuer Akteur*innen sind profitabler, wenn
sie eigenoptimiert handeln und nicht auf das Gesamtsystem ausgerichtet sind.
Datenhoheit vs. Systemnutzen
Wem gehören die Daten? Im derzeitigen System gibt es Kontroversen über
die Transparenz für die Generierung, Speicherung und Nutzung von Daten.
Datenzugang /
Datenverarbeitung
Fehlende Standards vs. schnellem Rollout
Intelligente Messsysteme sind eine essenzielle Notwendigkeit für die Digitalisie-
rung des Energiesystems. Derzeit fehlen aber Standards oder Regulierungen für
einen sinnvollen Rollout.
Umsetzung von Flexibilisierung vs.
ungleiche Verteilung der Kosten und Nutzen
Sozio-ökonomische Ebene
Es fehlen die finanzielle Anreize für die Umsetzung der
Nachfrageflexibilisierung.
Versorger vs. Prosumer vs. BNetzA vs. Netzbetreiber
Transparenz Es fehlt Transparenz über die Netzauslastung und klare Rollenzuweisung,
um netzdienlich zu agieren.
IT-affine Unternehmen vs. BNetzA vs. Netzbetreiber
Rollenverteilung Es entsteht ein Spannungsfeld durch das Selbstverständnis der Netzbetreiber
und den neu auf den Markt drängenden, IT affinen Akteur*innen.
Marktakteure vs. Netzbetreiber
Trading und Preissignale Herausforderungen in der Interaktion zwischen Markt und Netz und dem
Trading von Energie.34
5.1.3 RESULTIERENDE
KONFLIKTFELDER UND
HERAUSFORDERUNGEN:
REGULATORIK ZUM
ENGPASSMANAGEMENT
UND NETZSTABILITÄT
Zielkonflikt 1:
Netzstabilität vs. Flexibilisierung
Die Verteilung der Verantwortung für
Netzstabilität sowie das Engpassma-
nagement und Vorhalten von Reserven
ist unter zunehmender Flexibilisierung, Strombezug z. B. im Rahmen des Demand und Energie aus selbigen benötigen.
durch den Wandel der Akteur*innen und Response und Complex Service Solutions Das derzeitige System ist allerdings auf
neuen Geschäftsmodellen, wie Complex möglich sind, werden Kontroversen zur „Reagieren“ bei Engpässen der Betreiber
Service Solutions, unklar. Der §14A Verteilung der Verantwortlichkeit noch ausgelegt. Wird zukünftig weiter auto-
EnWG-Energiewirtschaftsgesetz zu steuer- mehr in den Vordergrund rücken. matisiert und mehr KI eingesetzt, führt
baren Verbrauchseinrichtungen und das dazu, dass bei einem Engpass der
abschaltbaren Lasten sowie zur Festle- zusätzliche Energiebedarf der KI das Sy-
gung des Verantwortungsbereichs für
5.1.4 RESULTIERENDE stem zusätzlich belastet, was zu Aus-
Versorgungsengpässe und Reservestrom KONFLIKTFELDER UND fällen führen kann. Dies liegt daran, dass
wurde von den Teilnehmenden der Ex- HERAUSFORDERUNGEN: das bestehende Regelwerk die Abrege-
pert*innenrunde als problematisch einge- TECHNOLOGIEEBENE lung und nicht das Demand Side Ma-
ordnet. Die Mechanismen seien nicht auf nagement als Option bevorzugt.
Flexibilisierung ausgerichtet, so dass An- Zielkonflikt 2:
reize nicht abgestimmt werden können. Versorgungssicherheit vs. Zielkonflikt 3:
Stattdessen ist es so ausgestaltet, dass Resilienz Eigenoptimierung vs.
die Versorgungsicherheit und Netzstabi- Gesamtsystemoptimierung
lität bei steigender Flexibilisierung ge- Die Teilnehmenden identifizierten einen
fährdet wird. Im §14A geht es um eine Zielkonflikt auf der Technologieebene, Neben den Konflikten um die regulatori-
„Netzentgelt-Privilegierungsregelung, der alle Beteiligten der Akteur*innenland- schen Rahmenbedingungen stellte sich
wobei als Gegenleistung für die Reduzie- schaft betrifft. Durch einen erhöhten heraus, dass zusätzlich fehlende finan-
rung des Netzentgelts die Gewährung Energiebedarf durch die Automatisierung zielle Anreize dazu führen, dass die Krite-
der Möglichkeit zur netzdienlichen Steu- des Energiesystems und dem vermehr- rien vorrangig auf Eigenoptimierung aus-
erung von steuerbaren Verbrauchsein- ten Einsatz von Künstlicher Intelligenz gerichtet sind. Eine gesamtgesellschaft-
richtungen durch den VNB erforderlich (KI) im System ist das Gesamtsystem liche Ausrichtung (Gesamtsystemoptimie-
ist“ (Hilpert und Antoni, 2019, S. 18). Die weniger resilient. Dies ist zusätzlich auf rung) ist individuellen Interessen somit
Abregelung als einfachstes Instrument den vermehrten Einsatz von Informati- untergeordnet. Dies kann zu ineffizienten
im derzeitigen Regelwerk verdrängt da- ons- und Kommunikationstechnologien Gesamtlösungen führen und die Interes-
her alle anderen Optionen. Wenn in Zu- zurückzuführen, die wiederum gleich- senskonflikte zwischen kleineren und grö-
kunft mehr Serviceangebote für flexiblen falls vom Stromsystem abhängig sind ßeren Systemakteuren weiter verschärfen.Sie können auch lesen