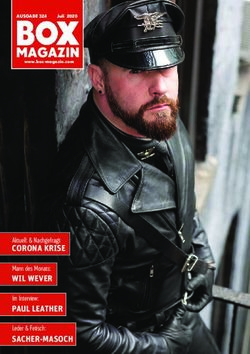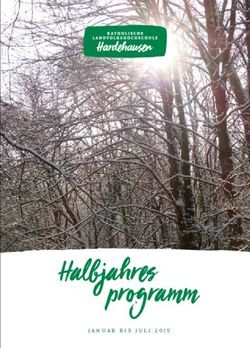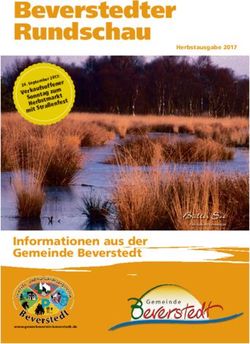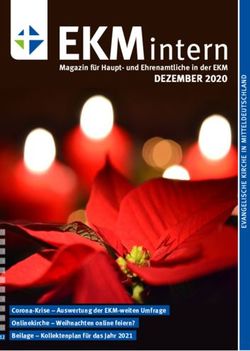Standpunkte der Ethik - Massenphänomen "Fußball" mehr als ein Spiel - aber keine Religion - Massenphänomen "Fußball" mehr ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Standpunkte der Ethik - Massenphänomen „Fußball“
mehr als ein Spiel - aber keine Religion
Diplomarbeit
Zur Erlangung des akademischen Grades eines
Magisters der Philosophie
eingereicht von
Christoph Reisenhofer
bei
Univ.-Prof. Mag. Dr. theol. Leopold Neuhold
Institut für Ethik und Gesellschaftslehre Katholisch-
Theologische Fakultät Karl-Franzens-Universität Graz
Graz, Juni 2019
1Ehrenwörtliche Erklärung
Ich, Christoph Reisenhofer, erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit
selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht
benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche
kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner
anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht
veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Version.
Graz, am 25.06.2019 Christoph Reisenhofer
2Danksagung
„You´II Never Walk Alone“ heißt es in einem Lied, das Fußballfans von Liverpool und
Dortmund in schönen und schweren Zeiten für ihre Mannschaft singen. „You´II Never Walk
Alone“- diese Erfahrung habe ich selber beim Erstellen meiner Diplomarbeit machen dürfen.
Ich möchte danke sagen.
An erster Stelle möchte ich meinem geschätzten Herrn Professor Dr. Leopold Neuhold für
die Beratung bei der Themenfindung und die kompetente Begleitung bei meiner
Diplomarbeit danken. Schließlich war er es, der durch seinen inspirierenden Vortrag in mir
die Entscheidung ausgelöst hat, meine Studienrichtung von Geographie auf Theologie zu
ändern.
Mein besonderer Dank gilt meiner Familie, insbesondere meinem Opa Heinz Koch, der als
Hobby Fußballanalytiker wesentlich zur Entstehung des gewählten Themas beigetragen hat.
Danke auch meinem Vater, der als Trainer vom FC Mölbenring meinen Freunden und mir
die ersten ethischen Prinzipen im Fußballsport vermittelt hat.
Ein ganz besonderer Dank gebührt auch meinem Onkel Joe Reisenhofer, begeisterter
Fußballfan und Pfarrer von Hartberg.
Obwohl er überzeugter Sturmanhänger ist, hat er mir als Rapidfan wertvolle Tipps und
Ratschläge gegeben. Eine wahre ethische Herausforderung im Spannungsfeld zweier
Fußballfanwelten.
Zuletzt möchte ich noch all denjenigen danken, die in der Zeit der Erstellung meiner Arbeit
für mich da waren bzw. mich in Ruhe arbeiten ließen, insbesondere meiner Freundin Jennifer.
3Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG 7
2. ENTWICKLUNG DES FUßBALLS 8
2.1 DIE GESCHICHTE DES FUßBAL 8
2.2 FANS UND ZUSCHAUER 9
2.2.1 DER ZUSCHAUER 9
2.2.2 DER FAN 9
2.2.3 KATEGORIEN VON FUßBALLFANS IM BEZUG AUF GEWALT 10
2.3 EINFÜHRUNG DES PROFIFUßBALLS UND GEHALTSENTWICKLUNG ANHAND DER
DEUTSCHEN BUNDESLIGA 12
2.4. GLOBALISIERUNG UND KOMMERZIALISIERUNG DES FUßBALLS. 14
2.4.1 SPONSORING 15
2.4.2 ENTWICKLUNG DES FUßBALLSPONSORING 15
2.5 INVESTOREN 20
2.5.1 POSITIVE BEISPIELE 20
2.5.2 PROBLEMATISCHE BEISPIELE 21
2.5.3 50+1 REGEL IN DEUTSCHLAND 24
2.6 MEDIEN 25
2.6.1 TV-MEDIEN 26
2.6.2 FUßBALL UND SOZIALE MEDIEN 28
2.7 TRANSFER UND SPIELERGEHÄLTER 29
2.7.1 BOSMAN URTEIL 29
2.7.2 GEHÄLTER 31
2.7.3 SALARY CAP 31
2.7.3.1 ARGUMENTE FÜR DEN SALARY CAP 32
2.7.3.2 CONTRA ARGUMENTE 33
2.8 COMMON GOAL UND EIN 1-PROZENT-PROJEKT 35
2.9 EIGENE STELLUNGNAHME 36
3. FUßBALL - (K)EINE RELIGION? 38
3.1 EINLEITUNG 38
3.2 WAS IST RELIGION - BEGRIFFSBESTIMMUNG 39
3.2.1 SUBSTANZIELLER RELIGIONS-BEGRIFF 39
3.2.2 FUNKTIONALISTISCHER RELIGIONSBEGRIFF 40
3.2.3 WEITERE FUNKTION VON RELIGION 41
3.3 RELIGION UND FUßBALL - DIE ANFÄNGE 42
3.4.GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE - FUßBALL UND KIRCHE 44
43.4.1 KONTINGENZBEWÄLTIGUNG 44
3.4.2 KIRCHENGEBÄUDE - STADION 45
3.4.3 JAHRESZYKLEN 47
3.4.4 SYMBOLIK IM FUßBALL 48
3.4.5 KLEIDUNG 50
3.4.6 GEMEINSCHAFT 51
3.4.7 RITUALE 52
3.4.8 „FUßBALLGÖTTER“ 53
3.4.9 FUßBALLER UND IHR GLAUBE 56
3.4.10 ABERGLAUBE IM FUßBALL 59
3.5 DER FUßBALL NÜTZT DIE RELIGION AUS 60
3.6 FAZIT: FUßBALL IST KEINE RELIGION 62
4.ETHIK UND IHRE EINFLÜSSE AUF DEN FUßBALL 66
4.1 WAS IST ETHIK 66
4.2 ETHIK IM FUßBALL 66
4.3 FUßBALLSCHULEN IN ENTWICKLUNGSLÄNDERN 73
4.4 DIE FIFA 76
4.4.1 ETHIK UND FIFA 77
4.4.2 ETHIKKODEX 2012 77
4.4.3ETHIKKODEX 2018 78
4.4 KORRUPTIONSFÄLLE IN DER FIFA 81
4.5 ETHISCHE UNTERSUCHUNG DER WM 2018 IN RUSSLAND 82
4.6 FUßBALL WELTMEISTERSCHAFT 2022 IN KATAR 85
4.7 EIGENE STELLUNGNAHME 86
5.CONCLUSIO 88
6. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 91
7. ABBILDUNGSVERZEICHNIS 91
8. LITERATURVERZEICHNIS 93
5Vorwort
2017 wechselte der brasilianische Fußballstar Neymar für 222 Millionen Euro vom FC
Barcelona nach Paris St. Germain. Als diese Schlagzeile öffentlich gemacht wurde, saß ich
gerade mit meinem Großvater auf seiner Terrasse bei einem Kaffee. Ich erzählte ihm von
diesem Transfer, worauf mein Großvater antwortete: „Das ist doch alles nicht mehr normal!“
Es folgte eine ausgiebige Diskussion über die Entwicklung des Fußballs. Auch ich mache mir
immer mehr Gedanken über die Entwicklung des Fußballs, speziell auch wegen der
Geldflüsse in dieser für mich so faszinierenden Sportart.
Transferwahnsinn, Millionengehälter, Multifunktionsarenen mit Sponsorennamen und
Milliarden an Fernsehgeldern - der Fußball wird kommerzialisiert und entfernt sich immer
mehr vom klassischen Volksport. Die Fans haben schon lange nichts mehr zu melden, und der
Fußball gehört denjenigen, die das Geld bereitstellen.
Fußball und Religion stehen sich in vielerlei Hinsicht sehr nahe, doch wird der beliebte und
faszinierende Rasensport zum Religionsersatz, darf und sollte dies kritisch hinterfragt werden.
Da ich selber jahrelang Fußball gespielt habe, momentan als Fußballvideoanalyst tätig und
immer noch ein glühender Fan dieser Sportart bin, ist es mir ein persönliches Anliegen, mich
in dieser Arbeit mit den ethischen Aspekten des Fußballs auseinanderzusetzen.
61. Einleitung
Drei wesentliche Schwerpunkte werden im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen.
Im ersten Teil möchte ich einen Blick auf die Entwicklung des Fußballs und dessen
Kommerzialisierung (Investoren, Gehaltsobergrenze, TV-Verträge) und Globalisierung
werfen. Hier gab es in den letzten Jahren enorme Veränderungen. Ein Fußballclub in einer
höheren Liga ist nicht nur ein Sportverein, sondern ein richtiges Unternehmen. Die Einflüsse
von Wirtschaft und Medien werden immer bedeutender. Die Leidtragenden dieser
Entwicklung sind die Fans, auf deren Bedürfnisse immer weniger Rücksicht genommen wird,
aber auch der Sportler selbst, der in dieser Entwicklung oft einen hohen Preis bezahlen muss,
wenn Überforderungen, Verletzungen oder Burnout ihn aus der Bahn werfen.
Im zweiten Kapitel möchte ich den Fußball mit Religion vergleichen. Für viele stellt Fußball
eine Art Ersatzreligion dar, doch kann man den Fußball wirklich als Religion bezeichnen? Ich
möchte aufzeigen, inwieweit Fankultur mit religiösen liturgischen Abläufen vergleichbar ist.
Des Weiteren möchte ich diese religiösen Elemente (Gesänge, Symbole, Fahnen ....) und ihre
Wirkung im Fußballstadion und ihren Einfluss auf Gemeinschaftsbildung und
Wertorientierung ergründen.
Anschließend werde ich mich mit der Thematik auseinandersetzen, dass Fußball, trotz vieler
religiöser Motive, trotzdem nicht als moderne Religion bezeichnet werden kann und auch
nicht mit Religion gleichgesetzt werden sollte.
Im letzten Kapitel geht es um den Beitrag der Ethik im Fußball. Was sind die Aufgaben und
Kritikpunkte von Ethik in dieser Sportart? Welche Ethikwerte, z.B. bei Spielern und
Ethikeinrichtungen (FIFA) gibt es im Fußball und welche Aufgaben erfüllen sie?
Wie kann Ethik gegen die starke Kommerzialisierung und Globalisierung entgegenwirken?
72. Die Entwicklung des Fußballs
2. 1 Die Geschichte des Fußballs
Man wird es kaum glauben, doch unser geliebter Fußball fiel im Zuge der Schöpfung nicht
einfach so vom Himmel. Er entwickelte sich, so wie die Menschheit über tausend Jahren der
Evolution. England wird als Mutterland des Fußballs bezeichnet, obwohl der Ursprung dieser
Sportart in China zu suchen ist. Chinesische Akrobaten spielten mit einem Ball und später
wurden richtige Spiele gegeneinander ausgetragen.1 Auch die Römer betrieben ein Spiel, das
dem Fußball schon sehr nahe kam.2 Es gibt Quellen aus dem 12. Jahrhundert über ein Fußball
ähnliches Spiel in England, wo die Mannschaften ohne Regeln mit einen Art Medizinball
gegeneinander spielten.3
Bis ins 19. Jahrhundert gab es diese Variante, die „Folk Football“ genannt wurde und eine
Mischung aus Rugby und Fußball war.4 Mit der Industrialisierung und Urbanisierung ging
die Bedeutung dieser Sportart verloren. Mitte des 19. Jahrhunderts entstand der Fußball, so
wie wir ihn heute kennen.5
1846 wurden an der Universität Cambridge die Regeln für den Fußball aufgestellt. In diesem
Regulativ wurde festgelegt, dass der Ball nicht mit der Hand gespielt werden darf. Es sollte
eine klare Differenzierung zum Rugby werden. 1863 kam es dann zu einem Gentlemen’s
6
Agreement, das zwölf englische Vereine unterschrieben. 1870 fingen sich die ersten
Mannschaften auf dem Platz zu organisieren an. Man teilte erstmals die Spieler in
Verteidigung, Mittelfeld und Stürmer ein. Zwei Jahre später wurde dann zum ersten Mal ein
Schiedsrichter eingesetzt, zuvor entschieden die Spieler selbst über ihre Verstöße. 7
1904 wurde die FIFA (Fédération Internationale de Football Association ) gegründet. Sie ist
seither für die Regeln auf und neben dem Platz verantwortlich.
1
Vgl. Galeano, Eduardo: Der Ball ist rund, Zürich: Unionsverlag 2000. S. 34.
2
Vgl. ebd.
3
Planet Wissen: Fußballgeschichte in: https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/sport/fussballgeschichte/index.html [abgerufen am 5.03. 2019]
4
Vgl. ebd.
5 Vgl. ebd.
6
Vgl. Galeano, Eduardo: Der Ball ist rund, Zürich: Unionsverlag 2000. S. 34.
7
Vgl. ebd. S.40.
82.2 Fans und Zuschauer
Ohne Zuschauer und Fans wäre Fußballsport nicht so gewinnbringend und erfolgreich, denn
ohne die Stadionbesucher, insbesondere der Fernsehzuschauer, würde es weit weniger
finanzielle Ressourcen geben. Ein Drittel des gesamten Budgets eines Fußballvereins wird
durch Zuschauer generiert.8 Auch für die Spieler hätte es enorme Auswirkungen, wenn es
keine Fans geben würde. 9 Natürlich hängt dies auch Stark von der Liga ab.
Ein volles Stadion treibt den Spieler zu Höchstleistungen. Ein weiterer Grund für die
Wichtigkeit der Fans ist das Gehalt des Sportlers, das bei geringem Zuseherinteresse
finanzielle Einbußen zur Folge hätte.
Im Fußball unterscheidet man zwischen dem klassischen Zuschauer und dem Fan.
2.2.1 Der Zuschauer
Der Zuschauer geht gelegentlich ins Stadion oder verfolgt das Spiel vor dem Fernseher. Für
ihn steht im Vordergrund die Erholung vom stressigen Alltag. Passiver Sport dient ihm als
Ausgleich, um in Balance zu bleiben.10 Zuschauer nützen auch den Sportplatz, um Freunde zu
treffen und unter Leute zu gehen. Es steht nicht unmittelbar eine Mannschaft im Fokus,
sondern mehr das Ereignis.11
Der Fan hingegen geht alleine wegen der Mannschaft ins Stadion und will jedes Spiel seiner
Mannschaft sehen.
2.2.2 Der Fan
Der Begriff „Fan“ stammt aus dem Englischen „fanatic, welches auf das lateinische Wort
„fanaticus.“ zurückzuführen ist.12 „Das lat. fanaticus ist abgeleitet von fanum-heilgen Bezirk;
8 Hock, Andreas: Ein Spiel dauert 90 Millionen. Wie der Kommerz unserm Fußball die Seele raubt. München:
Rivaverlag 2018 S. 34.
9
Krammer, Dieter: Fußball - Religion oder Ersatzreligion? : Religionswissenschaftliche Aspekte im
Zusammenhang mit der Fußball WM 2010. Graz 2013 (= Diplomarbeit Universität Graz) S. 46.
10
Vgl. ebd.
11
Vgl. ebd.
12
Vgl. Glasmayer, Christian: Sport als (Ersatz-)Religion?
Können Fußball und die dazugehörige Fankultur die Funktionen von Religion ersetzen? 2016 ( Examaenarbeit
Universität Paderborn) S. 14.
9es bezeichnet allgemein die Zugehörigkeit zu einem Heiligtum“.13 Fanum laut Duden
bedeutet „begeisterter Anhänger“, während Fanatiker so definiert ist: „Jemand, der von
bestimmten Ideen, einer bestimmten Weltanschauung o. Ä. so überzeugt ist, dass er sich
leidenschaftlich, mit blindem Eifer [und rücksichtslos] dafür einsetzt“.14
In dem Sammelband „Fans –soziologische Perspektiven“ aus der wissenschaftlichen Reihe
„Erlebniswelten“ werden Fans als „Menschen, die längerfristig eine leidenschaftliche
Beziehung zu einem für sie externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven,
gegenständlichen oder abstrakten Fanobjekt haben und in die emotionale Beziehung zu
diesem Objekt Zeit und/oder Geld investieren“15, bezeichnet.
2.2.3 Kategorien von Fußballfans in Bezug auf Gewalt
Zur Kategorie A zählt der„konsumorientierte Fan“. Er ist der Fußballgenießer und freut sich
jede Woche auf seine Mannschaft. Ein Fußballmatch zu sehen begeistert ihn, und er erhofft
sich einen hohen Unterhaltungswert.16 Fußball ist für ihn mit einem Kino - oder
Theaterbesuch vergleichbar. Für diesen Fan ist ein Fußballspiel ein Erlebnis. Sein Verhalten
ist ruhig, und er gibt sich gelassen; Konfrontationen jeder Art vermeidet er.
Zur Kategorie B gehören die sogenannten „Ultras“. Diese Fans geben alles für ihre
Mannschaft, üben aber auch einen gewissen Erfolgsdruck auf ihr Team aus. Die Fans sind
ganz stark mit ihrer Mannschaft verbunden und zeigen diese Verbundenheit durch
dementsprechende Emotionen bei Sieg oder Niederlage.17 „Ultras“ sind nicht unbedingt
gewaltbereit, können aber situativ Gewalt anwenden. Des Weiteren ist dieser Typ von Fan
auch bereit, eine große Menge an Geld für seinen Verein auszugeben.18 Dauerkarten, Trikots
und andere Fangegenstände sind Grundausstattung für einen Ultra.
13 Cancik, Hubert, Gladigow Burkhard, Laubscher Matthias (Hg.): Handbuch religionswissenschaftlicher
Grundbegriffe. Stuttgart, Kohlhammer Verlag 1990 S. 415.
14
Duden Online: Fanatiker in: https://www.duden.de/suchen/dudenonline/fanatiker [abgerufen am 07.03.2019]
15
Vgl. Glasmayer, Christian: Sport als (Ersatz-)Religion?
Können Fußball und die dazugehörige Fankultur die Funktionen von Religion ersetzen? 2016 (Examensarbeit
Universität Paderborn) S.14.
16
Vgl. Krammer, Dieter: Fußball - Religion oder Ersatzreligion? : Religionswissenschaftliche Aspekte im
Zusammenhang mit der Fußball WM 2010. Graz 2013 (= Diplomarbeit Universität Graz) S. 47.
17
Vgl. Krammer, Dieter: Fußball - Religion oder Ersatzreligion? : Religionswissenschaftliche Aspekte im
Zusammenhang mit der Fußball WM 2010. Graz 2013 (= Diplomarbeit Universität Graz) S. 47.
18
Vgl. ebd.
10Der Fußballfan der Kategorie C ist ein aktiv gewaltbereiter Fan, der in der Fußballszene
„Hooligan“ genannt wird. Es ist schwer zu definieren, was Hooligan wirklich bedeutet, weil
die Szene ziemlich dynamisch ist und sich kaum klare Grenzen ziehen lassen. Ingo-Felix
Meyer definierte Hooligans im Rahmen einer Studie von 2001 als Personen, welche im
Umfeld von Fußballspielen und Ereignissen durch gewalttätige Aktionen gegenüber Personen
und Gegenständen auffallen.19 Es lässt sich diskutieren, ob man solche Menschen überhaupt
als Fans bezeichnen kann. Obwohl Fans und auch Medien diesen gewalttätigen Gruppen
ablehnend gegenüberstehen, gelingt es ihnen immer wieder, für negative Schlagzeilen zu
sorgen. Meiner Meinung nach sind Hooligans keine Fans. Diese Menschen kommen ins
Stadion, um ihre Aggressionen abzubauen und Gewalt gegenüber Mitmenschen anzuwenden.
Dieses Verhalten kann in keiner Weise gut geheißen werden, denn Hooligans zerstören den
guten Ruf des Sports und haben in einem Fußballstadion nichts zu suchen.
In einer anderen Fanbeschreibung laut Farnberger werden die Zuschauer in 11 Typen
eingeteilt:
1. Der absolut treue Fan, der mit der Mannschaft alles durchlebt und auch zu sämtlichen
Auswärtsspielen fährt.
2. Der besserwisserische Fan ist, wie es der Name schon sagt, ein eher unangenehmer
Zeitgenosse und gibt sein Fachwissen gerne an andere weiter, auch ungefragt.
3. Der Fan als Misanthrop ist jemand, der zu Hause nichts zu sagen hat und die ganze
Frustration mit ins Stadion nimmt.
4. Der Lässige tut die ganze Zeit so, als würde ihn das Spiel nur am Rande interessieren.
5. Typ 5 ist der Säufer, der rdas Stadion als eine Art Bierbar sieht.
6. Der wettsüchtige Typ, der den Fußball als Abwechslung betrachtet, bei der er seine
Wettleidenschaft ausleben kann.
19
Meyer, Ingo Felix: Woher rührt der Hooliganismus? in: http://www.taz.de/!1121586/ [abgerufen am
20.03.2019]
117. Ein anderer Typ ist der Intellektuelle, der den Fußball zwar als wenig intelligent
betrachtet, aber sich dennoch gerne unter den anderen aufhält, um mit seinen
Kenntnissen zu brillieren.
8. Der nächste Fantyp ist der Anschlusssuchende, dieser will einfach nur ein
Zugehörigkeitsgefühl spüren.
9. Dieser trendige Fantyp ist nur dabei, so lange der Fußball auch im Trend ist.
10. Dies ist der Typ, welcher Fan eines bestimmten Spielers ist und diesen begleitet von
Mannschaft zu Mannschaft oder auch von Stadt zu Stadt
11. Der nicht allzu beliebte Pseudofan. In diese Kategorie fallen die, die sich durch
den Fußball Vorteile erwirken wollen. Dies sind meist Politiker oder Repräsentanten
großer Firmen. Die zuletzt genannte Gruppe befindet sich meist im VIP Bereich.20
2.3 Einführung des Profifußballs und Gehaltsentwicklung anhand
der Deutschen Bundesliga
Die erste professionelle Profiliga entstand 1885 in England. Die erste Meisterschaft außerhalb
Englands wurde in Österreich im Jahre 1924/25 ausgetragen. Die erste Weltmeisterschaft
wurde 1934 in Uruguay gespielt, wo der Gastgeber auch zum ersten Mal Weltmeister wurde.
Im Gegensatz zum englischen Fußball, wo es schon Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
Fußball Profis gab, wehrte man sich in Deutschland lange gegen die Einführung des
Profitums im Sport. Bis in das Jahr 1950 erlaubte der Deutsche Fußball-Bund keine Profis,
selbst in der höchsten Spielklasse.21 Erst ab 1951 wurde es den Vereinen erlaubt einen
Vertragsspieler anzustellen. Diese hatten aber auch eine Obergrenze: sie durften nur höchsten
320 DM (ca.163 Euro) verdienen. Mit Begründung der Deutschen Bundesliga im Jahre
1963/1964 waren dann 500 DM Grundgehalt erlaubt, das durch Prämien bis 1200 DM erhöht
20
Vgl. Krammer, Dieter: Fußball - Religion oder Ersatzreligion? : Religionswissenschaftliche Aspekte im
Zusammenhang mit der Fußball WM 2010. Graz 2013 (= Diplomarbeit Universität Graz) S. 47.
21
Vgl. Frick, Bernd: Die Entlohnung von Fußball-Profis:
Ist die vielfach kritisierte “Gehaltsexplosion” ökonomisch erklärbar? in:http://www.ak-spooek.de/nr19_2008.pdf
[ abgerufen am: 03.03.2019]
12werden konnte.22 Doch es gab auch Ausnahmen in dieser Zeit. Die Helden von Bern, die 1954
Weltmeister wurden, erhielten eine Prämie von jeweils 2000 DM ausgezahlt. Zu dieser Zeit
war dieser Betrag immens hoch.
Der frühere deutsche Bundesligaspieler Manfred Burgsmüller, der mit 213 Toren auf Rang
vier der ewigen Bundesliga Torschützenliste ist, bekam 1969 bei Rot Weiß Essen ein 400 DM
Monatsgehalt plus einen gebrauchten VW Käfer.23 Heute verdient ein Spieler seiner Qualität
ca. 3-5 Millionen Euro netto jährlich und hätte wahrscheinlich nach seiner Karriere finanziell
ausgesorgt. Aber in der damaligen Zeit war daran nicht zu denken, viele der Spieler in den
70er und 80er Jahren mussten sich später einen Job suchen, wie z.B. der Weltmeister von
1974, Hans Georg Schwarzbeck, der bis heute ein Schreibwarengeschäft leitet. Eine
beträchtliche Anzahl junger Fußballprofis der heutigen Spielergeneration kassieren bereits
Millionenbeträge. Durchschnittlich beträgt das Einkommen eines Fußballers ungefähr das
Vierzigfache von dem eines normalen Arbeiters.24
Wie ist diese Entwicklung zu erklären?
Die erste Trikotwerbung im deutschen Fußball war am 24. März 1973 zu sehen. „Eintracht
Braunschweig lief im Bundesligaspiel gegen Schalke 04 mit dem Hirschkopf-Emblem eines
Kräuterlikörherstellers auf und erhielt dafür 160.000 Mark, was als sportpolitischer
Sündenfall gegeißelt wurde.“25 Begriffe wie Merchandising, eine Form der Vermarktung des
Fußballs, waren zu dieser Zeit noch gänzlich unbekannt.
Das durchschnittliche Gehalt eines Spielers bei FC Bayern München beträgt 2018 5,68
Millionen Euro. Die drei Topverdiener in der Bundesliga sind die Spieler Manuel Neuer,
Thomas Müller und Robert Lewandowski, die 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Mit
diversen Prämien, Sponsoren und privaten Ausrüstern kann dieses Gehalt sogar auf ca. 25
Millionen Euro steigen.
22
Vgl. ebd.
23
Die Welt: Wie das Geld zum Fußball kam. in: https://www.welt.de/wams_print/article2078861/Wie-das-Geld-
zum-Fussball-kam.html [abgerufen am 5.11.2018]
24
Vgl. ebd.
25
Die Welt: Wie das Geld zum Fußball kam. in: https://www.welt.de/wams_print/article2078861/Wie-das-Geld-
zum-Fussball-kam.html [abgerufen am 5.11.2018]
13Dies sind Summen, die für einen normalen Arbeiter nicht greifbar sind, und die Tendenz ist
steigend.
Jahr Spieler Gehalt pro Jahr in €
1960er Uwe Seeler 7.200
1960er Wolfgang Overath 7.200
1970er Franz Beckenbauer 350.000
1970er Gerd Müller 250.000
1970er Günther Netzer 150.000
1980er Rudi Völler 550.000
1980er Klaus Augenthaler 300.000
1990er Lothar Matthäus 4.000.000
1990er Stefan Effenberg 4.000.000
1990er Andreas Möller 3.500.000
2000er Michael Ballack 6.500.000
2000er Jens Nowotny 3.500.000
2000er Kevin Kuranyi 2.600.000
2012 Bastian Schweinsteiger 10.000.000
2012 Phillip Lahm 10.000.000
2018 Thomas Müller 15.000.000
Abildung.1: 1. Gehälter Bundesliga eigene Grafik
2.4. Globalisierung und Kommerzialisierung des Fußballs.
Der kommerzielle Siegeszug des Fußballs wäre ohne Zuschauer und Fans nicht möglich
gewesen. Durch das steigende Interesse sind Wirtschaft und Medien auf den Fußball
aufmerksam geworden. Durch TV-Übertragungen wurde der Fußball für viele Menschen
zugänglich und gewann immer mehr an Interessenten. Vereine entwickelten sich immer mehr
zu Wirtschaftsunternehmen, während die Fans außen vor gelassen wurden. Hohe
14Eintrittspreise für Fans, teure Trikots und Pay-TV Fußball sind die Auswirkungen dieser
Kommerzialisierung. Ich möchte nun in vier Themenschwerpunkte aufzeigen, dass Fußball
kein normaler Ballsport mehr ist, sondern eine riesige Wirtschaftsmacht geworden ist.
2.4.1 Sponsoring
Die beste Definition, die ich für Sponsoring bzw. Sportsponsoring gefunden habe, lässt sich
auf Manfred Bruhn, einen deutschen Professor für Marketing und Unternehmensführung,
zurückführen. Laut ihm ist Sponsoring „die Analyse, Planung, Durchführung und Kontrolle
sämtlicher Aktivitäten, die mit der Bereitstellung von finanziellen Aufwendungen,
Sachmitteln, Dienstleistungen oder Know-how durch Unternehmen und Institutionen zur
Förderung von Personen und/oder Organisationen in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales,
Umwelt und/oder den Medien verbunden sind, um damit gleichzeitig Ziele der
Unternehmens- und Marketingkommunikation zu erreichen“26
Sponsoring ist einer der wichtigsten wirtschaftlichen Faktoren im Profifußball. Wenn wir uns
ein Fußballmatch anschauen, sieht man in kürzester Zeit zahlreiche Sponsoren. Es gibt
mehrere Möglichkeiten von Sponsoring, entweder als Bandensponsor, Trikotsponsor oder
Werbesports an verschiedensten Stellen im Stadion.27 Ein Profifußballverein wäre ohne
Sponsoren nicht mehr überlebensfähig und könnte heutzutage nicht mehr existieren.
2.4.2 Entwicklung des Fußballsponsoring
Bis 1970 war es im deutschen Profifußball noch ganz normal, dass auch Top-Klubs ihre
Ausrüstung selbst gekauft haben. Erst Anfang der 1970er Jahre begannen die großen
28
Sportartikelhersteller das Potenzial von Fußball zu erkennen. Vor allem Adi Dassler, der
Gründer von Adidas, war der Erste, der einen Deal mit der deutschen
Fußballnationalmannschaft abschloss. Bis heute ist Adidas der Ausrüster der deutschen
Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 1974 gab es Streit wegen des Ausrüsters.
Auch Holland hatte zu dieser Zeit einen Vertrag mit Adidas unterschrieben.
26
Bruhn, Manfred: Marketing: Grundlagen für Studium und Praxis. Wiesbaden Springer-Verlag 2012. S.236.
27
Schweres, Joannis Paul: Sportsponsoring als Instrument zur Erhöhung der monetären Mittel im Profifußball.
Hamburg 2014 Diplomica Verlag. S. 24.
28
Vgl. Hock, Andreas: Ein Spiel dauert 90 Millionen. Wie der Kommerz unserm Fußball die Seele raubt.
München: Rivaverlag 2018 S. 60.
15Das Problem war, dass der Superstar Johan Cruyff zur gleichen Zeit einen Exklusivvertrag
mit Puma abgeschlossen hatte. So produzierte man extra für Cruyff ein Trikot mit nur zwei
Streifen, statt den legendären drei Streifen von Adidas. 29
Heutzutage wäre dieses Szenario kaum mehr vorstellbar, denn der Ausrüstungskampf ist ein
knallhartes Business geworden. Gerade erst hat Puma den Streit um den Ausrüstungsvertrag
um Manchester City gewonnen und zahlt pro Saison 58 Millionen Euro an den Verein.
Ausrüster Firmen sind bereit, hohe Beträge zu zahlen, und die Vereine können sich den
Bestbieter aussuchen. Manchmal werden auch Vertragszeiten nicht eingehalten, wie wir das
am Beispiel Arsenal London wahrnehmen können . Der Verein wurde zunächst bei Nike und
anschließend bei Puma vertragsbrüchig, um einfach später zu dem höheren Bieter zu
wechseln.30
Die sichtbarste aller Sponsoring-Varianten im Fußball ist der Trikot-Sponsor. Wie bereits im
Kapitel. 2.2 erwähnt, war es 1973 Eintracht Braunschweig, die als erste Mannschaft in
Deutschland einen Trikotsponsor hatte. Heute ist diese Sponsoring-Variante ein profitables
Geschäft geworden. Real Madrid bekommt von ihrem Trikot Sponsor, der Fluggesellschaft
Fly Emirate, 70 Millionen Euro pro Jahr. In Deutschland ist der Topverdiener Bayern
München, die Bayern erhalten von der Telekom rund 30 Millionen Euro pro Saison. In
Österreich gibt es das Phänomen, dass die Trikots mit Sponsoren zugepflastert sind. Der
Wolfsburger AC hat 20 Werbeflächen von 12 verschiedenen Sponsoren auf dem Trikot.
29
Vgl. ebd.
30
Vgl. ebd. S.62.
16Ab.2:Trikot Wolfsberger AC, in:
http://www.spox.com/at/sport/fussball/oesterreich/1807/Diashows/wac-
trikots/die-neuen-trikots-des-wac-fuer-die-saison-2018-19-auf-den-
unterarmen-ist-noch-platz.html
In Sachen Sponsoring gibt es einige ethische Bedenken, die in unterschiedlichen Bereichen
auftreten können. Eine Problematik ergibt sich im Zusammenhang mit den Unternehmen und
wirft Fragen auf, wofür sie stehen, welche Produkte sie herstellen und unter welchen
Bedingungen, diese erzeugt werden. Denn sobald Geld im Spiel ist, spielt bei vielen Vereinen
die Moral keine Rolle mehr. Ein Beispiel für einen zweifelhaften Sponsor ist der Gaskonzern
Gazprom, der eine fragwürdige Rolle im Russland-Ukraine Konflikt spielt und seit 2007 den
FC Schalke 04 finanziell unterstützt, auch Werder Bremen, die sich vom
Geflügelproduktionsbetrieb „Wiesenhof“ finanzieren lassen, „dessen Haltungen immer
wieder Tierschützer auf die Barrikaden riefen,“31 lässt Fragen offen.
Aber es sind nicht nur Vereine, die fragwürdige Sponsoren haben, auch die FIFA selbst gerät
bei Weltmeisterschaften immer wieder in Kritik bei der Sponsorenvergabe. Eine Firma, die
immer für Schlagzeilen sorgt, ist der Getränkehersteller Coca-Cola. Obwohl das Produkt als
ungesund und gesundheitsschädigend eingestuft wird und eigentlich kein Getränk für einen
Profifußballer ist, war Coca-Cola einer der Hauptsponsoren der Fußball-WM 2018 in
Russland.
Coca-Cola genießt als Hauptsponsor viele Privilegien:
31Vgl. Hock, Andreas: Ein Spiel dauert 90 Millionen. Wie der Kommerz unserm Fußball die Seele raubt.
München: Rivaverlag 2018 S. 73.
17• Verwendung der offiziellen Marken
• Präsenz im Innen- und Außenbereich der Stadien
• Präsenz in allen offiziellen FIFA-Publikationen und auf der offiziellen Website
• Anerkennung des Sponsoring-Engagements durch Marketingprogramme
• Durchführung von Hospitality-Programmen (s. „Kontaktpflege zur Kernzielgruppe“)
• Direktwerbung, PR-Aktivitäten und bevorzugter Zugang zu Fernsehwerbung.32
Die Firma wirbt auf ihrer Webseite, dass sie ein nachhaltiges Unternehmen ist und sich für
Menschen und Umwelt einsetzt. Doch es gab in den letzten Jahren auch immer wieder
Probleme. „So soll Coca-Cola Mitverantwortung für die brutale Unterdrückung unliebsamer
Gewerkschafter in Südamerika tragen, Umweltstandards verletzen und durch den hohen
Zuckergehalt seiner Produkte mitschuld an Gesundheitsproblemen sein.“33 Diese
Unternehmen haben mit den modernen Fußball Clubs einiges gemeinsam, denn sie sind sehr
stark auf Gewinn fokussiert. Viele Unternehmen kommunizieren, dass sie gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen, doch an der konkreten Durchführung scheitern sie meist. Die
Journalistin Birgit Nöhammmer trifft mit ihrem Beitrag den Nagel auf dem Kopf:
„Die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung wird nur dann für ein
Unternehmen zum Sein, wenn es danach trachtet, den größten Gesamtnutzen für die
Gesellschaft zu schaffen, und von einer Philosophie, die Gewinne über alles andere
setzt und die Interessen der Aktionäre bevorzugt, Abstand nimmt. Damit sich jedoch
diese neue Art der Unternehmensführung entwickeln kann, die neben wirtschaftlichen
auch ethische Prinzipien berücksichtigt, müssen von Seiten der Politik als auch jedes
einzelnen Menschen Schritte gesetzt werden.“34
Wenn die Verantwortlichen diese zu bedenkenden Punkte nicht ernst nehmen, ist zu
befürchten, dass dem Profisport Schaden daraus entstehen könnte. Wenn dieser Weg
gewissenlos weitergegangen wird, könnten in Zukunft noch viel fragwürdigere Produkte den
Einzug in die Fußballwelt finden. Einer der bekanntesten Initiatoren des Sportsponsorings
32FIFA: „FIFA Partner“. in: https://de.FIFA.com/about-
FIFA/marketing/sponsorship/partners/index.html [abgerufen am am 23.03.2019]
33
Vensky, Hellmuth: „Vom Arzneimittel zur globalen Blubberbrause“.in:
https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2011-05/cola-unternehmensgeschichte [Zugriff am 23.03.2019]
34
Nöhammer, Birgit:„Gesellschaftliche Verantwortung zwischen Sein und Schein“. In: Transfer- Zeitschrift. Nr.
03/2009.
18hat einige interessante Thesen erstellt, die man als ethische Grundsätze heranziehen kann, um
die negativen Auswirkungen im Sponsoring zu verringern:
1. Lassen wir dem Sport seine Würde, seine Eigenständigkeit und seine innere
Autonomie.
2. Denken wir daran, dass Kommunikation mit dem Sport nicht nur Investition verlangt,
sondern auch Herz und Begeisterung für die Sache.
3. Investieren wir nicht in den Sport, wenn wir glauben, Erfolg und Siege ließen sich
kaufen.
4. Mischen wir uns als Sponsor nicht in sport-fachliche Dinge ein.
5. Suchen wir uns – wenn wir es nicht selbst tun können – erfahrene Kontaktleute,
welche die Sprache und die Stimmung des Sports verstehen.
6. Helfen wir dem Sport bei seinem Versuch, die Spielregeln zu achten und Begriffe wie
Fairness und Anstand im Kampf hochzuhalten.
7. Treten wir dem Sport gegenüber nicht als Oberlehrer auf.
8. Erklären wir Sponsoring unserer Belegschaft, unseren Mitarbeitern, unseren
Betriebsräten und unseren Geschäftspartnern.
9. Überlegen wir es uns dreimal, ob es glaubwürdig ist, einen Athleten oder einen Verein
direkt für unsere Produkte werben oder sprechen zu lassen.
10. Denken wir daran, dass ein guter Sponsor den Sport und den Sportler begleiten,
nicht aber optisch und visuell in den Hintergrund drängen sollte.35
Ein Verein sollte sich also durchaus Gedanken machen, mit welchem Unternehmen er
zusammenarbeiten möchte, denn das Sponsoring sollte glaubwürdig für den Sport sein.
Meiner Meinung nach sollten die Verantwortlichen eines Fußballvereines verstärkt auf die
ethischen Faktoren einer Firma und ihres Produktes achten, und nicht für jede fragwürdige
Geldquelle offen sein.
So kann der Fußball seine Würde, Eigenständigkeit und innere Autonomie bewahren.
35
Gäb, Hans Wilhelm: „Sport-Sponsoring – Zehn ethische Grundsätze“. In: Marketingjournal. Nr. 02.
192.5 Investoren
Ob russischer Öl-Oligarch, arabischer Scheich oder asiatischer Milliardär, es gibt immer
betuchte Menschen, die sich mit Unmengen von Geld Fußballclubs kaufen. Im letzten
Jahrzehnt haben die „Superreichen“ das Interesse am Fußball entdeckt. Vor allem in der
englischen Premier League begeben sich immer mehr Clubs in fremde Hände. Ein Investor
bringt natürlich auch Vorteile für einen Club. Mit frischem Kapital ist der Club
konkurrenzfähig und hat Geldmittel für Spielertransfers oder neue Stadien. Doch für viele
Fans ist der Verkauf des Klubs an einem privaten Finanzmann „ein Pakt mit dem Teufel“. Ein
Fußballclubbesitzer ist oft Alleinherrscher und kann fast alles bestimmen, was im Klub
geschieht.
In diesem Kapitel möchte ich sowohl positive als auch problematische Beispiele aufzeigen,
die ein Investor mit sich bringen kann und Gründe anführen, warum sich die deutsche
Bundesliga noch immer gegen Clubübernahmen durch superreiche Investoren wehrt.
2.5.1 Positive Beispiele
Der FC Chelsea gilt als Paradebeispiel eines Vereins, der von einem Investor profitierte.36
Bevor der Klub 2003 vom russischen Öl-Oligarchen Roman Abramowitsch gekauft wurde,
war er im Mittelfeld der Premier League zu finden. Erst durch den Einstig des reichen
Russen wurde der Klub zu einem der erfolgreichsten Fußballvereine der letzen Jahre, der mit
dem Gewinn der Champions League 2012 gekrönt wurde.
Auch Manchester City war jahrelang im Nirgendwo der englischen Premier League zu finden.
Erst durch den Einstieg von Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan 2008 kam der
Aufschwung. Seitdem konnte man drei Meistertitel feiern, und im letzen Jahr machte man
einen Rekordumsatz von 561 Millionen Euro. Doch dieser Erfolg war sehr teuer erkauft. Seit
36
Pfannemmüller:Fußball: Immer mehr Vereine sind von Investoren abhängig, in:
https://pfannenmuellersportblogs.wordpress.com/2018/06/10/fussball-immer-mehr-vereine-sind-der-laune-von-
investoren-unterworfen/ [abgerufen am 25.03.2019]
20der Übernahme vor 10 Jahren hat der Scheich 1,46 Milliarden Euro investiert. 37 Der Klub ist
ständig im Fokus der UEFA, weil er immer wieder gegen Regeln beim Financial Fairplay
verstoßen hat. Es wird spekuliert, dass Manchester City in den nächsten Jahren mit einer
Transfersperre bestraft wird, weil es Unregelmäßigkeiten bei der Verpflichtung von
minderjährigen Spielern gegeben haben soll. 38
Ein weiters Beispiel ist der Verein TSG Hoffenheim mit Investor Dietmar Hopp. Der kleine
Provinzklub aus Baden-Württemberg hatte einen märchenhaften Aufstieg in die Deutsche
Bundesliga und hat sich mittlerweile zu einem soliden Bundesligaverein etabliert. Dietmar
Hopp investierte ca. 400 Millionen Euro in den Club.39 Doch der Investor hat es nicht leicht in
Deutschland. Die Hoffenheim Fans feiern Dietmar Hopp als „Heiligen“, für viele andere
deutsche Fußballfans wird er als Feinbild gesehen. Dietmar Hopp war bei Auswärtsspielen
immer Anfeindungen ausgesetzt, die teilweise unter der Gürtellinie waren. Vor allem das
Verhältnis zu den Fans des Traditionsclubs Borussia Dortmund war sehr angespannt.40 Die
Dortmund Fans sahen in Hopp einen „Zerstörer“ des traditionellen Fußballs. Mittlerweile hat
Hopp seine Investitionen eingeschränkt, doch trotzdem spielt Hoffenheim einen erfolgreichen
Fußball und qualifizierte sich letzte Saison das erste Mal für die Champions League.
2.5.2 Problematische Beispiele
Im Jahre 2010 stieg der malaysische Multimillionär Vincent Tah bei Cardiff City als Investor
ein. Der Verein und die Fans erhofften sich durch den Investor neue Stars und den Aufstieg in
die Premiere League. Doch schon nach wenigen Wochen war die Euphorie verflogen und
Nüchternheit zog in den Club ein.41
37
Vgl. Kicker: Scheich investierte bei ManCity schon über 1,5 Milliarden Euro, in:
http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/startseite/731753/artikel_scheich-investierte-bei-mancity-schon-
ueber-15-milliarden-euro.html [abgerufen am 25.03.2019]
38
Vgl. Kleine Zeitung: Strafen durch FIFA und UEFAManchester City und Frankfurt von massiven Sanktionen
bedroht, in: https://www.kleinezeitung.at/sport/fussball/international/championsleague/5596139/Strafen-durch-
FIFA-und-UEFA_Manchester-City-und-Frankfurt-von [abgerufen am. 25.03.2019]
39
Vgl. Spiegel Online: Manchmal top, immer Hopp, in: https://www.spiegel.de/sport/fussball/1899-hoffenheim-
in-der-bundesliga-manchmal-top-immer-hopp-a-1224437.html [abgerufen am 25.03.2019]
40
Vgl. ebd.
41
Vgl.11 Freunde: Farben geändert, Wappen weg, in: https://www.11freunde.de/artikel/diesen-preis-bezahlte-
cardiff-city-fuer-den-aufstieg [27.03.2019]
21Die erste gravierende Änderung, die Vincent Tah vornahm war, dass er die Trikotfarbe des
Clubs änderte.42 Seit 1908 spielte Cardiff in blauen Trikots, weshalb sie auch die „Bluebirds“
genannt wurden. Tah wechselt die Farbe in Rot, um den Club besser in Asien zu vermarkten.
Rot gilt in Asien als Farbe des Glücks.
Für österreichische Fußballverhältnisse wäre es kaum vorstellbar, wenn Rapid Wien statt den
traditionellen grün–weißen Dressen in roten Trikots einlaufen müsste.
Die zweite Änderung, die Vincent Tah vornahm, betraf das Wappen. Er änderte das Logo von
einem Vogel zu einem Drachen.
Cardiff City war zu dieser Zeit hoch verschuldet, und der Club war auf das Geld des Investors
angewiesen. Doch für viele Fans war dieser Akt untragbar und sie kehrten dem Verein den
Rücken. Cardiff stieg zwar 2013 in die Premiere League auf, aber bereits ein Jahr später
wieder ab. 2015 verließ Tah den Club, und Cardiff änderte wieder die Vereinsfarben in Blau.
Auch Hull City erlebte durch den ägyptischen Investor Assem Allam ein Fiasko. Dieser
Geldgeber versuchte den Vereinsnamen des Clubs zu ändern, um ausländische Sponsoren
anzulocken.43 Doch der englische Fußball Verband erlaubte diesen Schritt nicht. Seitdem
möchte Allam den Verein verkaufen, nur er findet keinen Käufer und verlor das Interesse am
Club. 44
Eine ähnliche Geschichte ereignete sich auch beim FC Malaga in Spanien. Ein Öl-Scheich
pumpte 150 Millionen Euro in den Klub und kaufte Stars wie Ruud van Nistelroy oder Isco.45
Kurzeitig war der Erfolg da, 2012 stand man sogar im Viertelfinale der UEFA Champions
League.
Doch dann drehte der Scheich den Geldhahn zu und Malaga konnte nicht mehr die
Gehaltskosten der Spieler zahlen. Sie verstießen auch gegen das Financial Fairplay und
wurden sogar für ein 1 Jahr aus allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. „2018/19
42
Vgl. ebd.
43
Pfannenmüller: Fußball: Immer mehr Vereine sind von Investoren abhängig, in:
https://pfannenmuellersportblogs.wordpress.com/2018/06/10/fussball-immer-mehr-vereine-sind-der-laune-von-
investoren-unterworfen/ [abgerufen am 28.03.2019]
44
Vgl. ebd.
45
Vgl. Pfannenmüller: Fußball: Immer mehr Vereine sind von Investoren abhängig, in:
https://pfannenmuellersportblogs.wordpress.com/2018/06/10/fussball-immer-mehr-vereine-sind-der-laune-von-
investoren-unterworfen/ [abgerufen am 28.03.2019]
22stieg Malaga sogar aus der 1. Liga ab und muss zukünftig in der 2. spanischen Liga spielen.
Viele Fans fordern den Ausstieg des Investors, der immer noch Eigentümer des Vereins ist. 46
Eine wesentlich kompliziertere Angelegenheit betrifft das Konstrukt Red Bull und Fußball.
Mittlerweile hat Red Bull 4 Fußballclubs: Red Bull Salzburg, RB Leipzig, RB New York und
Red Bull Brasil.
Eines muss gesagt werden, ohne Red Bull Salzburg würde der österreichische Vereinsfußball
im europäischen Vergleich für Spitzenfußball sehr schlecht dastehen Es ist allein Red Bull
Salzburg zu verdanken, dass wir jedes Jahr so viele internationale Startplätze für den
europäischen Wettbewerb zur Verfügung haben. Doch Red Bull und Fußball ist für mich das
Sinnbild der Kommerzialisierung in dieser Sportart. In der aktiven Fanszene in Deutschland
und Österreich wird der Club Red Bull noch immer nicht akzeptiert. Und auch die mediale
Kritik am Konstrukt Red Bull wird immer lauter. Red Bull hat am Standort Salzburg ca. 700
Millionen Euro investiert.47 Man hat zwar in den letzten Jahren ständig die Meisterschaft in
Österreich gewonnen und ist den andern Vereinen innerhalb der Liga weit voraus, dennoch
hat man das große Ziel, die Qualifikation für die Champions League jahrelang nicht
geschafft. Die Red Bull Akademie ist zwar eine der besten in ganz Europa, doch mehr als ein
Ausbildungsverein wird Red Bull Salzburg wohl nie sein. Sobald der große Bruder aus
Leipzig anklopft, müssen die auserwählten Spieler in die Sachsenstadt wechseln, ob sie
wollen oder nicht. In den letzen Jahren waren 15 Spieler davon betroffen, obwohl von den
Verantwortlichen behauptet, dass beide Clubs strikt voneinander getrennt sind. 48
2009 wurde der Klub RB Leipzig gegründet. In Deutschland ist es verboten Sponsoren im
Vereinsnamen zu tragen. Deshalb heißt der Club auch nicht Red Bull Leipzig, sondern Rasen
Ballsport Leipzig. Doch mit der Abkürzung RB sollte erreicht werden, dass eigentlich die
Firma Red Bull assoziiert wird. In Deutschland war der Aufschrei noch größer als in
Österreich. Das liegt einerseits daran, dass es in Deutschland viele erfolgreiche Klubs wie
Bayern München oder Borussia Dortmund gibt, die RB Leipzig als Feinbild sehen, weil der
Verein gewisse Regeln umgangen hat, um die Lizenz für die erste Bundesliga zu bekommen.
„Unter anderem sei hier die 50+1 Regel genannt und die Verpflichtung der Vereine,
46
Vgl. ebd.
47
Vgl. HOFER, Gernot: Red Bull im Fußball: Fluch oder Segen?, in: https://www.sturmnetz.at/red-bull-im-
fussball-fluch-oder-segen/ [abgerufen am 30.03.2019]
48
Vgl. 12terMann.at: Von Salzburg nach Leipzig: Die Elf der Red-Bull-Transfers, in:
https://www.12termann.at/oefb/bundesliga/von-salzburg-nach-leipzig-die-elf-der-red-bull-transfers/ [ abgerufen
am 01.04.2019]
23Mitbestimmung der stimmberechtigten Mitglieder zu ermöglichen“.49 Doch bei RB Leipzig
kann man kein Mitglied werden. Dies ist ein Novum im deutschen Fußball, kein anderer
Verein verstößt gegen diese Regel.
Doch das Red Bull Imperium wächst immer weiter. Man hat noch weitere Fußall Clubs in
USA ( New York Red Bull), Brasilen und Ghana. Die Marke Red Bull ist heutzutage im
Fußball nicht mehr wegzudenken. Ob dies nun Fluch oder Segen ist, darf jeder für sich selbst
entscheiden.
2.5.3 50+1 Regel in Deutschland
In der Deutschen Bundesliga läuft zurzeit eine große Debatte, ob man sich für Investoren
öffnen sollte. Derweil ist es durch die 50+1 Regel nicht möglich, dass ein Investor einen
Fußballclub in Deutschland übernimmt. „Die 50+1-Regel des DFB und der DFL besagt, dass
in den deutschen Lizenzligen ausschließlich diejenigen aus den Fußballklubs ausgegliederten
Kapitalgesellschaften spielberechtigt sind, bei denen die Mehrheit der Stimmanteile beim
Verein liegt.“50
Vor allem für die Fans der Vereine ist das eine große Herausforderung, denn viele Fanclubs in
Deutschland stehen Investoren argwöhnisch gegenüber. Wie schon im vorherigen Kapitel
erwähnt, „droht dem Verein Identitätsverlust und eine unkontrollierbare wirtschaftliche
51
Situation“. Daher kam es in den letzen Jahren auf den Fußballplätzen in Deutschland zu
Kundgebungen mit Spruchbändern und Choreografien für die Erhaltung der Regel. Man
gründete sogar das Bündnis „Pro Fans“, in dem sich die Anhänger für den Erhalt der Regel
ausgesprochen haben und lautstark gegen DFB und DFL protestiert haben.
„Bundesweit wird ein Sturm heraufziehen, sollten die Verantwortlichen bei DFB und
DFL nicht schleunigst ein Machtwort für den Erhalt von 50+1 in seiner jetzigen Form
sprechen: Die angestrebte Diskussion um 50+1 ist eben nicht nur eine
49
Vgl. HOFER, Gernot: Red Bull im Fußball: Fluch oder Segen?, in: https://www.sturmnetz.at/red-bull-im-
fussball-fluch-oder-segen/ [abgerufen am 30.03.2019]
50
Spox.com: 50+1: Die Diskussion um die wichtigste Frage der Zukunft des Fußballs, in:
http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/1803/Artikel/diskussion-um-50-plus-1-die-wichtigste-frage-
der-zukunft.html [abgerufen am. 04.04.2019]
51
Spox.com: 50+1: Die Diskussion um die wichtigste Frage der Zukunft des Fußballs, in:
http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/1803/Artikel/diskussion-um-50-plus-1-die-wichtigste-frage-
der-zukunft.html [abgerufen am. 04.04.2019]
24Schönheitsdiskussion um irgendwelche Vereins- und Unternehmensstrukturen, sondern
definitiv der sportpolitisch wichtigste Kampf in der nahen Zukunft für alle Fans."52
Es gibt natürlich auch die Gegenseite, die fordert, dass die Vereine selbst entscheiden können,
ob man einen Investor ins Boot holt oder nicht. Doch das wird vom Bündnis kritisch gesehen,
weil es den Wettbewerbsdruck gegenüber anderen erhöht.
Ich persönlich vertrete die Meinung, dass sowohl Fans als auch Vereinsvorstände der
Deutschen Bundesliga verantwortungsvolle Zukunftsperspektiven anstreben müssen, um den
Fußball auch in den kommenden Jahren faszinierend zu gestalten. Möchte man international
erfolgreich sein und um große Titel wie die Champions League mitspielen, wird man einen
Investor benötigen, ansonsten wird es kaum möglich sein, mit den großen europäischen Clubs
finanziell mitzuhalten. Weiters besteht die Gefahr, dass die besten Spieler der Vereine den
Weg ins Ausland suchen, denn die deutschen Clubs können nicht mit den Gehaltsvolumen der
englischen, spanischen oder italienischen Liga mithalten. Deshalb wird es in Zukunft
spannend, ob die 50+1 Regel dem internationalen Druck standhält.
2.6 Medien
Der dritte Bereich, der für die Kommerzialisierung des Fußballs verantwortlich ist, betrifft
die Medien. Heutzutage ist es uns möglich, fast jeden Tag live Fußballübertragungen zu
sehen, wenn wir die passenden Abos haben. Egal ob auf Sky, DAZN oder Eurosportplayer,
jeden Tag läuft Live-Fußball. Für Fußballfreaks ist dies ein wahrer Segen, doch viele reden
auch von einer Übersättigung am Markt. Ein weiters Problem ergibt sich aus der Tatsache,
dass Fußball hauptsächlich nur mehr im Pay-TV übertragen wird, und dies kostet, wie der
Name schon sagt, Geld. Allein ein Sky Fußballabo kostet um die 50 Euro im Monat, obwohl
hier nicht einmal alle Spiele der Deutschen Bundesliga übertragen werden.
Doch es sind nicht nur die TV-Medien, die heutzutage den Fußball bestimmen, auch die
sozialen Medien haben die Vorteile von Fußball erkannt.
52
EBD.
252.6.1 TV-Medien
Eines der wichtigsten Einkommen der Fußballvereine sind die Übertragungskosten, die
Fernsehsender an die Clubs zahlen. Die Sender müssen die Übertragungsrechte erwerben, um
die Fußballspiele dann ausstrahlen zu dürfen. Im Fußball werden die Rechte meistens von den
Verbänden des jeweiligen Landes verkauft.
An Hand der deutschen Bundesliga lässt sich gut aufzeigen, wie sich in den letzten Jahren die
Kosten entwickelt haben. Im Jahre 1950 „zahlte der Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR)
zwischen 1000 und 2500 DM pro Spiel, das live gesendet wurde.“53 Mit der Einführung der
Deutschen Bundesliga kam es dann zur Zentralvermarktung. Die ARD zahlte 1963 ungefähr
0,33 Millionen Euro pro Saison. 54
In den 80er Jahren kam es dann zu einer Revolution in der deutschen Sportberichterstattung.
Durch die Einführung des dualen Rundfunksystems entdeckten werbetreibende
Wirtschaftsunternehmen das Potenzial von Fußball für sich.55 Auch private Sender erwarben
die Übertragungsrechte, um sich am Markt etablieren zu können.
So kam es, dass von 1993 bis 1998 die jährliche Fußballübertragung von 2750 Stunden auf
5400 Stunden stieg.56 Die Auswirkungen waren ein richtiges Wettbieten der Sender um die
Rechte an der Deutschen Bundesliga. Die Kosten für die Übertragungsrechte stiegen
zwischen 1985 und 2000 um 6250 Prozent.57 Vor allem der Kirch Konzern, damals noch
Premiere, trieb den Preis stark nach oben. Für die Saison 2000/2001 zahlten sie schon 355
Millionen Euro.
53
Bundeszentrale für politische Bildung: Kommerzialisierung des Sports.
Das Beziehungsgeflecht von Medien, Werbung und Sport, in: https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-
sport/deutsche-fernsehgeschichte-in-ost-und-west/245748/kommerzialisierung-des-sports [abgerufen am.
04.04.2019]
54
Vgl .ebd.
55
Die Welt: Wie das Geld zum Fußball kam. in: https://www.welt.de/wams_print/article2078861/Wie-das-
Geld-zum-Fussball-kam.html [abgerufen am 04.04.2019]
56
Vgl. Die Welt: Wie das Geld zum Fußball kam. in: https://www.welt.de/wams_print/article2078861/Wie-das-
Geld-zum-Fussball-kam.html [abgerufen am 04.04.2019]
57
Vgl. ebd.
26Mittlerweile bekommt die deutsche Bundesliga 1,16 Mrd Euro pro Jahr an TV Rechten. Die
englische Premier League kassiert sogar das Doppelte, 2,3 Mrd Euro pro Jahr. Dieses Geld
wird dann meistens für Transferablösen oder Spielergehälter verwendet.
Die Vereine freuen sich natürlich über das Geld, denn für sie ist es 1/3 des Gesamtbudgets.
Letztes Jahr hat die DFL acht sogenannte TV-Pakete verkauft, mit verschiedenen Optionen
für Free-Pay-TV- Anbieter, Streamingdienste und Online–Audio Angebote.58 Auch die
Anstoßzeiten haben sich nun weiter auseinander geschoben. In den 2000ern wurde nur an
zwei Anstoßzeiten gespielt, Samstag 15:30 Uhr und Sonntag 15:30 Uhr. Heute sind die
Spieltermine über das ganze Wochenende verteilt: Freitag 20:30 Uhr , am Samstag 15:30 Uhr
und 18:30 Uhr, Sonntag 15:30 Uhr und 18:00 Uhr und fünfmal im Jahr um 13:30, dazu
kommen noch fünf Montagsspiele pro Saison um 20:30 Uhr.59
Bei einer Fußballübertragung geht es schon lange nicht mehr um das Spiel alleine,
mittlerweile braucht man eine große Show rund um das Spiel. Das beginnt mit der
Liveübertragung ca. eine Stunde vor dem Spiel, wo sämtliche Mannschaftsaufstellungen und
Taktikprognosen andiskutiert werden. Spielszenen in Superzeitlupe oder Drohnenbilder, die
das Stadion von oben filmen, Taktikanalysen und Interviews runden die Fußballübertragung
ab.60 Oft gibt es auch schon einen Trailer zu einem Spiel, der mehr an einen
Hollywoodblockbuster erinnert als an ein Fußballmatch.61
2017 versuchte auch der DFB die legendäre Halbzeitshow des Amerikanischen Superbowl
nachzuahmen. Man lud Schlagerstar Helene Fischer ein, um die Fans in der Pause mit einer
Show zu unterhalten. Doch dies ging nach hinten los, über den gesamten Auftritt wurde die
Schlägersängerin von den Fans ausgebuht.
Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind die Fans, die für Fußballübertragungen plötzlich
viel Geld hinlegen müssen. Mein Großvater kann leider seinen geliebten SK Sturm Graz nicht
mehr im Fernsehen live schauen, weil die Österreichische Bundesliga nur noch im Pay-TV
58
Vgl. Vgl. Hock, Andreas: Ein Spiel dauert 90 Millionen. Wie der Kommerz unserm Fußball die Seele raubt.
München: Rivaverlag 2018 S. 130.
59
Vgl. ebd.
60
Vgl. Vgl. Vgl. Hock, Andreas: Ein Spiel dauert 90 Millionen. Wie der Kommerz unserm Fußball die Seele
raubt. München: Rivaverlag 2018 S. 130.
61
Vgl. ebd. S.131.
27läuft und er nicht dazu bereit ist, zusätzlich zu den Fernsehgebühren noch extra Geld zu
bezahlen. Für mich als Student stellt es eine gewisse finanzielle Belastung dar, meinem
Hobby zu frönen und meine Lieblingsmannschaften im Fernsehen live zu verfolgen. Wenn
sich die Kosten für Fußballübertragungen in diesem Maße weiter verteuern, wird sich auch
für mich in Zukunft die Frage stellen, ob der finanzielle Aufwand noch tragbar ist.
2.6.2 Fußball und soziale Medien
Soziale Netzwerke sind in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Auch der Fußball
ist sehr stark präsent. Jeder Verein hat eine offizielle Seite auf Facebook oder Instagram, um
sich möglichst Fan-nah zu präsentieren. Meist nutzen die Vereine die sozialen Netzwerke,
um Eindrücke von Training, Presseterminen oder sonstigen Vereinsveranstaltungen zu
präsentieren. Auch Fußballer haben den Nutzen von sozialen Netzwerken erkannt. Viele
haben bezahlte Partnerschaften mit Sponsoren, die sie regelmäßig in ihren Postings bewerben.
Der Umgang mit sozialen Medien ist für Fußballer ein heiße Gradwanderung. „ Das Dribbeln
zwischen authentischer Fan-Nähe, Einblicken ins Privatleben und kritischen Nutzer-
Kommentaren führt nicht selten zum Eigentor.“ 62 Vorsicht ist geboten, was man postet, weil
man unter Umständen sich auch rasch einem Shitstorm aussetzen muss. Jüngstes Beispiel
war die „Gold Steak Affäre“ um Franck Ribery. Dieser hatte im Januar 2019 beim türkischen
Promikoch Nurs Et, auch bekannt als „Saltbae“, ein Steak serviert bekommen, das mit
Blattgold umhüllt war. Ribery postete das Bild mit dem Steak auf Instagram, und ein
unbeschreiblicher Aufschrei der Community folgte. Viele User warfen Ribery vor, protzig zu
sein, und fanden es moralisch bedenklich, wenn man weiß, dass viele Menschen an Hunger
leiden. Riberys Rechtfertigungsversuch bestand darin, dass das Gold Steak ein Geschenk des
Starkochs war, und er es gar nicht bestellt hätte.
Da Soziale Medien zur Zeit immense Bedeutung haben, bieten viele Vereine mittlerweile
auch Medienschulungen für Fußballer an, in denen auch genau festgelegt wird , was gepostet
werden darf und was nicht, damit den Spielern und den Vereinen kein Schaden entsteht. Viele
Sportler lassen ihren Account von einer Beratungsagentur verwalten, weil der Aufwand und
moralische Verantwortung ihnen zu groß sind.
62
TZ: Fußballer und ihr Umgang mit Social Media, in: https://www.tz.de/sport/fussball/fussballer-und-ihr-
umgang-mit-social-media-zr-11440291.html [abgerufen am 07.04.2019]
28Sie können auch lesen