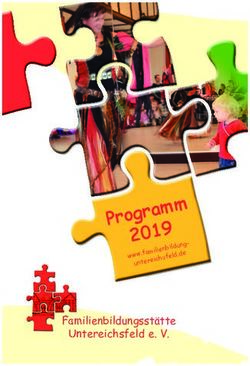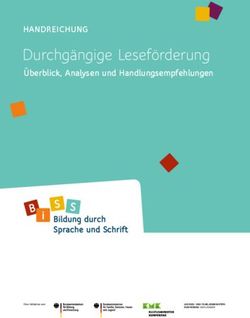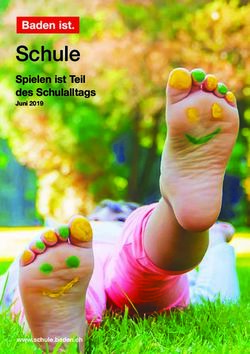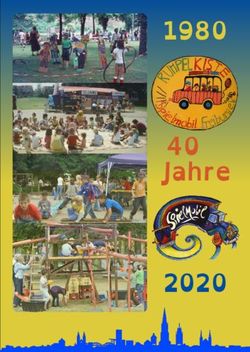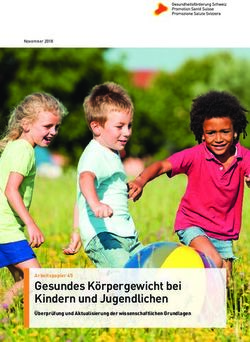TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN NACH SEXUALSTRAFTATEN KINDESMISSBRAUCH UND SEINE FOLGEN - Digitale Bibliothek ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Fachbereich Soziale Arbeit, Bildung und Erziehung
Studiengang Soziale Arbeit
TRAUMAFOLGESTÖRUNGEN NACH SEXUALSTRAFTATEN
-
KINDESMISSBRAUCH UND SEINE FOLGEN
Bachelorarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Bachelor of Arts (B.A.)
vorgelegt von: Sophie Conrad
Prüferin: Frau Prof. Dr. Barbara Bräutigam
Zweitprüferin: Frau Dr. Mirjam Reiß
URN-Nummer: urn:nbn:de:gbv:519-thesis2020-0725-5Inhaltsverzeichnis
Einführung ..................................................................................................................................1
Annäherung an wichtige Begrifflichkeiten....................................................................................2
Sexueller Missbrauch an Kindern ............................................................................................2
Traumatisierendes Ereignis, Trauma, Traumafolgestörung .....................................................3
Arten von Missbrauch .................................................................................................................4
… in der Familie ......................................................................................................................4
… in Institutionen ....................................................................................................................5
… peer-to-peer ........................................................................................................................6
… in organisationeller und ritueller Form .................................................................................7
… in der digitalen Welt ............................................................................................................9
Erkennungsmerkmale und Symptomatik ...................................................................................11
Traumafolgestörungen ..............................................................................................................12
Posttraumatische Belastungsstörung ....................................................................................13
Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung und Borderline Persönlichkeitsstörung .......14
Dissoziative Störungen..........................................................................................................16
Präventive Maßnahmen ............................................................................................................18
Gesamtkonzept des Bundesfamilienministeriums .................................................................19
Täter*innenprävention am Beispiel „Kein Täter werden“ ........................................................20
„Trau dich!“ – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ...............................................23
Schutzkonzepte in pädagogischen Einrichtungen .................................................................26
Beispiel Kinder- und Jugendhilfe Verbund Mecklenburg-Vorpommern...............................27
Prävention in der Sozialen Arbeit ..............................................................................................29
SAFE® ..............................................................................................................................30
STEEP™ ...........................................................................................................................31
Erzieherische Prävention und Sexualpädagogik ................................................................33
Anforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit ................................................................. 36
Fazit..........................................................................................................................................40
Abbildungsverzeichnis ..............................................................................................................42
Abbildung 1 – Rahmenmodell der Ätiologie von Traumafolgen nach Maercker 2013 ............ 42
Abbildung 5 – Überblick Ablauf SAFE nach Brisch 2016 ....................................................... 42
Quellenverzeichnis ...................................................................................................................43Einführung
Sexuelle Gewalt wird als die zerstörerischste Form der Gewalt erlebt und geht damit
meist mit einer Traumatisierung einher. 2020 wurden polizeilich über 16.000 Kinder
erfasst, die Opfer wurden. Die Dunkelziffer lässt auf viele weitere schließen.1
90-95% der missbrauchten Kinder und Jugendlichen weisen bei körperlichen
Untersuchungen Normalbefunde auf. Auf dem Körper bleibt diese massive Gewalt also
häufig unentdeckt, da Täter, die zu einem großen Teil aus dem nahen Umfeld kommen,
aufgrund eines Wiederholungsbedarfs keine physische Schädigungsabsicht verfolgen 2.
Diese Arbeit befasst sich mit den Grundlagen des komplexen Themas der sexuellen
Gewalt an Kindern und nimmt darin Traumafolgestörungen in den Fokus. Schwerpunkt
bildet in diesem Zusammenhang die Prävention, nicht zuletzt durch die Soziale Arbeit.
Sexueller Kindesmissbrauch ist leider noch immer ein viel zu großes Tabuthema und
die Ergreifung präventiver Maßnahmen lässt dort für sich sprechen. Erst 2014 wurde
ein Grundkonzept des Bundesfamilienministeriums errichtet, welches Schutzkonzepte
für Einrichtungen, Organisationen, Vereine, etc. niederlegt. Rechte, die z.B. die
Verjährungsfrist solcher Straftaten verlängern oder Opfern Anspruch auf Unterstützung
gewähren, kamen Jahre später.
Da Sozialarbeiter*innen in einigen Bereichen täglich mit Kindern, Peergroups und deren
Familien zusammenarbeiten und sexuelle Gewalt häufiger vorkommt als es gewünscht
ist, ist es für diese Fachgruppe notwendig sich Wissen in diesem Bereich anzueignen.
Ohne Wissen kann keine Handlung erfolgen. Sowohl in der Intervention als auch der
Prävention nicht. Zur Prävention gehört allerdings nicht nur die Misshandlungsthematik,
auch die eigene Person muss sich selbst unter die Lupe nehmen, um bestmöglichen
Schutz gewährleisten zu können. Die Anforderungen an das Fachpersonal und
pädagogische Möglichkeiten der Prävention ist demnach auch Teil der Arbeit. Ziel ist
es, einen möglichst guten Wissensstand über die wichtigsten Fakten zu generieren, der
als Grundlage für tiefergehende Inhalte dienen kann.
Um einen aktuellen Forschungsstand zu gewähren, wurde darauf geachtet
dementsprechendes Material zu verwenden. Da dies aber nicht immer nur in der
Literatur zu finden ist, wurde sich auch auf angemessene Websites und angegebene
Informationsbroschüren, Podcasts oder Dokumentationen gestützt.
1 vgl. Statista 2021 (Internetquelle)
2 vgl. Herrmann 2016, S. 136
1Annäherung an wichtige Begrifflichkeiten
Sexueller Missbrauch an Kindern
„[…] jede sexuelle Handlung, die an oder vor einem Kind entweder gegen den Willen
des Kindes vorgenommen wird oder der das Kind aufgrund körperlicher, psychischer,
kognitiver oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kann. Der Täter
nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine eigenen Bedürfnisse auf
Kosten des Kindes zu befriedigen.“3
Der Begriff des sexuellen Missbrauchs steht allerdings in Kritik, da er impliziert, dass es
auch einen „richtigen Gebrauch“ von Kindern gibt. Angebrachter scheint der Begriff der
sexuellen Gewalt zu sein. Hier wird direkt eingeordnet, dass mithilfe sexueller
Tätigkeiten Gewalt ausgeübt wird. Die begriffliche Veränderung soll in Zukunft auch im
Gesetzbuch Beachtung finden4.
Das Strafgesetzbuch nimmt in §§ 176 ff. Sexueller Missbrauch von Kindern die
Altersgrenze von 14 Jahren auf und bestimmt den Strafrahmen auf sechs Monate bis
zehn Jahre, in schweren Fällen nicht unter einem Jahr. Im Falle einer Todesfolge wird
die Freiheitsstrafe auf mindestens zehn Jahre bemessen. Hinzufügend zur oben
genannten Definition wird hier auch von Missbrauch gesprochen, wenn das Kind
sexuelle Handlungen an jener Person oder Dritten ausführen soll5.
3 Bange und Deegener zit. nach UBSKM 2016, S.8 (Internetquelle)
4 vgl. Krasa / Wohlers Podcast Mordlust 2020, ab 01:03:17
5 vgl. Bundesamt für Justiz, Gesetze im Internet
2Traumatisierendes Ereignis, Trauma, Traumafolgestörung
Der Begriff des Traumas stammt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie
„Wunde“6, wobei es sich hierbei um seelische bzw. psychische Wunden handelt. Diese
entstammen einem oder mehreren traumatisierenden Ereignissen, die als besonders
bedrohlich wahrgenommen werden können. Der DSM-5 differenziert es „auf ein
Ereignis oder Ereignisse, die eine Konfrontation mit „actual or threatened death, serious
injury, or sexual violence“ beinhaltet“7. Jene Ereignisse gehen demnach mit einer
starken erlebten bzw. gefühlten Lebensbedrohung einher.
Traumatisierende Ereignisse erlebt so gut wie jeder Mensch in seinem Leben, wie der
Verlust einer nahestehenden Person, Autounfälle, Übergriffe, einprägsame Krankheiten
oder auch Naturkatastrophen. Vergewaltigungen, Gewalt oder Vernachlässigung zählen
aber auch dazu. Sie werden in sogenannte Typ-I und Typ-II-Traumata unterschieden.
Typ I beinhaltet einmalige und kurzfristige, Typ II mehrfache und längerfristige
Ereignisse. Zusätzlich wird in „human-made“, von Menschen gemachte, und „not
human-made“, von außen kommende, Traumata unterschieden. „human-made“-
Traumata gelten zum Teil als schwerwiegender, da z.B. das komplette Menschenbild
erschüttert werden kann.
Nicht jedes führt allerdings zu einem Trauma, da individuelle
Bewältigungsmechanismen bestehen oder die Situation unterschiedlich
wahrgenommen wurde. Traumata entwickeln sich schlichtweg dann, wenn keine
Bewältigungsstrategien vorhanden sind und ein übermäßiges Gefühl der Hilflosigkeit
vernommen wird8. Aufgrund der Situation wird das Wohlbefinden der betroffenen
Person dann nachhaltig negativ beeinflusst.
Hält eine Traumasymptomatik länger als sechs Monate an, lässt sich schon von einer
Folgeerkrankung sprechen. Teilweise können sich Folgestörungen aber auch erst
mehrere Jahre später entwickeln. Die Entwicklung hängt dabei von mehreren Faktoren
ab (siehe Abbildung 1). Die Posttraumatische Belastungsstörung, Komplexe
Posttraumatische Belastungsstörung und Dissoziative Störungen sind mit komorbiden
Störungen, wie Depressionen, Angsterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen, die
drei schwersten Folgeerkrankungen.9
6 vgl. Hüllemann 2019, S. 9
7 APA 2013, S. 271 zit. nach Langer et al. 2020, S. 9
8 Fischer / Riedesser zit. nach Dixius / Möhler 2019, S. 17
9 vgl. Dipl. Psych. Nottelmann (Internetquelle)
3Arten von Missbrauch
Missbrauchsfälle können so gut wie über all dort stattfinden, wo sich Kinder aufhalten.
Dennoch gibt es Sozialräume, in denen Fälle häufiger bzw. seltener stattfinden. Zu
verzeichnen ist, dass missbrauchte Kinder die Täter*innen zu etwa 90% kennen. 30%
kommen direkt aus der Familie, die restlichen 60% aus dem familiären Umkreis. Zu ca.
6% kennen Opfer die Peiniger*innen nicht.
Zu 80-90% sind es Männer oder männliche Jugendliche, die sexuelle Gewalt ausüben.
Dabei ist jedoch zu beachten, dass es zu missbrauchenden Frauen oder weiblichen
Jugendlichen eher wenig Forschung gibt und das Dunkelfeld doch höher sein mag. 10
Wichtig zu erwähnen ist, dass es keinen direkten Zusammenhang gibt zwischen der
sexuellen Präferenzstörung Pädophilie / Hebephilie, also der sexuellen Anziehung zu
Kindern, und sexueller Gewalt. „Nur“ 40-50% der Täter*innen haben diese Störung.
Zu einem gewissen Teil haben Ausübende selbst solche Gewalttaten in der Kindheit
erlebt.11
Kinder bilden generell eine sehr vulnerable Gruppe ab, da sie noch sehr hilfebedürftig
und abhängig von ihrem Umfeld sind12. Zusätzlich das Alter und eine körperliche
Unterlegenheit zu Erwachsenen, machen sie zu leichteren Opfern. Sie haben weniger
bis gar keine Ausdrucksmöglichkeit oder ihnen wird ihre Glaubwürdigkeit in einigen
Fällen abgeschrieben13.
… in der Familie
Für Kinder ist hier die Familie nicht mehr ein Ort des Vertrauens und der Sicherheit. Vor
allem familiärer Missbrauch ist langwierig, da sich die Täter*innen im unmittelbaren
Umfeld befinden und meist Tag für Tag anwesend sind.
Gerade in dieser Situation ist es schwieriger den Taten zu entfliehen. Trotz des
massiven Vertrauensbruchs und der Grenzüberschreitung vermeintlicher
Bezugspersonen, besteht ein hohes Loyalitätsverhältnis. Oftmals wird es auch als
„familiäres Geheimnis“ deklariert, weshalb die betroffenen Kinder schweigen oder Angst
10 vgl. UBSKM (Internetquelle)
11 vgl. Y-Kollektiv 2018, ab Minute 7:00 (Internetquelle)
12 vgl. Oppermann u.a. 2018, S. 33
13 ebd., S. 34
4haben, ihre Eltern zu verlieren. Kinder, die noch nicht sprechen können, sind solchen
Missbräuchen erst recht ausgeliefert.
Trauen sich die Betroffenen doch, den Missbrauch anzusprechen ist es erschreckend,
wie lange es dauert bis eingeschritten wird. Prof. Dr. Sibylle Banaschak, Leiterin des
"Kompetenzzentrums Kinderschutz im Gesundheitswesen NRW", betont – sieben Mal
muss ein Kind „laut“ werden.14
In einer Aufarbeitung der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen
Kindesmissbrauchs wurden in (bis 2019) 524 Fällen festgestellt, dass knapp 43% der
eigene Vater der Täter war, gefolgt mit 15% kam der Missbrauch vom Stiefvater,
Lebensgefährten oder Freund der Mutter. Frauen als Täterinnen wurden hier zu 11%
fest gemacht.15 Die Datenlage ist nicht unbedingt repräsentativ, zeigt aber dennoch
einen Einblick und ist mit den oben genannten Prozentsätzen vereinbar. Diese
Aufarbeitung der Unabhängigen Kommission wird bis ins Jahr 2023 fortgesetzt, wobei
danach stichhaltigere Zahlen zum Vorschein kommen könnten.
… in Institutionen
Beim institutionellen Missbrauch handelt es sich um sexualisierte Gewalt, die in
Institutionen, z.B. Kinder- und Jugendeinrichtungen, Vereine, Schulen, Kirchen, durch
Fachkräfte ausgeübt wird. Vor allem in diesem Einrichtungen ist der „Zugang“ zu
Kindern leichter. In dieser Verbindung lässt sich der Begriff der „Autoritätsmacht“
auffinden. Diese Macht basiert also auf professionelle Gegebenheiten, die in einem
begrenzten Zeitraum gegenüber Schutzbefohlenen zur Verfügung gestellt wurde. 16
Zusätzlich zur generellen Unterlegenheit von Kindern, kommen institutionelle Regeln
und Strukturen mit vorhandenen Hierarchien. Das bestehenden Machtgefälle wird noch
verstärkt.
Sexuelle Gewalt ist aber nicht nur durch Fachkräfte direkt vorzufinden. Jene
Professionelle können auch Dritte dazu zwingen, diese Gewalt auszuüben, bspw. dass
ein Jugendlicher ein jüngeres Kind missbrauchen soll.
14 vgl. Banaschak 2020 (Internetquelle)
15 vgl. UBSKM zit. nach Statista 2019
16 vgl. Ferring / Willems 2014, S. 14 ff.
5Täter*innen kennzeichnen sich meist dadurch, dass sie unter Kolleg*innen oder Eltern /
Erziehungsberechtigten besonders beliebt sind und nach außen als sehr unscheinbar
und vertrauenswürdig gelten.
Kinder, die schon vorbelastet sind oder anderweitig beeinträchtigt sind, sind meist
häufiger betroffen, da sie ein besonderes Bedürfnis an Nähe zeigen.
Anders lässt sich der Missbrauch auch als Bestrafung, meist in Verbindung mit anderen
psychischen und physischen Gewalttaten, kategorisieren.
Aktuelle Zahlen lassen sich in keiner zufriedenstellenden Weise finden. Da aber
feststeht, dass 60% der Täter*innen aus dem Umfeld stammen, ist anzunehmen, dass
jegliche Institutionen einen weiträumigen Ort für Missbrauchshandlungen darstellen.
Diese Annahme lässt sich zusätzlich mit dem Punkt begründen, dass Kinder die meiste
Zeit in Kitas, Schulen oder sonstigen freizeitlichen Einrichtungen verbringen, die
Wahrscheinlichkeit des Übergriffs also hoch ist.
… peer-to-peer
Hier dreht es sich um die sexuelle Gewalt unter Gleichaltrigen. Da der Übergang von
einvernehmlichen zu ungewollten Handlungen meist fließend ist, werden Übergriffe in
dieser Systematik meist nicht erkannt oder bagatellisiert. Sogenannte „Doktorspiele“,
die von Erwachsenen als normale Erkundung des Körpers angesehen werden, können
für das Opfer Qualen bedeuten und zusätzlich in Traumafolgen enden.17
Nach Gordon und Schroeder ist die sexuelle Kontaktsuche zu Gleichaltrigen schon ab
einem Alter von 2 – 3 Jahren normal und gilt als Exploration. Übergriffiges und
auffälliges Sexualverhalten unterteilen sie in drei Gruppen – fraglich kritisches
Verhalten, kritisches Verhalten und alarmierendes Verhalten.18
1) Unter fraglich kritischen Verhaltensweisen sehen Gordon und Schroeder
beispielsweise die gehäufte Beschäftigung und Kommunikation, auch mit
Gleichaltrigen, mit Sexualität. Interesse an dem Körper anderer und das
Berühren im bekleideten Zustand zählt darunter.
17 vgl. Fegert u.a. 2015, S. 384 ff.
18 vgl. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, S. 5 ff. (Internetquelle)
62) In der nächsten Kategorie erscheint schon das Berühren von Genitalien und
das gewaltsame Zeigen derer, das Einführen von Gegenständen, intensive
Selbstbefriedigung oder das Anbieten von sexuellen Handlungen.
3) Penetration aller Arten (vaginal, oral, anal) von Tieren, anderen Kindern oder
Puppen, die Nachahmung von Geschlechtsverkehr und direkte sexuelle
Handlungen an jüngeren Kindern zählen dabei als alarmierende
Verhaltensweisen.
Erkennbar ist, dass sich die sexualisierte Gewalt unter Gleichaltrigen nicht unbedingt
unterscheidet von jener durch Erwachsene.19
Kinder unter 14 Jahren, die im Strafrecht sowieso als strafunmündig gelten, werden
auch nicht direkt als „Täter“ bezeichnet. Der Begriff „sexuell übergriffige Kinder“ soll
eine Kriminalisierung verhindern.
Eigene Missbrauchserlebnisse oder unangemessene Erfahrungen mit erwachsener
Sexualität durch die Eltern oder Pornografie können übergriffiges Verhalten
begünstigen. Negative Bindungserfahrungen, Missbrauchserlebnisse oder eine
schwache Nähe-Distanz-Regulation können Risikofaktoren in Bezug auf potenzielle
Opfer darstellen.20
… in organisationeller und ritueller Form
Diese beiden Formen der Gewalt gehen meistens Hand in Hand. Innerhalb solcher
mafiaähnlichen Strukturen wird gezielt und geplant psychischer, körperlicher und
sexualisierter Missbrauch im Sinne eines Glaubenssystems ausgeübt21. Die
ritualisierten Verhaltensweisen und Gewaltanwendungen stehen zusätzlich im Bezug
zur kommerziellen Ausbeutung, wie beispielsweise Kinderpornografie (auch:
Kinderfolterdokumentation) und Kinderprostitution. Das System wird auch als
„Milliardengeschäft“ bezeichnet22.
Das Glaubenssystem setzt sich aus der Annahme zusammen, über anderen Menschen
zu stehen, die „eigentlichen Herrscher der Welt zu sein“. Täter*innen glauben, dass es
19 vgl. Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, S. 6 (Internetquelle)
20 ebd., S. 9
21 vgl. Igney, Trauma & Gewalt 2019, S. 104f.
22 vgl. Huber 2020, ab Minute 18:05 (Internetquelle)
7gut für das System ist, solche Gewalt auszuüben und dadurch eine Berechtigung
erhalten zu haben. Zugang zu solchen Autoritäten fanden die Kinder häufig über die
Eltern, zum Teil, weil diese sich schon dort befanden.
Um diese Kommerzialisierung zu „perfektionieren“, Opfer an die Gruppe zu binden und
die Gruppenstruktur zu schützen, bedienen sich Täter*innen der Manipulation, einfacher
Lernpsychologie und der Bewusstseinskontrolle. Das Konzept bzw. die Fähigkeit der
Dissoziation (siehe „Traumafolgestörungen“) wird speziell genutzt. Ziel ist es damit
letztendlich „funktionsfähige“ Anhänger zu strukturieren, die denken, alles geschehe zu
ihrem Wohlergehen. In einem Forschungsprojekt der Aufarbeitungskommission zu
sexuellem Kindesmissbrauch in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen lässt sich
festhalten, dass 91% der Teilnehmer*innen dissoziative Persönlichkeitsanteile
entwickelten23.
Techniken beinhalten z.B. individuelle lebensbedrohliche Folter bis die Widerstandskraft
des Opfers bricht, der Überlebenswille stark einsetzt und es dissoziiert. Da die
Täter*innen Profis sind, erkennen sie eine Dissoziation, greifen ein und die
abgespaltene Persönlichkeit bekommt eine Identität. So können einzelne Anteile auf die
Art und Weise trainiert und geformt werden, dass sie strukturerwünschte Aufgaben
erledigen, beispielsweise widerstandslos der Prostitution nachgehen24.
Für Betroffene ist ein Ausstieg oft schwer und die Hürden sind groß. Es besteht eine
starke Abhängigkeit zu den Täter*innen und teilweise fehlen ihnen die Beweise, um sich
mittels Strafverfolgung zu schützen. „Dir glaubt ja eh keiner“ ist dann nicht nur eine
Manipulation, sondern wird zur Realität. Die fehlenden Beweise entstehen exemplarisch
durch die sogenannte „weiße Folter“, also maximal stressauslösende Foltermethoden,
die körperlich dann nicht erkennbar sind. Unter diese Folter fallen Scheinhinrichtungen,
Schlafentzug oder auch Waterboarding25.
23 vgl. Aufarbeitungskommission 2021, S. 13
24 vgl. Youtube-Kanal Lunis EinTraumApartment 2020 (Internetquelle)
25 vgl. Trube 2019 (Internetquelle)
8… in der digitalen Welt
Durch die zunehmende Digitalisierung erhalten auch Kinder mehr und einfacheren
Zugang zu Smartphones, Apps, Internet. Menschen, die Interesse daran haben, sich
jener Altersgruppe zu nähern, bekommen dadurch neue Möglichkeiten. „Das
Smartphone wird zum Tatwerkzeug“.
Sexueller Kindesmissbrauch im Netz hat mehrere Seiten und ist ein komplexes System,
welches sich schwer in einzelne Segmente isolieren lässt. Formal legale Handlungen
sind zum Großteil eng verstrickt mit schwer strafrechtlich relevanten Taten.
Einen Graubereich bilden normale Kinderfotos. Täter*innen nutzen Fotos, die privat,
von beispielsweise Eltern, im Internet gepostet wurden, kopieren diese und setzen sie
auf Seiten von sogenannten „Boy- und Girl-Lovern“. Fotos, die Kinder direkt
sexualisieren, also den Intimbereich inszenieren und Posen aufzeigen, sind dort
allerdings auch aufzufinden.26
Abbildung 2: Franke/Graf 2016 nach Taylor et al. 2001
Eine inhaltliche Bewertung kann nach der COPINE-Skala27, welche in der Abbildung 2
dargestellt ist, erfolgen, die die sexuelle Explizität und Gewalt in zehn Stufen unterteilt28.
Unter den Postings können dritte Täter*innen Kommentare schreiben, teilweise als
Pornografie in Textform oder als Anfragen, „das Kind für sich haben zu dürfen“. Die
26 vgl. Das Erste 2019, ab Minute 1:30 (Internetquelle)
27 „Combating Paedophile Information Networks in Europe“
28 vgl. Franke / Graf 2016, S. 88
9Kommentarfunktion wird weiter auch genutzt, um den Weg auf Hardcore-Seiten zu
eröffnen, auf denen Material direkter Kinderfolterdokumentation zu finden ist.29
Täter*innen, die sich mit Kinderfotos beschäftigen, lassen sich auch in Typen
unterscheiden. Die eine Gruppe empfindet eine persönliche Bindung zum Kind, sieht es
als „rituellen Partner“ an. Die andere Gruppe sind sogenannte zwanghafte Sammler, die
stets auf der Suche nach neuen Bildern sind, massenhaft Daten kopieren und nach
dem Prinzip „habe ich, habe ich nicht“ filtern.30
Ein weiteres Spektrum beinhaltet das Cybergrooming, also die direkte Kontaktsuche zu
Kindern im Online-Bereich. Hier können Apps, wie Instagram, oder sogar
Computerspiele genutzt werden. In Deutschlang pflegen allein 730.000 Erwachsene
sexuelle Onlinekontakte zu Kindern. Diese werden unter verdeckten, vermeintlich
gleichaltrigen, Identitäten angeschrieben. Vor allem beim gemeinsamen Spielen
passiert ein unweigerliches Vertrauensverhältnis. Fast jedes sechste Kind wird in
Online-Spielen mit sexuellen Kontaktversuchen konfrontiert. Täter*innen versuchen die
Kinder mittels normal wirkender Gespräche auf andere Messengerdienste, wie
Snapchat, Whatsapp oder Kik, zu locken. Dort gehen sie dann einen Schritt weiter,
versuchen sich mit den Kindern persönlich zu verabreden oder verlangen nach Bildern,
Videos oder Webcam-Treffen.31
Die Motivation liegt bei Täter*innen in der sexuellen Befriedigung in einem vermeintlich
legalen Rahmen. Vor allem, wenn Kinderfotos als normale Fotos deklariert sind oder
keine konkreten Missbrauchshandlungen stattfinden durch einfache Gespräche.
Der Bereich der Kinderpornografie beginnt schon beim oben genannten Graubereich
und findet sein Extrem im direkten Missbrauch mit diversen
Vervielfältigungsmöglichkeiten. Die Zahl der Seiten, die diese Inhalte tragen, lag 2017
bei 80.000.32
Es lassen sich drei verschiedene Deliktmechanismen feststellen – 1) die Produktion,
der Konsum und die Verbreitung, 2) Cyber-Grooming und 3) die Bildung von
Täternetzwerken.33 Grundsätzlich werden die Mechanismen in den Rahmen der Hands-
Off-Delikte eingeordnet, da kein Körperkontakt benötigt wird. Die Strafverfolgung stellt
29 vgl. Das Erste 2019, ab Minute 17:15 (Internetquelle)
30 ebd., ab Minute 7:02
31 ebd., ab Minute 21:15
32 vgl. Huber 2019, S. 135 (Internetquelle)
33 vgl. Franke / Graf 2016, S. 90
10sich allerdings als schwierig heraus, da sich das Netz international ausbreitet. „Länder
mit weniger strikten Strafverfolgungsgrundlagen sind häufig Produktionsorte für
Missbrauchsabbildungen“34.
Erkennungsmerkmale und Symptomatik
Da Kinder eher nicht über ihre Erfahrungen sprechen, da sie vom Täter oder der Täterin
zum Schweigen alarmiert wurden oder Scham und Schuld empfinden, ist es wichtig, auf
Symptomatiken zu achten. Jedes Kind zeigt andere Auffälligkeiten, dennoch gibt es
Gemeinsamkeiten, die auf sexuellen Missbrauch aufmerksam machen können. Sie sind
allerdings kein Garant dafür und können auch andere Ursachen haben.
- Plötzliche Verhaltensänderungen, vor allem aggressive Tendenzen
- Leistungsabfall z.B. in der Schule
- Rückfall in Verhaltensmuster aus früheren Jahren, z.B. Einnässen
- Rückzug, kein Näheempfinden mehr
- Klammern an die Bezugsperson
- Konzentrationsstörungen
- Schlafstörungen und Albträume
- Angst, allein zuhause zu bleiben
- Unangemessenes sexuelles Verhalten
- verändertes Essverhalten, z.B. zu viel oder zu wenig essen
… können Anzeichen sein. Medizinische Befunde gibt es kaum, da vor allem
Täter*innen im nahen Umfeld und bei Wiederholungsabsicht aufpassen. 35
Sollten Kinder sich trotz Angst an jemanden wenden, ist es wichtig zuzuhören. Mit einer
großen Wahrscheinlichkeit denken sie sich so etwas nicht aus.
34 vgl. Franke / Graf 2016, S. 88
35 vgl. UBSKM (Internetquelle)
11Traumafolgestörungen
Nicht jedes traumatische Ereignis zieht eine Folgestörung mit sich.
Ein Trauma zieht bei Kindern schwerere Folgen nach sich, da es die komplette
Entwicklung stören kann. „Entwicklungsaufgaben wie sich an die Schule gewöhnen,
sich von Eltern zu lösen, Selbstkonzept und Persönlichkeit auszubilden und weitere
zentrale Entwicklungsaufgaben werden durch Traumatisierung eingeengt“36. Im
Gesamten führt dies also zu weiteren Störungen und Konflikten.
Die Ausprägung der Folgen wird nicht nur von der Schwere des Traumas bestimmt.
Auch die jeweiligen psychischen, kognitiven, körperlichen und emotionalen
Entwicklungsstände sind entscheidend. Beispielsweise zeichnen jüngere Kinder ihr
Trauma öfter in Spielen ab. Generelle Symptome können z.B. Schlafstörungen,
Trennungsängste, Reizbarkeit oder Konzentrationsschwierigkeiten sein. Beobachtbar
ist auch ein Rückfall in Verhalten innerhalb eines jüngeren Alters, beispielsweise
Einnässen oder Baby-Sprache.
Ältere Kinder zeigen vermehrt dissoziative Zustände, Depressionen, Aggressivität,
selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken und auch Schlaf- und
Konzentrationsstörungen.37
Kennzeichnend ist, dass Traumafolgestörungen mit einer hohen Komorbiditätsrate
einhergehen. Komorbidität bezeichnet, dass neben den Grunderkrankungen noch
weitere Begleiterkrankungen vorliegen. Depressionen, Störungen bezogen auf Angst,
Sucht, Essverhalten, Persönlichkeit und Somatisierung sind, bezogen auf ein Trauma,
die häufigsten komorbiden Erkrankungen. Eine Ausprägung bei Kindern ist auch in
diesen Formen wieder vom Alter abhängig und unterscheidet sich von der Ausprägung
bei Erwachsenen. Meistens werden diese Erkrankungen auch im Vorfeld diagnostiziert,
bevor ein Trauma erkannt wird.38
36 vgl. Dixius 2019, S. 17
37 ebd., S. 18ff
38 ebd.
12Posttraumatische Belastungsstörung
Schon ab dem dritten Lebensjahr können Kinder eine Posttraumatische
Belastungsstörung (PTBS) entwickeln, wobei die Literatur teilweise auch von einer
Entwicklung ab 0 Jahren spricht. Es wird davon ausgegangen, dass sie diese selbst bei
verbaler Vermittlung traumatischer Erlebnisse, z.B. durch Erzählungen oder Bilder,
bilden können. Je nach Alter und kognitiver Beschaffenheit, variieren die Symptome.
Grundlegend lassen sich die Struktur bei Erwachsenen und Kindern vergleichen,
Besonderheit sind dennoch gegeben. Das DSM-5 unterscheidet hier Symptomatiken
bei Kindern unter 6 Jahren und von 6-14 Jahren. Lange Zeit gab es diese
Unterscheidung nicht, eine PTBS bei Kindern und Jugendlichen wurde ausgeschlossen.
Erst 2013 gab es eine vollständige Integration im DSM.
Kinder (im Alter von 6-14 Jahren) mit einer PTBS empfinden so häufig das Erlebnis
spielerisch nach und zeigen das in wiederholter Form. Dafür wird sowohl Spielzeug
verwendet, als auch in Rollenspielen mit anderen Kindern ausgeübt. Teilweise kann es
zu einem Verlust schon erworbener Fähigkeiten kommen und die Betroffenen nässen
wieder ein oder nutzen sprachliche Merkmale aus früheren Lebensjahren.
Weiterhin können Kinder neue Ängste entwickeln, wie z.B. die Angst vor der Dunkelheit
oder einem Monster unter dem Bett. Aggressives und selbstschädigendes Verhalten
spielt auch eine Rolle, wobei die Selbstschädigung eher im höheren Altersbereich zu
finden ist.39
Wie auch oben genannt, erleben Betroffene bei dieser Störung einen Verlust der
Zukunftsperspektive. Sie denken, die Schule nicht mehr abzuschließen, noch lange am
Leben zu bleiben oder später ein Leben mit Familie zu führen.
Speziell bei Kindern unter sechs Jahren ergab sich, dass Auslöser für die Störung eine
Traumatisierung durch die erste Bindungsperson darstellt. Zusätzliche Symptome
können hier eine Änderung des Essverhaltens, Schlafverhaltens und ein Verlust
positiver Empfindungen sein.40
Sexuelle Traumatisierungen besitzen gegenüber anderen Traumata ein 6- bis 7-fach
höheres Risiko an einer PTBS zu erkranken, wobei Mädchen eher betroffen sind als
Jungen41.
39 vgl. Maercker 2019, S. 413
40 ebd., S. 413f.
41 ebd., S. 417
13Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung und Borderline
Persönlichkeitsstörung
Die Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung (KPTBS) und die Borderline
Persönlichkeitsstörung (BPS) hängen stark miteinander zusammen. Bei beiden ist
davon auszugehen, dass schwere, vom Menschen verursachte, Traumata in der
frühesten Kindheit der Ursprung sind. Zu 80% weisen beide Störungen die Kriterien der
jeweils anderen auf.
Sack und Hofmann beschreiben sechs Störungsbereiche, die die KPTBS umfasst42:
1) Beziehungsstörungen
Dass wenigstens eine Bindungsperson vorhanden ist, ist generell bei der Ausprägung
einer Folgestörung sehr wichtig. Kommt es zu interpersonellen Traumata, wie zum
sexuellen Missbrauch, ist das meist nicht gegeben.
Misstrauen, Unsicherheit und ein unausgebildetes Nähe-Distanz-Verständnis prägen
künftige Beziehungsgestaltungen. Die Beziehungsfähigkeit wird stark beeinträchtigt.
Sexuelle Gewalt geht damit einher, dass kindliche Grundbedürfnisse von Nähe und
Geborgenheit missachtet bzw. „anders gekoppelt“ werden. Das Verständnis wird
verändert. So kann der Missbrauch dazu führen, dass der dieser als Zeichen von Liebe
angenommen wird oder einfache Näherungen mit Schmerz verbunden sind. „So
entwickelt es [das Kind] meist einen desorganisierten Bindungsstil, welcher von
Vermeidung sozialer Kontakte und gleichzeitig von der Tendenz der Reinszenierung
geprägt ist“43. Weiterhin ist charakteristisch, dass der Bindungsstil sehr widersprüchlich
ist. Einerseits wünschen sich Betroffene eine Bezugsperson, werden aber ständig von
ihren unsicheren, ängstlichen Empfindungen eingeholt. Durch die in der Literatur
beschrieben als „erfolgslose Suche“ kommt es zu einem vermehrten Rückzug.
Von einer Störung wird dann gesprochen, wenn ein abweichendes Bindungsverhalten
länger als ein halbes Jahr besteht. Solches abweichendes Verhalten kann sich in vier
Richtungen zeigen. Das Kind ohne Bindungsverhalten zeigt keine Reaktionen bei
Bindungsbrüchen. Bei einem übermäßigem Bindungsverhalten zeigt sich eine
Abhängigkeit mit starker Panik bei Verlust. Der Unfall-Risiko-Typ gefährdet sich häufig
selbst, um Zuwendung zu erhalten. Innerhalb der Parentifizierung übernehmen die
42 vgl. Molina 2018, S. 34ff.
43 ebd., S. 36
14Kinder meist die Rolle der Elternteile und verzichten auf eigene Bedürfnisse. Dieser Typ
ist auch viel bei Kindern nach sexueller Gewalt zu verzeichnen.44
2) Affekt- und Impulsregulationsstörungen
Diese Störung geht mit einem Kontrollverlust über wahrgenommene Gefühle einher.
Schon geringe Triggerpunkte können zu starker Stimmungsschwankung und
Anspannungsgefühlen führen. Die Person kann sich selbst also nur schwer emotional
von gewissen Zuständen distanzieren, die Reaktionen sind impulsgesteuert. Aggressive
Durchbrüche, Selbstverletzung oder schädigender Konsum von beispielsweise Drogen
oder Alkohol sind hier zu verzeichnen.
Ursächlich für diese Störung ist ein unsicheres Bindungsgefüge durch die erste
Bindungsperson innerhalb der Kindheit. Sexueller Missbrauch in der Familie, oder
weitläufiger, durch diese erste Bezugsperson, lässt sich damit demnach verknüpfen.
Neurologische Entwicklungen, die für die Emotionsregulation verantwortlich sind,
werden nach dem Trauma verhindert. Symptome sind zusätzlich eine gestörte
Empathiefähigkeit, eine fehlende Persönlichkeitsintegration und Selbstwertregulation. 45
3) Dissoziative Störungen
Dissoziationen können Teil einer integrierten KPTBS sein, in schwerer Form aber auch
als isolierte Traumafolgestörung auftreten. Näheres wurde im nächsten Punkt
beschrieben.46
4) Selbstbildstörungen
Komplex traumatisierte tendieren dazu, sich selbst konstant als minderwertig und
wertlos zu betrachten. Außerdem werden vermehrt Schuldgefühle, vor allem in Bezug
auf die traumatische Situation, wahrgenommen. Betroffene sind der Meinung, selbst
Schuld an dem Ereignis zu sein und es nicht anders verdient zu haben. In dem
Zusammenhang wird auch ein erhöhtes Schamgefühl empfunden.
5) Somatisierung
Die Somatisierung erfasst, dass bei Traumabetroffenen auch körperliche Schmerzen
auftreten, für die es jedoch keine organische Ursache gibt. Dabei sind z.B. chronische
44 vgl. Molina 2018, S. 36ff.
45 ebd., S. 42ff.
46 ebd., S. 44
15Erkrankungen, Erkrankungen im Verdauungssystem, Schwindel oder Herz- und
Lungenbeschwerden am ehesten verbreitet.
6) Veränderung der Lebenseinstellung
Hierbei verlieren jene Personengruppen ihre Werte und Überzeugungen, die vorher für
sie einen Sinn und eine Bedeutung für ihr Leben gegeben haben. Hoffnungslosigkeit
und Bedeutungslosigkeit dem Leben gegenüber sind bekannte Empfindungen
Der Unterschied zur BPS liegt besonders auf der Beziehungsgestaltung. Borderline
Patienten zeigen den „Ich hasse dich, verlass‘ mich nicht“ – Typus stark ausgeprägt.
Sowohl Nähe als auch Distanz werden emotional nicht ausgehalten.
Kriterien für die KPTBS, wie die Somatisierung oder die veränderte Lebenseinstellung,
sind bei der BPS eher nicht aufzufinden. Dafür ist das chronische Gefühl der Leere
ausschlaggebendes Kriterium im ICD-10 für die BPS.47
Dissoziative Störungen
„Sowohl die ICD-10 als auch das DSM-5 verstehen unter Dissoziation einen
psychophysiologischen Prozess, dessen wesentlichstes Charakteristikum in einer
Desintegration der normalerweise integrativen Funktionen des Bewusstseins, des
Gedächtnisses, der Identität, der Wahrnehmung der Umwelt sowie der Sensorik,
Sensibilität und Motorik besteht“48. Es kommt also zu einer Abspaltung bestimmter
Prozesse und Wahrnehmungen.
Neben einer alltäglichen, nicht-pathologischen Ausprägung, findet sich die Dissoziation
als Reaktion auf traumatischen, teilweise lebensbedrohlichen, Stress wieder. Die
Neigung zu dissoziieren wird hauptsächlich im frühen Kindesalter erlernt und bildet
damit für Kinder eine Schutzreaktion vor einer großen Gefahr oder Überforderung,
beispielsweise gegenüber Gewalt von Erwachsenen49.
Zu unterscheiden sind generell dissoziative Symptome und Störungen, wobei sich in
diesem Abschnitt nur auf die Störungen bezogen wird.
47 vgl. Maercker 2019, S. 54f.
48 Priebe u.a. 2013, S. 10
49 vgl. Firus 2018, S. 44f.
16Dissoziative Störungen können verschieden eingeteilt werden. Grundlegend lassen sie
sich jedoch in 2 Kategorien einordnen – die Bewusstseinsstörungen und
Konversionsstörungen50.
Bewusstseinsstörungen beziehen sich auf die psychische Ebene und gehen mit einer
Abspaltung von bspw. Zeiträumen erlebter Traumata, Orten, der eigenen Person oder
sogar Persönlichkeitsanteilen einher. Die Abspaltung von Persönlichkeiten ist hierbei
die schwerste Form der Dissoziation und wird als Dissoziative Identitätsstörung (DIS),
vorher bekannt als Multiple Persönlichkeitsstörung, bezeichnet. Diese Form begleitet
0,5 – 1% der Allgemeinbevölkerung51 und geht auf schwerste Traumata in der Kindheit
bis maximal zum 5. Lebensjahr zurück. Hier werden nochmal zwei Formen
unterschieden – teilweise gespalten, innerhalb dessen ein Alltags-Ich noch gehalten
werden kann, und das Vollbild, wo ein Alltags-Ich nicht erst gebildet werden konnte.
Charakteristisch für die DIS ist, dass Teilbereiche der Persönlichkeit nicht
zusammenwachsen. So können sich Identitäten bilden, die traumanahe Zustände
verkörpern, Fantasieprodukte sind oder bewusst von außen eingeredet werden (siehe
„organisierter und ritueller Missbrauch“). Die unterschiedlichen Persönlichkeitsanteile
sind ohne therapeutische Hilfe meist füreinander amnestisch, nehmen sich also nicht
wahr. Das kann sich dadurch äußern, dass eine „Vergesslichkeit“ besteht, Zeiträume
oder Tätigkeiten einfach vergessen und nicht wahrgenommen werden.52
Die zweite Kategorie der Dissoziativen Konversionsstörungen bezieht sich auf die
körperliche Ebene. Hier sind Bewegungsstörungen, Krampfanfälle und
Empfindungsstörungen untergebracht. Diese Dissoziationen verkörpern beispielsweise
Lähmungen, Seh- oder Hörstörungen oder „epileptische Anfälle“.53
50 vgl. Heedt 2017, S. 107
51 vgl. Firus 2018, S. 44
52 vgl. Huber 2020, ab Minute 2:35 (Internetquelle)
53 vgl. Heedt 2017, S. 111
17Präventive Maßnahmen
Unter Prävention wird ganz simpel die Vorbeugung möglicher Gefahren verstanden.
Unterschieden werden sowohl Opfer- und Täter*innenprävention als auch die primäre,
sekundäre und tertiäre Prävention.
Unter der Primärprävention werden alle Maßnahmen eingegliedert, die der sexuellen
Gewalt vorbeugen sollen. Ziel ist es, sie so früh wie möglich und langfristig einzusetzen,
damit Kinder Fähigkeiten zum Umgang entwickeln können. Präventive Möglichkeiten
sind hier vorrangig die Aufklärung von Kindern, aber auch Erziehungsberechtigten und
Personal. Schutzkonzepte von Einrichtungen, gesellschaftliche Sensibilisierung oder
Präventionsprogramme in der direkten Arbeit mit möglichen Betroffenen zählen auch
darunter.
Innerhalb der sekundären Prävention werden Maßnahmen getroffen, die schon
bestehende sexuelle Gewalt beenden können. Eine Sensibilisierung auf Symptomatiken
findet statt und die Förderung, möglichst frühzeitig einzugreifen.
Der tertiäre Bereich beschäftigt sich mit der Aufarbeitung geschehener Gewalttaten.
Betroffene sollen vor erneuten Übergriffen geschützt werden und z.B. therapeutische
Hilfen erhalten.54
In dem präventiven System wird darauf hingewiesen, dass „Prävention nach den
Adressaten unterteilt werden“55 sollte. Angefangen bei potentiellen Opfern, bei denen
die Förderung des Selbstschutzes an oberster Stelle steht. Potentielle Täter sollten im
Umgang mit Kindern unterstützt werden, Mitarbeiter pädagogischer Einrichtungen
sollten Verhaltensrichtlinien erhalten und die Aufklärung von Missbrauchstaten sollen
auch mit Bezugspersonen oder weiteren Einrichtungen erfolgen. Es wird deutlich, dass
eine Mehrdimensionalität der Prävention vorliegt, also das Gebiet weitläufiger zu
beachten ist und mit mehreren Menschen- und Berufsgruppen zusammengearbeitet
werden muss.
Schaut man allerdings in die Forschung, machen Jud und Kindler im Rahmen einer
Übersicht zum deutschlandweiten Forschungsstand deutlich, dass noch viel Arbeit
betrieben werden muss. Stand Dezember 2019 liegen nur drei Studien vor, die eine
Veränderung von sexuellen Übergriffen durch präventive Maßnahmen und die
Hilfesuche nach der Tat darstellen.56 Vor allem fehlen Daten zu Schutzkonzepten. Zum
54 vgl. Bayrischer Jugendring 2004, S. 6ff.
55 vgl. Chodan / Reis / Hässler in Trauma & Gewalt 2015, S. 97
56 vgl. Jud / Kindler 2019, S. 18
18Beispiel, inwieweit ein tatsächlicher Rückgang von Übergriffen zu verzeichnen ist,
spezieller unter welchen Umständen.57 Gestützt wird sich innerhalb
Präventionsmaßnahmen also vorrangig auf vorangegangenes Wissen, welches die
Grundlage bilden soll. Jedoch nicht auf empirische Befunde zu wirksamer Prävention
vor sexuellem Kindesmissbrauch.
Im Zusammenhang gibt es dennoch zahlreiche Programme und Konzepte, um das
Kindeswohl zu schützen, sowohl auf Opfer als auch auf Täter*innen bezogen.
Fortführend werden ausgewählte, großflächigere Maßnahmen vorgestellt, wobei die
Konzentration auf der Opferprävention liegt.
Gesamtkonzept des Bundesfamilienministeriums
Um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen, hat das
Bundesfamilienministerium im September 2014 ein Gesamtkonzept errichtet. Dieses
sollte Veränderungen in fünf Bereichen erwirken. Es wurde sich auf Empfehlungen des
Runden Tisches „Sexueller Missbrauch“ und den Aktionsplan 2011 zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeutung berufen.58
1) Strafrecht und Strafverfolgung
Hier gab es im November 2016 schon Veränderungen.
- Verlängerung der Verjährungsfrist
- Klarstellung von Strafbarkeitslücken
- Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten gegen Kinderpornografie
2) Schutz und Begleitung im Strafverfahren
Der Anspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung wurde 2017 beschlossen, womit
eine Belastbarkeit der jungen Betroffenen verringert werden kann. Zusätzlich ist eine
engere Zusammenarbeit von Jugendämtern und Ermittlungsbehörden angedacht
worden.
57 vgl. Jud/Kindler 2019, S. 19
58 vgl. BMFSFJ 2018 (Internetquelle)
193) Recht auf Schutz vor sexualisierter Gewalt
Durch einen Anspruch auf Beratung von Kindern und Jugendlichen, auch ohne
elterliche Zustimmung / Einweihung, sollen Kinderrechte gestärkt werden. Auch
Schutzkonzepte und Initiativen sollen ausgebaut und integriert werden.
4) Beratung, Hilfen und Therapie für Betroffene
Um eine kompetente Beratung zu gewährleisten, wurde 2017 die Bundeskoordinierung
Spezialisierter Fachberatung (BKSF) als politische Vertretung und Informations- und
Servicestelle eingeführt.
Zusätzlich sollten das Hilfesystem und die Zugänge dazu optimiert werden. Dies gilt für
Opfer, sowie für Täter.
5) Schutz in den digitalen Medien
Das Netzwerk „Keine Grauzonen im Internet“ kümmert sich um die Bekämpfung von
sexueller Ausbeutung und schaut auf Grauzonen. In Kooperation mit jugendschutz.net
werden auch Gegenstrategien entwickelt und weiteres Wissen zur Optimierung
angesammelt.
Täter*innenprävention am Beispiel „Kein Täter werden“
„Kein Täter werden“ ist ein deutschlandweites Behandlungsangebot für Menschen, die
sich sexuell zu Kindern angezogen fühlen, also von Pädophilie oder Hebephilie
betroffen sind. So soll verhindert werden, dass direkte oder indirekte sexuelle Übergriffe
entstehen.
Pädophilie und Hebephilie bilden sexuelle Präferenzstörungen und zeigen sich in der
„sexuellen Ansprechbarkeit auf Kinder, die sich in der körperlichen Entwicklung vor
Einsetzen der Pubertät (Tanner-Stadium I) bzw. in einem frühen Stadium der Pubertät
(Tanner-Stadien II und III) befinden“59. Dabei bezieht sich die Pädophilie auf das
Tanner-Stadium I, die Hebephilie auf die Tanner-Stadien II und III60.
59 vgl. Beier 2018, S. 2
20Abbildung 3: Schneider / Jacobi / Thyen 2020 nach James M. Tanner
Die benannten Tanner-Stadien, die in Abbildung 3 dargestellt sind, wurden 1969 von
einem englischen Arzt beschrieben und benennen die sichtbare körperliche Entwicklung
in der Pubertät bei Jungen und Mädchen.61
Eine Diagnose für solche Störungen kann schon ab dem 16. Lebensjahr erfolgen. Die
Kriterien werden allerdings nur erfüllt, wenn zusätzlich die betroffene Person
mindestens 5 Jahre älter als das jeweilige Kind beziehungsweise die jeweiligen Kinder
sind.
Jene Formen sind zusätzlich nochmal in exklusive und nicht-exklusive
Ansprechbarkeiten zu unterscheiden. Zu der exklusiven Kategorie gehören die „reinen“
Formen und weiterhin die Pädo-Hebephilie, also die Präferenz zu allen drei Stadien. Die
nicht-exklusive Kategorie beinhaltet Mischformen der Pädo-Teleiophilie, Hebe-
Teleiophilie und Pädo-Hebe-Teleiophilie. Die Präferenz liegt dann auch innerhalb
erwachsenen Körperschemata (Teleiophilie).62
Wie eine derartige Störung entsteht, ist noch nicht sehr deutlich. Teilweise wird aber
von einem bio-psycho-sozialen Konstrukt ausgegangen, die Genetik kann also auch
eine Rolle spielen.
61 vgl. Schneider / Jacobi / Thyen 2020, S. 74f.
62 vgl. Beier 2018, S. 3ff.
21Vorrangig sind Männer von der Störung betroffen, in Deutschland ca. 250.000. Von der
Gesellschaft wird der Kindesmissbrauch und die Pädophilie/Hebephilie gleichgesetzt.
Dennoch ist zu erwähnen, dass nicht alle Betroffenen strafrechtlich tätig werden.
50-60% der Täter*innen von sexueller Gewalt an Kindern zeigt keine dahingehende
Präferenz. Allerdings ist das Risiko, zum Täter oder zur Täterin zu werden definitiv
höher, wenn eine Neigung besteht. Häufig ist eine letztendliche Ausübung aber mit
mehreren Faktoren verknüpft, wie z.B. Persönlichkeitsmerkmalen oder Stressoren. 63
Das Projekt existiert seit 2005 und pflegte seinen ersten Standort in Berlin. Mittlerweile
gibt es mehrere Standorte mit dem Ziel weitere zu etablieren und ein flächendeckendes
Angebot herzustellen. Mithilfe einer Therapie sollen Betroffene Unterstützung erhalten,
mit der Neigung umzugehen und sie in ihre Person zu integrieren. Der Rahmen beläuft
sich unter der Schweigepflicht und ist kostenlos.
Generelle Kriterien, um an diesem Programm teilnehmen zu können, sind ein
Mindestalter von 16 Jahren und die freiwillige Aufsuche. Voraussetzungen sind dabei,
offen und ehrlich mitzuarbeiten und der Wille, keine Straftaten (mehr) zu begehen.
Inwieweit Betroffene schon einmal strafrechtliche relevante Handlungen begangen
haben, spielt keine Rolle in der Zusammenarbeit.
Die ambulante Therapie, die wöchentlich innerhalb von verschiedenen
Zusammensetzungen stattfindet, streckt sich über einen Zeitraum von ein bis zwei
Jahren. „Sie integriert psychotherapeutische, sexualwissenschaftliche, medizinische
und psychologische Ansätze sowie die Möglichkeit einer zusätzlichen medikamentösen
Unterstützung“64. Die Sexualpräferenz soll keinesfalls negiert oder verdrängt werden.
Es wird daran gearbeitet, die Neigung für sich zu akzeptieren und Strategien zu
entwickeln jener nicht „nachzugeben“.65
„Der wichtigste Teil der Therapie war für mich, zwischen Fantasien und der Verantwortung für
mein sexuelles Verhalten zu trennen. Ich kann es nicht verhindern, dass mich Kinder erregen,
aber was ich tun kann, ist keinerlei sexuellen Kontakt mit Kindern zu haben.“
Jan, 29, Medienmanager66
63 vgl. Y-Kollektiv 2018, ab Minute 13:30 (Internetquelle)
64 vgl. Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“ (Internetquelle)
65 ebd.
66 ebd.
22„Trau dich!“ – Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Bei „Trau dich!“ handelt es sich um eine Initiative in Verbindung mit dem
Gesamtkonzept des Bundesfamilienministeriums. Zentrales Ziel ist auch hier, Kinder im
Allgemeinen vor sexualisierter Gewalt zu schützen und die Gesellschaft darauf
aufmerksam zu machen. Dabei sollen Kinder im Alter von 8 – 12 Jahren aufgeklärt und
motiviert werden, sich nicht zu verstecken. Die Initiative spricht auch Eltern und
Fachkräfte an, die ebenfalls aufgeklärt und für eventuelle Interventionen sensibilisiert
werden sollen. Vor allem mit Schulen wird kooperiert, da dort die Zielgruppe verankert
ist.
Die Initiative wird von Fachkräften mehrerer Bereiche unterstützt und begleitet. So
wurden drei Bausteine konzipiert, die alle Zielgruppen wirksam erreichen sollen. 67
1) Interaktives Theaterstück und begleitende Aktionen
Das Theaterstück „Trau dich! Ein starkes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen“
setzt sich mit den Themen der eigenen Grenzen, wie diese klargemacht werden können
und dem Anvertrauen von Gewalt gegenüber anderer Personen auseinander. In
Verbindung mit der Theaterkompanie Kopfstand, welche sich auf Kinder- und
Jugendtheater spezialisiert haben, werden Kinder der Zielgruppe also aktiv mit
eingebunden und dazu motiviert ihre Gefühle und Grenzen ernst zu nehmen und sich
für sich einzusetzen. Es werden die Geschichten von Paula, Vladimir, Alina und Luca
erzählt, die im gleichen Alter sind und solch negative Erfahrungen erleben mussten /
müssen. Mithilfe von Musik, Bildern, Videos und Erzählungen soll das Stück
Identifikation und Botschaften vermitteln, die berühren und anstoßen sollen. Mitten im
Stück wird das Publikum befragt, wie sich Hilfe geholt werden kann oder welche
Gefühle das Kind der Geschichte wohl gerade durchlebt. Am Ende können die
Mädchen und Jungen nochmal Fragen stellen oder in ein persönliches Gespräch mit
den Darsteller*innen gehen.
Da alles rund um das Theaterstück gemeinsam mit den Partnern geplant wird, können
auch individuelle Anpassungen stattfinden. So werden Geschichten und Erfahrungen
mit den jeweiligen Kindern erarbeitet, die dann die Grundlage für die Aufführung bilden.
Neben der Aufführung gibt es allerdings noch weitere Materialien, Angebote und
Fortbildungen für Schulen und Eltern. Die Nachbereitung wird als sehr wichtig
67 vgl. Trau dich! Informationsbroschüre vom BZgA
23angesehen, damit erfahrene Informationen oder auch Gefühle verarbeitet und Grenzen
gewahrt und weiterhin bewusst gemacht werden können. Übungen können spielerisch
durchgeführt werden, um Inhalte zu vertiefen. So werden Spiele in verschiedene
Themenbereiche unterteilt:
a. Nähe und Distanz
Beispiel: Engelchen und Teufelchen.
Jedes Kind sucht sich zwei Personen aus, ein Engelchen und ein Teufelchen. Nach
einem Klatschen sollen sie, durch Bewegung im Raum, ihrem Engelchen möglichst
nahe kommen und ihrem Teufelchen möglichst fern sein. Nach einem weiteren
Klatschen sollen alle stehen bleiben und es wird geschaut, wer die Aufgabe
geschafft hat. Die Schwierigkeiten, die dabei entstanden sind, sollen die Kinder dann
deutlich machen.
b. Verschiedene Gefühle sammeln
Beispiel: Gefühle sammeln
Hier arbeiten die Kinder zu zweit. Innerhalb von ein paar Minuten sollen sie so viele
Gefühle aufschreiben, wie ihnen einfallen. Diese sollen sie dann von negativ zu
positiv ordnen.
c. Nahe und distanzierte Beziehungen im nahen Umfeld erkennen
Beispiel: Beziehungscluster
Das ist eine Übung, die jeder Junge und jedes Mädchen für sich allein durchführt.
Auf einem großen Blatt Papier schreiben die Kinder vorerst ihren Namen in die Mitte
und umkreisen ihn. Nun schreiben sie Personen aus ihrem Umkreis auf das Blatt. Je
nach Beziehung und Nähe zu ihnen, sollen sie zu ihrem Namen mehr oder weniger
Abstand halten. So entsteht ein individueller sozialer Raum. Die Vertrauensperson
kann dann noch markiert werden.
d. Gute und schlechte Geheimnisse
Beispiel: Streng geheim!
Hier wird Vorbereitung der durchführenden Person benötigt. Es wird ein Brief
geschrieben, der kindergerecht mitteilt, dass gute Geheimnisse bewahrt werden
können und schlechte Geheimnisse erzählt werden sollten. Der Brief kommt dann in
24Sie können auch lesen