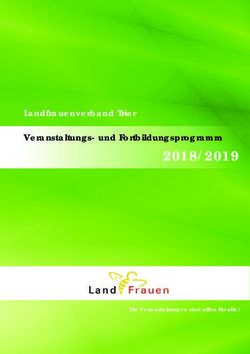UNIVERSITÄT, HOCHSCHULE UND BUNDESANSTALT KOOPERIEREN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
UNIVERSITÄT, HOCHSCHULE UND BUNDESANSTALT KOOPERIEREN Die Universität Koblenz-Landau, die Hochschule Koblenz und die Bunde- sanstalt für Gewässerkunde wollen noch enger im Bereich Wasser zusamme- narbeiten. Dazu schlossen die drei Einrichtungen nun ein Kooperations- abkommen. In dem Kooperationsabkommen vereinbaren die drei Institutionen eine en- gere Zusammenarbeit auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten. Mit dem Abkommen sollen unter anderem der freie Austausch von Erkenntnis- sen sowie Daten gefördert und gemeinsame wissenschaftliche Projekte un- terstützt werden. Studierende und Mitarbeitende der drei Einrichtungen profitieren unmittelbar: So wollen die drei Einrichtungen zukünftig vermehrt gemeinsame Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten ermöglichen und den Zugang zu den jeweiligen Bibliotheken vereinfachen. Die Kooper- ationsvereinbarung beinhaltet zudem die gegenseitige Nutzung von Groß- und Laborgeräten. Herzstück der Kooperation sind Vereinbarungen, die Lehrangebote für ge- meinsame Studiengänge ermöglichen. Die Planungen für einen von der Uni- versität in Koblenz, Hochschule Koblenz und der Bundesanstalt für Gewässerkunde getragenen Bachelor- sowie Master-Studiengang sind bere- its weit fortgeschritten. Der Studiengang „Gewässerkunde und Wasser- wirtschaft“ soll voraussichtlich im Wintersemester 2023/2024 starten.
Der Studiengang beinhaltet aktuelle Themen: Der Klimawandel, der Ein- trag von Spurenstoffen in Gewässer, eine alternde Wasserverkehrs-In- frastruktur und veränderte gesellschaftliche Ansprüche stellen die Gewässer-Ökosysteme überall und die Wasserstraßen vor große Heraus- forderungen. Zur Bewältigung und Lösung der drängenden Aufgaben wird eine neue Generation interdisziplinär ausgebildeter Wasser-Expert/-in- nen benötigt. Der Koblenzer Wasserstudiengang ist durch die Beteili- gung der Bundesanstalt für Gewässerkunde, einer Ressortforschungsein- richtung des Bundes, etwas Besonderes und kombiniert die Wasser-Exper- tise der drei beteiligten Einrichtungen. „Der neue Studiengang erweitert das attraktive Studien-Angebot der Uni- versität in Koblenz um ein innovatives, zukunftsweisendes Fach mit exzellenten beruflichen Perspektiven. Unsere Kooperation stellt eine Bereicherung für die im Bereich Wasser Forschenden, die Studierenden sowie Absolventen der Gewässerkunde und Wasserwirtschaft dar. Darüber hinaus bilden wir Fachkräfte aus, die dem Klimawandel entgegenwirken können“, betont Prof. Dr. Stefan Wehner, Vizepräsident für Koblenz der Universität Koblenz-Landau. „Die Kooperation ist eine großartige Möglichkeit, den Wissenschaftss- tandort Koblenz im Bereich der Hydrologie, der Gewässerkunde und Wasserwirtschaft zu positionieren und die fachliche Expertise der drei Einrichtungen zu bündeln“, erklärt der scheidende Präsident der Hoch- schule Koblenz, Prof. Dr. Kristian Bosselmann-Cyran. „Wir engagieren uns seit Jahren mit zwei Professuren in der Lehre der Universität Koblenz-Landau und haben ausgezeichnete Erfahrungen mit in unserem Haus betreuten Absolventen gesammelt. Durch die Kooperation bauen wir zudem unsere Beratungskompetenz rund um die Bundeswassers- traßen weiter aus. Der geplante Studiengang ist eine große Chance für uns, hervorragend ausgebildete Fachkräfte zu gewinnen“, sagt die Leit- erin der BfG, Direktorin und Professorin Dr. Birgit Esser. Quelle: BfG, Foto: Michael Hils/ BfG, v.l.r.: Prof. Dr. Kristian Bos- selmannCyran, Professorin Dr. Birgit Esser und Prof. Dr. Stefan Wehner nach der Unterzeichnung des Kooperationsabkommens.
VIRTUELL DIE GANZE WELT BEFAHREN Die Niederlande sind führend in der maritimen Technologie. Im Rotter- damer Hafen sind viele Unternehmen in diesem Bereich tätig. Eines von ihnen ist VSTEP Simulation, Entwickler von Simulatoren und Software für maritime Trainingszwecke. Der Hafenbetrieb Rotterdam nutzt diese Lösungen, um Befehlshaber auf RPA-Schiffen zu schulen. Als ehemaliger Entwickler von Schiffssimulationsspielen begann VSTEP, 2011 Simulatoren zu bauen. Zunächst nur für die Seeschifffahrt, später aber auch für die Binnenschifffahrt. Die Simulatoren werden von Reed- ereien, maritimen Trainingszentren und Schulen auf der ganzen Welt eingesetzt. Seit diesem Jahr lässt das „Scheepvaart en Transport Col- lege“ [Schifffahrts- und Transportkolleg] Rotterdam seine Studierenden auch an NAUTIS-Binnenschifffahrtssimulatoren von VSTEP trainieren. Mit diesen Simulatoren können sie virtuell alle Meere und Flüsse der Welt auf einem Schiff befahren, das sich ihren Trainingszielen anschließt. Von einem kleinen Fischerboot bis zu einem 400 Meter langen Container- schiff. Eine schöne Lösung, zum Beispiel auch zum Trainieren von Hafen- lotsen, die Schiffe auch bei schwierigen Wetterbedingungen und dichtem Verkehr sicher in den und aus dem Hafen lotsen müssen. „Das Training am Simulator hat eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem Training an Bord“, sagt Tije Vos, kaufmännischer Direktor bei VSTEP. „Es ist kosteneffizient und sicher. In einem Simulator kann man einen Unfall verursachen, ohne dass Menschen oder Schiffe zu Schaden kommen. Man kann besser auswerten, was schief gelaufen ist und aus deinen Feh- lern lernen. Wir nennen das auch Lernen durch Verwendung eines engi- neered Failure. Das passt zu unserer Vision: enabling learning by Simu- lation. Mit unseren Simulatoren ermöglichen wir unseren Kunden, ihre Trainingsziele zu erreichen. Unsere erste Frage ist denn auch immer: Was möchten Sie trainieren?“ Gemeinsam mit Sicherheitsexperten hat VSTEP eine spezielle virtuelle Umgebung für Sicherheitstrainings entwickelt: den Response Simulator. Unter anderem die Gemeinsame Feuerwehr in Rotterdam nutzt es zum Trainieren und zur Prüfung von Einsatzleitern. Vos: „Ein Einsatzleiter muss in der Lage sein, in kritischen Situationen schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir visualisieren die Ergebnisse dieser
Entscheidungen, damit Befehlshaber schneller lernen können.“ Der Hafen- betrieb Rotterdam nutzte den Response Simulator der gemeinsamen Feuer- wehr seit mehreren Jahren, um die Befehlshaber an Bord der RPA-- Fahrzeuge zu trainieren. Anfang 2021 hat der Hafenbetrieb diese Soft- ware selbst gekauft. Vos: „Sie können darin ihre eigenen Szenarien er- stellen. Man denke an ein brennendes Tankschiff. Wie muss man diese Si- tuation antizipieren? Alle Trainings werden zur Auswertung aufgezeich- net.“ „Als Rotterdamer Unternehmen sind wir stolz darauf, den Hafenbetrieb als Kunden zu haben. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Zusammenar- beit weiterentwickeln wird. Innerhalb des Hafenbetriebs haben wir ei- nen festen Ansprechpartner für Virtualisierung und Simulation. Das funktioniert sehr gut.“ Obwohl VSTEP noch jung und relativ klein ist, kann es mit einer Reihe von großen Anbietern auf dem Markt mithalten. „Wir arbeiten hart und machen professionelle Schritte mit den Produk- ten, die wir anbieten. Wir haben mittlerweile weltweit mehr als 400 Si- mulatoren für die Seeschifffahrt verkauft. In den Niederlanden nutzen alle Binnenschifffahrtsschulen unsere Binnenschifffahrtssimulatoren und wir sind vollauf im Gespräch mit Binnenschifffahrtsschulen in ganz Europa.“ Seit 2018 arbeitet VSTEP mit dem Rotterdamer Start-up Captain AI zusam- men, das Software für autonomes Fahren entwickelt. „Wir stellen unsere NAUTIS-Software zur Verfügung, um ihre Algorithmen zu trainieren“, erk- lärt Vos. „Unsere Software kann alle möglichen Wetterszenarien in kürzester Zeit simulieren und sie den Computern für das autonome Segeln vorlegen. So können sie schneller lernen. Mit der Zeit wird das autonome Fahren die maritime Industrie enorm effizient machen. VSTEP und Captain AI können sich in dieser Hinsicht gegenseitig verstärken. Jedes Jahr erhalten wir viele Anfragen zur Zusammenarbeit von ähn- lichen Start-ups, aber wir entscheiden uns für unsere Nachbarn in Rot- terdam. Wir arbeiten auch mit vielen anderen kleineren und größeren niederländischen Unternehmen zusammen. Damit sind die Niederlande führend in der maritimen Technologie.“ Die Coronapandemie hat den maritimen Sektor hart getroffen. Trainings wurden monatelang eingestellt, und die Flottenbesitzer hatten Sch- wierigkeiten, ihr Personal zu halten. Vos: „Wir sind auch von 70 auf 50 Mitarbeiter zurückgegangen, aber wir sind schon wieder bei 60. Die Aussichten sind gut: 2022 werden wieder viele Messen stattfinden und
wir werden auch wieder ins Ausland gehen dürfen. Es gibt also alle Hände voll zu tun!“ Laut Vos ist es dabei eine Herausforderung, freie Stellen zu besetzen. Was die Techniker angeht, so fischen viele Un- ternehmen in einem kleinen Teich. „Für Engineeringaufgaben suchen wir technisch ausgebildete Akademiker mit hydrodynamischen Kenntnissen. Wir haben auch allgemeine Positionen. Unser Charme ist, dass wir ein kleines Familienunternehmen mit großartigen Kunden und klugen, straf- fen Produkten sind. Wir sind vor kurzem von der Weena in den ehemali- gen Obstschuppen von Total Produce am Marconiplein gezogen. In diesem Gebäude, das dem Hafenbetrieb gehört, können wir Produktion und Büros kombinieren und wir sind dort zusammen mit anderen maritimen Unterneh- men untergebracht. Es ist ein inspirierendes Arbeitsumfeld, in dem wir schnell schalten, Geschäfte machen und neue Ideen aufgreifen können.“ VSTEP hat ein ehrgeiziges Ziel: „Bis 2030 soll ein Drittel des mariti- men Personals der Welt in einem unserer Simulatoren trainieren.“ In diesem Zusammenhang kommt das Unternehmen im Frühjahr 2022 mit einer Lösung für das Training zu Hause oder an Bord. „Ein Simulator ist die Endstation für Trainings. Das erfordert eine große Investition. Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, müssen wir zugänglicher werden und auch Home Training mit der gleichen hohen Qualität wie im Simulator an- bieten. Ein herausfordernder Weg, aber wir werden uns weiterentwick- eln, um den maritimen Sektor in Zukunft noch tatkräftiger zu machen!“ Quelle und Video: Port of Rotterdam WISSING SCHNÜRT PAKET FÜR BRÜCKENMODERNISIERUNG
Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, hat ein „Zukunftspaket leistungsfähige Autobahnbrücken“ vorgelegt. Als erfol- greiche Wirtschaftsnation im Herzen Europas benötige Deutschland eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur. Diese zu schaffen und zu er- halten, sei eine Generationenaufgabe, so der Minister. Mobilität sei ein gesellschaftliches Grundbedürfnis, sie stünde für Teilhabe, Chan- cen und Wohlstand. Sie zu erhalten müsse daher ein vordringliches An- liegen der Politik sein. Beim ersten Brückengipfel im Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hatte sich Wissing zunächst vier Stunden lang mit Ex- pertinnen und Experten aus Bauwirtschaft, Verwaltung, Ländern sowie Na- tur- und Umweltschutzverbänden ausgetauscht. Außerdem wurden bei der hybriden Veranstaltung die Ergebnisse der ersten umfassenden Brückenbi- lanz vorgestellt, die Wissing beauftragt hatte, um auf Basis dieser generellen Bestandsaufnahme konkrete Schritte und Maßnahmen zusammenzu- fassen. Bundesminister Dr. Volker Wissing: „Unser Land ist auf eine leistungs- fähige Infrastruktur angewiesen. Moderne Brücken sind ein ganz wesentlicher Teil davon. Der Zustand, in dem ich die Infrastruktur bei Amtsübernahme vorgefunden habe, ist nicht zufriedenstellend. Wir wollen nach vorne schauen und zielgerichtet effektive Maßnahmen ein- leiten und diese zügig und bürgerfreundlich umsetzen, damit unsere Verkehrsinfrastruktur modern und zukunftssicher bleibt. Unsere Maßnah-
men für leistungsfähige Autobahnbrücken zeigen einen Weg auf, wie wir dieser Zukunftsaufgabe gerecht werden können. Wir setzen neue Prior- itäten, um die Modernisierung der Brücken strategisch und in der sinn- vollsten Reihenfolge anzugehen. Wir erhöhen finanzielle Mittel und starten frühzeitig den Dialog mit allen Beteiligten. Wir beschleuni- gen, digitalisieren und vereinfachen Planungen, Verfahren und Abstim- mungen. All diese wichtigen Bausteine haben am Ende ein klares Ziel: Wir wollen die Brückenmodernisierung deutlich beschleunigen!“ Minister Wissing stellte das „Zukunftspaket leistungsfähige Autobahn- brücken“ gemeinsam mit Doris Drescher, der Präsidentin des Ferns- traßen-Bundesamtes, Stephan Krenz, dem Vorsitzenden der Geschäfts- führung der Autobahn GmbH des Bundes, sowie Prof. Markus Oeser, dem Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), vor. Sowohl die Brückenbilanz als auch das Zukunftspaket können auf der Homepage des B- MDV heruntergeladen werden. Dort finden Sie auch eine virtuelle Brück- enkarte mit allen wichtigen Daten zu Brücken auf Autobahnen und Bun- desstraßen: www.bmdv.bund.de/brueckengipfel-zukunftspaket www.bmdv.bund.de/brueckengipfel-bilanz Quelle: Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Foto: FDP.de UNSER GRUNDWASSER – DER UNSICHTBARE SCHATZ
Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Düsseldorfer Trinkwasser ist von erstklassiger Qualität und enthält wichtige Mineralien. Täglich nutzt jeder von uns rund 120 Liter. Gleichzeitig sind wir aber auch Teil des globalen Wasserkreislaufs. Alles, was wir herstellen, verteilen und konsumieren, kommt früher oder später mit Wasser in Kon- takt. Und dieses Wasser wird wieder Bestandteil des Grundwassers. Die elementare Bedeutung des Grundwassers als unverzichtbare Ressource und Teil des Wasserkreislaufs und die Belastungen, denen es durch men- schliche Tätigkeiten und zunehmend durch den Klimawandel ausgesetzt ist, sind vielen Menschen nicht präsent und bewusst. Aus diesem Grund und im Hinblick auf den bevorstehenden Wandel rücken die Vereinten Na- tionen die Bedeutung und den Wert unseres kostbaren Grundwassers wied- er stärker ins gesellschaftliche sowie politische Bewusstsein. Deshalb lautet das diesjährige Motto des Weltwassertages am Dienstag, 22. März: „Unser Grundwasser – der unsichtbare Schatz“. Auch die Stadtwerke Düsseldorf nutzen den Weltwassertag, um auf die Be- deutung des Grundwassers aufmerksam zu machen. Und darauf, dass jeder einen Beitrag zu dessen Schutz leisten kann. „Schon die achtlos wegge- worfene Zigarettenkippe oder Medikamenten-Entsorgung in der Toilette sorgen für eine unnötige Belastung des Grundwassers“, so Prof. Dr. Han- s-Peter Rohns, zuständig für die Qualitätsüberwachung des Trinkwassers bei den Stadtwerken Düsseldorf. Wer dazu mehr erfahren möchte, kann am Dienstag, 22. März, von 10 bis
14 Uhr auch im Wasserwerk Flehe, Himmelgeister Straße 325, vor- beischauen. Zum Weltwassertag haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeit- er dort eigens Informationstafeln vorbereitet. Ein Glas frisches Düs- seldorfer Trinkwasser gibt es für Gäste ganz bestimmt auch. Besucherin- nen und Besucher sollten mit dem Fahrrad, ÖPNV oder zu Fuß kommen, da es am Wasserwerk keinerlei Parkmöglichkeiten gibt. Und während es für uns zur Normalität gehört – einfach den Wasserhahn aufzudrehen und das Wasser zu genießen – ist es in anderen Länder im- mer noch undenkbar. Daran wollen die Stadtwerke Düsseldorf am 22. März erinnern und unterstützen deshalb wieder mit einer Spende den Düssel- dorfer Verein „Wasser für Afrika“. Für jeden genutzten Kubikmeter Düs- seldorfer Trinkwasser an diesem Tag spenden die Stadtwerke einen Cent an das Hilfsprojekt. Es setzt sich dafür ein, Menschen in Afrika den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. In diesem Sinne: Wasser- hahn auf und kühles Düsseldorfer Trinkwasser für den guten Zweck ge- nießen. Quelle und Foto: Stadtwerke Düsseldorf AG LANDSTROM AUS DER BATTERIE FÜR DIE BINNENSCHIFFFAHRT An der Maaskade in Rotterdam wartet kostenloser Landstrom auf große Binnenschiffe (CEMT-Klasse V und höher), die sich an einem Testprojekt mit Landstrom aus einem Batteriesystem beteiligen. Im Auftrag des
Hafenbetriebs von Rotterdam hat Skoon Energy dort ein Batteriesystem installiert, um die lokale Landstrom-Versorgung für die Binnenschiff- fahrt zu stärken. Im Zentrum von Rotterdam gilt ein Verbot für stillgelegte Generatoren für die Binnenschifffahrt. Die Binnenschifffahrt kann dort die Land- stromversorgung nutzen. Aber einige Schiffe benötigen mehr Strom, als die Anlagen liefern können. Die Batterie unterstützt die Land- strom-Schränke am Kai, indem sie den im Hafen liegenden Schiffen mehr Strom bereitstellt. Der Versuch dauert bis zum 31. März 2022 und soll zeigen, ob das Batteriesystem zusammen mit dem lokalen Land- strom-Schrank diesen Bedarf decken kann. Seit 2010 stehen an rund 60 Orten im Zentrum von Rotterdam Land- strom-Schränke für die Binnenschifffahrt. Diese Schränke können vier bis sechs Binnenschiffe bis maximal 40 Ampere mit Landstrom versorgen. Einige größere Binnenschiffe (in der CEMT-Klasse V und höher) benöti- gen heutzutage mehr Strom. Um dies ohne drastische Aktionen zu er- möglichen, hat sich der Hafenbetrieb für diese flexible Lösung entschieden. Die Batterie wird zwischen dem bestehenden Landstrom-Schrank und dem Binnenschiff platziert. So kann die Batterie, wenn ein Binnenschiff mehr als 40A benötigt, die zusätzlich erforderliche Leistung bis zu einem Maximum von 63A liefern. Ohne die Batterie dazwischen würde in einem solchen Fall die Sicherung durchbrennen und das Binnenschiff wäre ohne Strom. Zudem können andere Binnenschiffe in der alten Situa- tion diesen Landstrom-Anschluss nicht mehr nutzen, bis er repariert ist. Der Anschluss des Batteriesystems verhindert eine solche Situa- tion und kann auch größere Schiffe mit Landstrom versorgen. Skoon ist eine Online-Vermietungsplattform für die Nutzung mobiler Bat- terien und anderer Formen sauberer mobiler Energie. An einem zugänglichen Marktplatz können Firmen mobile Energiespeicher anbieten oder buchen. Skook bietet eine saubere und finanziell machbare Alterna- tive zum umweltschädlichen Dieselgenerator – dank einer breiten Palette an Energielösungen und intelligenten Analysen. Festivals, Events, Baustellen, Filmsets, Schiffe und viele weitere Anwendungen haben über Skoon einfachen Zugang zu sauberer Energie.
Landstrom ist ein wichtiger Teil der Energiewende. Am Kai liegende Schiffe laufen oft auf Generatoren für die nötige Energie an Bord. Dabei stoßen sie unter anderem Feinstaub, Stickstoff und CO² aus. Mit Landstrom können diese Emissionen reduziert werden, indem Schiffe mit einer sauberen Energiequelle versorgt werden. Quelle und Foto: Port of Rotterdam „FAST-TRACKING“ DES GRÜNEN GAS- TERMINALS IN WILHELMSHAVEN Tree Energy Solutions (TES) beschleunigt seine angekündigten Pläne, den deutschen Hafen Wilhelmshaven zu einem World-Scale-Hub für den Im- port von Grünem Gas zu entwickeln. Die schnelle Umsetzung („Fast-- Tracking“) wird für schnelle alternative Energieversorgung und -sicher- heit für Deutschland und Europa sorgen und gleichzeitig das Wachstum der grünen Gasimporte zeitlich beschleunigen. Mit grünem Wasserstoff als Grundlage ist das grüne Gasterminal Wil- helmshaven nachhaltig, klimaneutral und erlaubt die schnelle Deckung des kurz- und langfristigen Energiebedarfs der Bundesrepublik in nach- haltiger Weise. Das 2019 initiierte Wilhelmshaven-Projekt von TES soll noch schneller eine bedeutende Rolle bei der Energieversorgung Deutschlands und einen nachhaltigen Beitrag zur europäischen Energiestrategie spielen und
gleichzeitig das Wirtschaftswachstum der regionalen Wirtschaft stärken. TES bestätigt, dass eine Beschleunigung des Projekts in vollem Eink- lang mit den strategischen Prioritäten Nachhaltigkeit und Diversi- fizierung der Energieversorgung stehen und diese unterstützen wird, in- dem zusätzlich die Abwicklung von Gasimporten neben den geplanten Im- porten von grünem Gas in der Frühphase berücksichtigt wird. TES ist sich sicher, dass dieses Vorhaben die Möglichkeiten, die deutschen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, beschleunigen wird und keine In- vestitionen in später nicht mehr benötigte Anlagen erforderlich sind. „Wir planen nun weitere Arbeiten, um einen operativen Start der Phase 1 bis Winter 2025 in großem Maßstab sicherzustellen. Angesichts unseres geplanten Umfangs (wir planen 6 unabhängige Tanks in Kombina- tion mit 6 Schiffsliegeplätzen unter Verwendung eines neuartigen An- satzes mit minimalen ökologischen und visuellen Auswirkungen) sind wir auch bereit, alle alternativen Gasimporteure konstruktiv einzubinden und den Zugang Dritter im Einklang mit den aktuellen Vorschriften und Praktiken der EU DG Energie sicherzustellen. TES begrüßt die Teilnahme anderer Unternehmen an dem Vorhaben- unter der Bedingung, dass diese das Projekt beschleunigen und die eindeutige langfristige Absichten und Selbstverpflichtung zu sauberer und grüner Energie, die für die TES-Unternehmensphilosophie von zentraler Bedeutung sind, nicht gefähr- den. TES ist auch der Ansicht, dass die Bewältigung der aktuellen Krise so erfolgen sollte, dass langfristige Klimaziele nicht gefährdet werden oder beeinträchtigt werden müssen. Das TES-Wilhelmshaven-Pro- jekt ist ein einzigartiges Projekt, das genau das leisten kann.“ sagt Paul van Poecke, Gründer und Geschäftsführer von TES. Paul van Poecke fährt fort: „Das Projekt TES-Wilhelmshaven ist einzi- gartig in seiner Fähigkeit, die Pläne Deutschlands und Europas zur nachhaltigen Dekarbonisierung im industriellen Maßstab zu verwirk- lichen und gleichzeitig die aktuelle Energiekrise maßgeblich und um- sichtig zu bewältigen. Wir wollen die Energiewende mutig vorantreiben mit dem Ziel, die Energieversorgung Deutschlands CO2-neutral zu gestal- ten. Erreicht wird dies durch die Entwicklung Wilhelmshavens als grün- er Energiestandort. Die jüngsten Planungen der TES laufen dabei nicht gegen die energiepolitischen Ziele, die bis 2045 erreicht werden sollen. Bundeskanzler Scholz erwähnte bereits, wie Deutschland den Auf- bau eines Importterminals in Wilhelmshaven mit Wasserstoffpotenzial un-
terstützen will. TES ist der festen Überzeugung, dass das vollständig nachhaltige Wilhelmshaven-Projekt mindestens die gleiche, wenn nicht sogar stärkere Unterstützung erhalten sollte, wie traditionelle LNG Terminals unter Berücksichtigung der gleichzeitigen Klima-Krise.“ „Das Hauptziel der Dekarbonisierungspolitik der Europäischen Union ist es, die schnellstmögliche Reduzierung der CO2-Emissionen zu möglichst geringen Kosten zu erreichen“, sagte Otto Waterlander, Chief Commer- cial Officer bei TES. „Das derzeitige rasante Wachstum der erneuer- baren Energien muss fortgesetzt werden. Aber es wird unmöglich sein, alle Moleküle durch Elektronen zu ersetzen. Da nur 28 % des Primären- ergieverbrauchs der EU von 17.407 TWh aus Elektronen stammen, müssen wir uns auch auf die anderen 72 % konzentrieren, um unsere Netto-Nul- l-Ziele zu erreichen. Der von TES importierte grüne Wasserstoff wird die Energiewende in Deutschland deutlich beschleunigen und den Sek- toren Mobilität, Industrie und Energie helfen, ihre Dekarbon- isierungsziele zu erreichen und das Problem der Energiespeicherung zu lösen. Es wird sich unmittelbar auf die CO2-Emissionen auswirken und Dekarbonisierungskosten der Kunden minimieren. Unser Projekt Wil- helmshaven wird bis 2045 10 % des gesamten jährlichen Primärenergiebe- darfs Deutschlands decken, was etwa dem jährlichen Energieverbrauch von 43 Millionen Haushalten im Land entspricht.“ TES Grüner Wasserstoff wird hauptsächlich mit Solar-, Wind- und Wasserkraft in Ländern mit sehr gut verfügbaren erneuerbaren Energie- quellen hergestellt, wonach dem Wasserstoff dann CO2 hinzugefügt wird, um grünes CH4 herzustellen, das als „Energieträger“ verwendet wird. Diese wird dann mit einer eigens konstruierten Flotte von Schiffen nach Wilhelmshaven transportiert. In Wilhelmshaven kann das grüne CH4 wieder in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, wobei das entstehende CO2 abgeschieden und in einem kontinuierlichen geschlossenen Kreislauf- system per Schiff in die Erzeugerländer zurückgeführt wird – so garan- tieren wir, dass das CO2 niemals den Kreislauf verlässt und vermeiden THG-Emissionen. In der Anfangsphase von 25 TWh pro Jahr grünem Gasimport können in Wil- helmshaven mehr als eine halbe Million Tonnen Wasserstoff produziert und importiert werden. Diese wird auf 250 TWh pro Jahr in einer End- stufe und damit auf mehr als 5 Millionen Tonnen Wasserstoff steigen. Mit dem Energiebeitrag des Projekts wird ein wesentlicher Meilenstein der deutschen und europäischen Wasserstoff- und Klimaschutzstrategie
erreicht Quelle: Seaports of Niedersachsen, Grafik: TES Wilhelmshaven PLANMÄßIGE SPERRUNG DER SCHLEUSEN AM MDK Vom 19. März bis zum 08. April 2022 werden an den Schleusen des Main-Donau-Kanals und der Donau umfangreiche Unterhaltungsarbeiten durchgeführt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Donau MDK wird im Zeitraum von drei Wochen ein umfangreiches Bau- und Unterhal- tungsprogramm an den Schleusen Bamberg, Kriegenbrunn, Nürnberg, Eibach, Eckersmühlen, Kelheim und Regensburg umsetzen. Die Ampeln der Schleusen auf der Main-Donau-Wasserstraße werden dann auf Rot gestellt. Die Schifffahrt auf der rund 760 km langen transeu- ropäischen Wasserstraßenverbindung kommt für 12 bis 21 Tage zum Stills- tand. „Die vielen einzelnen Vorhaben, vom Wechsel einzelner Schleusentore, über die Bauwerksvermessung und Inspektion bis hin zur War-tung der Kameratechnik müssen sauber geplant, koordiniert und aufeinander abges- timmt werden. Für unsere Beschäftigten bedeuten diese Arbeiten eine
ganz besondere Herausforderung,“ so der für die Gesamtsteuerung verant- wortliche Fachbereichsleiter Marko Ruszczynski. Fünf Schleusenanlagen am Main-Donau-Kanal und eine Schleuse an der Do- nau werden u.a. für die Inspektionsarbeiten trockenlegt. Dazu zählt auch die Schleuse Eckersmühlen, die mit einer Hubhöhe von fast 25 m zu den größten Schleusen in Deutschland gehört, Die seit Monaten geplanten Arbeiten mit einem gesamten Auftragsvolumen von rund 10 Mio. Euro werden mit 270 eigenen Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern unter Beteiligung der Fachstelle für Maschinenwesen Süd durchgeführt. Zusätzlich wurden rund 100 Aufträge an externe Fir- men erteilt, die nochmals 220 Mitarbeiter/-innen und Spezialisten/-in- nen stellen. Quelle: WSA Donau RUSSLAND 2021 GRÖßTER HANDELSPARTNER DEUTSCHER SEEHÄFEN Von Januar bis November wurden 24,1 Millionen Tonnen an Gütern mit Russland umgeschlagen, 45 % davon fossile Energieträger. Ukraine hat 0,6 Millionen Tonnen an Gütern umgeschlagen, 70 % davon Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Die aktuellen Sanktionen gegen Russland dürften sich auch auf den Seev- erkehr Deutschlands auswirken. Wie das Statistische Bundesamt (Des- tatis) mitteilt, war die Russische Föderation von Januar bis November 2021 mit rund 24,1 Millionen Tonnen wichtigster Handelspartner der deutschen Seehäfen. Danach folgten Schweden (23,7 Millionen Tonnen) und die Volksrepublik China (20,2 Millionen Tonnen). Zur Einordnung: Von Januar bis November 2021 wurden in den deutschen Seehäfen insge- samt 265,3 Millionen Tonnen im Warenverkehr umgeschlagen. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum 2020, der stark von den Auswirkun- gen der Corona-Pandemie geprägt war, ist dies ein Anstieg um 5,2 %. Fossile Energieträger (insbesondere Kohle und Rohöl) sind wichtige Han- delsgüter deutscher Seehäfen. Insgesamt wurden von Januar bis November 2021 rund 28,6 Millionen Tonnen dieser fossilen Energieträger in deutschen Häfen empfangen, wobei 31,0 % des Empfangs auf Kohle und 68,3 % auf Rohöl entfielen. Mehr als ein Drittel (37,7 %) davon kamen aus der Russischen Föderation, die mit 10,8 Millionen Tonnen auf Platz 1 der wichtigsten Handelspartner für fossile Energieträger der deutschen Seehäfen lag. Auf den weiteren Plätzen folgten die Vereinigten Staaten mit 4,8 Millionen Tonnen und das Vereinigte Köni- greich mit 3,1 Millionen Tonnen. Im Seehandel Deutschlands mit der Russischen Föderation hat der Emp- fang von Gütern mit 89,2 % (21,5 Millionen Tonnen) den größten Anteil am Warenumschlag. Neben fossilen Energieträgern wie Kohle und Rohöl (10,8 Millionen Tonnen) wurden vor allem Kokerei- und Mineralölerzeug- nisse (5,4 Millionen Tonnen) aus der Russischen Föderation empfangen. Aus deutschen Seehäfen in die Russische Föderation geliefert wurden von Januar bis November 2021 rund 2,6 Millionen Tonnen Güter. Im Ver- gleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 10,0 %. Die Schwarzmeerhäfen der Ukraine sind wichtige Teile der Infrastruktur des Landes. Das Umschlagvolumen der deutschen Seehäfen mit der Ukraine lag von Januar bis November 2021 bei rund 636 000 Tonnen und damit um 4,3 % über dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Dabei han- delt es sich nahezu ausschließlich um Wareneingänge. Wichtigste Han- delsgüter der Ukraine mit den deutschen Seehäfen waren mit einem An- teil von 70,3 % die Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei wie beispielsweise Getreide. Die Ukraine gilt als Kornkammer Europas. Danach folgten mit einem Anteil von 20,7 % Erze, Steine und Erden sowie sonstige Bergbauerzeugnisse.
Methodische Hinweise: Erfasst werden Schiffe mit einem Raumgehalt von mindestens 100 Brutto- raumzahl (BRZ). Unberücksichtigt bleiben dabei Fischereifahrzeuge und Fischverarbeitungsschiffe, Bohr- und Explorationsschiffe, Schlepper, Schubschiffe, Schwimmbagger, Forschungs-/Vermessungsschiffe, Kriegsschiffe und Schiffe, die ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken verwendet werden sowie zu Bunker-, Versorgungs-, Reparatur- fahrten und Ähnliches. Die Daten zur Volksrepublik China sind ohne Taiwan und Hongkong. Güter, die auf ihrem Transportweg in einem Zwischenhafen umgeladen wer- den (zum Beispiel auf kleinere Schiffe), sind in der Seeverkehrsstatis- tik dem Partnerhafen zugeordnet, in dem es zu der Umladung kam. Quelle und Grafik: Destatis RHEINCARGO ÜBERNIMMT WERKSBAHN IN BAYERN Der Logistikdienstleister RheinCargo und der Kunststoff- und Chemiekonzern Lyondellbasell haben sich auf eine langfristige Zusamme- narbeit am Standort Münchsmünster in Bayern verständigt. RheinCargo
konnte die Ausschreibung für die Übernahme der dortigen Werksbahn gewinnen. Damit wächst der RheinCargo-Bereich „Werks- und Industriebah- nen“ weiter an. Auf dem etwa zehn Kilometer langen Gleisnetz rund um das Werk zur Her- stellung von hochdichtem Polyethylen wird seit Beginn des Jahres 2022 von RheinCargo der Rangierbetrieb mit zwei Lokomotiven an sieben Tagen in der Woche abgewickelt. „Herausfordernd war zunächst, kurzfristig das erforderliche Personal zu rekrutieren. Das ist uns gut gelungen, so dass wir alle logistischen Dienstleistungen in der von uns gewohn- ten Qualität abliefern können“, erklärt RC- Bereichsleiter Peter Ja- cobs, der vor Ort auch die Position des Eisenbahnbetriebsleiters über- nommen hat. „Die erneute Zusammenarbeit mit einem Weltkonzern zeigt, wie geschätzt die Produkte von RheinCargo sind. Wir sind optimistisch, dass wir in der Region weitere Projekte entwickeln können“, freut sich Wolfgang Birlin, für den Eisenbahnbereich zuständiger Geschäftsführer der Rhein- Cargo. Quelle und Foto: RheinCargo, v.l.n.r.: Peter Jacobs (Bereichsleiter Werks- und Industriebahnen), Klaus Seifert (Standortleiter Münchsmün- ster), Thomas Nebich (Lehrlokführer/Standortleiter Bottrop), Hakan Bul- gurcu (Standortleiter Münchsmünster) SCHLESWIG-HOLSTEIN WEITERHIN DRITTGRÖßTER SEEHAFENSTANDORT
Der Gesamtverband Schleswig-Holsteinischer Häfen (GvSH) lud mit Wirtschaftsminister Dr. Buchholz zum 12. Maritimen Parlamentarischen Frühstück in Berlin ein. Verkündung der Zahlen für 2021: +4,9% beim La- dungsumschlag; +23,8% bei den abgefertigten Passagieren. Schleswig-Hol- steinische Häfen sind gestärkt aus der Corona-Krise gekommen. Bereits zum zwölften Mal fand das Maritime Parlamentarische Frühstück des GvSH in Berlin statt. Fast 50 Teilnehmer/-innen, darunter Sch- leswig-Holsteins Wirtschafts- und Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz, Staatssekretärin Sandra Gerken (Bevollmächtigte des Landes Sch- leswig-Holstein beim Bund) sowie zahlreiche Bundestagsabgeordnete fan- den sich um 7:00 Uhr in der ständigen Vertretung des Landes Sch- leswig-Holstein beim Bund ein. Traditionell nutzt der GvSH das Maritime Parlamentarische Frühstück in Berlin, um auch die Umschlags- und Passagierzahlen des Vorjahres des Gesamthafenstandortes Schleswig-Holstein zu veröffentlichen. Frank Schnabel, Vorstandsvorsitzender des GvSH, konnte für das Jahr 2021 pos- itive Zahlen vermelden. Der Umschlag von Waren und Gütern ist im ver- gangenen Jahr um 4,9% gestiegen und lag bei insgesamt 52,6 Millionen Tonnen Ladung. Damit liegen die Schleswig-Holsteinischen Häfen auf na- hezu gleichem Niveau wie vor Corona und sind nach den Stadtstaaten Ham- burg und Bremen weiterhin drittgrößter Seehafenstandort Deutschlands, bzw. der größte Seehafenstandort unter den Flächenbundesländern. Frank Schnabel kommentiert: „Schleswig-Holstein ist das einzige Bundesland mit Zugang zu zwei Meeren. Unsere vielfältige Hafenlandschaft ist un-
ter anderem von Fähr- und RoRo-, Industrie-, Stück- und Massengut-, Kreuzfahrt-, Fischerei-, Insel- und Kanalhäfen geprägt. Daraus resul- tiert eine große Vielseitigkeit der Umschlagsgüter, sodass die Häfen eine bedeutende Handels-, Transport- und Dienstleistungsfunktion für Schleswig-Holstein, Deutschland und Europa wahrnehmen“. Bei der Anzahl abgefertigter Passagiere lag das Wachstum sogar bei 23,8%. Somit war eine deutliche Erholung bei den Passagierverkehren nach dem Coron- a-Krisenjahr 2020 zu verzeichnen. Auch wenn die Passagierzahlen weiter- hin unter dem Vor-Corona-Niveau lagen, wird im Jahr 2022 mit einer weiteren deutlichen Erholung der Passagierzahlen gerechnet. Ehrengast des Maritimen Parlamentarischen Frühstücks war erneut Dr. Bernd Buchholz, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein. Auch er unterstrich deut- lich den hohen Stellenwert der Häfen als wichtiges Drehkreuz der mari- timen Logistik: „Die Schleswig-Holsteinischen Häfen sind signifikante Knotenpunkte des internationalen Handels und des Personenverkehrs. Die systemrelevante Bedeutung der Häfen wurde auch besonders während der Corona-Pandemie deutlich, als die Häfen unter schwierigsten Bedingun- gen die Versorgungssicherheit der Menschen und Betriebe sicherstellen mussten. Dies wurde mit Bravour gemeistert. Umso erfreulicher ist es, zu sehen, dass die Schleswig-Holsteinischen Häfen nun gestärkt und mit großen Zuwächsen aus der Krise gekommen sind!“. Ungeachtet der guten Entwicklungen in den Schleswig-Holsteinischen Häfen stellen diese bereits heute die Weichen Richtung Zukunft. Ein be- deutender Schwerpunkt liegt derzeit auf der Umsetzung konkreter Maßnah- men zur Verbesserung der Umweltbilanz in der Schifffahrt. Der Ausbau von Landstromanlagen, Etablierung von emissionsreduzierten Treibstof- fen, emissionsfreie Antriebe für Hafenumschlaggeräte und Flurförder- fahrzeuge, Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie die Posi- tionierung der Häfen als Importterminals für grüne Energieträger sind nur einige Beispiele. „Die Schleswig-Holsteinischen Häfen sind sich ihrer Verantwortung bewusst, ihren Beitrag zur Einhaltung der Kli- maziele zu leisten. Hierfür werden hohe Investitionen in die Häfen getätigt. Auch werden die Häfen eine essenzielle Rolle spielen, um die Energiewende zu ermöglichen. Der notwendige Import von grünen Energi- eträgern wird über die Häfen erfolgen müssen. Darauf stellen wir uns ein“, erläutert Schnabel. Trotz der derzeitigen weltpolitischen Entwicklungen mit dem Krieg in
der Ukraine, deren langfristigen Folgen auf die Schleswig-Hol- steinischen Häfen noch nicht abschließend zu beurteilen sind, können die Schleswig-Holsteinischen Häfen positiv in die Zukunft blicken. Ins- gesamt betrachtet nimmt jeder der Schleswig-Holsteinischen Häfen, unab- hängig von seiner Größe, eine bedeutende Rolle ein und ist für die re- gionalen sowie überregionalen Warenströme von Bedeutung. „Unsere Häfen sind gut aufgestellt, sowohl heute als auch für die Zukunft“, fasst Schnabel zusammen. Quelle und Foto: Gesamtverband Schleswig-Holsteinischer Häfen e.V.
Sie können auch lesen