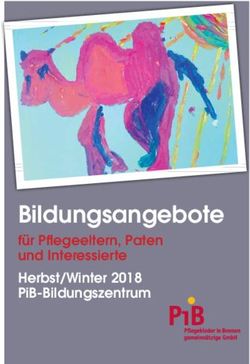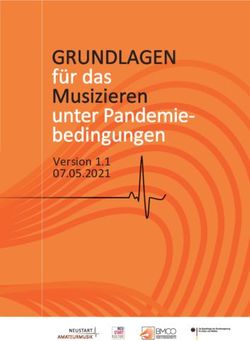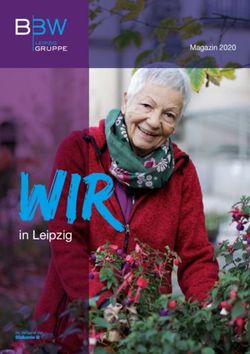Zur Arbeit der AIDS/STD Beratung - Ein Blick auf die Jahre 2003-2004 - Freie Hansestadt Bremen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Freie
Gesundheitsamt Hansestadt
Bremen
Sozialmedizinischer
Dienst für Erwachsene
AIDS / STD Beratung
Zur Arbeit der AIDS/STD Beratung
Ein Blick auf die Jahre 2003-2004Impressum
Herausgeber
Gesundheitsamt Bremen
Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene
AIDS/STD Beratung
Horner Str. 60-70
28203 Bremen
www.gesundheitsamt-bremen.de
Redaktion
Felicitas Jung
Thomas Hilbert
Barbara Freitag
Autoren
Felicitas Jung
Karen Jürgens
Martin Taschies
Susanne Coors
Johanna Ute Hauswaldt
Brigitte Cordes
Robert Akpabli
Sören Schmidt
Bearbeitung
Harald Freytag
Auflage
100
Erscheinungsdatum
2006
2Zur Arbeit der AIDS/STD Beratung
Ein Blick auf die Jahre 2003 und 2004
Gesundheitsamt Bremen
Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene
AIDS/STD Beratung
Mai 2006
3Inhaltsverzeichnis:
1 Die wichtigsten Daten im Überblick............................................................................6
1.1 AIDS ...................................................................................................................6
1.2 Sexuell übertragbare Erkrankungen...................................................................7
1.3 Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit..............................................................7
2 Einleitung....................................................................................................................8
3 Aufgaben und Ziele der AIDS/STD Beratung...........................................................12
4 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der AIDS/STD Beratung ................................13
Dolmetscherinnen und Dolmetscher ........................................................................14
5 Epidemiologische Situation ......................................................................................15
6 AIDS .........................................................................................................................18
6.1 Kein Test ohne Beratung – der HIV-Antikörper-Test .......................................18
Weitere Daten zur Testberatung ..............................................................................20
Welche Anlässe führen zum HIV-Test? ...................................................................22
Wie oft wurde der HIV-Test in Anspruch 2003 und 2004 genommen ?...................23
Neuinfektionen in 2004.............................................................................................24
6.2 Beratung von HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen ............................24
Warum waren 2004 mehr HIV-infizierte Menschen in der Beratung?......................27
Daten zu den HIV-infizierten Personen ....................................................................28
HIV-infizierte Migrantinnen und Migranten...............................................................29
Neuinfektionen in 2004.............................................................................................29
Kontakte zur Beratungsstelle: HIV-positive und AIDS-kranke Menschen sowie
Personen ihres Umfeldes 2003 und 2004................................................................30
6.3 Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim Reuterstraße 2003/2004 .....................32
6.4 Exkurs: Hoher Anteil HIV-infizierter intravenös Drogenabhängiger in Bremen –
ein statistisches Problem?............................................................................................33
7 Sexuell übertragbare Erkrankungen.........................................................................36
7.1 Untersuchung und Beratungvon Prostituierten 2004 .......................................36
4Arbeitsablauf ............................................................................................................ 37
Medizinische Untersuchungen................................................................................. 38
Diagnosen................................................................................................................ 39
Hepatitis B-Impfung ................................................................................................. 39
Weitervermittlung ..................................................................................................... 40
7.2 Projekt Apartmentarbeit – Prävention durch aufsuchende Sozialarbeit .......... 42
Die Bremer Situation................................................................................................ 42
Entwicklung des Projekts „Apartmentarbeit“............................................................ 43
Daten zur Apartmentarbeit 2003/2004..................................................................... 44
8 Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................... 46
8.1 Afrika Projekt – HIV/STD Prävention für Menschen aus Afrika ........................... 46
8.2 Auswirkungen auf die Prävention in Afrika ...................................................... 49
8.3 Jugendfilmtage................................................................................................. 50
8.4 Prävention für Jugendliche aus schwierigen Lebenslagen.............................. 53
8.5 Information für intravenös Drogenabhängige .................................................. 54
8.6 Radioauftritte.................................................................................................... 54
9 Zusammenfassung und Ausblick............................................................................. 55
10 Anhang................................................................................................................. 59
10.1 Überblick Fortbildungen und Informationsangebote 2004............................... 60
10.2 Glossar ............................................................................................................ 62
10.3 Literaturliste und Quellen ................................................................................. 65
51 Die wichtigsten Daten im Überblick
Tabelle 1: Daten im Überblick
2004 2003
1. HIV/AIDS1
Beratungskontakte 2.203 2.018
Beratung vor dem HIV-Test 1.180 1.059
• hohes Infektionsrisiko 12%
• keine Kondombenutzung 71,7% 66,1%
Erstdiagnose einer HIV-Infektion 0,5% (6 Personen) 0,5% (5 Personen)
HIV-infizierte, neue PatientInnen 51 31
• heterosexuell 42 21
• Migrationshintergrund 18 6
• Frauen / Männer 25 / 26 14 / 17
2. Sexuell übertragbare Erkrankungen
Beratungskontakte 1.283
• weibliche Prostituierte 90%
• Herkunftsregion Osteuropa 80%
• nicht krankenversichert 70%
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2003 und 2004
1.1 AIDS
2004 wurden insgesamt 2.203 Beratungskontakte im Zusammenhang mit dem HIV-
Antikörpertest durchgeführt, 1.180 davon betrafen ausführlichere Gespräche vor der
Durchführung des Testes. 2003 waren es insgesamt 2.018 Beratungskontakte im Zu-
sammenhang mit dem HIV-Antikörpertest, davon waren 1.059 ausführliche Gespräche
vor der Durchführung des Testes. In beiden Jahren wurde bei 0,5% der Personen
erstmalig eine HIV-Infektion entdeckt (Tabelle 1).
1
siehe Glossar
62004 hatten 12% derer, die die HIV-Testberatung in Anspruch genommen haben, über
ihre Sexualpartner und -partnerinnen ein erhöhtes bis hohes Risiko für eine HIV-
Infektion. Weitere 1% gaben an im näheren sozialen Umfeld Kontakt zu HIV-Infizierten
gehabt zu haben. Dagegen nannten 16 % Personen 2004 kein Risiko für eine HIV-
Infektion und ließen sich dennoch testen. Während gleichzeitig der Anteil derjenigen, die
kein Kondom benutzt hatten, von 66,1% im Jahr 2003 auf 71,7% im Jahr 2004 stieg
(Tabelle 1).
Im Jahr 2004 stieg die Zahl HIV-infizierte Menschen, die Kontakt zur Beratungsstelle
aufgenommen hatten um zwanzig gegenüber dem Jahr zuvor. Von diesen Personen
waren 2004 insgesamt 42 (84%) heterosexuell, während es in 2003 dies 21 Personen
(68%) waren. Von allen infizierten Menschen in der Beratungsstelle waren 2004 18
(35%) Migrantinnen und Migranten, 2003 waren es sechs Personen (20%). Frauen stell-
ten in beiden Jahren knapp die Hälfte aller infizierten Personen (Tabelle 1).
Insgesamt fanden 2004 445 Kontakte mit HIV-positiven Menschen und mit Personen
aus ihrem Umfeld statt, davon 208 telefonisch und 237 im persönlichen Gespräch. 2003
waren es insgesamt 296 Kontakte und davon 150 telefonisch und 146 im persönlichen
Gespräch.
1.2 Sexuell übertragbare Erkrankungen
2004 fanden insgesamt 1.283 Klientenkontakte statt. Nahezu 90 % der Kontakte waren
weibliche Prostituierte (Tabelle 1). Die Mehrheit war im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.
80 % der Klientinnen kamen aus Osteuropa (Tabelle 1).
Etwa 70 % waren weder in Deutschland noch in einem anderen EU-Land krankenversi-
chert (Tabelle 1).
1.3 Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit
Über Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für einzelne Gruppen wurden 310
Personen erreicht und über Großveranstaltungen ca. 3.900 Personen.
Zusätzlich wurden über eine Aktion in Bremer Afro-Shops 2.000 Kondome verteilt.
72 Einleitung
Vor 10 Jahren ist der letzte ausführliche Bericht über die Arbeit der damaligen AIDS
Beratung sowie über HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen in Bremen erschienen.
Seither hat sich viel verändert, nicht nur der Name der Beratungsstelle. Es ist an der
Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wir – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jetzi-
gen AIDS/STD Beratung 2 im Gesundheitsamt – wollen mit diesem Bericht unsere Tätig-
keitsfelder präsentieren, Transparenz über die Leistungen herstellen und die Diskussion
für eine konstruktive Fort- und Weiterentwicklung unseres Konzeptes anregen.
Bereits vor 10 Jahren hat ein Prozess der Normalisierung im Umgang mit der Krankheit
AIDS begonnen. AIDS hat sich im Bewusstsein vieler Menschen von einer tödlichen
Krankheit, die zeitweise als die größte Gesundheitsgefahr der Neuzeit erlebt wurde,
inzwischen zu einer fast alltäglichen chronischen Erkrankung entwickelt – mit allen guten
wie schlechten Folgen. Nach anfänglichen, oft dramatischen Horrorszenarien und
Schuldzuweisungen gegen Infizierte und Erkrankte ist die Angst vor der Erkrankung
zurückgegangen, hat die Diskriminierung der Betroffenen abgenommen. Das Gesund-
heitssystem, seine Institutionen und alle, die in der Versorgung arbeiten, haben sich der
Herausforderung gestellt und Wissen und Erfahrungen gesammelt. Die Lebenserwar-
tung von Infizierten konnte durch neue Medikamente deutlich verbessert werden. Doch
noch immer ist das Leben mit einer HIV-Infektion oder einer AIDS-Erkrankung alles an-
dere als einfach. Angst vor auftretenden Erkrankungen, Angst vor Ausgrenzung durch
andere Menschen, Angst vor den oft schweren Nebenwirkungen der Medikamente sind
immer noch Realität. Und: AIDS ist immer noch unheilbar.
Über die Auseinandersetzung mit den Infektionswegen von AIDS wurde der Blick für
andere infektiöse Erkrankungen wieder geschärft. Zunächst wurde die Prophylaxe für
Hepatitis B in Kliniken, Arztpraxen und auch in Kindergärten und Schulen verstärkt, da
die Infektionswege denen von HIV ähneln, die Ansteckungsfähigkeit des Hepatitis B-
Virus jedoch um ein vielfaches höher ist. Auch andere sexuell übertragbare Erkrankun-
gen wie Chlamydien, Gonorrhoe oder Syphilis erhielten in den letzten Jahren in der Öf-
fentlichkeit wieder mehr Aufmerksamkeit. Diese können bei Nichtbehandlung ebenfalls
zu gravierenden Folgeschäden führen und sie können Wegbereiter einer HIV-Infektion
sein.
2
AIDS entspricht der engl. Abkürzung Acquired Immune Deficiency Syndrom, im Deutschen er-
worbenes Abwehrschwäche Syndrom.
STD steht für die engl. Abkürzung Sexually Transmitted Disease, im Deutschen sexuell über-
tragbare Erkrankungen.
8Die Normalisierung von AIDS war und ist mit einer Reduzierung der früher großzügigen
Ressourcen auf vielen Ebenen verbunden: Bundesmittel für Modellprojekte wurden ge-
strichen und die Mittel für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die
für bundesweite Präventionskampagnen zuständig ist, drastisch gekürzt. In Bremen
wurde das gesamte Stellenkontingent der drei bestehenden Beratungsstellen reduziert.
Die AIDS Beratung im Gesundheitsamt wurde mit der Beratungsstelle für sexuell über-
tragbare Erkrankungen zusammengeführt. Ende 2004 wurde die finanzielle Förderung
der Beratungsstelle der AIDS-Hilfe Bremen e.V. eingestellt.
Angesichts einer über lange Zeit stagnierenden Zahl neu diagnostizierter HIV-
Infektionen, einem besserem Arrangement der Gesellschaft mit der Erkrankung und
einer wachsenden Bedeutung der medizinischen Versorgung gegenüber psychosozialer
Unterstützung sind diese Maßnahmen vernünftig. Aber: nachlassende Aufmerksamkeit
für Infektionsrisiken und stagnierendes oder sogar nachlassendes Schutzverhalten ge-
fährden die großen Erfolge der AIDS-Prävention in Deutschland. Zugleich entwickelt sich
die AIDS-Epidemie in Ländern außerhalb West-Europas teilweise ungebremst weiter.
Allmählich steigende Infektionszahlen bei einzelnen sexuell übertragbaren Erkrankungen
wie z.B. der Syphilis lassen für Deutschland bereits seit einiger Zeit vermuten, dass stei-
gende Infektionszahlen auch bei HIV zu erwarten sind. Für 2004 – und besonders auch
im ersten Halbjahr 2005 – bestätigen sich diese Annahmen. In allen Gruppen ist eine
Zunahme neu diagnostizierter HIV-Infektionen zu verzeichnen, die höchsten Steige-
rungsraten jedoch in der Gruppe homosexueller Männer. Das Robert-Koch-Institut be-
richtet hier vor allem in den letzten vier Jahren von einer deutlichen Steigerung. Präven-
tion ist also nach wie vor dringend erforderlich.
Die Erfahrungen der AIDS/STD Beratung – vor allem im Jahr 2004 – zeigen ebenfalls
einen Anstieg neu diagnostizierter HIV-Infektionen. Die Gründe dafür sind jedoch vielfäl-
tig und nicht nur mit steigenden Zahlen im Bundestrend zu erklären. Erst die kommen-
den Jahren können zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt und welche Gründe sich dafür
als plausibel erweisen. Zu beachten ist, dass die Klientinnen und Klienten der Bera-
tungsstelle weder den Bevölkerungsdurchschnitt, noch die Verteilung der hauptsächlich
betroffenen Gruppen widerspiegeln. Die Beratungsstelle erreicht traditionell viele Men-
schen, die sich über heterosexuelle Kontakte infiziert haben, gleichzeitig ist der Anteil an
Frauen relativ hoch. Nur ein kleiner Teil hat sich über homosexuelle Kontakte infiziert.
Eine wichtige Zielgruppe sind Migrantinnen und Migranten, die vor allem im Jahr 2004
die Beratungsstelle verstärkt nutzten. Sie stellten etwa ein Drittel aller HIV-Infizierten.
Die AIDS/STD Beratung ist in Bremen eingebettet in ein Netz von Beratungs- und Ver-
sorgungsangeboten mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Zielgruppen. Sie versteht
sich in der Versorgung HIV-infizierter Menschen als ein Partner vor allem für Fragen, die
9in der Regelversorgung schwer zu lösen sind. Sie repräsentiert außerdem ein zentrales
Angebot der medizinischen Versorgung von Prostituierten und leistet zur Gesundheits-
förderung dieser Gruppe einen wesentlichen Beitrag. Bei den präventiven Anstrengun-
gen um HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen ist sie ein Motor bei
der Entwicklung von Angeboten in der Kooperation mit anderen Einrichtungen.
Zu den Kerneinrichtungen des Bremer Netzes gehören neben dem System der ärztli-
chen und pflegerischen Versorgung das Rat und Tat Zentrum für Schwule und Lesben
e.V., das vorwiegend die Gruppe homosexueller Menschen anspricht. Die Zielgruppe
der Drogenabhängigen wird über die Drogenberatungsstelle (DROBS) und die medizini-
sche Ambulanz für Drogenabhängige erreicht. Bei der AIDS-Hilfe Bremen e.V., die sich
mit ihrem Beratungsangebot an unterschiedliche Zielgruppen gewendet hatte, besteht
das Projekt Betreutes Wohnen für Drogenabhängige weiter. Im Bereich der Prostitution
ist vor allem Nitribitt e.V. als Selbsthilfeorganisation für Prostituierte zu nennen. Eine
weitere wichtige Einrichtung ist Pro Familia Bremen e.V., mit der vor allem bei Themen
der sexuellen Aufklärung und Verhütung von Infektionskrankheiten eine enge Kooperati-
on besteht.
Die langjährigen Kooperationsbezüge ermöglichen eine gezielte Abstimmung zwischen
den Einrichtungen in der Ansprache der verschiedenen Zielgruppen und in der Planung
von Angeboten. Die effektive Entwicklung von gemeinsam durchgeführten Aktivitäten
wie Präventionsmaßnahmen für Jugendliche – vor allem zu nennen die „JugendFilm-
Tage“ – oder die gemeinsame Planung wechselnder Aktivitäten zum jährlichen Welt-
AIDS-Tag gehören hierzu.
Das lange Jahre bestehende Versorgungsnetz ermöglicht – trotz reduzierter finanzieller
und personeller Ressourcen – in der Regel auch bei schwierigen Versorgungsproblemen
eine gute und wenn nötig engmaschige Versorgung von Klienten, Patientinnen und
Patienten.
Im Feld der Prävention sind trotz der Bündelung der Kräfte durch Kooperationen ver-
schiedener Einrichtungen Lücken entstanden, die sich auch in zunehmenden Infektions-
zahlen zeigen. Diese Lücken können mit alten Konzepten nicht gefüllt werden. Die
HIV/AIDS Prävention steht hier vor neuen Herausforderungen. Zum einen sollte die Auf-
klärung über das Risiko einer HIV-Infektion mit der Aufklärung über Risiken für andere
sexuell übertragbare Erkrankungen und deren Folgen verbunden werden. Zum anderen
müssen die betroffenen Gruppen mit neuen und kreativen Konzepten, die die veränder-
ten Bedingungen berücksichtigen, angesprochen werden. Und es muss intensiv darüber
nachgedacht werden, wie diejenigen erreicht werden können, die bislang besonders
wenig von den Präventionsbotschaften profitiert haben: Menschen mit geringer Bildung
und aus sozial benachteiligten Milieus.
10Die AIDS/STD Beratung hat bereits begonnen, sich in einzelnen Feldern diesen Heraus-
forderungen zu stellen und neue Konzepte zu entwickeln. Das 2003 gestartete Afrika-
Projekt, das von einem Afrikaner aus Togo durchgeführt wird, hat die Aufklärung der in
Bremen lebenden Afrikanerinnen und Afrikaner zum Ziel. Sie sind von HIV und AIDS
besonders betroffen, ihr Informationsstand zu HIV und AIDS ist oft gering und sie waren
bislang schwer zu erreichen.
Eine relativ große Gruppe von Berufsschülern aus besonders schwierigen Lebenssitua-
tionen erhielt in den vergangenen Jahren Aufklärung und Information zu Sexualität,
Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Erkrankungen. Dieses Projekt wird nun in
enger Zusammenarbeit zwischen Pro Familia Bremen e.V., dem Rat und Tat Zentrum
für Schwule und Lesben e.V. und der AIDS/STD Beratung neu gestaltet.
Im Bereich der Prostitution wird seit vielen Jahren der direkte Kontakt vor allem zu aus-
ländischen Prostituierten durch aufsuchende Arbeit in den Appartements zusammen mit
Dolmetscherinnen gesucht. Darüber werden die Angebote der Beratungsstelle bekannt
gemacht und Aufklärung von Person zu Person betrieben.
Aus unserer Sicht befindet sich die Beratungsstelle auf einem positiven Entwicklungs-
weg, den es weiter zu verfolgen gilt.
Der hier vorliegende Bericht zeigt den Stand der Entwicklung.
Durchgängig fortlaufende Daten für HIV/ AIDS und Sexuell übertragbaren Erkrankungen
lagen für die vergangenen Jahre nicht immer vor. Wir haben verfügbare, neuere Daten
aus den Jahren 2004 und 2003 genutzt und – soweit vergleichbare Daten vorlagen –
auch andere Datenquellen wie alte Jahresberichte und Untersuchungen hinzugezogen.
Der Bericht präsentiert zum ersten Mal eine sehr weitgehende und detaillierte Auswer-
tung, die auch in den kommenden Jahren weiter fortgeführt werden soll.
Der Bericht schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick.
Der Anhang des Berichtes enthält ein Glossar, in dem im Text vorkommende
Fachbegriffe erklärt werden und weiterführende Literaturhinweise.
113 Aufgaben und Ziele der AIDS/STD Beratung
Die AIDS/STD Beratung hat zwei Aufgabenschwerpunkte: Auf der einen Seite stehen
Beratung, Begleitung und medizinische Untersuchung für Menschen, die in der Prostitu-
tion arbeiten, auf der anderen Beratung und Begleitung von Menschen, die von HIV und
AIDS betroffen sind. Beratung zu und Durchführung des anonymen HIV-Antikörper-
Tests gehören dazu. In beiden Schwerpunkten werden inhaltliche Aspekte von AIDS und
anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen berücksichtigt. In die Beratung zum HIV-
Test werden Risiken anderer sexuell übertragbarer Erkrankungen einbezogen und Pros-
tituierte können anonym einen HIV-Test durchführen lassen.
Aufklärung, Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit haben eine gemeinsame Zielsetzung.
Die Ziele sind:
• Aufklärung zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen,
• Ein Beitrag zur Reduzierung von Neuinfektionen durch Prävention,
• Förderung der Solidarität mit betroffenen Menschen und die Verhinderung von
Ausgrenzung.
Die Angebote sind:
• Information und Beratung zu HIV/AIDS und anderen sexuell übertragbaren Er-
krankungen,
• HIV-Antikörper-Test in Verbindung mit einem Beratungsgespräch vor und nach
dem Test,
• Medizinische Beratung,
• Ärztliche Untersuchung und Behandlung sexuell übertragbarer Erkrankungen in
Einzelfällen,
• Beratung und sozialtherapeutische Begleitung für Menschen mit HIV/AIDS, für
ihre Partnerinnen, Partner und ihre Angehörigen,
• Beratung und sozialtherapeutische Begleitung für weibliche und männliche
Prostituierte,
• Information zu Sozialleistungen,
• Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit.
124 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der AIDS/STD Beratung
(von links nach rechts: S. Coors, M. Taschies, B. Cordes, S. Paul, J.U. Hauswaldt, R. Akpabli, K. Jürgens,
F. Jung, C. Gronewoldt)
Das Team ist multidisziplinär mit medizinischer, pflegerischer, psychotherapeutischer
und pädagogischer Kompetenz besetzt (Stand 2005) 3:
Dr. Johanna Ute Hauswaldt, Ärztin (Referatsleitung)
Brigitte Julitz, Krankenschwester (Geschäftszimmer)
Susanne Coors, Dipl. Sozialpädagogin, Berufschullehrerin
Brigitte Cordes, Krankenschwester, Lehramt Biologie, Präventionsfachkraft
Christa Gronewoldt, Krankenschwester
Dr. Karen Jürgens, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie
Felicitas Jung, MPH, Pädagogin MA, Familien- und Sexualtherapeutin
Sagitta Paul, MPH, Dipl. Psychologin
3
Insgesamt verfügte die Beratungsstelle 2003 und 2004 über 6,5 Stellen, davon nur zwei Per-
sonen mit Vollzeitstellen.
13Martin Taschies, Dipl. Sozialarbeiter (Anleiter für Praktikantinnen und Praktikan-
ten)
R. Akpabli, Dipl. Biologe, Referent für Gesundheitsförderung
(Projektmanagement Afrika Projekt) (Juni 04 bis August 06)
Dirk Troué, Berufspraktikum Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Okt. 05 bis Sept. 06)
Die Beratungsstelle bildet regelmäßig Berufspraktikanten für Sozialarbeit/ Sozi-
alpädagogik aus.
Dolmetscherinnen und Dolmetscher
Um Migrantinnen und Migranten den Zugang zu erleichtern und ihnen eine angemesse-
ne und qualifizierte Versorgung zu bieten, werden zur Beratung Dolmetscherinnen und
Dolmetscher hinzugezogen. Teilweise werden vereidigte Dolmetscher und Dolmetsche-
rinnen über Dolmetscherbüros eingesetzt, einige Dolmetscherinnen stehen der Bera-
tungsstelle über Honorarverträge kontinuierlich zur Verfügung. Zur STD Beratung wer-
den Dolmetscherinnen zu festen Zeiten während der Sprechstunden eingesetzt. Im Jahr
2005 wurde dieser Dienst weiter ausgebaut, so dass jetzt an festgesetzten Tagen ent-
weder eine russisch, polnisch oder rumänisch sprechende Dolmetscherin anwesend ist.
Außerdem begleiten Dolmetscherinnen die Mitarbeiterinnen bei der aufsuchenden Sozi-
alarbeit (streetwork) für Prostituierte.
145 Epidemiologische Situation
Sexuelle Kontakte können zu infektiösen Erkrankungen führen. Auch wenig symptomati-
sche Erkrankungen wie die Infektion mit Chlamydien können zu schweren Folgeerkran-
kungen wie Unfruchtbarkeit führen.
Unkenntnis über die Symptome der Infektionen und Sorglosigkeit im Umgang mit Be-
schwerden führen zu ihrer Verbreitung. Unbehandelte sexuell übertragbare Erkrankun-
gen sind zudem Wegbereiter für eine HIV-Infektion. Rechtzeitige medizinische Behand-
lung und geschützter Geschlechtsverkehr können Infektionen verhindern.
Sexuell übertragbare Erkrankungen sind weltweit und zunehmend auch in Deutschland
ein ernst zu nehmendes Problem.
• Für das Jahr 2004 wurden in Deutschland insgesamt 3.345 neu diagnostizierte
Syphilisfälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Fälle um mehr als
400 (14%) gegenüber dem Vorjahr 4.
• Die Zahl der mit Gonorrhoe Infizierten liegt in Deutschland bei etwa 50.000 Fäl-
len pro Jahr 5.
• Für 2004 wurden in Deutschland insgesamt 2.751 Fälle einer akuter Hepatitis B
berichtet. Damit ist die Infektionsrate in Deutschland nicht weiter angestiegen. In
Europa sind jedoch ausgeprägte Unterschiede aufzufinden. In Deutschland be-
trägt die Inzidenzrate derzeit 0,4 bis 0,7% der Bevölkerung, in Osteuropa ist sie
6
mit bis zu 8 % mehr als zehnmal so hoch.
Die anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen wie Chlamydien- Infektionen, Infektio-
nen durch das Humane Papilloma- Virus (HPV) und durch Herpes-Simplex-Viren (HSV)
waren in Deutschland nie meldepflichtig. Die STD- Sentinel- Studie 7 des Robert-Koch-
Institutes (RKI) – an der wir uns beteiligen – ist derzeit die einzige Datenquelle zur Er-
fassung dieser Erkrankungen. In dieser Studie hat sich gezeigt, dass Chlamydien- Infek-
tionen neben HPV und HSV-Infektionen die am häufigsten diagnostizierten STDs sind.
In dieser Studie waren im Zeitraum Januar 2003 bis Dezember 2004 6,9% der auf
4
RKI (2005a). Epidemiologisches Bulletin. 26.
5
RKI (2004a). Epidemiologisches Bulletin. 39.
6
RKI (2005h). Epidemiologisches Bulletin. 46.
7
Studie zur Überwachung der Entwicklung epidemiologischer Trends bei sexuell übertragbaren
Erkrankungen (siehe auch Glossar).
15Chlamydien untersuchten Fälle positiv. Zum Vergleich: bei Laboruntersuchungen auf
Gonorrhoe und Syphilis waren jeweils 2,9% der untersuchten Fälle positiv 8, 9, 10.
HIV/AIDS bewegt sich in Deutschland seit Ende der achtziger Jahre auf einem relativ
gleichbleibenden Niveau 11. Die Anzahl der Menschen, die mit einer Infektion oder Er-
krankung leben, steigt leicht, da sich die Überlebenszeit Infizierter durch verbesserte
Medikamente deutlich erhöht hat. Ende 2004 lebten in Deutschland ca. 44.000 Men-
schen mit HIV/AIDS 12. Die Anzahl jährlicher Neuinfektionen war bis 2001 rückläufig,
steigt seither jedoch wieder an. Für 2003 und 2004 ist die Anzahl diagnostizierter Neuin-
fektionen allerdings nahezu identisch (2004: 1.928 Personen; 2003: 1.980 Personen 13).
In Deutschland stehen in der Verteilung der von HIV betroffenen Gruppen Männer, die
mit Männern sexuelle Beziehungen haben, an erster Stelle mit zunehmender Tendenz
(Tabelle 2). 2004 ist die Zahl der Neuinfektionen in dieser Gruppe um 6% gegenüber
dem Vorjahr angestiegen. Die zweitgrößte Gruppe sind Menschen aus Ländern mit einer
hohen HIV- Prävalenz. Die Hälfte von ihnen kommt aus Afrika aus den Subsahara-
Ländern, weitere 10% aus Südostasien und jeweils ca. 9% aus West-, Mittel- und
Osteuropa 14, 15.
2004 lebten in Deutschland 9.500 Frauen mit HIV/AIDS. Ihr Anteil betrug damit 21% aller
Infizierten. Kinder sind bislang nur selten von HIV betroffen. 2004 waren es ungefähr
300 Kinder 16.
8
RKI (2005b). STD-Telegramm vom 10.01.2005.
9
s.o. RKI (2005a).
10
RKI (2005bb). STD-Telegramm vom 05.04.2005.
11
RKI (2004b). Detaillierteren Grafiken zur Beschreibung der HIV-Epidemie in Deutschland nach
Zeitverlauf, Infektionsrisiken, Altersgruppen und Herkunft. HIV/AIDS-Folien. http://www.rki.de
(17.05.2005)
12
RKI (2005c). HIV in Deutschland – Eckdaten und Trends. http://www.rki.de (17.05.2005)
13
RKI (2005d). Epidemiologisches Bulletin. Sonderausgabe A/2005.
14
s.o. RKI (2005d)
15
s.o. RKI (2005c)
16
s.o. RKI (2005d).
16Tabelle 2:
Verteilung nach Infektionsrisiken bei HIV in Deutschland 2004
Infektionsrisiko Anteil
Männer, die sexuelle Beziehungen zu Männern
haben 47%
Menschen aus Ländern mit einer hohen HIV-
Prävalenz 16%
Menschen mit heterosexuellen Kontakte 13%
Intravenös Drogenabhängige 6%
ohne Angabe 18%
Gesamt 100%
Quelle RKI (2005b). Epidemiologisches Bulletin. Sonderausgabe A/2005
Die Neuinfektionen im Land Bremen zeigen eine durchschnittliche Inzidenz von 4,7 pro
100.000 Einwohner für die letzten 10 Jahre. Das Bremen (Land) liegt damit auf einem
niedrigeren Niveau als vergleichbare Regionen wie Hamburg, Berlin oder Köln und in-
nerhalb Deutschlands auf einem mittleren Niveau 17. Das RKI nennt für das Land Bre-
men insgesamt 433 bestätigte HIV-Infektionen seit dem 1.1.1993 18.
17
RKI (2005i). Telefonische Auskunft des RKI vom 02.11.2005.
18
RKI (2005f). Auskunft des RKI auf eine Anfrage des Gesundheitsamtes Bremen zu validen HIV-
Ersttestungen. Stand 01.09.2005.
176 AIDS
6.1 Kein Test ohne Beratung – der HIV-Antikörper-Test
Der HIV-Antikörper-Test hat sich zu einem festen Bestandteil der Prävention entwickelt.
Bundesweite Kampagnen der BZGA zur HIV-Prävention begleiten ihn ebenso wie vielfäl-
tige regionale Aktivitäten verschiedener Anbieter. Einige Aktivitäten der Beratungsstelle
zu Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit zählen gehören zu diesen Maßnahmen (siehe
Abschnitt 8).
Der kostenlose HIV-Test auf der Basis von Freiwilligkeit und Anonymität mit dem Ange-
bot einer Beratung gilt als ein Eckpfeiler der HIV- und auch der STD-Prävention. Ein
leichter Zugang ist durch offene Sprechstunden ohne Terminvereinbarung und zusätzli-
che Sprechstunden mit fester Terminvereinbarung möglich.
Das Gespräch mit Einzelpersonen oder Paaren vor und nach dem Test ist ein wichtiger
Bestandteil individueller Prävention. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu Übertra-
gungswegen und zum Schutz zu beantworten, tatsächliche oder auch nur vermutete
Infektionsrisiken anzusprechen und über den Umgang mit einem positiven Testergebnis
nachzudenken. Das Risiko anderer sexueller Erkrankungen wird ebenfalls berücksich-
tigt. Menschen mit häufig wechselnden Partnerinnen und Partnern wird zusätzlich eine
Impfung gegen Hepatitis B empfohlen.
Die früher zunächst zurückhaltendere Inanspruchnahme des HIV-Antikörper-Test hat
sich durch veränderte medizinische Behandlungsmöglichkeiten gewandelt. Bis Mitte der
neunziger Jahre war es der Medizin kaum möglich, den Krankheitsverlauf aufzuhalten.
Mittlerweile hat die Entwicklung verschiedener Medikamente das Gesicht von AIDS ver-
ändert. Die Lebenserwartung infizierter Menschen ist deutlich gestiegen. Das Wissen um
einen positiven HIV-Status bedeutet heute, rechtzeitig mit einer Behandlung beginnen zu
können. Eine optimale Therapie senkt die Viruslast und damit auch das Infektionsrisiko
für potentielle Sexualpartner und -partnerinnen. Das trägt zur Vermeidung neuer Infekti-
onen bei und ist damit Teil von Prävention.
Trotzdem muss in jedem Einzelfall Nutzen und Schaden des Testes gegeneinander
abgewogen werden. Ungesicherte Lebensverhältnisse, instabile soziale Beziehungen
oder schwere seelische Krisen können zunächst gegen einen Test sprechen.
18Tabelle 3:
Alle Kontakte im Zusammenhang mit HIV-Antikörper-Tests 2004 und 2003
2004 2003
Art des Kontaktes Anzahl der Prozent Anzahl der Prozent
Kontakte Kontakte
Testberatung 1.180 53,6 1.059 52,5
Ergebnismitteilungen 999 45,3 939 46,5
Weitere Beratungen 24 1,1 20 1,0
Kontakte insgesamt 2.203 100,0 2.018 100,0
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2003 und 2004
Alle Kontakte im Zusammenhang mit dem HIV-Antikörper-Test haben im Jahr 2004 um
9,2% gegenüber dem Jahr 2003 zugenommen, die Testberatungen selbst sind sogar um
11,4% gestiegen (Tabelle 3). Die Differenz zwischen Testberatungen und Ergebnismit-
teilungen erklären sich aus zwei Faktoren: nicht alle Beratungen münden in einen Test,
und ein kleiner Teil der beratenen Personen nimmt den Test in Anspruch, ohne das Er-
gebnis abzuholen.
In den Rubriken „weitere Beratungen“ sind Beratungen zusammengefasst, die als An-
lass keinen Testwunsch haben, sondern beispielsweise allgemeine Fragen zu Anste-
ckungswegen. Beratungen, die direkt HIV-Positive oder deren soziales Umfeld betreffen,
sind nicht enthalten (siehe Abschnitt 6.2).
Ein Blick in die Vergangenheit (1991-1994) zeigt, dass der HIV-Antikörper-Test im Bre-
mer Gesundheitsamt jetzt häufiger in Anspruch genommen wird. Da damals die Testbe-
ratung nicht von anderen Beratungen getrennt erfasst wurde, ist nur der Vergleich mit
Ergebnismitteilungen möglich: damals wurden zwischen 680 und 890 Ergebnisse mitge-
teilt 19, heute sind es zwischen 940 und 1.000 Ergebnisse. Nur 1993, als ein Skandal um
mit HIV- Viren kontaminierte Blutprodukte viele Menschen mobilisierte, war mit 1.147
Ergebnissen eine höhere Inanspruchnahme zu verzeichnen. Anders als im bundeswei-
ten Trend ist in Bremen keine rückläufige Nutzung des Tests im Gesundheitsamt zu
beobachten 20.
19
AIDS Beratung Bremen (Hrsg.) (1994). Jahresbericht 1993/1994. Bremen.
20
BZgA (2003). AIDS im Öffentlichen Bewusstsein der Bundesrepublik Deutschland 2002: Wis-
sen, Einstellungen und Verhalten zum Schutz vor AIDS; Endbericht. Köln.
19Weitere Daten zur Testberatung
In den ersten Jahren der AIDS Beratung haben vorwiegend Männer den Test in An-
spruch genommen (1986-1989: 70%) 21. Das hat sich zwar geändert (Tabelle 4), aber im
bundesweiten Vergleich wird der Test wesentlich stärker von Frauen als von Männern
genutzt 22.
Tabelle 4: Anteil der Geschlechter in der HIV-Test-Beratung
Jahr Frauen Männer Gesamt
1986-1989 30% 70% 100%
1992/1993 44,4%; 55,6% 100%
2003 47,9%; 52,1% 100%
2004 47,6%. 52,4% 100%
Quelle: AIDS Beratung Bremen (1994) und Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2003 und 2004
Über 60% der Personen, die den HIV-Test nutzen, sind unter 31 Jahren. Davon stellen
die 21-30 Jährigen die größte Gruppe. In 2004 ist sie mit fast 60% gegenüber dem Vor-
jahr noch angestiegen. Nur 7% aller Getesteten sind unter 21 Jahre alt, nur 5% über 50
Jahre. Frauen sind im Vergleich zu Männern etwas jünger (Abbildung 1).
21
s.o. AIDS Beratung Bremen (1994).
22
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2002). Gesundheitsämter im
Wandel. Abschlussbericht. Bonn
20Abb. 1: Altersverteilung nach Geschlechtern in 2003 und 2004
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
unter 18 18-20 Jahre 21-30 Jahre 31-40 Jahre 41-50 Jahre 51 und älter
Jahre
weiblich 2004 männlich 2004 weiblich 2003 männlich 2003
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2003 und 2004
Der HIV-Antikörper-Test wird überwiegend von heterosexuellen Personen genutzt. Ihr
Anteil steigt kontinuierlich. War es in den ersten Jahren ein rascher Anstieg von 76,6%
(1986/89) auf 86,4% (1992/93) 23, verlief der Anstieg in den vergangenen Jahren lang-
samer bis auf 93% im Jahr 2004. Gleichzeitig blieb die absolute Zahl homo- und bisexu-
eller Nutzer und Nutzerinnen konstant. Homosexuelle und Bisexuelle werden vom An-
gebot der Beratungsstelle also nur wenig ereicht. Auch der Anteil der intravenös Dro-
genabhängigen liegt unter 1%. Prostituierte nutzen vor allem das Untersuchungsangebot
der STD Beratung (siehe Abschnitt 7).
Der Anteil von Migranten und Migrantinnen 24 bei der Testberatung ist schwankend. Im
Jahr 2004 ist er – wie in 2001 25 – wieder auf 10% gestiegen, nachdem er 2003 auf
knapp 8% gesunken war.
23
s.o. AIDS Beratung Bremen (1994).
24
Zum verwendeten Migrationsbegriff siehe Glossar.
25
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2001
21Tabelle 5:
Herkunftsländer von beratenen Migrantinnen und Migranten 2004 und 2003
2004 2003
Nationalität Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent
Afrika 30 25,6% 19 23,8%
Asien 10 8,5% 12 15,0%
West-Europa/Zentral-
Europa 26 29 24,8% 23 28,8%
27
Mittlerer Osten 11 9,4% 0
Ost-Europa/Zentral-
Asien 28 21 17,9% 10 12,5%
Nord-Amerika 4 3,4% 2 2,5%
Lateinamerika 3 2,6% 5 6,3%
Übrige / unbekannt 9 7,7% 9 11,3%
Gesamt 117 100,0% 80 100,0%
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2003 und 2004
Männliche Migranten nehmen die Testberatung deutlich häufiger als Frauen in Anspruch
(2004: 67,5%). Im Jahr 2004 war der Frauenanteil bei den Migranten mit 32,5% etwas
höher als im Vorjahr mit 23,8%.
Aus den Erfahrungen der Beratungsstelle und aus vorliegenden Daten lässt sich erken-
nen, dass sich präventive Aktivitäten und Engagement in den verschiedenen ethnischen
„communities“ lohnen, da sie für Migranten und Migrantinnen Wege in die Beratungsstel-
le öffnen (Tabelle 5, siehe auch Abschnitt 8.1 Afrika Projekt).
Welche Anlässe führen zum HIV-Test?
Der Test wird häufig zu Beginn einer Beziehung als eine Art „Verlobungstest“ durchge-
führt. Ziel ist die Bestätigung eines negativen HIV-Status, um in der künftigen Partner-
schaft auf Kondome verzichten zu können. 2003 und 2004 geben jeweils ein gutes Drit-
tel eine neue Beziehung als Grund für den Test an 29. Seitensprünge innerhalb fester
Partnerschaften und „One- Night- Stands“ – einmalige sexuelle Erlebnisse – sind mit ca.
26
incl. Albanien, Türkei
27
Iran, Libanon, Syrien
28
Bulgarien, Lettland, Polen, Rumänien, Russland, Ukraine
29
Die hier genannten Daten beziehen sich auf Angaben während des Gesprächs vor dem Test.
Sie enthalten Mehrfachnennungen.
2210% ebenfalls häufige Gründe für einen Test. 3% (2004) bzw. 5% (2003) vermuteten bei
einem Partner oder einer Partnerin ein HIV-Risiko. Irrationale Ängste und Phobien als
Grund für den Test sind mit knapp 3% von untergeordneter Bedeutung.
Auffällig ist 2004 eine Zunahme HIV-infizierter Partner und Partnerinnen und HIV-
infizierter Personen im näheren sozialen Umfeld getesteter Personen. Während 2003
nur 15 HIV-infizierte Personen im Umfeld genannt wurden, waren es 43 Personen in
2004. Diese Steigerung ist nur teilweise mit einer Zunahme HIV-Infizierter in Bremen zu
erklären, die das RKI für das Jahr 2004 berichtet 30, 31.
Zwischen 2003 und 2004 hat der Anteil derjenigen, die als Risiko für eine mögliche In-
fektion angeben, kein Kondom benutzt zu haben, von 66,1% auf 71,7% zugenommen.
Der Anteil mit unklaren oder geringen Risiken wie dies bei oralem Sex der Fall ist, hat
dagegen abgenommen. Der Anteil derjenigen, die einen Test ohne erkennbares Risiko
durchführen, ist recht hoch (2004: 16%, 2003: 15%) und muss in den kommenden Jah-
ren weiter beobachtet werden.
Wie oft wurde der HIV-Test in Anspruch 2003 und 2004 genommen ?
Beziehungen sind in unserer Gesellschaft oft zeitlich begrenzt. Die Sozialforschung
spricht von „serieller Monogamie“, mehr oder weniger dauerhaften monogam gelebten
Beziehungen nacheinander. Diese Form der Sexualität kann daher immer wieder neue
Risiken mit sich bringen, was zu wiederholten HIV–Testungen führen kann. Von 2003
auf 2004 ist der Anteil der Mehrfachnutzer von 42,2% auf 39,4% gesunken. Wie oft der
Test außerhalb des Gesundheitsamtes in Anspruch genommen wird, ist uns unbekannt.
Eine frühere Umfrage zum HIV-Antikörper-Test im Jahr 2001 32 ergab, dass etwa 40%
derer, die sich mehrfach testen lassen, den Test bereits an anderen Stellen durchgeführt
haben.
Männer haben sich in den beiden vergangenen Jahren etwas häufiger mehrfach testen
lassen als Frauen (Tabelle 5).
30
RKI (2005e). Epidemiologisches Bulletin. Sonderausgabe B/2005
31
RKI (2005f). Auskunft des RKI auf eine Anfrage des Gesundheitsamtes Bremen zu validen HIV-
Ersttestungen. Stand 01.09.2005.
32
Gesundheitsamt Bremen AIDS/STD Beratung (Hrsg.) (2002). Nachgefragt ..... 2000/2001 –
Ergebnisse einer Umfrag. „NutzerInnen“ zum HIV-Antikörper-Test. Bremen.
23Tabelle 6: Testhäufigkeit und Geschlecht der beratenen Personen 2003 und 2004
weiblich männlich beide Geschlechter
2003 (N = 979)
Einmal 2003 60,9% 54,9% 57,8%
Zwei bis dreimal 2003 33,0% 36,4% 34,7%
Mehrmals 2003 6,1% 8,7% 7,5%
Gesamt 100% 100% 100%
2004 (N = 1.054)
Einmal 2004 62,4% 59,0% 60,5%
Zwei bis dreimal 2004 31,9% 33,2% 32,6%
Mehrmals 2004 5,7% 7,8% 6,8%
Gesamt 100% 100% 100%
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2003 und 2004
Homosexuelle Männer ließen sich in beiden Jahren deutlich häufiger mehrmals testen
als andere Männer. Nur 30% aller homosexuellen Männer kommen zum ersten Mal zum
Test und 22% bzw. 35% lassen sich mehr als dreimal testen.
Bei Frauen liegt - unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung – der Anteil an Ersttes-
tungen bei ca. 60%.
Neuinfektionen in 2004
Sieben Personen erhielten 2004 ein positives Testergebnis. Sechs dieser Ergebnisse
waren neu entdeckte Infektionen.
6.2 Beratung von HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen
Aufgaben und Selbstverständnis der Beratungsstelle haben sich auch in der Versorgung
HIV-infizierter Menschen verändert. Viele Jahre war die Beratungsstelle für nahezu alle
Fragen der Versorgung zuständig. Durch die Normalisierung im Umgang mit HIV und
AIDS werden nun viele Fragen und Probleme direkt von zuständigen Institutionen gelöst.
Die AIDS/STD Beratung nimmt jetzt, neben der psychosozialen Beratung, stärker Koor-
dinationsaufgaben wahr. Sie wird in die Klärung verschiedener Problemkonstellationen
einbezogen oder geht im Einverständnis mit Klientinnen und Klienten aktiv auf Koopera-
tionspartner zu. Die AIDS/STD Beratung hat sich zu einer Einrichtung entwickelt, die im
24Zusammenhang mit HIV/AIDS Fragen und Probleme bearbeitet, die in der Routine des
Versorgungssystems nicht gelöst werden können, wie das Fallbeispiel (Kasten 1) belegt.
Das Angebot für HIV-Infizierte und AIDS-Kranke ist breit gefächert. Neben
psychosozialer Beratung und Begleitung umfasst es medizinische Beratung,
Informationen zu Sozialleistungen und Hilfen bei der Versorgung im Krankheitsfall. Ein-
malige Gespräche sind möglich ebenso wie kontinuierliche Begleitung oder akute
Krisenintervention. Einzelpersonen, Paare, Familien, Freunde, Freundinnen oder
Fachpersonen können beteiligt sein. Auch bei Problemen am Arbeitsplatz ist Unterstüt-
zung möglich. Ärztinnen, Ärzte oder Krankenpflegepersonal können Kontakt zur
Beratungsstelle aufnehmen oder vermitteln. Gespräche können zu Hause, in der Klinik
oder am Arbeitsplatz stattfinden.
Ziel der Beratungsstelle ist, HIV-Infizierten und AIDS-Kranken möglichst lange ein
selbstständiges Leben mit der Infektion zu ermöglichen und im Bedarfsfall notwendige
Hilfen zu vermitteln. Dazu gehören auch Unterstützung des sozialen Umfeldes und Qua-
lifikation von Fachpersonal.
Kasten 1:
Fallbeispiel:
Eine Klinik vermittelte den Kontakt zu einer AIDS-kranken Asylbewerberin. Die
Frau war zunächst schwer krank; ihr körperlicher Zustand verbesserte sich
durch die medikamentöse Behandlung deutlich. Da sie nur wenig Englisch
sprach und ihre Landessprache ein afrikanischer Dialekt war, war unbekannt,
inwieweit sie und ihr Freund über ihre Erkrankung informiert waren. Sie war An-
alphabetin.
Die Frau war einverstanden, mit Hilfe eines Dolmetschers zur Beratungsstelle
Kontakt aufzunehmen.
Das Erstgespräch fand in der Klinik statt. Ihre Kenntnisse über HIV und AIDS
waren sehr gut, da sie in ihrem Heimatland bereits Informationen dazu erhalten
hatte. Für sie war jedoch unklar, was die Infektion und Erkrankung für ihre Zu-
kunft bedeuten würde und welche Behandlungsmöglichkeiten bestehen. Mit
Freund war eine Hochzeit seit langem geplant. Sie hatte jedoch Angst, ihm über
ihre Infektion zu berichten. Ihre gesamte Lebenssituation aufgrund ihres Aufent-
haltstatus instabil. Sie lebte in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber
und hatte außer zu ihrem Freund und dessen Schwester keine weiteren Kontak-
te.
25Mehrere Aufgaben waren zu lösen: die Mitteilung der Infektion an Freund und
Schwester, Abklärung des Infektionsstatus des Freundes, Beendigung der Isola-
tion im Wohnheim, weitere medizinische Versorgung, Analphabetismus und feh-
lende Deutschkenntnisse und Gestaltung der Lebensperspektive.
Aus dem Erstgespräch entwickelte sich ein fortlaufender Kontakt, der ein Jahr
bestand. Nach einem gemeinsamen Abschlussgespräch mit den behandelnden
Ärzten in der Klinik fanden alle weiteren Gespräche mit Dolmetscher in der Bera-
tungsstelle statt.
Die Klientin entschied sich, ihrem Freund die HIV-Infektion nicht allein, sondern
gemeinsam mit seiner Schwester mitzuteilen. Die Schwester reagierte sehr ver-
ständnisvoll und nahm die Aufgabe an, ihren Bruder und seine Freundin zu stüt-
zen. Der Freund kam anschließend in die Beratungsstelle, um sich auf HIV tes-
ten zu lassen. Das Ergebnis war zur Erleichterung aller negativ. Die Beziehung
zu ihr stand für ihn zu keinem Zeitpunkt in Frage.
Die Leiterin des Asylbewerberheims wurde mit Einverständnis der Klientin ein-
bezogen, um weitere Unterstützung für die Alltagsgestaltung zu geben und zu-
künftig anstehende Arzttermine koordinieren zu können. Dank der Initiative der
Heimleiterin gelang es, einen Sprach- und Alphabetisierungskurs und einen the-
rapeutischer Malkurs zu organisieren. Die Einbindung der Heimleiterin war sinn-
voll und notwenig, um die HIV-Infektion der Frau nicht über die Beteiligung der
Beratungsstelle preiszugegeben.
Ebenfalls mit dem Einverständnis der Frau und in Absprache mit der Klinik wur-
de ein Englisch sprechender Arzt zur Weiterführung der ambulanten Behandlung
gesucht, der bereit war, mit der Beratungsstelle zu kooperieren. Mit ihm und mit
der Klinik wurde vereinbart, dass Kopien der Befunde an die Beratungsstelle
gingen, um Fragen der Klientin zu Befunden und zur Behandlung gemeinsam
mit dem Dolmetscher und mit der Ärztin der Beratungsstelle beantworten zu
können.
Die Lebenssituation besserte sich, da die Heirat trotz HIV-Infektion nicht gefähr-
det war. Die Beschaffung der notwendigen Papiere dauerte trotz Hilfe von
Rechtsanwälten über ein Jahr. Erst danach waren Hochzeit und Einzug in eine
gemeinsame Wohnung möglich.
26Warum waren 2004 mehr HIV-infizierte Menschen in der Beratung?
2004 haben sich 51 HIV-infizierte Personen – 20 mehr als im Vorjahr – an die AIDS/STD
Beratung gewendet. Das ist gegenüber den Vorjahren eine deutliche Zunahme
(Abbildung 3).
Abb.3: Anzahl der HIV-infizierten Personen in der
Beratungsstelle 2000 - 2004
60 51
50 38
A
40 31 32 31
n
z
a 30
h
l 20
10
0
Jahr 2004 Jahr 2003 Jahr 2002 Jahr 2001 Jahr 2000
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2000-2004
Daten des Robert-Koch-Instituts verzeichnen für Bremen im Jahr 2004 mehr HIV-
Ersttestungen als zuvor 33, 34, ein Trend, der sich 2005 fortgesetzt hat und für das ge-
samte Bundesgebiet gilt 35, 36. Es handelt sich dabei vor allem um Neuinfektionen bei
homosexuellen Männern. Die Nutzer der Bremer AIDS/ STD Beratung sind überwiegend
heterosexuell (82,4%).
2004 haben besonders Kliniken durch Weitervermittlung an die Beratungsstelle zur ho-
hen Zahl von Klienten beigetragen. Über diesen Weg kamen nahezu ein Drittel aller
Betreuten in die Beratungsstelle. Einige Patienten und Patientinnen waren, anders als in
den vorherigen Jahren, zum Zeitpunkt des Erstkontakts bereits schwer an AIDS er-
krankt. Die Kommunikation mit Kliniken und Arztpraxen wird seit Jahren durch kontinu-
ierliche Beteiligung an der Ausbildung von Krankenpflegepersonal (siehe Abschnitt 10)
33
s. o. RKI (2005f).
34
s.o. RKI (2005e)
35
s.o. RKI (2005e)
36
s.o. RKI (2005f)
27und durch regelmäßige Teilnahme an einem Ärztekreis zu HIV/AIDS gepflegt. Diese
teilweise langjährigen Kontakte erleichtern schnelle und unkomplizierte Zusammenarbeit
bei jedem Einzelfall.
HIV-infizierte Migrantinnen und Migranten nutzen die Beratungsstelle immer häufiger.
Die kontinuierliche Präventionsarbeit für diese Zielgruppe trägt offensichtlich dazu bei,
dass die Beratungsstelle als verlässliche Institution wahrgenommen und genutzt wird
(siehe Abschnitt 8). 2004 waren etwa ein Drittel aller betreuten HIV- Infizierten Migran-
tinnen und Migranten, 2003 erst ein Fünftel.
Im Jahr 2004 kamen zusätzlich acht Personen auf Anregung von Menschen ihres sozia-
len Umfelds in die unmittelbaren Beratungsstelle.
Daten zu den HIV-infizierten Personen
Die Verteilung zwischen den Geschlechtern ist in der Beratungsstelle nahezu paritätisch.
2004 waren es 25 Frauen zu 26 Männer und 2003 waren es 14 Frauen zu 17 Männern.
Im Bundestrend liegt der Anteil der Frauen bei 21% aller neu diagnostizierten HIV-
Infektionen. Der Anteil infizierter Frauen ist also im Gesundheitsamt Bremen vergleichs-
weise hoch. Ein Grund ist die arbeitsteilige Versorgung der Zielgruppen durch die Bre-
mer Beratungsstellen. Die Gruppe der homosexuellen Männer wird überwiegend vom
Rat und Tat Zentrum für Schwule und Lesben e.V. erreicht, während sich Frauen erfah-
rungsgemäß eher an das Gesundheitsamt wenden.
Die Altersverteilung in der Beratungsstelle ist ähnlich wie im Bundesgebiet 37, mehrheit-
lich zwischen 30 und 50 Jahre alt (2004: 55%).
Der Anteil Heterosexueller liegt in der Beratungsstelle aufgrund des hohen Anteils von
Migranten und Migrantinnen sowie von deutschen Frauen über dem durchschnittlichen
Anteil derer, die sich im Bundesdurchschnitt über heterosexuelle Kontakte infiziert ha-
ben. 2004 waren 42 der Infizierten (84%) heterosexuell und in 2003 waren es 21 Perso-
nen (68%). Zum Vergleich: das RKI nennt für 2004 13% aller neu Diagnostizierten, die
sich auf heterosexuellem Weg infiziert haben und zusätzlich 16% Menschen aus Her-
kunftsländern mit einer hohen HIV- Prävalenz 38. Infektionen in diesen Ländern sind in
der Regel auf heterosexuelle Übertragungswege zurückzuführen. Werden die Bezugs-
größen des RKI für 2004 berücksichtigt, gilt für die Beratungsstelle: 25% der Infizierten
37
s.o. RKI (2005d)
38
s.o. RKI (2005d)
28waren heterosexuell und stammten nicht aus Hochprävalenzländern, während 30% aus
solchen Ländern kamen. Nur einer (!) von Ihnen bezeichnete sich offen als homosexuell.
Der Ansteckungsweg ist überwiegend und dem Bundestrend entsprechend ungeschütz-
ter Geschlechtsverkehr. 2004 nannten 39 unserer Klienten ungeschützten Geschlechts-
verkehr als Ansteckungsrisiko, 2003 waren es 22 Personen.
In beiden Jahren sind jeweils 2 Personen an der AIDS-Erkrankung gestorben.
HIV-infizierte Migrantinnen und Migranten
Die Mehrheit der Migrantinnen und Migranten stammt aus Ländern mit einer hohen HIV-
Prävalenz wie Afrika und Asien. Von 2003 auf 2004 stieg die Anzahl betreuter Afrikaner
von 5 auf 14 Personen an. 2004 wurden außerdem zwei Personen aus Osteuropa be-
treut. Für diese Länder befürchtet das RKI steigende Infektionsraten 39.
Frauen sind unter den infizierten Migranten deutlich in der Mehrheit. 2004 waren von 18
Personen 12 Frauen und sechs Männer.
Neuinfektionen in 2004
Im Jahr 2004 erhielten insgesamt 16 von der Beratungsstelle begleiteten Personen die
Erstdiagnose HIV/AIDS. Bei sechs von diesen wurde die Infektion direkt in der Bera-
tungsstelle diagnostiziert, die anderen in Kliniken und bei niedergelassenen Ärztinnen
oder Ärzten. Das Robert-Koch-Institut meldet für diesen Zeitraum im Land Bremen 31
neue Diagnosen40. Die Hälfte aller neu diagnostizierten Personen hat also 2004 die Be-
ratungsstelle in Anspruch genommen.
Fünf dieser in 2004 neu Diagnostizierten waren Frauen und elf Männer. Drei Männer
gaben als Infektionsweg homosexuellen Geschlechtsverkehr, zwei Personen ihre IV-
Drogenabhängigkeit an. Zwei der neuinfizierten Personen gingen der Prostitution nach.
Neun der gesamten Erstdiagnosen in 2004 betrafen Migrantinnen und Migranten. Acht
von ihnen kamen aus afrikanischen Ländern. Von den neu diagnostizierten Migranten
und Migrantinnen waren vier weiblich und fünf männlich.
39
RKI (2005g). Epidemiologisches Bulletin. 25.
40
s.o. RKI (2005f).
29Kontakte zur Beratungsstelle:
HIV-positive und AIDS-kranke Menschen sowie Personen ihres Umfeldes
2003 und 2004
2004 gab es 445 Gesprächskontakte mit HIV-positiven Menschen und mit Personen aus
ihrem Umfeld, davon waren 208 telefonisch und 237 im persönlichen Gespräch. 2003
waren es insgesamt 296 Kontakte, von denen 150 am Telefon und 146 im persönlichen
Gespräch geführt wurden.
Betroffene bevorzugten das persönliche Gespräch, während Fachpersonal eher den
telefonischen Kontakt nutzte (Tabelle 7).
Tabelle 7:
Wer nutzte 2004 den persönlichen und wer den telefonischen Kontakt ?
(Mehrfachantworten, Summe daher > 445)
Art des Kon- Klien- Soziales Klinik/ Personal Andere Sonstige Ge-
taktes Anzahl tIn Umfeld ÄrztIn Reuterstr. Insti- Personen samt
tutionen
Persönlicher 207 34 17 16 7 27 308
Kontakt
Telefonscher 59 16 31 22 61 24 213
Kontakt
Gesamt 266 50 48 38 68 51 521
Quelle: Dokumentation der AIDS/STD Beratung 2004
In 2004 war bei 19% der Kontakte zusätzlich zum jeweiligen Berater oder der jeweiligen
Beraterin eine weitere oder mehr Personen beteiligt (2003: 12%). Fallkonferenzen mit
schwierigen Fragestellungen bedeuteten Gesprächsrunden mit bis zu 10 Personen aus
verschiedenen Institutionen.
Die Themen der Gespräche waren in beiden Jahren ähnlich (Tabelle 8). Die meisten
Kontakte betrafen psychosoziale Beratungen mit Betroffenen und ihrem sozialen Um-
feld. An zweiter Stelle standen koordinierende Absprachen mit Fachpersonal und mit
Betroffenen.
30Sie können auch lesen