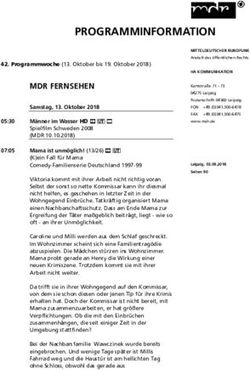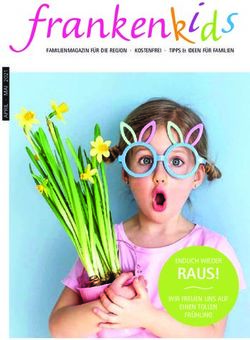10 Jahre Projekt zur Kultur der Natur - UN-Dekade ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
10 Jahre
Projekt zur Kultur der Natur
Idee und Konzept
Till Meyer
Eine Kooperation des
Bayerischen Staatsballetts
mit dem
Bayerischen Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz
Herausgegeben vom Bayerischen Staatsballett
und dem Bayerischen Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz
Titelbild: Erste Solistin Lisa-Maree CullumInhalt
Seite
6 Prolog
Ulrike Scharf, Ivan Liška
10 Auftakt
Till Meyer, Ivan Liška
18 Ursprünge
Bettina Wagner-Bergelt, Raoul Schrott
32 Geschichte, Religion und Kunst
Angelika Schneider, Gerhard Haszprunar,
Wolfgang Bischof
46 Naturschutz in Bayern
Jörg Müller, Michael Vogel, Manfred Wölfl,
Sabrina Reimann, Stefan Kluth
64 Psychologie und Gesellschaft
Konrad Ott, Odile Rodríguez de la Fuente,
Manfred Spitzer, Thomas Kirchhoff, Reinhold Messner
83 Kulturtechniken
Konrad Ott, Beate Seitz-Weinzierl
90 Naturschutz in Europa
Zoltan Kun, Hubert Faltermeier, Heinz Grunwald
102 Internationale Stimmen
Sabine Kuegler, Sharon Shay Sloan, Vance Martin,
Liz Close, Wolfgang Schröder
114 Schlussakkord
Michael Apel, Gerhard Trommer, Vance Martin,
Hubert Weinzierl, Hans-Dieter Schuster
124 Anhang
Making of, Danksagung, Autoren und Quellen,
Matthew Cranitch
Bildnachweis, ImpressumProlog net, 2014 folgte die Ehrung “Ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade Bio
logische Vielfalt”.
von Ulrike Scharf und Ivan Liška
Die Ergebnisse jüngster Umfragen zum Thema Wildnis lesen sich
wie eine Bestätigung für die Projektidee. Ein hoher Prozentsatz der Be
völkerung wünscht sich mehr vom Menschen möglichst nicht oder wenig
Als der Journalist Till Meyer 2003 im Umweltministerium anfragte, ob beeinflusste Naturräume, auch außerhalb von Schutzgebieten. Ein gesell
er Fotos von Tänzern des Bayerischen Staatsballetts präsentieren dürfe, die schaftspolitscher Auftrag, über den gemeinsam nachzudenken lohnt.
in der Wildnis des Nationalparks Bayerischer Wald aufgenommen worden Einen Beitrag dazu sollen auch die zum 10-jährigen Bestehen des
waren, war das Erstaunen anfangs groß. Aber bereits auf den ersten Fotos, Projekts entstandene Filmdokumentation und die dazugehörigen Beiträge
beeindruckend inszeniert vom Fotografen Berny Meyer, war die Faszina- von über 30 namhaften Autoren des umfangreichen Booklets leisten, die
tion “Ballett und Wildnis” spürbar, lösten sich die scheinbaren Gegensätze das Thema Kultur und Natur aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln
von Kunst und Natur in Wohlgefallen auf. Die Idee, mit dem Bayerischen beleuchten und beschreiben.
Staatsballett eine Aufführung in der Wildnis auf einer Naturbühne durch- Herzlichen Dank an die nahezu 100 Tänzer des Bayerischen Staats-
zuführen und damit gleichzeitig Wildnis auch als gesellschaftspolitische balletts, die sich in diesen 10 Jahren auf das Wagnis “Ballett und Wildnis”
und naturschutzfachliche Aufgabe zu vermitteln, war geboren. Damit ver- so eindrucksvoll eingelassen haben. Danke auch an unsere Mitarbeiter, die
bunden war auch der Wunsch, neue gesellschaftliche Zielgruppen für den sich für dieses Projekt enorm engagiert haben. Till Meyer für die Idee und
Naturschutz zu interessieren und umgekehrt, Naturschutzinteressierte für seinen großen persönlichen Einsatz sowie Berny Meyer, der von Anfang
das Bayerische Staatsballett. an mit seiner Kamera in unnachahmlicher Weise und mit viel Gespür für
10 Jahre besteht nun die Kooperation “Ballett und Wildnis” zwi Kunst und Natur die Fotos hat entstehen lassen. Last but not least: Danke
schen dem Bayerischen Staatsballett und dem Bayerischen Umweltmi an die Kelheimer Vereine Kelheim Zukunft e. V., den Kulturförderverein
nisterium. Nach der ersten Aufführung 2004 im Nationalpark Bayerischer Kelheim und die Musikvereinigung Kelheim, ohne die die Erstellung von
Wald folgten Aufführungen 2007 im Nationalpark Berchtesgaden und Film und Booklet nicht möglich gewesen wäre.
2013 anlässlich “150 Jahre Befreiungshalle Kelheim” im Bereich des Natur-
schutzgebiets Weltenburger Enge – vor mehreren Tausend Besuchern. Un-
vergessliche Erlebnisse für alle Beteiligten wie auch für das Publikum.
Immer begleiteten Ausstellungen und Filme zum Projekt die
Aufführungen. Während der aufführungsfreien Zeit wurden diese in-
ternational zu gegebenen Anlässen in München, Augsburg, Bonn, Pots-
dam, Prag, USA und Mexiko präsentiert. Vom Projekt angeregt, wurde
2005 in das Bayerische Naturschutzgesetz die Bestimmung aufgenommen
“Geeignete Landschaftsräume sind der natürlichen Dynamik zu überlas-
sen”. 2007 fand ein Kongress zum Thema “Wildnis-Werte-Wirtschaft” in
München statt.
Ganz besonders stolz sind wir auf die Auszeichnungen, die das Ulrike Scharf MdL Ivan Liška
Projekt bisher erhalten hat. 2007 wurde das Bayerische Staatsballett als Bayerische Staatsministerin für Direktor des
Umwelt und Verbraucherschutz Bayerischen Staatsballetts
“weltweiter Botschafter der Wildnis” von der Wild Foundation ausgezeich-
6 7Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
Lucie Barthélémy, Claudine Schoch und Séverine Ferrolier
im Nationalpark Berchtesgaden
8 9Auftakt
Auftakt Während sich einige Nationalparkbesucher über das Spektakel
gehörig wunderten, war den Kennern klar, dass hier Ballettgeschichte in
Szene gesetzt wurde, denn in vielen Balletten wuchern Wald, Wildnis und
Natur. In „Giselle“ (1841) wird die Titelheldin zu einer Wili, einem über-
Ballett und Wildnis irdisch-verwirrend schönen Wesen, welches die armen Burschen tief in
von Till Meyer den unheimlichen Wald lockt. Giselles Grab, so stellte die Ballettforscherin
Marion Kant fest, lag mitten im Deutschen Wald.
In Balletten wie „Sylvia“ (1877), „La Sylphide“ (1832) oder „Les
Am Anfang stand eine Idee: Ein Staatsballett, eine Staatsoper, ein Na- Sylphides“ (1907) haben geheimnisvolle Sylphen (Waldnymphen) tragende
tionaltheater sind das Aushängeschild für die Leistungen, die in einem Rollen.
Bundesland auf dem Sektor der Hochkultur erbracht werden. Ein Natio Kein Wunder, dass die Tänzerinnen und Tänzer mit Verve und
nalpark wiederum ist das Aushängeschild für die Leistungen eines Landes Herzblut dabei waren und sich einige sogar wünschten, „auch einmal
zum Schutz seiner Natur, zur Bewahrung seiner landestypischen Arten draußen in der Wildnis zu tanzen“.
ausstattung.
Johann Wolfgang von Goethe wäre fasziniert von dieser Kombina-
tion. Der Schriftsteller, Dichter, Naturforscher und herzogliche Minister
schrieb: „Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen; und haben sich, eh
man es denkt, gefunden.“
So brauchte es dann auch nicht lange, um Karl Friedrich Sinner,
den vormaligen Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, von der Idee zu
überzeugen: „Ein Ausflug des Bayerischen Staatsballetts in unseren Park?
Klar, wir werden vorbereitet sein!“ Die Ballett-Company durfte kommen;
Führungen und Übernachtung im Wildnis-Camp des Nationalparks inklu-
sive.
Aus der Direktion des Staatsballetts kam der Vorschlag, zu dem
Ausflug in den Nationalpark ein paar Original-Kostüme mitzunehmen,
darunter auch ein Solistinnen-Tutu aus dem Ballett „Schwanensee“.
Das Programm war dicht: geführte Natur-Wanderungen, Foto-
Im Nationalpark Bayerischer Wald 2004
shooting, Gespräche am Lagerfeuer – alles begleitet vom Fotografen Berny
Meyer.
Um nur einen der fotografischen Höhepunkte zu beschreiben: an- Der Rest ist bekannt. Die Umsetzung dieses Tänzer-Wunsches
getan mit dem wertvollen Schwanensee-Kostüm watete Lisa-Maree Cul- führte – nach diversen technischen, bürokratischen und auch finanziellen
lum, Erste Solistin des Balletts, in einen Waldsee und führte – als sei nichts Hürden – zu den viel beachteten Veranstaltungsreihen in den National-
selbstverständlicher – verschiedene Ballettposen vor, darunter ein Cambré parks Bayerischer Wald, Berchtesgaden und schließlich in Kelheim an der
derrière, eine lyrische gen Himmel gerichtete Verbeugung rückwärts. Der Donau, im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge.
Fotograf und sein Beleuchtungsassistent (und Verfasser dieser Zeilen) hat- Die Aufführungen in Kelheim aus Anlass des 150-jährigen Beste-
ten Mühe, der mutigen Ballerina in den See zu folgen (siehe Titelbild). hens der Befreiungshalle legten weitere Dimensionen des Projekts „Ballett
10 11Auftakt Auftakt
und Wildnis“ frei. König Ludwig I. (1786–1868), Bauherr der Befreiungs Die Tänzerinnen und Tänzer des Bayerischen Staatsballetts sowie
halle (eröffnet 1863), wurde 2013 zum „Spiritus rector“ – zum geistigen seine Junior Company konnten mit ihren Darbietungen zumindest kurz
Direktor – des Projekts „Ballett und Wildnis“. Ludwig hätte wohl seine fristig das Gegenteil bewirken: die Wiederverzauberung der Natur.
Freude daran gehabt! Dass so ganz nebenbei die Natur auch bei den Tänzern und Tän
Er war Kunstkenner und Mäzen, Hobbydichter, Europapolitiker, zerinnen einiges bewirkt hat, das zeigen die Wildnis-Zitate auf den folgen-
Naturfreund – sowie skandalös verwickelt in eine Affäre mit der irisch- den Seiten, die bei Interviews zumeist während der Exkursionen entstan
schottischen Tänzerin Lola Montez. Und wie jeder Romantiker war er so den. Die Tänzerin Pavla Micolavcic etwa verriet uns: „In der Natur kommen
wohl Traditionalist als auch Freigeist. mir Fragen zum Leben, Fragen, die mir in der täglichen Routine des Stadtle
Die Turbo-Aufklärung, die Napoleon Bonaparte den Europäern bens wohl gar nicht in den Sinn kommen würden.“
auferlegt hatte, schmeckte Ludwig gar nicht. Sein Bekenntnis hieß: Die Tänzer-Zitate bilden den roten Faden zu den nachfolgenden
„Fortschritt ja, aber nicht um jeden Preis“. Seiten: Eine Sammlung von Essays, Testimonials, Interviews und Informa-
tionskästen zur Wirkung und Bedeutung von Wildnis auf und für Men-
schen, garniert mit großartigen Bildern aus zehn Jahren „Ballett und Wild-
nis“.
Dass sich unter den renommierten Fachautoren auch zwei vor-
malige Mitglieder der „Gruppe Ökologie“ (S. 112 und 119) befinden, der
Generaldirektor der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen (S.
37), ein Philosoph der neuen Frankfurter Schule (S. 64, 84 und 87), macht
die vorliegende Sammlung sicherlich zu einem besonderen Schatzkäst
chen. Kurz vor Drucklegung überraschte uns auch ein bayerischer Bischof
(S. 41) und einer der berühmtesten Bergsteiger der Gegenwart, Reinhold
Messner (S. 78), mit aufschlussreichen Aussagen zur Wildnis.
Der vorerst letzte (aber sicher nicht allerletzte) Höhepunkt
des Projekts „Ballett und Wildnis“ ist die Auszeichnung als „Projekt der
UN-Dekade Biologische Vielfalt“ am 18. November 2014, zu der wir den
Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Raoul Schrott (S. 23) als Fest
redner gewinnen konnten.
Auch aus seinen Ausführungen wurde deutlich: Die beiden so
gegensätzlichen Aktionsräume Ballett und Wildnis haben viele Gemein-
Katja Geiger, Marc Geifes und Lukas Laux samkeiten, die tief in der Kulturgeschichte der Menschheit wurzeln. Durch
im Nationalpark Bayerischer Wald die Ausflüge der Tänzerinnen und Tänzer werden die alten Verbindungen
zu unserer Ur-Kultur nicht nur wiederbelebt, sondern auch reflektiert, be
Damit nahm Ludwig das vorweg, womit Philosophen der „Frank- wertet und hinterfragt.
furter Schule“, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, in den vierziger
Jahren des 20sten Jahrhunderts haderten: „Aber die vollends aufgeklärte
Welt strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der
Aufklärung war die Entzauberung der Welt.“
12 13Auftakt
Das Wilde Herz Europas
von Ivan Liška
Wilde Natur war immer Teil meines Lebens. Ich wuchs in Prag auf,
aber in meinen Ferien durfte ich oft die Wildnis des Šumava-Gebirges er-
leben. Als Erwachsener wurde ich Tänzer. Ich übte diesen Beruf über 30
Jahre lang aus, und immer wenn es Zeit war, meine Batterien wieder aufzu-
laden, kehrte ich in die Wildnis zurück.
Deshalb freute ich mich sehr, als ich 2009 hörte, dass der Šumava
und der Bayerische Nationalpark sich zusammenschließen würden, um ge-
meinsam das Wilde Herz Europas zu bilden.
Ganz wie bei uns Menschen besteht dieses Herz aus zwei Kam-
mern. Eine davon wird aus Deutschland versorgt, dem Land, in dem
ich nun seit 42 Jahren lebe, die andere von der Tschechischen Republik,
meinem Geburtsland. Ich habe hier Kindheit und Jugend bis zum Alter
von 19 verbracht, sie ist mein „Vaterland“, wie es der tschechische Kom-
ponist Bedřich Smetana in seinem berühmten Werk über die Moldau be-
schrieb.
Natürlich hat es mich beunruhigt, als mir zu Ohren kam, dass
die beiden Herzkammern plötzlich nicht mehr im Gleichtakt arbeiteten.
Und dass meine Landsleute den Einsatz von Motorsägen und Baumernte-
Maschinen mitten in der Wildnis befürworteten, machte mich richtig wü-
tend.
Es kostete einige Jahre an Bemühungen, aber jetzt, so glaube ich,
findet das Wilde Herz Europas wieder zu einem beständigen Rhythmus,
dem einzigartigen Rhythmus des Böhmerwalds.
Als Künstler kann ich bloß staunen, welche Ansätze es gibt, die
“Wir lieben die Natur. Die Wildnis Schönheit der Natur zu bewahren und wieder herzustellen. Der Arbeit von
ehrenamtlichen und staatlichen Naturschützern zolle ich größten Respekt.
ist für uns eine Quelle des Entdeckens und Deshalb wird unser Ensemble dem Projekt „Ballett und Wildnis“ noch
der Inspiration. Sie ist der Wille des Lebens, viele Jahre lang treu bleiben.
so wie die Menschheit es auch ist.” Die Liebe zum Tanz und die Liebe zur Natur wurzeln in demsel-
ben Boden: Beide entstanden in der Zeit der Romantik. Wobei Romantik
nicht wirklich eine Zeit war, sondern vielmehr eine künstlerische, lite
Norbert Graf (Deutschland), Valentina Divina (Italien) rarische und intellektuelle Bewegung zwischen dem Ende des 18. und dem
Anfang des 20. Jahrhunderts.
14 15Auftakt
Dass die Naturschutzbewegung und das klassische Ballett beide
darauf zurückzuführen sind, ist kein Zufall. Romantisch zu sein gilt heute
nicht unbedingt als cool. Man denkt dabei an Kerzenlicht, Kitsch, Nostal-
gie und übermäßige Gefühlsduselei.
Im 19. Jahrhundert jedoch sah man das anders: Die roman-
tische Bewegung war avantgardistisch, fast subversiv, da sie dem herr-
schenden Zeitgeist völlig zuwider lief. Dieser befand sich auf dem Zenit der
Aufklärung, die Wissenschaft und die industrielle Revolution waren auf
dem Vormarsch, Schornsteine und Förderbänder machten sich breit. Die
Menschen kamen in den Genuss neu errungener Freiheiten und Mobilität.
Romantiker waren nicht gegen den Fortschritt und sicher auch
nicht gegen die Wissenschaft. Doch sie ahnten, dass weder die Forschung
noch die Industrie alle Probleme lösen würden, und dass zu viel Fortschritt
uns vielleicht einiger Werte berauben würde, die uns als Menschen aus-
machen.
Dies war und ist kurz gesagt die wichtigste These der romantischen
Bewegung. Und hält man an dieser Definition fest, dann können wohl mit
Fug und Recht noch heute die meisten Künstler und Naturschützer genau
als das bezeichnet werden: als Romantiker.
Romantik
Eine Biographie über König Ludwig I. trägt den Titel: „Ein Romantiker
auf Bayerns Thron“ (F. Herre). Dort heißt es:„Ludwigs gefühlsmäßige An
lagen entwickelten sich frühzeitig, während seine verstandesmäßige
Heranbildung viel später einsetzte und stets im Hintertreffen blieb.“
„Wildnis, das ist der Gegensatz, die Abwesenheit von Zivi
Romantik steht also für einen Überschuss an Sentimentalität.
Ein anderes Buch, „Romantik – Bayern für Liebhaber“ (H. Schin lisation. So gesehen gibt es eigentlich in Deutschland keine
dler), gibt dem Begriff eine komplexere Bedeutung: „Der Aufbruch zur Wildnis. Wildnis, so wie wir sie im Bayerischen Wald kennen
Romantik um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert stellt das ele gelernt haben, ist von den Menschen gewollt. Und Kunst hat
mentarste Ereignis der deutschen Geistes- und Kulturgeschichte dar. auch viel mit Wollen zu tun. Deswegen ist Wildnis ein Stück
(...) Einer Bewegung, die von Deutschland aus ganz Europa erfasste und
Kunst, vor allem auch, weil sie dem ästhetischen Bedürfnis
in Bayern eine durch die Vielfalt der Erscheinungen besonders interes
sante Rolle spielte.“ Zu einer Definition von „romantisch“ im Brockhaus: der Zivilisationsmenschen entgegenkommt. Vor richtiger
„stimmungsgetragenes Neuerleben von Landschaft“ gibt es noch eine Wildnis hätten die meisten sicher Angst.“
etymologische Ergänzung. Deutsch ist die einzige Sprache, in der es
Laure Bridel-Picq (Frankreich)
das Wort wildromantisch gibt.
16 17Ursprünge
Ursprünge Ich gehe in die Maske, in die Garderobe. Ich prüfe meine Spitzen-
schuhe, probiere aus, welche ich tragen werde. Ich gehe ins Studio, wärme
mich auf, plié, …, … Konzentriere mich auf die Vorstellung, die vor mir
liegt, gleite langsam hinüber in einen anderen körperlichen und geistigen
Eine andere Welt Zustand. Die Kolleginnen helfen mir, mein Kostüm anzuziehen. Zuerst das
von Bettina Wagner-Bergelt der Prinzessin. Sie tanzt an einem unbestimmten Ort, in einer Zeit vor
dieser Geschichte. Der Zauberer Rotbart, getanzt von meinem Mann Mar-
lon Dino, wird mich beobachten.
Ich bin Lucia Lacarra. Ich bin Tänzerin. In dem Moment, in dem ich Der Zauberer ist einsam, wie alle mächtigen Männer. In einem
die Bühne betrete, tauche ich ein in eine andere Welt. Augenblick wird er die Hände nach mir ausstrecken, die Augen schließen
Ich werde, was ich tanze. und seine ganze Kraft aufwenden, mich in einen weißen Schwan zu verzau-
bern. Von nun an muss ich in Tiergestalt bei ihm bleiben – es sei denn, ein
Mann verliebte sich in mich und bliebe mir treu – die alte Geschichte…
Da kommt Siegfried ins Spiel. Der junge Prinz, der keine Lust
auf Machtspiele hat. Der nicht regieren will und noch weniger die Frau
heiraten, die seine Königinmutter für ihn ausgesucht hat. Ein Träumer, ein
Weltflüchtiger.
Nichts wie weg vom steifen Hofzeremoniell in die Natur, in eine
Welt jenseits der Wirklichkeit! Ich erscheine ihm mit anderen weißen
Schwänen am See. Und er verliebt sich in mich, die Schwanenprinzes-
sin Odette, Inbegriff der Unschuld – Liebe auf den ersten Blick, der erste
Schwur.
Ich bin schüchtern, aber ich vertraue dem Geliebten. Im weißen
Akt, einem der schönsten der Ballettgeschichte, oszilliere ich zwischen
dem weißen Schwan und der sich hingebenden Frau, die nichts als Sehn-
sucht fühlt nach Liebe und Erlösung – endlich wieder ein Mensch sein dür-
fen!
Mit Rotbarts Wut habe ich nicht gerechnet. Der Zauberer wird mich
nicht gehen lassen. Über Siegfrieds Liebesschwur lacht er böse und …
Noch einmal lässt er seine magischen Kräfte walten: er verwandelt
mich in den schwarzen Schwan Odile – ja, ich selbst muss unter Qualen
Siegfried auf die Probe stellen, ihm begegnen als verführerische schwarze
Schwanenfrau. Er soll auch der dunklen Welt seine Liebe schwören – und
den weißen Schwan verraten. Im Schloss allein mit Siegfried, lässt der Zau-
berer mich meine ganze Faszination aufbieten, um Siegfried zu betören.
Die Variation des schwarzen Schwans – ein leidenschaftliches Glanzstück
unter Marius Petipas Choreographien.
18 19Ursprünge Ursprünge
Überwältigt von der erotischen Anziehungskraft Odiles hebt
Siegfried erneut die Hand zum Treueschwur– und verrät seine Liebe zum
weißen Schwan, zu mir. Fassungslos über seinen Verrat, stürzt er sich in
den Tod und mich ins Unglück. Rotbart nimmt mich mit in sein Reich, ein
weißer Schwan bis in alle Ewigkeit.
Ich bin Lucia Lacarra. Ich bin Tänzerin. In dem Moment, indem
ich die Bühne betrete, tauche ich ein in eine andere Welt.
Waldgeister
Ob Sylphiden, Wilis, Trolle, Pane, Faune, Feen, Hexen, Moosweib
chen: In den Märchen und Mythologien fast aller Völker gibt es
allerlei seltsame Kreaturen, die weder zu den Tieren gehören
noch zu den Menschen. Wie in dem Ballett “Schwanensee” ste
hen manche dieser Mischwesen für den Wunsch nach Erlösung
in einer jenseitigen Welt. Oft verkörpern sie aber auch ein archai
sches Initiations-Muster: Junge Erwachsene müssen durch die
Wildheit hindurch, um kulturfähig und reif zu werden für die
Zivilgesellschaft. Den Eltern manch heutiger Teenager ist dieses
Muster nicht unbekannt.
Eine weitere Erklärung für die seltsamen Geschöpfe ist,
dass sich Menschen in früheren Zeiten auf Dinge des Waldes
und der Natur einen Reim zu machen versuchten, für die es da
mals noch keine Erklärung gab. Inzwischen, so scheint es, hat
die Wissenschaft fast sämtliche Geister aus der Natur vertrieben.
Die Forscher selber wissen freilich meistens nur zu gut, dass sie
viele Zusammenhänge in der Natur kaum kennen, und dass es
noch viel zu forschen gibt. Von den neuen Erkenntnissen (siehe
S. 46 und 58) sind sie begeistert.
Claudine Schoch, Ivy Amista und Magdalena Lonska
20 21
im Nationalpark BerchtesgadenUrsprünge Ursprünge
Gehen und Stehen
von Raoul Schrott
Wir haben das aufrechte Stehen und Gehen in den Bäumen gelernt,
uns mit Händen zu jenen Astspitzen hantelnd, wo unter dem Laub die sü-
ßesten Früchte versteckt waren. Ist dies nicht bereits, was jedes Ballett
zum Ausdruck bringt: unser vergebliches Emporrecken nach etwas Süßem,
verlangend und verzehrend? Etwas, nach dem wir uns auf dem Boden des
Irdischen vergeblich ausstrecken?
Unser Gehen besteht aus einer Abfolge von Bewegungen, durch
die wir uns von der Stange der Äste wegzubewegen gelernt haben, einen
Ablauf von seit Kindheit an trainierten Kunstgriffen, mit denen wir uns
über das Fallen hinweg schwindeln. Tritt ein Bein nach dem anderen steif
auf den Boden, verschiebt sich das ganze Gewicht des Körpers erst auf die
Ferse, dann zum großen Zeh, der Spann als Stoßdämpfer, die Hüfte den
Rückstoß auffangend.
Dieser aufrechte Gang brachte uns Leistenbrüche, Hämorrhoiden,
kaputte Bandscheiben und Knie, Hammerzehen und Plattfüße ein, erspar-
te im Vergleich zum Laufen auf vier Beinen jedoch genauso viel Energie
wie unser großes Hirn nun verbraucht – während der Tanz des aufrechten
Gangs Oberschenkel und Becken so veränderte, dass unsere Kinder zu früh
geboren werden müssen, damit der Kopf noch durch das Schambein passt –
was wiederum eine lange Zeit der Nachbetreuung bewirkte, die mittelbar
zu Familienleben führte – während Schultern und Arme zugleich musku-
löser wurden, um uns beim Gehen auszubalancieren – was die Vielseitig-
keit der nunmehr freien Hände beförderte, die genug Kraft und Wendigkeit
erhielten, um Steine abzuschlagen und sie zu schleudern – wobei Brustkorb
und Hals eine freiere Aufhängung erfuhren, sodass Lungen und Kehlkopf
leichter Laute hervorbringen konnten – was insgesamt jene erhöhte Mobi-
lität und Kommunikationsfähigkeit bedingte, dank derer wir uns bald über
die Erde ausbreiteten. Die Maschine Mensch – von zylindrischen Stößeln
angetrieben, ihre Glieder und Gelenke ineinander verzahnt – ist nichts als
Marc Geifes und Alexandre Vacheron
ein Ballet Méchanique: überaktiv und verspielt, dazwischen melancholisch
im Nationalpark Bayerischer Wald verlorenen Anfängen nachhängend, und letztlich selbstdestruktiv.
22 23Ursprünge Ursprünge
Evolution und Tanz
Der Mensch stammt vom Affen ab; er ge
hört wie Orang-Utan und Schimpanse zu den
Menschenaffen (Primaten). Was ihn jedoch
neben seiner Intelligenz von den anderen Pri
maten unterscheidet, ist sein aufrechter Gang.
Möglich und nötig wurde diese Form der Fort
bewegung, als vor einigen Millionen Jahren
aus klimatischen Gründen der angestammte
Wald-Lebensraum der Primaten schrumpfte.
Mehr und mehr Primatenstämme verließen
die Wälder, um in den Savannen nach Überle
bensmöglichkeiten zu suchen. Jetzt konnten
sich die Tiere freilich nicht mehr so einfach
von Baum zu Baum hangeln, sondern mussten
lernen, auf den Hinterbeinen zu stehen und zu
gehen.
Nach und nach stellten diese Primaten
ihre Nahrung auf fleischliche Zusatzkost um.
Bei der Jagd war taktische Gruppenkommu
nikation wichtig und die Fähigkeit schnell
und ausdauernd laufen zu können. Ein hierzu
geeigneter Muskelapparat und vor allem die
Fähigkeit, aufeinander abgestimmte Gruppen
bewegungen durchzuführen, wurde immer
wichtiger. Höhlenmalerei mit Abbildungen Marc Geifes
von harmonisch angeordneten Menschen
gruppen, aber auch Instrumentenfunde wie
Knochenflöten zeigen, dass Musik und Tanz bei
der Kommunikation der frühen Menschen min
destens so wichtig war wie die gesprochene
Sprache. Sicher ist: lange bevor die Menschen
einander Briefe schrieben, tanzten sie mitein
ander!
24 25Ursprünge Ursprünge
Tanz hat alles „Um auf der Bühne zu überzeugen, muss ich an
von Bettina Wagner-Bergelt meine Grenzen gehen. Dazu ist viel Disziplin nötig,
aber auch Wildheit, ja sogar Aggression. In der Musik
wie auch in der Wildnis gibt es vieles, was sich mit
Tanz hat alles, was Menschen bewegt – ein schöner, überzeugender
Slogan. Dennoch raten deutsche Väter ihren Söhnen, die den Wunsch
dem Verstand nicht greifen lässt. Beides, Musik und
äußern, zu tanzen oder gar ins Ballett zu gehen, bis heute verschwörer- Wildnis, sind für mich übersinnlich.“
isch, sich das besser noch einmal zu überlegen und lieber Fußball spiel- Claudine Schoch (Schweiz)
en zu gehen. Die Rollenzuschreibungen treiben in zeitgenössischen Ac-
tionfilmen immer monströsere Blüten, und sie gehen nicht nur auf das
martialische, und heute in hohem Maße lächerlich scheinende Männer-
bild von Kaiserzeit und Faschismus zurück, sondern – im weiblichen
Gegenentwurf – auch auf das gleichermaßen abschreckende Klischee
der ätherischen romantischen Ballerina, die nur noch mit der Spitze
ihres Fußes die Erde berührend im besten Fall einer Elfe, im schlech-
testen einer rachsüchtigen mordenden Wili gleich, die die dunklen
Wälder der Romantik bevölkerte. Heute schiebt sich überdies die er-
nährungsgestörte, selbstmordgefährdete Tänzerin vor das reale Bild der
modernen Künstlerin, die in der Welt ihre Frau steht, ihre Tänzerin-
nenkarriere von vornherein dual plant und auch für Mann und Kind
schon Zeit und Ort im Lebenskalender freigehalten hat.
Tanz ist also noch immer suspekt, falsche, überkommene Bilder
halten sich nicht nur als Inbegriff des Balletts, sondern des Weiblichen
schlechthin, beharrlich gegen jede moderne Erscheinungsform des
sportlich-durchtrainierten, gesunden Tänzer-Körpers, und das, obwohl
seit den 70er Jahren – einer Volksbewegung gleich – Laien beiderlei Ge-
schlechts in die Tanzstudios strömen, um sich mit klassischem Ballett
fit zu halten und Expressivität auszuleben. Natürlichkeit und Gesund-
heit der Bewegung, Hingabe, Emotion, Sinnlichkeit, die Vereinigung
von Physis und Psyche, Achtsamkeit und Empathie – Tanz hat alles, was
Menschen bewegt.
26 27Ursprünge Ursprünge
Wildheit und Tanz
von Bettina Wagner-Bergelt und Thomas Mayr
Interview: Till Meyer
Meyer: Neben unseren intellektuellen Fähigkeiten unterscheiden
wir Menschen uns von den anderen Menschenaffen durch den aufrechten
Gang und ganz konkret den gut ausgebildeten Gesäßmuskel Gluteus maxi-
mus, der ja bei den Pliés, den seitlichen Kniebeugen, eine wichtige Rolle
zu spielen scheint. Warum sind die Pliés beim Tanztraining überhaupt so
wichtig?
Mayr: Der Gluteus maximus ist einer der wichtigsten Außenrota-
toren für die Auswärtsdrehung der Beine. Pliés braucht man, um zu sprin-
gen, zu landen, aber auch Pirouetten einzuleiten und zu beenden, und die
Frauen brauchen sie, um auf die Spitze und von der Spitze zu gehen.
Meyer: Der schwebende, romantische Effekt wird im klassischen
Ballett durch das Tanzen auf den Fußspitzen erzielt. Offenbar haben aber
auch die Arme Bedeutung, um diesen Effekt zu erzielen. Wie werden beim
Ballett die Arme trainiert? Krafttraining mit Hanteln wäre da doch sicher
fehl am Platz.
Mayr: Ausschlaggebend für die Armbewegung, das Ports de
bras und das Épaulement, ist die Rückenmuskulatur, die die Arme stützt.
Épaulement ist Zusammenspiel von Kopfhaltung, Schulter, Rücken, Ar-
men, Hüften und Beinen. Das bestimmt die ganze künstlerische Linie und
damit die Wirkung beim Publikum. Zum Training des Port de bras reicht
das Eigengewicht der Arme in der Regel aus. Aber es gibt Tänzer, die beim
Stangentraining kleine Gewichte benutzen.
Meyer: Bei den Aufführungen und sogar beim Training haben
Tänzer häufig ein Lächeln im Gesicht. Ist das Lächeln nur aufgesetzt,
eingeübt für das Publikum, oder haben die Tänzer wirklich Spaß an ihrer
Arbeit?
Wagner-Bergelt: Tänzer lieben ihren Beruf. Sie sind keine ar-
Lucia Lacarra und Marlon Dino in “Giselle” 2007 im Nationalpark Berchtesgaden men malträtierten Seelen und Körper, die vor dem Publikum schnell ein
Lächeln über ihre Schmerzen legen, auch keine Masochisten, die sie ge-
28 29Ursprünge Ursprünge
nießen. Wenn man gute Proben hatte und dann auf der Bühne eine Rolle
tanzt – oder auch nur eine Variation – die man gern tanzen wollte, dann
machen eben nicht nur die modernen, organischen Bewegungen Freude,
sondern gerade auch die klassischen. Da sagen der Körper, der Blick, der
Gesichtsausdruck: Schaut her, schaut mich an, was ich hier mache, und
wie großartig ich es kann – und ich tue es für Euch! Und natürlich lächeln
die Tänzer dabei. Ansonsten lächeln sie hoffentlich nur, wenn es die Rolle
erfordert, Dornröschen, wenn es die vielen Bewerber um ihre Hand sieht,
die Kameliendame, als Armand ihr seine Liebe gesteht, und Julia, wenn
Romeo sie in die Arme schließt…
Meyer: Claudine Schoch, eines ihrer ehemaligen Companymit-
glieder, hat erklärt, dass für sie eine gewisse Wildheit und auch Aggres-
sion zum Tanz dazu gehört. Brauchen gute Tänzerinnen und Tänzer ein
gewisses emotionales Ungestüm, ein Quantum Wildheit, um ihre Darbie
tungen mit Bravour auszuführen?
Wagner-Bergelt: Die Wildheit, das Ungestüm, das Claudine
Schoch meint, bezeichnet man als Attacke, das heißt, die Tänzer „greifen“
tatsächlich an. Sie fokussieren das Publikum, konzentrieren ihren Blick da-
hin, schmeißen ihren Körper, sich selbst in den Tanz hinein, immer unter
der Kontrolle und im Rahmen der vorgegebenen Choreographie – schwer
zu beschreiben. Aber wenn ein Tänzer/eine Tänzerin keine Attacke hat,
nicht mutig und mit dem Bewusstsein des unendlichen Raumes und der
individuellen Empfindung der Zeit – also seiner eigenen Dynamik – in die
Bewegung hineinginge, wäre es einfach nur langweilig.
Im Nationalpark Bayerischer Wald 2004
30 31Geschichte, Religion und Kunst
Geschichte, Religion und Kunst Die Einheit von Natur und Kultur zerbrach in der Philosophie mit
dem von heutigen Naturschützern vielfach gescholtenen René Descartes
(1596-1650), mit dessen Trennung von Geist und Natur (res cogitans,
res extensa). Ab dem
Natur und Malerei 18. Jahrhundert be-
von Angelika Schneider schleunigte sich die in-
dustrielle Revolution.
Urbanisierung und in-
„Oh, Wildnis, oh Schutz vor ihr“ – in Elfriede Jelineks Titel zu dustrielle Landwirt
einem Prosatext, in dem es um die Entmystifizierung esoterischer Natur- schaft vertrieben die
verehrung geht, klingt die alte Angst des Menschen, eine rechte Ur-Angst, Wildnis. Gleichsam als
vor ungezähmter Natur an. Ständig bedroht Wildnis den Menschen, der Kontrast und Ventil
sich hinter Zäunen und in Hütten vor ihr in Sicherheit zu bringen sucht. dazu häuften sich in der
Leonardo da Vinci (1452-1519) kannte eine solche Angst nicht. Malerei die künstleri-
Er wusste: „La pittura è partorita da essa natura.” – Die Malerei ist aus der schen Abbildungen der
Natur geboren. wilden Natur. Beson
In seiner Zeit, der florentinischen Renaissance, löste das Studium ders die Berge wurden
der Naturgesetze den mittelalterlichen Mystizismus ab. Der Toskaner Leo als Gegenden des lust
nardo ging beherzt daran, der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen, durch vollen Erschauderns ent-
Frage und Experiment, Mathematik und Geometrie, durch das Sezieren deckt, und die wilde
von Leichen und die Konstruktion von Maschinen. Natur zum Quell „er-
Leonardo hinterließ neben seinen Gemälden Tausende von Ar- habener Gefühle“.
beitsblättern, die Zeugen seines allumspannenden Geistes sind. Für ihn Etliche Bilder ei
waren Kunst und Natur eins; die Inspiration des Künstlers musste an die ner Gruppe von Land-
Natur gebunden bleiben: „Der Maler muss mit seiner Kunst die Natur schaftsmalern fanden
nachahmen, die Zierde der Welt“. ihren Weg an die
Auf seinem berühmtesten Gemälde, der Mona Lisa, in Italien La Wände des Kapitols in
Gioconda (die Heitere) genannt, sind Kunst und Wissenschaft untrenn- Washington. Dort sol-
bar miteinander verwoben. Hinter den Schultern der Lisa tut sich eine von len sie einige Abgeord-
Bergen umrahmte Flussebene auf. Es ist das toskanische Arnotal, östlich nete entscheidend mit
der Berge des Chianti gelegen. Leonardo malte sie dal vero, „nach der dazu motiviert haben,
Wahrheit“; die Berge treten uns als Abbilder der Wirklichkeit entgegen, Naturlandschaften im
nicht als Symbol oder Metapher. Berge und Porträt waren für Leonardo Westen der USA als Na-
gleich bedeutsam, er wählte zwei verschiedene Fluchtpunkte für die Frau tionalparks unter den
im Vorder- und die Felsen im Hintergrund. Dies ruft im Betrachter eine Schutz des Gesetzes zu stellen. Mit dem Yellowstone Nationalpark wurde
unbewusste Irritation hervor, was zur Entstehung des Mythos des Bildes 1871 der erste Nationalpark der Welt gegründet.
beitrug.
32 33Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
Ludwig und Lola
König Ludwig I. von Bayern (1786–1868) liebte die Kunst und
liebte die Natur. Wichtiges Anliegen waren ihm „die Einheit
von Natur in der vorgegeben Kulturlandschaft“ sowie die „Ver
schwisterung von Geschichte und Natur“. Er reist nach Italien,
wandert wochenlang durch die Schweizer Alpen. Landschafts
maler wie Carl Rottmann, Johann Georg von Dillis begleiten
ihn. Was die Künstler im Auftrag von Ludwig schaffen, sind oft
schroffe und wilde Landschaften. Damit werden sie zu Trend
settern in der Kunstgeschichte: weg von der Natur als Symbo
lik, Ornamentik und Staffage, weg von den lieblich-barocken
Schäferidyllen – und hin zur Natur als Hort der schauerlichen
Faszination. Die Bilder sollten die Menschen an die Großartig
keit und Erhabenheit der Schöpfung erinnern – und das eigene
Dasein relativieren.
Nicht nur die Verklärung der Natur, auch deren ak
tiven Schutz machte Ludwig zur Chefsache. 1835 verhindert er
persönlich die Beseitigung einer Pappel in der Dachauer Straße
in München. Im Jahr 1840 erlässt Ludwig ein Verbot gegen den
Gesteinsabbau in der Weltenburger Enge. Das Dekret dürfte die
wichtigste Voraussetzung für die Gründung eines der ersten
Schutzgebiete in Bayern, dem Naturschutzgebiet „Weltenburger
Enge mit Donaudurchbruch“ im Jahr 1938 gewesen sein.
Ludwig war Romantiker. Er liebte die Schönheit, aber
auch das Abgründige daran. Dass der König sich 1846 (im Al
ter von 60 Jahren) auf eine Affäre mit der Tänzerin Lola Montez
einließ, die vorgab, „Balletttänzerin aus Andalusien“ zu sein,
passt gut in dieses Bild. Mit königlichem Protektorat durfte sie
sogar am Hof- und Nationaltheater ein paarmal vor Publikum
auftreten – und das, obwohl der damalige Intendant ihr zuvor
die Tür gewiesen hatte.
34 35Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
Wildnis und Schöpfung
von Gerhard Haszprunar
„Wildnis, das heißt Natur Natur sein lassen, das “Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns
ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des
heißt auch als Mensch, sich in Bescheidenheit und
Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf
Demut zu üben. Dazu müssen viele ihre Einstel dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes
lungen und Grundsätze ändern. Hier hat die schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.” (Gen 1, 26–27).
Kunst eine Aufgabe. Kunst ist viel mehr als nur Die Schöpfungserzählung der Bibel stellt nicht das Wie, sondern
Entertainment.“ das innere Wesen der Schöpfung dar. Sie definiert den Menschen – wohlge-
merkt, gleichwertig als Mann und Frau – als “Ebenbild Gottes”, der über
Vance Martin (USA) die Erde herrschen soll. Selten ist ein Schriftwort in der Geschichte der-
art verzerrt und missverstanden worden. Ein antiker Herrscher war näm-
lich zuallererst ein Beschützer seines Volkes, nicht sein Ausbeuter. Und
keineswegs ist damit gemeint, dass dieser Schöpfergott so aussieht wie
ein Mensch oder umgekehrt – es gilt ja das 2. Gebot “Du sollst dir KEIN
Bild von mir machen”. Nein, gemeint ist hier Funktionalität: Der Mensch
bekommt die Aufgabe, die Schöpfung nun als “Abbild“, d.h. Stellvertreter
Gottes zu bewahren.
In der Tat wird heute unter „Bewahrung der Schöpfung“ primär
der Schutz der noch verbliebenen Naturräume, zunehmend aber auch von
naturnahen Kulturen wie etwa einer Streuobstwiese als ethische Aufgabe
verstanden. Bedeutet das aber auch, dass „die Wildnis“ – sofern sie insbe-
sondere in unseren Breiten als solche überhaupt noch existiert – sich ganz
selbst zu überlassen ist, der Mensch als Schädling am besten ganz ausge
sperrt werden sollte?
„Man kann nur schützen, was man kennt.“ heißt es vielfach. Aber
viele Naturschützer sowie die Naturkundemuseen, für die ich hier schreibe,
haben gelernt, dass die Sache ein bisschen komplexer liegt: „Man wird nur
schätzen, was man kennt – und nur das schützen, was man zu schätzen
gelernt hat.“ Was heißt das konkret? Einerseits sind die Anstrengungen
der Bildungspolitik gerade im Bereich Naturkunde deutlich zu verstärken.
In der Schule, an außerschulischen Lernorten wie Naturlehrpfaden oder
Naturkundemuseen, in den gedruckten oder elektronischen Medien muss
der naturkundlichen Bildungserosion wirksam entgegen getreten werden.
36 37Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
Zugleich müssen wir aber auch die Wildnis erforschen, ihre Arten,
ihre Strukturen, ihre Wechselwirkungen, ihre Funktionen und ihre Sukzes-
sionsstufen. Wer weiß denn schon, dass Mangrovenwälder („Moskitobrut-
stätten“) der effektivste Schutz vor Flutwellen und Wellenerosion sind, wer
ahnt, dass gerade massives Totholz („Refugium der Forstschädlinge“) im
Alpenwald die beste Bremse für Lawinen darstellt? Nicht den Menschen
aussperren heißt die Devise, sondern behutsam und voller Staunen und
Ehrfurcht die Natur kennen und dadurch schätzen lernen.
Unbestritten, auch das noch Unbekannte verdient unseren Schutz,
unsere Fürsorge. Aber es wird umso leichter fallen, dieses Anliegen in der
Gesellschaft durchzusetzen, je mehr wir darüber wissen und dieses Wis-
sen auch vermittelt haben. Und mehr noch, nur intakte, aber erfasste
Naturflächen, verstandene Wildnis also, können uns lehren, ob und wie
weit Kulturflächen naturnah geblieben sind und wie gut verordnete Re-
naturierungsmaßnahmen tatsächlich gegriffen haben – erst der Vergleich
macht uns sicher.
„Wildnis wagen“ ist ein weiterer Gesichtspunkt. Gerade der
deutschen Seele fällt es schwer, im Garten oder gar im Park ein „Gestrüpp“
oder gar ein „schlampiges Eck“ zu dulden. Aber wo sollen sich Igel, Spitz-
maus und Äskulapnatter verkriechen, wo Tausendfüßer und Laufkäfer
überleben, wenn nicht zumindest gelegentlich Holzschnitthaufen oder
Grobkompost stehen bleiben? Bewahrung der Schöpfung heißt eben gele
gentlich auch mal einfach gewähren lassen.
Denn diese Wildnis, sei sie im eigenen Garten, im Nationalpark
oder in fernen Ländern, nützt nicht nur der Natur und ihren Organismen,
nein, sie macht auch Menschen glücklich – wenn sie wissen und erleben
können, was sie schützen und bewahren. Dabei müssen Herz, Hirn und
Hand zusammenspielen, Gefühl und Verstand das Tun anleiten. „Bal-
lett und Wildnis“ sind daher keine Gegensätze, sondern notwendige An-
tipoden des Seins, zusammengebracht zum Wohle der Schöpfung und
ihrer Geschöpfe, einschließlich des Menschen.
Totholz im Naturschutzgebiet Weltenburger Enge
38 39Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
Kirche und Wildnis
von Wolfgang Bischof, Interview Till Meyer
Meyer: Was lernen angehende Priester heute über das Herr-
schaftsgebot „Macht Euch die Erde untertan“?
Bischof: Unsere angehenden Priester und Mitarbeiter in der Seel-
sorge lernen das, was heute auch Wissensstand in der Theologie ist. Wir
dürfen nie vergessen, dass es eine Zeit gegeben hat, in der der Herrschafts
anspruch und manchmal auch der Ausbeutungsanspruch stark betont
worden sind – aber diese Zeiten sind vorbei. Wir machen mittlerweile
in der Theologie deutlich, dass der Mensch einen Gestaltungsauftrag hat.
Dieser kommt auch vom biblischen Verständnis des Königtums: Der König
Siting Qiu im Nationalpark Berchtesgaden hatte eine Hirtenaufgabe, eine sorgende Aufgabe, eine pflegende Aufgabe,
letztendlich die Aufgabe, Leben zu ermöglichen. Diese Aufgabe verbindet
sich mit dem Auftrag „Macht euch die Erde untertan“, aber im Sinn der
Pflege, des schöpferischen Weiterentwickelns.
Säkularisation und Wildnis Meyer: Wilde Natur hat für viele Menschen auch spirituelle Be-
Die Auflösung von Kirchen und Klöstern (Säkularisation) in deutung. Was sagt die Kirche dazu?
Deutschland als Folge der Französischen Revolution hatte einen Bischof: Da muss man eines klarstellen: Wenn es um Pantheismus
denkwürdigen Nebeneffekt: Viele Menschen suchten jetzt Gott geht, um eine Vergöttlichung der Natur, eine Vergöttlichung von Natur-
in der Natur. Der Philosoph Immanuel Kant glaubte, dass dem phänomenen, kann der christliche Glaube nicht mitmachen. Dass aber
Natur den Menschen dem Schöpfer näherbringen kann, dass man in der
Menschen „ein Drang innewohnt, sich wilder Natur auszusetzen,
Natur den Schöpfungsgedanken verinnerlichen und dadurch auch eine
um dadurch in sich ein Gefühl der Religiosität zu erzeugen.“
spirituelle Tiefe erreichen kann – da haben wir wieder eine Ebene, wo bei-
Künstler – wie die von Ludwig I. geförderten Landschaftsmaler –
des zusammengeht. Für die Kirche ist es wichtig, dass wir nicht in eine
aber auch Dichter und Schriftsteller der Romantik stellen die wil- Vergöttlichung der Natur hineingeraten, sondern: Die Natur ist Geschöpf
de und unbeherrschbare Natur oft dar als Quell von überwälti- des Schöpfers, Geschöpf Gottes, sie ist uns zur Verfügung gestellt, damit
genden Gefühlen (Erhabenheit) und innerer Einkehr (Katharsis). wir mit seinem Heilsplan in Berührung kommen.
Die Dichter und Denker hatten recht. Heute wissen Psychologen
und Soziologen, dass Wildnis auf Menschen einen reinigenden Meyer: Ist man in der Natur näher an Gott? Wie erleben Sie
Effekt haben kann. Die Konfrontation mit einer nicht von Men- persönlich die Natur in Bayern?
schen gestalteten und beherrschten Natur führt oft dazu, dass Bischof: Bayern ist gesegnet mit einer Natur, die einem das Herz
man moralisch auftankt, dass die inneren Werte gestärkt und höher schlagen lassen kann. Wir erleben in manchen Bereichen unseres
Sozialgefühle geweckt werden. Landes eine sehr ursprüngliche Natur, eine sehr ursprüngliche Begegnung
40 41Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
mit der Schöpfung Gottes. Das ist etwas Wunderbares. Wenn ich auf einen
Berg steige, wenn ich auf einem See segle – da komme ich mit der Natur Gruppe Ökologie
und mit der Schöpfung ganz unmittelbar in Berührung. Von daher kann Am 13. Mai 1972 trifft auf dem Bauernhof von Hubert
man sagen, dass Bayern sicherlich ein ganz besonderes Herzstück der Weinzierl im bayerischen Heiligenstadt ein bunter
Schöpfung Gottes ist. Haufen prominenter Naturwissenschaftler, Forstleute,
Naturschützer, Künstler und Publizisten zusammen, um
die „Gruppe Ökologie“ aus der Taufe zu heben. Zu den
35 Gründungsmitgliedern gehören neben Weinzierl,
Horst Stern, Wolfgang Schröder, Konrad Lorenz, Bern
hard Grzimek und Heinz Sielmann auch der Dirigent
Enoch zu Guttenberg und der Zoologe Josef Reichholf.
Mit der Forderung, in „einer offensiven Ausein
„Wildnis ist eine Reise zurück in die Kindheit. In andersetzung Politiker zu zwingen, naturwissenschaftli
der Jugend habe ich sehr viel Wildnis gesehen, che Grundkenntnisse nachzulernen“ bringt es die
erlebt und erwandert. Dann war ich 30 Jahre auf Gruppe Ökologie in diesem Jahr sogar auf die Titelseite
der Süddeutschen Zeitung.
der Bühne, und jetzt – die Konfrontation mit der Die Stimmung, die in jenen Jahren von der
Wildnis ist nicht nur wie ein Wiedersehen, es ist Gruppe Ökologie ausgeht, macht selbst vor dem „Tier
wie ein Aufladen.“ professor“ Bernhard Grzimek nicht Halt, der sich von
einer ungewohnt kämpferischen Seite zeigt und 1972
Ivan Liška (Tschechien) aus Enttäuschung über die Bonner Umweltpolitik sein
Amt als Bundesbeauftragter für Naturschutz hinwirft.
Für viel Munition in dieser Aufbruchstimmung
hatte nur wenige Wochen vor der Gründung der Gruppe
Ökologie der Report des „Club of Rome“ am 1. März
1972 in Washington gesorgt. Darin stellte der junge
Wissenschaftler Dennis Meadows „Die Grenzen des
Wachstums“ vor, ein Bericht, der viele liebgewonnene
Gewissheiten der Konsumgesellschaft in Frage stellte
und sich wie ein Lauffeuer in vielen Ländern verbreitete.
Die Stimmung und die neuen Erkenntnisse
trafen die Bayerische Staatsregierung nicht unvorberei
tet. In München war 1970 das „Bayerische Staatsmini
sterium für Landesentwicklung und Umweltfragen“
gegründet worden; nicht nur das erste Umweltministe
rium in Deutschland, sondern auch in Europa und welt
weit.
42 43Geschichte, Religion und Kunst Geschichte, Religion und Kunst
Nationalpark Bayerischer Wald von den Gesetzen der Natur – ist immer aufs Neue atemberaubend.
Als erster Nationalpark in Deutschland wurde der Nationalpark Bay Mit seiner entstehenden Waldwildnis und seinem Reichtum an un
erischer Wald 1970 gegründet. Im Südosten Bayerns, an der Grenze terschiedlichsten Biotopstrukturen bietet der Nationalpark vielen
zur Tschechischen Republik gelegen, erstreckt sich der Nationalpark gefährdeten Tier- und Pflanzenarten Zuflucht und neuen Lebens
über eine Gesamtfläche von rund 242 km2. Die drei Berggipfel Lusen raum. Luchs, Schwarzstorch, Auerhuhn, Wanderfalke und Fischotter
(1373 m), Rachel (1453 m) und Falkenstein (1315 m) prägen das Gesi haben hier ihre Heimat, genauso wie das Rotwild, viele Spechte und
cht des Nationalparks ebenso wie der nahezu die gesamte Fläche des Eulen und unzählige weitere Arten.
Parks bedeckende, vielgestaltige Wald und die darin eingebetteten Gemeinsam mit dem unmittelbar angrenzenden tschechi
Schachten (Weideflächen) und Moore. Die Dynamik der Waldentwick schen Nationalpark Šumava (Böhmerwald) bildet der Nationalpark
lung, die sich in der Naturzone des Parks seit mehr als vier Jahrzehn Bayerischer Wald das „Grüne Dach Europas“, eine von ihrer Größe
ten entfaltet – frei von Nutzungen durch den Menschen, gelenkt allein und Naturausstattung wie auch von ihrer geschichtlichen und kul
turellen Vielfalt her einzigartige Landschaft im Herzen Europas.
Im Zusammenwachsen der beiden Nationalparks wird auch ein
Stück der Wiedervereinigung Europas spürbar.
Pürstling im Nationalpark Šumava mit Blick
zum Lusen, Nationalpark Bayerischer Wald
44 45Naturschutz in Bayern
Naturschutz in Bayern Müller: All unsere bisherigen Forschungen haben gezeigt, dass
immer, wenn der Mensch das Wort Katastrophe in den Mund nimmt,
die biologische Vielfalt einer Waldlandschaft gewinnt. Diese Störungs
ereignisse, insbesondere, wenn wir sie nicht gleich wieder aufräumen,
Wildnis und Vielfalt schaffen wichtige und wertvolle Strukturen für viele Arten, die in unserer
von Jörg Müller / Interview: Till Meyer Kulturlandschaft gefährdet sind. Über alle taxonomischen Gruppen hin-
weg hat sich der Borkenkäfer im Nationalpark als Schlüsselart erwiesen
und die Artenvielfalt angehoben.
Meyer: Mit dem Sonderband “Biologische Vielfalt im Natio
nalpark Bayerischer Wald” haben Sie ein beeindruckendes Inventar der
Pflanzen- und Tierarten im Gebiet des Nationalparks vorgelegt. In diesem Carlos Salcedo de Zarraga
Zusammenhang fallen immer wieder Fachausdrücke wie “strukturelle
Komplexität” oder “funktionelle Struktur”. Was bedeuten diese Begriffe?
Müller: Bäume und Totholz bieten viele verschiedene Strukturen,
je nach Art, Durchmesser, Feuchte und Zersetzungsgrad. Je mehr ver-
schiedene Typen hier auftreten, desto mehr Lebensräume sind vorhanden.
Je mehr Lebensräume vorhanden sind, desto mehr Arten können in einem
Wald leben. Funktionale Strukturen sind Elemente, die mit bestimmten
Ökosystemfunktionen eng verknüpft sind. So stellt eine Baumhöhle nicht
einfach ein Loch im Holz dar, sondern bietet Nistlebensraum für Eulen
oder auch Insektenarten.
Meyer: Sie hatten im Frühjahr Besuch von Daniel Donato, einem
amerikanischen Forscherkollegen, der neue Erkenntnisse zur Entwicklung
aus USA mitgebracht hat.
Müller: Seine Kernaussage zum Nationalpark war, dass nach
Störungen vielfältigere Lebensräume entstehen können, wenn wir Men-
schen uns nicht einmischen. Dabei ist entscheidend, dass die Waldverjün- Meyer: Kann die Forstwirtschaft aus den Erkenntnissen im Na-
gung zeitlich und räumlich sehr differenziert abläuft. Daraus entsteht über tionalpark Bayerischer Wald lernen?
Zeiträume von 50 Jahren ein neuer heterogener Wald mit hohem Wert Müller: Die wichtigsten Erkenntnisse sind, dass Störungs
für den Naturschutz. Interessant war auch seine Feststellung, dass junge ereignisse, die man sowieso nicht verhindern kann, auch im Wirtschafts
Sukzessionsstadien nach Käferbefall und Windwurf eine ganze Reihe von wald zur Steigerung der Artenvielfalt genutzt werden können, selbst wenn
Eigenschaften alter Wälder aufweisen, wie z.B. Lücken, Totholz oder Wur- dort klar ökonomische Ziele dominieren. Daneben deutet sich an, dass
zelteller. natürlich verjüngte Wälder strukturreicher und auch risikosicherer in der
Meyer: In den Zeiten des Klimawandels kommt es weltweit ver- Zukunft werden. Die langen Gradienten im Nationalpark, z.B. bezüglich
mehrt zu außergewöhnlichen Ereignissen wie großflächigen Windwür- Totholzmengen, erlauben zusätzlich, Informationen zu bekommen, wo
fen und Waldbränden. In den Fernsehnachrichten heißt es dann, dass so kritische Schwellenwerte für bedrohte Arten liegen. Diese Erkenntnisse
Wälder “zerstört” oder “vernichtet” worden seien. Forscher im National- werden aktuell genutzt, um integrative Naturschutzstrategien in genutzten
park sprechen dagegen nüchtern von “ Störungsereignissen”. Wäldern umzusetzen.
46 47Naturschutz in Bayern Naturschutz in Bayern
Meyer: Welche Gebiete innerhalb der vom Menschen weitgehend
ungenutzten Naturzonen sollten Besucher des Nationalparks als „Hot- “Wildnis heißt, sich an der Natur und den Dingen
spots der Artenvielfalt“ unbedingt kennenlernen? Können Sie bestimmte zu erfreuen, die sie uns schenkt. Wildnis genießt
Führungen durch Ranger empfehlen?
Müller: Hier gibt es eine ganze Reihe an Highlights. Sicherlich ist
man zwar am besten gemeinsam, aber auch allein
eine Wanderung über den Rachel mit seinen totholzreichen Waldbeständen ist Wildnis etwas Wunderbares. Allein zu sein in
und vorbei am Urwald am Rachelsee eine Spezialität. Aber auch im Fal der Wildnis heißt, eins zu sein mit der Erde. Wenn
kenstein-Gebiet kann man Urwaldbestände hinter dem Zwieslerwaldhaus man dann flach auf dem Waldboden liegt und in
und spannende, belassene Windwürfe hinter dem Ruckowitzschachten den Sternenhimmel blickt, ist es, als ob Mutter Erde
besuchen. Hochattraktiv ist auch das Gebiet ganz im Südosten zwischen dich umarmt. Jeder sollte das mal erlebt haben.”
Buchwaldstraße und Reschbachklause. Mit etwas Glück lassen sich hier
Haselhuhn und Kreuzotter beobachten. Ryan Ocampo (Philippinen)
Prozessschutz
Wildnis heißt, der Natur die Freiheit der unbeeinflussten Entwicklung
zurückzugeben. „Prozessschutz“, so lautet die offizielle Bezeichnung
für diese Naturschutzstrategie, die evolutionäre Prozesse zulassen soll.
Was das bedeuten kann, wurde 1983 deutlich, als große Sturmwurf
flächen im Nationalpark Bayerischer Wald der natürlichen Entwicklung
überlassen wurden. „Natur Natur sein lassen“, so nannte der damalige
Nationalparkleiter Dr. Hans Bibelriether das, was viele als „verantwor
tungsloses Experiment“ bezeichneten.
Heute ist klar, dass dieses Experiment ein Glücksfall war. An
gesichts des Klimawandels werden wir Zeuge, wie neue Lebensge
meinschaften entstehen und ungeahnte Beziehungsgeflechte zwi
schen Pflanzen und Tieren geknüpft werden. „Natur Natur sein lassen“
ist heute das Motto aller Nationalparks der Bundesrepublik.
Allerdings gibt es einen Haken. „Prozessschutz“ bedeutet
auch „das Aufrechterhalten von Veränderungen in Form von dynami
schen Erscheinungen auf der Ebene von Arten, Biozönosen, Bio- oder
Ökotopen, Ökosystemen und Landschaften.“ Mit anderen Worten: Die
ökologische Veränderungsdynamik macht nicht Halt vor Nationalpark-
und auch nicht vor Ländergrenzen. Eine Erkenntnis, die natürlich auch
für Borkenkäfer und Braunbären gilt. Die Strategie kann dann von der
„Aufrechterhaltung“ durch Nicht-Eingreifen übergehen zum „Manage
ment“ durch Eingreifen.
48 49Sie können auch lesen