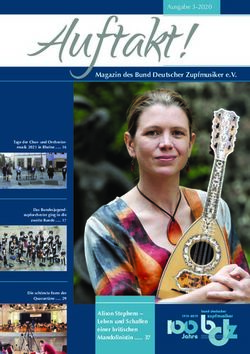Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich - Deloitte.Radar 2016
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Chancen entstehen
im Kopf
Mit dem Deloitte.Radar analysieren Mit dem Deloitte.Radar 2016 blicken wir
wir seit drei Jahren die Attraktivität des gemeinsam mit anerkannten Persönlichkeiten
Wirtschaftsstandortes Österreich. Dieser ist für selbst in den Spiegel: Welche mutigen
unsere Kunden, für unsere 1.200 Mitarbeiter, Schritte wollen und können wir für
sowie für uns selbst Lebensraum und zukünftige Chancen setzen?
-grundlage. Diese Chancen entstehen zu allererst in unseren
Es kann niemandem gleichgültig sein, wie Köpfen. Wir freuen uns daher, wenn Sie uns
wir uns im Wettbewerb mit einer immer auch an Ihren Gedanken und Meinungen dazu
stärker vernetzten globalen Welt behaupten teilhaben lassen (radar@deloitte.at).
und ob wir das mögliche Potenzial unseres Im Namen aller, die an diesem Projekt
Landes sowie unserer Wirtschaft auch mitgewirkt haben, wünschen wir Ihnen eine
tatsächlich zur vollen Entfaltung bringen. spannende Lektüre und bedanken uns für Ihr
Mit dem gebündelten Know-how in den Interesse.
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung,
Consulting und Financial Advisory tragen wir Ihr/Ihre
tagtäglich dazu bei, das Vertrauen und die
Bernhard Gröhs Claudia Fritscher
Zuversicht in die Wirtschaftskraft Österreichs Managing Partner Chairwoman
zu stärken. Nur wenn wir die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Herausforderungen in
unserem Land mutig und entschlossen lösen,
fördern wir auch für künftige Generationen
den Wohlstand.Cockpit
Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs
1 Politisches und hat sich 2015 weiter verschlechtert: Der
Indexwert über die sieben von Deloitte
makroökonomisches Politisches und makro- bewerteten Standortfaktoren sinkt von
Umfeld ökonomisches
Umfeld
Tendenz
3,00 im Jahr 2014 auf 2,86 von fünf
Vorjahr
Österreich sieht sich aktuell mit einer der möglichen Punkten. Dies ist auf die Ver-
geringsten Wachstumsraten Europas, schlechterung der makroökonomischen
sinkenden Investitionen und einer hohen Gesamtsituation zurückzuführen.
Staatsverschuldung konfrontiert. Die
gute Beschäftigungssituation wird durch
2
einen anhaltenden Anstieg der Arbeits-
Unternehmensinfra-
losigkeit getrübt. Die Bewertung sinkt
struktur und Umfeld
gegenüber dem Vorjahr – kurzfristig ist Unternehmens-
keine Besserung in Sicht. infrastruktur und Mit seiner gut ausgebauten allge-
S 14 Umfeld Tendenz
Vorjahr meinen Infrastruktur zählt Österreich
zu den hochentwickeltsten Standor-
ten. Beim raschen technologischen
3 Regulatorisches
Umfeld
Fortschritt und der dafür notwendi-
gen IKT-Infrastruktur besteht jedoch
noch Aufholbedarf auf die führenden
Die regulatorischen Auflagen werden als
Innovationsstandorte – hier darf der
größtes unternehmerisches Risiko und
Anschluss nicht verpasst werden.
Investitionshemmnis wahrgenommen. Regulatorisches
Österreich fällt dabei im europäischen Umfeld S 20
Vorjahr Tendenz
Vergleich durch einen anhaltend
hohen Bürokratieaufwand, viele
4
Einzelregelungen und vergleichsweise
wenig Flexibilität auf – eine Ent- Kosten
spannung ist noch nicht zu erwarten.
S 28 Österreichs Fiskalpolitik schneidet im
Ö
internationalen Wettbewerb sowohl
hinsichtlich der hohen Steuer- und
Abgabenbelastung als auch bei der
5 Innovation, Forschung Kosten
Vorjahr Tendenz Bewertung der Lenkungseffekte
und Technologie schlecht ab. Die Steuerreform war
Österreich zählt zu den überdurch-
Ö ein erster Schritt zur Entlastung des
schnittlich starken Forschungs- und Faktors Arbeit, allerdings mit einer
Innovationsstandorten in Europa und überwiegend einnahmenseitigen
konnte in den letzten Jahren die Innova- Gegenfinanzierung.
S 34
tionseffizienz kontinuierlich verbessern.
Für eine dynamische Startup-Szene sind
der Abbau bürokratischer Hürden und Innovation, Forschung
und Technologie
die Förderung einer stärkeren Private
Equity-Kultur essentiell.
S 38
Vorjahr Tendenz
6 Verfügbarkeit von
Arbeitskräften
Seit Jahren steht eine steigende Ar-
beitslosigkeit bei geringer qualifizierten
und älteren Arbeitnehmern den Eng-
7 Lebensqualität
Materieller Wohlstand und die Verfügbarkeit von
pässen bei gut ausgebildeten Arbeits-
und Fachkräften gegenüber. Österreich
hat die große Herausforderung zu
Arbeitskräften meistern, weitere Erwerbspotenziale
Qualität des Lebensstandards sind
Vorjahr Tendenz zu erschließen und das Bildungsniveau
überdurchschnittlich stark ausgeprägt.
kontinuierlich zu steigern.
Beim subjektiven Wohlbefinden
und bei der Einschätzung künftiger S 46
Möglichkeiten liegt Österreich jedoch
hinter vergleichbaren Staaten zurück,
z Dringender Handlungsbedarf
wodurch die hohe Lebensqualität in zz Handlungsbedarf
der Wahrnehmung vieler in Gefahr ist. zzz Gute Basis für notwendige Verbesserung
zzzz Standortvorteil mit Verbesserungspotenzial
S 54 zzzzz Klarer Standortvorteil
Lebensqualität
Vorjahr TendenzSchlüsselfaktoren geortet
Die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes beruht auch in hohem Maße auf der kollektiven Wahrnehmung und Stimmung in der
Bevölkerung. Politik, Unternehmer, Arbeitnehmer und die Gesellschaft als Ganzes müssen sich bewusst sein, auf welche Faktoren es
gerade jetzt ankommt. Wir haben die wesentlichen Ansatzpunkte zusammengefasst.
Mut zukunftsorientierten
zu Investitionen
Mut Vereinfachung
Mut Transparenz Fokus auf markterweiternde Investitionen zu
zu und Reformen von Staat und Unternehmen durch
• Konzentration auf digitale und • Umsetzung der staatlichen
• Konsolidierte Darstellung aller öffentli- physische Produktinnovationen Aufgabenreform zur Deregulierung
chen Finanzen von Bund und Ländern und Entbürokratisierung
• Infrastrukturerweiterungen statt
• Kompetenz- und Aufgabenreform zur reiner Ersatzinvestitionen • Neuregelungen als Chance für
Beseitigung von Doppelgleisigkeiten, Reduktion und Vereinheitlichung
dadurch Reduktion der • Schaffung von Freiraum
Verwaltungskosten und Konzentration auf die
• Reinvestition der frei werdenden wertschöpfenden Aktivitäten
Mittel in Bildung, Forschung und
Infrastruktur
Mut sozialer Mut Risiko
zu Verantwortung zu und Innovation
• Steigerung der Achtsamkeit jedes • Erleichterung des Zugangs
Einzelnen und stärkeres Bewusstsein zu Risikokapital und
für gesellschaftliche Entwicklungen Abschreibungsfähigkeit für
• Wertschätzung und Ausbau des Risikoinvestments
zivilgesellschaftlichen Engagements • Vereinfachung des
sowie der sozialen Verantwortung F&E-Fördersystems als
vieler Unternehmen und Bürger Innovationsmotor vor allem
• Wahrung und nachhaltige Verbesserung im KMU-Bereich
bzw. Modernisierung des österreich- • Etablierung einer „Kultur des
ischen Sozialstaates Scheiterns“ und Verankerung
eines breiten „Unternehmer-
Mindsets“ in der Gesellschaft
Mut Modernisierung Mut SStrukturbereinigung
zu der Arbeit zu und Modernisierung
• Flexibilisierung der Arbeit hinsichtlich Zeit, Ort • Weitere Entlastung der Arbeitskosten,
und Compensation, unter Nutzung technischer Gegenfinanzierung über strukturelle
Möglichkeiten und vor einem zeitgemäßen recht- Maßnahmen
lichen Rahmen • Vereinfachung des Steuerrechts durch
• Kontinuierliche Anpassung des (Weiter-)Bildungs- Reduktion von Ausnahmen
angebots hinsichtlich Skills, Mindset und Technologie • Besonderes Augenmerk auf Rechtssicherheit
• Bewusste Nutzung und Förderung der Erwerbs- und investitionsfördernde Maßnahmen in der
und Kompetenzpotenziale von Frauen, älteren Steuerpolitik
Arbeitnehmern und MigrantenAuf den Punkt gebracht Deloitte.Radar 2016 – Mehr Mut und neue Chancen für den Wirtschaftsstandort Österreich Der Befund zur Wettbewerbsfähigkeit Österreichs war in den letzten Jahren ernüchternd – der Standort geriet gegenüber den Top-Volkswirtschaften zunehmend ins Hintertreffen. Gleichzeitig sorgen globale und kaum beeinflussbare Entwicklungen – minimales Wirtschaftswachstum, niedrige Zinsen, Migration und Digitalisierung – für eine pessimistische Stimmung, Unsicherheit und gefühlten Stillstand. Das führt zu einer zögerlichen und zurückhaltenden Grundeinstellung der Menschen in unserem Land, wodurch eine positive wirtschaftliche Entwicklung verhindert wird. Umgekehrt liegen zahlreiche Rezepte und Ideen vor, wie es wieder aufwärts gehen kann. Und viele Unternehmen sowie die Zivilgesellschaft zeigen, wie konkretes Anpacken eine positive Wirkung entfalten kann. Wir sind davon überzeugt: Für eine Trendumkehr fehlen nicht die Ideen. Der Schlüssel liegt im Mut jedes Einzelnen – für Veränderungen, neue Wege und Entschlossenheit. Dann wird die Wirtschaft wieder vermehrt investieren und es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Denn Wirtschaften heißt immer auch Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Es braucht den Glauben an eine positive Zukunft, an Chancen für wirtschaftlichen Einsatz und unternehmerischen Erfolg. Mit dem Deloitte.Radar leistet Deloitte Österreich einen Beitrag dazu. Mögen viele weitere folgen.
Impressum Herausgegeben von Deloitte Österreich, Renngasse 1/Freyung, 1010 Wien, Bernhard Gröhs (Managing Partner) Projektleitung: Christian Radauer Autoren und Redaktion: Armin Nowshad, Marie-Therese Praniess, Verena Moosbrugger mit den jeweiligen Fachexperten und ihren Teams Koordination und Beratung: Melinda Mihóczy, Sepp Tschernutter (klar.) Layout und Satz: Ilse Barth
Inhalt
EXPERTENRAT
04
GLOBALER STANDORT-WETTBEWERB
06
WIE ATTRAKTIV IST DER STANDORT ÖSTERREICH?
12
1. POLITISCHES UND MAKROÖKONOMISCHES UMFELD
14
2. UNTERNEHMENSINFRASTRUKTUR UND UMFELD
20
3. REGULATORISCHES UMFELD
28
4. KOSTEN
34
5. INNOVATION, FORSCHUNG UND TECHNOLOGIE
38
6. VERFÜGBARKEIT VON ARBEITSKRÄFTEN
46
7. LEBENSQUALITÄT
54
METHODIK
60
Die in einer geschlechtsspezifischen Form verwendeten Begriffe, Bezeichnungen
und Funktionstitel gelten selbstverständlich jeweils für beide Geschlechter.
Deloitte Radar 2016 | 3Expertenrat – gemeinsam für den Standort Österreich
Im dritten Jahr des Deloitte.Radar wurde der inhaltliche Austausch mit anerkannten Persönlichkeiten aus Wissenschaft
und Wirtschaft aufgenommen, um wesentliche Aussagen zum Standort umfassender zu beleuchten. Die Mitglieder des
Expertenrates haben ihrerseits bereits bewiesen, dass man durch Eigeninitiative und Mut vieles schaffen kann.
Genau das benötigen wir auch für Österreich: Chancen und Zukunftspotenziale entstehen im Kopf – für die Umsetzung
braucht es aber insbesondere Mut.
Dkfm. Frank Hensel
(Vorstandsvorsitzender der Rewe International AG)
„Die Bildungsreform ist ein erster richtiger
Als Vorstandsvorsitzender der REWE International AG verantwortet Schritt. Wenngleich noch vieles zu tun ist, ist vor
Frank Hensel die Geschäfte der Handelsfirmen BILLA, MERKUR, BIPA a
allem die „klimatische“ Auswirkung der Reform
und ADEG, den Zentraleinkauf, die Eigenmarken, inklusive der Bio- --dass es nämlich in Österreich auch in festge-
Marke Ja! Natürlich und der Weinkellerei Wegenstein, die Revision,
die Unternehmenskommunikation, die Bereiche Nachhaltigkeit und fahrenen Bereichen Bewegung geben kann –
Personal/Personalentwicklung sowie den Vollsortimentsbereich der von großer Bedeutung.“
REWE Group in Italien.
Mag. Georg Kapsch „Österreichs Wirtschaft ist grundsätzlich bereit zu
(Unternehmer, Präsident der Industriellenvereinigung)
investieren. Aber solche Investitionen müssen wie-
Seit Juli 1989 ist Georg Kapsch Mitglied des Vorstands der Kapsch
AG und seit Oktober 2001 deren CEO. Weiters ist er seit 2000 CEO der leistbar werden und sich auch lohnen. Nur so
der Kapsch Group Beteiligungs GmbH und wurde im Dezember 2002 kann das Überleben der österreichischen Unterneh-
zum Mitglied des Vorstands der Kapsch TrafficCom AG ernannt und
ist seitdem auch deren CEO. Im Juni 2012 wurde Georg Kapsch zum
men langfristig sichergestellt werden. Und eines ist
Präsidenten der Industriellenvereinigung gewählt. klar, nur Unternehmen schaffen Arbeitsplätze.“
„Österreich braucht eines ganz besonders: Eine aus-
Prof. Dr. Christian Keuschnigg
(Professor der Volkswirtschaftslehre in St. Gallen,
geprägte Risikokultur. Vor allem ein ausbalancierter
Direktor des Wirtschaftspolitischen Zentrums Wien) Kapitalmarkt kann nur mit Risikokapital funktionie-
Christian Keuschnigg ist Professor für Nationalökonomie an der Uni- rren – und davon gibt es gerade für Startups noch
versität St. Gallen und Direktor des Wirtschaftspolitischen Zentrums in vviel zu wenig. Es braucht aber viele Gründungen,
Wien. Von 2012 bis 2014 leitete er das Institut für Höhere Studien in
Wien. Keuschniggs Forschungsinteressen betreffen u.a. Steuerreform, damit einige wenige zu wirklich großen Unter-
Wachstum, Unternehmensfinanzierung, Kapitalmarktentwicklung, nehmen heranwachsen und neue Impulse für die
Alterung, Arbeitsmarkt sowie die Internationalisierung der Wirtschaft.
Wirtschaft des Landes geben können.“
Mag. Dr. h.c. Monika Kircher „Die Erhöhung der Forschungsprämie ist ein klares
(Innovationsexpertin, Gründerin der Initiative für Kärnten,
ehem. Vorstandsvorsitzende von Infineon)
Signal an forschende Unternehmen und Institute –
Monika Kircher war von 2007 bis 2014 Vorstandsvorsitzende der damit wird das Vertrauen in die Rahmenbedingun-
Infineon Technologies Austria AG. Sie ist Gründerin der Initiative für g
gen am Standort gestärkt. Das kann aber nur einer
Kärnten, deren Ziel es ist, dem Bundesland Kärnten wieder zu dem
Stellenwert zu verhelfen, der diesem eigentlich zusteht. Das besondere
von vielen Schritten sein, um die Attraktivität Öster-
Engagement von Monika Kircher gilt seit langem der Forcierung reichs zu erhöhen. Die Errichtung der gemeinsamen
familienfreundlicher Rahmenbedingungen in Unternehmen und der Plattform Industrie 4.0 weist hier in die Zukunft.“
Förderung von Frauen, gerade in technischen Berufen.
DDr. Regina Prehofer
(Finanzexpertin, diverse Aufsichtsratsmandate, „Die Umsetzung der Reform der Verwaltungsgerichts-
ehemalige WU Vizerektorin für Finanzen und Infrastruktur)
b
barkeit und die Überführung in einen zweistufigen Ins-
Regina Prehofer war von 2011 bis 2015 Vizerektorin für Finanzen
und Infrastruktur an der Wirtschaftsuniversität Wien. Davor war sie in ttanzenzug geht genau in die richtige Richtung: Entlas-
mehreren Vorstandspositionen, unter anderem für die Bank Austria ttung, Vereinfachung und klare Strukturen – Österreich
Creditanstalt AG und die BAWAG P.S.K. Heute ist Regina Prehofer als braucht mehr von solchen gelungenen Reformen.“
Aufsichtsrätin einer Reihe von namhaften Unternehmen tätig.
Dr. Eveline Steinberger-Kern „Österreich braucht kluge Infrastrukturinvestitionen,
(Expertin für Energiewirtschaft, Gründerin der Blueminds-Company) um in den Stärkefeldern zum Top-Standort zu wer-
Eveline Steinberger-Kern ist Gründerin und Geschäftsführerin von The
Blue Minds Company GmbH, einem innovativen Beratungs- und Re-
d
den. Mit voranschreitender digitaler Transformation
search-Unternehmen, das sich mit der Transformation des Energiesys- ssehe ich diese vor allem in der Bioökonomie, im Ma-
tems beschäftigt. In der Energie Burgenland AG und UniCredit Bank n
nagement und Aufbau dezentraler und erneuerbarer
Austria AG hält Eveline Steinberger-Kern Aufsichts- und Verwaltungs-
ratsmandate.
Energieanlagen sowie in der Prozesseffizienz in den
österreichischen Grundindustrien.“
4 | Deloitte Radar 2016In einem offenen Diskurs hat sich der Expertenrat mit den positiven und negativen Entwicklungen am heimischen
Wirtschaftsstandort auseinandergesetzt und diese auf den Punkt gebracht. Dabei zeigt sich das durchaus
ambivalente Bild des Wirtschaftsstandortes – mit vielen Vorzügen, aber auch klaren Handlungsfeldern.
Politisches und Makroökonomisches Umfeld
+ E-Government: in diesem Bereich ist Österreich führend _ Staatshaushalt: mangelnde Budgetdisziplin, dringender
Investitionstätigkeit des Staates: zukunftsorientierte Reformbedarf
+ _
Ausgaben, wie Breitbandmilliarde und Hochschulmillionen Pensionssystem: fehlende Nachhaltigkeit, inkonsequente
Generationenpolitik
_ Verteilungspolitik: hohe Förderungstätigkeit, fehlende Trans-
parenz und Nachvollziehbarkeit
_ Föderalismus: unklare Kompetenzverteilung lähmt Reformen
_ Finanzmarktpolitik: fehlendes Leitkonzept zur Erhöhung
der Bedeutung des Finanzplatzes Österreich
Unternehmensinfrastruktur und Umfeld
+ Energiepolitik: erneuerbare Energien, Elektromobilität und _ Infrastrukturstrategie: mangelnde Rechts- und
Energieeffizienzgesetz als Investments in eine nachhaltige Planungssicherheit bei großen Infrastrukturprojekten
Zukunft
+ Qualität der Infrastruktur: hohes Niveau und Sicherheit
der bestehenden Netze und Services
Regulatorisches Umfeld
§ + Verwaltungsgerichtsbarkeit: größte Reform seit 1920, _ Bürokratie: komplexe Gesetzgebung und überbordende
dadurch Vereinfachung der Verfahren, klare Strukturen Regularien
und Entlastung der Verwaltung _ Komplexität: Vielzahl von Regularien auf allen Ebenen
+ Aufgabenreform: erste Umsetzungsschritte der (EU, Bund, Länder & Gemeinden)
Deregulierungskommission
Kosten
+ Lohnnebenkostensenkung: Faktor Arbeit erstmals +
_ Steuerreform: längst fällige Tarifreform und weitere
entlastet, aber noch immer vergleichsweise hoch besteuert gute Lenkungseffekte, aber teilweise durch Gegenfinan-
+ Eigenkapitalzufuhr an Unternehmen: nun ohne zierung konterkariert
Steuerbelastung _ Steuern & Abgaben: überwiegend einnahmeseitige
Finanzierung des Staatshaushalts
Innovation, Forschung und Technologie
+ Forschungsprämie: Erhöhung macht F&E-Standort +
_ Kapitalbeschaffung: verbesserter Zugang für KMU
Österreich attraktiver durch Crowdfunding-Gesetz, Risikokapital für innovative
+ Innovationseffizienz: Verhältnis von Input und Output ist Unternehmen dennoch knapp
seit Jahren steigend
Verfügbarkeit von Arbeitskräften
+ Arbeitnehmerflexibilität: sie tragen Beschäftigungs- +
_ Bildungsreform: zusehends im Fokus und positive
schwankungen mit, stärken die Krisenrobustheit und Ansätze, aber langwieriger Prozess
leisten Beitrag zur Beschäftigungssicherheit _ Arbeitsrecht: relativ strenge und unflexible Rahmen-
+ Hochschulbereich: positiver Effekt durch Investitionen bedingungen und negative Effekte durch das Lohn- und
erkennbar Sozialdumpinggesetz
+ Bildungsinitiativen: Potenzialentwicklung und neue
Lernformen gewinnen an Bedeutung
Lebensqualität
+ Gemeinnützigkeitsgesetz: Förderung von Wohltätigkeit _ Polarisierung in der Gesellschaft: zunehmendes
durch neues Gesetz, bringt Impulse für wirtschaftliche und Auseinanderdriften von Meinungen und Bevölkerungs-
soziale Innovationen gruppen
+ Zivilgesellschaftliches Engagement: Selbstorganisation in
der Zivilgesellschaft hilft bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise
Deloitte Radar 2016 | 5Globaler
Standort-Wettbewerb
Die Standortvergleiche renommierter Institutionen
veranschaulichen und reihen Volkswirtschaften
Internationale Standortrankings nach diversen Faktoren. Als Basis dienen sowohl
volkswirtschaftliche Kennzahlen als auch qualitative
sehen die Schweiz, die USA und Umfragen unter Wissenschaftlern, Managern und
Entscheidungsträgern. Da bei den Wirtschaftsdaten
Singapur an der Spitze – in einer oftmals auf dieselben Quellen zurückgegriffen wird,
kommt in den Indizes den Einschätzungen und
breiteren Betrachtung gelten Prognosen der Befragten eine hohe Bedeutung zu.
Die mehrjährige Betrachtung von fünf anerkannten
besonders die skandinavischen Standortrankings im Deloitte.Radar zeigt, dass dabei
die Attraktivität einiger Wirtschaftsstandorte von
Länder als Benchmark. einer sehr breiten Wahrnehmung gedeckt ist. Die
Schweiz und Schweden nehmen seit Jahren in allen
Die Weltwirtschaft hat seit 2007/2008 mit einer Indizes eine Top 10-Platzierung ein. Auch die USA,
„Dauerkrise“ zu kämpfen, die von Verunsicherung, die Stadtstaaten Singapur und Hong Kong, viele
Vertrauensverlust und sich fundamental ändernden nord- und mitteleuropäische Staaten sowie Kanada
Parametern begleitet wird. Damit werden im und Neuseeland sind in allen untersuchten Rankings
globalen Wettbewerb der Wirtschaftsstandorte die unter den Top 20 gereiht.
Karten neu gemischt. Innovative und reformwillige
Volkswirtschaften profitieren, während andere Gefahr
laufen ihren Wohlstand mittelfristig zu verspielen.
Anzahl der Platzierungen 2015
z in den Top 10 z in den Top 20
Schweiz zzzzz Japan zzzz
Schweden zzzzz Irland zzzz
USA zzzzz Australien zzz
Dänemark zzzzz Island zzz
Finnland zzzzz Belgien zzz
Singapur* zzzz Österreich zzz
Deutschland zzzzz Vereinigte Arab Emirate* zz
Niederlande zzzzz Katar* zz
UK zzzzz Taiwan zz
Norwegen zzzzz Malaysia zz
Kanada zzzzz Korea, Rep. z
Luxemburg zzzzz Frankreich z
Hong Kong* zzzz Spanien z
Neuseeland zzzz Quellen: Global Competitiveness Index 2015
World Competitiveness Index 2015
Global Innovation Index 2015
Corruption Perceptions Index 2015
Verbesserung gegenüber Vorjahr
OECD Better Life Index 2015
Verschlechterung gegenüber Vorjahr
*beim OECD Better Life Index nicht bewertet
6 | Deloitte Radar 2016Österreich büßt im internationalen Wettbewerb Plätze ein
In den beiden umfassendsten Standortvergleichen (Global Corruption Perceptions Index, Better Life Index) reicht es hingegen
Competitiveness Index, World Competitiveness Index) ist die einst für Plätze zwischen 16 und 18. In den Bereichen Innovation
unter den Top 15 gereihte Alpenrepublik nicht mehr unter den Top und Anti-Korruption gab es bereits das zweite Jahr in Folge
20 zu finden. In den spezifischeren Indizes (Global Innovation Index, Verbesserungen im Ranking (siehe nächstes Kapitel).
Top-Nationen in internationalen Standortrankings
Rang Global World Global Innovation Corruption Better Life Index
Competitiveness Competitiveness Index (INSEAD) 2015 Perceptions Index (TI) (OECD) 2015
Index (WEF) 2015 Index (IMD) 2015 2015
1 Schweiz USA Schweiz Dänemark Australien
2 Singapur Hong Kong UK Finnland Schweden
3 USA Singapur Schweden Schweden Norwegen
4 Deutschland Schweiz Niederlande Neuseeland Schweiz
5 Niederlande Kanada USA Niederlande Dänemark
6 Japan Luxemburg Finnland Norwegen Kanada
7 Hong Kong Norwegen Singapur Schweiz USA
8 Finnland Dänemark Irland Singapur Neuseeland
9 Schweden Schweden Luxemburg Kanada Island
10 UK Deutschland Dänemark Deutschland, Finnland
Luxemburg, UK
11 Norwegen Taiwan Hong Kong Niederlande
12 Dänemark Vereinigte Arab. Emirate Deutschland Irland
13 Kanada Katar Island Australien, Island Deutschland
14 Katar Malaysia Korea, Rep. Belgien
15 Taiwan Niederlande Neuseeland Belgien Luxemburg
16 Neuseeland Irland Kanada Österreich, USA UK
17 Vereinigte Arab. Emirate Neuseeland Australien Österreich
18 Malaysia Australien Österreich Hong Kong, Irland, Japan Frankreich
19 Belgien UK Japan Spanien
20 Luxemburg Finnland Norwegen Japan
Österreich (Rang 23) Österreich (Rang 26)
Herausgeber World Economic Forum International Institute Cornell University (USA), Transparency Internatio- Organisation für interna-
/ WEF (Schweiz) for Management Eliteuniversität INSEAD nal (Deutschland) tionale Zusammenarbeit
Development / IMD (Frankreich) und World und Entwicklung / OECD
(Schweiz) Intellectual Property (Frankreich)
Organization (Schweiz)
Anzahl der 140 Volkswirtschaften 61 Industrienationen 141 Volkswirtschaften 168 erfasste Staaten 36 (OECD Staaten plus
untersuchten Brasilien, Russland)
Nationen
Veröffent- Seit 1979, jährlich, Seit 1989, jährlich, Seit 2008, jährlich, Seit 1995, jährlich, zu- Seit 2011, jährlich,
lichung zuletzt im September zuletzt im Mai 2015 zuletzt im September letzt im Jänner 2016 zuletzt im Mai 2015
2015 2015
Erhebungs- Umfassende Executive Umfassende Analyse der Inno- Umfragen unter Beschreibung der
methode Opinion Survey (ca. wissenschaftlich vationsfähigkeit und Managern und allgemeinen Lebens-
14.000 Teilnehmer) durchgeführte Executive –unterstützung anhand Analysten zur qualität auf Basis
sowie statistische Kenn- Opinion Survey diverser Indikatoren in Wahrnehmung zusammengesetzter
zahlen internationaler (ca. 4.300 Teilnehmer) Bereichen wie Infra- von Korruption bei Indikatoren, Berechnung
Institutionen (z.B. OECD, struktur, Bildung, Amtsträgern und anhand amtlicher
Währungsfonds, WHO) Knowledge, Kapazitäten Politikern Datenquellen
und Innovations-Output
Quellen: Global Competitiveness Index 2015, World Competitiveness Index 2015, Global Innovation Index 2015,
Corruption Perceptions Index 2015 und OECD Better Life Index 2015
Deloitte Radar 2016 | 7Global Competitiveness Index (GCI)
Der Global Competitiveness Index (GCI) des Weltwirt- Österreich wird in dieser Abbildung ebenfalls zur
schaftsforums ist der umfassendste Standortvergleich in Gruppe der besten Wirtschaftsstandorte gezählt
Hinblick auf Umfang (3 Subindizes, 12 Säulen), Breite („best“) – befindet sich allerdings nur mehr auf
der Executive Survey (14.000 Teilnehmer) und Anzahl Rang 23 und hat damit gegenüber dem Vorjahr weitere
der untersuchten Volkswirtschaften (140 Länder). zwei Plätze verloren. Im Jahr 2008 war Österreich mit
Die grafische Darstellung („Heat Map“) illustriert die Platz 14 noch deutlich besser positioniert.
Konzentration der besonders wettbewerbsfähigen
Staaten in Nord- und Mitteleuropa, Nordamerika,
Südostasien und Ozeanien. Die Schweiz, Singapur und
die USA belegen auch im Ranking 2015 wieder die
ersten drei Plätze. Dahinter folgt Deutschland, das sich
dank verbesserter Wirtschaftsdaten sowie seiner hohen
und glaubwürdigen Bedeutung für die Weltwirtschaft
von Rang 5 auf Rang 4 verbessert hat.
World Heat Map – Die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Länder im Vergleich
Quelle: Global Competitiveness Index 2015-2016
8 | Deloitte Radar 2016Der Zeitvergleich macht klar: Reformen zeigen
Wirkung
Neben dem Nord-Süd-Gefälle werden im Jahresvergleich Im direkten Vergleich mit den Top 5 Volkswirtschaften
auch die Auswirkungen der jeweiligen Reformbereitschaft der EU* sieht man, dass Österreich – abgesehen von
sichtbar. Nach den Strukturreformen der Vorjahre konnten der Marktgröße – insbesondere bei der Entwicklung auf
sich beispielsweise Spanien sowie Italien verbessern und den Finanzmärkten, beim technologischen Fortschritt
liegen nun auf Rang 33 (35 im Vorjahr) bzw. 43 (49 im und im Bereich der Innovation am stärksten vom
Vorjahr). Tschechien holt seit 2013 Jahr für Jahr mehrere Spitzenfeld abweicht (d.h. Abweichung größer als 0,5
Plätze auf und liegt im aktuellen GCI-Ranking auf Platz vom Durchschnitt der Top 5). Auch bei der Bewertung
31. Umgekehrt führt Reformstau zu Stagnation oder der öffentlichen Institutionen und der Flexibilität des
Verschlechterung. Arbeitsmarktes hat Österreich Aufholbedarf auf die fünf
wettbewerbsfähigsten Nationen in der Europäischen
Reformstau in Österreich bewirkte Verlust an
Union.
Wettbewerbsfähigkeit
Österreich hat sich in den letzten beiden Jahren um sieben
Ränge verschlechtert und damit auch im Vergleich zu
anderen EU-Staaten an Wettbewerbsfähigkeit verloren.
Handlungsfelder – Vergleich Österreich / Top 5-Volkswirtschaften der EU
Institutions
7,0
Innovation Infrastructure
6,0
5,0
4,0
Business sophistication Macroeconomic environment
3,0
2,0
1,0
Market size 0,0 Health and primary education
Technological readiness Higher education and training
Financial market development Goods market efficiency
Labor market efficiency
Österreich TOP 5 EU *
*TOP 5 in der EU: Deutschland, Niederlande, Finnland, Schweden, UK
Deloitte Radar 2016 | 9Social Progress Index (SPI)
Die Chancen und Möglichkeiten unserer
Kinder sind entscheidend für die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit
Die Ergebnisse des SPI 2015 zeigen, dass sich viele Zukunftsorientierung – ausgedrückt in Möglichkeiten
Aspekte des gesellschaftlichen Fortschritts durch und Chancen – ein höheres Augenmerk geschenkt
steigendes Einkommen verbessern. Wohlhabende werden muss. Die Alpenrepublik ist in dieser
Länder wie der Spitzenreiter Norwegen erzielen Kategorie nur mehr knapp in den Top 20 zu finden.
durchwegs bessere gesellschaftliche Ergebnisse Österreich schneidet vor allem in den Bereichen
als Länder mit niedrigem Einkommen. Das BIP ist Bildung, Integration und Toleranz schlechter ab
jedoch längst nicht der einzige Faktor, der sich auf als vergleichbare Volkswirtschaften. Es gilt wichtige
gesellschaftlichen Fortschritt auswirkt. Costa Rica und mutige Schritte zu setzen, um negativen
(Platz 28) mit einem BIP von USD 13.431 pro Kopf wirtschaftlichen Folgen entgegenzuwirken. Identifizierte
erreicht ein viel höheres Level an gesellschaftlichem Themen sind hier die Integration von Minderheiten, die
Fortschritt als Italien und Südkorea, deren BIP ungefähr Gleichberechtigung von Frauen am Arbeitsmarkt und
doppelt so hoch ist. Die USA schneiden wiederum mit eine weitreichende Reform des Bildungssystems.
einem BIP von USD 51.340 pro Kopf in vielen vom
SPI gemessenen Bereichen schlecht ab. Im Bereich
„Gesundheit und Wohlbefinden“ liegen die USA Info
beispielsweise auf Platz 16 hinter Kanada (6) und dem Der Social Progress Index der Harvard Business School
Vereinigten Königreich (11), die beide ein geringeres und Deloitte beurteilt seit 2013 jährlich 133 Länder
BIP pro Kopf aufweisen als die USA. Besonders die in drei Kategorien („menschliche Grundbedürfnisse“,
Golfstaaten zählen zu den Verlierern, die trotz hohem „Grundlagen des Wohlergehens“ sowie „Chancen &
BIP beim gesellschaftlichen Fortschritt deutlich hinter Möglichkeiten“). Der Index basiert ausschließlich auf
ihren Möglichkeiten zurückbleiben. sozialen und ökologischen Kennzahlen und stellt diese
Der Social Progress Index bestätigt den Eindruck, dass dem BIP gegenüber. Der SPI zielt darauf ab, Stärken
Wohlstand und Wohlbefinden in Österreich hoch sind. und Schwächen der gesellschaftlichen Entwicklung zu
Gleichzeitig zeigt sich aber auch hier, dass der identifizieren und Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.
Platzierung Punktzahl Land BIP Menschliche Menschliche Grundlagen des Grundlagen des Chancen & Chancen &
pro Kopf Grundbedürf- Grundbedürf- Wohlergehens Wohlergehens Möglichkeiten Möglichkeiten
in USD nisse nisse Punktzahl Platzierung Punktzahl Platzierung
Punktzahl (100) Platzierung (100) (133) (100) (133)
(133)
1 88,36 Norwegen 62.448 94,80 9 88,46 1 81,82 9
2 88,06 Schweden 43.741 94,83 8 86,43 3 82,93 5
3 87,97 Schweiz 54.697 95,66 2 86,50 2 81,75 10
4 87,62 Island 41.250 95,00 6 86,11 4 81,73 11
5 87,08 Neuseeland 32.808 92,87 17 82,77 6 85,61 2
6 86,89 Kanada 41.894 94,89 7 79,22 14 86,58 1
7 86,75 Finnland 38.846 95,05 3 82,58 8 82,63 7
8 86,63 Dänemark 41.991 96,03 1 82,63 7 81,23 12
9 86,50 Niederlande 44.945 94,80 9 83,81 5 80,88 13
10 86,42 Australien 42.831 93,73 13 79,98 12 85,55 3
11 84,68 UK 37.017 92,22 19 79,04 15 82,78 6
12 84,66 Irland 44.931 93,68 15 76,34 29 83,97 4
13 84,45 Österreich 44.376 95,04 4 82,53 9 75,77 18
14 84,04 Deutschland 43.207 94,12 12 81,50 10 76,49 16
15 83,15 Japan 35.614 95,01 5 78,78 20 75,66 19
16 82,85 USA 51.340 91,23 21 75,15 35 82,18 8
17 82,83 Belgien 40.607 93,73 13 76,57 27 78,19 14
18 81,91 Portugal 25.596 92,81 18 76,17 31 76,76 15
19 81,62 Slowenien 27.576 92,88 16 80,87 11 71,12 24
20 81,17 Spanien 31.596 91,09 23 76,79 26 75,62 20
10 | Deloitte Radar 2016Fortune 500
Der Trend setzt sich fort: Die weltweit größten
Unternehmen finden sich immer mehr in der
Asien-Pazifik-Region
Bei einer Betrachtung der Fortune 500-Unternehmen Südamerika hat in diesem Zeitraum seinen Anteil auch
der Jahre 2005 bis 2015 ist eine deutliche Kräfte- um acht zusätzliche Unternehmen erhöht und damit um
verschiebung von Nordamerika und Europa hin zu 160% zugelegt. Aus Österreich ist die OMV als einziges
asiatischen und südamerikanischen Staaten feststellbar. Unternehmen unter den Fortune 500 (erstmals 2006).
In diesem Zeitraum haben die USA 48 und Europa 30 Das international tätige Öl- und Gasunternehmen hat
Nennungen in der Fortune 500-Liste eingebüßt. Dem im Vergleich mit dem Vorjahr einige Plätze verloren: Im
stehen 82 zusätzlich vertretene Unternehmen in China letzten Ranking befindet es sich auf Rang 223, 2014
gegenüber. belegte es noch Rang 179.
Land Anzahl F500 Anzahl F500 Anzahl F500 Veränderung Veränderung Langfristiger Veränderung Kurzfristiger
2005 2014 2015 absolut in % Trend in % Trend
2005-2015 2005-2015 2014-2015
Europa (inkl. Russland) 177 153 147 -30 -17% -4%
Österreich 0 1 1 1
Belgien 3 2 2 -1
Belgien/Niederlande 1 1 -1
UK 35 28 28 -7
UK/Niederlande 2 1 1 -1
Dänemark 2 1 1 -1
Finnland 3 1 -3
Frankreich 39 31 31 -8
Deutschland 37 28 28 -9
Irland 1 2 2 1
Italien 8 9 9 1
Luxemburg 1 1 1 0
Niederlande 14 13 13 -1
Norwegen 2 1 1 -1
Polen 0 1 1 1
Russland 3 8 5 2
Spanien 8 8 8 0
Schweden 7 3 3 -4
Schweiz 11 13 12 1
Naher Osten 1 2 2 1 100% 0%
Saudi Arabien 1 1 1 0
VAE 0 1 1 1
Südamerika 5 12 13 8 160% 8%
Brasilien 3 7 7 4
Chile 0 0 1 1
Kolumbien 0 1 1 1
Mexiko 2 3 3 1
Venezuela 0 1 1 1
Kanada & U.S. 189 138 139 -50 -26% 1%
Kanada 13 10 11 -2
U.S. 176 128 128 -48
Asien & Pazifik 128 195 199 71 55% 2%
Australien 9 8 8 -1
China 16 95 98 82
Indien 5 8 7 2
Indonesien 0 0 2 2
Japan 81 57 54 -27
Malaysien 1 1 1 0
Singapur 1 2 2 1
Südkorea 11 17 17 6
Taiwan 2 5 8 6
Thailand 1 1 1 0
Türkei 1 1 1 0
Total 500 500 500
Deloitte Radar 2016 | 11Wie attraktiv ist der Standort
Österreich?
Österreich hat sich gegenüber 2008 in allen untersuchten
Standortvergleichen verschlechtert. Im Global Competitiveness
Unter den globalen Index des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist der österreichische
Wirtschaftsstandort in den letzten beiden Jahren um sieben
Wirtschaftsstandorten spielt Plätze zurückgefallen (von Rang 16 in den Jahren 2012 und 2013
auf Rang 23 im Jahr 2015). Beim World Competitiveness Index
Österreich eine geringere des International Institute for Management Development (IMD)
ist Österreich bereits seit vier Jahren nicht mehr in den Top 20
Rolle als noch vor sieben vertreten. Auch in der Bewertung der allgemeinen Lebensqualität
im OECD Better Life Index kam es zuletzt zu einem schlechteren
Jahren. Bei den bereits Ranking (Rang 17, zuletzt 15). Positive Entwicklungen gibt
es hingegen im Global Innovation Index der Eliteuniversität
bekannten Schwächen INSEAD und im Corruption Perceptions Index von Transparency
International. In diesen beiden spezifischen Ländervergleichen
braucht es endlich Mut konnte sich Österreich bereits zwei Jahre in Folge verbessern
und damit wieder unter den Top 20-Nationen landen. Das
zu Veränderungen. Niveau von 2008 ist jedoch noch nicht erreicht, da sich andere
Volkswirtschaften in Relation besser entwickelt haben.
Indizes Ranking Österreich 2008-2015
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
5
10
Rang
15 16
17
18
20
23
25
26
30
Global Competitiveness Index (WEF) Global Innovation Index (INSEAD)
World Competitiveness Index (IMD) Corruption Perceptions Index (TI)
OECD Better Life Index
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Global Competitiveness Index WEF 14 17 18 19 16 16 21 23
World Competitiveness Index IMD 14 16 14 18 21 23 22 26
Global Innovation Index INSEAD 15 15 21 19 22 23 20 18
Corruption Perceptions Index TI 12 16 15 16 25 26 23 16
OECD Better Life Index 14 16 13 15 17
12 | Deloitte Radar 2016Global Competitiveness Index Global Innovation Index
World Economic Forum INSEAD
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0
5 5
10 10
15 14 15 15 15
17 16 16
18 19 19 18
20 21 20 21 20
23 22 23
25 25
30 30
World Competitiveness Index Corruption Perceptions Index
IMD Transparency International
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0
5 5
10 10
12
15 14 14 15 15
16 16 16 16
18
20 21 20
23 22 23
25 26 25 25 26
30 30
Better Life Index
OECD
2011 2012 2013 2014 2015
0
5
10
14 13
15 16 15 Quellen:
17 Global Competitiveness Index 2015
20 World Competitiveness Index 2015
25 Global Innovation Index 2015
Corruption Perceptions Index 2015
30 OECD Better Life Index2015
Bernhard Gröhs, Managing Partner
„Wir alle kennen die Handlungsfelder für die Rückkehr zur
Spitze sehr gut. In Österreich braucht es jetzt MEHR MUT
zum Anpacken – denn die Chancen der Zukunft beginnen
im Kopf, beim richtigen Mindset.”
Deloitte Radar 2016 | 131.
Politisches und Vorjahr
Politisches und
makroökonomisches
Umfeld Tendenz
makroökonomisches
Umfeld
Österreich sieht sich aktuell mit einer der geringsten Wachstumsraten Europas, sinkenden Investitionen und einer
hohen Staatsverschuldung konfrontiert. Die gute Beschäftigungssituation wird durch einen anhaltenden Anstieg
der Arbeitslosigkeit getrübt. Die Gesamtbewertung für diesen Standortfaktor sinkt gegenüber dem Vorjahr auf zwei
Punkte – kurzfristig ist keine Besserung in Sicht.
+ Hoher Wohlstand (BIP/Kopf) und Reifegrad der - Steigende Arbeitslosigkeit (+2%p in den letzten
Wirtschaft 8 Jahren), weiterhin negativer Ausblick
+ Stabilität und Sicherheit - Sinkende Investitionsquote in den letzten drei
+ Hohe Beschäftigungsquote (Platz 8 in der Jahren, unter dem EU-Durchschnitt
EU) und vergleichsweise noch immer niedrige - Unterdurchschnittliches Exportwachstum im
Arbeitslosenquote (Platz 5)
EU-Vergleich
+ Anstieg des privaten Konsums und damit des
Wirtschaftswachstums erwartet
- Hohe Staatsverschuldung (rund 86% des BIP) und
Ausgabeverhalten des Staates
- Geringes Wirtschaftswachstum in den letzten vier
Jahren (0,3 bis 0,8%), in den letzten beiden Jahren - Nachhaltige Finanzierbarkeit des Pensions- und
deutlich hinter Deutschland und dem EU-Durchschnitt Sozialsystems in Gefahr
- Geringe Bedeutung des Finanzplatzes
MUT zu Beispiele
Transparenz E-Government: Die öffentliche
Verwaltung bietet bereits eine
und Reformen Vielzahl an benutzerfreundlichen
Die hohe Staatsverschuldung und Serviceleistungen im Internet an und
die strukturellen Probleme sollten kann sich dabei auch international
durch eine klare Kompetenzvertei- messen lassen.
lung zwischen den Gebietskörper-
schaften behoben werden. Mit Mut Haushaltswesen: Vom BMF wurden
zu einer transparenten Darstellung einheitliche Budgetregeln für Bund,
von Aufwand und Nutzen auf den Länder und Gemeinden erlassen und
unterschiedlichen Ebenen können Spending Reviews vorbereitet, die die
die notwendigen Reformen fak- Nachhaltigkeit der öffentlichen Haus-
tenbasiert und zukunftsorientiert haltsführung stärken sollen.
angegangen werden. Die eingespar- Die Umsetzung sollte rasch erfolgen.
ten Budgetmittel wären in Bildung,
Forschung und Infrastruktur
wesentlich besser angelegt.
14 | Deloitte Radar 2016Politik und Verwaltung
Die Performance der Politik und des öffentlichen Bruttoverschuldung des Staates im Vergleich
Sektors wird in internationalen Standortstudien in % des BIP
konstant schlechter bewertet als jene des privaten 100,0
Sektors – eine Einschätzung, die sich beispiels- 90,0 86,0
weise in Deutschland und der Schweiz umgekehrt 85,3
80,0
darstellt. Während Österreich bei Stabilität und 68,5
70,0 71,9
Sicherheit Top-Bewertungen erzielt, werden das 65,0
60,0
Ausgabeverhalten des Staates sowie die Belastungen 61,0
durch öffentliche Regulierung und Bürokratie seit 50,0
43,2
Jahren kritisiert. Der „Reformstau“ – den es trotz einer 40,0
Vielzahl an Konzepten und Ideen gibt – lähmt die 30,0 36,8
Dynamik der Wirtschaft. Die Auswirkungen zeigen 20,0
sich mittlerweile auch in der volkswirtschaftlichen 10,0
Performance. 0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Die Staatsverschuldung ist seit Ausbruch der welt-
weiten Wirtschaftskrise aufgrund fremdfinanzierter Österreich Deutschland Schweden EU28
Krisenprogramme und der Auswirkungen der
Quelle: EUROSTAT (Februar 2016)
Bankenrettungspakete stark angestiegen. Österreich
liegt mit einer Staatsverschuldung in Höhe von fast
86% des BIP mittlerweile nur mehr knapp unter dem
EU-Schnitt – der seit 2008 noch stärker gestiegen ist
Entwicklung der Neuverschuldung Deutschland/Österreich
– und damit deutlich über den Maastricht-Kriterien in % des BIP
von 60%.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Das strukturelle Defizit geht seit Jahren zurück und 1,0
betrug laut EU Kommission 2015 -0,6%.1 Damit liegt 0,3
0,0
-0,2 -0,1
Österreich beim Saldo aus staatlichen Einnahmen und -0,1
-1,0
Ausgaben besser als der EU-Schnitt. In der Mischung -1,4 -1,0
-1,3
aus konjunkturellen Effekten und strukturellem Defizit -2,0
-2,2
hat Deutschland bereits in den letzten Jahren ein -2,6 -2,7
-3,0
Nulldefizit bzw. einen leichten Budgetüberschuss -3,2
erwirtschaftet, wodurch der Handlungsspielraum für -4,0 -4,2
-4,4
wirtschaftspolitische Maßnahmen größer ist als in -5,0
Österreich. -5,3
-6,0
Österreich Deutschland
Quelle: Statistik Austria bzw. Deutsches Bundesfinanzministerium
1
Vgl. Budgetdienst des Österreichischen Parlaments, Administratives
und strukturelles Defizit
Deloitte Radar 2016 | 15Korruption
Seit über 20 Jahren wird von Transparency International Jene Länder, die sich unter den Vorreitern befinden,
der Corruption Perceptions Index (CPI) veröffentlicht, der weisen dieselben Besonderheiten auf: Pressefreiheit,
die Wahrnehmung betreffend Korruption im öffentlichen öffentlicher Zugriff auf Budgetdaten zur Darlegung
Sektor misst. Im CPI 2015 konnte Österreich – nach der Mittelherkunft und -verwendung, Unabhängigkeit
drei Jahren hinter den Top 20 – zuletzt eine deutliche der Organe des öffentlichen Bereichs sowie der Justiz.2
Verbesserung verzeichnen und stieg im Vergleich zum Aufgrund der Tatsache, dass der Missbrauch von
Vorjahr um sieben Plätze von Rang 23 auf Rang 16. Trotz anvertrauter Macht zum privaten Nutzen oder Vorteil
dieser positiven Entwicklung liegt Österreich im Vergleich stets im Geheimen stattfindet, sind seitens Österreichs
zu den entwickelten Industriestaaten, langjährigen weitere Maßnahmen zu setzen, die zu mehr Transparenz
Demokratien und Rechtsstaaten dennoch im Mittelfeld führen und letztlich das Vertrauen in den Standort
und befindet sich damit hinter den Nachbarstaaten Österreich stärken.
Schweiz (Rang 7) und Deutschland (Rang 10).1
Karin Mair, Partnerin, National Leader Forensic
„Der Korruptionswahrnehmungsindex 2015 bestätigt,
dass auch weiterhin Maßnahmen zur Korruptions-
prävention zu setzen sind.“
1
Vgl. Transparency International, Corruption Pereceptions Index 2015
2
Vgl. Transparency International, Presseinfo, 27.01.2016
16 | Deloitte Radar 2016Allgemeine Wirtschaftslage BIP-Wachstum im Vergleich
in % gegenüber Vorjahr
Österreich hat mit einem geringen Wirtschafts- 6
wachstum, zurückhaltenden Investitionen und einer
steigenden Arbeitslosigkeit zu kämpfen. 4
2
Konjunktur: Angleichung an EU-Schnitt
Mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf (in 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 p 2017p
Kaufkraftstandards) von rund EUR 36.000 zählt
-2
Österreich weiterhin zu den Top 5-Nationen der EU.
Das Wirtschaftswachstum von lediglich 0,6% im Jahr -4
2015 liegt aber deutlich unter dem EU-Schnitt von
1,9%. Für heuer und nächstes Jahr erwarten sowohl die -6
EU-Kommission als auch das WIFO ein Wachstum von
-8
+1,7%, was auch den durchschnittlichen EU-Prognosen
Österreich Deutschland EU (28 Länder)
entspricht. Grund dafür ist laut WIFO die Zunahme
Quelle: EUROSTAT (Februar 2016)
der Inlandsnachfrage durch die höheren verfügbaren
Einkommen der Haushalte (Steuerreform) sowie die
Ausgaben zur Bewältigung der Flüchtlingskrise.
Arbeitslosenquote
in % der Erwerbsbevölkerung
Investitionen: Zunahme erwartet
Trotz niedriger Zinsen war das Investitionsvolumen 2015
zum dritten Mal in Folge rückläufig (-0,1%), während es 12,0
10,9
im EU-Schnitt um 2,9% gewachsen ist. Laut dem CFO- 10,0 9,5
9,0
Stimmungsbarometer sehen Österreichs Finanzvorstände 8,7
8,0 7,6
die wesentlichsten Gründe für eine verhaltene 7,4
7,0 6,0 6,2 6,4
Investitionsbereitschaft in der allgemeinen Konjunktur, 6,0
den Wachstumsaussichten sowie den regulatorischen 4,8 4,9 5,2
4,0 4,1 4,0
Auflagen und den erhöhten Anforderungen an
Kreditunterlagen. In der letzten Umfrage Ende 2015 2,0
gaben 49% an, dass sie in den nächsten 12 Monaten
0,0
ihre Investitionen anheben wollen, 14% gehen 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016p2 017p
von einem Rückgang aus und 37% werden keine Quelle: EUROSTAT (Februar 2016)
Österreich Deutschland EU28
Änderungen ihres Investitionsverhaltens vornehmen.
Beschäftigung: Negativer Trend hält an
Einst führend in der europäischen Arbeitslosenstatistik,
verzeichnet Österreich seit knapp zwei Jahren
eine Zunahme der Arbeitslosenquote. Obwohl die
Beschäftigung steigt (+0,7% im Jahr 2015), nimmt auch Josef Schuch, Partner und Universitätsprofessor
die Arbeitslosigkeit kontinuierlich zu. Einerseits reicht „Minimalwachstum, geringe
die Anzahl der neuen Stellen nicht für das angestiegene
Arbeitskräftepotenzial. Andererseits passen die Investitionsbereitschaft
angebotenen und die gesuchten Qualifikationen immer und steigende Arbeitslosigkeit.
häufiger nicht zusammen (siehe auch Standortfaktor
„Verfügbarkeit von Arbeitskräften“). Leider eine klare Tendenz: Vom
einstigen Musterschüler Europas
zum Sorgenkind.“
Deloitte Radar 2016 | 17Bundesländer im Vergleich
Im politischen Diskurs kommt dem Föderalismus eine besonders Förderungen und Ausgaben sowie immer öfter auch die Idee für eine
große Bedeutung zu. Dem Finanzausgleich sowie der Steuerautonomie der Bundesländer diskutiert.
Kompetenzverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wird
Ein Vergleich einiger wesentlicher Kennzahlen zeigt die
viel Energie gewidmet. Länder und Gemeinden tragen wesentlich
Unterschiede hinsichtlich Wirtschaftsleistung, Arbeitsmarkt und
zur hochdotierten Förderpolitik am Wirtschaftsstandort bei. In den
Staatsverschuldung:
letzten Jahren werden der Wunsch nach mehr Transparenz aller
Vorarlberg Tirol Salzburg
Arbeitslosenquote 2015 6,1% Arbeitslosenquote 2015 7,0% Arbeitslosenquote 2015 5,9%
Veränderung zum Vorjahr 2,4% Veränderung zum Vorjahr 1,7% Veränderung zum Vorjahr 4,1%
Schuldenstand/EW 2014 485 Schuldenstand/EW 2014 309 Schuldenstand/EW 2014 4.134
BIP/EW 2014 41.496 BIP/EW 2014 41.237 BIP/EW 2014 45.225
BIP Wachstum 3,8% BIP Wachstum 3,3% BIP Wachstum 1,9%
Größtes Wachstum des BIP im Niedrigster öffentlicher Niedrigste Arbeitslosenquote im
Bundesländervergleich Schuldenstand pro Einwohner BL-Vergleich
(lt. Statistik Austria) (lt. Deloitte Berechnung basierend (lt. Arbeitsmarktservice Österreich)
auf Daten der Statistik Austria)
Oberösterreich
Arbeitslosenquote 2015 6,1%
Veränderung zum Vorjahr 8,3%
Schuldenstand/EW 2014 1.312
BIP/EW 2014 39.245
BIP Wachstum 1,8%
Im BL-Vergleich führender Industries-
tandort gemessen an der Anzahl der
Beschäftigten im produzierenden
Bereich (lt. Statistik Austria)
Wien
Arbeitslosenquote 2015 13,5%
Veränderung zum Vorjahr 16,0%
Schuldenstand/EW 2014 3.218
BIP/EW 2014 47.282
BIP Wachstum 1,6%
Höchstes Bruttoinlandsprodukt pro
Einwohner im BL-Vergleich
(lt. Deloitte Berechnung basierend
auf Daten der Statistik Austria)
Niederösterreich
Arbeitslosenquote 2015 9,1%
Veränderung zum Vorjahr 7,4%
Schuldenstand/EW 2014 4.765
BIP/EW 2014 31.377
BIP Wachstum 1,2%
Größte Kaufkraft pro Haushalt
und pro Einwohner im Jahr 2015
im BL-Vergleich
(lt. Kaufkraftstudie des GfK)
Kärnten Steiermark Burgenland
Arbeitslosenquote 2015 11,1% Arbeitslosenquote 2015 8,3% Arbeitslosenquote 2015 9,3%
Veränderung zum Vorjahr 3,3% Veränderung zum Vorjahr 4,8% Veränderung zum Vorjahr 5,1%
Schuldenstand/EW 2014 5.546 Schuldenstand/EW 2014 3.134 Schuldenstand/EW 2014 3.718
BIP/EW 2014 32.226 BIP/EW 2014 34.716 BIP/EW 2014 26.540
BIP Wachstum 1,2% BIP Wachstum 2,7% BIP Wachstum 2,1%
Höchste Erfolgsquote bei der neuen Höchste Kinderbetreuungsquote
Höchste regionale F&E Quote im der 3-5-jährigen im BL-Vergleich
Reifeprüfung im BL-Vergleich BL-Vergleich (lt. Statistik Austria)
(lt. BM für Bildung und Frauen) (lt. Statistik Austria)
Quellen: Statistik Austria, AMS 2015
18 | Deloitte Radar 2016Herbert Kovar, Partner, International Tax
„Die Wiederbelebung der Seidenstraße bietet attraktive Geschäftsmöglich-
keiten für zahlreiche österreichische Betriebe und kann damit einen wichtigen
Beitrag zur Stärkung des Standortes und der globalen Vernetzung leisten.“
One Belt, One Road: Die neue
Seidenstraße als Chance für Österreich
Lange Zeit war sie die wichtigste Lebensader zwischen China Telekommunikationshauptleitungen auszubauen. Dabei
und Europa: die legendäre Seidenstraße als Tor zum Reich der kann die Expertise der österreichischen Betriebe im Bereich
Mitte. der Glasfaserkabeltechnik einen fundamentalen Beitrag zum
internationalen Netzwerkaufbau leisten.
„One Belt, One Road“ stellt das neueste Erfolg versprechende
Prestigeprojekt der chinesischen Führung zur Wiederbelebung Österreichisches Know-how ist auch in den Bereichen
der Seidenstraße dar und soll den Ausbau von Verkehrs- und Feinverarbeitungstechnik, Anlagenbau und ingenieurstech-
Transportverbindungen zwischen Asien und Europa massiv nische Dienstleistungen gefragt. Darüber hinaus bringt
vorantreiben. Der neue Wirtschaftsgürtel soll auf dem die Wiederbelebung der Seidenstraße besonders in den
Landweg von Xi’an in Zentralchina über Kasachstan, den Iran Bereichen Transport (Hochgeschwindigkeitszüge, Flughäfen
und Irak sowie die Türkei nach Europa führen. Die maritime und Straßen), Energiewirtschaft, Telekommunikation, und
Seeroute soll von der südostchinesischen Provinz Fujian Petrochemie interessante Möglichkeiten für die heimischen
ausgehend über Hainan, Kalkutta, Sri Lanka nach Kenya Betriebe. In die Seidenstraßeninitiative sind bereits 16
führen und sich schließlich über das Horn von Afrika via zentral- und osteuropäische Staaten eingebunden, die
Athen bis nach Venedig erstrecken. gemeinsam zahlreiche Großprojekte, wie beispielsweise
den „Trans-Eurasia-Express“ (Zugverbindung Budapest-
Wirtschaftspolitisch erhofft sich China mit der Seidenstraßen-
Belgrad), den massiven Ausbau des Hafens von Koper in
initiative erneute Wachstumsimpulse durch die Erschließung
Slowenien sowie die Transportstrecke Europa-Kaukasus-
neuer Handelsrouten, Absatzmärkte und Energiequellen.
Asien, vorantreiben. Der Donauraum hat mit einer
Die Finanzierung von „One Belt, One Road“ soll dabei durch
Einzugsregion von etwa 100 Mio. Menschen enormes
einen eigens geschaffenen Fonds und die neu gegründete
Potential die Logistikdrehscheibe Europas zu werden.
Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (AIIB) erfolgen.
Geschäftschancen für österreichische Betriebe ergeben
sich insbesondere in der verkehrstechnischen Anbindung
Chancen für den Wirtschaftsstandort Österreich der zahlreichen Industriebetriebe an den Außengrenzen
Nachdem die Hauptzielländer der chinesischen Direkt- Europas an das europäische Schienennetz. Um zur
investitionen in der Vergangenheit noch Australien, USA europäischen Güterdrehscheibe an der Donau aufsteigen
und Großbritannien hießen, investiert China nun vermehrt zu können, sollte die Politik den weiteren Ausbau des
strategisch in KMU und Hightech Hidden Champions. Diese Wiener Hafens fördern, der bereits heute als trimodaler
veränderte Investitionsstrategie Chinas hat für Österreich Logistikumschlagknoten fungiert.
als Brückenkopf für die CEE-Region eine große Bedeutung.
So fungiert das Hochtechnologieland Österreich als Abbau der bürokratischen Hürden
strategischer „Stepping Stone“ für chinesische Konzerne
nach Osteuropa. Für österreichische Unternehmen Um langfristige bilaterale Beziehungen zwischen China
entstehen insbesondere im Bereich Umwelttechnik gute und Österreich herzustellen, bedarf es außerdem eines
Geschäftschancen, da ein neues chinesisches Umweltgesetz Abbaus bürokratischer Hürden. Durch eine Erleichterung
die Betriebe zwingt, auf „Clean Production“ umzurüsten. des Verfahrens für Geschäftsvisa („Red White Red
Carpet“) können Handelsbeziehungen ermöglicht und die
Der von der chinesischen Regierung präsentierte Realisierung länderübergreifender Projekte vereinfacht
Fünfjahresplan 2016-2020 sieht den Ausbau erneuer- werden.
barer Energien vor. Hier können österreichische
Unternehmen durch die Zulieferung von Ausrüstung für Österreich muss daher wirtschaftspolitische Anreize
Wasserkraftwerke und die Bereitstellung von Fachwissen setzen, damit die heimischen Betriebe ihr Wissen speziell
für die Integration von Erneuerbaren Energien ins im Bereich der erneuerbaren Energien, des maritimen
Stromnetz sowie durch umfangreiches Know-how Ingenieurswesens, der Biotechnologie, der Wasser- und
über energiesparende Technologien partizipieren. Die Windkraft sowie der Förderung von metallhaltigen
bewährten Nachhaltigkeitskonzepte der österreichischen Mineralien im Rahmen des Seidenstraßenprojektes optimal
Hidden Champions, die den von den Initiatoren der einsetzen können. Dazu sind vor allem die Zusammenarbeit
Seidenstraße geforderten Ansprüchen einer kohlen- in aufstrebenden Industriezweigen, die Etablierung einer
stoffarmen Arbeitsweise nachkommen, müssen von Kooperationsstruktur und eine Risikokapitalbeteiligung
Österreich noch viel mehr als bisher weltweit vermarktet notwendig.
werden. Weiters gilt es die länderüberschreitenden
Deloitte Radar 2016 | 19Sie können auch lesen