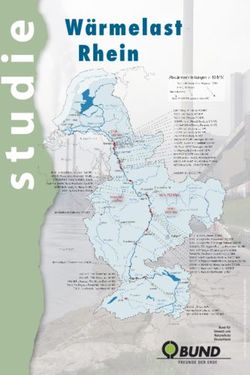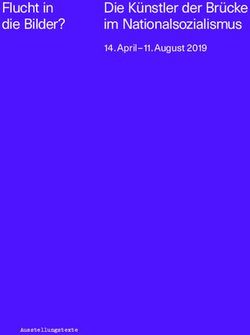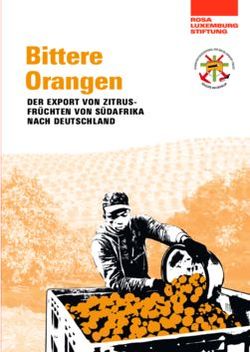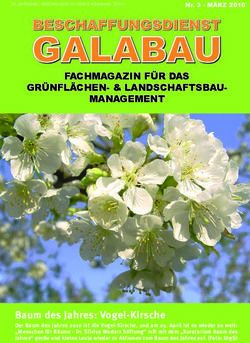Aus Politik und Zeitgeschichte - 50/2006 11. Dezember 2006 - BPB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
APuZ
Aus Politik und Zeitgeschichte
50/2006 ´ 11. Dezember 2006
Fæderalismusreform
Roman Herzog
Kooperation und Wettbewerb
Fritz W. Scharpf
Weshalb wurde so wenig erreicht?
Werner Reutter
Regieren nach der Fæderalismusreform
Annegret Eppler
Fæderalismusreform und Europapolitik
Henrik Scheller
Die Reform der Finanzverfassung
Hans-Peter Schneider
Fæderale Finanzautonomie im internationalen Vergleich
Beilage zur Wochenzeitung Das ParlamentEditorial
Die Wurzeln des deutschen Fæderalismus reichen bis ins Mit-
telalter zurçck. Vergleichsweise spåt kam es in Deutschland zur
Bildung eines Nationalstaats; die Macht der Landesfçrsten und
des Klerus war stark. Nach dem Untergang des Reiches leiteten
die Westalliierten 1945 die fæderale Neuordnung ein. Seit der
deutschen Vereinigung gilt es, die Interessen von jetzt 16 Bun-
deslåndern mit denen des Bundes auszutarieren ± das ist kein
leichtes Unterfangen, zumal dann, wenn die Mehrheiten in Bun-
destag und Bundesrat parteipolitisch unterschiedlich ausfallen.
Im Oktober 2003 wurde auf Beschluss beider Kammern die
¹Kommission zur Modernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nungª eingesetzt. Die Vorarbeiten der Kommission nutzte die
groûe Koalition, um die Fæderalismusreform umzusetzen. Am
1. September 2006 traten die umfangreichsten Grundgesetzånde-
rungen seit Bestehen der Bundesrepublik in Kraft. Die Zahl der
im Bundesrat zustimmungspflichtigen Gesetze sinkt, um Effizi-
enz und Leistungsfåhigkeit des Staates zu sichern und klarere
Verantwortlichkeiten zu schaffen. Im Gegenzug erhalten die
Lånder ausschlieûliche Gesetzgebungskompetenzen etwa im
Strafvollzugsrecht, in Teilen des æffentlichen Dienstrechtes und
beim Ladenschluss.
Der diffizilere Reformschritt steht noch aus: eine Reform der
Finanzverfassung, die zu Kooperation und Wettbewerb ermu-
tigt. Wie kænnen Haushaltsnotlagen vermieden werden? Das
Bundesverfassungsgericht hat im Oktober die Klage des hoch
verschuldeten Landes Berlin auf zusåtzliche Finanzhilfen des
Bundes verworfen. Der Einfluss der Lånder auf ihre Einnahmen
ist gering, und der Lånderfinanzausgleich in der jetzigen Form
ermutigt kaum zum Sparen.
Hans-Georg GolzRoman Herzog wird zu selten gestellt. Natçrlich kommt es
entscheidend auf die Materie an, fçr die eine
Kooperation und zentrale oder dezentrale Entscheidung zur
Debatte steht, und natçrlich kommt in sehr
vielen Fållen nur die zentrale, bundeseinheit-
Wettbewerb liche Regelung in Frage (sollten die Bayern ±
oder sagen wir zur Abwechslung einmal: die
Essay
Sachsen ± etwa selbst entscheiden dçrfen, auf
welcher Straûenseite in ihrem Bundesland der
Verkehr zu rollen hat?). Was mich stært, ist
der unreflektierte Reflex, der hinter dem Ein-
wand ¹Aber dann kænnten doch . . .ª allzu
R ichtigeª Bundesstaaten entstehen in der
Regel durch den Zusammenschluss von
Gliedstaaten, die dem Bundesstaat historisch
håufig steckt: entweder die unbefragte An-
nahme, Einheitlichkeit sei ein Wert an sich,
oder die ebenso unkritische Unterstellung,
vorausgehen, und nicht durch die Dezentrali- der hæheren Entscheidungsebene stehe auto-
sierung vorhandener Einheitsstaaten. Deutsch- matisch auch die hæhere Weisheit bei ihren
land hat diesen Prozess zweimal erlebt, aber Entscheidungen zu Gebote. Beides ist nicht
unter Umstånden, die unterschiedlicher kaum nur grundfalsch ± in einem Fall ist sogar das
håtten sein kænnen: 1871 als Zusammenschluss Gegenteil richtig. Natçrlich nicht im Falle
souveråner Staaten, geboren aus dem Sieg im der Gleichsetzung hæherer Entscheidungs-
deutsch-franzæsischen ebenen mit hæherer Weisheit: ¹Untenª sind
Krieg; 1949 als Ver- Menschen genau so fehlbar wie ¹obenª. Die-
Roman Herzog ser Auffassung kann man nur resignierend
such von jeder Souve-
Dr. jur., geb. 1934; Professor, ihre Verwurzelung im Untertanengeist be-
rånitåt baren Besat-
Bundespräsident a.D.; Vorsit- scheinigen und fragen, warum dann nicht
zungseinheiten, nach
zender des Konvent für Deutsch- gleich alle Entscheidungen auf der Ebene der
der totalen Niederlage
land e.V., Dorotheenstraûe 35, Vereinten Nationen getroffen werden: Dort
ein Stçck deutscher
10117 Berlin. mçsste nach dieser Logik doch die Weisheit
Staatlichkeit zurçck-
jane.uhlig@konvent-fuer- am græûten sein. Richtig ist aber das Gegen-
zugewinnen. Dazwi-
deutschland.de teil der Auffassung, Einheitlichkeit sei ein
schen hatten ein be-
tråchtlicher Unitarisie- Wert an sich. Einheitlichkeit ist manchmal
rungsschub in der Weimarer Republik und die nætig, um uns das Leben durch Verlåsslich-
vællige Zerstærung der fæderalen Strukturen im keiten zu erleichtern (auf welcher Straûensei-
¹Dritten Reichª gelegen. te rollt der Verkehr?). Aber produktiv ist sie
nicht. Das produktive Prinzip heiût Vielfalt.
Man hat den Eindruck, dass alle diese Ent-
wicklungsphasen ihre Spuren in unserer heu- Das Prinzip Vielfalt ist das Leitprinzip
tigen bundesstaatlichen Realitåt hinterlassen eines jeden recht verstandenen Fæderalismus.
haben. Nicht, dass ich jemandem unterstellen Es geht darum, vorgefundener Vielfalt ge-
mæchte, er oder sie beziehe seine Vorbilder recht zu werden: Die Verhåltnisse im Saar-
aus der NS-Zeit! Aber unitarischen Neigun- land sind anders als in Mecklenburg-Vorpom-
gen (die schon in der Weimarer Republik mern. Darum werden ihnen Entscheidungen,
wirksam waren und nicht nur deshalb nichts die in Saarbrçcken bzw. in Schwerin getrof-
spezifisch Nationalsozialistisches sind) be- fen werden, eher gerecht als Entscheidungen,
gegnet man heute auf Schritt und Tritt. Man die in Berlin fçr die ganze Bundesrepublik
denke nur an die in den Fæderalismusreform- getroffen werden. Es geht um das vielbe-
Debatten der vergangenen drei Jahre immer schworene (aber wenig praktizierte) Prinzip
wieder zu hærenden, erschreckten Ausrufe: der Subsidiaritåt.
¹Aber dann kænnten ja die Bayern . . .ª (an-
dere Bundeslånder wåren nach Belieben und Das Subsidiaritåtsprinzip wurde bekannt-
Neigung ± oder Abneigung ± einzusetzen.) lich erstmals von Papst Pius XI. in seiner En-
zyklika Quadragesimo Anno (1931) formu-
Die Frage, warum denn die Bayern (o. a. liert, weshalb es bis heute vielfach als eine auf
Bundeslånder) nicht kænnen sollen, was der die katholische Soziallehre begrenzte Aussage
Bund und/oder andere Lånder nicht tun, (die etwa den Zweck habe, katholische Kin-
APuZ 50/2006 3dergårten oder Krankenhåuser gegen staatli- fassung gegenstandslos: ¹Die Bundesrepublik
che Zugriffe abzuschirmen) missverstanden ist ein demokratischer und sozialer Bundes-
wird. In Wahrheit ist es nicht nur in seiner staat.ª (Artikel 20 GG). Demokratie heiût
Substanz viel ålter, sondern auch in seiner Be- Wettbewerb, Sozialstaat heiût Solidaritåt. Es
deutung und Anwendbarkeit viel universeller: kommt auf das Mischungsverhåltnis an. Je
Es besagt, dass Entscheidungsmacht immer so mehr autonome Handlungsmæglichkeiten die
nahe wie mæglich bei den Betroffenen (man Lånder haben, desto stårker wird das Wettbe-
kænnte auch sagen: bei den Problemen) ange- werbselement. Daher wåre ein Fæderalismus
siedelt sein soll. Hier wird gern (obwohl es ohne Wettbewerb einer ohne Autonomie ±
nicht ganz dem juristischen Sinn des Konzepts also çberhaupt kein Fæderalismus. So gesehen
entspricht) von einer ¹Beweislast-Regelungª ist der Begriff ¹Wettbewerbsfæderalismusª
gesprochen: Wer etwas ¹obenª oder zentral tautologisch. Trotzdem kann man in der Pra-
entscheiden will, muss erst den Nachweis fçh- xis die Wettbewerbs- und Autonomieelemen-
ren, dass es ¹untenª bzw. dezentral nicht geht. te so weit herunterfahren, dass der Fæderalis-
Genau das ist das Muster, nach dem eine fæde- mus zum Schatten seiner selbst wird. Genau
rale Verfassung geschneidert sein muss ± das ist in Deutschland in den vergangenen
wobei ¹untenª selbstredend nicht bei den fçnfeinhalb Jahrzehnten geschehen. Das
Låndern aufhært: Die Gemeinden, die Zivilge- Grundgesetz von 1949 gab ± auch unter dem
sellschaft und ihre Formationen und vor allem Einfluss der Besatzungsmåchte, die keinen
die Bçrgerinnen und Bçrger selbst sollen pri- starken deutschen Zentralstaat wollten ± den
mårer ¹Sitzª von Entscheidungskompetenz Låndern erhebliche Handlungsspielråume.
sein. In einer demokratischen Gesellschaft Die Art, wie diese Autonomierechte nach
wird Entscheidungsmacht von unten nach und nach eingeschrånkt und aufgegeben wur-
oben delegiert, niemals anders. den, ist ein Paradebeispiel fçr einen falsch
verstandenen ¹kooperativen Fæderalismusª.
Ist Vielfalt damit zum einen Ausdruck und
Bedingung von Freiheit, so beruht zum ande- Das Kooperative an diesem Fæderalismus
ren ihre produktive Kraft auf dem Wettbe- war nåmlich nicht so sehr die Zusammenar-
werb, den sie ja erzeugt, sobald man sie als beit unter den Låndern. Zwar gab und gibt es
¹Vielfalt der Læsungsansåtzeª versteht. Geht Einrichtungen wie die Kultusministerkonfe-
man davon aus, dass es dem Erkenntnisver- renz, von denen bæse Zungen behaupten, sie
mægen nur ausnahmsweise gelingt, auf An- seien dazu da, die letzten den Låndern noch
hieb die richtige Læsung eines Problems zu verbliebenen Eigenståndigkeiten auf dem
finden, so wird klar: Dass sich unter 16 Læ- Altar der freiwilligen bundesweiten Verein-
sungsansåtzen der richtige findet, ist 16-mal heitlichung zu opfern. Was es kaum gibt, sind
wahrscheinlicher, als dass ein einziger flå- verwaltungsstrukturelle Kooperationen zwi-
chendeckender Ansatz die Læsung bringt. schen den Låndern, die Dinge wie gemeinsa-
Und umgekehrt: Bei einer Vielfalt von Læ- me Universitåten oder Kliniken, grenzçber-
sungsansåtzen ist der Schaden, der durch fal- schreitende kommunale Zusammenarbeit
sche Antworten in einigen Bundeslåndern an- oder gemeinsame Raumordnungen zum Ge-
gerichtet wird, wesentlich geringer als bei genstand haben. Der Grund ist eine juristi-
einer flåchendeckend falschen Einheitslæsung sche Grauzone: Mit solchen Kooperationen
fçr die ganze Republik. werde eine dritte Ebene eingezogen, die mit
der vom Grundgesetz gewollten Zweiglied-
Freilich: All das gilt nur, wenn Wettbewerb rigkeit des deutschen Fæderalismus unverein-
unter den Bundeslåndern tatsåchlich zugelas- bar sei. Das kann man dann auch anders
sen ist. Und das ist leider keineswegs selbst- sehen, wenn solche Kooperationen nur zwei
verståndlich. Schon der Ausdruck ¹Wettbe- oder drei Lånder umfassen und keine bundes-
werbsfæderalismusª erzeugt reflexartige Ab- weite ¹dritte Ebeneª einziehen. Wenn man
wehrreaktionen: Der deutsche Fæderalismus solche Kooperationen gewollt håtte, dann
sei ein kooperativer Fæderalismus, heiût es håtte man die nætigen Klårungen notfalls im
dann, gekennzeichnet durch Solidaritåt und Grundgesetz selbst herbeifçhren kænnen. Of-
nicht Konkurrenz. Aber stimmt es denn, dass fenbar wollte man aber nicht. Das ist bemer-
Solidaritåt und Wettbewerb einander aus- kenswert, weil hier eine gute Gelegenheit fçr
schlieûen? Wenn es so wåre, wåre eine der freiwillig praktizierte Solidaritåt zwischen
grundlegenden Bestimmungen unserer Ver- den Bundeslåndern gewesen wåre. Stattdes-
4 APuZ 50/2006sen wurde der ¹kooperative Fæderalismusª der Solidaritåt im kooperativen Fæderalismus.
fast ausschlieûlich in vertikaler Richtung, Ein bisschen verwunderlich ist das schon,
zwischen Bund und Låndern, praktiziert. Die denn hier findet zwangsweise Umverteilung
Kooperation sah im Wesentlichen so aus, dass statt (kann es erzwungene Solidaritåt geben?),
die Lånder ihr Erstgeburtsrecht autonomer wåhrend die Mæglichkeiten freiwilliger Soli-
Kompetenzen Stçck fçr Stçck gegen Mitspra- daritåt ungenutzt bleiben. Vor allem aber er-
cherechte auf der Bundesebene eintauschten. stickt der Finanzausgleich in seiner heutigen
Die waren allerdings kein Linsengericht: Im Form jeden auch noch so kleinen Ansatz zum
Ergebnis hatte sich der Anteil der Gesetze, Wettbewerb unter den Låndern. Sein Nivel-
die nur mit Bundesratszustimmung erlassen lierungsgrad ist so groû, dass fçr niemanden
werden kænnen, versechsfacht (1949: ca. mehr ein Anreiz çbrig bleibt, sich anzustren-
10 %, 2005: ca. 60 %). ¹Kooperativer Fædera- gen: Den Geberlåndern wird jedes zusåtzli-
lismusª hieû: Ohne Lånderzustimmung låuft che Einkommen nahezu restlos abgeschæpft,
auf Bundesebene fast nichts; eigenverant- die Nehmerlånder werden auch ohne eigene
wortlich bestimmen kænnen die Lånder auch Anstrengungen in die Nåhe des Durch-
fast nichts. Das Ergebnis: programmierter schnittsniveaus hoch subventioniert.
Stillstand, ganz besonders dann, wenn Bun-
destags- und Bundesratsmehrheit parteipoli- Ist es da unzulåssig radikal, wenn man die
tisch unterschiedlich gefårbt waren. Frage stellt: Wozu eigentlich noch ein hori-
zontaler Finanzausgleich? Wenn schon die
Die ¹Fæderalismusreform Iª vom Sommer Solidaritåt unter den Låndern nur par ordre
2006 hat einen Teil dieser Fehlentwicklungen fdral funktioniert (das Erfordernis der
korrigiert und den wildwçchsigen Kompe- Bundesratszustimmung ist bei fçnf Geber-
tenzdschungel zwischen Bund und Låndern und elf Empfångerlåndern eigentlich nur eine
wenigstens ein Stçck weit entflochten. Die Verånderungsbremse), warum macht dann
Lånder haben Kompetenzen zurçckerhalten, der Bund nicht gleich das Ausgleichsgeschåft
und wenn die Prognose stimmt, dass der selbst? Er mçsste nur im Steueraufkommen
Bund in Zukunft wieder deutlich mehr als die entsprechend ausgestattet werden, und der
Hålfte seiner Gesetze ohne Lånderzustim- Ausgleich inakzeptabler Unterschiede ist eine
mung erlassen kann, dann ist das ein Fort- genuine Bundesaufgabe. Die Lånder aber
schritt. Ob damit auch eine Korrektur der wåren der Strangulierung durch eine perverse
hoffnungslos aus dem Gleichgewicht gerate- (im Wortsinne!) Anreizgestaltung ledig und
nen Balance zwischen Wettbewerb und oben- kænnten im positiven Sinne miteinander in
drein falsch verstandener Kooperation im einen stimulierenden Wettbewerb um die
deutschen Fæderalismus eingeleitet wurde, beste Pflege ihrer Steuerquellen, um Unter-
bleibt abzuwarten. Denn das Hauptstçck der nehmensansiedlungen, um Studenten treten
Entflechtungsarbeit steht noch bevor, die und dabei ihre komparativen Vorteile unge-
wichtigste Wettbewerbsbremse ist vorder- hindert ins Spiel bringen.
hand noch fest angezogen. Eine utopische Vorstellung? Vielleicht.
Aber so viel ist sicher: Ohne eine gehærige
Gemeint ist die Finanzverfassung, die bei Portion mehr Wettbewerb wird es nicht
der Fæderalismusreform I ausgeklammert gehen. Das muss nicht zu Lasten richtig ver-
wurde und in einem Reformschritt II ent- standener Kooperation und Solidaritåt gehen.
flochten werden soll. Dass das unbedingt ge- Vielleicht werden von ihren Fesseln befreite,
schehen muss, steht auûer Frage, denn bei erfolgreiche Lånder sogar zu einer gewissen
dem gegenwårtigen, åhnlich wie die Kompe- Dosis an freiwilliger Solidaritåt bereit sein.
tenzverflechtung in Jahrzehnten gewachsenen Und noch etwas, ohne das es nicht gehen
Verflechtungszustand kænnen sich vor allem wird: ein Stçck Umdenken. Mit dem Pochen
die Lånder finanziell kaum bewegen, ohne auf ¹Einheitlichkeit der Lebensverhåltnisse
dass der Bund sie låsst. Das heiût: Die gewon- im Bundesgebietª werden wir die Wende zur
nene Autonomie bei den Sachfragen ist ziem- lebensnotwendigen Reformfåhigkeit unseres
lich wertlos, wenn die Autonomie im Finan- Landes nicht schaffen. Im ¹Konvent fçr
ziellen nicht bald dazukommt. Das gilt hin- Deutschlandª haben wir das auf eine Formel
sichtlich Ertrag und Regelungskompetenz bei gebracht: Mut zum produktiven Unterschied.
den Steuern; aber es gilt ganz besonders beim
Finanzausgleich. Der ist angeblich der Sitz
APuZ 50/2006 5Fritz W. Scharpf den in der Sache begrçndeten Mehrebenen-
charakter der Staatsaufgaben als auch die gra-
Fæderalismus- vierenden Unterschiede in der Leistungsfå-
higkeit der Lånder. Drittens schlieûlich
reform: Weshalb
bestimmten die Vetospieler jeder Verfas-
sungsreform ± die Ministerpråsidenten und
die Sprecher der Bundestagsfraktionen ±
wurde so wenig nicht nur das parlamentarische Verfahren,
sondern bereits die Kommissionsberatungen.
erreicht? Kaum verminderte Zustimmungsrechte
des Bundesrats
D ie im Herbst 2003 eingesetzte ¹Kom-
mission zur Reform der bundesstaatli-
chen Ordnungª hatte sich das Ziel gesetzt,
Die angestrebte Verminderung des Bundesrats-
vetos scheiterte am ersten und am dritten dieser
Faktoren. Objektiv gesehen låsst die Funkti-
die deutsche Politik aus der ¹Verflechtungs- onsverflechtung im deutschen Bundesstaat eine
falleª zu befreien ± aus einer Situation also, in weitgehende Beseitigung von Zustimmungs-
der die Bundespolitik durch die Vetomacht rechten des Bundesrats von vornherein als un-
des Bundesrats gefesselt werden kann, wåh- realistisch erscheinen. Wenn fast alle Bundesge-
rend die Politik in den setze von den Låndern als eigene Angelegen-
Låndern weder in der heit und auf eigene Kosten zu vollziehen sind,
Fritz W. Scharpf
Gesetzgebung noch in und wenn die Steuereinnahmen der Lånder fast
Dr. iur., geb. 1935; Professor,
der Finanzwirtschaft vollståndig von Bundesgesetzen abhången,
ehem. Direktor am Max-Planck-
çber autonome Hand- dann kænnen die Landesregierungen ihren Ein-
Institut für Gesellschafts-
lungsspielråume ver- fluss auf die Gesetzgebung des Bundes auch
forschung, Paulstraûe 3,
fçgt. Gemessen an nicht aufgeben. In der Kommission hat man
50676 Köln.
diesem Ziel ist das deshalb çber die Zustimmungsrechte in der
fs@mpifg.de
Ergebnis dçrftig: Die Finanzverfassung gar nicht erst geredet.
Zustimmungsrechte
des Bundesrats wurden in politisch wichtigen Die Diskussion beschrånkte sich auf
Fragen eher vermehrt als vermindert, und die Art. 84 Abs. 1 Grundgesetz (GG), der die
Erweiterung der landespolitischen Hand- çberwiegende Zahl der Zustimmungsfålle
lungsmæglichkeiten blieb hinter dem Nætigen ausgelæst hat: ¹Fçhren die Lånder die Bun-
und Mæglichen weit zurçck. desgesetze als eigene Angelegenheit aus, so
regeln sie die Einrichtung der Behærden und
Weshalb wurde so wenig erreicht? Es kom- das Verwaltungsverfahren, soweit nicht Bun-
men drei Erklårungen in Frage: objektive desgesetze mit Zustimmung des Bundesrates
Schwierigkeiten und Hindernisse, die einer etwas anderes bestimmen.ª Wenn der Bund
problemgerechten Reform entgegenstanden; in die Verwaltungshoheit der Lånder eingrei-
ein ungeeigneter Ansatz, der erfolgverspre- fen will, muss der Bundesrat gefragt werden.
chende Reformversuche verhinderte; schlieû- Zum Problem konnte diese sinnvolle Regel
lich eine Interessenkonstellation unter den erst werden, nachdem das Bundesverfas-
Vetospielern, die eine Einigung auf problem- sungsgericht (BVerfG) 1958 die so genannte
gerechte Reformen ausschloss. Offenbar ¹Einheitstheorieª erfunden hatte. 1 Danach
haben alle drei Faktoren eine Rolle gespielt: beschrånkte sich das Zustimmungserfordernis
Zum einen kollidieren Versuche einer Ent- nicht auf die jeweiligen Vorschriften çber Be-
flechtung mit der grundlegenden Architektur hærdenorganisation oder das Verwaltungsver-
des deutschen Bundesstaates, in der dem fahren, sondern bezog sich auf das ganze Ge-
Bund und den Låndern nicht bestimmte setz als ¹gesetzgebungstechnische Einheitª.
Staatsaufgaben im Ganzen, sondern einzelne Die schådlichen Folgen des Urteils zeigten
Staatsfunktionen zugeordnet werden. Zum sich in den 1970er Jahren, als der (soziallibera-
zweiten ignorierte der von der Kommission len) Regierungsmehrheit zum ersten Mal eine
verfolgte Ansatz einer ¹klaren Trennungª der
Aufgaben von Bund und Låndern sowohl 1 BVerfGE 8, 274.
6 APuZ 50/2006oppositionelle Mehrheit im Bundesrat gegen- lieûen sich auf solche Ûberlegungen nicht
çberstand. Nun konnte das zum Schutz der ein. Sie waren nicht mehr bereit, die Mæglich-
Verwaltungshoheit nætige Zustimmungsrecht keit parteipolitisch motivierter Blockaden
als parteipolitisch motiviertes Veto gegen un- gegen den Inhalt von Bundesgesetzen aufzu-
geliebte Gesetzesinhalte genutzt werden. geben, 4 und angesichts ihrer Vetoposition im
Prozess der Verfassungsreform sah auch die
Diese Konstellation, die Gerhard Lehm- Bundesseite keinen Sinn in weiteren Diskus-
bruch zum ersten Mal analysiert hat, 2 ent- sionen çber die Einheitstheorie. Statt dessen
wickelt eine charakteristische Dynamik: In verlagerte sich die Diskussion auf Læsungen,
schwierigen Zeiten, in denen die Regierung die im Prinzip darauf hinausliefen, dass der
unpopulåre Maûnahmen durchsetzen mçsste Bund auf verbindliche Regelungen des Ver-
und in denen Landtagswahlen als Plebiszit waltungsverfahrens und der Behærdenorgani-
çber die Bundespolitik inszeniert werden sation verzichten und so das Zustimmungs-
kænnen, kann die Opposition rasch die Mehr- recht çberhaupt vermeiden sollte. Das håtte
heit im Bundesrat gewinnen. Die oppositio- der Bund allerdings schon immer von sich
nellen Ministerpråsidenten kænnen dann aus tun kænnen. Aber nachdem die Lånder
unter drei Handlungsorientierungen wåhlen: auf das zunåchst geforderte Verbot von Orga-
Sie kænnen sich auf die Vertretung der institu- nisations- und Verfahrensregelungen verzich-
tionellen Eigeninteressen ihres Landes be- tet und sich mit einem Abweichungsrecht zu-
schrånken, sie kænnen versuchen, die ¹Poli- frieden gegeben hatten, einigte man sich da-
cy-Interessenª der Oppositionsparteien rauf, in Ausnahmefållen doch wieder
durchzusetzen, oder sie kænnen deren ¹posi- verbindliche Verfahrensregeln zuzulassen (die
tionale Interessenª færdern, indem sie Erfolge dann selbstverståndlich wieder der Zustim-
der Regierung verhindern. Im ersten Fall ist mung des Bundesrats bedçrfen). Wenn man
eine pragmatische Einigung wahrscheinlich. freilich unterstellt, dass der Bund auch bisher
Im zweiten Fall kann man Kompromisse Verfahrensregeln nur aus einigermaûen zwin-
im Vermittlungsausschuss erwarten, die als genden Grçnden mit dem materiellen Gesetz
Kombination gegensåtzlicher Konzepte von verbunden hatte, dann kænnte die zugelassene
keiner Seite verteidigt werden. Im dritten Fall Ausnahme auch kçnftig die Regel bleiben.
schlieûlich ist mit Blockaden zu rechnen,
deren wichtigstes Ziel es ist, die jeweilige Re- Die Lånder allerdings sahen in der gefun-
gierung als inkompetent und hilflos erschei- denen Læsung eine Konzession, die nun ih-
nen zu lassen. Franz-Josef Strauû hat diese rerseits kompensiert werden musste: Wenn
Optionen ebenso brillant und zynisch ausge- das Zustimmungsrecht entfiel, weil der Bund
spielt wie spåter Oskar Lafontaine und dann auf verbindliche Verfahrensregeln verzichtete,
wieder die Ministerpråsidenten der Union. dann konnten sie sich ja auch nicht mehr
Die Malaise der deutschen Politik, in der gegen Bundesgesetze wehren, die ihnen Kos-
keine Seite in der Lage ist, ein Reformkon- ten auferlegten. Am Ende der Beratungen
zept zu verwirklichen und dann auch zu ver- stand deshalb ein neues Zustimmungsrecht
antworten, hat ihren wesentlichen Grund in fçr Gesetze, die ¹Pflichten der Lånder zur
der Mæglichkeit parteipolitischer (oder auch Erbringung von Geldleistungen, geldwerten
innerparteilicher) 3 Blockaden im Bundesrat. Sachleistungen oder vergleichbaren Dienst-
leistungen gegençber Dritten begrçndenª
In der Kommission gab es Vorschlåge der (Art. 104a Abs. 4 GG [neu]). Im Ergebnis
juristischen Sachverståndigen, die das Zu- wird deshalb die Zahl der Zustimmungsfålle
stimmungsrecht wieder auf die Organisati- sogar eher zu- als abnehmen. 5
ons- und Verfahrensregeln beschrånkt håtten
± und die angesichts der neueren Rechtspre- 4 Im persænlichen Gespråch verwies einer der Minis-
chung wohl auch vom BVerfG respektiert terpråsidenten auf den Ansehensverlust, den der Bun-
worden wåren. Aber die Ministerpråsidenten desrat erleiden wçrde, wenn die Landesregierungen
ihre Ablehnung des materiellen Gesetzes nicht aus-
drçcken kænnten und sie deshalb ein Veto gegen ei-
2 Vgl. Gerhard Lehmbruch, Parteienwettbewerb im gentlich unkontroverse Verfahrensvorschriften mit fa-
Bundesstaat, Stuttgart 1976. denscheinigen Argumenten begrçnden mçssten.
3 Auch in der Groûen Koalition erhålt der innerpar- 5 Vgl. Simone Burkhart/Philip Manow, Was bringt die
teiliche Widerspruch der Ministerpråsidenten sein Fæderalismusreform? Wahrscheinliche Effekte der ge-
volles Gewicht erst durch die drohende Blockade im ånderten Zustimmungspflicht. MPIfG Working Paper
Bundesrat. 06/6, Kæln, Oktober 2006.
APuZ 50/2006 7Kaum erweiterte Handlungsspielråume Sie durfte auch in den Beratungen der Fædera-
lismuskommission nicht mehr in Frage gestellt
der Landespolitik werden. Ûberdies sahen sich, je mehr der Ver-
teilungskonflikt an Bedeutung gewann, die lei-
In der Vergangenheit hatten die Landesregie- stungsstarken sçd- und westdeutschen Lånder
rungen auf Kosten ihrer Landtage an der auch im Bundesrat immer æfter einer struktu-
Ausweitung der Gesetzgebungskompetenzen rellen Mehrheit der wirtschaftlich schwachen
des Bundes bereitwillig mitgewirkt, sofern Lånder gegençber. Zwar konnten ihre Minis-
nur ihre Zustimmungsrechte im Bundesrat terpråsidenten aus den Zustimmungsrechten
gesichert waren. Wenn diese seit Jahrzehnten immer noch politisches Kapital schlagen, aber
beobachtete Tendenz zum ¹unitarischen Bun- fçr die wirtschaftlichen Belange ihrer Regio-
desstaatª 6 nun durch die Reform umgekehrt nen konnten sie nur noch wenig erreichen.
werden sollte, so gab es dafçr sowohl sachli-
che als auch politische Grçnde. Unter diesen Bedingungen stieg ihr Interesse
an autonomen Handlungsmæglichkeiten der
Sachlich hat mit der Vollendung des euro- Landespolitik. Wenn schon die fiskalische Um-
påischen Binnenmarktes die bundeseinheitli- verteilung hingenommen werden musste, so
che Gesetzgebung die Funktion verloren, glei- wollten sie wenigstens ihre Mæglichkeiten in
che Wettbewerbsbedingungen fçr alle auf dem der Gesetzgebung erweitert sehen. Dem ent-
deutschen Markt konkurrierenden Unterneh- sprach zunåchst die rhetorische Hinwendung
men zu sichern. Was einheitlich geregelt wer- zur Idee eines ¹Wettbewerbsfæderalismusª 9 ±
den sollte, muss heute europåisch geregelt dem liberalen Gegenkonzept zur bisherigen
werden. Umgekehrt gewinnen in der europå- normativen Selbstbeschreibung des ¹koopera-
ischen Standortkonkurrenz Spezialisierungs- tiven Fæderalismusª. 10 Da der Begriff aber als
vorteile an Bedeutung, die bei der heterogenen Aufkçndigung der Solidaritåt zwischen den
Wirtschaftsstruktur der Bundesrepublik re- Låndern verstanden wurde und mehr Ableh-
gional differenzierende Læsungen vorteilhaft nung als Zustimmung provozierte, wurde er in
erscheinen lassen. 7 Wichtiger waren aber den Beratungen der Kommission durch den
wohl die politischen Interessen der leistungs- ¹Gestaltungsfæderalismusª ersetzt ± eine For-
starken sçd- und westdeutschen Lånder: Sie mel, die sich mit mehr Erfolg als gemeinsames
waren unzufrieden mit dem Lånderfinanzaus- Interesse aller Lånder pråsentieren lieû.
gleich, wo nach der Einbeziehung der neuen
Lånder das Umverteilungsvolumen von etwa Im Mai 2004 einigten sich die Ministerprå-
1,5 Milliarden Euro 1994 auf mehr als sechs sidenten in einem gemeinsamen ¹Positionspa-
Milliarden 1996 und mehr als acht Milliarden pierª auf die Forderung umfassender Gesetz-
im Jahre 2000 gestiegen war. Besonders dra- gebungszuståndigkeiten fçr die Regelung
matisch war die Verånderung fçr Bayern, das ¹regionaler Lebenssachverhalteª, von der æf-
erst seit 1989 zu den Geberlåndern gehært und fentlichen Fçrsorge çber die aktive Arbeits-
dessen Beitråge von sechs Millionen 1993 auf marktpolitik, das Umweltrecht bis zum Wirt-
1,3 Milliarden 1995 und schlieûlich auf knapp schaftsrecht. Zugleich sollte sich der Bund
2,3 Milliarden im Jahre 2001 eskalierten. Der aus der Bildungs- und Erziehungspolitik
Versuch, çber eine Verfassungsklage Entlas- (¹von der Kita bis zur Habilitationª) voll-
tung zu erreichen, blieb faktisch ohne Erfolg, 8 ståndig zurçckziehen. Dass sich hinter dieser
und in den Verhandlungen çber den ¹Solidar- gemeinsamen Front gravierende Interessen-
pakt IIª wurde 2001 die West-Ost-Umvertei-
lung sogar bis zum Jahr 2019 festgeschrieben.
9 Vgl. K. Morath (Anm. 7); Heribert Schatz/Robert
Chr. van Oyen/Sascha Werthes, Wettbewerbsfædera-
6 Konrad Hesse, Der unitarische Bundesstaat, Karls- lismus. Aufstieg und Fall eines politischen Streitbe-
ruhe 1962. griffs, Baden-Baden 2000; Jochen Zenthæfer, Wettbe-
7 Vgl. Fritz W. Scharpf, Fæderale Politikverflechtung. werbsfæderalismus. Zur Reform des deutschen
Was muû man ertragen? Was kann man åndern?, in: Bundesstaates nach australischem Vorbild, Grasberg b.
Konrad Morath (Hrsg.), Reform des Fæderalismus, Bremen 2006.
Bad Homburg 1999, S. 23±36; ders., Mehr Freiheit fçr 10 Konrad Hesse, Aspekte des kooperativen Fædera-
die Bundeslånder. Der deutsche Fæderalismus im lismus in der Bundesrepublik, in: Theo Ritterspach/
europåischen Standortwettbewerb, in: Frankfurter Willi Geiger (Hrsg.), Festschrift fçr Gebhard Mçller,
Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 7. 4. 2001. Tçbingen 1970; Gunter Kisker, Kooperation im Bun-
8 BVerfGE 101, 158 vom 11. 11. 1999. desstaat, Tçbingen 1971.
8 APuZ 50/2006konflikte zwischen Låndern verbargen, zeigte Behinderungen fçr den lånderçbergreifen-
sich schon daran, dass die von den sçddeut- den Rechtsverkehrª eine ¹Bedrohung von
schen Låndern ursprçnglich geforderten Ge- Rechtssicherheit und Freizçgigkeit im Bun-
setzgebungskompetenzen çber die den Lån- desstaatª erzeugen, oder wenn dadurch ¹die
dern zuflieûenden Steuern aus dem Katalog Funktionsfåhigkeit des Wirtschaftsraums der
gestrichen werden mussten und dass auch die Bundesrepublik Deutschlandª in Frage ge-
Forderung nach Abschaffung der Gemein- stellt wird. 11
schaftsaufgaben und Finanzhilfen nur mit er-
heblichen Einschrånkungen formuliert wer- Diese extrem restriktive Interpretation der
den konnte. Die leistungsschwåcheren Lån- (1994 verschårften) Erforderlichkeitsklausel
der sahen im Gestaltungsfæderalismus die betraf nicht nur das Hochschulrahmengesetz,
Gefahren einer fçr sie mæglicherweise ¹rui- sondern den gesamten Bereich der konkurrie-
næsenª innerdeutschen Standortkonkurrenz. renden Gesetzgebung und damit den çber-
wiegenden Teil des geltenden Bundesrechts.
Mit der Vorlage des ¹Positionspapiersª Vom bçrgerlichen Recht çber das Strafrecht,
fanden die Diskussionen im Plenum der Fæ- den Strafprozess oder das Arbeitsrecht bis
deralismuskommission ihr Ende. Die Bera- zum Straûenverkehrsrecht konnten nun nicht
tungen verlagerten sich in sieben speziali- nur die Landesregierungen, Landtage und der
sierte ¹Projektgruppenª, in denen die Gene- Bundesrat, sondern alle Angeklagten in Straf-
ralisten aus den Staatskanzleien auf die prozessen und alle Parteien in Zivilprozessen
Spezialisten aus den Bundesressorts trafen, das geltende Recht mit der Begrçndung an-
die mit Unterstçtzung aus den Verbånden je- fechten, es sei nicht nachgewiesen, dass von
weils im Detail darlegten, weshalb die Ûber- Land zu Land unterschiedliche Regelungen
tragung ihrer Gesetzgebungskompetenzen schlechterdings unertrågliche wirtschaftliche
auf die Lånder ganz besonders schådlich oder soziale Folgeprobleme haben mçssten.
wåre. Das Ergebnis entsprach den Erwartun-
gen: Da die Lånder dem Bund nichts geboten Nun brauchte der Bund die Zustimmung
hatten, sah auch das Bundeskanzleramt kei- der Lånder, um den politisch unstrittigen Be-
nen Grund, die Ressorts zu Konzessionen zu stand seiner Gesetzgebungskompetenzen ver-
motivieren. Als die Projektgruppen nach der fassungsrechtlich abzusichern. Es lag auf der
Sommerpause ihre Berichte vortrugen, håtte Hand, dass er dafçr etwas bieten musste. Bis
man die Fæderalismusreform fçr gescheitert Anfang November 2004 entstand ein zumin-
erklåren kænnen. Dass dann in den allerletz- dest quantitativ durchaus ansehnlicher Kata-
ten Wochen doch noch ernsthafte und fast er- log von Gesetzgebungskompetenzen, die der
folgreiche Verhandlungen zustande kamen, Bund zur Ûbertragung auf die Lånder anbot
verdankt sich weniger dem Verhandlungsge- ± von denen am Ende allerdings nicht alle
schick der Vorsitzenden oder der Kompro- von den Låndern akzeptiert wurden. Im Ge-
missbereitschaft der Beteiligten als einer In- genzug waren die Lånder bereit, wenigstens
tervention des BVerfG. Das Urteil vom 27. einen Teil der konkurrierenden Kompetenzen
Juli 2004, das die Einfçhrung der ¹Juniorpro- entweder in die ausschlieûliche Kompetenz
fessurª durch das Hochschulrahmengesetz des Bundes zu çberfçhren oder sie explizit
fçr verfassungswidrig erklårt hatte, hatte zu- von der Erforderlichkeitsklausel freizustellen
gleich die Verhandlungsposition des Bundes (Art. 72 Abs. 2 GG [neu]).
in der Fæderalismuskommission radikal ver-
schlechtert: Es hatte sich nicht damit begnçgt, Trotzdem lieûen die Lånder die Fæderalis-
die Ûberschreitung der Grenzen eines Rah- musreform im Dezember 2004 zunåchst
mengesetzes zu rçgen, sondern es verneinte scheitern ± nach der æffentlich vorgetragenen
auch die ¹Erforderlichkeitª einer bundes- Begrçndung deshalb, weil der Bund damals
rechtlichen Regelung nach Art. 72 Abs. 2 noch nicht bereit war, auch die letzten Reste
GG. Diese setze voraus, dass ¹gerade durch seiner vom BVerfG reduzierten Kompeten-
unterschiedliches Recht in den Låndern eine zen im Bildungswesen aufzugeben. Dieses
Gefahrenlage entstehtª ± etwa, wenn ¹sich Hindernis wurde von der Groûen Koalition
die Lebensverhåltnisse in den Låndern (. . .) beseitigt.
in erheblicher, das bundesstaatliche Sozialge-
fçge beeintråchtigender Weise auseinander
entwickelt habenª, wenn ¹unzumutbare 11 BVerfG 2 BvF 2/02, Tz 128±135.
APuZ 50/2006 9Weshalb ist das Ergebnis ungençgend? gilt fçr die Umwelt-, die Wirtschafts-, die
Arbeitsmarkt- oder die Sozialpolitik.
Dass unter diesen Umstånden der Bund bei
der Reform wenig gewinnen konnte, liegt auf Zudem ignoriert das von den Låndern
der Hand. Aber auch aus der Sicht der sçd- postulierte ¹Trennprinzipª den seit den Frei-
und westdeutschen Lånder wurden die Re- heitskriegen gegen Napoleon manifesten kul-
formziele nicht erreicht. Wo es ihnen um die turellen Nationalismus der Eliten und deren
Mæglichkeit der autonomen Gestaltung poli- Abneigung gegen die ¹deutsche Kleinstaate-
tisch und wirtschaftlich bedeutsamer ¹Le- reiª. 13 Deshalb werden politische Diskussio-
benssachverhalteª gegangen war, stand am nen, die æffentliches Interesse finden, in den na-
Ende der Beratungen ein Katalog isolierter tionalen Medien gefçhrt, und politische Forde-
Zuståndigkeiten fçr eng umschriebene Spe- rungen werden wie selbstverståndlich an die
zialgesetze. Dabei hatte sich etwa die ur- Bundespolitik adressiert. Anders als etwa in
sprçnglich geforderte Kompetenz fçr die re- Belgien oder in der Schweiz dient der deutsche
gionale Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik Fæderalismus eben nicht dem Schutz sprachli-
auf Zuståndigkeiten fçr Ladenschluss, Gast- cher, ethnischer oder religiæser Minderheiten;
ståtten und Spielhallen reduziert; von der und anders als in den USA gelten regionale Un-
Umweltpolitik blieb die Zuståndigkeit fçr die terschiede, wenn sie çber das Folkloristische
Regelung des Freizeitlårms, und die regionale hinausgehen, bei uns nicht als authentischer
Sozialpolitik schrumpfte auf das Heimrecht Ausdruck regionaler Demokratie, sondern als
(vgl. Art. 74 Abs. 1, Ziff. 1, 7, 11, 17, 18, 24, Mobilitåtshindernisse und als Verweigerung
27 GG [neu]). Fçr Mçnchen, Stuttgart, Wies- des Verfassungsanspruchs auf ¹einheitlicheª
baden oder Dçsseldorf waren dies ¹Quisqui- oder wenigstens ¹gleichwertige Lebensverhålt-
lienª oder ¹Kleinkramª. ¹Dafçrª, so ein In- nisseª. Kurz: Fæderalismus mag wohl sein,
terviewpartner aus dem Stuttgarter Staats- aber er sollte keinen Unterschied machen.
ministerium, ¹waren wir nicht angetreten.ª
Wegen des Anspruchs auf Gleichwertigkeit
An dieser Einschåtzung kann auch der er- der Lebensverhåltnisse stehen schlieûlich auch
zwungene Rçckzug des Bundes aus der Bil- die seit der deutschen Vereinigung noch ge-
dungspolitik nicht viel åndern, der sich ohne- wichtigeren Unterschiede in der wirtschaftli-
hin schon nach wenigen Monaten eher als Pyr- chen, finanziellen und administrativen Leis-
rhussieg der Staatskanzleien denn als Erfolg tungsfåhigkeit der Lånder einer pauschalen
der Bildungspolitik in den Låndern erwiesen Dezentralisierung von Regelungskompeten-
hat. 12 Weshalb konnten die Lånder nicht mehr zen entgegen. Die Ministerpråsidenten haben
erreichen? Der entscheidende Grund scheint im Mai 2004 mit dem Argument, ¹ein fairer
mir der oben an zweiter Stelle genannte zu Wettbewerbª erfordere ¹gleichartige wirt-
sein: Die Ministerpråsidenten verfolgten ihr schaftliche Ausgangsbedingungenª, die Ûber-
Ziel mit einem Reformkonzept, das auf die tragung von Steuerkompetenzen abgelehnt.
realen Bedingungen des deutschen Fæderalis- Aber dasselbe Argument konnte auch gegen
mus zu wenig Rçcksicht nahm. Indem sie als die Ûbertragung anderer Gesetzgebungskom-
Ziel der Entflechtung eine ¹klare Trennungª petenzen verwendet werden, wenn diesen ein
der Kompetenzen und die vollståndige Ûber- Einfluss auf die ¹Lebensverhåltnisse im
tragung ganzer ¹Lebenssachverhalteª in die Bundesgebietª zugeschrieben werden konnte.
ausschlieûliche Regelungskompetenz der Lån- Ûberdies musste die Diskussion darçber
der forderten, ignorierten sie den objektiven im Modus der Antizipation gefçhrt werden.
Mehrebenencharakter der meisten Politikfel- Wenn es im Rahmen einer Verfassungsreform
der. So gibt es gerade etwa in der Bildungspoli- um die vollståndige und endgçltige Ûbertra-
tik zwar viele Aspekte, die am besten regional gung von Kompetenzen ging, dann mussten
und sogar lokal oder in den Universitåten und verantwortungsbewusste Verfassungsgeber die
Schulen geregelt werden sollten. Andere aber Risiken ihrer mæglichen Nutzung durch kçnf-
brauchen national oder fçr das Sprachgebiet
einheitliche Regeln, wieder andere bedçrfen 13 Gerhard Lehmbruch, Der unitarische Bundesstaat
der europaweiten Koordination. Øhnliches in Deutschland: Pfadabhångigkeit und Wandel, in: Ar-
thur Benz/ders. (Hrsg.), Fæderalismus. Analysen in
12 Vgl. Heike Schmoll, Die Kçr der Spitzen- entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Per-
hochschulen, in: FAZ vom 22. 8. 2006. spektive. PVS Sonderheft 32/2001, S. 53±110.
10 APuZ 50/2006tige Landesregierungen und Parlamente ab- der Bund im Bereich der konkurrierenden
schåtzen ± angesichts der Unsicherheit antizi- Gesetzgebung generell von den Beschrånkun-
pierender Urteile waren Bedenken grundsåtz- gen des Art. 72 Abs. 2 GG befreit werden,
lich leichter zu begrçnden als auszuråumen. aber die Lånder kænnten Gesetze beschlie-
ûen, die vom geltenden Bundesrecht abwei-
Mit der Festlegung auf das Prinzip der chen. Allerdings mçssten diese abweichenden
Kompetenztrennung als Læsung fçr die Pro- Gesetze dem Bund notifiziert werden, und
bleme der Politikverflechtung hatten die Re- der Bundestag kænnte mit Zustimmung des
former einen ¹Bezugsrahmenª fixiert, in dem Bundesrats ihr Inkrafttreten durch Einspruch
mit guten Grçnden nur eng umschriebene verhindern.
Kompetenzen delegiert werden konnten,
welche die administrative und finanzielle Ka- Der Bund kænnte also eine gegebene Mate-
pazitåt des Saarlandes oder Bremens nicht rie im systematischen Zusammenhang und
çberforderten und die auch bei unvernçnfti- ohne fæderale Beschrånkungen regeln. Eben-
ger oder unsolidarischer Nutzung weder die so kænnte aber auch das einzelne Land ohne
Interessen anderer Lånder schådigen noch die Rçcksicht auf eng definierte Kompetenzgren-
Gleichwertigkeit der Lebensverhåltnisse in zen die Mæglichkeit eigener Læsungen prç-
Frage stellen oder die Mobilitåt von Unter- fen. Bei der Diskussion darçber ginge es im
nehmen und Familien behindern konnten. Bundestag und Bundesrat dann nicht mehr
An diesen Kriterien gemessen ist der jetzt er- um abstrakte Gefahren einer generellen und
reichte Zugewinn an Lånderkompetenzen das dauerhaften Kompetenzçbertragung. Zu ent-
Maximum dessen, was Bayern, Baden-Wçrt- scheiden wåre vielmehr im Einzelfall çber
temberg, Hessen oder Nordrhein-Westfalen eine Regelung, die der Gesetzgeber in einem
bei Anwendung des ¹Trennprinzipsª errei- Land fçr notwendig gehalten hat und deren
chen konnten. Risiken und Nebenwirkungen fçr andere
Lånder oder die gesamtstaatlichen Belange
sich einigermaûen sicher abschåtzen lassen.
Fazit Im Ergebnis håtte dies den Handlungsspiel-
raum der Lånder wesentlich erweitert, ohne
Håtte es einen anderen Bezugsrahmen gege-
Øngste vor einem ruinæsen Wettbewerbsfæ-
ben, der fruchtbarere Verhandlungen ermæg-
deralismus zu provozieren. 17
licht håtte? Ich denke ja, und zusammen mit
Arthur Benz 14 in der Kommission und spåter
Wir sind jedoch in der Kommission mit
auch zusammen mit Ursula Mçnch 15 bei der
unseren Argumenten nicht durchgedrungen,
Anhærung im Rechtsausschuss des Bundesta-
und die wenigen Abweichungsrechte, die
ges habe ich mich fçr ein Reformkonzept ein-
(¹unkonditioniertª, aber durch eine ¹Lex-
gesetzt, das die Politikverflechtung nicht ab-
posteriorª-Regel relativiert) tatsåchlich in die
schaffen, sondern flexibler und effizienter
Verfassung aufgenommen wurden (Art. 72
ausgestalten sollte. Zentrales Element war der
Abs. 3 GG [neu]), haben mit unseren Vor-
seit 1977 vorliegende Vorschlag ¹konditio-
schlågen kaum etwas zu tun. Allenfalls kænn-
nierter Abweichungsrechteª. 16 Danach sollte
ten sie sich als Fuû in der Tçr fçr spåtere Re-
14 Vgl. Arthur Benz, Ûberlegungen zu Gesetz- forminitiativen erweisen.
gebungskompetenzen und Mitwirkungsrechten des
Bundesrats, Ms., 4. 2. 2004; www.bundesrat.de/cln_
050/nn_8364/DE/foederalismus/bundesstaatskommis
sion/ unterlagen/ AU-028, templateId= raw, property= liche Regelung durch Landesgesetz ersetzen oder ån-
publicationFile.pdf/AU-028.pdf (9. 11. 2006). dernª (kænnen), ¹wenn nicht der Bundestag innerhalb
15 Vgl. Ursula Mçnch, Schriftliche Stellungnahme zur
von drei Wochen nach der Zuleitung Einspruch er-
Anhærung des Rechtsausschusses zum Thema ¹Fæ- hebtª. Vgl. Beratungen und Empfehlungen zur Ver-
deralismusreformª am 15. 5. 2006; www.bundestag.de/ fassungsreform. Teil II: Der Bund und die Lånder.
ausschuesse/a06/ foederalismusreform/ Anhoerung/ Schlussbericht der Enquete-Kommission Verfassungs-
01_ Allgemeiner_ Teil/Stellungnahmen/Prof__ Dr__ reform. Zur Sache 2/77, Bonn 1977, S. 76.
Ursula_Muench.pdf (9. 11. 2006). 17 Vgl. Fritz W. Scharpf, Recht und Politik in der Re-
16 Er geht zurçck auf ein Sondervotum des frçheren
form des deutschen Fæderalismus, in: Michael Becker/
Hamburger Senators Ernst Heinsen in der Enquete- Ruth Zimmerling (Hrsg.), Politik und Recht. PVS
Kommission Verfassungsreform des Deutschen Bun- Sonderheft 36/2006, S. 306±332.
destages. Danach sollten ¹die Lånder im Bereiche der
konkurrierenden Gesetzgebung eine bundesgesetz-
APuZ 50/2006 11Werner Reutter herstellen ± und die staatliche Handlungsfå-
higkeit insgesamt verbessern. Die am 1. Sep-
Regieren nach tember 2006 in Kraft getretetene erste Stufe
der Reform gilt zu Recht als die weit rei-
chendste Ønderung des GG seit 1949. Insge-
der Fæderalismus- samt 25 der 183 Artikel des GG waren be-
troffen, elf mehr als bei der letzten groûen
reform
Verfassungsreform von 1994. Angestrebt
wurde vor allem, den Anteil zustimmungsbe-
dçrftiger Gesetze zu reduzieren sowie die le-
gislativen Kompetenzen von Bund und Lån-
dern neu festzulegen. 5 Wie viele andere
D ie fæderative Ordnung ist çberholt.ª
Unter anderem mit diesem Argument
begrçndete Bundespråsident Horst Kæhler
erwartete Matthias Platzeck, damals Bundes-
ratspråsident, dass nach der Reform ¹schnel-
ler, effizienter und besserª regiert werden
im Juli 2005 seine Entscheidung, den Deut- kænne. 6 Die nåhere Prçfung wird zeigen, ob
schen Bundestag aufzulæsen, 1 und mit dieser solche Hoffnungen begrçndet sind.
Einschåtzung stand er wahrlich nicht allein.
Politiker jeglicher Couleur, Politikwissen-
schaftler, Staats- und Verfassungsrechtler plå- Gesetzgebung im (un-)demokratischen
dieren schon lange fçr eine Restrukturierung
des Bund-Lånder-Ver-
Bundesstaat
håltnisses. Denn das
Werner Reutter Nicht wenige hielten die Verknçpfung des
Grundgesetz habe, so
Dr. phil., geb. 1958; Privat- Demokratiegebotes mit dem Bundesstaats-
die herrschende Mei-
dozent an der Humboldt-Uni- prinzip lange Zeit fçr eine glçckliche, ebenso
nung, die politischen
versität zu Berlin, Institut für die Freiheit sichernde wie die staatliche
Akteure in das Pro-
Sozialwissenschaften, Unter Handlungsfåhigkeit verbessernde Konstella-
krustesbett der Ko-
den Linden 6, 10099 Berlin. tion. 7 Doch seit Mitte der 1970er Jahre hat
operation und zum
werner.reutter@rz.hu-berlin.de sich in der Politikwissenschaft die Auffassung
Konsens gezwungen
durchgesetzt, dass bundesstaatlicher Kon-
und damit den zentra-
senszwang hohe demokratische Kosten er-
len demokratischen Legitimationsmechanis-
zeugt und effektives Regieren erheblich ein-
mus untergraben: den auf Konflikt und
schrånkt, ja vielfach sogar ausschlieût. In der
Mehrheitsentscheidung beruhenden Parteien-
wettbewerb. Dieser ¹Strukturbruchª (Ger- 1 Fernsehansprache am 21. 7. 2005, in: www.
hard Lehmbruch) zwischen Bundesstaat und bundespraesident.de (10. 4. 2006).
Parteienwettbewerb schrånke die Handlungs- 2 Manfred G. Schmidt, Die Politik des mittleren We-
und Steuerungsfåhigkeit des Staates ein, weil ges. Besonderheiten der Staatståtigkeit in der Bundes-
er umfassende Politikwechsel ausschlieûe und republik Deutschland, in: Aus Politik und Zeit-
allenfalls eine ¹Politik des mittleren Wegesª 2 geschichte (APuZ), (1990) 9 ±10, S. 23 ±31.
3 Vgl. Gerhard Lehmbruch, Parteienwettbewerb im
zulasse. 3 Der in Artikel 20 Absatz 1 des Bundesstaat, Wiesbaden 20003.
Grundgesetzes (GG) postulierte ¹demokrati- 4 Roman Herzog, Berliner Rede vom 26. 4. 1997.
sche Bundesstaatª ist ± polemisch formuliert 5 Vgl. Deutscher Bundestag, Entwurf eines Gesetzes
± in der Verfassungswirklichkeit also ein ¹un- zur Ønderung des Grundgesetzes. Drs. 16/813 vom
demokratischer Bundesstaatª. Ein ¹Ruckª, 7. 3. 2006, S. 7. Auf das dritte Reformziel ± den Abbau
wie ihn einst Roman Herzog forderte, kann von Mischfinanzierungen sowie die Neufassung der
Mæglichkeiten fçr Finanzhilfen des Bundes ± wird im
auf einer solchen verfassungsrechtlichen Basis
Weiteren ebenso wenig eingegangen wie auf die Frage
schwerlich durch Deutschland gehen. 4 der ¹Europatauglichkeitª des Grundgesetzes.
6 In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 7. 3. 2005,
Mit der Fæderalismusreform ± von Ed- hier zit. nach: Simone Burkhart/Philip Manow, Was
mund Stoiber als ¹Mutter aller Reformenª bringt die Fæderalismusreform? Wahrscheinliche Ef-
bezeichnet ± sollten diese Hemmnisse besei- fekte der geånderten Zustimmungspflicht. MPIFG
Working Paper 06/6, Kæln, Oktober 2006, in:
tigt werden. Sie sollte die Verantwortlichkei- www.mpifg.de/pu/workpap/wp06±6/wp06±6.html
ten zwischen Bund und Låndern klarer zu- (6. 10. 2006), S. 2.
ordnen, die Transparenz politischer Entschei- 7 Vgl. z. B. Konrad Hesse, Der unitarische Bundes-
dungsprozesse erhæhen ± bzw. çberhaupt erst staat, Karlsruhe 1962.
12 APuZ 50/2006Gesetzgebung haben sich diese Probleme be- ûig von den Parteien, die sich im Bundestag
sonders bemerkbar gemacht. Gesetzgebung in der Opposition befinden, als politisches
ist nicht nur ¹das wichtigste, dem Rechtsstaat ¹Widerlagerª 11 und Blockadeinstrument
angemessene Mittel politischer Steuerungª, 8 missbraucht. Damit werde nicht nur der poli-
sondern auch Manifestation des souverånen tische Mehrheitswille, wie er in Bundestags-
Volkswillens. In Gesetzen sollte sich daher, wahlen zum Ausdruck kommt, unterlaufen,
so die verbreitete Auffassung, der in Wahlen sondern die Lånderexekutiven, die im Bun-
ermittelte Mehrheitswille widerspiegeln; desrat vertreten sind, gewånnen einen Ein-
zudem sollte das Verfahren ausreichend fluss, der ihnen aus demokratischer Perspek-
transparent sein, und die Wåhler und Wåhle- tive nicht zustehe. Gleichzeitig wçrden Ent-
rinnen sollten erkennen kænnen, wer wofçr scheidungen in hohem Maûe unter
verantwortlich ist. Schlieûlich sollte die poli- Ausschluss der Úffentlichkeit getroffen, im
tische Ordnung sachgerechte und gemein- Konfliktfall gar in der ¹Dunkelkammerª 12
wohlfærderliche Læsungen privilegieren. 9 des Vermittlungsausschusses und in Form
von Tauschgeschåften und Paketlæsungen, so
Die Gesetzgebung im kooperativen Fæde- dass bisweilen nicht einmal die direkt Betei-
ralismus scheint keine dieser Anforderungen ligten mehr zu wissen scheinen, wem welche
zu erfçllen. Erstens wird vorgebracht, dass Ergebnisse zuzuordnen sind. 13 Und schlieû-
die Politikverflechtung, d. h. eine durch lich wird davon ausgegangen, dass Unitarisie-
¹zwei oder mehr Ebenen verbindende Ent- rung und Europåisierung den Låndern suk-
scheidungsstrukturª, eine Dominanz der zessive substantielle Gestaltungsbereiche ent-
Exekutive verursache, zur Entparlamentari- zogen håtten. Den Bundeslåndern drohe die
sierung beitrage und dazu tendiere, aus ¹ihrer ¹Verædung zu regionalen Verwaltungsprovin-
institutionellen Logik heraus systematisch zen mit Landtagen als regionalen Vertre-
(. . .) ineffiziente und problem-unangemes- tungskærperschaftenª. 14
sene Entscheidungenª zu erzeugen. 10 Ge-
setzgebung ist in dieser Perspektive kaum Zusammenfassend lassen diese Befunde
mehr als parlamentarische Notifikation von nur eine Schlussfolgerung zu: Die Funktions-
Beschlçssen, die andernorts, in zumeist nicht- prinzipien des kooperativen Fæderalismus
æffentlichen und informellen Gremien, ge- unterminieren zentrale demokratische Anfor-
troffen wurden und die sich nur in Ausnah- derungen an die Gesetzgebung. Um die Re-
mefållen als sachgerecht bezeichnen lassen. gierungsfåhigkeit zu verbessern und um
Zweitens wçrde ± unterschiedliche Mehr- sicherzustellen, dass demokratisch zustande
heitsverhåltnisse in Bundesrat und Bundestag gekommene Entscheidungen dem ¹Allge-
vorausgesetzt ± die Lånderkammer regelmå- meinwohl dienen und dem Kriterium der Ver-
8 Heinrich Oberreuter, Gesetzgebungsverfahren, in: 11 G. Lehmbruch (Anm. 3), S. 77 ±82.
Manfred G. Schmidt (Hrsg.), Die westlichen Lånder. 12 Hans Meyer, Einige Ûberlegungen zum Entwurf
Lexikon der Politik, Bd. 3, Mçnchen 1992, S. 121 ±129, einer Verfassungsånderung, 8. 5. 2006, in: www.
hier S. 121. bundestag.de/ausschuesse/a06/foederalismusreform/
9 Zur Gesetzgebung und zum Gesetzgebungsver- Anhoerung/01_Allgemeiner_Teil/Stellungnahmen/
fahren in Deutschland vgl. Hans Schneider, Gesetz- Prof_Dr_Hans_Meyer.pdf (16. 5. 2006), S. 14.
gebung. Ein Lehr- und Handbuch, Heidelberg 20023; 13 Vgl. z. B. Roland Johne, Bundesrat und parla-
Wolf-Rçdiger Schenke, Gesetzgebung zwischen Par- mentarische Demokratie. Die Lånderkammer zwi-
lamentarismus und Fæderalismus, in: Hans-Peter schen Entscheidungshemmnis und notwendigem Kor-
Schneider/Wolfgang Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und rektiv in der Gesetzgebung, in: APuZ, (2004) 50 ±51,
Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland, S. 10 ±17, hier S. 13; åhnlich: Volker Kauder (CDU) in:
Berlin u. a. 1989, S. 1485±1522; fçr demokratietheo- Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 16/23, 23. Sit-
retische Aspekte: Fritz W. Scharpf, Demokratietheorie zung vom 10. 3. 2006, S. 1750.
zwischen Utopie und Anpassung, Konstanz 1970; 14 Joachim Linck, Haben die deutschen Landes-
Arthur Benz, Fæderalismus und Demokratie. Eine parlamente noch eine Zukunft?, in: Zeitschrift fçr
Untersuchung zum Zusammenwirken zweier Ver- Politikwissenschaft, 14 (2004) 4, S. 1215±1234, hier
fassungsprinzipien, Polis 57/2003, FernUniversitåt S. 1231; vgl. auch: Uwe Thaysen, Landesparlamen-
Hagen, in: www.fernuni-hagen.de/POLINST/pdf-fi- tarismus zwischen deutschem Verbundfæderalismus
les/Polis57.pdf (9. 3. 2004). und europåischem Staatenverbund: Lage und Leistung
10 Fritz W. Scharpf, Die Politikverflechtungs-Falle: 1990± 2005, in: Thçringer Landtag (Hrsg.), Der Thç-
Europåische Integration und deutscher Fæderalismus ringer Landtag und seine Abgeordneten 1990± 2005.
im Vergleich, in: Politische Vierteljahresschrift, 26 Studien zu 15 Jahren Landesparlamentarismus, Wei-
(1985) 4, S. 323±356, hier S. 350. mar u. a. 2005, S. 19 ±68.
APuZ 50/2006 13Sie können auch lesen