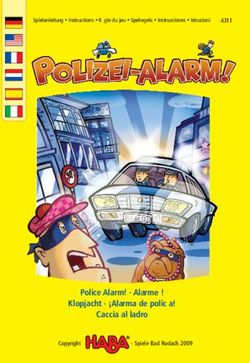Dystopische Postmoderne - Masterarbeit - UNIPUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Dystopische Postmoderne
Zwei literarische Beispiele spanischer und französischer Zukunftsvisionen
(Rafael Reig und Michel Houellebecq)
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
einer Magistra der Philosophie
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Sonja CVJETKOVIĆ
am Institut für Romanistik
Begutachterin: Ao. Univ.-Prof. Dr. Susanne Knaller
Graz, 2021Inhaltsverzeichnis Einleitung ................................................................................................................................. 1 I. Postmoderne ........................................................................................................................ 3 1. Die Postmoderne: Versuch einer Begriffsdefinition .............................................................. 3 2. Der literarische Paradigmenwechsel: Wesen und Potential des postmodernen Romans ..... 10 II. Utopie und Dystopie: Theoretischer Abriss ............................................................. 13 1. Zum Begriff der Utopie ........................................................................................................ 13 2. Der Utopiebegriff zwischen Vollkommenheitsfantasie und Schreckensszenario ............... 19 3. Von der Utopie zu Dystopie ................................................................................................. 20 4. Elemente der literarischen Utopie und Dystopie.................................................................. 24 III. Dystopie und Postmoderne ......................................................................................... 28 1. Rafael Reig – Sangre a borbotones: Analyse dystopischer Konstituenten .......................... 28 2. Michel Houellebecq – Unterwerfung: Analyse dystopischer Konstituenten ....................... 41 3. Die Dystopie im Zeichen der Postmoderne.......................................................................... 55 3.1 Rafael Reigs Sangre a borbotones als postmoderner dystopischer Roman ....................... 55 3.2 Michel Houellebecqs Unterwerfung als dystopischer Bildungsroman der Postmoderne .. 74 Conclusio ................................................................................................................................ 84 Bibliographie ......................................................................................................................... 86 Primärliteratur .......................................................................................................................... 86 Sekundärliteratur ...................................................................................................................... 86
Einleitung
Die Begriffe „Postmoderne“ und „Dystopie“ werden in ähnlichem Maße mit Endzeitszenarien
assoziiert. Während die Apokalypse als allgemeines Leitmotiv jeder Dystopie betrachtet
werden kann (vgl. Vosskamp 2013 16f.), gilt die Postmoderne als zutiefst apokalyptisches, von
geradezu lustvoller Unvernunft gezeichnetes Phänomen (vgl. Fiedler 1988: 58). Der Zweck der
vorliegenden Arbeit liegt in der Erforschung dieser beiden eschatologisch konnotierten
Termini. Diese soll aber nicht um ihrer selbst willen, sondern im Kontext zweier dystopischer
Romane erfolgen. Beim ersten Untersuchungsgegenstand handelt es sich um das im Jahr 2002
erschienene Werk Sangre a borbotones des spanischen Autors Rafael Reig (vgl. 2011). Das
zweite hier analysierte Werk ist Michel Houellebecqs im Jahr 2015 erschienener Roman
Unterwerfung, der – aufgrund seiner in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den terroristischen
Anschlägen auf die Redaktion der Zeitschrift Charlie Hebdo erfolgten Veröffentlichung (vgl.
Schönwälder 2018: 215) – vermutlich auf immer und ewig mit diesem Ereignis in
Zusammenhang gebracht werden wird.
Der 1963 im asturischen Cangas de Onís geborene Spanier Rafael Reig gilt als ein Vertreter
der sogenannten „Generation X“, die vor allem für ihre Verankerung in der populären und
medialen Kultur bekannt ist (vgl. Schmelzer 2014: 280 und vgl. Reig 2011). Im Rahmen des
Madrider „Hotel Kafka“ erteilt der spanische Autor als Vertreter einer unprätentiösen Literatur
zudem Unterricht im literarischen Schreiben (vgl. Schmelzer 2014: 279).
Was Michel Houellebecq betrifft, so bedarf es in Bezug auf seine Person wohl kaum einer
Vorstellung. Denn:
Nur wenige Gegenwartsautoren verfügen über eine derartige Medienpräsenz wie der französische
Schriftsteller und Dichter Michel Houellebecq, enfant terrible der europäischen Literaturszene, oder
auch: »Ketzer, Seelentröster und Pornograph«. (Schönwälder 2018: 214)
Der Kernaspekt der vorliegenden Arbeit liegt in der Untersuchung der dystopischen und
postmodernen Elemente der genannten Romane der beiden Autoren.
In Teil I wird der Begriff der Postmoderne mitsamt des diese kennzeichnenden Romans einer
theoretischen Diskussion unterzogen.
Der II. Teil bietet eine theoretische Beleuchtung der Termini „Utopie“ und „Dystopie“ sowie
der dieser literarischen Gattung inhärenten Konstituenten.
1Im III. und abschließenden Teil der Arbeit werden Rafael Reigs Sangre a borbotones und
Michel Houellebecqs Unterwerfung schließlich einer praktischen Analyse unterzogen, wobei
zunächst deren utopisch-dystopische Elemente erläutert werden, um daran anschließend die
ihnen zugrundeliegenden postmodernen Aspekte zu ergründen.
2I. Postmoderne
1. Die Postmoderne: Versuch einer Begriffsdefinition
Der Begriff „Postmoderne“ ist zwar ein geflügeltes, in zahlreichen Diskursen unserer Zeit
omnipräsentes Wort, dennoch erscheint es alles andere als einfach, den Terminus mit einer
eindeutigen Definition zu versehen. In der Beantwortung der Frage, worauf genau sich die
Bezeichnungen „postmodern“ und „Postmoderne“ beziehen, genügt es nicht, auf die Bedeutung
des Präfixes „post“ zu verweisen, welches „eine neue Epoche nach der Moderne“ zu indizieren
scheint (vgl. Kösser 2006: 496). Dieses
[…] ‚post‘ bedeutet in diesem Fall, dass man sich nach bestimmten Ereignissen, Leistungen,
Entwicklungen der Moderne weiß, die man kritisch reflektierend in seinem Denken berücksichtigen will
und muss. (Kösser 2006: 496)
Demnach referiert der Begriff der Postmoderne keinesfalls auf eine neue Epoche, sondern ist
am ehesten als „selbstreflexive Moderne“ zu verstehen (vgl. ibid.). Denn: „Aus dem
Selbstverständnis von Postmoderne ist ein Ende nicht erklärbar, weil sie in »ihrer eigenen Sicht
keine ‚historische Epoche‘ [ist], sondern das Ende jeglichen Epochendenkens«.“ (ibid.).
Das Wort „postmodern“ findet bereits um das Jahr 1870 herum Eingang in den Sprachgebrauch,
als es vom englischen Künstler John Watkins Chapman bemüht wird, um auf seine Malerei im
Sinne einer noch ‚moderneren‘ Malerei zu verweisen, die es vermag, zu seinen Lebzeiten
herrschende Stile wie den Impressionismus zu überwinden (vgl. Kösser 2006: 497). Bei dieser
Attitüde des Malers handelt es sich um eine zutiefst moderne, der jene „Grundhaltung des
»höher-weiter-schneller-besser«“ innewohnt, zu der die heutige Postmoderne in Distanz zu
gehen sucht, da sie sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie sich „nach diesem
Fortschrittsdenken“ positioniert (vgl. ibid.). Doch war auch der Begriff der Moderne ein
unscharfer, sodass die beiden Begriffe ihrem Wesen nach in ähnlicher Weise als
„programmatisch und provokativ“ erscheinen (ibid.). Zudem bestimmen sich beide Begriffe in
Differenz zu etwas; „die Moderne in Differenz zur Antike, die Postmoderne in Differenz zur
Moderne“ (vgl. ibid.). Während beide Termini für eine Fusion von „Affirmation und Kritik“
stehen, „unterliegt nun im Wesentlichen das, was die Moderne als positiv bewertete – Technik,
Fortschritt, Geschichte, umfassende Sinnangebote usw. – der Kritik.“ (vgl. ibid.). Der Versuch,
den Beginn dessen zu definieren, was als postmoderne Bewegung gilt, wird häufig an
Phänomenen wie der amerikanischen Literaturdebatte oder jener zur postmodernen Architektur
festgemacht, am Aufkommen künstlerischer Diskurse also, die in den 1970er-Jahren dann
durch überwiegend französische, mit dem Namen Jean-François Lyotard konnotierte
3philosophische Debatten substituiert werden (vgl. ibid.). Folglich sind und bleiben Denotate
wie „postmodern“ und „Postmoderne“ im Hinblick auf ihre Legitimität, ihren
Anwendungsbereich, ihre zeitliche Ansetzung und ihren Inhalt umstritten, wobei dieselbe
Umstrittenheit auch den Terminus der Moderne kennzeichnet (vgl. ibid.).
In Toynbees A Study of History aus dem Jahre 1947 bezeichnet „postmodern“ jedenfalls „die
Phase nach dem Krieg der modernen Gesellschaften“ (vgl. Kösser 2006: 497f.). Im Rahmen
dieses Werkes wird „postmodern“ schließlich in den Kontext der amerikanischen
Literaturdebatte transferiert, wo es für „die Literatur nach der klassischen Moderne“ steht, die
sich dadurch auszeichnet, dass sie „ihren elitären Charakter aufgibt und in Richtung einer
Verbindung von Elite- und Massenkultur tendiert“ (vgl. ibid.: 498). Analog dazu sieht man sich
in der postmodernen Architekturdebatte in einer Phase „nach dem Funktionalismus des
Bauhauses und plädiert für Mehrfachcodierung, während sich die philosophische Diskussion
nach Auschwitz und nach 68 begreift“, sodass sie nicht umhinkommt, „das Ende der großen
Erzählungen“ zu verlautbaren (vgl. ibid.). Abgesehen von der Schwierigkeit, zu definieren,
wonach die Postmoderne kommt, erscheint es überaus komplex, den Begriff in seiner
Heterogenität zu fassen, da sich Vertreter wie „Lyotard, Derrida, Baudrillard, Eco, Rorty,
Welsch, Kamper, Marquardt u.a.“ nicht nur hinsichtlich ihrer „Positionen, Methoden,
Traditionslinien, sondern auch in dem, was sie unter postmodern verstehen“, unterscheiden
(vgl. ibid.). So bietet der Begriff der Postmoderne nur in Bezug auf seine Uneinheitlichkeit
einen Konsens:
Wenn die Postmoderne „überhaupt irgendwie einheitlich ist, dann wohl nur im Sinne einer
Wittgensteinschen ‚Familienähnlichkeit‘“. Die Heterogenität der Bewegung selbst also macht eine
Begriffsbestimmung schwierig und befördert die Rede von der Beliebigkeit. (Kösser 2006: 498)
Dementsprechend sind „Pluralität und Heterogenität“ als primäre Insignien der Postmoderne
zu begreifen (vgl. ibid.). Dabei ist es insbesondere dieser postmoderne Anspruch auf Pluralität,
der seinerseits einen Kontrast zur Moderne impliziert, denn:
Pluralität meint nicht nur die Existenz einer Vielfalt an Sicht- und Denkweisen, an Lebensstilen und
Lebensformen, und auch nicht nur Toleranz, sondern zielt auf das Bekenntnis zum Eigenwert der
heterogenen Elemente, verbunden mit einer Absage an modernes Einheitsstreben, das wiederum eine
Reaktion auf moderne Differenzierungsprozesse war. (Kösser 2006: 498)
Die Moderne zeichnet sich zwar durch Merkmale wie „Differenzierung, Arbeitsteilung,
Pluralität“ aus, strebt aber danach, diese miteinander in Einklang zu bringen, was ihre Tendenz
zu „Einheitsvisionen, Universalisierung, Ganzheitsdenken“ erklärt (vgl. ibid.). Typisch
moderne Resultate, welche sich aus der Logik solcher Einheitsbestrebungen ergeben,
manifestieren sich in Phänomenen wie „Universalwissenschaft und Universalgeschichte“, da
4die Moderne „immer ein Prinzip, das alles vorantreibt“ zu denken geneigt ist, „sei es der
absolute Geist oder Prinzipien a priori oder der Klassenkampf“ (vgl. ibid.). So geht es stets um
die Vereinigung von Getrenntem: „Natur und Kultur, Kunst und Leben, politische und
künstlerische Avantgarde, die Zusammenführung der getrennten Diskurse usw.“ (vgl. ibid.).
Aus der Perspektive der Einheitsphilosophie steht dem „Einen“ Vorrang vor dem „Vielen“ zu,
weil „Vielheit als Unglücksfall“ begriffen wird, den es zu reparieren gilt, sodass
„universalisiert, totalisiert, globalisiert, egalisiert, emanzipiert, revolutioniert“ werden muss
(vgl. ibid.: 498f.). Diese Einheitsphilosophie spiegelt sich auch im künstlerisch-ästhetischen
Feld der Moderne, welchem die Aufgabe obliegt, „verlorene Ganzheit wiederherzustellen oder
zu ermöglichen“ (vgl. ibid.: 499). Die Philosophie der Vielheit hingegen – durch die sich die
Postmoderne von der Moderne abhebt – plädiert für „den Vorrang des Vielen vor dem Einen“
(vgl. ibid.). Denn aus postmoderner Perspektive ist „Vielheit der Grundcharakter des Lebens“,
wogegen das Konzept der Einheit in Form von „Einheitswissenschaft, Einheitspartei,
Einheitsmeinung“ den „Unglücksfall“ darstellt, den es zu beheben gilt (vgl. ibid.). So äußert
sich die Postmoderne vor allem im Hinblick auf ihren Hang zu Detotalisierung,
Dezentralisierung, Differenzierung, Pluralisierung, Traditionalisierung, Regionalisierung und
Individualisierung (vgl. ibid.). Nach Ansicht von Odo Marquard (zitiert nach vgl. ibid.) „hat
die moderne Welt diese Balance von Einheit und Vielheit auszuhalten“, worin sich ein
wichtiger Hinweis auf die Tatsache artikuliert, „dass Postmoderne nicht wirklich nach der
Moderne ist, sondern in der Moderne, dass sie eine Denkhaltung ist, die gegen eine andere
Denkhaltung vorgeht“ (vgl. ibid.). Im Kontext der pluralistischen im Zeichen der Heterogenität
stehenden Vielheitsphilosophie geht es also nicht um Konsens, sondern um Dissens sowie um
„Differenz“ und „Inkommensurabilität“ (vgl. ibid.). Somit ist die Postmoderne gerade daher
nicht als Epochenbegriff zu betrachten, da sie nicht in einem zeitlichen Sinn auf die Moderne
folgt, „sondern sie ist nach der Moderne in einem polemischen Sinn“ (vgl. ibid. 500). Als
Denkhaltung begriffen stellt sich die Postmoderne immer zugleich als Kritik an der Moderne
dar (vgl. ibid.).
Dieser historische Moment der „Kritik und Selbstkritik der Moderne“ offenbart sich im
postmodernen „Bezug und Rückgriff auf vorhergehende Stufen“, was Postmoderne in gewisser
Weise zu einer „Fortsetzung der Dialektik der Aufklärung“ macht, die als solche zusätzlich
einer Radikalisierung unterworfen ist (vgl. Kösser 2006: 500).
5Diese radikalisierte aufklärerische Dialektik wirkt auf mehreren unterschiedlichen Ebenen:
[…] sowohl bezogen auf den Sachverhalt der Kritik an der Vermessenheit, an Beherrschungsstrategien,
am Fortschrittsdenken, an der Instrumentalisierung der Vernunft als auch unter Bezug auf das Werk
selbst. (Kösser 2006: 500)
Als weiteres Instrument derartiger „Modernekritik“ lässt sich auch die Marxsche Kritik am
Kapitalismus betrachten, dies gilt insbesondere insofern, als diese es vermochte, jene
„entscheidende Illusion der Aufklärung“ loszulassen, die in der Annahme bestand, „dass das
Bewusstsein allein die Realität verändern könne“ (vgl. ibid.). In ähnlicher Hinsicht steht
Nietzsches Konzept des Übermenschen im Zeichen der kritischen Betrachtung der Aufklärung,
welches die Absurdität des Ganzheitsdenkens entlarvend zu einer „Berufungsinstanz für
Postmoderne“ wurde (vgl. ibid.). Ebendiese Kapazität, Positionen von Denkern wie „Kant,
Marx, Nietzsche, Heidegger, Adorno u.a.“ auf polemische Weise einer kritischen Reflexion zu
unterziehen, lässt die Postmoderne als eine Form der „Anamnese der Moderne“ erscheinen (vgl.
ibid.: 500f.).
Einen besonders wichtigen Keim der Postmoderne-Diskussion birgt die gegen Ende der 1950er-
Jahre einsetzende „amerikanische Literaturdebatte“, die ein Erschlaffen der amerikanischen
Gegenwartsliteratur in Konfrontation zu „den einst großen Leistungen eines Yeats, Eliot, Pound
oder Joyce“ diagnostizierte (vgl. Kösser 2006: 501). Ihrer Erkenntnis der Tatsache, sich an
einem Punkt „nach der künstlerischen Moderne“ zu befinden, entspringt jene den Tod der
modernen Kunst proklamierende Diagnose, welche Kunst in einen Bereich der „Geschichte“,
fern von der „Wirklichkeit“ verfrachtete, was zur These der bereits vollzogenen
Institutionalisierung der Avantgarden und der daraus folgenden Musealisierung ihrer Werke
führte (vgl. ibid.). Der Begriff der Musealisierung meint hier die (Re-)Präsentation und
(Re-)Konstruktion des zeitlich oder räumlich Absenten (vgl. ibid.). Die Diagnose fußt auf
folgender Annahme:
Gerade in der „Moderne sammelt das Museum alles, was aus der Mode und aus dem Gebrauch kommt“,
das Museum ist das kulturelle Gedächtnis, gerade weil die Moderne immer neu sein will, daher ist der
Müllhaufen der Geschichte die Hauptquelle für museale Ausstellungen. Erst wenn Artefakte ihre frühere
Funktion verlieren und sich in geschichtlichen Müll verwandeln, ist der Übergang von der Realität in die
Sammlungen möglich, erst dann kann der Müll recycelt werden und der Kultur wiederum zugeführt
werden. (Kösser 2006: 501)
Laut Uta Kösser liegt ebendieser These ein für die Postmoderne zentraler Ansatz zugrunde (vgl.
ibid.).
Einen diesbezüglich bedeutenden Ausdruck postmoderner Reflexion erkennt die
Kulturwissenschaftlerin in Leslie A. Fiedlers „Cross the Border – Close the Gap!“ betiteltem
Aufsatz, welcher die Forderung formuliert, „aus der Grenzschließung oder
6Grenzüberschreitung von hoher und niederer Kultur, von belles-lettres und pop art, kritisches
Potenzial“ zu gewinnen (zitiert nach vgl. Kösser 2006: 501f.). Der Artikel selbst soll im
nachfolgenden Abschnitt der Arbeit noch einer genaueren Betrachtung unterzogen werden, hier
dient seine Nennung primär der Veranschaulichung des Panoramas postmoderner Positionen.
Demnach artikuliert Fiedlers Postulat
[…] insofern ein postmodernes Programm, als diese Differenzierung in „hohe“ und „niedere“ Kultur ein
Ergebnis der Moderne ist, das sich überlebt hat, und man nun nach dieser Einteilung der Moderne nach
neuen Wegen sucht. Es geht jedoch nicht darum, hohe und niedere Kultur zu vereinigen – dies wäre ein
modernes Programm –, sondern es soll ein „vieldeutig Neues“ entstehen, was sich nicht mehr in die alten
Polarisierungen einordnen lässt, weil diese alten Wertorientierungen nicht mehr greifen. (Kösser 2006:
502)
Denn: „Fiedler will diese moderne Vereinheitlichung subversiv gebrauchen: wider die
Ordnung, wider die Hierarchien.“ (ibid.). In dieser „Akzentuierung von Pluralität und
Doppelkodierung“ liegt ein Keim jener zivilen und künstlerischen Protestbewegungen, die sich
in den USA gegen den Vietnamkrieg und die „Institutionalisierung der Moderne“ richteten (vgl.
ibid.: 502f.). Andreas Huyssen verweist in diesem Kontext auf die Tatsache, „dass ein großer
Teil der europäischen Avantgarde in die USA emigriert war und dort nun als ehemals
vehementer Kritiker der Institution Kunst selbst zu einer Institution wurde“, weswegen die
amerikanische Postmoderne auch aus der Perspektive der Bewegungen der Gegenkultur der
1960er- und 1970er-Jahre zu betrachten ist (zitiert nach vgl. Kösser 2006: 503).
In der auf die literarische Debatte folgenden „Architekturdebatte“ wird die Postmoderne
schließlich „mit dem Programm tatsächlicher Pluralität verbunden“, sodass Vilém Flusser sogar
so weit geht, den Ursprung des Wortes „postmodern“ in der Architektur zu verankern, da
„einige Architekten es mehr als satt haben, Gebäude so zu entwerfen, wie sie das unter dem
Titel ‚modernes Bauen‘ gelernt hatten“ (zitiert nach vgl. Kösser 503f.). Zugleich vermag es die
architektonische Dimension, die Postmoderne empirisch und sinnlich erfahrbar zu machen:
Architektur steht also einerseits als sichtbarer Beleg für das Scheitern moderner Projekte und auch für ein
Denken nach Auschwitz, für Kritik an Industrialisierung versus Kapitalisierung, andererseits erscheint
sie als das Feld, wo das Programm der Postmoderne bereits erlebbar, sichtbar wird, wo die Erzählung
der Postmoderne von der Pluralität gestaltet wird. (Kösser 2006: 504)
Dieses Vermögen, sich selbst zu versinnlichen, liefert „wiederum ein Indiz dafür, dass die
Postmoderne sich in der Moderne befindet, denn auch die Moderne nutzt die Künste zur
Versinnlichung ihrer Programme“, wobei sich die Postmoderne nichtsdestotrotz „zugleich nach
der Moderne“ befindet, da sie sich „ganz konkret von deren »Scheußlichkeiten« abgrenzt“ (vgl.
ibid.). Demnach äußern sich in der Postmoderne jener paradoxale „Dualismus“ und jene
„Doppeldeutigkeit“, die auch ihrem hybriden Namen innewohnen, wonach sie laut Jencks „die
Fortsetzung der Moderne und zugleich ihre Transzendenz“ bedeutet (zitiert nach vgl. Kösser
72006: 505). Anhand des öffentlichen Raums bietet die Architektur jene der Postmoderne
inhärente Chance, „das Nebeneinander verschiedener Möglichkeiten“ auszudrücken und somit
ein Bekenntnis zu „Pluralität“ zu liefern (vgl. ibid.). Charakteristisch für „eine gelungene
Pluralität“, die sich „von bloßer Beliebigkeit“ abhebt, ist laut Jencks der „doppelte Code“, der
„sowohl neu wie alt als auch elitär wie populär“ ist (zitiert nach vgl. Kösser 2006: 505). Ein
aus philosophischer Sicht an die Pluralität gekoppeltes und für diese zentrales Konzept ist das
der „Gerechtigkeit“ (vgl. ibid. 506), da:
[…] Pluralität in diesem Verständnis nicht mit einfachem Zitieren oder Kombinieren erschöpft ist, nicht
nur einfach Heterogenität anerkennt, sondern dem Heterogenen, dem je Verschiedenen auf Grund seiner
Spezifik und Tradition eine bestimmte Funktion und Berechtigung zuweist, das jeweils Spezifische
optimal zur Geltung zu bringen, seine Möglichkeiten anzuerkennen, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen, damit auch ihre Widersprüche zur Geltung zu bringen. (Kösser 2006: 506)
So werden „‚Sprachspielereien‘“ traditioneller und moderner Natur laut Jencks „nicht
synthetisiert, sondern in ihrem ganzen Spannungsverhältnis nebeneinander gestellt“, worauf sie
zur „Allegorie für unsere aufgesplitterte, schizophrene Kultur“ werden (zitiert nach vgl. Kösser
2006: 506). Analog dazu begreift auch Lyotard im Rahmen seiner sprachphilosophischen
Analyse Heterogenität als „wesentliches Merkmal der Sprache“ sowie „der gesellschaftlichen
Strukturen, für die Sprache nur ein Modell darstellt“ (zitiert nach vgl. Kösser 2006: 507). Für
ihn ist „Widerstreit“ ein „Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der nicht
angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare
Urteilsregel fehle“ (vgl. ibid.). Lyotard geht es aber „nicht darum, den Widerstreit aufzulösen,
zu beheben, Konsens herzustellen, sondern ihn zu bezeugen, d.h. immer wieder darauf zu
verweisen, dass er besteht“ (vgl. ibid.). Dabei handelt es sich um eine auf Gerechtigkeit zielende
Aufgabe, die laut Lyotard dem künstlerischen und philosophischen Diskurs obliegt:
Daher sind für Lyotard der Künstler und der Philosoph in der gleichen Situation: Sie müssen vom
Widerstreit zeugen, indem sie die Idee der Gerechtigkeit aufrechterhalten. Die Idee der Gerechtigkeit als
Idee aufrechtzuerhalten, ist ein weiteres Verfahren, das zu dieser postmodernen Gerechtigkeitskonzeption
gehört. Eben weil die Diskursarten heterogen sind, ist eine positive Realreform unmöglich, man kann
eine universelle Gerechtigkeit nicht realisieren. Praktisch ist nur „weniger Ungerechtigkeit“ möglich.
(Kösser 2006: 509)
In diesem Sinne enthält diese postmoderne Konzeption der Gerechtigkeit „auch resignative
Züge“, da „die Widerstreite“ ertragen werden müssen (vgl. ibid.).
Lyotards Gerechtigkeitskonzept enthält auch einen Verweis auf die europäische Situation, die
sich zu dem Zeitpunkt, als die „Moderne-Postmoderne-Diskussion“ anläuft, stark von der
amerikanischen unterscheidet (vgl. Kösser 2006: 510). Denn:
Die Studentenbewegung von 68 ist vorbei, sie gilt als gescheitert. 1968 scheitert darüber hinaus nicht nur
die Studentenbewegung, sondern für die linken westeuropäischen Intellektuellen wird – u.a. durch den
8Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die ČSSR – offensichtlich, dass der real existierende
Sozialismus sein Versprechen als machbare Alternative nicht einlösen kann. (Kösser 2006: 510)
Konsequenz dieser Enttäuschung ist die Tatsache, dass die Moderne in Europa nicht nur in
Hinblick auf „Institutionalisierung der Kunst, Masse- und Elitekunst, Funktionalismus, Bauen
mit einem emanzipatorischen Programm“ hinterfragt wird, sondern dass eine allgemeine
Revision stattfindet, im Zuge derer die Moderne „insgesamt hinsichtlich ihres philosophischen
Anspruchs auf Herrschaft des Menschen über seine Bedingungen, als Streben nach
unaufhaltsamen Fortschritt infrage gestellt“ wird, indem es zu einer Konfrontation dieses
Anspruchs mit Negativfolgen wie „Auschwitz und Gulag“ kommt (vgl. ibid.). Eine derartige
Problematisierung der Moderne zeichnete sich schon in der aufklärerischen Dialektik ab, sie
wird durch das postmoderne Denken nun fortgesetzt, sodass dieses als „Denken nach
Auschwitz“ erscheint (vgl. ibid.). Verschärft wird diese Problematisierung durch die Einsicht,
dass der moderne Kapitalismus nicht nur nicht überwunden werden konnte, sondern sich
weiterentwickelt hat und gar unüberwindbar scheint, da keine Alternative in Sicht ist (vgl.
ibid.). Aus diesen Gründen erscheint die europäische Postmoderne für Lyotard nicht als jener
fröhliche „Kehraus der Moderne“, als der sie in der amerikanischen Literaturdebatte diskutiert
wird, sondern stellt einen Begriff dar, „der grundlegende Zweifel am Projekt resp. den Projekten
der Moderne und ihren Folgen artikuliert“ (zitiert nach vgl. Kösser 2006: 510f.).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Postmoderne vor allem anhand des Merkmals
„Unbestimmtheit oder, genauer gesagt Unbestimmtheiten“ fassbar wird, welches sich in
unterschiedlichen „Arten von Ambiguitäten, Brüchen, Verschiebungen innerhalb unseres
Wissens und unserer Gesellschaft“ manifestiert (vgl. Hassan 1988: 49). Besagte
„Unbestimmtheiten durchziehen unsere Aktionen, Ideen, Interpretationen, sie machen unsere
Welt aus“ (vgl. ibid.). Der Ursprung dieses Unbestimmten liegt in jener allen postmodernen
Phänomenen innewohnenden „Fragmentarisierung“ (vgl. ibid.). Denn:
Der postmoderne Mensch nimmt lediglich Trennungen vor; Fragmente sind angeblich das einzige, dem
er noch vertraut. Seine tiefste Verachtung gilt jeglicher „Totalisierung“, jeglicher Synthese, sei sie
sozialer, kognitiver oder sogar ästhetischer Art. Daher seine Vorliebe für Montage, Collage, das
literarische objet trouvé, cut up, für Formen der Parataxe anstelle von Hypotaxe, für Metonymie statt
Metapher, Schizophrenie statt Paranoia. Daher erklärt sich auch die Hinwendung zum Paradoxon,
Paralogischen, zur Parabasis, Parakritik, zur Offenheit des Zerbrochenen, zu unerklärten Randzonen.
(Hassan 1988: 49)
92. Der literarische Paradigmenwechsel: Wesen und Potential des postmodernen Romans
Der im Jahre 1969 im Playboy erschienene Essay „Cross the Border – Close the Gap“ des
nordamerikanischen Literaturwissenschaftlers und -kritikers Leslie A. Fiedler offenbart ein
zentrales Postulat der theoretischen Reflexion der Postmoderne, das darin besteht, jene
zwischen Elite- und Massenkultur klaffende Kluft zu überwinden (vgl. Fajen 2007: 39 und vgl.
Welsch 1988: 22).
Bevor ich zur hier relevanten Abhandlung der darin präsentierten Thesen schreite, sei an dieser
Stelle auf die Tatsache verwiesen, dass Leslie A. Fiedlers Aufsatz (vgl. 1988) mir bereits in
meiner Arbeit Die Geburt des „Pulp“ aus dem Geist der Postmoderne zur Erörterung der
Besonderheiten des postmodernen Romans diente, weswegen der Darstellung der Kernthesen
des Autors jene Reihenfolge zugrunde liegt, welche auch die soeben erwähnte Arbeit prägt (vgl.
Cvjetković 2020).
Fiedlers Text wurde zu Beginn häufig als bloßes Plädoyer für Popkultur und Pornographie
missverstanden, doch ist er weit mehr als das, denn der Autor artikuliert darin ein „Programm
von Postmoderne“, das nicht nur zur Überwindung des elitären Kunstverständnisses dient,
sondern auch für die Fusion populärer und elitärer Register im Sinne einer postmodernen
„Pluralität und Mehrdimensionalität“ eintritt (vgl. Welsch 1988: 22).
So sah Fiedler seine Zeit durch den „Todeskampf der literarischen Moderne und die
Geburtswehen der Post-Moderne“ gekennzeichnet, weswegen er jene Literatur, die sich mit
dem Attribut ‚modern‘ zu versehen pflegt, für „tot“ erklärte (vgl. Fiedler 1988: 57). Bei dieser
dem Tode geweihten modernen Literatur handelt es sich um jene, „deren Siegeszug kurz vor
dem ersten Weltkrieg begann und kurz nach dem zweiten endete“, sodass sie nicht mehr dem
Bereich der Wirklichkeit, sondern jenem des Historischen zuzurechnen ist (vgl. ibid.). Das
Adjektiv „modern“ empfindet Fiedler dabei als Anmaßung, da es darauf anzuspielen scheint,
dass es sich um die literarische Repräsentation größtmöglicher „Fortgeschrittenheit in
Sensibilität und Form“ handle, weswegen eine über derartige Literatur hinausgehende
Innovation nicht mehr möglich sei (vgl. ibid.). Der von Fiedler proklamierte Tod dieser
anmaßenden modernen Literatur impliziert für das Genre des Romans, dass „das Zeitalter von
Proust, Joyce und Mann vorüber ist“, für jenes der Lyrik, dass „T.S. Eliot und Paul Valéry
passé“ sind (vgl. ibid.).
10Diese im Anbruch befindliche neue postmoderne Zeit erfordert eine neue Kritik, die der
neuartigen Literatur gewachsen ist und diese zu begreifen vermag, denn:
Wir leben jetzt in einer sehr anderen Zeit – apokalyptisch, antirational, offen romantisch und sentimental;
einer Zeit freudvoller Misologie und prophetischer Verantwortungslosigkeit, mißtrauisch gegen Ironie
als Selbstschutz und allzu große Bewußtheit von sich selbst. Wenn Kritik überleben soll, wenn sie also
nützlich, lebensfähig und wichtig werden oder bleiben soll, muß sie radikal verändert werden, jedoch
nicht in der von marxistischen Kritikern angedeuteten Richtung, wie subtil und differenziert sie auch sein
mag. (Fiedler 1988: 58)
Der Aufgabenbereich dieser neuen Kritik wird sich nicht vordergründig „mit Fragen der
Struktur, Diktion oder Syntax“ befassen, schließlich müsse sie im Angesicht dieses neuen
kulturellen Panoramas der Versuchung trotzen, sich selbst ernst zu nehmen oder derartigen
„Unernst“ zumindest ihrer Leserschaft gestatten, da sie sonst Gefahr laufe, die „Wiedergabe
des gespreizten Kanons aus vornehmer Tradition und dem niederschmetternden Gejammer der
Kulturreligion des Modernismus“ fortzusetzen (vgl. Fiedler 1988: 58f.). So müsse die Kritik
neuester Ausprägung „ästhetisch und poetisch in Form und Inhalt sein, gleichzeitig aber auch
komisch, respektlos und vulgär“ (vgl. ibid.: 59). Eine solche, der neuen Zeit angemessene Kritik
bezeichnet Fiedler als „Tod-der-Kunst-Kritik“ (vgl. ibid.).
Im Genre des Romans erkennt Fiedler die erste „Form von Pop-Literatur“, die sich des
Umstands bewusst war, dass „ihre Lebenszeit, verglichen mit den klassischen Formen des Epos
und der Tragödie, notwendigerweise kurz sein würde“ (vgl. Fiedler 1988: 60). Damit soll aber
keineswegs der Tod des gedruckten Buchs heraufbeschworen werden, es ginge nur um die
Einsicht, dass ebendieses „gedruckte Buch in all seinen Formen, besonders aber vielleicht in
der des Romans, radikal zu verändern ist“ (vgl. ibid.). Schließlich scheint Folgendes
festzustehen: „So sicher, wie der alte Gott tot ist, ist es der alte Roman“ (Fiedler 1988: 60).
Dementsprechend hat ein Kommunikationsmedium, wenn es aus der Mode kommt, zu einer
„Form der Unterhaltung“ zu werden (vgl. ibid.). Dies veranschaulicht Fiedler, indem er den
Roman mit anderen kulturellen Phänomenen wie „dem der Vorlesung und des christlichen
Gottesdienstes“ konfrontiert, um festzustellen, dass diese ausschließlich aufgrund ihres
Selbstbewusstseins überdauert hätten (vgl. ibid.). Denn:
So wie die seriöse Vorlesung durch die Technologie des 15. Jahrhunderts und der seriöse Gottesdienst
durch die Philologie des 18. und 19. Jahrhunderts bedroht wurden, werden der seriöse Roman und die
seriöse Kritik durch Technologie und Philologie des 20. Jahrhunderts bedroht. Das Selbstbewußtsein des
Romans muß – gleich dem der Vorlesung und des christlichen Gottesdienstes – das Bewußtsein seiner
eigenen Absurdität, ja Unmöglichkeit, einschließen. Da der seriöse Roman unserer Zeit der Kunstroman
ist, wie er von Proust, Mann und Joyce begründet und von deren Epigonen nachgeahmt wurde, müssen
wir jener merkwürdigen Mischung aus Dichtung, Psychologie und Dokumentation, deren wirkliches,
wenn auch nicht immer eingestandenes Ziel es war, sich zu kanonisieren, abschwören. (Fiedler 1988: 60)
11Die Tatsache, dass die westlichen Gesellschaften sich an einem Punkt befinden, in dem nicht
nur die Bibel als „das Buch“ an Autorität im Sinne eines Referenzsystems verloren hat, sondern
Bücher im Allgemeinen ihren Einfluss auf die Menschheit eingebüßt haben, fördert die
Notwendigkeit eines neuartigen Romans zutage (vgl. Fiedler 1988: 61). Dieser „wirklich Neue
Roman“ müsse seinem Wesen nach vor allem „anti-künstlerisch und anti-seriös sein“ (vgl.
ibid.). Diesem Diktum widerspricht beispielsweise „der sogenannte nouveau roman“, der „in
seinem tödlichen Ernst alles andere als wirklich neu“ ist (vgl. ibid.). Als „Prototyp des neuen
Romanciers“ erscheint Fiedler hingegen der Franzose Boris Vian, „obwohl er seit zehn Jahren
tot ist und seine bezeichnende Arbeit in den Jahren kurz nach dem Zweiten Weltkrieg
entstanden ist“ (vgl. ibid.). Denn mit dem Roman I’ll Spit On Your Grave sei es Vian zumindest
beinahe gelungen, die Grenze zwischen belles-lettres und pop-art zu überwinden (vgl. ibid.).
Als Mittel dieser annähernden Überbrückung der Kluft zwischen elitärer und populärer Kultur
diente dem Franzosen das Eintauchen in die der Kritik unterworfene, nordamerikanische
Kultur:
Er war, vor allem, ein Amerikaner im Geist [...], der sich im Widerstand gegen die amerikanische Politik
befand just in dem Augenblick, als er am tiefsten in seine ‚Volkskultur‘ eingetaucht war – schrieb er doch
gerade einen Detektivroman mit dem Titel I’ll Spit on Your Grave unter dem Pseudonym Vernon Sullivan
und unter der Vorgabe, nur der Übersetzer ins Französische zu sein. Kraft dieses Verschnitts aus
mythologischem Amerikanismus gelang es ihm, einen Fuß über die Grenzlinie zu setzen, wenn nicht gar
die Lücke zu schließen zwischen hoher Kultur und niederer, belles-lettres und pop-art. Auf der einen
Seite war er der Verfasser von pop songs und ein Jazztrompeter, beeinflußt vom New-Orleans-Stil,
andererseits aber ein Romanautor, der unter dünner Tünche französische Intellektuelle wie Jean Paul
Sartre und Simone de Beauvoir aufs Korn nahm. (Fiedler 1988: 61f.)
In ebendieser „Überbrückung der Kluft zwischen Elite- und Massenkultur“ erkennt Fiedler „die
exakte Funktion des Romans heute“ (vgl. ibid.: 62). Die neuen Romanformen würden sich
„offen der Formen des Pop“ bedienen und wie „die ‚hardboiled‘ Detektivgeschichten“ Boris
Vians „möglichst weit weg von Kunst und Avantgarde, weit entfernt von Innerlichkeit, Analyse
und Anspruch, daher immun gegen Lyrizismus als auch platten sozialen Kommentar“ sein (vgl.
ibid.). Demnach würden die neuen, postmodernen Romanformen, statt den Kompromiss mit
dem Marktplatz zu scheuen, bewusst jenes Genre präferieren, „das sich der Exploitation durch
die Massenmedien am ehesten anbietet, den Western, Science-fiction [sic.] und Pornographie“
(vgl. ibid.).
12II. Utopie und Dystopie: Theoretischer Abriss
1. Zum Begriff der Utopie
Die historischen Ursprünge der Utopie im Sinne „der literarischen Darstellung eines idealen
Staates“ wurzeln bereits in der Antike (vgl. Haufschild / Hanenberger 1993: 5). Der Begriff der
Utopie ist jedoch bei Weitem jünger als das Phänomen selbst. Denn obgleich Platons Politeia
als „erste rational durchkonstruierte Utopie“ gilt, erscheint der Terminus, der dem Genre den
Namen verleiht, erst im Jahre 1516 mit der Veröffentlichung von Thomas Morus‘ Utopia1 (vgl.
Biesterfeld 1982: 1 und vgl. Haufschild / Hanenberger 1993: 5). Der von Morus stammende
Begriff, der nicht nur „namensgebend für eine ganze literarische Gattung“ war, sondern auch
Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch fand, ist eine Ableitung des griechischen „ou-
topos (= Nicht-Land) oder eu-topos (= Schön-Land), wahrscheinlich aber von beidem zugleich“
(vgl. Haufschild / Hanenberger 1993: 5). Da es für das griechische Wort keinerlei Belege in der
klassischen Sprache gibt, scheint es sich um eine „humanistische Neubildung“ zu handeln (vgl.
Biesterfeld 1982: 1). Im Allgemeinen bezeichnet der Terminus „Utopie“ die Gesamtheit aller
literarischen Werke, „die sich mit der Schilderung eines nicht existierenden Staatsgebildes
befassen, das Idealcharakter besitzt“ (vgl. Haufschild / Hanenberger 1993: 5).
Was Morus‘ Utopia betrifft, so handelt es sich um eine Reiseerzählung in Dialogform, in der
der Reisende (Raphael Hythlodaeus) Bericht „über ein ideales, vernünftiges Staatswesen auf
einer Insel irgendwo in der Südsee“ erstattet (vgl. Seeber 1983: 7). Die Rede ist folglich von
einem philosophischen Text, dessen Name nach Ansicht von Altphilologen den
Wortbildungsregeln der griechischen Sprache zuwiderläuft. Diese grammatische Inkorrektheit
ist ein Hinweis auf den von Morus implizierten „unseriösen, phantastischen, spielerischen
Charakter seiner Erfindung“, wodurch diese sich sogleich als Fiktion zu erkennen gibt (vgl.
ibid.). Demnach spielt Morus bewusst mit der „Doppelbedeutung des Präfixes ou, das im
Englischen wie eu ausgesprochen wird“, woraus sich dann „Eutopia“ (ein Synonym zu „Gut-
Ort“) ergebe (vgl. ibid.). Diese doppelte, zwischen Ideal und Fiktion oszillierende Bedeutung
ist es, welche die Begriffsgeschichte der Utopie seit jeher prägt (vgl. ibid.). Denn:
Das ideale Gemeinwesen wird in Form einer literarischen Fiktion präsentiert. Und während sich die einen
nur an dem rein literarischen Charakter des Phänomens ergötzen, betrachten andere, zumal Historiker
und Soziologen, das Literarische nur als Einkleidung und die systematische Exposition eines anderen
Staatswesens als das Entscheidende. (Seeber 1983: 7)
1
Der lateinische Originaltitel lautet: „[Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo
reipublicae statu deque nova insula Utopia]“ (vgl. Haufschild / Hanenberger 1993: 5).
13Doch im Laufe zahlreicher von Wissenschaft, Politik und Journalismus hervorgebrachter
Diskurse wurde der Begriff mit immer neuen Bedeutungen versehen, wodurch er (beeinflusst
von Ernst Bloch, Karl Mannheim und anderen) eine Abkoppelung vom literarischen Terrain
erfuhr, sodass er aus dem politischen Sprachgebrauch kaum mehr wegzudenken ist (vgl. ibid.).
Im 20. Jahrhundert gelangten Terminus und Objekt der Utopie dann zu einer scheinbar heute
noch anhaltenden Blüte, die nicht zuletzt mit dem Erscheinen der Anti-Utopien von Aldous
Huxley (Brave New World) und George Orwell (Nineteen Eighty-Four) in Verbindung zu
stehen scheint, welche es vermochten, die Utopie im kollektiven Bewusstsein zu verankern und
sie „zu einem nicht zu unterschätzenden politischen Schlagwort“ zu machen (vgl. ibid.).
Aufgrund „ihrer politischen, satirischen und technischen Phantasie“ wird auch der literarisch
anspruchsvollen Science Fiction häufig ein enger Konnex zur utopischen Literatur nachgesagt,
weswegen sich sagen lässt, dass „ein beträchtlicher Teil der Romanproduktion des 20.
Jahrhunderts einen mehr oder weniger starken utopischen Charakter aufweist“ (vgl. ibid.).
Die übermäßige „Erweiterung und Ausdifferenzierung“ des semantischen Gehalts von „Utopie“
hat zwei nicht unproblematische Extrempositionen hervorgebracht; auf der einen Seite befinden
sich jene Sprachrohre der literarischen Norm, die „das Prädikat »Utopie« am liebsten auf den
vieldeutigen literarischen Prototyp des Thomas Morus“ beschränken wollen, auf der anderen
Seite stehen jene Instanzen der Literaturwissenschaft, „die Utopie mit Literatur und Kunst
schlechthin“ assoziieren (vgl. Seeber 1983: 8). Demzufolge ist es nötig, einzugestehen, dass
auch Texten, die nicht in die „Gattungstradition Utopie“ fallen, eine „utopische Qualität“
zugrunde liegen kann, sofern diese „Gegenbilder zur Wirklichkeit enthalten“ (vgl. ibid.).
Auch fern des künstlerisch-literarischen Feldes pendeln die Betrachtungen der Utopie zwischen
zwei Extremen: Während in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine „ausgesprochene
Utopie-Feindschaft“ herrscht, da das Utopische mit totalitären Systemen, die eine offene
Gesellschaft gefährden, konnotiert wird, warnen andere „vor einem Utopieverlust der Kultur“,
da diese „ohne utopische Ziel- und Wunschvorstellungen“ Gefahr laufe, „ihre Vitalität zu
verlieren“ (vgl. Seeber 1983: 8). Am Ende des 19. Jahrhunderts geht Oscar Wilde sogar so weit
zu behaupten, dass Fortschritt das Resultat der Verwirklichung von Utopien sei (vgl. Seeber
1983: 8f.).
Dieses dem Utopischen innewohnende „Prinzip Hoffnung“ erklärte „Ernst Bloch, der große
Erforscher der Utopie und des Utopischen“, zu einer alles Anthropologische prägenden
„Konstante“, die sich als solche „in allen Manifestationen des menschlichen Geistes“ findet
(vgl. Seeber 1983: 9).
14Denn:
[…] utopisches Denken hinterläßt allenthalben seine Spuren, in Tagträumen vom privaten Glück ebenso
wie in Entwürfen einer besseren Sozialordnung, in den großen Monumenten der Renaissance-Kunst
ebenso wie in den Symphonien von Beethoven. Es kommt nach Bloch darauf an, „das Hoffen zu lernen,
das Futurum philosophisch zu durchdringen.“ „Es gibt keinen Realismus“, schreibt Bloch in Das Prinzip
Hoffnung, „der einer wäre, wenn er von diesem stärksten Element in der Wirklichkeit als einer unfertigen
abstrahiert.“ Als „Traum nach vorwärts“, zielt seine „konkrete Utopie“ auf eine Veränderung der
Wirklichkeit in Richtung auf mehr Freiheit und Gerechtigkeit. Die problematische Dialektik dieses
Progresses, d.h. die Erfahrung, daß die u.a. von der Utopie gelenkte und beschleunigte
Geschichtsbewegung einen erschreckenden Preis abfordert, ist eines der großen philosophischen Themen
unseres Jahrhunderts. (Seeber 1983: 9)
Das Thema der Utopie ist ein universelles, das mit Grundtopoi der „philosophischen Ethik“
sowie „mit theologischen und staatstheoretischen Überlegungen“ und
„geschichtsphilosophischen Theoremen“ in Verbindung steht (vgl. ibid.). „Utopische
Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte“ florierten vor allem in Zeiten soziohistorischer
Umbrüche wie „der Renaissance oder dem frühen 19. Jahrhundert“ (vgl. ibid.: 10).
Dementsprechend steht fest, dass sich im Rahmen der Erforschung des Utopiebegriffs eine
interdisziplinäre Grenzüberschreitung nicht vermeiden lässt, auch wenn man den Fokus auf
Aspekte der Literaturwissenschaft legt. Doch trotz des polysemen Gehalts von „Utopie“ haben
sich „drei Grundbedeutungen“ herauskristallisiert (vgl. ibid.). Demnach meint Utopie:
1. eine literarische Gattung, die auf einen Prototyp zurückgeht;
2. einen wirklichkeitsübersteigenden Entwurf einer „anderen“ Gesellschaft, die besser (Idealstaat) oder
auch schlechter als die Wirklichkeit ist, in jedem Falle aber anders sein muß. Eine solche Vorstellung
kann in literarischen oder nicht-literarischen Texten vorkommen. Man könnte diesen zweiten
Bedeutungsschwerpunkt unter den Begriff „utopisches Denken“ subsumieren;
3. umgangssprachlich und abwertend eine nicht zu verwirklichende, realitätsfremde Idee, wishful
thinking, Illusion, Schimäre. (Seeber 1983: 10)
Der deutsche Philosoph Wilhelm Kamlah definiert Utopie gar aus einer rein literarischen
Perspektive (vgl. ibid.). Seine Darlegung lautet folgendermaßen:
„Eine Utopie ist die literarische Fiktion optimaler, ein glückliches Leben ermöglichender Institutionen
eines Gemeinwesens, die faktisch bestehenden Mißständen kritisch gegenübergestellt werden.“ (Seeber
1983:10)
Aus Sicht der Literaturwissenschaft handelt es sich dabei um eine zu enge Begriffsdefinition.
Obwohl Kamlah explizit die „Spannung zwischen Wirklichkeit und Ideal“ als ausschlaggebend
für das „Prinzip der Utopie“ ausweist und somit die „gesellschaftskritische Intention“ des
Genres anerkennt, schließt er mit seiner inhaltlichen Einschränkung eine Vielzahl satirischer
und utopiekritischer Texte aus, die für die Geschichte der literarischen Utopie maßgeblich sind
(vgl. Seeber 1983: 11).
15Demnach kann Fiktionalität nicht als gattungsbildendes Merkmal herhalten:
Im 17. und 18. Jahrhundert gibt es Reiseberichte über „andere“ Länder, bei denen sprachlich und
inhaltlich nicht eindeutig auszumachen ist, ob sie nun real oder fiktiv sind. Platons Politeia, das große
Vorbild für Morus, spricht über den gerechten Staat nur im Modus des Sollens, entspräche also nicht der
Forderung einer „literarischen Fiktion“. Eine literarische Fiktion setzt nämlich das stillschweigende
Einverständnis zwischen Autor und Leser voraus, daß hier erfundene Sachverhalte so ausgesagt werden,
als ob sie wahr wären, sei es in einer Erzählung oder einer Beschreibung. (Seeber 1983: 11)
Interessanterweise wurde der Begriff „Utopie“ im englischen Sprachraum sehr lange gar nicht
mit einer literarischen Gattung assoziiert, weswegen das Nomen „utopia“ im Oxford English
Dictionary des Jahres 1961 lediglich in seiner „räumlichen und politisch pejorativen Bedeutung
verzeichnet“ ist (vgl. ibid.). Die räumliche Denotation erhielt der Begriff im Jahre 1551 mit der
Übersetzung von Morus‘ Utopia ins Englische, durch welche das Wort Eingang in die Sprache
fand und primär „die Insel mit ihren idealen sozialen Institutionen, schließlich jeden Raum, der
vollkommene soziopolitische Zustände aufweist“ bezeichnete (vgl. ibid.). Das im politischen
Sinne negative (bis heute wirksame) Konnotat wurde dem Begriff dann im 17. und 18.
Jahrhundert zuteil, wo er für „an impossibly ideal scheme, esp. for social reconstruction“ stand
(vgl. ibid.). Eine ähnliche Entwicklung durchläuft auch das Adjektiv „utopian“, das sogar noch
früher als das Nomen „den schimärischen, unwirklichen Charakter utopischer Perfektion
anzeigt“ (vgl. ibid.). Die Tatsache, dass in diesem Sprachgebrauch Utopie nichts mit Literatur
gemein hat, hängt eventuell mit der „Überlegenheit des Inhalts, der utopischen Idee, über ihre
Art der Präsentation“ zusammen (vgl. Seeber 1983: 12).
Wie es scheint, beruht die „negative Bewertung der Utopie“ auf drei Positionen (vgl. Seeber
1983:12). Diese sind:
1. Der pragmatische Realismus, dessen „gesunder Menschenverstand“ sie ob ihrer
Unvereinbarkeit mit der Erfahrung verwirft und das Utopische „als gefährliches „Hirngespinst“
anprangert“ (vgl. ibid.);
2. „Die Religion“, die sich „die Verfügung über die Heilsgüter […] ungern wegnehmen“ lässt,
weswegen ihre Vertreter den „Utopisten“ zum Vorwurf machen, dass „sie unbefugt den
Himmel auf die Erde zerren und damit einen Akt menschlichen Hochmuts begehen“ (vgl. ibid.).
Schließlich ließe sich im Umkehrschluss kontern, „der Himmel sei eine ins Jenseits verlegte
Utopie, eine religiöse Utopie“ (vgl. ibid.);
3. „Der Marxismus“, der sich gegen den „abstrakten, »vorwissenschaftlichen« Charakter des
utopischen Sozialismus“ wendet, dem er einen wissenschaftlichen Sozialismus gegenüberstellt
(vgl. ibid.).
16Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus
sowie durch die im Jahre 1888 erfolgte Veröffentlichung von Bellamys Looking Backward
zusätzlich politisiert, wovon auch Neubildungen wie „Utopist“ und „Utopismus“ zeugen (vgl.
Seeber 1983: 13).
Die weiter oben beschriebene zweite Komponente der Bedeutung des Begriffs „Utopie“ wurzelt
in „analytischen Bemühungen von Philosophen und Wissenssoziologen des 20. Jahrhunderts“,
wobei diesbezüglich vor allem Karl Mannheim begriffsprägend war, als er in seinem 1929
erschienenen Klassiker Utopie und Ideologie das „utopische Bewusstsein“ zur „Grundlage
jeglicher Utopie“ erklärte (vgl. Seeber 1983: 13). Bei diesem Bewusstsein handelt es sich um
eines, „das sich mit dem es umgebenden ‘Sein’ nicht in Deckung befindet“, weswegen seine
die Wirklichkeit transzendierenden Vorstellungen Konsequenzen für die „Seinsordnung“ haben
können, wenn es diesen glückt, die „historische Seinswirklichkeit durch Gegenwirkung in der
Richtung der eigenen Vorstellung zu transformieren“ (vgl. ibid.). Im Gegensatz zur Ideologie,
die Mannheim als „irreale Wahnvorstellung“ („ohne umwälzende Wirksamkeit“) versteht, ist
die Utopie „etwas Geschichtsmächtiges“, dem die Intention innewohnt, die bestehende
Gesellschaft zu sprengen (vgl. ibid.). So legt Mannheims „utopische Intention“ den Grundstein
für jene Interpretationsweise, die im utopischen Denken „vor allem eine Kritik der
gesellschaftlichen Wirklichkeit erkennt“ und „in dieser Kritik die eigentliche Absicht der
Utopien sieht“ (vgl, ibid.). In diesem Sinne wird die „utopische Intention“ zur „Negation des
Bestehenden“ (vgl. ibid.).
Hinsichtlich der Analyse der literarischen Utopie birgt dieser intentionale Utopiebegriff
folgende zwei Konsequenzen; einerseits ist es wichtig, „die entstehungsgeschichtlichen
Zusammenhänge zwischen der jeweiligen Utopie und der zeitgenössischen Wirklichkeit“,
welche sie kritisiert, zu beleuchten, andererseits muss die der Kritik inhärente literarische Form
„(Satire, Groteske, Komödie, Polemik, Argumentation, selektive Beschreibung etc.)“ eruiert
werden (vgl. Seeber 1983: 14).
Trotz der bereits erläuterten (vom 16. bis zum 18. Jahrhundert manifesten) Dominanz des
räumlichen und politisch abwertenden Utopiebegriffs, ist seit dem 17. Jahrhundert ein
Gattungsbewusstsein vorhanden, was bedeutet, dass Klarheit darüber herrscht, dass durch
Thomas Morus eine neue Art „von Reiseerzählungen angestoßen wurde, für die man aber noch
keinen eigenen Namen hatte“, weswegen man dazu tendierte, das Neue in bereits vertraute
Gattungen wie jene der Satire oder der Romanze einzuordnen (vgl. Seeber 1983: 14). Diese
Tendenz lässt sich auch im deutschen Sprachraum des 18. Jahrhunderts feststellen, wo man in
17Zedlers Universallexikon des Jahres 1732 die Utopie unter dem Lemma „Schlaraffenland“
verzeichnet findet (vgl. ibid.). Zedlers Definition ist insofern von besonderem Interesse, als sie
„die literarische Form und satirische Intention der Utopie treffend charakterisiert“, weshalb
Seeber sie eingehend zitiert (vgl. ibid.).
Aus demselben Grund soll der Lexikoneintrag auch an dieser Stelle wortgetreu wiedergegeben
werden:
„Schlaraffenland, lat. Utopia, welches im Deutschen Nirgendwo heißen könte, ist kein wirkliches,
sondern erdichtetes moralisches Land. Man hat es aus dreyerley Absichten erdacht. Einige stellen
darunter eine gantz vollkommene Regierung vor, dergleichen wegen der natürlichen Verderbniß der
Menschen in der Welt nicht ist und seyn kann; und thun solches zu dem Ende, damit sie in einem Bilde
desto deutlicher und bisweilen auch ungestrafter, alle diejenigen Thorheiten und Unvollkommenheiten
zeigen können, denen unsere Monarchien, Aristocratien und Democratien unterworffen sind.
Andere suchen das Elend und die Mühseligkeit des menschlichen Lebens dadurch vorzustellen.
Deßwegen erdichten sie solche Länder oder Insuln, darinnen man ohne Arbeit alles erlangen kan, d.z.E.
Seen voll Wein, Ströme voll Bier, Teuche und Wälder voll‘ gesottener Fische und gebratenen Vögel sind
und was dergleichen mehr ist.
Noch andere stellen darunter die lasterhafte Welt vor, und mahlen die Laster unter Bildern der Länder
ab, z.E. die Landschaft Bibonia, die Republik Venena und andere mehr.“ [sic.] (Seeber 1983: 15)
„Utopia“ stand damals demnach für „eine räumliche Vorstellung, die ein »erdichtetes
moralisches Land« darstellte, um die Wirklichkeit zu kritisieren“ (vgl. ibid.). In Frankreich sind
im 18. Jahrhundert „mindestens 83 Utopien erschienen“, sodass der Terminus „Utopie“ dort
bereits 1798 im Akademie-Wörterbuch als literarische Gattung bezeichnet wurde (vgl. ibid.).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird es schließlich auch in Großbritannien möglich, mit dem
Begriff „utopia“ im literaturwissenschaftlichen Kontext auf „ein literarisches Werk mit einer
bestimmten Machart“ zu verweisen, was sich in der 1873 erschienenen Ausgabe der Notes and
Queries spiegelt (vgl. Seeber 1983: 16). Dieser zufolge können drei Merkmale auf literarische
Utopien hindeuten:
„I. ‘Utopias’ proper: works which describe an ideal state of society, […]
II. Those whoch [sic] satirize, […]
III. […] account of the possible or probable future state of society […]” (Seeber 1983: 16)
Da die Utopie also nicht von vornherein etwas „rein Literarisches“ meint, steht ihr unter den
Gattungen eine Sonderstellung zu (vgl. Seeber 1983: 16).
18Sie können auch lesen