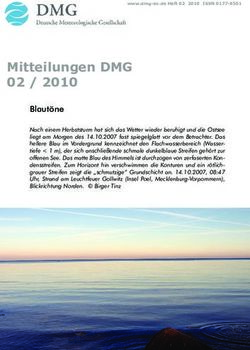HOTSPOT - Vorzeigeprojekte Biodiversität: Forschung und Praxis im Dialog Informationen des Forum Biodiversität Schweiz 22 | 2010 ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
HOTSPOT
Vorzeigeprojekte
Biodiversität: Forschung und Praxis im Dialog
Informationen des Forum Biodiversität Schweiz
22 | 2010Autoren und Autorinnen
Geobotanik an der ETH Zürich ab. Das Kultur- arbeitet seither 50% im nationalen Amphibien-
landschaftsprojekt Domleschg betreut sie seit schutz bei der karch und 50% als Wis sen
1997. Sie hat ein eigenes Ökobüro und leitet schaftler am Institut für Evolutionsbiologie und
zahlreiche Vernetzungsprojekte in Graubünden Umweltwissenschaften an der Universität Zü-
und im Tessin. Karl Ziegler ist Revierförster der rich. So verbindet er Theorie und Praxis des Na-
Roman Graf ist ausgebildeter Sekundarlehrer. Gemeinden im Ausserdomleschg (GR) und be- turschutzes. Silvia Zumbach hat ihr Biologie-
Er arbeitet seit 1987 an der Schweizerischen treut dort seit 1989 rund 1700 Hektaren öf- studium an der Universität Bern mit Schwer-
Vogelwarte Sempach und ist dort für zahlreiche fentlichen und privaten Wald. In seinem Revier punkt Verhaltensbiologie abgeschlossen und
Aufwertungsprojekte im Kulturland verant- wurden verschiedene Auflichtungsprojekte zu- arbeitet seit 25 Jahren hauptberuflich im natio-
wortlich, unter anderem für das vorgestellte gunsten der Artenvielfalt und zur Erhaltung nalen Amphibien- und Reptilienschutz. Sie ist
Beispiel Wauwiler Ebene. Simon Birrer schloss wertvoller Trockenstandorte realisiert. Er enga- Leiterin der karch. > Seite 16
1987 sein Biologiestudium an der Universität giert sich für den «Bündner Kantonalen Patent-
Basel mit einer Diplomarbeit ab. Seither arbei- jäger-Verband» als Jungjägerausbildner im Christian Bohren absolvierte
tet er an der Schweizerischen Vogelwarte Sem- Fach «Wild und Umwelt». > Seite 10 nach der Landwirtschaftslehre
pach, wo er seit 2000 den Bereich «Grundla- 1982 die Fachrichtung Pflanzen-
gen für die Praxis» leitet. Er beschäftigt sich vor Heinrich Schiess ist Landwirt bau des damaligen Schweizeri-
allem mit angewandten Projekten im Bereich und Zoologe. Seine Tätigkeiten schen Landwirtschaftlichen Tech-
Landwirtschaft und Wald. PD Dr. Lukas Jenni kreisen um Landschaft und Biodi- nikums in Zollikofen. Nach einem dreijährigen
promovierte 1984 an der Universität Basel und versität, wobei sich die Schwer- Aufenthalt in Westafrika als Berater an einer
habilitierte 1997 in Zoologie an der Universität punkte im Lauf der Jahre von Frei- landwirtschaftlichen Schule begann er seine
Zürich. Seit 1979 ist er an der Schweizerischen zeit und Ehrenamt über Wissenschaft und For- Arbeit als Herbologe in Zürich-Reckenholz. Seit
Vogelwarte Sempach tätig. Seit 2000 ist er schung zu Auftragsarbeit und Erwerb verscho- gut sieben Jahren ist er als Herbologe in
Wissenschaftlicher Leiter und seit 2008 zudem ben haben. Heute bilden – neben dem eigenen Changins bei Nyon tätig. Hier entwickelt er u.a.
Vorsitzender der Institutsleitung. > Seite 6 Landwirtschaftsbetrieb – Aufwertungsprojekte, Bekämpfungsstrategien gegen Neophyten und
Artenförderung und Wirkungskontrollen die andere Problempflanzen. Er leitet eine interna-
Der Botaniker Bertrand von Arx hauptsächlichen Aktivitäten. Im Landschafts- tionale Arbeitsgruppe der EWRS (European
ist seit 2003 Chef des «Service de konzept Neckertal wirkt Heinrich Schiess als Weed Research Society) über invasive Pflanzen.
la conservation de la nature et du Projektbearbeiter und Koordinator. > Seite 12 > Seite 18
paysage» des Kantons Genf. Zu-
dem präsidiert er die Konferenz PD Dr. Matthias Diemer wurde
der Beauftragten für Natur- und Landschafts- 1990 an der Universität Innsbruck
schutz (KBNL). Vor seinem Stellenantritt in Genf promoviert und habilitierte sich
war er zehn Jahre in Kanada tätig – zuerst als 2000 in Umweltwissenschaften
Landwirt, später im Umweltministerium. 1988 an der Universität Zürich. Seit
bis 1995 war Bertrand von Arx Präsident der 2003 ist er Abteilungsleiter im Programmde-
Genfer Sektion des Schweizerischen Bundes für Adrian Borgula arbeitet seit dem Abschluss partement des WWF Schweiz, wo er zuerst für
Naturschutz (SBN), heute Pro Natura. > Seite 8 des Biologiestudiums an der Universität Bern den Bereich Wald und seit 2008 für Internatio-
im eigenen Büro für Naturschutzbiologie und nale Projekte verantwortlich ist. Zwischen 2004
Franziska Andres für die karch. Er ist im Auftrag des BAFU seit und 2008 vertrat er den WWF International
schloss 1987 das Stu- 1990 Leiter des Projekts IANB (Inventar der Am- beim Aufbau der Multi-Stakeholderprozesse zu
dium der Biologie mit phibienlaichgebiete von nationaler Bedeu- Palmöl (RSPO) und Soja (RTRS). Im selben Zeit-
Vertiefung in Rich- tung). Dr. Benedikt Schmidt schloss 2003 sei- raum war er Vorstandsmitglied des RSPO.
tung Ökologie und ne Dissertation an der Universität Zürich ab. Er > Seite 20
IMPRESSUM Das Forum Biodiversität Schweiz fördert Schopfheim im Wiesental. Papier: RecyMago 115 g/
den Wissensaustausch zwischen Biodiversitätsforschung, m2, 100% Recycling. Auflage: 3600 Exempl. deutsch,
Verwaltung, Praxis, Politik und Gesellschaft. HOT SPOT 1200 Exempl. französisch. Kontakt: Forum Biodiversität
ist eines der Instrumente für diesen Austausch. HOT Schweiz, Schwarztorstr. 9, CH–3007 Bern, Tel. +41 (0)31
SPOT er scheint zweimal jährlich in Deutsch und Fran 312 02 75, biodiversity@scnat.ch, www.biodiversity.ch.
zösisch; PDFs stehen zur Verfügung auf www.biodiversity. Geschäftsleiterin: Dr. Daniela Pauli. Produktionskos
ch. HOTSPOT 23|2011 erscheint im April 2011 und ist ten: 15 CHF/Heft.
dem Thema «Biodiversität und Wirtschaft» gewidmet. Um das Wissen über Biodiversität allen Interessierten zu-
Herausgeber: © Forum Biodiversität Schweiz, Bern, Ok- gänglich zu machen, möchten wir den HOTSPOT weiterhin
tober 2010. Redaktion: Dr. Gregor Klaus (gk), Dr. Daniela gratis abgeben. Wir freuen uns über Unterstützungs Titelseite: (von oben) Kiebitzschwarm (Foto Mathias Schäf); Schot-
Pauli (dp), Pascale Larcher (pl). Übersetzung ins Deut beiträge. HOTSPOT-Spendenkonto: PC 30-204040-6. tische Hochlandrinder im Neeracherried; Pflegearbeiten im Flach-
sche: Hansjakob Baumgartner, Bern. Gestaltung / Satz: Manuskripte unterliegen der redaktionellen Bearbeitung. moor (beide Fotos Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz);
Esther Schreier, Basel. Fotos: Die Bildautorennachweise Die Beiträge der Autorinnen und Autoren müssen nicht Gewässerrenaturierung GE (Foto Service de la conservation de la
sind den Fotos beigestellt. Druck: Print Media Works, mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. nature et du paysage, Kanton Genf).
2 HOTSPOT 22 | 2010Editorial Vorzeigeprojekte
Dr. Robert Meier
robert.meier@kbnl.ch 04 Vorzeigeprojekte und ihre Erfolgsfaktoren
In der Schweiz gibt es zahlreiche Vorzeigeprojekte, die auf lokaler Ebene bemüht sind,
den Rückgang der Biodiversität zu stoppen. Aus den Projekten, die hier vorgestellt werden, lassen
sich Erfolgsfaktoren identifizieren.
Wenn man mit dem Ausland vergleicht,
kommt es einem vor, als wenn in der
06 Wenn der Mais der Kreuzkröte weicht
Ein Aufwertungsprojekt in der Wauwiler Ebene lässt die Agrarlandschaft erblühen.
Der Aufbau und die Pflege eines Netzwerks aus allen Akteuren ist der wichtigste Erfolgsfaktor.
Schweiz der Naturschutz und die Förde-
rung der Biodiversität ein stiefmütterli-
ches Dasein pflegen. Grossflächige Schutz-
gebiete fehlen. Eine Ausnahme gibt es:
08 Mehr Raum – mehr Qualität
Der Kanton Genf verfolgt eine ambitionierte Politik zur Förderung der Biodiversität.
Bisher wurden über 15 Kilometer Gewässerläufe sowie 25 Hektaren Feuchtgebiete renaturiert.
Die Schaffung des Schweizerischen Natio-
nalparks war und ist ein Leuchtturmpro-
jekt – aber das war die Pioniertat unserer
Urgrosseltern. Hat es seither keine akti-
10 Aufgewertete Kulturlandschaft im Alpenraum
Das Kulturlandschaftsprojekt Domleschg war eines der ersten Vernetzungsprojekte,
welche beim Bund eingereicht wurden. Kernstück sind freiwillige, gesamtbetriebliche Verträge.
ven Naturschutzgenerationen mehr gege-
ben? Diese Sichtweise ist zu negativ. Die
Schweiz «tickt» nicht nur im politischen
Vergleich anders als die umliegenden
12 Regionales Landschaftskonzept Neckertal
Drei Gemeinden setzen ihre Lebensgrundlage in Wert. Einer der Schwerpunkte liegt auf
der Wiederherstellung artenreicher Wälder und Waldränder.
Länder, sondern auch in der Naturschutz-
politik. Diese kann im benachbarten Aus-
land nicht selten viel grossräumiger um-
gesetzt und teilweise zentralistischer or-
14 Neue Amphibienweiher der Spitzenklasse
Den Amphibien fehlen in der entwässerten Schweizer Landschaft vor allem temporäre
Gewässer. Mit dem Projekt «1001 Weiher» soll die Dichte solcher Klein- und Kleinstgewässer
ganisiert werden als in der Schweiz. Mit deutlich erhöht werden.
der Delegation des Natur- und Heimat-
schutzes von der Bundes- auf die Kantons
ebene ist eine Situation gegeben, welche
die durchaus erwünschten grossen Würfe
16 Interview mit Werner Müller, Schweizer Vogelschutz SVS/BirdLife Schweiz
«Auch wenn die Gesellschaft von Projekten zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität
profitiert, bestimmen letztlich einige wenige, was gemacht werden kann und was nicht.»
selten möglich macht. So unterscheidet
sich das Naturschutzziel des Kantons So-
lothurn nicht grundsätzlich von demjeni-
gen des Aargaus, aber die Umsetzungs-
18 Ambrosia artemisiifolia erfolgreich eingedämmt
Die invasive Pflanzenart Ambrosia ist ein Gesundheitsrisiko für den Menschen. Dank einer
landesweiten Informations- und Aktionskampagne gelang es, die Verbreitung und Individuendich-
strategien sind verschieden. Jeder Kanton te von Ambrosia in der Schweiz deutlich zu reduzieren.
wählt den Weg, welcher in der jeweiligen
Bevölkerung und Politik die höchste Ak-
zeptanz erreicht und historisch gewach-
sen ist. Die schweizerische Naturschutz-
20 Mit Monokulturen die Biodiversität erhalten?
Der WWF ist Mitbegründer des «Roundtable on Sustainable Palm Oil». Ziel ist es, die
Ausbreitung von Palmölplantagen in ökologisch verträgliche Bahnen zu lenken.
politik ist ein Fleckenteppich diverser
Strategien und Umsetzungsintensitäten.
Mit der Biodiversitätsstrategie des Bundes
kann diesem Fleckenteppich der Saum
gegeben werden, welcher hilft, den Blick Rubriken
aufs Ganze zu gewinnen. Wenn das ge-
lingt, bin ich überzeugt, dass wir ein gros 22 Forum Biodiversität Schweiz
ses, weitläufiges Leuchtturmprojekt ha- Privatwirtschaft in die Verantwortung nehmen
ben, in welchem all die Projekte, die heu-
te eher unscheinbar scheinen, Teil davon 23 Bundesamt für Umwelt BAFU
sind. Nagoya muss uns einen grossen Schritt weiterbringen
24 Schweizerische Kommission für die Erhaltung von Kulturpflanzen SKEK
Nationale Datenbank NDB-PGREL
26 Biodiversitäts-Monitoring Schweiz BDM
Ex-officio Vertreter der KBNL Ausstrahlung über die Grenzen hinweg
im Forum Biodiversität Schweiz
28 Die Karte zur Biodiversität
Die Südliche Mosaikjungfer und der KlimawandelLeitartikel
Vorzeigeprojekte und ihre Erfolgsfaktoren
Von Gregor Klaus, Redaktor
Es gibt in der Schweiz praktisch keine regionaler Ebene erhalten und fördern ermöglicht es auch, Ressourcen zu mobili-
echten Leuchtturmprojekte, dafür aber und von denen eine Signalwirkung aus- sieren, über die der klassische Natur-
zahlreiche Vorzeigeprojekte, die auf loka geht. Um es vorwegzunehmen: Eigentli- schutz nicht verfügt.
ler Ebene bemüht sind, den Rückgang che Leuchtturmprojekte haben wir nicht
der Biodiversität zu stoppen. Aus den gefunden, dafür aber zahlreiche Vorzeige- Faktor 3
Projekten, die hier vorgestellt werden, projekte, die auf lokaler Ebene den Rück- Starke Projektleitung
lassen sich Erfolgsfaktoren identifizieren. gang der Biodiversität stoppen. Wir haben Unterschiedliche Sichtweisen, Interessen-
aus einigen Problemfeldern mehr oder we- und Werthaltungen lassen sich nicht be-
Reden wir Klartext: Die Biodiversität in niger zufällig einzelne Projekte herausge- liebig einander annähern. Die Projektlei-
der Schweiz ist in keinem guten Zustand. griffen. Aus den Beiträgen lassen sich fünf tung steht oft Vertreterinnen und Vertre-
Ein Naturschutzbeamter aus Bayern Erfolgsfaktoren identifizieren, die auch tern ganz unterschiedlicher Nutzungsan-
drückte das kürzlich so aus: «Für vieles, für zukünftige Leuchtturmprojekte gelten sprüche gegenüber. Verhandlungsge-
was bei euch in der Schweiz als Biotop von dürften. schick und Konfliktmanagement erlauben
nationaler Bedeutung ausgeschieden ist, es, zu konsensualen Lösungen zu gelan-
steige ich hier in Bayern nicht mal aus Faktor 1 gen. Konflikte werden ausgetragen und ei-
dem Auto.» Wie gross die Mängel bei der Sektorenübergreifender Ansatz ner Lösung zugeführt. Dies benötigt eine
Erhaltung und Förderung der Biodiversi- Die Erhaltung und Förderung der biologi- starke Projektleitung, die nicht nur über
tät in der Schweiz sind, hat die im April schen Vielfalt tangiert alle gesellschaftli- ökologische, sondern auch über soziale
2010 publizierte Studie des Forum Biodi- chen und wirtschaftlichen Bereiche und Kompetenzen verfügt. Der Einsatz von
versität Schweiz aufgedeckt. Vor allem im hängt damit von der biodiversitätsverträg- klassischen Instrumenten des Projektma-
Mittelland ist die Schweiz keine blühende lichen Nutzung der natürlichen Ressour- nagements ist dabei unerlässlich für Effi-
Landschaft mehr. Wichtige Ökosystem- cen durch alle Sektoren ab. Echte Erfolge zienz und Effektivität.
leistungen wie die Erholungsfunktion können nur dann erzielt werden, wenn al-
sind hier kaum noch gewährleistet. Ob- le zusammenspannen. Jeder einzelne Sek- Faktor 4
wohl im Mittelland 60% der Schweizer Be- tor muss dabei seine Verantwortung wahr- Genügend finanzielle Mittel
völkerung leben, gefällt laut einer reprä- nehmen. Ein sektorenübergreifender An- Sind die ersten drei Punkte erfüllt, sollte
sentativen Meinungsumfrage des LINK In- satz gewährleistet zudem, dass ökologi- es eigentlich möglich sein, genügend fi-
stituts aus dem Jahr 2010 nur gerade je- sche, ökonomische und soziale Aspekte nanzielle Mittel aufzutreiben. Ansonsten
dem 10. Schweizer dieser Teil der Schweiz gleichermassen berücksichtigt werden wird jedes noch so gut gemeinte Projekt
am besten. und die Akzeptanz der Massnahmen hoch scheitern.
Im letzten HOTSPOT haben wir Visionen ist. Angesichts der schlechten Situation der
vorgestellt, was getan werden müsste, um Biodiversität in der Schweiz sind Bund
die Biodiversität in der Schweiz umfas- Faktor 2 und Kantone angehalten, neue und inno-
send zu erhalten und zu fördern. Kluges Einbezug der Bevölkerung vative Finanzierungsinstrumente zu ent-
Schreiben und Reden ist zwar gut, doch Die Massnahmen zur Erhaltung und För- wickeln und mehr Gelder zur Verfügung
dann braucht es richtiges Handeln vor derung der Biodiversität müssen letztend- zu stellen. Die Erhaltung unserer Lebens-
Ort. Gefragt ist eine Vielzahl von grossen lich durch die Menschen vor Ort getragen grundlagen müsste es uns wert sein. Da
und kleinen Projekten, die eintönige Kul- oder sogar umgesetzt werden. Damit es die Förderung der Biodiversität auch eine
turwälder, monotone Agrarlandschaften, «ihre» Konzepte und Massnahmen sind, Inwertsetzung der Ökosystemleistungen
langweilige Siedlungen und eingedolte Bä- müssen sie frühzeitig einbezogen werden. bedeutet, kann langfristig mit deutlich po-
che wieder zu Lebensräumen machen. Für Eine sorgfältige Kommunikation des Vor- sitiven Auswirkungen auf Wirtschaft und
die Umsetzung der zukünftigen Biodiver- habens von Anfang an kann entscheidend Gesellschaft gerechnet werden.
sitätsstrategie werden solche Projekte von sein für das Gelingen eines Projekts.
zentraler Bedeutung sein. Der Bevölkerung muss bewusst werden, Faktor 5
dass die Biodiversität unsere Lebensgrund- Wissenschaftliche Begleitung
Fünf Erfolgsfaktoren lage ist; Massnahmen zu ihrer Erhaltung Für die Entscheidung, welche Biodiversi-
In diesem HOTSPOT wollten wir eigentlich und Förderung konkurrieren vor allem tät wie geschützt werden soll, sind Er-
Leuchtturmprojekte vorstellen, die den in langfristig nicht mit anderen gesellschaft- kenntnisse der Wissenschaft unentbehr-
der letzten Ausgabe präsentierten Visio- lichen und wirtschaftlichen Belangen, lich. Das Wissen darf sich dabei nicht nur
nen nahekommen – grosszügige, vorbild- sondern dienen in der Regel auch dem auf Schutzgebiete beschränken, sondern
liche und sektorenübergreifende Projekte Schutz von uns Menschen und der Erhö- muss auch die Nutzgebiete einbeziehen
also, die die Biodiversität zumindest auf hung der Lebensqualität. Diese Einsicht und die natürliche und kulturelle Dyna-
4 HOTSPOT 22 | 2010Nationalstrassenbau oder Naturschutzmassnahme? Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Naturschutzprojekte ist die sorgfältige Information der Einbezug der Bevölkerung.
Foto Service de la conservation de la nature et du paysage, Kanton Genf
mik beachten. Bei der Umsetzung einer Zu lokal, zu selten Gewässer» zur Volksinitiative «Lebendiges
flächendeckenden biodiversitätsverträgli- Schon kleinere Veränderungen würden Wasser» (Renaturierungsinitiative). Damit
chen Nutzung werden auch die Konflikte aus so manchem Vorzeigeprojekt ein werden die Kantone per Gesetz verpflich-
zwischen statischen und dynamischen An- Leuchtturmprojekt machen. Oft fehlt es tet, ausreichenden Gewässerraum auszu-
sätzen zurückgehen. Die derzeit vielfach aber an Mut und genügend Fläche, auf der scheiden und Revitalisierungen zu för-
scharfen Grenzen zwischen Schutz- und die Biodiversität Vorrang hat. Ein Blick dern. Konkret fordert der Bund von den
Nutzungsgebieten lassen sich so entschär- über die Landesgrenzen eröffnet andere Kantonen, in den nächsten 80 Jahren rund
fen und die vermeintliche «Flächenkon- Dimensionen. In Mecklenburg-Vorpom- 4000 Kilometer Gewässer prioritär zu revi-
kurrenz» nimmt ab. mern etwa wurden im Rahmen des Moor- talisieren – viel Raum also für Leucht-
Auch für den Konsens über Schutz und schutzprogramms 30 Quadratkilometer turmprojekte.
Nutzung der Biodiversität ist es wichtig, ehemalige Moorfläche wiedervernässt. Es Ein Blick auf die von den Projekten neu ge-
dass sämtliche Massnahmen wissenschaft- entstanden nicht nur wertvolle Lebens- schaffenen oder in Wert gesetzten Ökosys-
lich begründet sind und von daher ihre Le- räume; eine wichtige Kohlenstoffsenke temleistungen lohnt sich. Die Ökosysteme
gitimation beziehen. Ein fachlicher Beirat wurde reaktiviert. Die Kosten für die Mass- sind ein wichtiges Kapital, das Güter pro-
erhöht die Akzeptanz. Eine Erfolgskont- nahmen von 0 bis 12 Euro pro Tonne CO2- duziert und Dienstleistungen erbringt.
rolle ist unerlässlich. Äquivalenten lagen bei den Massnahmen Die Liste ist lang: Hochwasserschutz, Koh-
Von besonderer Bedeutung sind Angaben deutlich unter den sonst üblichen Kosten lenstoffspeicher, Erholung und Touris-
zur möglichen Inwertsetzung von Ökosys- zur Klimagasminderung. mus, Trinkwasser, gesunde Nahrungsmit-
temleistungen und die Entwicklung von In den letzten Jahren ist aber auch in der tel, Schutz vor Erosion und Steinschlag,
ökonomischen Instrumenten. Diese er Schweiz einiges in Bewegung geraten. Entgiftung von Schadstoffen etc. Letztend-
möglichen es, die Ziele des Biodiversitäts Grosse Hoffnungen werden in die nationa- lich entstehen in den Projektgebieten at-
schutzes in wirtschaftliche Abläufe zu in- le Biodiversitätsstrategie gesetzt, die zur- traktive und intakte Landschaften, in de-
tegrieren. Damit sind sie flexibel und er- zeit erarbeitet wird. Eine grüne Revoluti- nen die Menschen gerne leben und mit
zielen zugleich Breitenwirkung. on verspricht der parlamentarische Ge- denen sie sich identifizieren können.
genvorschlag «Schutz und Nutzung der
HOTSPOT 22 | 2010 Brennpunkt Vorzeigeprojekte 5Natur- und Kulturlandschaft im Mittelland
Wenn der Mais der Kreuzkröte weicht
Roman Graf, Simon Birrer und Lukas Jenni, Schweizerische Vogelwarte, CH-6204 Sempach, roman.graf@vogelwarte.ch
Die Wauwiler Ebene hat sich dank eines anderem grosse Bestände der stark be- endete 2008. Bis dahin hatten die artenrei-
Aufwertungsprojekts vom intensiv ge drohten Kreuzkröte und die grösste Brut- chen Wiesen von 2,5 auf 33,6 Hektaren zu-
nutzten Ackerland zur vielfältigen Land population des Kiebitzes in der Schweiz. genommen, die Zahl der Kleingewässer
schaft gewandelt. Das wichtigste Erfolgs Bereits damals war klar, dass das Gebiet stieg von 6 auf 28 (siehe Grafik) und die
rezept ist der Aufbau und die Pflege ei ein sehr hohes Potenzial für die Biodiversi- Zahl der Hecken erhöhte sich von 55 auf
nes Netzwerks, in welchem alle Akteure tät aufweist. 95. Zu einem besonderen «Bijou» entwi-
eingebunden sind. ckelte sich eine 6 Hektaren grosse zusam-
Umfangreiche Aufwertungen menhängende Parzelle, die zuvor während
In der Wauwiler Ebene (Kanton Luzern) 1995 initiierten die Schweizerische Vogel- Jahren als Maisacker genutzt worden war.
dehnte sich im 19. Jahrhundert eine wei- warte Sempach und der Luzerner Natur- Diese Parzelle wurde 1997 mit mehreren
te, von einzelnen Moränenzügen unter- und Vogelschutzverband ein Aufwertungs- Tümpeln und Gebüschgruppen ausgestat-
brochene Moorlandschaft aus, welche projekt mit dem Ziel, den Anteil an ökolo- tet und frisch eingesät. Zur Anwendung
auch mehrere Kleinseen enthielt – darun- gischen Ausgleichsflächen von damals nur kam eine relativ billige Mischung für Ex-
ter den Wauwiler See, der ursprünglich 3,2% deutlich zu erhöhen. Ein wichtiger tensivwiesen; etwa alle zehn Meter legte
etwa 500 Hektaren gross war. Um 1850 Teil dieses ersten Projekts war nebst der der neue Pächter allerdings einen Streifen
legte der Kanton den See mittels Tieferle- Lebensraumaufwertung auch die Informa- mit einer artenreichen Wiesenblumenmi-
gung des Flüsschens Ron trocken. An- tion der Bevölkerung. Jäger, Landwirte, Be- schung an. Seither bewirtschaftet der äus
schliessend baute man die bis zu sieben hörden, Naturschützer und weitere inter- serst motivierte Landwirt die aufgewertete
Meter mächtigen Torfschichten ab und essierte Personen aus der Region erhielten Fläche nach naturschutzfachlichen Krite-
nutzte die organische Substanz zum Hei- an über 50 Veranstaltungen Informatio- rien (u.a. Staffelmahd, partielle Aufrau-
zen. Nach dem 2. Weltkrieg setzte die nen über Ziele und Massnahmen. Der ung des Bodens, fachlich korrekte Hecken-
landwirtschaftliche Melioration ein. Fonds Landschaft Schweiz und die Vogel- und Tümpelpflege). Zur Brutzeit hielten
Die Wauwiler Ebene wandelte sich all- warte finanzierten das Vorhaben. sich dort in den letzten Jahren mehrere
mählich von der Moorlandschaft zur in- 2002 gründeten alle Anstössergemeinden, Qualität anzeigende Brutvogelarten der
tensiv genutzten Agrarlandschaft. Obwohl die örtlichen Naturschutzvereine und die Kulturlandschaft auf, darunter Wachtel,
empfindliche Torfböden über Seekreide Jagdgesellschaften einen Verband mit dem Wachtelkönig, Schwarzkehlchen, Neuntö-
vorherrschen, die für den Ackerbau wenig Ziel, dieses erste Aufwertungsprojekt in ter, Dorngrasmücke und Grauammer. Für
geeignet sind, nahmen Äcker 1993 46% ein landwirtschaftliches Vernetzungspro- einige davon ist eine erfolgreiche Brut
der Gesamtfläche ein. Naturnahe Lebens- jekt nach Öko-Qualitätsverordung (ÖQV) nachgewiesen, für die anderen liegt zu-
räume fanden sich fast nur noch in den zu überführen und damit die Finanzie- mindest Brutverdacht vor.
Naturschutzgebieten Hagimoos, Wauwi- rung der Ausgleichsmassnahmen zu insti- Auch die Naturschutzgebiete konnten
lermoos und Mauensee. Flora und Fauna tutionalisieren. Der Verband betraute die stark aufgewertet werden – dies vor allem
waren bereits stark verarmt. Nach wie vor Vogelwarte mit der Projektleitung. Die dank grosszügiger Unterstützung aus dem
gab es aber bedeutende Naturwerte, unter erste Umsetzungsphase des ÖQV-Projekts kantonalen Naturschutzfonds. Im Natur-
schutzgebiet Wauwilermoos schuf der
Kanton im Winter 2009/2010 rund vier
Lebensräume in der Wauwiler Ebene in den Jahren 1987 (grün) und 2008 (dunkelrot). Die Bilanz ist bei den massge- Hektaren neue Flachwasserzonen, deren
benden Lebensraumtypen positiv. Einzig die Hochstammobstbäume (in der Grafik nicht enthalten) haben um fast die Wasserstand über den Betrieb des Meliora-
Hälfte abgenommen. Quelle: Schweizerische Vogelwarte Sempach tionspumpwerks reguliert werden kann
(siehe Foto). Im Hagimoos liess der Kanton
Wildkrautfluren/Brachen (n) 1987
2008 zudem zwei grosse Teiche ausheben, und
Wildkrautfluren/Brachen (ha) am Mauensee legten Landwirte und der lo-
kale Naturschutzverein mehrere Kleinge-
Artenreiche Wiesen (n)
wässer an.
Artenreiche Wiesen (ha)
Feuchtgebiete (ha)
Erfolgreiches Netzwerk
Die wichtigste Grundlage für diesen Erfolg
Weiher, Tümpel, Teiche (n) ist ein Netzwerk, in welches alle Akteure
Weiher, Tümpel, Teiche (ha) eingebunden sind, vor allem Exponenten
der Landwirtschaft, Verantwortliche in
Krautsaum an Fliessgewässern (ha)
den Gemeinden, örtliche Naturschutzver-
0 10 20 30 40 50 60 eine, die Strafanstalt Wauwilermoos mit
6 HOTSPOT 22 | 2010Böden bald einmal Manganmangel ein,
welcher zu einem lückigen, blumenlosen,
niedrigwüchsigen Bestand aus Wiesenris-
pengras und Behaarter Segge führt. Zur-
zeit bereitet der Trägerverband Versuche
vor, um auf solchen Standorten Pfeifen-
graswiesen zu etablieren.
Die oben als vorbildlich geschilderte Kom-
munikation ist ein schwieriges, mit Stol-
persteinen gespicktes Feld. Leider wird hin
und wieder in der Hitze des Gefechts ver-
säumt, alle Partner adäquat einzubezie-
hen. Leidtragende sind manchmal die Na-
turschützer vor Ort, manchmal die Land-
wirte, aber des öfteren auch die Projektlei-
tung selbst.
Erschwerend für die vollständige Errei-
chung der Naturschutzziele ist die immer
noch bestehende amtliche Trennung von
Landwirtschaft und Naturschutz. Zwar ar-
beiten die entsprechenden Amtsstellen im
Kanton Luzern sehr gut zusammen und
sind Anfang 2010 zu einer Abteilung fusio-
Die neuen Pumpteiche im Naturschutzgebiet Wauwiler Moos werten das Gebiet für Amphibien, Wat- und niert, aber die gesetzlichen Vorgaben ver-
Wasservögel deutlich auf. Foto: Amtsstelle für Natur- und Landschaftsschutz, Kanton Luzern. hindern so manche sinnvolle Massnahme.
Beispielsweise werden Landwirte für das
Anlegen von temporären Tümpeln noch
ihrem grossen Landwirtschaftsbetrieb, die liefert durch ihre Forschungstätigkeit im immer bestraft, indem man ihre landwirt-
kantonalen Jagd-, Landwirtschafts- und Gebiet auch immer wieder wissenschaftli- schaftliche Nutzfläche reduziert.
Naturschutzbehörden sowie die Vogelwar- che Grundlagen, die direkt dem Natur- Trotz dieser Schwierigkeiten konnten be-
te. Die auftretenden Probleme werden im schutz zugute kommen. So hat sie in deutende Erfolge realisiert werden, was
Netzwerk jeweils rasch angegangen. bis- mehrjährigen Versuchen die Ursachen für sich auch in den Reaktionen der Ziel- und
her gelang es stets, konstruktive Lösungen den vormals miserablen Bruterfolg der Leitarten des Projekts manifestiert: Bis
zu finden. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist Kiebitze erforscht und daraus neuartige 2008 haben die Feldhasenbestände in der
auch die personelle Kontinuität. Seit nun- Schutzmethoden entwickelt. Wauwiler Ebene um 34% zugenommen,
mehr 15 Jahren gab es kaum personelle während sie in 16 über die Schweiz verteil-
Wechsel an den Schaltstellen. In dieser Aus Fehlern lernen ten Vergleichsgebieten um 23% abgenom-
Zeit ist es gelungen, viel gegenseitiges Ver- Natürlich gibt es bei solch grossen Projek- men haben. Feldgrillen und Grosse Gold-
trauen aufzubauen. ten auch Dinge, die weniger optimal lau- schrecken konnten dank der neu geschaf-
Von Vorteil ist zudem, dass mit der Vogel- fen. Zu Beginn der Umsetzungsarbeiten fenen Saumstrukturen und Extensivwie-
warte eine starke Institution massgeblich scheiterte manches Teilprojekt an man- sen weite Teile der Ebene wieder besie-
im Projekt involviert ist. Ihr Engagement gelnder Erfahrung. Buntbrachen entwi- deln, und die Ringelnatter schaffte un-
half, finanzielle Engpässe zu mildern, ckelten sich kurz nach der Ansaat in reine längst den Sprung in den vorher verwais-
wenn beispielsweise ein sinnvolles Projekt Blacken-Bestände, neu angelegte Waldsäu- ten östlichen Teil des Gebiets. Weil immer
nicht in den Rahmen der ÖQV passte und me in übermannshohe Brennesseldickich- wieder neue Gewässer geschaffen werden
deshalb vom Staat nicht finanziert werden te, und einzelne Kleingewässer hatten konnten, stiegen die Bestände von Kreuz-
konnte. Auch unkonventionelle Ideen wie kaum je Wasser. Diese Probleme hat man kröte und Kleiner Pechlibelle, welche auf
der Anbau von Rohrkolben als Agrarroh- inzwischen in den Griff bekommen. Als Pioniergewässer angewiesen sind, und
stoff auf überschwemmtem Kulturland besondere Herausforderung erwies sich selbst der Brutbestand des vom Ausster-
lassen sich mit einem allgemein aner- die Ansaat von Blumenwiesen auf den de- ben bedrohten Kiebitzes hat sich verdop-
kannten Forschungsinstitut im Hinter- gradierten Seekreideböden. Bei ausblei- pelt.
grund leichter lancieren. Die Vogelwarte bender Düngung stellt sich auf solchen
HOTSPOT 22 | 2010 Brennpunkt Vorzeigeprojekte 7Gewässerrenaturierung
Mehr Raum, mehr Qualität
Bertrand von Arx, Service de la conservation de la nature et du paysage, Kanton Genf, CH-1205 Genf, bertrand.vonarx@etat.ge.ch
Seit einigen Jahren verfolgt der Kanton Daraufhin wurde nach Wegen und Mit-
Genf eine ambitionierte Politik zur Förde teln gesucht, um die Situation zu verbes-
rung der Biodiversität. Im Zentrum der sern. Es sollten nicht nur bestehende Na-
Bemühungen stehen die Fliessgewässer turwerte bewahrt werden; vielmehr woll-
und die Flachmoore. Bisher wurden über te man auch neue Feuchtgebiete anlegen,
15 Kilometer Gewässerläufe sowie 25 um so die Bestände der auf diese Lebens-
Hektaren Feuchtgebiete renaturiert. räume angewiesenen Tier- und Pflanzen-
arten im Kanton zu stärken.
Rund 15 Prozent der Fläche des Kantons Zunächst galt es, den Ist-Zustand der auf-
Genf sind Gewässer. Dazu gehören der zuwertenden Flächen zu erheben. Die Pa-
Genfer Anteil am Lac Léman sowie 300 Ki- lette der Massnahmen umfasst einerseits
lometer Bäche und Flüsse, die sich zum punktuelle Eingriffe, mit denen natürli-
Teil in einem schlechten ökomorphologi- che Dynamik, die in der verbauten Land-
schen Zustand befinden. Ende der 1990er- schaft nicht mehr zum Zug kommt, reak-
Jahre lancierte der Kanton Genf zusam- tiviert wird, und andererseits regelmässi-
men mit Partnern mehrere Programme ge Unterhaltsarbeiten, welche die Ent-
zur Revitalisierung von Fliessgewässern wicklung noch funktionierender Lebens-
sowie zur Aufwertung und Pflege der räume zielgerecht lenken. Neophyten, die
Feuchtgebiete. Diese Lebensräume sollen auf der schwarzen Liste der Schweizeri-
ihre ökologischen Funktionen wieder voll- schen Kommission zur Erhaltung der
umfänglich erfüllen, besser in die Land- Wildpflanzen (SKEW) stehen, werden prä-
schaft integriert und über ein Netz ver- ventiv und aktiv bekämpft. Bestandteil
schiedener Gewässerökosysteme mitein- der Unterhaltskonzepte ist zudem die Be-
ander verbunden werden. Damit wird sucherlenkung. Beim Unterhalt der Natur-
auch der Schutz von Menschen und Sach- reservate ist Pro Natura der wichtigste
werten vor Hochwasser deutlich erhöht. Partner der kantonalen Behörden. Die Na-
Zudem will man der Bevölkerung neue Er- turschutzorganisation ist seit 1928 aktiv
holungsgebiete verfügbar machen. beim Schutz und der Pflege biologisch
Das Kantonsparlament hat für das Vorha- vielfältiger Flächen.
ben bedeutende finanzielle Mittel bereit- Der Kanton setzt Projekte nur mit Zustim- wurde deutlich, dass für grössere Vorha-
gestellt. Über das Programm «Natur und mung der Landeigentümer, der Bewirt- ben nebst den rein technischen auch die
Landschaft» im Rahmen des Neuen Fi- schafter (v.a. Landwirte) sowie der betrof- sozialen Aspekte gebührend beachtet wer-
nanzausgleichs zwischen Bund und Kan- fenen Anwohner um. Diese werden noch den müssen: Es muss viel Zeit und Kraft in
tonen (NFA) sowie über das Stabilisie- vor Beginn des Vernehmlassungsverfah- Verhandlungen mit den zahlreichen Part-
rungsprogramm zur Milderung der Wirt- rens an Informationsveranstaltungen und nern investiert werden, um eine für alle
schaftskrise stellte auch der Bund Gelder Ortsbegehungen ins Bild gesetzt. Für be- Seiten befriedigende Lösung zu erreichen.
zur Verfügung. sonders heikle Vorhaben werden Begleit- Die Seymaz wurde in der Vergangenheit
gruppen gebildet, in denen die lokalen Be- kanalisiert. Die angrenzenden Landwirt-
Gemeinsam Lösungen suchen hörden, die Landeigentümer und -bewirt- schaftsflächen wurden dabei entwässert
Die letzten grossen Moore Genfs wurden schafter sowie interessierte Organisatio- und dem Einfluss regelmässiger Überflu-
in der Zwischenkriegszeit zerstört. Ende nen mitreden können. Die Betroffenen tungen entzogen. Das Gelingen des Pro-
des 20. Jahrhunderts waren nur noch Re- sind so immer auf dem aktuellen Wissens- jekts hing deshalb von der Bereitschaft der
likte übrig, die dank des Einsatzes visionä- stand, können strittige Fragen rechtzeitig Bauern ab, dem Bach durch den Abbau der
rer Naturfreunde unter Schutz gestellt aufwerfen und gemeinsam mit den Pro- Dämme ein Stück Freiheit zurückzugeben
und mehr schlecht als recht unterhalten jektverantwortlichen Lösungen erarbei- und eine temporäre Überflutung einzel-
wurden. Daneben existierten in bewalde- ten. ner Parzellen zuzulassen. Doch nur der
ten Gebieten noch ein paar als «Réserves Flusslauf war in öffentlichem Besitz; die
biologiques forestières» geschützte Feucht- Soziale Aspekte beachten angrenzenden Parzellen musste der Kan-
biotope. Die Erfolge können sich sehen lassen. Ein ton von den privaten Eigentümern erwer-
Bei der systematischen Umsetzung der Beispiel dafür ist das Projekt zur Renatu- ben. Um die Verkaufsverhandlungen zu
Pflegekonzepte ab 2003 offenbarte sich rierung der Haute Seymaz und die Wie- erleichtern und den Kulturlandverlust auf
der desolate Zustand dieser Lebensräume. dervernässung ihrer Feuchtgebiete. Hier ein Minimum zu begrenzen, wurde die Sa-
8 HOTSPOT 22 | 2010nässung erleichterten den Entscheid.
Um den Erfolg nach Abschluss der Gestal-
tungsarbeiten dauerhaft zu gewährleis-
ten, werden auch bei diesem Projekt genü-
gend finanzielle Mittel benötigt. Vor allem
gilt es, eine zu rasche Vegetationsentwick-
lung zu verhindern. Mehrere Pflegeein-
griffe pro Jahr während der Vegetationspe-
riode sind am Anfang unumgänglich,
auch wenn diese mit Störungen verbun-
den sind.
Fortsetzung folgt …
Allein 2009 hat der Kanton sieben grössere
Projekte realisiert. Um das angestrebte
Netz renaturierter Feuchtbiotope vervoll-
ständigen zu können, müssen die nötigen
Mittel bereitgestellt werden.
Trotz zahlreicher Erfolge gilt es auch in
Zukunft, Hindernisse zu überwinden.
Schwierig ist vor allem die Beschaffung
der Flächen, die für gute Projekte benötigt
werden. Sie liegen grösstenteils im Land-
wirtschaftsgebiet. Die Bodenqualität der
Marais des Douves vor, während und nach den Renaturierungsarbeiten. Die – teils angesäte – Feuchtgebietsvegetation potenziellen Naturschutzflächen ist oft
besiedelte das Terrain rasch. Doch Achtung: Auch Neophyten wie die Goldrute finden hier geeignete Standortbedin- gering, weshalb sie vielfach im Visier von
gungen. Fotos: Service de la conservation de la nature et du paysage, Kanton Genf landwirtschaftlichen Meliorationen ste-
hen. Um den Flächenbedarf zu minimie-
ren und gleichzeitig eine bessere Vernet-
nierung zahlreicher Drainagen in den wei- lich wachsen, entwickelte sich mit der zung der Biodiversitäts-Reservoirs zu er-
ter entfernten Parzellen in das Projekt in- Zeit ein vor allem für Amphibien und Li- reichen, wird man deshalb künftig auch
tegriert und über dieses finanziert. Bei bellen wertvoller Waldweiher. Als man bestehende naturnahe Strukturen aufwer-
den Finanzen hat sich gezeigt, dass auch wegen fehlender Mittel den Unterhalt des ten müssen. Und schliesslich braucht es
für die Zeit nach Abschluss der Bauarbei- Wasserlochs aufgab, eroberte der Wald zusätzlich zur bisher geleisteten Kommu-
ten noch genügend Ressourcen bereitge- das Terrain zurück. Es blieb das alte Was- nikationsarbeit im Rahmen der einzelnen
stellt werden müssen, und zwar für die serloch, umgeben von einer Feuchtzone Projekte weitere Anstrengungen, um die
technische Feinjustierung (z.B. die Was- mit Relikten der Flora und Fauna, die einst Bevölkerung und die Politik für den Na-
serstandsregulierung), die Regelung sozia- den Wert dieses Biotops ausgemacht hat- turschutz zu sensibilisieren und die Ak-
ler Fragen und die periodischen Unter- te. zeptanz für weitere Vorhaben zu erhöhen.
haltsarbeiten. Mit Hilfe von Methoden der Geomatik, na- Mittelfristig sollen für sämtliche Projekte
mentlich des digitalen Geländemodells, Wirkungskontrollen durchgeführt wer-
Wiederbelebtes Wasserloch wurde das Vergrösserungspotenzial für den. Diese erfolgen anhand von Zielarten.
Die Renaturierung der Marais des Douves die Feuchtzone bestimmt. Das Einzugsge- Deren Zahl darf nicht allzu gross sein, und
im Wald von Versoix offenbarte das oft in biet erwies sich zudem als gross genug, die Auswahl erfolgt in Abstimmung mit
der Landschaft verborgene ökologische um eine ausreichende Wasserversorgung Projekten des Bundes und der Nachbarge-
Potenzial, das es zu nutzen gilt, damit ein zu gewährleisten. Vor Projektstart muss- biete in Frankreich. Die Ergebnisse wer-
Projekt seine volle Wirkung entfalten ten allerdings noch die Kollegen aus dem den es erlauben, Fehlentwicklungen zu
kann. Hier hatte man in den 1970er-Jah- Forstamt davon überzeugt werden, dass korrigieren – sofern sich die Ursachen da-
ren zur Entwässerung der umliegenden ein öffentliches Interesse an einer Rodung für eruieren lassen.
Flächen und als Löschwasserreservoir eine dieser Staatswaldfläche und ihrer Gestal-
Vertiefung gegraben. Über dem lehmigen tung als Feuchtgebiet besteht. Die schlech-
Boden, auf dem die Bäume nur kümmer- te Bodenqualität und die periodische Ver-
HOTSPOT 22 | 2010 Brennpunkt Vorzeigeprojekte 9Kulturlandschaft im Alpenraum
Mehr beraten als kontrollieren
Franziska Andres, Trifolium, CH-7000 Chur, und Karl Ziegler, Forstamt Ausserdomleschg, CH-7417 Paspels, mail@trifolium.info
Im Domleschg wurde 1994 ein Projekt zur
Erhaltung und Aufwertung der reichhalti
gen Kulturlandschaft gestartet. Freiwilli
ge Bewirtschaftungsverträge, die ge
samtbetriebliche Beratung, gesicherte
Finanzen, eine aktive Trägerschaft und
die Vielfalt an begleitenden Projekten
waren ausschlaggebend für den Erfolg
des Unternehmens.
Das Domleschg ist vor allem für seine
Burgen und Schlösser bekannt. Weniger
bekannt ist der ausserordentliche Reich-
tum der Kulturlandschaft. Die Hänge sind
geprägt durch trockene Steppengrashal-
den, magere, von Trockenmauern einge-
fasste Obstgärten und ehemalige Acker-
terrassen; Heckenreihen säumen Wiesen Blick auf das Domleschg. Im Hintergrund der Piz Beverin. Fotos Franziska Andres
und Wege. Die vielfältige Kulturlandschaft
bietet Lebensraum für zahlreiche Tier-
und Pflanzenarten, die im Schweizer Mit- Die im Jahre 2002 festgelegten und teil- sechs Jahren die Hecken zu pflegen, ver-
telland selten geworden sind, beispielswei- weise ehrgeizigen Ziele sind heute zu 84% brachte Wiesen zu entbuschen, Hoch-
se Wendehals, Gartenrotschwanz, Espar- erreicht (siehe Grafik). Rund 70 Betriebe stammobstbäume zu pflanzen oder Tro-
settenbläuling und Dingel. Die Intensivie- und damit 90% der Landwirte im Dom ckenmauern zu reparieren. Bei jedem
rung der Landwirtschaft seit den 1950er- leschg beteiligen sich an dem Projekt. Für Landwirt sind die Ziele im Vertrag schrift-
Jahren führte allerdings auch im Dom die dritte Betriebsphase des Vernetzung- lich festgelegt. Er kann jährlich die geleis-
leschg zu einer schleichenden Verarmung projekts (2008 bis 2013) wurde das Leitbild teten Arbeiten melden und verrechnen.
der Kulturlandschaft. überarbeitet. Die Ziele weichen im Kern Die Finanzierung erfolgt über die ÖQV
nicht wesentlich von jenen der beiden vor- und das Natur- und Heimatschutzgesetz.
Neue Dynamik dank ÖQV angegangenen Betriebsphasen ab. Ein weiterer wichtiger Faktor für den bis-
Im Rahmen eines Kulturlandschaftpro- herigen Erfolg des Projekts war das Be-
jekts wurde dieser negativen Tendenz er- Das Erfolgsrezept mühen der Fachleute, mit den Landwirten
folgreich entgegen gesteuert. Esther Kernstück des Kulturlandschaftprojekts eng zusammenzuarbeiten, eigene Initiati-
Bräm, Agronomin aus Scharans, erstellte waren von Anfang an freiwillige Verträge, ven der Landwirte zu unterstützen, Wahl-
1994 im Auftrag der Region ein Land- welche die gesamte Betriebsfläche umfas- möglichkeiten aufzuzeigen und schwer-
schaftsleitbild. Anhand von Erhebungen sen. Im Zusammenspiel mit einer fundier- punktmässig mehr zu beraten als zu kon
bei drei Testbetrieben wurde gleichzeitig ten Beratung konnten die Landwirte ihre trollieren. Eine Stärke des Projekts ist zu-
ein Umsetzungs- und Finanzierungskon- Verträge direkt mitgestalten. Dieses Mo- dem die aktive Trägerschaft, welche die
zept erarbeitet. Im Jahr 2001, am Ende der dell für die Zusammenarbeit von Natur- Zielerreichung des Projekts mitverfolgt
ersten sechs Projektjahre, die der Fonds schutz und Landwirtschaft wird vom Amt und ankurbelt.
Landschaft Schweiz finanzierte und an für Natur und Umwelt (ANU) und seinen Seit Projektbeginn begleitet eine achtköp-
dem sich 40 Betriebe beteiligt hatten, trat Auftragnehmern seit Inkrafttreten der fige Arbeitsgruppe das Unternehmen. Die-
die neue Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) ÖQV in ganz Graubünden angewendet. se besteht zurzeit aus einem betroffenen
in Kraft. Sie gab dem Projekt neue Dyna- Ziel ist eine Bewirtschaftung, die naturna- Landwirt, einem Förster, zwei Vertretern
mik, indem es in ein Vernetzungsprojekt he Biotope und traditionelle kulturland- der Regionalplanung, der Präsidentin des
gemäss den ÖQV-Richtlinien umgewan- schaftliche Elemente bewahrt und trotz- Obstvereins Mittelbünden, einem Vertre-
delt werden konnte. Das Kulturland- dem zeitgemäss ist. ter der landwirtschaftlichen Beratung, ei-
schaftsprojekt Domleschg war eines der Wichtig sind eine standortgerechte, abge- nem Vertreter des Amtes für Natur und
ersten Vernetzungsprojekte, welche beim stufte Intensität der Bewirtschaftung und Umwelt, einer Vertreterin von Pro Natura
Bund eingereicht wurden. Dies sicherte eine regelmässige Pflege der wertvollen und der Projektleitung. So können sich die
für längere Zeit höhere Beiträge an die Elemente. Die Landwirte verpflichten sich antreibenden Kräfte koordiniert für ihre
Landwirtschaftsbetriebe. zudem, in der Projektphase von jeweils Anliegen einsetzen.
10 HOTSPOT 22 | 20101400
1200
1000
800
600
400
200
0
(m)
)
)
(a)
(Stk)
(a)
)
a)
(m )
entbu dorte
(a)
)
Pflan äume
(ha)
(ha)
uern 2
ge (a
scht (a
sen (a
en (a
sen (h
borde
n
ume
äune
rache
eiden
iesen
zung
nstan
npfle
obstb
efläch
bstwie
rautsä
e Wie
Holzz
n
enma
Buntb
sive W
sive W
rasse
Hecke
e
stamm
Streu
Trock
sive O
tensiv
hte K
Trock
hte Te
Exten
Exten
Hoch
gemä
Exten
in
Ziegen halten die Landschaft offen.
gemä
Wenig
Spät
Spät
Jede der neun Gemeinden, welche im Kul- Projektziele und deren Erreichung in der ersten Phase des Vernetzungsprojekts 2002–2007. Grün: Ziel 2002–2007;
turlandschaftsprojekt mitmacht, hat ei- Dunkelrot: Ziel zu mindestens 80% ereicht; Orange: Ziel nicht erreicht.
nen Kulturlandschaftsdelegierten, wel-
cher regelmässig Informationen über das nungsmerkmale. Vor rund 50 Jahren stell- orten nach Entbuschungsmassnahmen
Projekt erhält. Die Gemeinden finanzieren te der Gutshof Canova die letzten Apfel- besonders geeignet. Bereits 1998 entstand
die laufenden Betreuungskosten des Pro- schachteln her. Sie wurden im 19. Jahr- die Idee, das Gebiet Spunda mit Ziegen zu
jekts. Dank dieser Beiträge können lau- hundert der Luxus-Hotellerie verkauft nutzen. Ab Herbst 2007 wurden 2,8 Hekta-
fend neue Projekte entwickelt und umge- und sogar bis nach Sankt Petersburg an ren Haselbuschwald aufgelichtet und be-
setzt werden. Inzwischen ergänzen weite- den Zarenhof exportiert. weidet. Die heute noch bestehenden Tro-
re Landschaftsprojekte das Vernetzungs- Im Jahr 2006 wurde für Zoja ein Grund- ckenstandorte konnten so miteinander
projekt, wie die beiden folgenden Beispie- konzept erarbeitet und die Vernetzungsar- vernetzt und verarmte Flächen wieder in
le zeigen. Die Vielfalt der Landschaftsele- beit mit der Landwirtschaft geleistet. Fürartenreichere überführt werden.
mente ermöglicht es, immer wieder neue Vertrieb und Marketing entstand eine ei- Damit die Anliegen des Forstes, der Jagd,
spannende Themen aufzugreifen und so- gene Homepage (www.zoja-viamala.ch). der Landwirtschaft und des Naturschutzes
mit das Projekt lebendig zu halten. optimiert werden können, arbeiteten die
Ziel war es, im ersten Jahr 1000 Apfelkist-
chen zu verkaufen. Da die Nachfrage grös Projektverantwortlichen zusammen mit
Zoja, die Apfeldegustationsschachtel ser ist als das Angebot, wurde dieses Zielden Landwirten unter Einbezug aller Be-
Das milde, nebelfreie Klima machte die problemlos erreicht. Limitierend für den teiligten ein Weidereglement aus. Der Be-
Region einst zu einem der wichtigsten Verkauf sind die Mengen der zur Verfü- weidungsdruck konnte so lokal erhöht
Obstanbaugebiete der Schweiz. Noch heute gung stehenden alten Apfelsorten. und der Wildwechsel möglichst intakt ge-
gedeihen hier über 120 Apfelsorten. Zwi- halten werden.
schen 1961 und 1991 reduzierte sich der Ziegen fressen Sträucher Durch das Projekt sollten keinerlei Kon-
Baumbestand allerdings um die Hälfte. Ursprünglich dominierten im Gebiet flikte mit der Erfüllung der Schutzfunkti-
Um die Obstgärten zu erhalten und zu Spun
da gemähte, artenreiche Halbtro- on des Waldes entstehen. Die mosaikarti-
fördern, wurde ein alter Wirtschaftszweig ckenrasen das Landschaftsbild. Seit den ge Verteilung von offenen und geräumten,
wiederbelebt: die Apfeldegustations 1950er-Jahren werden allerdings immer aufgelichteten und bewaldeten Flächen
schachtel Zoja. Diese enthält sechs bis mehr Flächen nicht mehr bewirtschaftet. stellt sicher, dass keine grossflächigen An-
neun Apfelsorten. Beigelegte Kärtchen er- Dies hat zur Folge, dass das Gebiet lang- riss- oder Durchflusszonen für Schneerut-
zählen von der Geschichte der seltenen sam mit Haselsträuchern zuwächst. sche entstehen. Zudem wirkt sich eine
Äpfel und deren charakteristischen äusse- Ziegen sind aufgrund ihrer Eigenart, Grasnarbe, welche durch eine angepasste
ren, inneren und geschmacklichen Erken- Sträucher und Jungbäume zu verbeissen, Beweidung kurz gehalten wird, positiv auf
für ein Offenhalten von Trockenstand - die Hangstabilisierung aus.
HOTSPOT 22 | 2010 Brennpunkt Vorzeigeprojekte 11Regionales Landschaftskonzept
Unser Lebensraum: vielfältig und vernetzt
Heinrich Schiess, Projektbearbeiter des Landschaftskonzepts Neckertal, CH-9125 Brunnadern, schiess.buehler@bluewin.ch
Das Landschaftskonzept Neckertal be dern entlang von ökologisch wertvollem hängig davon, ob dieser durch Nichtnut-
zweckt die ökologische Aufwertung drei Grünland (z.B. Magerweiden, Magerwie- zung oder als Folge forstlicher Massnah-
er Gemeinden. Im Fokus steht die gesam sen, Streurieder und Hochmoore) sowie men zustande kommt. Noch viel ausge-
te Landschaft. Besonderes Augenmerk die Wiederherstellung von vorratsarmen, prägter werden die zahlreichen Neben-
gilt den Kontaktlebensräumen zwischen lichten Beständen («Magerwald») auf be- und Lichtbaumarten unterdrückt, was
geschlossenem Wald und dem Offenland. sonders trockenen, nassen, sauren oder sich bezüglich Vielfalt beispielsweise im
rutschenden Böden. Auf diesen Sonder- Fall der insektenreichen Eichen, Föhren,
Nach mehreren Jahren Vorarbeit wurde standorten sind die Holzsortimente quali- Birken, Weiden und Zitterpappeln beson-
am 1. Januar 2007 das Landschaftskonzept tativ schlecht, die Erträge gering und die ders nachteilig auswirkt. Das Artenspekt-
Neckertal offiziell aus der Taufe gehoben. Kosten für die Nutzung hoch. Gleichzeitig rum an Pflanzen und Tieren, die durch ei-
Trägergemeinden sind Oberhelfenschwil, ist das Potenzial für die Vielfalt gross. Bei ne dichte Baumschicht ausgeschlossen
Neckertal und Hemberg im Kanton St. Gal- einer ausbleibenden Nutzung geht die werden, weitet sich in der Strauchschicht
len. Die Grundidee klang verheissungs- Vielfalt allerdings über kurz oder lang und in der Krautschicht nochmals enorm.
voll: Ein Projekt, das in der ganzen Land- selbst auf den waldfeindlichsten Standor- Auch besonnter, offener (nicht kultivier-
schaft, in allen Lebensräumen und für je- ten verloren. Das Auslichten ist deshalb ter) Boden, der bei Waldauslichtungen re-
de Artengruppe die Vielfalt fördert. Ganz sowohl ökologisch dringend notwendig gelmässig entsteht und in der gesamten
so einfach war es dann allerdings doch als auch – mit der Defizitdeckung durch heutigen Landschaft Mangelware ist, stellt
nicht. Als motivierende Vision und als in- das Landschaftskonzept – ökonomisch in- ein überaus wertvolles Element dar.
haltliches Oberziel hat die Idee jedoch teressant. Gefördert werden in erster Linie In allen diesen Belangen schufen die ur-
auch heute noch Bestand. Die Initianten Lichtbaumarten wie Föhren, Eichen, Zit- sprünglichen gemischten Waldnutzungen
gaben ihrem Projekt folgende Grundsätze terpappeln und Birken; unter den Sträu- eine vollkommen andere Situation als die
mit auf den Weg: chern sind es vor allem Weiden, Schwarz- heutige Nutz- und Wertholzproduktion.
> Die Mitwirkung von Bewirtschaftern dorn und Weissdorn, die allesamt für die Der Wald gilt heute als Hort der ökologi-
und Waldbesitzern ist in jedem Fall Biodiversität eine zentrale Rolle spielen. schen Sicherheit, weil seine Arten prozen-
freiwillig. Ein Spezialfall sind die ehemaligen Föh- tual am wenigsten gefährdet sind. Das
> Die ökologischen Ziele sind fachlich gut ren-Weidewälder, eine Kombinations-Nut- stimmt wohl für die übriggebliebenen, so-
abgestützt und werden für jedes Teil- zung zwischen Holzproduktion und Land- genannten «Waldarten», nicht aber für
projekt vertraglich festgehalten. wirtschaft, die in vielen Kulturlandschaf- viele besondere Pflanzen und Tiere.
> Die Vertragspartner erhalten faire, at ten eine grosse Rolle gespielt hat und auch
traktive Beiträge. für das Toggenburg typisch ist. Mit der Aufwertungen im Kulturland
> Zweckgebundene Mittel von aussen er- Rationalisierung der Landnutzung ver- Die zweite Hauptmassnahme des Land-
zeugen im wirtschaftlich peripheren schwanden die Föhrenweiden entweder schaftskonzepts gilt den Baumpflanzun-
Tal ein substanzielles Angebot an Ar- im Stammholzwald oder sie wurden der gen auf der landwirtschaftlichen Nutzflä-
beit und Verdienst. Landwirtschaft zugeschlagen, was meist che. Bis Ende 2009 setzten die interessier-
> Die enge Zusammenarbeit mit den Be- den Verlust der Bäume zur Folge hatte. In ten Grundeigentümer rund 1600 Hoch-
hörden und allen involvierten Interes- vielen Fällen begegnet man heute nur stamm- und Einzelbäume, die im Rahmen
sengruppen, vor allem mit den Förs- noch den nach der Aufgabe der Bewei- des Projekts stark verbilligt abgegeben
tern, ist eine Selbstverständlichkeit. dung in den Hochwald integrierten Föh- werden konnten. Auch für das Ausholzen
> Die wichtigsten Stossrichtungen sind ren. Die strukturelle Wiederherstellung einwachsender Magerweiden, die Anlage
das Wiederverbinden von Offenland dieses speziellen Lebensraums lohnt sich neuer Hecken, Teiche und weiterer Ele-
und Wald, die Extensivierung und die sowohl aus ökologischer als auch aus kul- mente bietet das Projekt Finanzhilfen an.
De-Rationalisierung der Bewirtschaf- tureller und landschaftlicher Sicht. Knapp die Hälfte der rund 300 Landwirt-
tung sowie die Konzentration auf Ob- Ziele und Massnahmen des Landschafts- schaftsbetriebe in den drei Gemeinden
jekte mit vorgegebenen Qualitäts- und konzepts im Wald basieren auf der oft be- nimmt an genehmigten oder geplanten
Potenzialkriterien. legten negativen Korrelation zwischen ÖQV-Vernetzungsprojekten teil. Das Land-
> Die Öffentlichkeitsarbeit wird stark ge- Vielfalt und Holzvorrat. So wird der schaftskonzept spielte hier die Rolle des
pflegt. Höchststand der Artenvielfalt in den mit- Geburtshelfers.
teleuropäischen Wäldern mit der Periode Eine ökomorphologische Bewertung der
Schwerpunkt Wald des tiefsten Holzvorrates in Verbindung Gewässer hat einen allgemein sehr guten
Eine der Schwerpunktmassnahmen ist das gebracht. Nur schon bei den bestandesbil- Zustand festgestellt. Für Aufwertungs-
Auslichten von Wald. Dazu zählt das (Wie- denden Bäumen sinkt die Artenzahl mit massnahmen ist ein Konzept in Arbeit.
der-)Auflösen von geschlossenen Waldrän- steigendem Holzvorrat, und zwar unab-
12 HOTSPOT 22 | 2010Sie können auch lesen