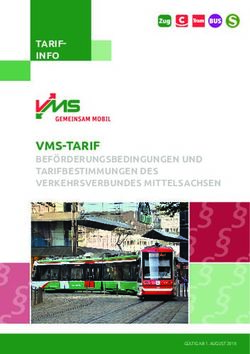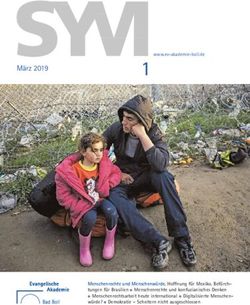IBA Forum - IBA meets IBA - Stadtkapital! 18. und 19. April 2011 in Berlin Dokumentation - Senatsverwaltung für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
Vorwort der Senatorin für Stadtentwicklung Ingeborg Junge-Reyer ................................................ 3
Einführung der Senatsbaudirektorin Regula Lüscher . ............................................................................... 4
Grußwort von Dr. Marta Doehler-Behzadi........................................................................................................ 7
Veranstaltungsrückblick .......................................................................................................................................10
IBA Berlin 2020: Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Sonja Beeck und Martin Heller ......... 15
Schwerpunkt 1: anders hinschauen – die Beiträge . .................................................................................. 17
Schwerpunkt 2: anders rechnen – die Beiträge .......................................................................................... 22
Schwerpunkt 3: anders kooperieren – die Beiträge .................................................................................. 27
Berichte zum aktuellen Stand der Internationalen Bauausstellungen
in Hamburg, Basel, Berlin, Heidelberg und Thüringen ............................................................................. 31
Impressum . .............................................................................................................................................................. 44
2Vorwort
Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin für Stadtentwicklung
Der Zustand und die Entwicklung der großen Städte sind die Gradmesser für die Zukunfts-
fähigkeit unserer Gesellschaft. Ihre nachhaltige Organisation voran zu bringen, entscheidet
über die Zukunft unseres Zusammenlebens. Internationale Bauausstellungen reflektieren die
Herausforderungen ihrer Zeit. Sie spiegeln die Debatten über die Aufgaben der Architektur
und des Städtebaus. Sie gehen über die bekannten Horizonte hinaus und setzen Akzente und
Trends.
Berlin hat sich eine dritte Internationale Bauausstellung vorgenommen. Als Gastgeberin des
Forums – IBA meets IBA hat Berlin die Auseinandersetzung mit dem Thema Stadtkapital! auf
die Tagesordnung gesetzt. Voneinander lernen, Erfahrungen produktiv auszutauschen, das
war das Anliegen dieser Veranstaltung. Ingeborg Junge-Reyer,
Senatorin für
Stadtentwicklung
Stadtkapital! ist auch das Motto der IBA Berlin 2020. Dieses Kapital, die Vielfalt, Kreativität und
das kulturelle Potential Berlins wollen wir nutzen, um die Stadt in ihrer Beispielhaftigkeit wie
auch ihrer Besonderheit herauszustellen. Dabei sollen die unterschiedlichsten Projekte Pionier-
arbeit für die Stadt von morgen leisten. Die IBA Berlin 2020 soll dafür Motor und Versuchslabor
sein. Stadtkapital verweist auf die Ressourcen, wie sie in Berlin, aber auch in anderen Städten
vorhanden sind: Woraus schöpfen Städte ihre Innovationskraft? Wie kann Stadtentwicklung in
die Zukunft weisen? Nutzen wir das Kapital unserer Städte hinreichend? Was können wir von
guten Beispielen andernorts lernen und für unsere Stadtgesellschaften nutzbar machen?
Zwei Herausforderungen stehen dabei auch für eine IBA Berlin 2020 im Mittelpunkt. Erstens:
Wie wird die Stadt fertig mit den massiven und ständig weiter steigenden räumlichen Anforde-
rungen? Hier muss ein Umdenken einsetzen. Die Stadt muss ökologisch und demokratisch im
umfassenden Sinne gedacht werden: Sie muss Platz für alle und alles schaffen und gleichzei-
tig die Menschen „mitnehmen“, sie zu Akteuren machen. Dabei darf sie die ökonomischen
Anforderungen nicht vernachlässigen: Die Einkommen und das Leben ihrer Bewohnerschaft
zu sichern und im Wettbewerb der Städte zu bestehen. Die Stadt des 21. Jahrhunderts braucht
ein öffentliches Regelwerk zur Nutzung der räumlichen Ressourcen. Der verfügbare Raum
der Stadt darf nicht beliebig vernutzt, bebaut und veräußert werden. Die Ressource Raum als
„Heiligtum der Städte“ muss öffentlich nachvollziehbaren Kriterien im Interesse der Stadt-
gesellschaft unterworfen werden. Berlin hat für diesen Zugang zum Städtebau gute Voraus-
setzungen, weil hier noch über Raum gestritten werden kann, wo anderswo aus Mangel an
Möglichkeiten nur noch über den Preis geredet wird. Gleichwohl wissen wir auch in Berlin,
dass in bestimmten innerstädtischen Lagen Raum bereits zum knappen Gut wird.
Die zweite Herausforderung lautet: Wie kann die Stadt den unterschiedlichen Erwartungen
zeitnah entsprechen, ohne die Zukunft zu verbauen? Gerade weil die Stadt in der ständigen
Gefahr steht, dem Augenblicklichen zu verfallen, muss es Möglichkeiten des Temporären ge-
ben. Es wird die Zeit eingefordert, in der sich Architektur und Städtebau einem Ort annähern,
sich Zeit nehmen, den Dialog mit den Menschen führen, um schließlich das Beste aus einer
räumlichen Situation zu machen.
Unterstützt durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hatte die
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein Netzwerk von Experten und Akteuren vergange-
ner, aktueller und zukünftiger IBA und interessierte Fachleute eingeladen, sich mit aktuellen
Fragen der Stadtentwicklung vor dem Hintergrund sich stetig ändernder Bedingungen aus-
einanderzusetzen.
Das IBA Forum Stadtkapital! hat sich den wichtigen neuen Themen mit gutem Beispiel gestellt
– aus Berlin und vielen anderen Städten. Diese Dokumentation zeigt die unterschiedlichen
Ansätze und Erfahrungen, mit denen die Zukunftsfragen der Städte gelöst werden.
Die IBA ist ein Prozess, ein Lernprozess für diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ein Ent-
wicklungsprozess für die, die sie „managen“, ein Prozess der Einmischung und des Mitmachens
für die Bürgerinnen und Bürger und ein Prozess der Bereicherung für die ganze Stadt.
3Einführung
Die Stadt anders mischen. Zum Planungsstand einer IBA 2020 in Berlin
Auszüge aus der Eröffnungsrede von Senatsbaudirektorin Regula Lüscher am 19. April 2011.
Das Motto dieser Tagung und des Vorkonzepts zur Durchführung einer IBA 2020 in Berlin lautet
Stadtkapital!. Es ist das Ergebnis eines gemeinsamen dreimonatigen Arbeitsprozesses mit dem
aus sieben Experten zusammengesetzten Prae-IBA-Team und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Entstanden ist ein Rohkonzept, das die
Herangehensweise und den Umsetzungsanspruch beschreibt und drei Strategien liefert, das
Berliner „Stadtkapital“ zu heben. Dabei wurde vorerst nicht von einem problemorientierten,
sondern einem potenzialorientierten Ansatz ausgegangen.
Dieses Vorkonzept wurde während drei weiterer arbeitsintensiver Monate hier in der Alten Senatsbaudirektorin
Regula Lüscher
Zollgarage in Tempelhof, im IBA Studio, mit Berlinerinnen und Berlinern, mit der interessierten
Fachöffentlichkeit, mit Politik und Verwaltung diskutiert und weiterentwickelt. Wir haben es
gewagt, uns in dieser frühen und konzeptionell fragilen Phase der Kritik und der Reflexion
durch die Öffentlichkeit zu stellen. Das war ein spannender und im Ergebnis erkenntnisreicher
Diskussions- und Lernprozess, der vorerst in einer Denk- und Konzentrationsphase mündete.
Jetzt stehen wir kurz vor einem weiteren Schritt, der Präzisierung des Konzepts und dessen
vielfältiger konzeptioneller Gedanken.
Was waren unsere inhaltlichen Startpositionen? Erstmals wohnt die Mehrheit der Menschheit
in den Städten, will dort ihre Lebensplanung verwirklichen und will selbstverständlich beteiligt
sein an dem, was sich in ihrer Stadt entwickelt. Die Stadt muss dabei ökologisch und demo-
kratisch im umfassenden Sinne weiterentwickelt werden. Dies werden die Kernpunkte der IBA
Berlin 2020 sein: Stadt, Teilhabe, Energiewende. Was sind aber dabei die ganz spezifischen
Herausforderungen, die uns interessieren? Schließlich soll eine IBA unter anderem nach den
zehn Punkten des IBA Memorandums ein Ausnahmezustand sein, Mut zum Risiko beweisen,
einen Paradigmenwechsel einläuten und zumindest ein „bösartiges“ Problem behandeln.
„Die Stadt steht vor einem Clash, vor einer ultimativen Bürgerblockade“, formulierte kürzlich
einer meiner Mitarbeiter. Ist es tatsächlich so dramatisch? Mit dem zunehmenden Bedürfnis
der mündigen Bürger, am „Stadt-machen“ aktiv teilzunehmen, ist in der Tat auch eine steigen-
de Komplexität aller Projekte und Verfahren zu beobachten. Konkurrierende Interessen geraten
miteinander ins Gefecht, und nicht selten führen unversöhnliche Positionen zu Pattsituationen.
Das können konkurrierende Interessen bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes sein, das ist
der Bürgerwille zum Schutz eines Ortes gegen die Position des Investors, das ist das Dilemma,
Klimaanpassung erschwinglich und dadurch sozial verträglich zu bewältigen. Viele dieser
Pattsituationen spiegeln die Schwierigkeit wider, die durchmischte europäische Stadt, die wir
uns so sehr wünschen, zu leben und zu bauen. Wir betrachten heute die Brachen, die diese
Konflikte im Raum hinterlassen. Wir konstatieren aber auch die Grenzen und Schranken der
städtebaulichen Verfahren.
Die IBA Berlin 2020 hat sich zum Ziel gesetzt, modellhaft und systematisch die Prozessqualität
für komplexe Bauaufgaben auf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen in Zukunft in Berlin, aber
auch anderswo, Stadtentwicklung mit fast leeren Kassen betreiben. Spätestens dann stellt sich
verschärft die Frage nach den Steuerungsmöglichkeiten. Wer nicht mehr die Macht des Geldes
hat, wird sich andere Strategien überlegen müssen, um seine Ziele zu erreichen. Die Aushand-
lungsprozesse brauchen verlässliche und engagierte Ansprechpartner, die mit Experimenten
und ungewöhnlichen Ansätzen andere mitnehmen und begeistern können. Deshalb könnte
der aufstrebende Bürgerwille alles andere als ein weiteres Hindernis sein, sondern zu einer fes-
ten Ressource werden. Das Heben dieses Kapitals, dieser Ressource ist existenziell für die Städ-
te – ob global oder lokal. Nicht ohne Grund heißt daher das Motto unserer IBA Stadtkapital!.
Die drei Strategien zur Umsetzung heißen Hauptstadt, Raumstadt, Sofortstadt. Berlin als
Hauptstadt ist das Schaufenster Deutschlands. Hier wird der gesellschaftliche Entwurf einer
verstädterten demokratischen Gesellschaft ausgestellt. Dazu wollen wir im Rahmen der IBA
4Einführung
beitragen und Gebautes zeigen. Im Jahre 2020 sollen Berliner und Gäste Architektur und
städtebauliche Projekte, aber auch Landschafts- und Kunstprojekte entdecken können. Diese
sollten modellhaft sein und eine Ästhetik verkörpern, die internationale Aufmerksamkeit
generiert. Darüber hinaus werden diese Projekte ein demokratisches Berlin im 21. Jahrhundert
zeigen, das im Labor IBA 2020 acht Jahre lang daran gearbeitet hat, das Bild der durchmischten
europäischen Stadt als Gesellschaftsmodell produktiv zu kultivieren. Das dafür gesorgt hat,
dass der Energieverbrauch sozial verträglich reduziert werden kann, und zwar im eigenen
Bestand und mit seinen Bürgerinnen und Bürgern.
Die städtebauliche Strategie Raumstadt zielt nun auf ein beachtliches Kapital Berlins: den
Raum. Das ist ganz sicher eine der Ressourcen, um die uns andere Städte beneiden. Es gilt,
diesen Raum zum Wohle aller restriktiv und klug zu bewirtschaften und sich genau zu über-
legen, an welchen Stellen jetzt oder erst in weiter Zukunft gebaut werden muss. Es gilt zu
entscheiden, an welchen Stellen öffentlicher Raum und grüne Oasen auf die fortschreitende
Klimaveränderung reagieren und deshalb konsequent freigehalten werden müssen. Die IBA
soll so Modelle für eine nachhaltige Flächenbewirtschaftung erproben und neue Formen der
Raumaneignung entwickeln.
Die kulturelle Strategie Sofortstadt versteht Planen und Bauen explizit als Prozess. Sofortstadt
greift die oft unvermeidbaren und aus komplexen Sachzwängen resultierenden langen Zwi-
schenzustände als Chance auf, als Chance, Beteiligung und Kooperation im Entwurfsprozess
von Stadt anders zu nutzen. In diesen Zwischenzuständen ergibt sich die Möglichkeit, Zukunft
auszuprobieren. Berlin ist die Hauptstadt der Zwischennutzung, der temporären Inanspruch-
nahme. Mit zeitlich überschaubaren, freudvollen, praktischen Projekten soll Teilhabe und
Stadtmachen real gemacht werden. Bewusst leihen wir uns dabei den Instrumentenkasten
kultureller Projektentwicklungen aus. Die Projekte helfen, das Terrain zu sondieren, es für
bestimmte Nutzungen zu testen, Adressen zu bilden. Sie qualifizieren Diskussionsprozesse, sie
überbrücken lange Planungszeiträume, sie regen an, und manchmal lenken sie auch ab.
Das IBA Team nennt die Potenziale Berlins das „Stadtkapital“, welches gehoben werden soll.
Gemäß dem Leitbild der gemischten Stadt, der Frage des Energieumbaus und der Prozess-,
Beteiligungs- und Verantwortungskultur, haben wir uns bei der Suche in der ganzen Stadt nach
geeigneten Orten umgesehen, wo dieses Stadtkapital zu heben ist. Die Idee, Tempelhof als
singulären IBA-Ort herauszustellen, haben wir dabei verlassen.
Die beispielhaften Suchräume spiegeln das Thema der gemischten Stadt auf sehr unterschied-
liche Weise: Orte der Hochkultur mit Alltagskultur verbinden, globale Unternehmen oder
innerstädtische Forschungsadressen mit lokalen Nachbarschaften vernetzen, Neubaugebiete
nutzen, um Bestandgebiete sozial anders zu ergänzen und somit eine andere Mischung zu
erhalten, die Dazwischenstadt oder heterogene Stadt ergänzen und städtebaulich anders
mischen, die Schlafstadt mit Arbeitplätzen ergänzen, um somit eine andere funktionale
Mischung zu erreichen, große leerstehende Bauten mit anderen Nutzungen aufmischen,
um so das baukulturelle Erbe zu aktivieren.
Wenn es darum geht, das Kapital der Stadt zu erhöhen, so muss das „Stadt-anders-mischen“
die Orte erreichen, die wir nicht per se mit diesem Leitbild verbinden. Eine IBA in Berlin muss
von der Mitte bis zu den Rändern wirken. Moderne Urbanität braucht dazu neue, zeitgemäße
Bilder und Strategien, die dezentrale Orte urban und attraktiv machen.
Wo soll die IBA ihre Fragestellungen ansetzen, wo ihre Projekte verwirklichen? Eine Festlegung
hierzu ist nicht getroffen worden, Überlegungen gibt es allerdings schon:
Für den Themenkomplex Wohnen, Arbeiten und Wissenschaft in der gemischten Stadt werden
als Beispiele der Campus Charlottenburg in der City West und das Gebiet Müllerstraße im Wed-
ding von jetzigen Bayer Health-Care Standort bis zur Seestraße vorgeschlagen.
5Einführung
Alle Metropolen wollen attraktiv für globale Unternehmen, aber auch die Wissenschaft und
Bildung sein. Wie weit kann man abgeschottete Unternehmens- und Wissensstandorte öffnen
und stadträumlich vernetzen als Gewinn für die Universitäten, Unternehmen und das städti-
sche Umfeld?
Als Vorschlag für den Städtebau in der gemischten Stadt bietet sich an, das Gebiet der Nördli-
chen Frankfurter Allee als ein Beispiel für Urbanität in einer Situation zwischen Innenstadt und
Außenbezirken zu untersuchen und in Oberschöneweide die Entwicklung von der alten Indus-
triestadt zur neuen Vorstadt am Wasser in den Blick zu nehmen. Wie kann man diese urbane
Heterogenität baulich weiterentwickeln, um ein städtebauliches Leitbild für die gemischte
Stadt des 21. Jahrhunderts von morgen zu finden und Resträume, Abstandsräume, Grünräu-
me, Dächer, Wasserlagen, „Indoor Voids“ zu einem neuen räumlichen Gefüge zu ergänzen und
umzubauen? Diese Fragestellungen könnten mit der Raumstadtstrategie eine Antwort finden.
Es bietet sich aber auch an, die Großraumsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre zu betrach-
ten. Als Schlafstadt der Metropole konzipiert, sind sie ein Auslaufmodell. Wie kann in der mo-
nofunktional geprägten Gropiusstadt unter den Vorzeichen der Energiewende eine differen-
ziertere Mischung von Wohnen, Arbeiten und Lernen erprobt werden? Welche Rolle spielt der
öffentliche Raum, wenn es darum geht, die Transformation vom Energieverbraucher hin zum
Energieproduzenten zu erreichen? Wie sieht an diesem Ort die Zukunft der Arbeit und Bildung
aus im Sinne der Neumischung? Dabei können gerade Sofortstadtstrategien, die z. B. temporär
studentisches Arbeiten, Sommerkurse und Akademien in ebenso temporären An-, Auf- und
Umbauten nach Gropiusstadt verlagern, ein neues Bild von Stadt ausprobieren.
Ein Ort von ganz besonderem Interesse für die Frage der demokratischen Öffentlichkeit ist
die historische Mitte mit Humboldt-, Marx-Engels-, Rathaus-Forum, Räume, in denen sich
das Hauptstadtsein Berlins manifestiert. Wie soll das demokratische Zentrum der deutschen
Hauptstadt aussehen, wie kann sich hier Öffentlichkeit konstituieren? Wie kann ein dialogi-
scher Findungsprozess für die Gestaltung dieser Räume mit dem Ziel initiiert werden, Qualität,
Heterogenität sowie Lebendigkeit in der Mitte Berlins als Symbol für die Hauptstadt nachhaltig
zu verankern? Andere Modelle der Aushandlung für Nutzungsmischung und Gestaltqualität
werden erprobt. In neuen Formaten mit durchaus auch kulturellen Setzungen wird der Prozess
langsam vorangetrieben. Die Sofortstadt als Methode gibt neue Möglichkeiten in diesem
kollektiven Vergewisserungsprozess.
Darüber hinaus sind Teile von Nord-Neukölln in der Nachbarschaft der Tempelhofer Freiheit
interessant durch die Frage nach der Herstellung und Haltbarkeit der sozialen Mischung in der
nachhaltigen Stadt. Einerseits ist das Ergebnis aus dem Parklandschaftswettbewerb hervor-
ragend geeignet, als Leuchtturmprojekt einer IBA Exzellenz von internationaler Ausstrah-
lungskraft zu erreichen. Es kann aber auch einen wichtigen Beitrag zur Frage der Integration
verschiedenster Bevölkerungsgruppen und Milieus leisten. Welche Rolle kann außerdem
die Neubebauung der Ränder spielen, um die Integration der Menschen in Neukölln in den
Bereichen Bildung und Arbeit zu befördern? Wie kann das Gebiet mit vielfältigen Wohn- und
Lebensangeboten sozial vielfältiger werden?
Übergreifend zu diesen gebietsbezogenen „Suchräumen“ steht das Thema der „gebauten Ele-
fanten“. Das sind die XXL-Gebäude des 20. Jahrhunderts, die es in jeder Stadt gibt. Sie wurden für
eine Nutzung gebaut, die aktuell nicht mehr nachgefragt wird. In Berlin hat ein großer Teil die-
ser „Elefanten“ teilweise oder komplett seine ursprüngliche Nutzung verloren – vom Steglitzer
Kreisel über das ehemalige Tempelhofer Flughafengebäude bis hin zur Zukunft der staatlichen
Museen in Dahlem. Hier geht es darum, nach ihrer möglichen Rolle in der gemischten Stadt zu
fragen, ihre spezifischen Eigenschaften zu ergründen und zu nutzen, ihre energetische Poten-
ziale auszuloten sowie Konzepte öffentlich zu beratschlagen und umzusetzen. Wie können
diese Riesen wieder in Gebrauch genommen werden und dabei für die klimatische, soziale
und ökonomische Verbesserung des städtischen Umfeldes wirken? Sie stehen beispielhaft für
Innenräume, mit denen sich die Raumstadtstrategie beschäftigt.
6Einführung
Diese Vorschläge sollen das Konzept illustrieren. Sie bedeuten keine Entscheidung „ex cathedra“.
Vielmehr sollen in einem weiteren Prozess die Zahl, die Orte, die Ausrichtung und nach der
Entscheidung über eine IBA die Projekte festgelegt werden.
Die aufgezählten Suchräume sind Orte mit extrem komplexer Gemengelage und mit der Ten-
denz zur Blockade. Sie sind, und das haben Gemengelagen an sich, zunächst einmal unüber-
sichtlich. Sie können im übertragenen Sinn auch explosiv werden. Mut zum Risiko beweisen
wir, indem wir trotz Handlungs- und Erwartungsdruck den Weg des behutsamen Forschens
und des sukzessiven Handelns anbieten. Der Ausnahmezustand IBA ist deshalb gerechtfertigt,
weil wir ohne diese Laborsituation unsere jeweiligen Partner nicht für ein Projekt gewinnen
können. Wir brauchen eine Kultur für die Phase Null. Die Phase Null ist der Raum vor dem
Projekt, der Zeitraum, in dem Blockaden vorgebeugt werden kann, oder die Pattsituation auf-
gelöst wird, wo die Analyse durch künstlerische Strategien angereichert wird, um so qualifi-
zierte Ausschreibungen zu bekommen.
Im IBA-Ausnahmezustand kann das andere Hinschauen, das andere Rechnen, das andere
Kooperieren und das andere Bauen schlussendlich erprobt und mit internationalen Gästen
diskutiert werden. Diese ersten drei Schwerpunkte haben wir im Rahmen unserer Tagung
Stadtkapital! durch Vorträge, durch Praxisbeiträge aus dem In- und Ausland beleuchtet und da-
durch die Diskussion vertieft. Wenn es gelingt, die in dieser Metropole innewohnende mentale,
kulturelle, wirtschaftliche und formale Kraft zu sehen, kann daran angeknüpft werden. Wenn
erkannt ist, wie verborgene Ressourcen, wie sozialer Zusammenhalt, Innovationsvermögen
oder kulturelle Vielfalt in Form von anderen Rechnungsmodellen in Wert gesetzt werden kön-
nen, und wie mit Partnern und sachkundig-engagierten Bürgerinnen und Bürgern konstruktiv
kooperiert werden kann, dann ist das die Voraussetzung für einen Paradigmenwechsel in
planerischen und politischen Entscheidungsprozessen.
Internationale Bauausstellungen reflektieren die Herausforderungen ihrer Zeit. Sie spiegeln die
Debatten über die Aufgabe der Architektur und des Städtebaus. Sie gehen über die bekannten
Horizonte ihrer Zeit hinaus und setzen Akzente und Trends. Das muss und wird auch eine IBA
2020 in Berlin leisten.
Regula Lüscher, Senats-
baudirektorin von Berlin,
eröffnete das IBA Forum.
7Grußwort
Eine IBA, viele IBA – die Fortsetzung eines Lernprozesses?
Dr. Marta Doehler-Behzadi, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Internationale Bauausstellungen haben in Deutschland weiterhin Konjunktur; sie treffen
den Nerv einer breiten Öffentlichkeit. Dass eine IBA „von unten“ aus der Bevölkerung heraus
wachsen muss, ist hier in Berlin gerade hervorragend zu sehen. Und auch die anderen derzeit
laufenden oder geplanten IBA in Basel, Hamburg, Heidelberg und Thüringen erfahren eine
große Resonanz, die für die Vitalität des Instruments IBA und für die Aktualität von Stadtent-
wicklungsdebatten spricht.
Berlin ist eine IBA-Stadt par excellence. Aus den bis heute heiß diskutierten und Maßstab
setzenden IBA 1957 und 1987, der Interbau und der Auseinandersetzung mit dem Thema Dr. Marta Doehler-Behzadi,
Bundesministerium für
Stadterneuerung und -rekonstruktion ist eine Tradition entstanden. Berlin scheint immer einer Verkehr, Bau und Stadtent-
IBA würdig zu sein. Das liegt vermutlich daran, dass die Stadt ein weltweit beachtetes Labor wicklung
der Gleichzeitigkeit gesellschaftlicher und urbanistischer Entwicklungen ist. In Berlin lassen
sich in verdichteter Form die wesentlichen Herausforderungen studieren, vor denen unsere
Städte stehen.
In der Regel stellen sich drängende gesellschaftliche Fragen in unseren Städten meist früher
und stärker. Hier sind die Probleme zugespitzter, die Folgen drastischer und die Strukturen
komplexer. Folgende Themen werden die Stadtdebatten der kommenden Jahrzehnte ab-
sehbar prägen, wenn nicht dominieren: Da ist nach den Ereignissen in Japan die Notwendig-
keit einer beschleunigten Energiewende. Und es ist, durchaus in wesentlichen Punkten damit
zusammenhängend, die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts und sozialen Ausgleichs
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des nach wie vor stattfindenden demografischen Wandels.
Alle Aspekte haben mit Kommunikation, mit Technologie und Planung sowie mit konkreten
Bauprojekten zu tun. Und mit Beteiligung. Veränderungen durch Einbeziehung der Bürgerin-
nen und Bürger, durch Information und Kommunikation zu gestalten, ist eine Kernaufgabe der
Stadtentwicklung. Dafür braucht es offene, kreative, von hoher fachlicher Kompetenz geprägte
Instrumente. Eine IBA ist auch dafür immer ein Weg besonders innovativer Lösungssuche.
Immer stand am Anfang vor Ort ein drängendes Problem, das eine Antwort suchte. Eine IBA
kann deutlich machen, dass Stadt für die anstehenden Herausforderungen nicht nur eine Be-
schreibungsgröße, sondern eine konkrete Handlungsfläche ist. IBA stand immer für Offenheit
im Denken und die Anschlussbereitschaft der Stadtentwicklungspolitik an gesellschaftspoli-
tische, technologische und ökonomische Entwicklungen. In der Stadtentwicklungspolitik mit
ihrer Bindung an das Notwendige und Machbare setzt vor allem die IBA auf einen Möglich-
keitssinn. Eine IBA bildet immer eine Sondersituation, einen Ausnahmezustand auf Zeit, die
herkömmliche Instrumente und Vorgehensweisen extrem zu erweitern vermag. Ihr experi-
menteller Charakter hat stets neue Partnerschaften und unkonventionelle Lösungen hervor-
gebracht. Das prädestiniert sie dazu, auch für die aktuellen Herausforderungen eine wichtige
Plattform zu sein. Eine IBA bildet den städtebaulichen Wandel nicht nur ab, sondern bewegt
sich in der Regel in gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Es geht um gesellschaftliche
und kulturelle Zukunftsfragen.
Dabei ist eine IBA keine reine Theorieveranstaltung, sondern sucht konkrete Lösungen. Eine
IBA hat immer auch eine bauliche Ausprägung. Das „B“ im Sinne von „Bau“ im Namen hat
durchaus auch heute noch einen Sinn. Es geht um Stadtgestaltung, um städtebauliche Lösun-
gen auf der Basis stadtentwicklungspolitischer Leitideen. Stadtumbau in unserer heutigen
Situation meint wirklich Umbau. Eine IBA ohne Geld ist daher schwer vorstellbar. Privates Kapi-
tal und ziviles Engagement werden zwar in der Stadtentwicklung seit Jahren als Heilsbringer
beschworen, und beides ist als Ergänzung auch enorm wichtig. Aber Stadtentwicklungspolitik
braucht vor allem auch ein klares Bekenntnis der öffentlichen Hand. Allein für den energe-
tischen Umbau wird in den nächsten Jahrzehnten sehr viel Geld und Know-how in nahezu
alle relevanten Stadtbereiche fließen müssen, so dass unsere Städte und Kulturlandschaften
vermutlich komplett umgekrempelt werden. Wir reden über einen langwierigen und umfas-
senden Prozess der Veränderung und des Umbaus, nicht über einen Schalter, den man einfach
8Grußwort
umlegen kann. Und gerade eine IBA steht für prozessorientierte Innovation und für beispiel-
hafte, international übertragbare Lösungen im Stadtbereich.
Bei der IBA geht es um eines der zentralen Instrumente der Stadtentwicklung in Deutschland.
Das Nachdenken über die Zukunft der „Marke IBA“ ist daher auch ein Nachdenken über die
Entwicklung einer der zentralen Institutionen unserer Baukultur. Unter der Überschrift „IBA-
Qualitätsprozess“ wurde daher vor rund drei Jahren im Rahmen der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung eine Reihe von
Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Sitzungen und Publikationen begonnen, zu denen auch
das IBA Forum gehört. Mit dem „Memorandum zur Zukunft Internationaler Bauausstellungen“,
dem IBA-Labor, dem Forum und dem Expertenrat erhielten daher der inhaltliche Anspruch an
eine IBA und die Voraussetzungen zu deren Qualitätssicherung eine übergreifende Struktur.
Das IBA-Memorandum dient dabei als eine Art Konvention, was eine IBA ausmacht. Es ist eine
lernende, weiter zu entwickelnde Grundlage. Ebenso wie eine konkrete IBA „lebt“ und sich bis
zu ihrer Präsentation verändert und ihr Profil schärft, müssen auch die übergreifenden generel-
len Eckpunkte der weltweit einmaligen „Marke IBA“ stetig im Lichte der Erfahrungen weiterent-
wickelt und aktualisiert werden.
Die Vielzahl derzeit parallel laufender und vorbereiteter IBA belegt die Dynamik und den In-
novationsbedarf im städtischen Bereich. Jede aktuelle IBA sollte sich der Aufgabe stellen, die
Staffel von einem Ort zum anderen weiter zu tragen und das Format in diesem Sinne weiter
zu entwickeln. Der Bund versteht sich dabei im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungs-
politik und seiner Baukulturpolitik als Partner; das Bundesbauministerium sieht sich überdies
als Stadtentwicklungsressort in der Pflicht, auch in den nächsten Jahren intensiv für Quali-
täten in städtischen Entwicklungsprozessen zu werben. In guten Zeiten hat man manchmal
den Eindruck, dass sich außerhalb von Fachkreisen kaum einer für „Stadt’“ als Politikfeld zu
interessieren scheint. Als Problem ist „Stadt“ dann aber plötzlich in aller Munde. Um dieses
Bild zu korrigieren, muss Stadtentwicklungspolitik vom Reagieren zum Agieren gelangen, es
müssen aktiv Lösungen und Wege gesucht und vorangetrieben werden. Da unsere Städte vor
einem gravierenden Umbau stehen, braucht es ungewöhnliche, kreative Vorgehensweisen und
integrierte Arbeitsformen.
Eine IBA ist ein Instrument des Zutrauens in die Gestaltbarkeit von Stadt. Sie ist eine Ent-
deckungsreise in Sachen innovativer Verfahren, Strukturen und Lösungsansätze. Eine Gelenk-
stelle in die Zukunft.
Dr. Marta Doehler-Behzadi
führte für das Bundesminis-
terium in das Thema ein.
9Veranstaltungsrückblick
Stadtkapital! Von Möglichkeiten und Vermögen des Städtischen
Das Vermögen der Stadt stand im Mittelpunkt des IBA Forums 2011. Es wurde aus vielerlei
Perspektiven betrachtet: Was sind die Kapitalien einer Stadt? Wie geht sie mit ihrem Besitz um?
Inwiefern kann eine Internationale Bauausstellung zum Heben von Stadtkapital, zur Erkennt-
nis und zur Aktivierung städtischer Potenziale beitragen? Was bedeutet es insbesondere für
eine Stadt wie Berlin mit seinem komplexen urbanen Gefüge, sich in Zeiten von Ressourcen-
knappheit mit dem eigenen Vermögen auseinanderzusetzen? Rund 200 Experten und Akteure
vergangener, laufender und geplanter Internationaler Bauausstellungen und weitere Fachleute
von Universitäten, Ministerien und Institutionen kamen am 18. und 19. April in der Hauptstadt
zusammen, um über Stadt- und IBA-Kapital zu diskutieren. In Vorbereitung der Internationalen
Bauausstellung IBA Berlin 2020 war die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin Gastge- Der Vorabend im Heimat-
hafen Neukölln: Für manchen
berin des IBA Forums – IBA meets IBA. eine neue Entdeckung!
„In Berlin lassen sich in besonders verdichteter Form die Herausforderungen studieren, vor de-
nen unsere Städte stehen.“ Dr. Marta Doehler-Behzadi vom Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) brachte es in ihrem Grußwort zur Tagung auf den Punkt. „Und
die IBA ist genau das richtige Instrument, um das Problem, die Aufgabe, das Potenzial und die
Lösung in Verbindung zu bringen. Die IBA ist der besonders innovative Weg für die Lösungs-
suche auf eine ganze Reihe von Anforderungen.“ Dem vom BMVBS berufenen IBA-Expertenrat,
der am Vortag des Forums zusammenkam, wurden neben den Planungen in Berlin drei weitere
Vorhaben Internationaler Bauausstellungen vorgestellt. Die IBA Basel 2020 startete im vergan-
genen Herbst in der trinationalen Stadtregion, in Heidelberg und Thüringen wird ebenso an
IBA-Vorbereitungen gearbeitet.
„Es geht um Stadtkapital als Strategie, den Möglichkeiten des Städtischen und der Städte auf
eine neue Spur zu kommen“, umriss Martin Heller vom Berliner Prae-IBA-Team das Thema des
IBA Forums 2011. „Suchen, finden, nutzen! Diese Dreifaltigkeit ist so etwas wie der Imperativ
urbaner Kapitalanlage.“ Hinzu komme die Aufgabe, das Gefundene bewusst zu machen, es
als Potenzial in der Stadtbevölkerung zu verinnerlichen. Zum Auftakt konnten sich die Ver-
anstaltungsteilnehmer im Rahmen von drei Exkursionen am Nachmittag des 18. April selbst
auf die Suche nach Berliner Potenzialen begeben. Bei strahlendem Sonnenschein ging es zu
Am Ende jedes Vortrags-
Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Schiff auf Tour. Über 100 Interessierte nahmen am Exkur- blocks wurden die Ansätze
sionsprogramm teil. Bei der Führung über das Tempelhofer Feld ging es vor allem um die In- und Inhalte diskutiert.
besitznahme der Freifläche, sowohl durch Bewohner der Stadt als auch durch Pionier- und
Zwischennutzer. Bei einem Spaziergang durch Neukölln wurden Partizipationsmöglichkeiten
im Zusammenhang von urbanen „Voids“ vorgestellt. Bei der Bootsfahrt standen städtebauliche
Planungen entlang eines jahrzehntelang unzugänglichen Spreeufers und deren aktuelle und
künftige Realisierungsaussichten im Zentrum. Begleitet wurden die Exkursionen von Mitglie-
dern des Prae-IBA-Teams, Vertretern der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und weiteren
Ortskennern.
Spurensuche I: Tempelhofer Freiheit
Die Tempelhofer Freiheit ist eines der zentralen Berliner Entwicklungsgebiete, bei dem die
Stadtgesellschaft aktiv miteinbezogen wird. Die Schließung des ehemaligen Flughafens bot
den Ausgangspunkt für die Überlegungen zur IBA 2020, von Januar bis Mai 2011 fanden hier
zahlreiche IBA Studio-Abende in der ehemaligen Zollgarage statt. Bei der Exkursion am 18. April
standen vor allem das Leitbild der Tempelhofer Freiheit und die Involvierung von temporären
Nutzern in den Entwicklungsprozess im Mittelpunkt. Ausgangspunkt der Tour war das denk-
malgeschützte Flughafengebäude. Hier begrüßte Mike Petersen von der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung die Teilnehmer und stellte den aktuellen Planungsstand vor. Ines Rudolph
von der Tempelhof Projekt GmbH und Markus Bader, raumlaborberlin/Prae-IBA-Team, radelten
dann mit den 32 Exkursionsteilnehmern über die drei Pionierfelder am Tempelhofer Damm, am
Die Konferenz-Pause führte die
Columbiadamm und in der Oderstraße. Nutzer erhalten hier für eine Übergangszeit von bis zu Gäste auf die Freiflächen des ehe-
fünf Jahren Flächen, auf denen sie ihre Ideen und Projekte unkonventionell umsetzen können. maligen Flughafens Tempelhof.
10Veranstaltungsrückblick
Spurensuche II: Spreeraum
Auf dem „Fliegenden Holländer“ waren 41 Teilnehmer unterwegs auf Spurensuche weiterer
Kapitalien und Potenziale im Berliner Stadtraum. Statt um Freiflächen ging es bei dieser Tour
um urbane Verdichtung bei gleichzeitigem Interesse an einer öffentlichen Zugänglichkeit der
Spreeufer durch öffentliche Parks, Uferweg und Aussichtsplattform. Die innere Stadtspree zählt
zu den dynamischsten urbanen Entwicklungsräumen Berlins und ist dabei auch Konfrontati-
onsort unterschiedlicher Nutzerinteressen. Während der Bootstour, begleitet von Dr. Dagmar
Tille und Takis Sgouros von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sowie Dr. Fritz Reusswig
vom Prae-IBA-Team, wurden gegenwärtige Entwicklungen, Brachflächen, Planungen und Pro-
jekte zwischen Rummelsburger Bucht und Jannowitzbrücke erläutert. Debattiert wurde über
Planungs- und Beteiligungsverfahren sowie die Profilierung des Prozesses. Mit einem Begrüßungskaffee
vor der Alten Zollgarage
startete das IBA Forum am
Spurensuche III: Void-Safari Neukölln 19. April 2011.
Brachen, Baulücken, leer stehende Gebäude und Industrieareale sind an vielen Stellen prä-
gender Bestandteil des Berliner Stadtbilds. Sie eröffnen als „urbane Voids“ eine Vielzahl von
Nutzungs- und Partizipationsmöglichkeiten. Auf einem Spaziergang durch Neukölln mit der
Stadtplanerin und Architektin Vanessa Carlow und der Sozialwissenschaftlerin Pamela Dorsch
vom Prae-IBA-Team Berlin sowie Ursula Renker von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
wurden die Qualitäten exemplarischer Voids verdeutlicht. 35 Teilnehmer kamen zu dem Rund-
gang. Startpunkt war der ehemalige Friedhof in der Leinestraße im Schillerkiez. Hier wurden
beispielhaft die Potenziale eines urbanen Voids zur Aufwertung eines Kiezes aufgezeigt, etwa
durch kulturelle Bespielung durch das Programm „48 Stunden Neukölln“. Von dort ging es
weiter auf „Void-Safari“ zum Tempelhofer Feld durch den Rollbergkiez, vorbei am Stadtbad
Neukölln hinunter zur Karl-Marx-Straße, wo am Abend der IBA-meets-IBA-Auftakt stattfand.
Positionsbestimmung: Auftakt im Heimathafen
Name und Lokalität des abendlichen Veranstaltungsorts, des „Heimathafens Neukölln“, ver-
binden Berliner IBA-Tradition und Zukunft. Mit seinen zwei Internationalen Bauausstellungen
1957 und 1987 ist Berlin selbst ein gewisser Heimathafen der IBA. Mit der Auftaktveranstaltung
Zahlreiche Teilnehmende
im Neuköllner Heimathafen verwiesen die Veranstalter aber auch gleichzeitig auf das Thema erkundeten das Tempelhofer
der geplanten IBA – auf die manchmal unvermuteten, versteckten Potenziale einer Stadt, so Feld.
wie das neu erblühte Volkstheater in dem ehemaligen Ballsaal in der Neuköllner Karl-Marx-
Straße. Mehr als 150 Gäste kamen – hier trafen die Mitglieder des IBA-Expertenrates auf Berli-
ner Stadtaktivisten, Ministeriumsvertreter auf dänische Kulturvermittler, Journalisten von der
Berliner Tagespresse auf sachsen-anhaltinische Kommunalpolitiker, Architekten aus Österreich
auf Stadtplaner aus der Schweiz und den Niederlanden. Am Eingang zum Heimathafen hatte
sich zudem eine Gruppe von Bürgern positioniert, die auf die Gefahren der Gentrifizierung
im mittlerweile bei der Kreativszene beliebten Neukölln hinwiesen. Damit war eine mögliche
Positionierung der IBA 2020 schon mit dem Auftakt erfolgt: mittendrin in der Berliner Stadtge-
sellschaft.
Die Redebeiträge des Abends lassen sich als Positionsbestimmung einer zukünftigen Berliner
IBA lesen. In ihrer Eröffnungsansprache verband die Senatorin für Stadtentwicklung, Ingeborg
Junge-Reyer, die Planungen für 2020 mit der Berliner IBA-Geschichte – von der Interbau mit
ihrem avantgardistischen Blick auf modernen Städtebau über die IBA 1984/1987 mit der Kreuz-
berger Haubesetzer und ihrem Schwerpunkt auf Stadterneuerung und kritischer Rekonstruk-
tion bis hin zum aktuell erarbeiteten Vorkonzept des Prae-IBA-Teams mit seinen Aktionsfeldern
Hauptstadt, Raumstadt und Sofortstadt. Ingeborg Junge-Reyer verwies auf die Chancen des
Ausnahmezustands IBA, über die Horizonte der eigenen Zeit hinauszudenken. Die IBA 2020
böte dabei unter anderem auch die Möglichkeit der Entschleunigung, der Reflexion.
Die IBA Basel war mit Teil-
Dr. Sonja Beeck und Martin Heller, die das Berliner Prae-IBA-Team an diesem Abend auf der nehmenden und Informa-
Bühne vertraten, knüpften mit ihrem Redebeitrag „Stadtkapital: suchen, finden, nutzen“ hier tionsmaterial vertreten.
11Veranstaltungsrückblick
an. Sie formulierten vor allem die Haltung, aus der heraus das Berliner IBA-Vorkonzept entstan-
den ist. Im Wechsel trugen sie jeweils Gedankensplitter zur intellektuellen Positionsbestim-
mung einer dritten IBA vor. Sie konzentrierten sich in ihren Ausführungen auf das Instrumenta-
rium von zeitgemäßer und avantgardistischer Stadtentwicklung – auf Methodik und Strategie,
um das Leitbild einer „radikal durchmischten Stadt“ mit Leben erfüllen zu können. Dabei ginge
es weniger um Problem-, sondern vielmehr um Potenzialerkenntnis „Stadtkapital meint und
erschließt Zugänge zur Stadt als solcher und zu jeder Stadt im Besonderen“, so Sonja Beeck.
„Stadtkapital ist imstande, konstruktive Kräfte freizusetzen und so etwas wie eine Kultur der
Selbstbesinnung zu initiieren.“ Mit der Fachtagung am Folgetag des IBA-Forums wolle man
Beispiele dieser Kultur der Selbstbesinnung, der veränderten, möglicherweise auch entschleu-
nigten Wahrnehmung urbaner Phänomene diskutieren. „Anders hinschauen, anders rechnen,
anders kooperieren: Damit können, damit müssen die Voraussetzungen geschaffen werden für Die Fahrradtour über das
ehemalige Flugfeld machte
das, was uns alle beschäftigt und was das Ziel jeder IBA ist – anders bauen“, so Martin Heller. die Dimensionen deutlich.
„Beim IBA-Forum geht es nicht um dieses Bauen, sondern um seine Voraussetzungen. Wir
haben uns auf die Suche begeben, nach denkbaren Zugängen und Methoden, diese Voraus-
setzungen zu schaffen.“
Fundstücke I: anders hinschauen
Auf die Notwendigkeit dieses derzeitig laufenden Suchprozesses, dieses Forschens nach
Etablierung einer Kultur der Phase Null – also des Vorbereitungsstadiums, in dem sich die
Berliner IBA momentan befindet – verwies die Senatsbaudirektorin Regula Lüscher in ihrer
Eröffnungsrede zum IBA-Forum. „Mut zum Risiko beweisen wir, indem wir trotz Handlungs- und
Erwartungsdruck den Weg des behutsamen Untersuchens und Diskutierens und des sukzes-
siven Handelns anbieten“, so die Senatsbaudirektorin. „Wir brauchen eine Kultur für die Phase
Null. Die Phase Null ist der Raum vor dem Projekt, der Zeitraum, in dem Blockaden vorgebeugt
werden kann oder die Pattsituation deblockiert wird, wo die Analyse durch künstlerische
Intervention strategisch wird. Das Ziel sind qualifizierte Be- und Ausschreibungen. Im IBA-
Ausnahmezustand kann das andere Hinschauen, das andere Rechnen, das andere Kooperie-
ren und das andere Bauen schlussendlich erprobt und mit internationalen Gästen diskutiert
werden.“ Eine lebendige Diskussion konnte man während der Tagung am 19. April bekommen.
In drei Blöcken strukturiert, wurden jeweils zwei bis drei Praxisbeispiele und im Anschluss eine
Auf dem Spaziergang durch
Reflexion zum Thema präsentiert. Dr. Sonja Beeck vom Prae-IBA-Team führte in die jeweiligen Neukölln wurden die Quali-
Bereiche ein und moderierte die anschließenden Diskussionsrunden. täten exemplarischer Voids
verdeutlicht.
Etwa 200 Teilnehmer waren zum Forum ins IBA-Studio in der alten Zollgarage des Flughafens
Tempelhof gekommen. Viele der Nicht-Berliner waren zum ersten Mal seit der Stilllegung des
Flughafenbetriebs im Herbst 2008 an diesem Ort, der sich zukünftig zur „Bühne des Neuen“
entwickeln soll. Tagungsteilnehmer, die diese denkmalgeschützte Gebäudeanlage möglicher-
weise zum ersten Mal erlebten, nahmen sie bewusst konzentriert und bereits „anders hinschau-
end“ in Augenschein, indem sie betont langsam zum Veranstaltungsort herabschritten. Um das
anders Hinschauen ging es auch im ersten Teil der Tagung. Anhand von drei sehr unterschiedli-
chen Beispielen wurden im Rahmen des IBA-Forums Varianten des Sehens, des Wahrnehmens,
des Identifizierens von Stadtkapital aufgezeigt.
Adri Duivesteijn, Stadtrat für Wohnungswesen und Stadtplanung im niederländischen Almere,
zeigte mit seinem Vortrag, dass organisch gewachsene Stadtentwicklung von unten durchaus
in so komplexe Stadtplanungsvorhaben wie der Wachstumsstrategie, die mit „Almere 2.0“ bis
zum Jahr 2030 verfolgt wird, integriert werden kann. Die Stadt fördert offensiv private Bauher-
rentätigkeit, stellt Infrastrukturen bereit, aber lässt vor allem die Bürger das städteplanerische
Raster mit ihren eigenen Häusern füllen. Almere ist in dieser Hinsicht auch ein Beispiel für den
Willen einer Verwaltung, einer Stadtplanungsbehörde, Gestaltung und damit Verantwortung
aus der Hand zu geben. „Was würde passieren, wenn wir in Tempelhof ein Raster ziehen und
die Bevölkerung bauen lassen?“, fragte daher in ihrem Fazit zu Almere die Senatsbaudirektorin
Die Schiffs-Exkursion führte
Regula Lüscher. „Was würden die Architekten sagen? Almere lehrt uns, Dinge aus der Hand zu durch den Spreeraum.
geben und andere Ästhetiken zu akzeptieren.“
12Veranstaltungsrückblick
Während Almere aus der Problematik des Wachstums eine neue urbane Identität mithilfe
seiner Bürger erschaffen will, spielt sich das im Anschluss von Oberbürgermeister Kurt-Jürgen
Zander präsentierte Beispiel im sachsen-anhaltinischen Köthen im Kontext einer schrumpfen-
den Stadt ab. Im Rahmen der IBA Stadtumbau 2010 nutzte Köthen sein lange vernachlässigtes
Erbe – nämlich Geburtsstätte der Homöopathie zu sein – für die eigene erfolgreiche Profilie-
rung. Köthen ist damit einen ungewöhnlich experimentierfreudigen Weg gegangen. Hier hat
man nicht nur auf die eigene Stadtgeschichte „anders hingeschaut“, sondern auch auf stadtpla-
nerische Methoden. Im Rahmen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe wurden homöopathi-
sche Grundsätze auf Stadtplanung übertragen.
Eine dritte Spielart des Anders-Hinschauens stellte der Linzer Architekt Lorenz Potocnik vor.
Mit einer Postkartenserie und einer Ausstellung lenkte er im Jahr der Kulturhauptstadt Linz Takis Sgouros von der
Senatsverwaltung für
2009 die öffentliche Aufmerksamkeit auf die „hässlichen Entlein“ der Stadt. Es ging ihm dabei Stadtentwicklung leitet die
um eine veränderte Wahrnehmung dieser das Stadtbild prägenden Gebäude der 1960er und Spree-Exkursion.
1970er Jahre, um die Kultivierung eines anderen Blicks. Zum Abschluss des Blocks stand Martin
Hellers nachdrückliches Plädoyer für ein anderes Hinschauen als methodisches und dabei fast
spielerisches Vorgehen, um neue Qualitäten von Stadt zu finden, um Stadtkapital zu heben
und zu generieren. Er beschrieb dabei die IBA als ein „Stipendium für das städtische Lernen“,
einen Lern- und Schulungsprozess, in dessen Rahmen auch Streit und Reibung, die Konfron-
tation unterschiedlicher Wahrnehmungen ausgehalten werden müsse – ja fast notwendig
erforderlich sei.
Fundstücke II: anders rechnen
Nach der Mittagspause im vormaligen Transitbereich mit kilometerweitfreiem Blick auf das
Rollfeld war im zweiten Teil eine gewisse Form dieser Reibung zu spüren. Es ging um die
ökonomische Dimension von Stadt. „Dieser Block liegt uns sehr am Herzen, deshalb liegt er
wahrscheinlich auch im Herzen dieses Tages“, sagte Sonja Beeck in ihrer Einführung. „Wenn
man über Stadtentwicklung heute nachdenkt, interessiert uns – auch als Hebel dieser neuen
IBA – das Nachdenken über neue Finanzierungsmodelle.“ Auf welcher Grundlage werden
Finanzierungsentscheidungen getroffen? Welche Rolle spielen nicht-ökonomische Faktoren bei
der Mittelvergabe beziehungsweise bei der Bewertung von Investitionen? Inwiefern könnten
Vanessa Carlow vom Prae-
alternative Finanzierungs- oder Geschäftsmodelle neue Möglichkeitsräume eröffnen? IBA-Team begleitete die
Void-Safari.
Den Anfang machte Sybille Wegerich, Vorstand der GAG Immobilien AG mit ihrem selbst so
bezeichneten „Exotenvortrag“. Ihre Ausführungen zur Investitionspraxis des größten Kölner
Wohnungsunternehmens provozierten dabei zum einen Kritik an der möglichst maximalen
Renditeorientierung und Effizienzbetrachtung in der Wohnungswirtschaft. Sie warfen zum
anderen die Frage nach der Quantifizierung, dem Messen von nicht-monetären Renditen und
Kapitalien auf. Wie bemisst sich Wohnqualität, eine funktionierende Nachbarschaft – wie viel
sind solche sozialen Aspekte wert?
Der in Berlin lebende Architekt und Stadtaktivist Arno Brandlhuber sprach im Anschluss über
Möglichkeitsräume und beschrieb Architektur als „das Ordnen sozialer Beziehungen durch
Bauen“. Er regte mit seinem Vortrag zum Nachdenken über Architektur und Eigentum, über Lie-
genschaftspolitik, Bauprivilegien und Nutzungsrechte an und kritisierte das reine Denken nach
messbaren ökonomischen Faktoren scharf, weil sie der Stadt nicht gerecht würden.
Der britische Sozialunternehmer Peter Holbrook präsentierte im Anschluss mit dem Modell
der Social Enterprises einen alternativen Geschäfts- und Investitionsansatz. Der mitreißende
Vortrag dieses „Robin Hood of Economics“, wie er sich mit einem Augenzwinkern selbst nannte,
zeigte dabei die dynamische Entwicklung des Sozialunternehmertums in Großbritannien mit
mehr als 62.000 Social Enterprises auf. Diese Tendenz verweist aber auch gleichzeitig auf die
zunehmende Versorgungslücke der öffentlichen Hand etwa im Bereich der Stadtteilarbeit.
Die Void-Safari zeigte ein
vielfältiges Neukölln.
13Veranstaltungsrückblick
In seiner Reflexion verwies der Kulturökonom Prof. Dr. Uwe Hochmuth explizit auf die Notwen-
digkeit, im kommunalen Rechnungswesen zukünftig anders zu rechnen, oder zumindest des-
sen Stellenwert anders zu bemessen. „Wir haben vor lauter Kümmern um Finanzen und Zahlen
vergessen, wofür sie inhaltlich stehen“, so Hochmuth. Aufgrund eines immer stärker kaufmän-
nisch orientierten Rechnungswesen dominiere Effizienz vor Effektivität. Die öffentliche Hand
dürfe aber nicht wie ein privater Investor agieren. In der Abschlussdiskussion ging es vor allem
um Stadtentwicklung als öffentliches Gut, um die Rolle der Stadt im Umgang mit eigenem und
fremdem Investment, um staatliche und zivilgesellschaftliche Verantwortung. In der anschlie-
ßenden Pause wurde diese Diskussion in angeregten Einzelgesprächen fortgeführt.
Fundstücke III: anders kooperieren
Der abendliche Auftakt im
Heimathafen Neukölln klang
„Anhand der intensiven Diskussion, die wir im letzten Block erlebt haben, wird deutlich, dass mit guten Gesprächen aus.
neue Finanzierungsmodelle auch andere Kooperationsformen nach sich ziehen müssen“,
spannte Sonja Beeck den inhaltlichen Bogen zum dritten und letzten Tagungsteil. Wie lassen
sich die „richtigen“ Partner mobilisieren und involvieren? Welche alternativen Kooperationsmo-
delle existieren jenseits klassischer Bürgerbeteiligung? Inwiefern hängt die Bildung kreativer
Netzwerke von einem bestimmten städtischen Umfeld ab? Zum Thema Stadtentwicklung
und Kooperation wurden im dritten Teil des IBA Forums sowohl kooperative Methoden für
komplexe Planungsprozesse als auch basisdemokratische Verfahren und Untersuchungen zu
standortbezogenen Kooperationsmodellen vorgestellt.
Dr. Ignacio Farías vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung präsentierte seine Stu-
dien zu Kollaborationen und Innovationsdynamiken in der chilenischen Architekturbranche.
Dabei legen seine Untersuchungen nahe, das Modell der kreativen Stadt, des „Kreativviertels“
in Frage zu stellen oder es zumindest anders zu denken. Die Verortung kreativer Netzwerke,
so ein Fazit von Farías, hängt also nicht zwingend von einem augenscheinlich „kreativen“
Stadtumfeld ab.
Von Chile ging es im Anschluss in die Schweiz: Mit seinem Vortrag lieferte der Journalist Dr.
Martin Beglinger einen anschaulichen Erfahrungsbericht eines extrem basisdemokratischen
Verfahrens, bei dem sich die Bürger des Kanton Glarus für ein nicht minder radikales Koopera-
Rund 200 Experten und
tionsmodell entschieden. Im Jahr 2006 wurde im Schweizer Kanton Glarus die Fusion von 25 Akteure kamen am 19. April
zu nur noch drei Gemeinden beschlossen. Entschieden wurde das auf dem Zaunplatz in Glarus zum IBA Forum in die Alte
von den Kantonsbürgern bei der jährlich stattfindenden Glarner Landsgemeinde. Per Handzei- Zollgarage.
chen stimmen hier die Einwohner über zentrale politische Vorhaben im Kanton ab und können
eigene Anträge zur Entscheidung bringen.
Um Kooperationsmodelle in komplexen Stadtentwicklungsvorhaben, um die Involvierung
möglichst vieler so genannter Stakeholder, ging es im abschließenden Beitrag von Prof. Raoul
Bunschoten. Der niederländische Architekt hat sich mit seinem Büro CHORA auf Methoden
der „prozessualen Stadtentwicklung“ spezialisiert. Er nutzt dazu vor allem Spieltechniken und
bringt diese in Projekten wie dem Londoner Green Enterprise District zum Einsatz. Bunscho-
tens Vortrag rückte die Rolle des Architekten und Planers als Prozessmanager in den Mittel-
punkt. Bunschoten bezeichnete sie als die eines Choreografen komplexer Planungsvorgänge
und Partizipationsverfahren – ein Rollenverständnis, das sicherlich viele der anwesenden IBA-
Akteure teilten. Er beendete seine Ausführungen mit dem Verweis auf die Potenziale Tempel-
hofs und der IBA als ein Inkubator für die europäische Stadtentwicklung. Das Forum endete
mit einem Fazit der Senatsbaudirektorin.
Die wichtigsten Inhalte, Zitate und weitere Informationen zu den Referenten und Beiträgen
werden auf den folgenden Seiten zusammengefasst. Eine filmische Dokumentation des IBA
Forums 2011 und aller vorangeganger IBA Studio-Talks in der alten Zollgarage des Flughafens
Tempelhof sind zudem auf dem Portal www.architekturclips.de einsehbar.
Teilnehmer befragen das
Podium
14Zur Einführung: Stadtkapital suchen, finden, nutzen!
Dr. Sonja Beeck und Martin Heller, Prae-IBA-Team, Berlin / Zürich
Bei der Auftaktveranstaltung am Vorabend des IBA-Forums nahmen Dr. Sonja Beeck und
Martin Heller eine Positionsbestimmung vor. Aus welcher Haltung heraus hat das Prae-
IBA-Team seine konzeptionellen Überlegungen für eine IBA 2020 in Berlin formuliert? Im
Zentrum der Betrachtung stand die Frage des richtigen Instrumentariums, des adäquaten
Ansatzes, um den immer komplexer werdenden Gemengelagen, in denen Stadtentwick-
lung im 21. Jahrhundert operiert, gerecht zu werden. Einige Auszüge aus dem Beitrag:
„Am Anfang von großen Fortschritten steht meist ein Problem. So sind wir es gewohnt. Mittlerweile
aber neigen wir zur Einsicht, dass die reflexhafte Frage nach dem Problem selbst ein Problem ist.
Vielleicht muss man sich grundsätzlich entscheiden, welchen Weg man geht: den des Problems
oder den des Potenzials. Wir halten jenen Weg für den fruchtbareren, der die latenten Kräfte einer
Stadt zu identifizieren und zu nutzen imstande ist. Gerade für eine IBA, die, selbstverpflichtet, den
Aufbruch zu Neuem proben will.“
„Wer eine IBA plant, erwartet Gewinn – für alle Beteiligten. Um uns diesen Gewinn nicht von den
Problemen her vorzustellen, müssen wir einiges umdrehen, im Kopf und in der Planung. Dann geht
es nämlich nicht mehr um den bewährten Werkzeugkasten der bewährten Problemlösung; stattdes-
sen müssen wir über konkrete Techniken nachdenken, wie sich die Potenziale einer Stadt finden und
stärken lassen.“
„Wir suchen eine Stadt als Lebensraum für alle – Stichwort: Teilhabe. Als postindustriellen Wirt-
schaftsraum – Stichwort: Durchmischung. Und als energieeffiziente Struktur – Stichwort: vom
Energieverbraucher zum Energieproduzenten. Diese neue Stadt ist die Stadt der Vielen, der Inter-
essierten und damit der unterschiedlichsten Interessenslagen. Sie ist natürlich nicht konfliktfrei zu
haben, sondern produziert laufend Blockaden, Pattsituationen und immer wieder neue Frontlinien.
Bürger widersetzen sich Projekten. Projekte werden durch Gesetze verhindert. Die Verwaltung treibt
Bürger oder sich selbst in den Wahnsinn. Investoren attackieren mit Renditeerwartungen parti-
elles Gemeinwohl. Und schlussendlich: Bürger stehen gegen Bürger. Was die Frage aufwirft: Mit
welchen strategischen Instrumenten und mit welcher grundsätzlichen Haltung ist es möglich, diese
zunächst hinderlichen Konflikte in produktive, weil Energie erzeugende Reibung zu verwandeln? (...)
Wahrscheinlich müssen wir uns davon verabschieden, dass man in der Stadtentwicklung Probleme
prinzipiell lösen kann.“
„An diesem Punkt der Überlegungen ist uns ein Begriff zugefallen, der die Komplexität des Städti-
schen zugleich anerkennt und nutzt: Stadtkapital.“
Dr. Sonja Beeck und Martin
Heller reflektierten die
Herangehensweise des Prae-
IBA-Teams an die Entwick-
lung der IBA Berlin 2020.
15Sie können auch lesen